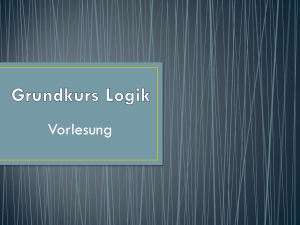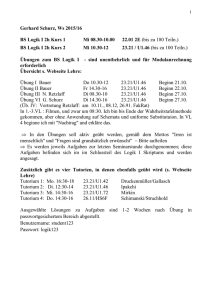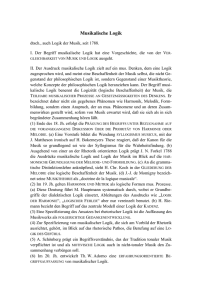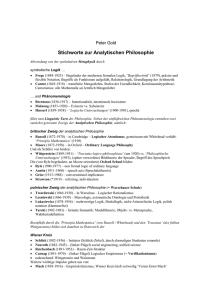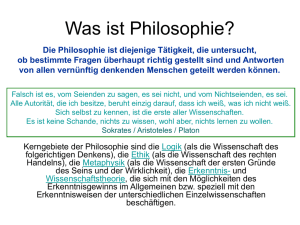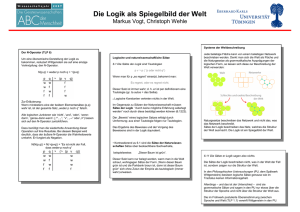Die symbolische Logik - Prof. Dr. Kazimierz Rynkiewicz
Werbung

Prof. Dr. Kazimierz Rynkiewicz
Die epistemische Koexistenz
von Theorie und Wissen
- aus wissenschaftstheoretischer Perspektive
Vorlesung
Ludwig-Maximilians-Universität München
WS 2016/17
2
3
Vorlesung 15
(08.02.2017)
2.6. Exkurs: Kritik am Naturalismus mit dem Blick auf Kant
3. Dynamische Entfaltung der formalen Wissenschaften: Logik
3.1. Klassische Logik
3.1.1. Die symbolische Logik
Exkurs: Kritik am Naturalismus mit dem Blick auf Kant
Wenn die Naturwissenschaften Natur zum Gegenstand ihrer Analyse haben,
dann müssen sie sich ebenfalls mit der äußeren Erfahrung und Naturgesetzen
befassen. Kognitionswissenschaft, deren Struktur, Leistungen und
geschichtliches Profil im Vorangehenden beschrieben wurden, liefert uns ein
umfassendes Paket von Instrumenten, damit die äußere Erfahrung
wissenschaftlich analysiert werden kann.
Für die äußere Erfahrung, so behauptet etwa Kant, sind aber Naturgesetze
konstitutiv. Deshalb schreibt er in der Anmerkung zur dritten Antinomie, dass
die Naturgesetzlichkeit zum Merkmal empirischer Wahrheit gehört, welches
Erfahrung vom Traum unterscheidet (vgl. KrV B 479). Darüber hinaus
behauptet Kant im Anschluss an die drei Analogien der Erfahrung, dass die
Objektivität in der Einsicht gründet, dass die Natur (=die Außenwelt) einen
Zusammenhang nach empirischen Gesetzen bildet (vgl. KrV B 520f.).
Diese das empirische Element hervorhebende Konstellation verführte jedoch
einige angesehene Philosophen (z.B. Quine) zu einem naturalistischen
Standpunkt, oder kurz zum Naturalismus.
Es ist die Ansicht, dass die empirische Erkenntnis ausschließlich auf natürliche,
empirisch zu erforschende Sachverhalte zurückzuführen sei. Der Naturalismus
besteht als solcher aus einer Reihe von Ansichten, die sich nicht nur
epistemologisch, sondern auch wissenschaftstheoretisch auswirken. So gibt es
etwa den genetischen Naturalismus (GN), der in einer allgemeinen und einer
besonderen Form auftritt:
(1) Der allgemeine GN befasst sich mit der Erkenntnis überhaupt und erklärt
ihre Entstehung lediglich aus natürlichen Faktoren, etwa gewissen Anlagen und
Keimen, die sich im Laufe der Phylo- und Ontogenese entwickeln. Dabei ist der
Beitrag von Kognitionswissenschaften nicht zu übersehen; und
(2) Der besondere GN wird auch als Psychologismus bezeichnet, konzentriert
sich nicht auf die Rechtfertigung von Aussagen, sondern auf die Beziehungen
4
zwischen Meinungszuständen empirischer Subjekte, und ist mit den alltäglichen
Meinungen eng verbunden.
Beim Entstehen, bei der Aufrechterhaltung und Veränderung persönlicher
Meinungen wird also die Relevanz psychologischer Faktoren akzentuiert. Der
kognitionswissenschaftlich fundierte GN ist jedoch weder für Erkenntnistheorie
noch für Wissenschaftstheorie interessant.
Diese beiden Wissenschaften interessieren sich vielmehr für den logischen
Naturalismus (LN), der selbst für die Geltung nur natürliche Faktoren zulässt.
Der LN setzt sich immer noch besonders gegen Descartes ab; d.h. der LN
glaubt, selbst die Kritik Kants überspringen zu dürfen. Kants Theorie ist
indessen einerseits anticartesisch, andererseits kompromisslos antinaturalistisch,
und zwar in drei Autonomie-Thesen:
(1) Erstens untersucht Kant die vorempirischen Bedingungen der Empirie, es
geht ihm also um thematische Autonomie;
(2) Vorausgesetzt, dass sich diese Bedingungen finden, stellt zweitens Kants
Theorie einen autonomen und von allen empirischen Wissenschaften wie etwa
Physik, Biologie und Psychologie usf. unabhängigen Forschungszweig dar, d.h.
disziplinäre Autonomie; und
(3) Drittens werden die thematische und die disziplinäre Autonomie erst durch
die methodische Autonomie möglich, d.h. durch ein zweiteilig nichtempirisches
Verfahren, durch den sowohl metaphysischen als auch transzendentalen
Nachweis der vorempirischen Bedingungen.
Der Naturalist bewertet das positive Selbstverständnis des Antinaturalisten – wie
etwa eines Kants - negativ, d.h. als Ablehnung einer Kooperation mit den
Kognitionswissenschaften, obwohl man aus deren immenser Erfahrung doch
Neues lernen könne. In der Tat vollzieht sich aber (auch bei Kant) keine
generelle Ablehnung, sondern sie betrifft lediglich eine schmale, aber
grundlegende Frage. Diese Frage geht noch hinter das Thema zurück, mit dem
sich manche Naturalisten befassen, hinter Strukturelemente der
Wissenschaftspraxis wie Induktion, Hypothesenbildung, Erklärung und Theorie.
Die fundamentalphilosophische Erkenntnistheorie fragt, ob die Empirie durch
vorempirische Momente konstituiert werde, derartige Wissenschaftstheorie
hingegen, wie die Empirie durch diese Momente konstituiert werde.
Die Empirie kann selbst offenbar diese Frage nicht beantworten. Denn wie soll
man über vorempirische Momente eine empirische Entscheidung treffen
können? Argumentationslogisch gesehen ist die objektive Erkenntnis ein
normativer Begriff, der – um dem Sein-Sollensfehler zu entgehen – durch die
deskriptiven Aussagen empirischer Wissenschaften nicht eingelöst werden kann:
5
Wie will die Empirie in Frage stellen, dass die wahrheitsfähige Grundeinheit ein
gegliedertes Ganzes, eine Aussage bzw. Proposition ist.
Mit anderen Worten: Wahrheit bedeutet die tatsächliche Welt zu erkennen, dafür
ist aber das Zusammenspiel von Anschauung und Begriff erforderlich. Oder
wenn eine naturalistische Erkenntnistheorie den Prozess untersucht, der wahre
Meinungen
hervorzurufen
verspricht,
so
interessiert
sich
eine
fundamentalphilosophische und zugleich antinaturalistische Erkenntnistheorie
für die normative Vorfrage, was hier „wahr“ heißt und welche
geltungstheoretischen Faktoren für wahre Aussagen vorausgesetzt sind. Die
Wissenschaftstheorie kann diese Frage noch weiter verfeinern.
Wenn wir den Logischen Naturalismus (LN) aus Sicht der Kritik Kants
betrachten, dann können wir also sagen, der LN sei eine Form des unplausiblen
Empirismus. Kant argumentiert gegen ihn nicht mit übernatürlichen Faktoren.
Wenn Kant vielmehr für Ereignisse in der Natur ausschließlich natürliche
Erklärungen anerkennt, vertritt er sogar einen methodischen Naturalismus, der
aber in einem erkenntnistheoretischen Antinaturalismus gründet: Für die
natürlichen Erklärungen samt deren Exklusivrecht sind vornatürliche, für die
Empirie nämlich vorempirische Faktoren konstitutiv.
Das erste Gegenargument gegen den Logischen Naturalismus können wir der
„Ästhetik“ Kants entnehmen. Es liegt in der Bindung der Erfahrung an zwei
Anschauungsformen (d.h. Raum und Zeit), deren nähere Bestimmung zwar von
der Erfahrung abhängt, ihre Grundform aber nicht. Selbst wenn wir Einiges bei
Kant kritisieren können, dürfen wir jedoch nicht leugnen, dass auch drei weitere
vorempirische Elemente für die Empirie konstitutiv sind: die Syntheseleistung
des „Ich denke“, die Kategorien (die der Synthesis zur Bestimmtheit verhelfen)
und die transzendentalen Schemata (die die Anwendung der Kategorien auf
Erscheinungen ermöglichen. All diese Entitäten weisen auch einen logischen
Charakter auf.
Dynamische Entfaltung der formalen Wissenschaften: Logik
Dass formale Wissenschaften für die wissenschaftstheoretischen Analysen
durchaus erforderlich sind, leuchtet schon dann ein, wenn man die Begriffe
„Theorie“ und „Wissenschaft“ betrachtet. Denn wenn wir etwas über eine
Theorie und Wissenschaft sagen wollen, so haben wir grundlegende logische
Prinzipien zu beachten, z.B. die logische Variante des Satzes vom Widerspruch.
6
Dieser Satz besagt, dass zwei kontradiktorisch entgegengesetzte Sätze nicht
beide wahr sein können, bzw. dass dasselbe niemals zugleich bejaht und
verneint werden darf.
Wenn wir über formale Wissenschaften reden, denken wir meistens an die Logik
als „Inbegriff formaler Wissenschaften“. Das Wort „Logik“ kommt vom
griechischen lógos und wird als „Wort“, „Vernunft“, „Geist“ übersetzt. Über die
Logik spricht man jedoch in mehreren Bedeutungen:
Mit Kant können wir etwa unter der Logik die Lehre von den apriorischen
Bestimmungen des Verstandes (Kategorien und Grundsätze) und der Vernunft
(Ideen) verstehen (vgl. KrV B 74f.), mit Hegel den Versuch, die
transzendentalen Bestimmungen des Verstandes und die ontologischen
Bestimmungen des Seins dialektisch zusammenzudenken (vgl. Enz. §85f.), und
schließlich mit Aristoteles die Lehre von der formalen Folgerichtigkeit des
Denkens bzw. Sprechens.
So schreibt Aristoteles bereits im ersten Buch seines „Organons“ Folgendes:
„Unsere Arbeit verfolgt die Aufgabe, eine Methode zu finden, nach der wir
über jedes aufgestellte Problem aus wahrscheinlichen Sätzen Schlüsse bilden
können, und wenn wir selbst zur Rede stehen sollen, in keine Widersprüche
geraten“ (Topik, 100a).
Es steht außer Zweifel, dass es für Aristoteles nur den einen Weg bzw. die eine
Methode gibt, um nicht in Widersprüche geraten zu müssen, nämlich die
konsequente Beachtung logischer Gesetze.
Wittgenstein erklärt indes in seinem „Tractatus“, warum wir uns auf die Logik
verlassen können:
„Die Logik muss für sich selber sorgen. Ein mögliches Zeichen muss auch
bezeichnen können. Alles was in der Logik möglich ist, ist auch erlaubt.
(„Sokrates ist identisch“ heißt darum nichts, weil es keine Eigenschaft gibt, die
„identisch“ heißt. Der Satz ist unsinnig, weil wir eine willkürliche Bestimmung
nicht getroffen haben, aber nicht darum, weil das Symbol an und für sich
unerlaubt wäre). Wir können uns, in gewissem Sinn, nicht in der Logik irren“
(TLP 5.473).
Da die Logik „für sich selbst sorgen“ muss, kann sie dann auch garantieren, dass
das logische Verfahren zu einem epistemisch gültigen Resultat führt, sobald nur
die logischen Gesetze beachtet werden. In der „Sorge der Logik“ zeigt sich ihr
dynamisches Entfaltungspotential, das sich auf der formalen Ebene auswirkt.
Deshalb sprechen wir von einer formalen Logik, auf deren Leistungen auch die
Wissenschaftstheorie angewiesen ist.
Unser Augenmerk richtet sich hier nur auf die formale Logik. Diese beschäftigt
sich mit den Beziehungen zwischen Prämissen eines Schlusses und der
Schlussfolgerung selbst (d.h. der Konklusion). Die Konklusion und Prämissen
7
bilden eine sprachliche Einheit, die „Argument“ genannt wird. In der Logik wird
die Struktur von Argumenten im Hinblick auf ihre Gültigkeit untersucht,
unabhängig vom Inhalt der Aussagen. Darum wird nur mit bestimmten
inhaltsleeren Zeichen oder Symbolen operiert. So wird es erlaubt sein, die in der
Alltags- oder Fachsprache formulierten Schlüsse, deren Stimmigkeit nicht
problemlos zu durchschauen ist, durch eine Übersetzung in die formalisierte
Sprache der Logik auf ihre logische Korrektheit zu untersuchen.
Seit dem 20. Jahrhundert wird die formale Logik durch die sogenannte Logistik
ergänzt, d.h. die symbolische (bzw. mathematische) Logik. Die formale Logik
kann man in die klassische und nicht-klassische Logik aufteilen.
Klassische Logik
Wenn wir über die klassische Logik reden, so denken wir in erster Linie an
Aristoteles. In der Vorrede zu seiner „Kritik der reinen Vernunft“ schreibt Kant
Folgendes:
„Dass die Logik diesen sicheren Gang schon von den ältesten Zeiten her
gegangen sei, lässt sich daraus ersehen, dass sie seit dem Aristoteles keinen
Schritt rückwärts hat tun dürfen, wenn man ihr nicht etwa die Wegschaffung
einiger entbehrlichen Subtilitäten, oder deutlichere Bestimmung des
Vorgetragenen, als Verbesserungen anrechnen will, welches aber mehr zur
Eleganz, als zur Sicherheit der Wissenschaft gehört“ (KrV B VIII).
Kant würdigt also einerseits die Leistungen des Aristoteles auf dem Gebiet der
Logik, weil Aristoteles die Grundlagen der Logik so formuliert hatte, dass sie
aus ihr nicht mehr wegzudenken sind, andererseits weist er aber darauf hin, dass
die Logik in der Zukunft noch verbessert bzw. verfeinert werden kann.
Das bedeutet, in der Logik sind auch Fortschritte denkbar, wenn etwa ihre
einzelnen Bereiche deutlicher herausgearbeitet werden. Gemeint sind vor allem
folgende Bereiche: Aussagen-, Prädikaten-, Klassenlogik und Syllogistik. All
diese Bereiche stellen also (heute) die Bestandteile der klassischen Logik dar.
Sie beruht auf zwei semantischen Bedingungen bzw. Prinzipien:
(1) dem Prinzip der Zweiwertigkeit - jede Aussage hat genau einen von zwei
Wahrheitswerten, die meist als wahr und falsch bezeichnet werden; und
(2) dem Prinzip der Kompositionalität – der Wahrheitswert einer
zusammengesetzten Aussage ist zum einen eindeutig durch die Wahrheitswerte
ihrer Teilaussagen bestimmt, zum anderen durch die Art, wie diese Teilaussagen
zusammengesetzt sind.
8
Daher ergibt sich folgendes Schema:
Die klassische Logik
Aussagenlogik
Prädikatenlogik
Zweiwertigkeit + Kompositionalität
Klassenlogik
Syllogistik
Der einfachste Typ von Logik ist also die „Aussagenlogik“; sie handelt von den
Aussagensätzen und den sogenannten Satzoperatoren (=Junktoren), mit deren
Hilfe aus solchen Sätzen neue, komplexere Sätze gebildet werden können. Eine
Aussage bezieht sich auf einen Sachverhalt und besitzt einen Wahrheitswert, sie
kann wahr oder falsch sein. Es gibt Elementaraussagen wie z.B. „München liegt
in Bayern“ und zusammengesetzte Aussagen wie z.B. „Berlin liegt in
Deutschland und Warschau liegt in Polen“. In der Aussagenlogik geht es weder
um die Form der Aussagen noch um deren Inhalt, sondern ausschließlich um die
Form ihrer Verbindung. Die verbindenden Wörter werden Junktoren genannt
und symbolisch dargestellt. Die grundlegenden Junktoren sind also folgende:
1. Die Konjunktion „und“ (Symbol ˄ )
(„Maria liebt Hans [p] und Adam liebt Eva [q]“); also p ˄ q
2. Die Disjunktion „oder“ (Symbol ˅ )
(„John hat einen Audi A3 [p] oder Smith befindet sich in Warschau [q]“); also
p˅q
3. Die Implikation „wenn…dann“ (Symbol → )
(„Wenn Katrin ihr Abitur gut besteht, dann freut sich ihre Mutter sehr“); also p
→q
4. Die Exklusion „nicht zugleich…und“ (Symbol | )
(„Monika ist nicht zugleich in München und Warschau“); also p | q
5. Die Äquivalenz „genau dann, wenn“ (Symbol ↔ )
(„Sebastian Vettel gewinnt das Rennen genau dann, wenn er die beste Zeit
hat“); also p ↔ q
In der Aussagenlogik werden zudem auch die Negatoren „ ¬ “ und (runde,
eckige und geschweifte) Klammern verwendet, damit eine Aussage sich auf
einen Sachverhalt zweckgemäß beziehen kann.
Einen anderen Typ von Logik stellt die Prädikatenlogik dar. In der
Prädikatenlogik kann man auch die innere Struktur von Sätzen darstellen, die
aussagenlogisch nicht weiter zerlegbar sind. Die innere Struktur der Aussage
„Die Banane ist gelb“ wird also durch das Prädikat („ist gelb“) und das
9
Argument („die Banane“) dargestellt. Für die Zuordnung von Prädikaten zu den
Argumenten sind Prädikatoren zuständig.
Während man also unter einem Prädikat die Beschaffenheit des Arguments
versteht, enthält ein Prädikator hingegen die Beschaffenheit des Arguments plus
Kopula und kann ein- oder mehrstellig sein.
Nennen wir ein paar Beispiele:
(1) Einstellige Prädikatoren sind {raucht} in „Peter raucht“, {ist die Hauptstadt
Frankreichs} in „Paris ist die Hauptstadt Frankreichs“, {ist weiß} in „die Kreide
ist weiß“ usf.;
(2) Zweistellige Prädikatoren sind dagegen etwa {ist größer als} in „Hamburg
ist größer als Bremen“, {ist Lehrer von} in „Sokrates ist Lehrer von Platon“,
{begrüßt} in „Herr Müller begrüßt Herrn Lehman“ usf.;
(3) Dreistellige Prädikatoren sind z.B. {gibt} in „Klaus gibt Dieter das Buch“,
{ist Produkt von} in „12 ist Produkt von 3 mal 4“;
(4) Neunstellige Prädikatoren sind etwa {liegt zwischen} in „Österreich liegt
zwischen Liechtenstein, der Schweiz, der BRD, Tschechien, Slowakei, Ungarn,
Slowenien und Italien“ usf.
Die Prädikatenlogik könnte man mit dem folgenden Schema auf den Punkt
bringen:
Prädikat
Argument
Prädikator
In der Prädikatenlogik wird auch zwischen Prädikatenlogik der ersten Stufe und
Prädikatenlogik höherer Stufe unterschieden, und zwar mit Hilfe der Quantoren
„alle“ und „mindestens ein“.
Mit anderen Worten: (1) Allquantor – „für alle X gilt“; und (2) Einsquantor –
„für mindestens ein X gilt“.
Mit der Prädikatenlogik ist Klassenlogik verbunden, in der auch Prädikatoren
zum Einsatz kommen. Wie oben angedeutet, sind Prädikatoren Wörter, die
einem Gegenstand zu- oder abgesprochen werden – im Gegensatz zu den
Wörtern, die einen Gegenstand vertreten und darum als Eigennamen bezeichnet
werden. Prädikatoren sind allgemein und werden deshalb von den Scholastikern
Universalien genannt. Allgemeinheit lässt sich im Kontext des Begriffs
„Prädikator“ extensional oder intensional verstehen.
Wir können also von der Extension eines Prädikators sprechen – gemeint ist die
Klasse seiner Designate, d.h. die Gesamtheit der Dinge, die er bezeichnet.
Wir können aber auch von der Intension (Bedeutung) eines Prädikators reden,
wobei die Intension das ist, was der Prädikator ausdrückt, d.h. was er dem
Gegenstand zu- oder abspricht.
10
So leuchtet schnell ein, dass die Klassenlogik sich auf die Extension von
Prädikatoren stützt. Mit anderen Worten: In der Klassenlogik steht die
extensionale Betrachtungsweise im Vordergrund, weil jeder einstellige
Prädikator eine Klasse bildet.
Beispiele für Klassen sind etwa „die Dozenten“, „die Münchner“, „die roten
Autos“ usf. Klassen können durch verschiedene Junktoren verknüpft werden,
wodurch neue Klassen entstehen.
So können wir etwa folgende Junktoren einsetzen:
(1) Vereinigung – K ist die Klasse der Ärzte und R ist die Klasse der Fußballer.
Durch Vereinigung von K und R ergibt sich also die neue Klasse, die sowohl
Ärzte als auch Fußballer umfasst;
(2) Differenz – K ist die Klasse der Rechtecke und L ist die Klasse der Quadrate.
Die Rechtecke, die keine Quadrate sind, bilden dann die Differenzklasse; und
(3) Durchschnitt – K ist die Klasse der Mädchen und L ist die Klasse der
Maturanten. So sind Mädchen, die Maturanten sind, Elemente der
Durchschnittsklasse.
Das Ergebnis der Einsetzung der obigen drei Junktoren können wir sowohl
schematisch als auch symbolisch darstellen:
K
L
Vereinigung: K U L
K
L
Differenz: K ‒ L
K
L
Durchschnitt: K ∩ L
Als Teil der klassischen Logik gilt auch Syllogistik. Sie geht auf Aristoteles
zurück und lässt sich als Vorläufer der Prädikatenlogik verstehen. Für die
Syllogistik sind Begriffe entscheidend. Darum schreibt Aristoteles in seiner
„Ersten Analytik“:
„Wenn sich also drei Begriffe zueinander so verhalten, dass der letzte (der
Unterbegriff) in dem mittleren als Ganzem ist, und der mittlere in dem ersten
(dem Oberbegriff) als Ganzem entweder ist oder nicht ist, so ergibt sich
notwendig für die Außenbegriffe ein vollkommener Schluss. Mittleren Begriff
[…] (terminus medius) nenne ich denjenigen Begriff, der gleichzeitig in einem
anderen ist und einen anderen in sich begreift – der auch durch seine Stellung
der mittlere wird. […] Äußere Begriffe (termini extremi) nenne ich erstens
den, der selbst in einem anderen ist, und zweitens den, in dem ein anderer ist“.
(24bf)
11
Für das Verstehen der Funktionierung des Syllogismus ist vor allem der erste
Teil des Zitates entscheidend, wo Aristoteles von dem Unterbegriff, Oberbegriff
und vollkommenen Schluss redet. Es sind also drei Komponenten des
Syllogismus:
Obersatz (= 1. Prämisse): „Alle Fußballer sind Menschen“
Untersatz (=2. Prämisse): „Cristiano Ronaldo ist ein Fußballer“
Schlusssatz (=Konklusion): „Also ist Cristiano Ronaldo ein Mensch“
Das Verhältnis zwischen den drei obigen Sätzen, welche die Struktur des
Syllogismus widerspiegeln, zeigt deutlich, dass es sich bei Syllogismus um
einen Schluss handelt. Gemeint ist allerdings eine einfache Schlussfolgerung mit
den Begriffen, die in ihr nicht weiter zerlegt werden. In der Prädikatenlogik
werden die Begriffe dagegen nicht nur als einstellige Prädikate ausgedrückt,
sondern man kann auch die innere Struktur von Begriffen analysieren und damit
die Gültigkeit von Argumenten zeigen, die syllogistisch nicht fassbar sind (vgl.
oben). So kann man hier folgendes klassisches Beispiel angeben: „Alle Pferde
sind Tiere; also sind alle Pferdeköpfe Tierköpfe“.
Die symbolische Logik
Wir konnten oben bereits sehen, dass die klassische Logik als Aussagen-,
Prädikatenlogik und Syllogistik ihre „semantische Botschaft“ mit Hilfe von
Symbolen vermittelt. Der Einsatz von Symbolen kommt jedoch auf dem Gebiet
der symbolischen Logik viel intensiver als im Bereich der oben genannten Typen
von Logik vor. Die symbolische Logik wird auch als Logistik oder
mathematische Logik bezeichnet; sie stellt ein Teilgebiet der Mathematik und
der formalen Logik dar.
Man kann drei grundlegende Etappen in der Entwicklung der mathematischen
Logik unterscheiden.
* Die erste Etappe wird mit G.W. Leibniz (1646-1716) in Verbindung gebracht,
der als Logiker mathematische Ideen entwickelte.
* Die zweite Etappe lässt sich mit dem 19. Jahrhundert identifizieren, in dem vor
allem die Arbeiten von G. Frege (1848-1925) und E. Schröder (1841-1902) zu
beachten sind. Diese Leistungen wurden von A.N. Whitehead (1861-1947) und
B. Russell (1872-1970) fortgesetzt, insbesondere im umfassenden Werk
„Principia Mathematica“, das aber in erster Linie nur eine formale Erweiterung
der aristotelisch-stoischen Logik darstellt.
12
* Damit ist die dritte Etappe im Entwicklungsprozess der mathematischen Logik
angebrochen. Charakteristisch sind für diese Etappe die sogenannten
„heterodoxen“ Systeme, die nicht auf der aristotelisch-stoischen Grundlage
erstellt werden. Gemeint sind vor allem die mehrwertige Logik von J.
Łukasiewicz (1921) und die intuitionistische Logik von A. Heyting (1930). Auch
das aristotelisch geprägte System von S. Leśniewski ist hier zu erwähnen.
Leśniewski stellte in seiner Arbeit „Die Grundlagen der allgemeinen
Mengenlehre“ das Modell einer axiomatischen Theorie dar. Sie beruht auf dem
ursprünglichen Terminus, der in den Sätzen des Typus „Der Gegenstand P ist
ein Teil des Gegenstandes P1“ auftritt. Auf dieser Grundlage definierte
Leśniewski den Begriff, der für die Formulierung der Antinomie Russells
entscheidend war, d.h. den Begriff, der in den Sätzen des Typus „Der
Gegenstand P ist eine Klasse der Gegenstände m“ vorkommt. Erst dann konnte
Leśniewski seine Analyse der Antinomie Russells fortsetzen und nach einer
Lösung suchen. Die Herausarbeitung des Begriffs „Klasse im kollektiven Sinne“
(im Unterschied zur „Klasse im distributiven Sinne“) ermöglichte Leśniewski
das Aufstellen einer deduktiven Theorie, die er „Mereologie“ nannte. Dabei
spielte vor allem das intuitiv unterbaute „Gefühl der Korrektheit“ und der
konsequente Gebrauch von einzelnen und allgemeinen Sätzen eine
entscheidende Rolle.
Wenn man die Thesen von Leśniewski genauer betrachtet, dann kann man
feststellen, dass zwei Sachverhalte bei der mathematischen Logik zu beachten
sind:
(1) Zum einen wird es klar, auf welchen Gebieten die mathematische Logik
erfahrbar ist – es ist ein kombinatorisches Studium von Inhalten. Dabei wird
also nicht nur die syntaktische Perspektive in Betracht gezogen, d.h. die Analyse
von formalen Zeichenketten als solchen, sondern auch die semantische, d.h. die
Belegung solcher Zeichenketten mit Bedeutung.
(2) Zum anderen ist eindeutig zu sagen, dass einige Missverständnisse im
Verlaufe der Entwicklung der mathematischen Logik aufgetreten sind. Gemeint
ist vor allem der Versuch einer Identifizierung der mathematischen Logik mit
dem Neopositivismus, dessen logische Tendenzen nicht zuletzt durch
Wittgenstein geprägt waren (vgl. TLP 5.551; 6.02).
Auch wenn wir bei Wittgenstein über die Philosophie der Logik durchaus
sprechen können, weil er logische Junktoren (z.B. „nicht“, „und“, „oder“ usf.),
Quantoren („für alle Dinge“, „für einige Dinge“) und Wahrheitswerte („wahr“,
„falsch“) ins Spiel bringt, lässt sich dies noch nicht als mathematische Logik im
strengen Sinne betrachten.
13
Die mathematische Logik umfasst indes grundsätzlich folgende vier Gebiete:
(1) Mengenlehre – ist die Analyse der Mengen, die abstrakte Kollektionen von
Objekten sind. Während einfache Konzepte wie Teilmenge oft im Bereich der
naiven Mengenlehre behandelt werden, so arbeitet die moderne Forschung im
Bereich der axiomatischen Mengenlehre. Diese benutzt logische Methoden, um
festzustellen, welche mathematischen Aussagen in verschiedenen formalen
Theorien, wie z.B. in der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre, beweisbar sind;
(2) Beweistheorie – stellt die Untersuchung formaler Beweise und verschiedener
logischer Systeme dar. Beweise werden als mathematische Objekte betrachtet,
um sie mittels mathematischer Techniken untersuchen zu können;
(3) Rekursionstheorie (=Berechenbarkeitstheorie) – zielt darauf ab,
berechenbare Funktionen und Turing-Grade zu erforschen, welche die nicht
berechenbaren Funktionen nach dem Grad ihrer Nicht-Berechenbarkeit
klassifizieren. Darüber hinaus befasst sich die Rekursionstheorie mit der
Analyse verallgemeinerter Berechenbarkeit und Definierbarkeit; und
(4) Modelltheorie – untersucht Modelle von formalen Theorien. Die Menge aller
Modelle einer bestimmten Theorie wird elementare Klasse genannt. Die
klassische Modelltheorie versucht, die Eigenschaften von Modellen einer
bestimmten elementaren Klasse zu bestimmen, bzw. herauszufinden, ob
bestimmte Klassen von Strukturen elementar sind.
Wenn wir allerdings logisch ehrlich sein wollen, dann müssen wir dabei auch
betonen, dass sich keine genaue Grenze zwischen den obigen vier Gebieten der
mathematischen Logik ziehen lässt. So kann man davon ausgehen, dass diese
Gebiete teilweise aus sachlich-methodischer Sicht miteinander verflochten sein
müssen. Diese Konstellation ergibt sich ferner daraus, dass jedes einzelne Gebiet
eine ziemlich komplexe Struktur aufweist. Wir können dies etwa mit dem
Beispiel von Modelltheorien verdeutlichen.
Wollen wir also eine Modelltheorie entwerfen, dann haben wir vorab zwei
Sachen zu klären:
(1) Zum einen müssen wir festlegen, was wir unter einem Modell verstehen.
Denn
es
gibt
Herstellungsmodelle
(Prägemodelle,
Gussmodelle),
Planungsmodelle (Baumodelle, Handlungsmodelle) usf. In diesen Modellen
werden unterschiedliche Techniken wie Abbildung, Repräsentation, Simulation
usf. eingesetzt.
(2) Zum anderen muss die Struktur von den zu entwerfenden Modellen bestimmt
werden.
Was das Verständnis von Modellen anbelangt, interessieren uns hier bloß die
Modelle von formalen Theorien, die aber auch beim Entwerfen von
Herstellungs- und Planungsmodellen gut eingesetzt werden können.
14
Aus wissenschaftstheoretischer Sicht ist also die Frage nach mathematischen
Strukturen viel interessanter. In der Mathematik werden Strukturen (unter
Vermeidung einer von Hilbert bestimmten definitorischen Axiomatik)
grundsätzlich als diejenigen Eigenschaften eingeführt, die eine formale
Verknüpfung von Gegenständen oder Relationen erlauben. So führt etwa Russell
den Strukturbegriff in die Grundlagentheorie der mathematischen
Wissenschaftstheorie anhand einer Karte ein:
„Ist ein Ort nördlich von einem anderen, so befindet sich die entsprechende
Stelle auf der Karte oberhalb der anderen; liegt ein Ort westlich von einem
anderen, so befindet sich die entsprechende Stelle auf der Karte links von der
anderen und usf. Die Struktur der Karte entspricht der Gegend, die sie
darstellt.“
(Russell, B., Einführung in die mathematische Philosophie, Hamburg 2002, 68f)
Um zu erklären, wie die Ähnlichkeitsrelation zu konstituieren ist, führt Russell
ein weiteres Beispiel ein. Damit sind folgende Beziehungspaare gegeben: ab, ac,
ad, bc, ce, dc, de. Dabei sind a, b, c, d und e fünf beliebige Elemente, deren
Relationen man schematisch wie folgt darstellen kann:
A
B
D
C
E
Für Russell ist also klar, dass die Struktur der Relation nicht von den besonderen
Elementen abhängt, die das Feld der Relation bilden. Das Feld kann geändert
werden, ohne dass sich die Struktur ändert, und die Struktur kann sich ändern,
ohne dass dies beim Feld der Fall ist. Wenn wir z.B. das Paar AE im obigen
Schema noch zusätzlich hinzufügen, dann verändern wir die Struktur, nicht aber
das Feld. So weist Russell darauf hin, dass es eine Asymmetrie von Feld und
Relation gibt.
Dennoch müssen wir hier kritisch fragen, nach welchen Kriterien die Struktur
der Relation einzuführen sei. Denn zum einen behauptet Russell, dass zwei
Relationen die gleiche Struktur haben, falls die gleiche Karte für beide gilt;
unter der Karte versteht Russell das Entsprechungsverhältnis der oben
bestimmten Ähnlichkeitsrelationen (etwa zwischen Karte und Gegend). Zum
anderen gilt es aber, dass die Ähnlichkeitsrelation genau dann besteht, wenn die
gleiche Struktur existiert; und die gleiche Struktur liegt genau dann vor, wenn
eine gleiche Ähnlichkeitsstruktur erkennbar ist. Daraus ergibt sich also, dass
15
diese Definition des Strukturbegriffs ein logischer Zirkel ist. Begreift man das
Existieren der Ähnlichkeitsrelation als Interpretation der Struktur, welche die
Struktur wahrmacht, und führt man wahre Strukturen als Modelle ein, dann folgt
daraus, dass Modelle jeweils die Strukturen bestimmen, die Strukturen aber
durch Modelle definiert werden.
So können wir sagen, dass Russells Strukturbegriff, den er für die
mathematische Wissenschaftstheorie und den daraus resultierenden
Modellbegriff eingeführt hat, grundlegende sichtbare Schwächen aufweist.