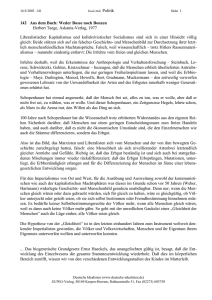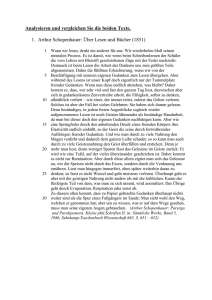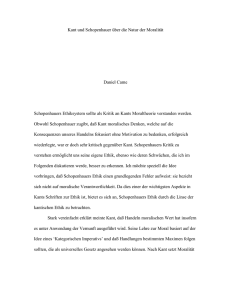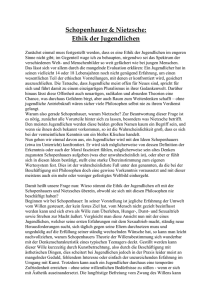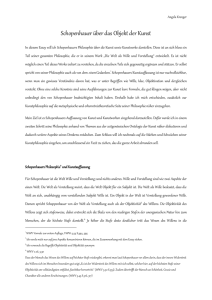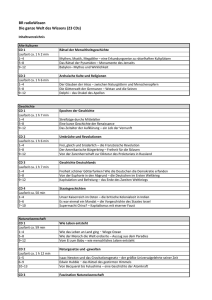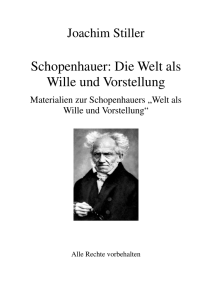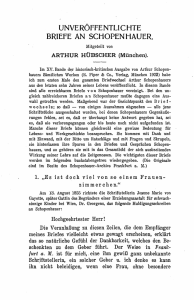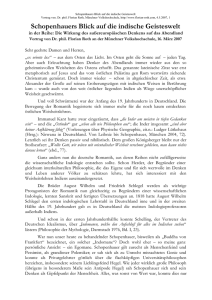Das bessere Bewusstsein und der Wille
Werbung

Das bessere Bewusstsein und der Wille Eine Einführung in die Philosophie von Arthur Schopenhauer Vorlesung von Martin Jandl im WS 2011/12 Version: Fast final 23.01.2012 Inhaltsverzeichnis Erste Vorlesung ................................................................................................................... 1 Eine Schopenhauer-Vorlesung an der SFU – cui bono? ....................................... 1 Schopenhauers Leben in CV-Form ........................................................................... 5 Widersprüche in Schopenhauers Werk .................................................................... 9 Auf dem Weg zum besseren Bewusstsein – Immanuel Kant ............................ 15 Zweite Vorlesung .............................................................................................................. 30 Auf dem Weg zum besseren Bewusstsein – Platon ............................................. 30 Das bessere Bewusstsein ............................................................................................. 35 Die Schrift über Wurzeln, nicht für Apotheker geeignet ................................... 38 Dritte Vorlesung ............................................................................................................... 55 Die Dresdner Geburtssituation ................................................................................. 55 Zu Schopenhauers Verwendung von ›Wille‹......................................................... 57 Gedankengang und Komposition von WWV ....................................................... 65 Vierte Vorlesung ............................................................................................................... 71 Lektüre der WWV: Die Welt als Vorstellung........................................................ 71 Lektüre der WWV: Der Leib als objektivierter Wille .......................................... 73 Lektüre der WWV: Die Objektivationen des Willens ......................................... 76 Lektüre der WWV: Kontemplation & Befreiung.................................................. 85 Fünfte Vorlesung .............................................................................................................. 92 Lektüre der WWV: Bejahung & Verneinung des Willens .................................. 92 Lektüre der WWV: Streben und Leiden ................................................................. 94 Lektüre der WWV: Bejahung und Sexualität ........................................................ 96 Lektüre der WWV: Quietiv des Willens ................................................................. 99 Individueller Charakter und kolossaler Egoismus ............................................. 104 Literaturverzeichnis ...................................................................................................... 113 Siglenverzeichnis ....................................................................................................... 113 Bücher .......................................................................................................................... 113 Erste Vorlesung Eine Schopenhauer-Vorlesung an der SFU – cui bono? Die Philosophie von Arthur Schopenhauer stellt im Gegensatz zu Kants Œuvre keinen Einschnitt in die Philosophiegeschichte dar – es lässt sich nicht stimmig behaupten, dass es eine Philosophie ›vor Schopenhauer‹ und eine ›nach Schopenhauer‹ gibt, was sehr wohl auf Kants Kritik der reinen Vernunft zutrifft. Dennoch – Schopenhauer gilt als einer der bedeutendsten Philosophen (nicht nur des 19. Jahrhunderts), was für sich betrachtet allerdings noch nicht erklärt, warum gerade sein philosophisches System an der Sigmund Freud Universität vorgetragen werden soll. Es sind zwei Gründe, die mich dazu motivierten, eine Vorlesung über Schopenhauer anzubieten. Der erste Grund liegt auf der Hand – in Freuds Konzeption der Psychoanalyse lassen sich Einflüsse der Welt als Wille und Vorstellung, Schopenhauers Hauptwerk, feststellen. Dass die Psychoanalyse in wesentlichen Punkten von Schopenhauer beeinflusst ist, lässt sich problemlos in Freuds Selbstdarstellung von 1925 finden: »Die weitgehende Übereinstimmung der Psychoanalyse mit der Philosophie Schopenhauers – er hat nicht nur den Primat der Affektivität und die überzeugende Bedeutung der Sexualität vertreten, sondern selbst den Mechanismus der Verdrängung gekannt – lassen sich nicht auf meine Bekanntheit mit seiner Lehre zurückführen. Ich habe Schopenhauer sehr spät in meinem Leben gelesen. […] An der Priorität lag mir ja weniger als an der Erhaltung meiner Unbefangenheit.« (Freud 1999:86) Freud konzediert eine Übereinstimmung in vielen Positionen, weist allerdings den Gedanken einer direkten Beeinflussung zurück, indem der auf einer späten Lektüre insistiert. Allerdings ist es nicht von entscheidender Bedeutung, ob wir Freud quasi beim heimlichen Lesen von Schopenhauer ›erwischen‹; denn Wien um die Jahrhundertwende ist durch eine spezifische kulturhistorische Situation gekennzeichnet: Architektur und Kunst, Journalismus und Jurisprudenz, Philosophie und Dichtung, Musik und Theater sind zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Wien keineswegs als »parallele, aber voneinander unabhängige Aktivitäten [aufzufassen], die sich bloß zufällig zur selben Zeit am selben Ort entfalteten« (Janik & Toulmin 1989:20). Das Ziehen von Trennlinien entspricht nicht der historischen Realität. »In dieser Hinsicht könnten wir leicht irregeführt werden durch die grundlegenden Unterschiede zwischen dem späten habsburgischen Wien – wo künstlerisches und kulturelles Leben die Angelegenheit vergleichsweise eng kommunizierender Gruppen von Künstlern, Musikern und Schriftsteller war – und dem Seite | 1 heutigen Westeuropa oder Amerika, wo etwa die akademische oder künstlerische Spezialisierung selbstverständlich ist und die verschiedenen Sphären schöpferischer Aktivität in grundsätzlicher Unabhängigkeit voneinander existierten.« (Janik & Toulmin 1989:21) In suggestivem Ton stellen Janik & Toulmin dem/der LeserIn folgende Fragen: »War es einfach Zufall, daß die Anfänge der Zwölftonmusik, der ›modernen‹ Architektur, des Rechtspositivismus, der abstrakten Malerei und der Psychoanalyse – oder auch das Wiederaufleben des Interesses an Schopenhauer und Kierkegaard – alle in der gleichen Zeit entstanden und daß sie so weitgehend auf Wien konzentriert waren? War es nur eine biographische Merkwürdigkeit, daß der junge Dirigent Bruno Walter regelmäßig Gustav Mahler zu Einladungen im Haus der Familie Wittgenstein in Wien begleitete und dabei beide ihr gemeinsames Interesse an der Philosophie Kants entdeckten, was Mahler veranlaßte, Walter zu Weihnachten 1894 die gesammelten Werke Schopenhauers zu schenken?« (Janik & Toulmin 1989:21) Es ist eine gut belegte Tatsache, dass in den Wiener Salons um die Jahrhundertwende ein reger intellektueller Austausch gepflegt wird, in dem auch der ›Anti-Philosoph‹ Schopenhauer intensiv diskutiert wird (Janik & Toulmin 1989:37) – neben Nietzsche übrigens. So gesehen müssen sich die Wiener Intellektuellen des Fin-de-siècle-Wien gar nicht die Mühe machen, die Schriften der gerade ›aktuellen‹ Philosophen zu lesen. Daraus lässt sich ein weiterer Schluss ziehen: Schopenhauers Werk ist nicht nur Freud bekannt, sondern allen PsychoanalytikerInnen und PsychotherapeutInnen, die während des Fin-desiècle in den Wiener Salons verkehrten. Außerdem (so meine Annahme) wird Freud seine Schüler und Mitstreiter dazu anreget haben, sich mit Schopenhauer zu beschäftigen. Wie Pongratz (1984:207) ausführt, sind die Übereinstimmungen zwischen Schopenhauers Willensmetaphysik und Freuds Psychoanalyse ›in der Tat weitgehend‹. Pongratz charakterisiert Schopenhauers Philosophie wie folgt: »Der Urkonflikt im Menschen ist durch eine existentielle Frustration hervorgerufen: Des Menschen Wünschen und Wollen ist grenzenlos, seine Ansprüche maßlos, ein befriedigter Wunsch zeugt einen neuen. ›Keine auf der Welt mögliche Befriedigung könnte hinreichen sein Verlangen zu stillen, seinem Begehr ein endliches Ziel zu setzen und den bodenlosen Abgrund seines Herzens auszufüllen.‹ Das Angebot der Welt liegt weit unter den Erwartungen menschlichen Wollens, das macht die grundlegende Frustration aus. Eine zweite Form des Konfliktes entsteht durch die Widerpartnerschaft des bewußt verneinenden Willens gegen den Triebwillen. Von der Verneinung, nicht von der Erfüllung des Triebwollens ist Ruhe, ist Erlösung zu erhoffen. Schließlich steht der Mensch Seite | 2 von vornherein in einem Sozialkonflikt; denn der Wille Schopenhauers pessimistischer Philosophie ist kraß egoistisch. Streit und Kampf herrscht in der Natur, entzweit die Menschen. Jeder will Mittelpunkt der Welt sein, und so streitet das Bedürfnis des einen gegen das gleichgerichtete des anderen, und jeder ist bereit, ›eine Welt zu vernichten, um nur sein eigenes Selbst, diesen Tropfen im Meer, etwas länger zu erhalten‹. Aus dieser Grundsituation erwachsen die seelischen Störungen; sie haben ihren Ursprung letztlich in dem Widerstreit, den Freud durch die Gegensätzlichkeit von Trieb und Abwehr gekennzeichnet hat.« (Pongratz 1984:207) Zimmer (2010:117) hebt die Erschütterungen besonders hervor, die Schopenhauer auf das Selbstverständnis des Menschen ausübt: »Das angebliche Vernunftwesen Mensch ist in Wahrheit ein Triebwesen, seine Rationalität schwimmt wie ein kleiner schwankender Kahn auf einem Ozean des Triebhaften, Irrationalen und Unbewussten.« Diese Erschütterung findet sich bei Freud (1987:133ff) reformuliert als die ›dritte Kränkung‹ des Menschen (neben sich selbst nennt Freud bekanntlich Kopernikus und Darwin). Sexualität ist für Schopenhauer kein beliebiges, sondern ein zutiefst metaphysisches Thema; er sieht in der Sexualität einen Schlüssel für das Verständnis des Menschen, denn in den Triebregungen des Körpers ist der Mensch in unmittelbarem Kontakt zum Willen als dem universalen Lebensantrieb (s. Zimmer 2010:149f). Schopenhauers Traumtheorie dürfte keinen geringen Einfluss auf Freuds Die Traumdeutung haben (s. Zimmer 2010:216). »Dass rationales Begreifen und Verstehen und alles das, was die Tradition Bewusstsein nannte, auf einem Kontinent undurchschauter Triebe und Willensregungen ruht, ist eine Entdeckung Schopenhauers, die Freud ausgebeutet und fruchtbar gemacht hat. […] Schopenhauer kann mit Recht als der erste Philosoph und Entdecker des Unbewussten und Freud als der im Bereich der Psychologie bedeutendste Schopenhauer-Erbe gelten. Freud teilt mit Schopenhauer die Erkenntnis, dass die Sexualität einen Schlüssel zum Verständnis der menschlichen Natur liefert und dass die Kanalisierung und Gestaltung des Irrationalen ein Charakteristikum der menschlichen Kultur ausmacht.« (Zimmer 2010:268) Allerdings muss man die Wirkung von Schopenhauer auf Freud nicht positiv sehen, ja es gibt AutorInnen, die Freuds Psychoanalyse im Vergleich zu Schopenhauers Willensmetaphysik als nachgerade barbarisch einstufen. Folgendes Zitat sei als Beispiel angeführt: »Fragwürdig erscheint auch die Berufung auf Schopenhauer im Falle Sigmund Freuds. Dessen monomanischer Pansexualismus beruht offenbar auf einer Mißdeutung der wirklichkeitsgemäßen Feststellung Schopenhauers, daß die Geschlechtsliebe, ›nächst der Liebe zum Leben, sich als die stärkste und thätigste Seite | 3 aller Triebfedern erweist, die Hälfte der Kräfte auf Gedanken des jüngeren Theiles der Menschheit fortwährend in Anspruch nimmt, das letzte Ziel fast jedes menschlichen Bestrebens‹ sei. Aus der ›stärksten und thätigsten aller Triebfedern‹ macht der moderne Psychoanalytiker praktisch die einzige Triebfeder; aus der ›Hälfte der Kräfte und Gedanken des jüngeren Theils der Menschheit‹ ein altersmäßig kaum begrenztes Totales: Dies aufgrund einer rein mechanistischen Vorstellung vom ›Unbewußten‹, die ihrerseits einer Psychologie entspricht, nach der er möglich sein soll, die Psyche aus der Physis zu erklären. Wohingegen wohl die unangreifbarste aller Einsichten Schopenhauers diese ist und bleiben wird: daß jede ›physische Erklärung, überhaupt und als solche, noch einer metaphysischen bedarf, welche den Schlüssel zu allen ihren Voraussetzungen lieferte, eben deshalb aber auch einen ganz anderen Weg einschlagen müßte‹.« (Abendroth 2007:130f) Es soll nicht darauf eingegangen werden, ob Abendroth Freud nicht missversteht, denn für Freud deckt sich Sexualität »keineswegs mit dem Drang nach Vereinigung der geschiedenen Geschlechter oder nach Erzeugung von Lustempfind an den Genitalien, sondern weit eher mit dem allumfassenden und alles erhaltenden Eros des Symposions Platons« (Freud 1999:105). Wie man auch immer das intellektuelle Verhältnis von Schopenhauer und Freud einschätzen mag – es liegt auf der Hand, dass die Kenntnis von Schopenhauers zentralen Gedanken für PsychotherapiewissenschaftlerInnen nicht unmaßgeblich ist. »Schopenhauer hat, fast ein Jahrhundert vor Freud, die das abendländische Denken beherrschende Bewußtseinsphilosophie umgedreht. Bei Schopenhauer gibt es zum ersten Mal eine ausgeführte Philosophie des Unbewußten und des Leibes. Das Sein bestimmt unser Bewußtsein. Aber das Sein ist nicht, wie bei Marx, der Gesellschaftskörper, sondern unser wirklicher Körper, der uns allem gleichmacht und doch auch uns mit allem verfeindet, was lebt. […] Aber er war der ›rationalste Philosoph des Irrationalen‹ (Thomas Mann). Er wußte: Man muß dem Schwächeren beistehen, der Vernunft. Für die Torheit, den Willen, diesen Riesen, zu sich selbst befreien zu wollen, hatte er nur Verachtung übrig. Er jedenfalls wollte sich nicht dazu hergeben, als Schwanz mit dem Hund zu wackeln.« (Safranski 2010:509f) Für die Psychotherapiewissenschaft gilt im Speziellen, was Safranski allgemein festhält: »Es war nicht lange vor seinem Tode, daß Schopenhauer sagte: ›Die Menschheit hat Einiges von mir gelernt, was sie nie vergessen wird…‹ Man hat von ihm gelernt, hat aber auch vergessen, daß man von ihm gelernt hat.« (Safranski 2010: 509) Seite | 4 Damit ist der zweite Grund für diese Vorlesung angesprochen. Psychotherapiewissenschaft bedarf einer philosophischen Basis. Oder anders formuliert: Das Verständnis von philosophischen Texten und die Bewandertheit in unterschiedlichen philosophischen Denksystemen ist für die Psychotherapiewissenschaft nicht unerheblich – gerade für ihr wissenschaftliches Selbstverständnis. Die Trennung von der Philosophie, die die Mainstream-Psychologie vollzogen hat – und zwar nicht unbedingt zu ihrem Vorteil –, sollte in der ›Wissenschaft vom Subjektiven‹ (wie man es trefflich formuliert hat) nicht dupliziert werden. Die Einführung in Schopenhauers Denken bringt mit sich, dass auch über Kant und Platon, über Erkenntnistheorie und Ethik, über Ästhetik und das Leib-Seele Problem zu reden ist. Schopenhauers Werk ist reich, und es zu verstehen bedeutet zugleich wichtige philosophische Grundlagen zu rezipieren. Oder, anders gesagt: Eine Vorlesung über Schopenhauer ist auch eine Einführung in vielerlei philosophische Themen. Und das ist für die junge Disziplin der Psychotherapiewissenschaft nicht unnötiges Beiwerk. Das, gemeinsam mit der Bedeutung von Schopenhauers Werk auf die Entwicklung der Psychoanalyse, sind die beiden Gründe für die Wahl, Schopenhauers Werk als Vorlesung an der SFU vorzutragen. Schopenhauers Leben in CV-Form »Schopenhauer ist ein Philosoph des frühen 19. Jahrhunderts. Das vergisst man leicht, weil seine Wirkung erst so spät eingesetzt hat.« (Safranski 2010:13) Es ist leider nicht möglich, das Leben des Arthur Schopenhauer hier detailliert nachzuzeichnen – wie das beispielsweise Safranski (2010), Zimmer (2010) oder auch Abendroth (2007) in ihren lesenswerten Biografien machen. Für unsere Zwecke soll ein Kurzüberblick, ein CV sozusagen, genügen. Ich kompiliere die folgenden Daten aus Abendroth (2007:137ff) und Birnbacher (2009:139f). 1788 Geboren am 22. Februar in Danzig (Heiligengeistgasse 114) als Sohn des Kaufmanns Heinrich Floris Schopenhauer und dessen Frau Johanna, die später zu einer weithin bekannten und geschätzten Romanautorin wird; Taufe am 3. März 1793 Der Vater verlegt sein Geschäft nach Hamburg, um nicht mit der Angliederung Danzigs an Preußen preußischer Untertan zu werden. Arthur Schopenhauer besucht eine Privatschule für angehende Kaufleute. 1797 Geburt der Schwester Adele; Arthur Schopenhauer fährt zur Erlernung der französischen Sprache nach Le Havre, wo er im Haus des Geschäfts- Seite | 5 freunds seines Vater, Grégoire de Blésimaire, zwei (glückliche) Jahre verbringt und sich mit dem Sohn des Hauses, Anthime Grégoire, befreundet. 1799 Besuch der Rungeschen Privatschule in Hamburg. Arthur Schopenhauer eignet sich den Lehrstoff sehr (zu) schnell an und bittet daher seinen Vater, ihn aufs Gymnasium zu schicken; der Vater allerdings beharrt auf einer Ausbildung zum Kaufmann (und hält humanistisches Wissen für überflüssig). Arthur wird von seinem Vater schließlich vor eine Alternative gestellt: Gymnasium oder mehrjährige Bildungsreise durch Europa (und dann Kaufmann). Arthur entscheidet sich für die Reise. 1800 Reise mit den Eltern nach Karlsbad und Prag 1803-04 Europareise (England, Frankreich, Schweiz, Österreich) mit den Eltern. Aufenthalt in England zum Erwerb der englischen Sprache (im Eagle House zu Wimbledon). Während der ganzen Reise führt Arthur Schopenhauer Tagebuch; hier finden sich neben den vielfältigen positiven Eindrücken auch frühe pessimistische Empfindungen und Eindrücke. 1805 Kaufmannslehre in der Hamburger Firma Jenisch. Der Vater begeht Suizid. 1806 Die Mutter und Schopenhauers Schwester Adele übersiedeln nach der Auflösung des väterlichen Geschäfts nach Weimar und lassen Arthur Schopenhauer in Hamburg allein zurück. Schopenhauer wirft der Mutter in Briefen vor, den Suizid des Vaters durch Lieblosigkeit verschuldet zu haben; dabei ist er hin und hergerissen zwischen pflichtmäßiger Fortsetzung der Kaufmannslehre und der Neigung zum geistigen Lebensberuf (liest begeistert Matthias Claudius, W.H. Wackenroders und Ludwig Tiecks). 1807-09 Schopenhauer wird Schüler des ›Gymnasium illustre‹ in Gotha, das er wegen eines Spottgedichts noch im selben Jahr verlassen muss. Übersiedlung nach Weimar. Großjährig geworden, bekommt Schopenhauer seinen Anteil am väterlichen Erbe (und hat fortan keine Geldsorgen mehr). Schopenhauer bewältigt das Gymnasialpensum in zwei Jahren. 1809 Aufnahme des Studiums der Medizin, der Naturwissenschaften und der Philosophie an der Universität Göttingen; Schopenhauer lernt die Werke von Kant und Platon kennen. 1811 Studium der Philosophie an der Universität Berlin, unter anderem bei Fichte und Schleiermacher; Schopenhauers ursprüngliche Begeisterung Seite | 6 für diese Geistesgrößen schlägt schnell in Verachtung und Geringschätzung um, die er Zeit seines Lebens beibehalten wird. 1813 Wegen Kriegsunruhen verlässt Schopenhauer Berlin; kurzer Aufenthalt in Weimar, wo er sich mit der Mutter streitet, aber immerhin Goethe kennenlernt, der bei der Mutter gern gesehener Gast ist. Schopenhauer zieht sich nach Rudolstadt zurück und verfasst in kurzer Zeit seine Dissertation. 1813 Promotion zum Dr. phil. an der Universität Jena mit der Dissertation Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde; einer der ersten Leser ist Goethe (oder vielleicht auch nicht…). Durch Friedrich Majer wird Schopenhauer mit der altindischen Philosophie, dem Brahmaismus, bekannt. 1814 Übersiedlung nach Dresden. Zerwürfnis mit der Mutter 1816 Abschluss der Studien zur Farbenlehre mit der Veröffentlichung der Abhandlung Über das Sehen und die Farben; Goethe ist nicht wirklich begeistert und dürfte den transzendentalphilosophischen Ansatz, der Schopenhauer eigen ist, nicht verstehen. 1819 Die Welt als Wille und Vorstellung. Im Zuge der Abrechnungen beleidigt Schopenhauer seinen Verleger, F. A. Brockhaus; das Buch wird ein wirtschaftliches Desaster. 1818-19 Italienreise; sie führt über Venedig, Rom Neapel, Paestum, Rom, Venedig, Mailand; in Venedig verliebt sich Schopenhauer in eine unbekannt gebliebene Dame. Das Bankenhaus L. A. Muhl bricht zusammen, dort hat Schopenhauer sein Vermögen liegen; die finanzielle Zukunft ist plötzlich ungewisse, Schopenhauer bemüht sich um eine Professur. 1820 Antrittsvorlesung und Vorlesungstätigkeit als Privatdozent an der Universität Berlin. Da Schopenhauer seine Vorlesungen demonstrativ zu den Stunden von Hegels Hauptkolleg setzt, bleiben die Hörer aus – zu diesem Zeitpunkt ist Hegel die unbestrittene Philosophengröße. Seite | 7 1821 Muhl & Co zahlen Schopenhauer seine Forderungen aus. Die finanzielle Zukunft ist wieder gesichert. 1822 Zweite Italienreise über die Schweiz, Mailand, Venedig und Florenz 1823 Rückkehr nach Deutschland; in München wird Schopenhauer wegen mehrerer Krankheiten fast ein Jahr festgehalten; tiefe Depression, gesteigert durch die Ertaubung des rechten Ohrs. 1824 Kur in Gastein 1825-31 Ab April wieder in Berlin, um einen weiteren Anlauf zur Dozentenkarriere zu übernehmen (Schopenhauers Erwartungen sind gedämpft); die Resonanzlosigkeit hält allerdings an. In der ›Kleinen Bücherschau‹ erscheint eine positive Besprechung von Die Welt als Wille und Vorstellung, geschrieben von Jean Paul. Im August 1831 flieht Schopenhauer aus Berlin, um der Choleraepidemie nicht zum Opfer zu fallen; Hegel bleibt und stirbt an Cholera. 1832 Abschluss der Übersetzung von Baltasar Graciáns Hand-Orakel und Kunst der Weltklugheit, veröffentlicht nach Schopenhauers Tod 1833 Übersiedlung nach Frankfurt am Main, wo sich Schopenhauer nun endgültig niederlässt. 1836 Abfassung und Erscheinen der Schrift Über den Willen in der Natur 1837 Schopenhauer greift in die Gestaltung der Kant-Gesamtausgabe ein, indem er erfolgreich für die Aufnahme der ersten Fassung der Kritik der reinen Vernunft anstatt der zweiten Fassung plädiert. 1838 Tod der Mutter 1839 Preisschrift über die Freiheit des menschlichen Willens, ausgezeichnet von der Königlichen Norwegischen Societät der Wissenschaften 1840 Preisschrift über das Fundament der Moral, nicht ausgezeichnet von der Königlichen Dänischen Societät der Wissenschaften. Beide Preisschriften erscheinen 1841 unter dem zusammenfassenden Titel Die beiden Grundprobleme der Ethik. Mit Julius Frauenstädt tritt der erste von Schopenhauers in den folgenden Jahren sich ständig mehrenden ›Aposteln und Evangelisten‹ in dessen Gesichtskreis. 1843 Schopenhauer bezieht für die Dauer von 16 Jahren das Haus Schöne Aussicht Nr. 17. 1844 Die Welt als Wille und Vorstellung, Neuauflage zusammen mit einem ergänzenden zweiten Band 1847 Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde, erweiterte und veränderte Neuauflage 1849 Tod der Schwester Adele, kurz nach dem letzten Wiedersehen Seite | 8 1851 Parerga und Paralipomena, 2 Bände (Band 2 enthält die Aphorismen zur Lebensweisheit) 1854 Richard Wagner lässt Schopenhauer seine Dichtung Der Ring der Nibelungen überreichen; dieser meint, Wagner habe mehr Talent zum Dichter als zum Musiker ;-) 1858 Schopenhauer wird zum 70. Geburtstag die Mitgliedschaft in der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin angetragen; er lehnt ab. 1859 Schopenhauer übersiedelt in das Nachbarhaus Schöne Aussicht Nr. 16. 1860 Am 9. September Ausbruch einer Lungenentzündung; letztes Gespräch mit Wilhelm Gwinner (erster Schopenhauer-Biograf) am 18. September; Arthur Schopenhauer stirbt am 21. September und wird fünf Tage später auf dem Städtischen Hauptfriedhof beigesetzt. Widersprüche in Schopenhauers Werk »Schopenhauer ist der Philosoph der Säkularisierungsschmerzes, der metaphysischen Obdachlosigkeit, des verlorenen Urvertrauens. […] Doch es gibt bei ihm noch ein metaphysisches Staunen, auch Entsetzen über die gnadenlose Immanenz des Lebenswillens, der kein Jenseits kennt. Er hat mit Ersatzgöttern (Naturvernunft, Geschichtsvernunft, Materialismus, Positivismus) zu einem Zeitpunkt aufgeräumt, als die Flucht in diese neuen ›Religionen‹ des Machbaren erst so richtig begann.« (Safranski 2010:509) Es gibt Widersprüche in Schopenhauers Werk, und zwar motivischer und inhaltlicher Art. Der erste liegt wohl darin begründet, dass Schopenhauer ein Philosoph des Übergangs ist. Birnbach (2009:7) sieht in Schopenhauer einen ›Denker des Übergangs‹: Sein Denken steht einerseits in der Tradition der neuzeitlichen Philosophie, vornehmlich von Kants Transzendentalphilosophie, andererseits macht sich in Seite | 9 Schopenhauers Philosophierens ein gänzlich neuer Typ philosophischen Denkens bemerkbar, für das sich die Bezeichnung ›Existenzphilosophie‹ eingebürgert hat. Søren Kierkegaard, der als der eigentliche Begründer der Existenzphilosophie gilt, gehört der Generation nach Schopenhauer an und ist von diesem beeinflusst. Schopenhauer sieht sich als der Nachfolger Kants und nimmt für sich in Anspruch, dessen Vermächtnis reiner fortzuführen als dies Fichte, Schelling und Hegel tun. Tatsächlich ist Schopenhauer ein ausgesprochen loyaler Kantianer: »Er wahrte seinem Vorbild nicht nur dadurch die Treue, dass er das Ideal des Selbstdenkens für sich ebenso verbindlich hielt, wie es Kant getan hatte, sondern auch dadurch, dass er – aus heutiger Sicht gelegentlich bemerkenswert unkritisch – zentrale Lehrstücke der kantischen Philosophie übernahm.« (Birnbacher 2009:7) In der Erkenntnistheorie übernimmt Schopenhauer die zentralen Elemente der Transzendentalphilosophie, obwohl er Raum, Zeit und Kausalität in einer Weise thematisiert, die Kant wohl nicht recht gewesen wäre; auch wird Kants ›Affektion‹, die das Kausalitätsprinzip nicht voraussetzt, durchaus kreativ auf körperliche Vorgänge umgelegt und damit das Kausalitätsprinzip in die Affektion hereinholt. (Bei Kant wird Kausalität vom erkennenden Subjekt ins Spiel gebracht und kann nicht zur Erklärung der Beeinflussung der noch nicht erkannten Welt aufs Subjekt herangezogen werden). In der Ethik übernimmt Schopenhauer Kants Idee, dass für den moralischen Wert einer Handlung ausschließlich die Motive entscheidend sind, nicht die Handlungsfolgen oder der Handlungstyp, den die jeweilige Handlung exemplifiziert. In der Ästhetik hält sich Schopenhauer schließlich an Kants ›interesseloses Wohlgefallen‹ (s. Birnbacher 2009:8). »Seinem Vorbild Kant folgt Schopenhauer vor allem aber auch in der Art und Weise, in der er seine Philosophie insgesamt anlegt, nämlich als ein umfassendes philosophisches System, das aus einem einzigen zentralen Gedanken heraus entwickelt ist und diesen in alle Unterdisziplinen der Philosophie hinein sich entfaltet und ausdifferenziert. Schopenhauer möchte – nicht anders als seine erklärten Gegner, die deutschen Idealisten – das Ganze der Erfahrung in einen übergreifenden Sinnzusammenhang einordnen und die Vielfalt der Weltstrukturen mit wenigen grundlegenden Kategorien erfassen. Der Maßstab, an dem sich dieses Denken ausrichtet, ist derselbe, den auch andere Systemdenker für sich reklamiert haben: größtmögliche Einheit, Geschlossenheit und Vollständigkeit. Dazu passt, dass sich Schopenhauer in seinen gelegentlichen Reflexionen über den historischen Standort seiner Philosophie ganz selbstverständlich in die Traditionslinie der großen Systematiker Platon, Aristoteles, Descartes, Spinoza und Kant einordnet.« (Birnbacher 2009:8f) Seite | 10 Doch es meldet sich auch etwas Neues zu Wort, eben das Existenzielle. Die Existenzphilosophie steht in Widerspruch zum Systemdenken, denn während dieses systematisch vorgeht, ist jene subjektiv und willkürlich; sie spricht aus, was das denkende Individuum berührt: Existenzphilosophisch versucht das Individuum in Begriffen sich über seine höchstpersönliche Existenz klarzuwerden, sich mit seiner individuellen Erfahrung der Welt auseinander zu setzen und seiner ureigensten Betroffenheit von den Zumutungen der Welt Ausdruck zu geben (unter diesen Zumutung die größte: die eigene Endlichkeit) (s. Birnbacher 2009:9). »Schopenhauers Philosophie gibt nicht nur seinen Gedanken Ausdruck, sondern auch seinen innersten Gefühlen […]. Kaum ein anderer Philosoph begegnet dem Leser so unmittelbar als Mensch, und nicht nur als Lehrer oder Gelehrter, wie Schopenhauer. Nicht ohne Grund wählte Nietzsche für die dritte seiner Unzeitgemäßen Betrachtungen den Titel ›Schopenhauer als Erzieher‹ und nicht etwa ›Schopenhauer als Lehrer‹. Schopenhauer spricht den Leser direkt an, unverstellt und ohne sich hinter einer Maske zu verstecken. […] Der Leser wird, ob er will oder nicht, hineingezogen in eine ungewöhnliche freie, aber auch ungewöhnlich von Nöten, Ängsten, Einsamkeit und Depression belastete Existenz.« (Birnbacher 2009:9f) Schopenhauer will nicht nur belehren, sondern auch erschüttern, und dazu benutzt er Ausdrucksmittel, die ansonsten eher in der Literatur zu finden sind; er arbeitet mit suggestiven Bildern, lapidaren Sentenzen, paradoxen Zuspitzungen und auch mit beißendem Spott (s. Birnbacher 2009:10). Diese motivische Mischung, die sich aus dem Verharren in der Traditionslinie Kants und der Öffnung der Philosophie für Persönliches ergibt, wird durch inhaltliche Widersprüche komplettiert – denn Schopenhauer ist auch ein ›Denker der Gegensätze‹ (Birnbacher 2009:18). Schopenhauer versucht eine idealistische mit einer realistischen Tendenz zu verbinden. Den Idealismus findet Schopenhauer bei Kant, und zwar in dessen Idee, dass die Welt nichts anderes als (m)eine Vorstellung ist, dass also die Welt durch die subjektiven Anschauungs- und Denkformen in ihrer Gegenständlichkeit hervorgebracht (konstituiert) wird. Natürlich kennt Kant das ›Ding an sich‹ und ist damit nicht vorschnell als Idealist einzustufen. Allerdings führt Kants Konstitutionsdenken dazu, dass Schopenhauer die Welt als Vorstellung konzipiert, in der das principium individuationis (und die Kausalität) regiert. Ist die durch dieses Prinzip gestiftete Individualität durch den Tod außer Kraft gesetzt, bedeutet das zwar den Verlust des Lebens, aber ein Fortbestehen der Seele – Schopenhauer integriert hier die indische Philosophie mit der Überschreitung der Vorstellungswelt. Gleichzeitig bleibt Schopenhauer als begeisterter Leser der naturwissen- Seite | 11 schaftlichen Erkenntnisse seiner Zeit ein robuster Materialist; dies wird deutlich an Schopenhauers Auffassung, dass die Welt ein Produkt der Verarbeitung innerer und äußerer Reize im Gehirn ist. Schopenhauer fasst in der Folge der französischen Pioniere der Gehirnforschung, v.a. von Pierre Jean Georges Cabanis, das Gehirn als ›Denkorgan‹ auf und identifiziert es mit Kants ›Verstand‹. Damit erklärt Schopenhauer die Operationsweise des Verstandes nicht transzendental, sondern naturalistisch. Dieser argumentative Schachzug verträgt sich allerdings schwer mit der von Schopenhauer ansonsten hochgehaltenen idealistischen Sichtweise der Natur als einer bloßen Erscheinung (s. Birnbacher 2009:18f). Wie unzweifelhaft festzuhalten ist: »Ein Teil der physischen Welt, das Gehirn, kann unmöglich Erscheinung und zugleich die Quelle aller Erscheinungen sein. Als Quelle aller Erscheinungen kann das Gehirn nicht selbst zur Erscheinungswelt gehören. Als Teil der Erscheinungswelt kann es nicht die Quelle seiner selbst sein. Die Frage nach dem Status des Gehirns wird insofern für Schopenhauer zur metaphysischen Gretchenfrage. […] Aber Schopenhauer gibt auf diese Frage an keiner Stelle eine eindeutige und ausdrückliche Antwort. Seine Philosophie vollzieht sich als ein fortwährender Drahtseilakt zwischen Idealismus und Realismus als sich gegenüberstehende Polaritäten.« (Birnbacher 2009:19) In dieser Spannung liegt aber auch ein besonderer Reiz von Schopenhauers Philosophie – in der Spannung, die zwischen Rationalismus und Mystik besteht. Schopenhauer ist zugleich Aufklärer und Stifter einer eigentümlichen, zwischen Christentum und Buddhismus angesiedelten Art von Spiritualität. Schopenhauer kritisiert in der Tradition der französischen Aufklärer die Kirchenfürsten und sieht sich zugleich in der Tradition von Meister Eckhart und Angelus Silesius; die indischen Veden schätzt er als eine Vorwegnahme seiner eigenen Lehre (s. Birnbacher 2009:20). Safranski beschreibt die geistesgeschichtliche Situation, in der Schopenhauer sein Denken entfaltet, wie folgt: »Die alte ›Ordnung der Dinge‹ (Foucault) zerfällt mit Kant und entbindet jene Modernität, deren Zauber wir zwar verloren haben, aus der wir aber immer noch nicht heraus sind. An jene mit dem Namen Kants verbundene Zäsur wird Schopenhauer erst später vorstoßen, doch er ist schon ganz eingehüllt von der Atmosphäre dieses Umbruchs, bei der Begegnung mit der Romantik hat er es bereits mit einem Aspekt seiner epochalen Wirkung zu tun. Er wird gewissermaßen schon der zweite oder dritte Akt des großen Spiels gegeben, als Schopenhauer sich anschickt, daran teilzunehmen. Das ist nicht ohne Bedeutung: Im Krebsgang, über die Romantik, wird er zu Kant kommen, und dort angelangt, wird er eine Revision des Prozesses vornehmen, den die Nachfolger gegen Kant angestrengt hatten. Dabei wird er, mit der Schubkraft buddhistischer und mysti- Seite | 12 scher Esoterik, über Fichte, Hegel und Marx hinausgetrieben, mitten hinein in eine Transzendenz ohne Himmel, in eine radikal zu Ende geführte ›Analyse der Endlichkeit‹ (Foucault), die aber das Kunststück fertigbringt, Metaphysik nicht preiszugeben.« (Safranski 2010:101) Aber nicht nur in Bezug auf die Polarität von Rationalismus und Mystik, Aufklärung und Romantizismus steht Schopenhauers Philosophie in einem delikaten Spannungsverhältnis. Auf diese Spannungsthematik im Werk von Schopenhauer macht Thomas Mann in seinem Schopenhauer-Essay aufmerksam – Inhalt und Form bzw. Gegenstand und Darstellungsweise decken sich nicht; das Schreckliche wird trefflich in Worte gefasst. »Thema dieser Philosophie ist die Abgründigkeit des Übels und die Aussichtslosigkeit, diesem Übel zu wehren: Die Welt ist die Hölle und keinem ist diese Hölle zu wünschen. Aber die Hölle wird bei Schopenhauer in der vollendetsten Prosa beschrieben – ähnlich wie bei Dante in des vollendetsten Versen –, was jene Behauptung ein Stück weit widerlegt; eine Welt, in der solche sprachliche Höhepunkte möglich sind, kann nicht die allerschlechteste sein. In der Tat zählt Schopenhauers Prosa neben der Nietzsches zu der vollendetsten der deutschsprachigen Philosophie, insbesondere dank ihrer ungewöhnlichen Lebendigkeit. Wie Platon und Kant seine philosophischen Vorbilder sind, ist Goethe sein künstlerisches.« (Birnbacher 2009:23) Schopenhauer hat nicht nur Kants Vernunftkritik fortgeführt, sondern die deutsche Philosophiesprache, in Goethes Spuren, in den Rang von Weltliteratur gehoben – so Zimmer (2010:9). Ich möchte in Parenthese anmerken, dass es keinen namhaften Philosophen gibt, der nicht gut schreibt, dessen Schriften also keine literarischen Qualitäten aufweisen – schließlich ist das schlecht Gesagte lax gedacht, wie das Adorno (1990:29) so trefflich auf den Punkt gebracht hat. Schopenhauer ist ein ›philosophischer Weltbürger‹ (Zimmer 2010); Schopenhauers kulturelle Orientierung überschreitet die Grenzen seines Landes, ja er ist aus den Koordinaten der deutschen Geistesgeschichte nur unzureichend zu verstehen (s. Zimmer 2010:9). Durch keinerlei sprachliche Barrieren behindert, liest Schopenhauer die englische und französische Philosophie – Locke, Hume, Voltaire und Rousseau sind ihm bekannt. Nicht zu vergessen ist, dass Schopenhauer viele Jahre seiner Schulzeit in Frankreich und England verbrachte, daneben spricht er für damalige Gelehrte selbstverständlich Latein und Griechisch, Spanisch und Italienisch bringt er sich später bei; er liest jeden Tag die Times, und der Einfluss der romanischen Sprachen auf sein Werk lässt sich nicht leugnen; Calderón und Gracián waren ihm näher als die deutsche Literatur seiner Zeit; die französischen Moralisten, von La Rochefoucauld bis Seite | 13 Chamfort, haben Schopenhauers Denken geprägt, ebenso wie Voltaire und Rousseau (s. Zimmer 2010:11f). In der Nachfolge von Wolff und Kant setzt Schopenhauer die Anliegen der Aufklärung, die Tradition der clarté fort, dabei allerdings – und hierin liegt ja die erstgenannte Spannung – die Metaphysik nicht entthronend. Für Zimmer (2010:10f) ist es kein Zufall, dass Schopenhauer einer der weltweit am meisten gelesenen deutschen Philosophen ist, denn seine Philosophie verbindet »stringente Argumentation und Problemdiskussion mit dem Anspruch der Deutung der großen Sinnfragen«. Und weiter: »Betrachtet man sein Werk in einem internationalen Kontext, wird der vielseitig gebildete, weit gereiste, über Zeitläufe und Wissenschaften glänzend informierte Gelehrte sichtbar. Schopenhauer ist nicht nur der Erbe Kants und Goethes, sondern verbindet auch so gegensätzliche Traditionen wie den Idealismus Platons und den Empirismus David Humes. Er ist ein erfahrungsorientierter Visionär, ein Anhänger des Common Sense, der sich einer spirituellen Weltsicht öffnet, ein leidenschaftlicher Metaphysiker, der nie den Kontakt zur Wissenschaft verliert. Der Aufklärung hat er keineswegs abgeschworen, er hat sie vielmehr ergänzt und über sich selbst aufgeklärt. Schopenhauer bedauerte es zutiefst, dass die Vernunft sich fest im Griff des irrationalen Willens befand und nicht jene Kraft hatte, die ihr die Aufklärer des 18. Jahrhunderts zugeschrieben hatten.« (Zimmer 2010:11) Der philosophische Weltbürger ist aber auch der Sozialisation ein Grenzgänger. Während seine älteren Zeitgenossen, die das intellektuelle Klima in Deutschland maßgeblich prägten – Hölderlin, Schelling und Hegel –, ihre intellektuelle Sozialisation im Milieu des Tübinger Stifts, also in einem auf den Württemberger Pfarrnachwuchs ausgerichteten Theologiestudiums erhalten, wächst Schopenhauer im offenen Milieu von Danzig und Hamburg auf – »Städte mit einem selbstbewussten Bürgertum, Umschlagplätze für Waren und Ideen« (Zimmer 2010:12). Hinzu kommen die Aufenthalte in Frankreich und England, Schopenhauers Reisen nach Italien und schließlich die Wahl Frankfurts a.M. zu seinem späteren Wohnort, auch dieser eine freie Reichsstadt. Schopenhauer darf als ein ›wahrer Internationalist der deutschen Philosophie‹ (Zimmer 2010:12) gelten. Diese Verortung von Schopenhauers Denken ist mehr als nur eine Hintergrundinformation – in ihr liegt eine Neuinterpretation. Schopenhauer ist pessimistisch gestimmt – das ist nicht zu leugnen; aber er sollte nicht nur als Pessimist gelesen werden. »So tritt uns der Pessimist im Biedermaier-Interieur bei näherem Hinsehen in einer ganz anderen Gestalt entgegen: als ein Denker mit weitem Blick, der Hori- Seite | 14 zonte öffnet und kulturelle Grenzen überwindet, ein Denker, der die kritischen Traditionen der westlichen Philosophie bewahrt und diese gleichzeitig erweitert und bereichert.« (Zimmer 2010:12) Auf dem Weg zum besseren Bewusstsein – Immanuel Kant Am 7. Oktober 1809 macht sich Schopenhauer auf den Weg nach Göttingen, wo er sein Studium aufnimmt – Goethe hat ihm kein Empfehlungsschreiben auf den Weg mitgegeben, obwohl ihn Johanna Schopenhauer darum gebeten hat (s. Safranski 2010:154). Göttingen ist der Fixstern unter den deutschen Universitäten: 1734 gegründet, muss sich diese Universität nicht erst aus der theologischen Umklammerung befreien – die Naturwissenschaften geben seit der Gründung den Ton an (s. Safranski 2010:155). Während die Studentenschaft eher zum Lärmenden neigt, zählt sich Schopenhauer zu den ruhigeren Studenten und bildet in Göttingen seinen Lebensrhythmus aus, den er bis ins hohe Alter beibehalten wird: »Die frühen Morgenstunden werden für die anspruchsvolle geistige Arbeit genutzt, er entspannt sich beim Flötenspiel. Nachmittags unternimmt er größere Spaziergänge; abends besucht er das Theater oder gesellige Kreise.« (Safranski 2010:158) Während sich Schopenhauer die ersten drei Semester für die Naturwissenschaften und Medizin interessiert, inskribiert er im dritten Semester schließlich Philosophie; sein erster philosophischer Lehrer ist ein skeptischer Kantianer, Gottlob Ernst Schulze, und dieser macht Schopenhauer mit zwei Philosophen bekannt, die die Leitsterne für sein ganzes Leben bleiben werden: Platon und Kant. Wenden wir uns dem zweitgenannten zu. »Kant war die große Zäsur am Ende des 18. Jahrhunderts. Nach seinem Auftreten war im abendländischen Denken nichts mehr wie zuvor.« (Safranski 2010:163) »Es bleibt uns nichts anderes übrig, als die Philosophiegeschichte in die Zeit ›vor Kant‹ und ›nach Kant‹ einzuteilen, und wir denken alle, wenn nicht bloß Philosophiehistoriker sein wollen, ›nach Kant‹, d.h. unter Bedingungen, die er ermittelt und zu respektieren gelehrt hat.« (Schnädelbach 2005:8) Seite | 15 Kant (1724–1804) ist sich seiner Stellung in der Philosophiegeschichte im Klaren. Ähnlich wie Freud greift er auf Kopernikus zurück, um die Bedeutung der Kritik der reinen Vernunft herauszustreichen, die 1781 in der ersten und 1787 in der zweiten Auflage erscheint: »Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche, über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser Voraussetzung zunichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten […]. Es ist hiermit eben so, als mit den ersten Gedanken des Kopernikus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärungen der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen, und dagegen die Sterne in Ruhe ließ. In der Metaphysik kann man nun, was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen. Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müßte, so sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne; richtet sich aber der Gegenstand (als Objekt der Sinne) nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese Möglichkeit ganz wohl vorstellen.« (Kant 1988a:25) Kant will den ›Kampfplatz der endlosen Streitigkeiten‹ befrieden, er will die Fragen, die Vernunft zwar nicht beantworten kann, aber von denen sie ständig ›bedrängt‹ wird, einer Lösung zuführen, mit einem Wort: Kant will zeigen, dass Metaphysik als Wissenschaft nicht möglich ist. Für Kant (1988a:7, 338; Fußnote) hat die Metaphysik drei Themen, nämlich Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. In der Metaphysik geht es »um den lebendigen Mensch, der eine letzte Orientierung und Sinngebung sucht, der daher ›aus der Natur der allgemeinen Menschenvernunft‹ (B22) Fragen stellt, ›die durch keine Erfahrungsgebrauch der Vernunft … beantwortet werden können‹ (B21), sondern jenseits aller Erfahrung nur im metaphysischen Glauben an Gott, Freiheit und Unsterblichkeit Antwort finden« (Coreth & Schöndorf 1983:98). Diese drei Themen entspre- Seite | 16 chen der ›metaphysica specialis‹, worin Kant seinem Lehrer Christian Wolff (1679-1754) folgt. Dieser untergliedert die Metaphysik in ›metaphysica specialis‹ mit den drei Disziplinen Psychologie, Kosmologie und Theologie, und in ›metaphysica generalis‹, die die Grundlagen des Seins klärt und seit Wolff auch Ontologie genannt wird. Kants Strategie bei der Klärung des wissenschaftlichen Status der Metaphysik ist durch und durch aufklärerisch: Kant strebt eine ›Selbsterkenntnis der Vernunft‹ an. Diese Selbsterkenntnis ist durchgeführt als ›Kritik der reinen Vernunft‹, wobei die Vernunft zugleich Subjekt und Objekt der Kritik ist. Dabei greift Kant auf die eigentliche Bedeutung von ›Kritik‹ zurück – das griechische Verb ›krinein‹ heißt so viel wie ›scheiden, unterscheiden, urteilen, beurteilen‹ (s. Schnädelbach 2005:33). »Ich verstehe aber hierunter nicht eine Kritik der Bücher und Systeme, sondern die des Vernunftvermögens überhaupt, in Ansehung aller Erkenntnisse, zu denen sie, unabhängig von aller Erfahrung, streben mag, mithin die Entscheidung der Möglichkeit oder Unmöglichkeit eine Metaphysik überhaupt und die Bestimmung so wohl der Quellen, als des Umfanges und der Grenzen derselben, alles aber aus Prinzipien.« (Kant 1988a:13) Die erste Frage, die sich hier stellt, lautet, wie Kant überhaupt dazu kommt, nach Erkenntnissen zu fahnden, die vor der Gegenstandserkenntnis liegen. Warum sollte die Naturwissenschaft dadurch gesichert werden, dass die Vernunft die Bedingung der Möglichkeit einsieht, nach denen sich die Gegenstände zu richten haben? Geht Wissenschaft nicht ›objektiv‹ vor? Richtet sich wissenschaftliche Erkenntnis nicht nach den Objekten ihre Forschung? Nun – Kant betrachtet die Forschungspraxis von Galilei und verneint die letzten beiden Fragen umstandslos. Die Großtat von Galileo Galilei (1564-1642) ist: Er formuliert ein Gesetz, das von der Empirie unabhängig ist – die gleichförmige Bewegung ist der Normalzustand eines Körpers, für den es keines Kraftaufwands bedarf. (Zu dieser Einsicht gelangt Galilei 1638, begründet damit die Kinematik; später, 1687, wird Newton diese Einsicht als ›lex prima‹ oder Trägheitsgesetz reformulieren.) Für Aristoteles (384 bis 322 v. Chr.) sieht die Sachlage anders aus: In dessen geordnetem Universum hat jeder Körper die innere Tendenz, sich in natürlicher Bewegung dem ihm zukommenden Ort zu nähern: Das Leichte strebt nach oben, das Schwere nach unten. Folglich sind die Gegenstände, so sie nicht von außen bewegt werden, in Ruhe. Dieser aristotelische Gedanke ist ›empirisch‹ gewonnen (besser: entspricht unseren lebensweltlichen Erfahrungen); die Ansicht des Galilei von der uniformen gleichmäßigen Bewegung hingegen nicht: Wir können die Dinge fallen und dann ruhen sehen, wir werden aber nie uniforme Seite | 17 gleichmäßige Bewegung sehen. Schreibt man den Dingen zunächst die Bewegtheit zu, dann öffnet sich ein weiter Fragenraum, nämlich: warum sehen wir so wenig Bewegung? Die Antworten darauf sind in der Kinematik, der physikalischen Bewegungslehre, ausgearbeitet (s. Cassirer 1923:157; s. auch Strauss 2005:77ff). Galilei lässt keinen Zweifel daran, dass seine Gesetze ›mente concipio‹ sind – das Bewegungsgesetz ist nicht aus einer besonderen Klasse empirisch wirklicher Bewegungen hervorgegangen. Der Begriff der geradlinigen und gleichförmigen Bewegung wird in abstrakt-phoronomischer Bedeutung eingeführt und ist auf die ideellen Schemata der Geometrie und der Arithmetik bezogen (s. Cassirer 1923:233). Kant kommentiert Galileis Leistung wie folgt: »Als Galilei seine Kugeln die schiefe Fläche mit einer von ihm selbst gewählten Schwere herabrollen […] ließ […]: so ging allen Naturforschern ein Licht auf. Sie begriffen, daß die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt, daß sie mit Prinzipien ihrer Urteile nach beständigen Gesetzen vorangehen und die Natur nötigen müssen, auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber sich von ihr allein gleichsam am Leitbande gängeln lassen müsse […]. Die Vernunft muß mit ihren Prinzipien, nach denen allein übereinkommende Erscheinungen für Gesetze gelten können, in einer Hand, und mit dem Experiment, das sie nach jenen ausdachte, in der anderen, an die Natur gehen, zwar um von ihr belehrt zu werden, aber nicht in der Qualität eines Schülers, der sich alles vorsagen läßt, was der Lehrer will, sondern eines bestallten Richters, der die Zeugen nötigt, auf die Fragen zu antworten, die er ihm vorlegt. […] Hierdurch ist die Naturwissenschaft allererst in den sicheren Gang einer Wissenschaft gebracht worden, da sie so viel Jahrhunderte durch nichts weiter als ein bloßes Herumtappen war.« (Kant 1988a:24) Die Natur ist also vor den ›Richterstuhl der Vernunft‹ zu zitieren. Die empirische Wissenschaft ist deswegen empirisch, weil sie ihre eigenen Entwürfe experimentell überprüft; sie ist nicht deswegen empirisch, weil sie sich einer Nachzeichnung der natürlichen Abläufe und Ereignisse verschreibt. Kant formuliert damit nicht nur eine bis heute gültige Einsicht der Wissenschaftstheorie, sondern nimmt es auch auf sich, diese Forschungsstrategie auf die Vernunft selbst anzuwenden – schließlich soll der Kampfplatz der Metaphysik befriedet werden. Trotz aller Hochschätzung der Leistung Kants – die Befriedung ist ihm nicht gelungen, und sein gelehriger Schüler, Schopenhauer, dient dafür als Beispiel (neben Fichte, Hegel, Schelling und vielen anderen, die sich auf diesem Kampfplatz tummeln). Seite | 18 »[S]o klingt es zwar anfangs befremdlich, ist aber nichts desto weniger gewiß, wenn ich […] sage: der Verstand schöpft seine Gesetze nicht (a priori) aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor.« (Kant 1988b:189) *** Die Grundfrage der Kritik der reinen Vernunft lautet, wie Metaphysik als Wissenschaft möglich ist bzw. wie synthetische Urteile a priori möglich sind (s. Kant 1988a:58f). Damit sind zwei Begriffspaare angesprochen, die noch vor der Zergliederung der Vernunft in ihre Teilbereiche zu diskutieren sind: analytischsynthetisch, a priori/a posteriori. Ein Urteil a priori ist ein Urteil, das nicht empirisch gewonnen ist, das also ›rein‹ von anschaulichem Material ist; ein Urteil a posteriori ist ein empirisches Urteil. Der Unterschied zwischen apriorischen und aposteriorischen Urteilen liegt in der Erfahrung: Was aus der Erfahrung stammt, ist ›a posteriori‹, was ihr zugrunde liegt oder als Bedingung ihrer Möglichkeit vorausgeht, ist ›a priori‹ (s. Coreth & Schöndorf 1983:97). Dass es Kant um apriorische Urteile geht, also um Urteile vor der Erfahrung, macht die Grundfragen bereits klar – die Fragen nach Gott und nach der Unsterblichkeit der Seele sind nun einmal empirisch nicht zu beantworten. In den berühmten Einleitungsworten der Kritik der reinen Vernunft fasst Kant die Unterscheidung von apriorischen und aposteriorischen Erkenntnissen, gemäß den zwei Quellen der Erkenntnis, wie folgt: »Daß alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel; denn wodurch sollte das Erkenntnisvermögen sonst zur Ausübung erweckt werden, geschähe es nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne rühren und teils von selbst Vorstellungen bewirken, teils unsere Verstandestätigkeit in Bewegung bringen […] und so den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Erkenntnis der Gegenstände zu verarbeiten, die Erfahrung heißt? Der Zeit nach geht also keine Erkenntnis in uns vor der Erfahrung vorher, und mit dieser fängt alle an. Wenn aber gleich all unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung. Denn es könnte wohl sein, daß selbst unsere Erfahrungserkenntnis ein Zusammengesetztes aus dem sei, was wir durch Eindrücke empfangen, und dem, was unser eigenes Erkenntnisvermögen (durch sinnliche Eindrücke bloß veranlaßt) aus sich selbst hergibt, welchen Zusatz wir von jenem Grundstoffe nicht eher unterscheiden, als bis lange Übung uns darauf aufmerksam und zur Absonderung desselben geschickt gemacht hat. Es ist also wenigstens eine der näheren Untersuchung noch benötigte und nicht auf den ersten Anschein sogleich abzufertigende Frage: ob es ein dergleichen von der Erfahrung und selbst von allen Eindrücken der Sinne unabhängiges Erkenntnis gebe. Man nennt solche Erkenntnisse a priori, und unterscheidet sie Seite | 19 von den empirischen, die ihre Quelle a posteriori, nämlich in der Erfahrung, haben.« (Kant 1988a:45) Die Frage nach Erkenntnissen a priori ist die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis. Dass es Erkenntnis gibt, ist gewiss – wir machen sie ständig; aber was ist die Bedingung dafür, dass Erkenntnis möglich ist? Was ist das Apriori unserer Erkenntnis? Wenn man in dieser Weise fragt, dann betreibt man eben – ›Transzendentalphilosophie‹. Dabei sollte ›transzendental‹ keineswegs mit ›transzendent‹ verwechselt werden. Während dieses ›übersteigend‹ bedeutet (in diesem Sinn ist Gott transzendent – er übersteigt die Welt), bedeutet jenes so viel wie ›erkenntnisstiftend‹. Philosophie, die die Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis vor dem tatsächlichen Erkenntnis-machen formuliert, steht in Kants Schuhen und ist Transzendentalphilosophie. »Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht so wohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, so fern diese a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt. Ein System solcher Begriffe würde Transzendental-Philosophie heißen.« (Kant 1988a:63) Kants Transzendentalphilosophie dient der ›Läuterung unserer Vernunft‹ und soll sie ›von Irrtümern frei halten‹ (Kant 1988a:63); insofern »ist die Transzendental-Philosophie eine Weltweisheit der reinen bloß spekulativen Vernunft« (Kant 1988a:65). Die zweite, oben bereits angesprochene Begriffsunterscheidung ist diejenige von analytischen und synthetischen Urteilen. »Analytische Urteile sagen im Prädikat nichts, als das, was im Begriffe des Subjekts schon wirklich, obgleich nicht so klar und mit gleichem Bewußtsein gedacht war. Wenn ich sage: alle Körper sind ausgedehnt, so habe ich meinen Begriff vom Körper nicht im mindesten erweitert, sondern ihn nur aufgelöset, indem die Ausdehnung von jenem Begriffe schon vor dem Urteile, obgleich nicht ausdrücklich gesagt, dennoch wirklich gedacht war; das Urteil ist also analytisch. Dagegen enthält der Satz: einige Körper sind schwer, etwas im Prädikate, was in dem allgemeinen Begriffe vom Körper nicht wirklich gedacht wird, er vergrößert also meine Erkenntnis, indem er zu meinem Begriffe etwas hinzutut, und muß daher ein synthetisches Urteil heißen.« (Kant 1988b:125) Analytische Urteile sind Zergliederungsurteile, die im Prädikat das explizieren, was im Gegenstand bereits enthalten ist. Synthetische Urteile sind Erweiterungsurteile. Dass analytische Urteile a priori möglich sind, ist leicht einzusehen. Kants Beispiel aus der Kritik der reinen Vernunft lautet: Der Kreis ist rund. Die Rund- Seite | 20 heit liegt bereits im Kreisbegriff, daher ist es ohne Empirie möglich, die Rundheit auszusagen. Für Kant sind analytische Urteile auch dann apriorisch, wenn sie sich auf Empirisches beziehen: »[Z].B. Gold ist ein gelbes Metall; denn um dieses zu wissen, brauche ich keiner weitern Erfahrung, außer meinem Begriffe vom Golde, der enthielte, daß dieser Körper gelb und Metall sei.« (Kant 1988b:126) Aber wie sollen Erweiterungsurteile a priori möglich sein? Grundsätzlich gibt es für Kant synthetische Urteile a priori, und zwar in der Mathematik: 7 + 5 = 12. »Man sollte anfänglich denken: daß der Satz 7 + 5 = 12 ein bloß analytischer Satz sei, der aus dem Begriffe einer Summe von Sieben und Fünf nach dem Satze des Widerspruchs erfolge. Allein, wenn man es näher betrachtet, so findet man, daß der Begriff der Summe von 7 und 5 nichts weiter enthalte, als die Vereinigung beider Zahlen in eine einzige, wodurch ganz und gar nicht gedacht wird, welches diese einzige Zahl sei, die beide zusammenfaßt. Der Begriff von Zwölf ist keinesweges dadurch schon gedacht, daß ich mir bloß jene Vereinigung von Sieben und Fünf denke, und, ich mag meinen Begriff von einer solchen möglichen Summe noch so lange zergliedern, so werde ich doch darin die Zwölf nicht antreffen. Man muß über diese Begriffe hinausgehen […].« (Kant 1988b:127f) Mit diesen Grundunterscheidungen ausgerüstet, ist es nun gut möglich, die Struktur der Kritik der reinen Vernunft wiederzugeben. Kant ist vom Grundsatz geleitet, dass alle Erkenntnis ›Synthesis des Mannigfaltigen‹ (B103) ist. Das ungeordnete Material der Sinneseindrücke muss zur Einheit gebracht werden, wodurch der Gegenstand konstituiert und damit ›als Gegenstand erkannt‹ wird. Die ›Dinge an sich‹ affizieren die Sinne und rufen eine vielfältige Fülle von Sinneseindrücken hervor – die Einwirkung der Gegenstände auf die Sinne als ›Affektion‹ (mit dem dazugehörigen Verb ›affizieren‹) zu bezeichnen geht übrigens auf Descartes Büchlein Les passions de l’âme zurück. Diese Fülle muss nun strukturiert bzw. vereinigt werden, und die Einigung oder ordnende Formung ist die Leistung des erkennenden Subjekts (=das transzendentale Subjekt, ≠ empirisches Subjekt). Alle Synthesis des Mannigfaltigen setzt ein vorgängiges Prinzip der Einheit voraus, wodurch und woraufhin die Einigung geschieht. Der Vollzug der Erkenntnis muss durch apriorische Formen bedingt und bestimmt sein, denen wesentlich eine synthetische, Einheit-stiftende Funktion zukommt. Das gilt von beiden Quellen der Erkenntnis, der Sinnlichkeit und des Verstandes, der Rezeptivität und der Spontaneität. Aber auch die Ideen der reinen Vernunft haben synthetische Funktion – wenngleich nicht konstitutiv, so doch regulativ. Strukturell bedeutet dies zunächst eine Zweiteilung, die Analyse der Sinnlichkeit und eine Analyse des Verstandes. Reine Sinnlichkeit und das Urteilen Seite | 21 des Verstandes sind die ersten beiden Bereiche, in die sich die Vernunft in ihrer Kritik/Unterscheidung differenziert. Bezüglich dieser ersten beiden Bereiche schreibt Kant die berühmten Zeilen: »Unsre Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts, deren die erste ist, die Vorstellungen zu empfangen (die Rezeptivität der Eindrücke), die zweite das Vermögen, durch diese Vorstellungen einen Gegenstand zu erkennen (Spontaneität der Begriffe); durch die erstere wird uns ein Gegenstand gegeben, durch die zweite wird dieser im Verhältnis auf jene Vorstellung (als bloße Bestimmung des Gemüts) gedacht. Anschauung und Begriffe machen also die Elemente aller unsrer Erkenntnis aus, so daß weder Begriffe, ohne ihnen auf einige Art korrespondierende Anschauung, noch Anschauung ohne Begriffe, ein Erkenntnis abgeben können.« (Kant 1988a:97) In der ›Transzendentalen Ästhetik‹ arbeitet Kant die sinnlichen Bedingungen der Gegenstandserkenntnis heraus. Leitend ist die Frage: Welche sinnliche Eigenschaften lassen sich von keinem Ding wegdenken und kommen daher nicht den Dingen als solchen zu, sondern der menschlichen Sinnlichkeit? Was ist also die subjektive Zugabe, die die Bedingung der sinnlichen Affektion ermöglicht? Kant nennt zwei Formen der Sinnlichkeit, die rein sind, die also »abgesondert von aller Empfindung« (Kant 1988a:70) betrachtet werden können: Raum und Zeit bzw. äußere und innere Anschauungsform. »Vermittelst des äußeren Sinnes (einer Eigenschaft unsres Gemüts) stellen wir uns Gegenstände als außer uns, und diese insgesamt im Raume vor. Darinnen ist ihre Gestalt, Größe und Verhältnis gegen einander bestimmt, oder bestimmbar. Der innere Sinn, vermittelst dessen das Gemüt sich selbst, oder seinen inneren Zustand anschauet, gibt zwar keine Anschauung von der Seele selbst, als einem Objekt; allein es ist doch eine bestimmte Form, unter der die Anschauung ihres inneren Zustandes allein möglich ist, so, daß alles, was zu den innern Bestimmungen gehört, in Verhältnissen der Zeit vorgestellt wird.« (Kant 1988a) Raum und Zeit sind wichtige Bestimmungsstücke der Erkenntnis. Kant nimmt eine besondere Zuspitzung vor und bezeichnet die beiden als reine Anschauungsformen, die nicht dem affizierenden Material zukommen, sondern ausschließlich auf der Seite des (transzendentalen) Subjekts zu verbuchen sind. Der Raum ist kein empirischer Begriff, der von äußeren Erfahrungen abgezogen wird (s. Kant 1988a:72); der Raum ist subjektiv, eine reine Anschauungsform des transzendentalen Subjekts. Ebenso verhält es sich mit der Zeit, der inneren Anschauungsform; sie ist subjektiv. Allerdings gilt für Raum und Zeit, dass sie eben nicht nur subjektiv sind: Weil sie transzendentalsubjektiv sind, sind sie zugleich objektiv. Bezogen auf die Zeit liest sich das bei Kant wie folgt: Seite | 22 »Die Zeit ist also lediglich eine subjektive Bedingung unserer (menschlichen) Anschauungen (welche jederzeit sinnlich ist, d.i. so fern wir von Gegenständen affiziert werden), und an sich, außer dem Subjekte, nichts. Nichts desto weniger ist sie in Ansehung aller Erscheinungen, mithin auch aller Dinge, die uns in der Erfahrung vorkommen können, notwendiger Weise objektiv.« (Kant 1988a:82) Die Behauptung, dass die Zeit eine subjektive Anschauungsform und zugleich objektiv von den Erscheinungen gilt, verwirrt zunächst. Allerdings kommt hier ein Kerngedanke der Kritik der reinen Vernunft zum Ausdruck, nämlich jener, dass uns ›Dinge-an-sich‹ affizieren, aber dass wir ›Erscheinungen‹ erkennen. »Wir können nicht sagen: alle Dinge sind in der Zeit […]. Wird nun die Bedingung zum Begriffe hinzugefügt, und es heißt: alle Dinge, als Erscheinungen (Gegenstände der sinnlichen Anschauung), sind in der Zeit, so hat der Grundsatz seine gute objektive Richtigkeit und Allgemeinheit a priori.« (Kant 1988a:82) Die Unterscheidung von ›Ding an sich‹ und ›Erscheinung‹ bzw. von ›Dingen an sich‹ und ›Erscheinungen‹ – das Ding an sich kommt bei Kant meist im Plural vor (s. Schnädelbach 2005:36) – ist für Kants Philosophie von entscheidender Bedeutung, und Schopenhauer ist davon fasziniert. Was bei Kant als Erscheinung auftritt, wird bei Schopenhauer zur Vorstellung. Die Dinge an sich sind »die Gegenstände unserer Erkenntnis, wie sie sein mögen, unabhängig davon, dass und wie wir sie erkennen können; in diesem Sinn sind sie in der Tat etwas bloß Gedachtes oder Noumena. Die Gegenstände hingegen, die wir tatsächlich zu erkennen vermögen, haben wir nicht unabhängig davon vor uns, dass und wie wir sie erkennen können; sie unterstehen den Bedingungen, unter denen unsere Erkenntnis allein möglich ist.« (Schnädelbach 2005:36) Die Ummodelung des Dings an sich zur Erscheinung passiert in zwei Schritten. Die Dinge an sich affizieren/beeinflussen die Sinne (hier darf keineswegs an eine kausale Beeinflussung gedacht werden!). Modern (und etwas verfälschend) ließe sich sagen: Eine Überfülle an Information bestürzt die sinnlichen Kanäle. Die Information muss gebündelt und strukturiert werden, wobei im ersten Schritt die Information nach Raum und Zeit gebündelt/strukturiert wird. Im zweiten Schritt kommen die Begriffe zur Anwendung. Das Vermögen der Begriffe bzw. die Spontaneität ist die Angelegenheit der zweiten Quelle, aus der Erkenntnis entspringt, nämlich die des Verstandes. Wie die reine Sinnlichkeit ist der Verstand ein Vermögen der Vernunft. »Unsre Natur bringt es so mit sich, daß die Anschauung niemals anders als sinnlich sein kann, d.i. nur die Art enthält, wie wir von den Gegenständen affiziert werden. Dagegen ist das Vermögen, den Gegenstand sinnlicher Anschauung zu denken, der Verstand. Keine dieser Eigenschaften ist der anderen vorzuziehen. Seite | 23 Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben, und ohne Verstand keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. […] Nur daraus, daß sie sich vereinigen, kann Erkenntnis entspringen.« (Kant 1988a:98) In der ›Transzendentalen Logik‹ legt Kant sein Verständnis des Verstandes dar. Der Verstand ist ein nichtsinnliches Erkenntnisvermögen (s. Kant 1988a:109), der sich nicht affizieren lässt, sondern der auf begrifflichen Funktionen beruht. Kant definiert Funktion als »die Einheit der Handlung, verschiedene Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen zu ordnen« (Kant 1988a:109f) Der Verstand vollzieht diese ›Handlungen‹, indem er urteilt. Das Urteil bezieht sich natürlich niemals auf das Ding an sich, sondern auf die Vorstellungen, die das transzendentale Subjekt durch Form und Zeit für die Beurteilung bereits synthetisiert hat. »Wir können aber alle Handlungen des Verstandes auf Urteile zurückführen, so daß der Verstand überhaupt als ein Vermögen zu urteilen vorgestellt werden kann. […] Denken ist das Erkenntnis durch Begriffe. Begriffe aber beziehen sich, als Prädikate möglicher Urteile, auf irgend eine Vorstellung von einem noch unbestimmten Gegenstande.« (Kant 1988a:110) Kants Begriffe leitet er aus der Urteilstafel ab, also aus dem systematischen Überblick über alle Funktionen des Verstandes bzw. aus den Verstandesformen. Alle Urteile lassen sich nach vier Kriterien einteilen, nämlich (i) Quantität, (ii) Qualität, (iii) Relation und (iv) Modalität. Es gibt, unter (i) subsumiert, allgemeine, besondere und einzelne Urteile, unter (ii) subsumiert, bejahende, verneinende und unendliche Urteile, unter (iii) subsumiert, kategorische, hypothetische und disjunktive Urteile, unter (iv) subsumiert, problematische assertorische und apodiktische Urteile. Der Verstand urteilt über das mannigfach in der Anschauung Gegebene mittels dieser Urteilsformen. Kant modelt an den Urteilen noch etwas herum und gelangt zur Feststellung, dass der Verstand gemäß der ›Verstandesbegriffe‹ oder ›Kategorien‹ seine Funktion erfüllt (Kant 1988a:118). Die Kategorientafel lässt sich wie folgt veranschaulichen: Seite | 24 Quantität Qualität Einheit Realität Vielheit Negation Relation Modalität der Inhärenz und Subsistenz Möglichkeit – Un- (substantia et accidens) möglichkeit der Kausalität und Dependenz (Ursache und Wirkung) der Gemeinschaft (Wechselwir- Allheit Limitation kung zwischen dem Handelnden und leidenden) Dasein – Nichtdasein Notwendigkeit – Zufall aus: Kant (1988a:118) Wie Kant (1988a:121) anmerkt, sind die Kategorien der ersten beiden Abteilungen auf Gegenstände der Anschauung gerichtet, und die Kategorien der anderen beiden Abteilungen auf die Existenz dieser Gegenstände, entweder in Beziehung aufeinander oder auf den Verstand. Diese Begriffe a priori müssen von empirisch gewonnenen Begriffen unterschieden werden (wie z.B. ›Nadelbaum‹). In den empirischen Begriffen halten wir bestimmte Merkmale von Gegenstandsarten oder -klassen fest, die wir aus der Erfahrung kennen. Kants These lautet, dass drin immer auch Begriffe enthalten sind, die nicht aus der Erfahrung stammen. »Haben wir etwa einen Nadelbaum vor uns, so fassen wir ihn als einen und nur einen Gegenstand auf, der soundso beschaffen ist, der eine Zeit lang derselbe bleibt und der tatsächlich vor uns steht; wir bringen somit Vorstellungen von Quantität, Qualität, Substanzialität und Wirklichkeit ins Spiel, die deswegen nicht empirisch sein können, weil sie Voraussetzungen dafür sind, dass wir überhaupt einen identifizierbaren Gegenstand, also einen Nadelbaum, vor uns haben, und nicht eine ungeordnete, chaotische Menge von Einzeleindrücken« (Schnädelbach 2005:59) Safranski (2010:168) bezeichnet die Darstellung der ersten beiden Vermögen der Kantischen Vernunftkritik, reine Sinnlichkeit und Verstand, als »rokokohaft konstruierte Spieluhr unseres Wahrnehmungs- und Erkenntnisvermögens mit den verschiedenen Urteilsarten, an denen dann die Greifarme der jeweils drei Kategorien befestigt sind«. Als Resultat dieser Spieluhr, dieser transzendentalen Mechanik wird das Ding an sich zur Erscheinung bzw. der Gegenstand der Erkenntnis. Der Verstand ist ›gegenstandskonstitutiv‹ (bzw. nur ›konstitutiv‹) – auf Basis des in den Anschauungsformen rezipierten und (anschaulich) synthetisierten Materials nimmt er eine urteilende Synthesis gemäß der Kategorien vor und lässt somit den Gegenstand entstehen; was die An- Seite | 25 schauungsformen sinnlich ordnen, bringen die Verstandesformen auf den Begriff. Allerdings: Genau gesprochen konstituiert der Verstand nicht den Gegenstand, sondern die Gegenständlichkeit des Gegenstandes; der Verstand erschafft den Gegenstand nämlich nicht (dieser ist Ding an sich), sondern bloß die Art und Weise, wie wir ihn erkennen – und wir erkennen die Dinge an sich als Gegenstände. Eine besondere Stellung in der Kategorientafel fällt übrigens der Kausalität zu, in der Abteilung ›Relation‹ die zweitgenannte. Um es in aller Kürze anzusprechen: David Hume (1711-1776) hat in Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand (erstmals 1748 erschienen) geleugnet, dass es Kausalität gibt. Wir neigen zwar dazu, dass wir von einem kausalen Einfluss ausgehen, wenn eine Billardkugel die andere anstößt und diese dann ins Rollen kommt; allerdings sehen wir bloß zwei Ereignisse, die nacheinander auftreten, und Hume – als Empirist – besteht darauf, dass nur das zählt, was wir beobachten. Außer Zweifel steht nun, dass sich Kausalität nicht beobachten lässt, woraus Hume den Schluss zieht, dass es keine Kausalität gibt, sondern (bloß) eine zur Gewohnheit stabilisierte Assoziation des menschlichen Verstandes. Diese Ableugnung der Kausalität, auf deren Existenz die moderne Naturwissenschaft beruht, hat Kant aus seinem dogmatischen Schlummer gerissen. Die Kausalität rettet Kant als eine Kategorie – das ist die erste Rettung, die die Kritik der reinen Vernunft anstrebt. »Ein Vorgang folgt einem anderen, doch können wir niemals eine Bindung zwischen ihnen beobachten; sie scheinen verbunden (conjoinded), doch nie verknüpft (connected). Und da wir keine Vorstellung von etwas haben können, das sich niemals unseren äußeren oder inneren Wahrnehmung darbot, so scheint die notwendige Schlußfolgerung zu sein, daß wir überhaupt keine Vorstellung des Zusammenhanges oder der Kraft haben […].« (Hume 1990:99) »Als ein Mensch zu ersten Male die Mitteilung der Bewegung durch Stoß beobachtete, etwa beim Aufeinanderprallen zweier Billardbälle, konnte er nicht sagen, daß das eine Ereignis mit dem anderen verknüpft war, sondern nur, daß es mit ihm verbunden war. Hat er mehrere derartige Fälle beobachtet, erklärt er sich für verknüpft. […] Sagen wir deshalb, ein Gegenstand sei mit einem anderen verknüpft, so meinen wir nur, daß sie in unserem Denken eine Verknüpfung erlangt haben und einen Schluß veranlassen, durch den sie zu Beweisen ihres beiderseitigen Daseins werden.« (Hume 1990:100f) »Das ist alles.« (Hume 1990:100) »Ich gestehe frei: die Erinnerung des David Hume war eben dasjenige, was mir vor vielen Jahren zuerst den dogmatischen Schlummer unterbrach […].« (Kant 1988b:118) Seite | 26 *** Mit den ersten beiden Vernunftvermögen (reine Anschauung und Verstand) ist Kants Analyse der Vernunft nicht abgeschlossen: Einbildungskraft, Urteilskraft, der transzendentale Schematismus, die transzendentale Apperzeption ebenso wie die regulativen Vernunftideen gälte es noch zu erwähnen. Allein – für das Verständnis von Schopenhauers Denken ist dies nicht notwendig. Schopenhauer ist von Raum, Zeit und der Kausalität angetan – den Rest von Kants Erkenntnisvermögen thematisiert Schopenhauer selten. Aber die Trennung von Ding an sich und Erscheinung ist das Grundelement in Schopenhauers Philosophie. Schopenhauer hat in seinen frühen Tagebuchnotizen den Erscheinungsstatus der Gegenstände im Unterschied zum Status als ›ignotum X‹ der ›Dinge an sich‹ schon früh durchschaut – er sieht darin ein frivoles Spiel. In einer Randglosse notiert Schopenhauer: »Epikur ist der Kant der praktischen Philosophie, wie Kant der Epikur der spekulativen.« (zit. nach Safranski 2010:162) Epikur (341-271), dessen hedonistische Lebensweisheit Horaz mit den Worten ›Carpe diem!‹ auf den Punkt gebracht hat, hat die Existenz der Götter auf sich beruhen lassen. Epikur löst die praktische Sittlichkeit von himmlischen Verpflichtungen und Versprechungen. Das diesseitige Glücksstreben steht für den Hedonisten im Mittelpunkt einer pragmatischen Lebensweisheit. Göttern wird kein absoluter, sondern nur ›als-ob‹-Geltung zugebilligt – spielen sie für das Glück eine Rolle, dann soll man sich ihrer bedienen, ganz im Sinne einer lebensfreundlichen Fiktion. Die Unerkennbarkeit des Dings an sich spielt, so Schopenhauers Einsicht, bei Kant eine ähnliche Rolle wie bei Epikur die Götter (s. Safranski 2010:162). »Das ›Ding an sich‹ ist nun auf eine weitaus radikalere Weise unbekannt, als es etwas sein kann, das nur ›noch nicht‹ bekannt ist. Das ›Ding an sich‹ ist der Name für jenes Unbekannte, das wir paradoxerweise erst erzeugen, indem wir uns etwas bekannt machen; es ist der Schatten, den wir werfen. Wir können alles nur in dem erfassen, was es für uns ist. Was die Dinge ›an sich‹ sind, unabhängig von den ›Organen‹, mit denen wir sie uns vorstellen, das muß uns immer entgleiten. Das Sein ist ›Vorgestellt-Sein‹. Mit dem ›Ding an sich‹ war eine neuartige Transzendenz am Horizont erschienen; keine Transzendenz des alten Jenseits, sondern eine Transzendenz, die nicht mehr, aber auch nicht weniger ist als die immer unsichtbare Rückseite aller Vor-Stellungen.« (Safranski 2010:171) Kant hat ›mit großer Gelassenheit‹ (Safranski 2010:171) am Ding an sich nicht weiter herumgedeutelt. Er behandelt die Erscheinungen tatsächlich als-ob sie Dinge an sich sind – und zwar so lange, wie er erkenntnistheoretisch unterwegs ist; geht es um die Freiheit, dann wird die Unterscheidung von Ding an sich und Seite | 27 Erscheinung wieder prominent diskursiv eingesetzt. In seinem wohleingerichteten Gebäude hinterlässt Kant mit dem Ding an sich »ein Loch, durch das beunruhigende Zugluft hereinkam« (Safranski 2010:172). Die kantischen Erscheinungen lassen sich als scheinhafte Fassade verstehen, hinter der sich die Dinge an sich verbergen; hierin liegt nicht nur für manche Romantiker, sondern auch für viele Esoteriker eine Faszination – hinter der Alltagswirklichkeit, die bloße Erscheinung ist, liegt eine geheimnisvolle Hinterwelt, das Reich der Dinge an sich. Schopenhauer wird sich darum bemühen, das Loch im Kantischen Gebäude zu schließen. Abschließend noch eine Bemerkung zu einem wichtigen Motiv der Kritik der reinen Vernunft – und damit ist die zweite Rettung angesprochen, die Kant ins Werk setzt. Kant hat im Zeitalter der aufblühenden Wissenschaft geschrieben, die die Lebenswelt immer stärker in Kausalbeziehungen auflöst. Kants Grundproblem ist bis heute nicht gelöst, und es lautet: Angesichts der wissenschaftlichen Erkenntnisse – wie lässt sich menschliche Freiheit behaupten? Frei-Sein bedeutet nämlich, nicht in einer Kausalkette zu stehen. Angesichts des naturwissenschaftlichen Weltbilds gibt es kein Ereignis, das außerhalb der kausalen Geschlossenheit steht. In diesem Weltbild ist der Mensch nicht frei; die Kausalketten sind in seinem Fall nur sehr kompliziert. Kant will die Freiheit des Menschen retten, ihn als ›Bürger zweier Welten‹ sehen – einerseits als Bürger der Natur, andererseits als Bürger einer noumenalen Welt, die der Kausalität nicht unterworfen ist. »Die Freiheit im praktischen Verstande ist die Unabhängigkeit der Willkür von der Nötigung durch Antriebe der Sinnlichkeit. Denn eine Willkür ist sinnlich, so fern sie pathologisch (durch Bewegursachen der Sinnlichkeit) affiziert ist; sie heißt tierisch (arbitrium brutum), wenn sie pathologisch nezessitiert werden kann. Die menschliche Willkür ist zwar ein arbitrium sensitivum, aber nicht brutum, sondern liberum, weil Sinnlichkeit ihre Handlung nicht notwendig macht, sondern dem Menschen ein Vermögen bewohnt, sich unabhängig von der Nötigung durch sinnliche Antriebe, von selbst zu bestimmen.« (Kant 1988a:489) Die Vernunft ist also ein Vermögen, das unabhängig von empirischen Bedingungen eine Reihe von Begebenheiten von selbst anzufangen, »so, daß in ihr selbst nichts anfängt, sondern sie, als unbedingte Bedingung jeder willkürlichen Handlung, über sich keine der Zeit nach vorhergehende Bedingungen verstattet, indessen daß doch ihre Wirkung in der Reihe der Erscheinungen anfängt, aber darin niemals einen schlechthin ersten Anfang ausmachen kann« (Kant 1988a:503). Seite | 28 Als körperliches Wesen ist der Mensch den Vernunftbegriffen unterworfen, und in dieser Perspektive lassen sich seine Handlungen nur als kausal verursacht auffassen; gleichzeitig ist der Mensch aber auch Ding an sich, und unter diesen Vorzeichen ist sein Handeln intelligibel, also nicht nach Kausalgesetzen gesteuert. Als Ding als sich ist der Mensch frei, Bürger der noumenalen Welt. Die Kausalität wird durch die Trennung von Ding an sich und Erscheinung von der Freiheitsfrage abgezogen, und Kant kann die Behauptung aufrecht erhalten, dass der Mensch frei ist. Es dürfte sich nicht mehr paradox anlesen, dennoch sind folgende Worte Kants derart treffend formuliert, dass man sie zumindest zweimal lesen muss: »Die Vernunft ist also die beharrliche Bedingung aller willkürlichen Handlungen, unter denen der Mensch erscheint. Jede derselben ist im empirischen Charakter des Menschen vorher bestimmt, ehe noch als sie geschieht. In Ansehung des intelligibelen Charakters, wovon jener nur das sinnliche Schema ist, gilt kein Vorher, oder Nachher, und jede Handlung, angesehen des Zeitverhältnisses, darin sie mit anderen Erscheinungen steht, ist die unmittelbare Wirkung des intelligibelen Charakters der reinen Vernunft, welche mithin frei handelt […].« (Kant 1988a:502) Seite | 29 Zweite Vorlesung Auf dem Weg zum besseren Bewusstsein – Platon Der Korpus von transzendentalen Urteilen, die sich ans Werk machen, wenn die Anschauungsformen Raum und Zeit das sinnliche Material vor-geformt geliefert haben, und derart die begrifflich-konstitutive Gegenstandserkenntnis ermöglichen, ist weit davon entfernt, Schopenhauers Wahrheitssuche in Ansätzen zu befriedigen. Kant wird von Schopenhauer als ›Maschinist der Vernunft‹ (Safranski 2010:173) geschätzt und hochgehalten, aber für die Kontemplation, für das Eintauchen in die Welt der Wahrheit, taugt die Kritik der reinen Vernunft nicht. Schopenhauer geht es »nicht um den Nutzen, sondern um das Glück der Erkenntnis« (Safranski 2010: 173). Den Weg zur Wahrheit – den Weg, in der Wahrheit zu stehen – weist ihm Platon, der zweite Philosoph, der für die Gedankenarchitektur von Die Welt als Wille und Vorstellung von entscheidender Bedeutung ist. »[D]er junge Schopenhauer will sich mit Kants skeptischer Gelassenheit nicht zufriedengeben. Auch er will ins Herz der Dinge. Er versucht den Kritizismus Kants auszubalancieren mit Platon, der, so glaubt er, nicht nur ein Türhüter, sondern ein Apostel der Wahrheit ist. Kant lehrt nur Tischsitten, kennt auch ein paar Rezepte; Platon bringt aber die Speise.« (Safranski 2010:173) Schopenhauer ist von Platons ›Erotik der Wahrheit‹ (Safranski 2010:181) hingerissen; der Platonismus bietet ein Erkennen, das ein anderes Sein bedeutet, denn »es geht nicht darum, die Gegenstände besser zu sehen, sondern in der Sonne zu sein« (Safranski 2010:181). Diese letzte Formulierung spielt auf das berühmte Höhlengleichnis an. Über Platons Leben und Werk gibt es nur wenig authentische Nachrichten. Einige wichtige Daten sind: Platon wird 428 oder 427 v. Chr. geboren, ist der bedeutendste Schüler des Sokrates, von dem wir übrigens noch weniger authentische Nachrichten haben, gründet 387 die berühmte Akademie, die erste Philosophenschule, schreibt, lehrt – einer seiner namhaftesten Schüler ist Aristoteles – und stirbt 347 (s. Suhr 2001:13 & 185f). Die Reihenfolge von Platon Schriften (Dialogen) musste rekonstruiert werden. Die Schriften sind in neun Tetralogien (= eine Folge von vier zusammengehörenden künstlerischen Werken, wobei es sich in Athen zu Platons Zeiten dabei um drei Tragödien und ein erheiterndes Satyrspiel handelt) überliefert, wobei das Einteilungsprinzip philosophisch-systematisch, nicht chronologisch ist. Nach chronologischen Gesichtspunkten lassen sich die Schriften in folgende Gruppen einteilen (s. Suhr 2001:178): I. Laches, Charmides, Protagoras, Euthyphron, Lysis, Politeia I, Ion Seite | 30 II. III. IV. Apologie, Kriton, Gorgias, Menon, Euthydem, Kratylos, Hippias I und II, Menexenos Symposion, Phaidon, Politeia II-X, Phaidros Theaitet, Parmenides, Sophistes, Politikos, Timaios, Kritias, Phiebox, Nomoi Raffael, Die Schule von Athen (1510-1511), Vatikan Im Höhlengleichnis formuliert Platon das Verhältnis von den einzelnen seienden Dingen (i.e. Entitäten) zu demjenigen, was ihnen als Gemeinsames zukommt. Alle Pferde teilen bestimmte Eigenschaften, die sich in den konkreten Pferden auf sehr unterschiedliche Weise zeigen können; trotz dieser sinnlich wahrnehmbaren Abweichungen erkennen wir in all den unterschiedlichen Pferden dasselbe Charakteristikum. Die wahrnehmbaren Eigenschaften der Pferde haben also etwas gemeinsam, das zwar nicht wahrnehmbar, aber von der ›Seele‹ erfassbar ist. Das, woran die einzelnen Entitäten teilhaben, nennt Platon ihre Idee bzw. Urbild; jede konkret wahrnehmbare Entität hat an ihrer Idee teil, wobei ›Teilhabe‹ ›methexis‹ (µετηεξισ) heißt. Eine Wikipedia-Grafik veranschaulicht das Teilhabe-Verhältnis von den vielfältigen, sinnlich wahrnehmbaren Entitäten und deren Ideen/Urbildern wie folgt: Seite | 31 Platons Höhlengleichnis findet sich im siebenten Buch von Der Staat oder Über die Gerechtigkeit (Politeia), das nach 377 v. Chr. erschienen ist. Die beiden Gesprächspartner sind Sokrates und Glaukon (so heißt einer der älteren Brüder des Platon), wobei es sich hier nicht um die Wiedergabe eines tatsächlich geführten Gesprächs handelt, sondern um literarisch-philosophische Fiktion. »›Und jetzt will ich dir ein Gleichnis für uns Menschen sagen, wenn wir wahrhaft erzogen sind und wenn wir es nicht sind. Denke dir, es lebten Menschen in einer Art unterirdischer Höhle, und längs der ganzen Höhle zöge sich eine breite Öffnung hin, die zum Licht hinaufführt. In dieser Höhle wären sie von Kindheit an gewesen und hätten die Fesseln an den Schenkeln und am Halse, so daß sie sich nicht von der Stelle rühren könnten und beständig geradeaus schauen müßten. Oben in der Ferne sei ein Feuer, und das gäbe ihnen von hinten her Licht. Zwischen dem Feuer aber und diesen Gefesselten führe oben ein Weg entlang. Denke dir, dieser Weg hätte an seiner Seite eine Mauer, ähnlich wie ein Gerüst, das die Gaukler vor sich den Zuschauern gegenüber, zu errichten pflegen, um darauf ihre Kunststücke vorzuführen.‹ ›Ja, ich denke es mir so.‹ ›Weiter denke dir, es trügen Leute an dieser Mauer vorüber, aber so, daß es über sie hinwegragt, allerhand Geräte, auch Bildsäulen von Menschen und Tieren aus Stein und aus Holz und überhaupt Erzeugnisse menschlicher Arbeit. Einige dieser Leute werden sich dabei vermutlich unterhalten, andere werden nichts sagen.‹ ›Welch seltsames Gleichnis! Welch seltsame Gefangene!‹ ›Sie gleichen uns! – Haben nun diese Gefangenen wohl von sich selber und voneinander etwas anderes gesehen als ihre Schatten, die das Feuer auf die Wand der Höhle wirft, der sie gegenübersitzen?‹ ›Wie sollten sie! Sie können ja ihr Leben lang nicht den Kopf drehen!‹ ›Ferner: von den Gegenständen, die oben vorübergetragen werden? Doch ebenfalls nur ihre Schatten?‹ ›Zweifellos.‹ ›Und wenn sie miteinander sprechen können, so werden sie in der Regel doch wohl von diesen Schatten reden, die da auf ihrer Wand vorübergehen.‹ ›Unbedingt.‹ Und wenn ihr Gefängnis auch ein Echo von der Wand zurückwirft, sobald ein Vorübergehender spricht, so werden sie gewiß nichts anderes für den Sprecher halten als den vorüberkommenden Schatten.‹ ›Entschieden nicht.‹ ›Überhaupt werden sie nichts anderes für wirklich halten, als diese Schatten von Gegenständen menschlicher Arbeit.‹ ›Ja, ganz unbedingt.‹ Seite | 32 ›Nun denke dir, wie es ihnen ergeht, wenn sie frei werden, die Fesseln abstreifen und von der Unwissenheit geheilt werden. Es kann doch nicht anders sein als so. Wenn einer losgemacht wird, sofort aufstehen muß, den Hals wendet, vorwärtsschreiten und hinauf nach dem Licht schauen muß – das alles aber verursacht ihm natürlich Schmerzen, und das Licht blendet ihn so, daß er die Gegenstände, deren Schatten er bis dahin sah, nicht erkennen kann –,was wird er dann wohl sagen, wenn man ihm erklärt: bis dahin habe er nur eitlen Tand gesehen; jetzt sei er der Wahrheit viel näher und sähe besser; denn die Gegenstände hätten höhere Wirklichkeit, denen er jetzt zugewendet sei! Und weiter, wenn man auf die einzelnen Gegenstände hinzeigt und ihn fragt, was sie bedeuteten. Es würde doch keine einzige Antwort geben können und würde glauben, was er bis dahin gesehen, hätte mehr Wirklichkeit, als was man ihm jetzt zeigt.‹ ›Weit mehr.‹ ›Und zwingt man ihn, das Licht selber anzusehen, so schmerzen ihn doch die Augen. Er wird sich umkehren, wird zu den alten Schatten eilen, die er doch ansehen kann, und wird sie für heller halten als das, was man ihm zeigt.‹ ›Ja, das wird er tun.‹ ›Und zieht man ihn gar den rauhen steilen Ausgang mit Gewalt hinauf und läßt nicht ab, bis man ihn hervor ins Sonnenlicht gezogen hat, so steht er doch Qualen aus, wehrt sich unwillig, und, ist er oben im Licht, so hat er die Augen voller Glanz und kann kein einziges von den Dingen sehen, die wir wirklich nennen.‹ ›Nein, wenn es plötzlich geschieht, nicht.‹ ›Er muß sich an das Licht gewöhnen, wenn er die Gegenstände oben sehen will. Zuerst wird er wohl am besten die Schatten erkennen, später die Spiegelungen von Menschen und anderen Gegenständen im Wasser, dann sie selber. Weiter wird er die Himmelskörper sehen und den Himmel selber, und zwar besser bei Nacht die Sterne und den Mond als bei Tage die Sonne und ihre Strahlen.‹ ›Freilich.‹ ›Schließlich wird er die Sonne selber sehen können. […] Wenn er jetzt an die alte Wohnung zurückdenkt und an die dortige Weisheit und an seine Mitgefangenen, so preist er sich doch glücklich über den Wechsel und bedauert jene.‹ ›Gewiß.‹ […] ›Nun mußt du dies ganze Gleichnis mit unserer voraufgegangenen Darlegung zusammenhalten, lieber Glaukon. Setze an die Stelle der Gefängniswohnung die durch den Gesichtssinn offenbarte Welt und an die Stelle des lichtspendenden Feuers die Kraft der Sonne. Wenn du dir ferner unter dem Aufstieg und dem Kennenlernen der Oberwelt die Wanderung der Seele zur denkbaren Welt hinauf denkst, so verstehst du meine Meinung, die du ja zu hören wünschst, durchaus richtig. […] Meine Ansicht jedenfalls geht dahin, daß es in der erkennbaren Welt die Idee des Guten ist, die man zuletzt und mit Mühe gewahr wird. Ist man Seite | 33 aber ihrer ansichtig geworden, so muß man zu der Überzeugung kommen, daß alles Rechte und Schöne in der ganzen Welt von ihr ausgeht. In der sichtbaren Welt schafft sie das Licht und den Herrn des Lichts; in der denkbaren Welt ist sie selber Herrin und gibt Wahrheit und Vernunft. Und wer mit Vernunft handeln will, in seinem persönlichen Leben oder als Staatsmann, der muß sie sehen lernen.‹« (Platon 1973:226ff) Platon spricht in der Folge davon, wie wenige sich aufmachen, die Idee des Guten zu sehen, und davon, dass diese wenigen ausgelacht werden, wenn sie die Idee des Guten gesehen und davon den anderen berichtet haben, die sich in ihrem Schattendasein eingefunden haben (s. Platon 1973:230f). Der Philosoph hat also einiges Unbill auf sich zu nehmen, und ausgelacht zu werden ist eines davon. Das Lachen der Magd über Thales, dem ›Philosophen im Brunnen‹, hallt zumindest zu Platons Zeiten noch sehr hell. Thales von Milet (~624-545 v.Chr.) gilt als Begründer der Philosophie und als namhafter Astronom und Mathematiker; bei einer seiner nächtlichen Sternenbeobachtung übersieht Thales einen Brunnen und stürzt hinein, worauf ein thrakische Magd lachend darüber spottet, dass Thales zwar wissen wolle, was am Himmel sei, aber es ihm verborgen bleibe, was vor ihm und zu seinen Füßen liege. Platon, der diese Geschichte berichtet, zieht daraus einen ernsten Schluss: »Der gleiche Spott trifft alle, die in der Philosophie leben. Denn in Wahrheit bleibt einem solchen der Nächste und der Nachbar verborgen […]. Was aber der Mensch im Unterschied von den anderen zukommt, danach sucht er und das zu erforschen müht er sich.« (Platon, zitiert nach Weischedel 1987:13ff) Wenn es um Gerechtigkeit und Wahrheit geht, werden sich die Mitbürger fragend an den Philosophen wenden, wenn die Zeit reif ist – so die Moral dieser Auffassung. Was den jungen Schopenhauer (und Generationen von PhilosophiestudentInnen) an Platons Höhlengleichnis begeistert: Es ist der/die PhilosophIn, der/die den Weg hinauf ans Tageslicht bewältigen kann und muss. Weiters: das Höhlengleichnis steht in der Politeia, in der Platon fordert, dass es die Philosophen (weibliche Philosophen sind für Platon ein Unding) sind, die den Staat regieren sollen – dazu müssen sie aber erzogen werden. Gerechtigkeit können Philosophen nur ausüben, wenn sie die Idee des Guten erfasst haben. Das Höhlengleichnis ist nicht nur ein Gleichnis bezüglich des Verhältnisses von Entitäten zu ihren Urbildern bzw. des Erkenntnisvollzuges, sondern auch ein Gleichnis für die Notwendigkeit der Charakterbildung von Philosophen bzw. Staatenlenkern. Der alltägliche Mensch lebt gefangen in Schattenbildern und Echos und ist nicht fähig, die Dinge selbst zu sehen. Der Alltagsmensch verfehlt das Wesen der Wirklichkeit, lacht aber über den Philosophen, wenn er das Wesen der Seite | 34 Dinge erkennen will. Der Philosoph tut sich den Schmerz der Welterkenntnis an – er öffnet im strahlenden Sonnenlicht die Augen; er will sehen. Das Öffnen der Augen ist gleichbedeutend mit Vernunfteinsichten zu erlangen. Das letzte Prinzip, das den ideellen Bereich der Vernunfteinsichten, der Ideen, strukturiert, ist die Idee des Guten. Platons Philosophie ist damit im Grunde praktisch bzw. politisch ausgerichtet. Schopenhauer jedenfalls ist fasziniert vom Weg in die Sonne; er will am Sein teilhaben (s. Safranski 2010:182). Ihn fasziniert der ›Ausstieg aus der Jammerwelt‹ und die Rückkehr in diese (s. Noerr-Schmid 2006:35ff). Das bessere Bewusstsein Safranski (2010:201) zitiert folgende Stelle aus Schopenhauers philosophischem Tagebuch, niedergeschrieben 1813: »Ich aber sage in dieser Zeitlichen, Sinnlichen, Verständlichen Welt giebt es wohl Persönlichkeit und Kausalität, ja sie sind sogar nothwendig. – Aber das bessre Bewußtseyn in mir erhebt mich in eine Welt wo es weder Persönlichkeit noch Kausalität noch Subjekt und Objekt mehr giebt.« Aus dieser Tagebucheintragung ist die ›Vermischung‹ von Kant und Platon bereits zu erahnen – einerseits ein Beibehalten der kausalen Welt, andererseits ein Pochen auf eine Welt, die der Urgrund von Subjekt und Objekt ist, quasi das Verlassen der Höhle. Die wirkliche Welt will Schopenhauer zu diesem Zeitpunkt bereits auf einen anderen Weltentwurf hin überschreiten, mittels der Sprache der Vernunft allerdings (s. Safranski 2010:201). Dass empirisches und ›besseres‹ Bewusstsein auseinanderklaffen, liegt für Schopenhauer auf der Hand. Die Kluft zwischen den beiden Bewusstseinsformen ist unüberbrückbar, denn während das empirische Bewusstsein der erfahrbare Standardmodus unseres Bewusst-Seins ist, liegt beim besseren Bewusstsein eben kein Bewusstsein-von-etwas vor, kein Denken, dass sich einem Objekt annähert: »Das ›bessere Bewußtsein‹ ist […] eine Art der Wachheit, die in sich ruht, nichts will, nichts befürchtet, nichts hofft. Ichlos und deshalb unbetreffbar, hat das ›bessere Bewußtsein‹ die Welt vor sich, eine Welt allerdings, die, weil sie nicht mehr auf ein Ich ›wirkt‹, in einem bestimmten Sinn auch aufhört ›wirklich‹ zu sein.« (Safranski 2010:202) Schopenhauers besseres Bewusstsein ist ein Zustand des Draußen, der die Urteilsbeziehung zur Welt sistiert. Obwohl Schopenhauer erst später die Ähnlich- Seite | 35 keit seines frühen Denkansatzes mit den deutschen Mystikern (z.B. Meister Eckhart), die vom ›nunc stans‹ sprechen, und zu den indischen Weisheitslehren entdecken wird, zielt Schopenhauer auf eine Auflösung des empirischen Bewusstseins im Zustand des besseren Bewusstseins; Safranski beschreibt dies wie folgt: »Wenn ich in einem Augenblick ganz in die Aufmerksamkeit versunken bin, dann ist tatsächlich die Trennung von Ich und Welt plötzlich aufgehoben. Es wird gleichgültig, ob ich sage: ich bin draußen bei den Gegenständen oder die Gegenstände sind in mir, entscheidend ist vielmehr: Ich erleben meine Aufmerksamkeit nicht mehr als eine Funktion meines verkörperten Ichs. Diese Aufmerksamkeit ist aus den Raum-Zeit-Koordinaten, deren Schnittpunkt unser verkörpertes Ich ist, herausgelöst: raum-, zeit- und selbstvergessen. Die Mystiker gaben dieser Erfahrung den Namen ›nunc stans‹, stehendes Jetzt. Die Intensität dieser Gegenwart ist anfangs- und endlos, und sie kann nur verschwinden, weil wir aus ihr verschwinden. Die Aufmerksamkeit bricht ab, wenn ich wieder in mein Subjektsein zurückgetrieben werde, dann sind wieder alle Trennungen da: Ich und die anderen, dieser Raum, diese Zeit. Hat mich mein empirisches Ich wieder, so werde ich diesen ›Augenblick der Aufmerksamkeit‹ im Ankerwerk meiner Individualität, meiner Lebenszeit, meines Ortes fest vertäuen und werde daher das verloren haben, was diesem Augenblick das Unverwechselbare gegeben hat: sein Nirgendwo und Nirgendwann. Diese Art der Aufmerksamkeit muß aufgehört haben, wenn ich sie einem Ort und einer Zeit zurechnen kann.« (Safranski 2010:203) Das bessere Bewusstsein katapultiert das Individuum aus der empirischen Welt hinaus; das Individuum entzieht sich für einen Augenblick – gemessen an den Regeln des empirischen Bewusstseins – dem Treiben der Kausalität und ist über den weltimmanenten Vernunftgebrauch hinaus. Schopenhauer fasst also die Realität des besseren Bewusstseins und die Wirklichkeit des empirischen Bewusstseins als zwei voneinander geschiedene Bewusstseinsmodi auf. Schopenhauer strebt keine Versöhnung der Duplizität von empirischem und besserem Bewusstsein an, sondern verfolgt ein anderes Projekt – das Unsagbare darf nicht zum Unsäglichen werden (s. Safranski 2010:212). Adorno wird später schreiben: »An [Philosophie] ist die Anstrengung, über den Begriff durch den Begriff hinauszugelangen.« (Adorno 1990:27) Das begriffliche Denken weist über sich hinaus und bleibt doch in sich befangen, wobei diese Befangenheit herkömmlicher Weise als Vorrang der begrifflichen Sphäre aufgefasst wird. Adorno konzediert, dass ohne die begriffliche Sphäre nichts gewusst wird, doch aus diesem Status darf nicht die Priorität über das Nichtbegriffliche geschlossen werden. »Philosophische Reflexion versichert sich des Nichtbegriffli- Seite | 36 chen im Begriff. Sonst wäre dieser, nach Kants Diktum, leer, am Ende überhaupt nicht mehr der Begriff von etwas und damit nichtig. Philosophie, die das erkennt, die Autarkie des Begriffs tilgt, streift die Binde von den Augen.« (Adorno 1990:23f) Safranski sieht eine andere Parallele: Schopenhauers doppelte Perspektive und das Bestreben, das Unsägliche nicht zum Unsagbaren absteigen zu lassen, findet ihren Widerhall in der Philosophie von Wittgenstein, näherhin im berühmten letzten Satz des Tractatus logico-philosophicus: »Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.« (Wittgenstein 1963:115) Die Philosophie soll in diskursiver Sprache sagen, was sich sagen lässt, damit jener Bereich umgrenzt wird, an den die Sprache nicht herankommt; die Philosophie »soll bis an die Grenzen der möglichen Begriffsarbeit gehen, damit sie weiß, wovon es keinen Begriff geben kann« (Safranski 2010:212). *** Schopenhauers Frühphilosophie, jene (unpublizierten) Fragemente aus den Jahren 1812-1814 (s. Malter 1988:5ff), gipfelt in der Idee des besseren Bewusstseins und macht sich damit auf den Weg zur reifen Willensmetaphysik. Die doppelte Perspektive begründet ein Janusgesicht der Welt. »Die Philosophie des ›besseren Bewußtseins‹ zeigt […] bereits das Janusgesicht der Welt. Wir finden in dieser Philosophie viele der Probleme, die das Hauptwerk auflöst. […] In bewußter Platonnachfolge unterscheidet Schopenhauer zwischen einer sinnlichen und einer übersinnlichen Welt, dem Reich Gottes und dem Reich der Nichtigkeit, einer zeitlich-hoffnungslosen und einer zeitloserfüllten menschlichen Existenz. Dieses an Platon gewonnene Duplizitätsschema stellt sich für den zugleich an Kant anknüpfenden jungen Schopenhauer als Bewußtseinsdoppelung dar. Aus der noch gegenständlich gefassten Zwei-WeltenLehre wird eine Duplizitätsphilosophie, die insofern monistischen Charakter hat, als sie die Doppelbetrachtbarkeit der menschlichen Existenz als Handlung des einen Bewußtseins ansieht: das Bewußtsein hat in freier Wahl zwei Möglichkeiten seines Verhaltens zum leidenden Subjekt, das mit diesem einen Bewußtsein identisch ist – der eine Mensch kann sich, als mit Bewußtsein ausgestattetes Individuum, zweifach verwirklichen. Bewußtseinsverdoppelung besagt daher nicht Spaltung des Bewußtseins, sondern zweifaches Sichverhaltenkönnen des Bewußtseins zu sich selbst als zu dem leidend-reflektierenden Subjekt.« (Malter 1988:5) Das bessere Bewusstsein steht jenseits aller Bestimmtheit der Objektwelt und jenseits des der Objektwelt korrespondierenden Erkenntnissubjekt, womit es sich nicht fassen lässt als ›denkend‹ oder ›erkennend‹; das bessere Bewußtsein Seite | 37 entzieht sich dem Zugriff durch Erfahrung oder Vernunft. Aussagen über das bessere Bewusstsein lassen sich folglich nur ex negativo machen – derartige Aussagen sind beispielsweise im Bereich der Kunst möglich (s. Malter 1988:8). Schon hier, in den frühen Notizen, sieht Schopenhauer die Bedeutung der Kunst für die Wahrheit. Doch die Spaltung ins empirische und bessere Bewusstsein wirft eine Frage auf: Warum und wie kommt es überhaupt zu dem als qualvoll leiderzeugenden empirischen Bewusstsein? »Von Anfang an ist die Frage nach dem Ursprung des Bösen und des Übels in der Welt, die Theodizee-Frage, in Schopenhauers Denken präsent; in gewissem Sinn ist seine Frühphilosophie genauso wie sein reifes Denken der Versuch einer Antwort.« (Malter 1988:10) Dabei versteht man unter ›Theodizee‹ »die Rechtfertigung Gottes gegen den Vorwurf, daß er für das Übel und das Böse in der Welt verantwortlich sei, da es in seiner Allmacht gestanden haben müßte, es nicht zuzulassen« (Regenbogen & Meyer 2005:661). Die Konzeption des besseren Bewusstseins als klar vom empirischen Bewusstsein getrennter Bewusstseinsmodus und der Übergang von diesem zu jenem rückt den Tod in den Vordergrund der Philosophie – hierin liegt u.a. ein wichtiges Moment für Schopenhauers existenzialistisches Philosophieren. Doch im Tod liegt für Schopenhauer nicht das Ziel der Aufhebung des empirischen Bewusstseins (s. Malter 1988:11f) – Schopenhauer wird den Selbstmord weder praktizieren, noch predigen. Bevor Schopenhauer allerdings die doppelte Perspektive in die Duplizierung der Welt in die Welt als Wille und die Welt als Vorstellung ausformuliert, beendet er sein Studium und legt seine Dissertation vor, Die vierfache Wurzel des Satzes vom Grunde. Die Schrift über Wurzeln, nicht für Apotheker geeignet 1813 greift die Politik in Schopenhauers Leben ein, und zwar in Form von Deutschlands Kriegserklärung gegen Frankreich: Am 28. März 1813 wird mit einem Gottesdienst der Krieg gegen Napoleon offiziell eröffnet. Schopenhauer selbst wird nicht eingezogen, aber zwei Drittel seiner Kommilitonen ziehen in den Kampf, womit die Berliner Universität verödet. Schopenhauer macht sich auf die Flucht, verlässt schleunigst Berlin, denn den Krieg hat er schon in Weimar gesehen. Vor seiner Flucht mit Zielort Weimar, wo seine Mutter lebt, spendet er die Ausrüstung eines Soldaten, »aber schlagen will er sich nicht, Pat- Seite | 38 riotismus ist ihm fremd« (Safranski 2010:222). Den Weg nach Weimar wird Schopenhauer in Rudolstadt unterbrechen und in ein Dorfgasthaus einkehren, eigentlich von Juni bis November 1813 sein Domizil beziehen. Und es kommt die Zeit der intellektuellen Niederkunft: Schopenhauer beginnt und vollendet in diesen sechs Monaten seine Dissertation Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. Damit beginnt eine fünfjährige Schaffensphase, die das ganze Werk in nuce hervorbringen wird. Trotz des guten Gefühls, das Schopenhauer beim Verfassen und Schaffen hat – es wird noch lange dauern, bis sein Werk gelesen wird. »In diesen fünf Jahren werden alle seine wesentlichen Lehrsätze ihre endgültige Formulierung finden; er wird diese Lebensphase beenden mit dem Bewußtsein, seine eigentliche Lebensaufgabe erfüllt zu haben. Danach wird er vor das Publikum treten und zu seinem Entsetzen feststellen, daß keiner gekommen ist. Ohne einen Auftritt gehabt zu haben, tritt er ab.« (Safranski 2010:229) Schopenhauers herbe Enttäuschung über die Nicht-Rezeption seines Werks fängt bereits an, als er seine Dissertation, die er auf eigene Kosten publiziert, seiner Mutter überreicht. Johanna Schopenhauers Karriere als Schriftstellerin beginnt sich zu diesem Zeitpunkt zwar gerade erst abzuzeichnen, aber die Zeichen sind nicht trügerisch und künden von einer blendenden Zukunft. Johanna Sch. hat die Kriegswirren von 1806/07 in Briefen ausführlich geschildert, und diese Briefe werden im Verwandten- und Bekanntenkreis wie literarische Dokumente herumgereicht. Johannas Reiseberichte, die sie bei abendlichen Zusammenkünften vorträgt, werden gelobt – schließlich beginnt sie, ihre Erlebnisse schriftstellerisch auszuwerten. 1813/14 erscheinen ihre Erinnerungen von einer Reise in den Jahren 1803, 1804 und 1805. 1817 erscheint Reise durch das südliche Frankreich, ab 1818 schreibt sie Liebesromane, und bis Ende der 1820er Jahre bringt ihr Verleger, Brockhaus übrigens, eine zwanzigbändige Werkausgabe heraus. In diesem Jahrzehnt ist Johanna Schopenhauer eine der berühmtesten Schriftstellerinnen Deutschlands, eine deutsche Madame de Staël (s. Safranski 2010:250f). Als Schopenhauer seiner erfolgreich publizierenden Mutter sein Büchlein in die Hand drückt, entspinnt sich folgendes Gespräch, das Schopenhauer viele Jahre später seinem Bekannten Wilhelm Gwinner berichtet: »Die Mutter, indem sie Arthurs Dissertation DIE VIERFACHE WURZEL zur Hand nimmt: ›Das ist wohl etwas für Apotheker.‹ Arthur: ›man wird sie noch lesen, wenn von Deinen Schriften kaum mehr ein Exemplar in einer Rumpelkammer steckt.‹ Die Mutter: ›von den Dingern wird die ganze Auflage noch zu haben sein.‹« (Safranski 2010:255) Seite | 39 Tatsächlich markiert dieses Gespräch den Bruch zwischen Mutter und Sohn, weniger allerdings wegen der abfälligen Bemerkung, sondern mehr deswegen, weil die Mutter in einer Liaison steht, die der Sohn ganz und gar nicht wohlheißt. Allerdings lässt sich Johann Schopenhauer von ihrem Sohn nicht sagen, wie sie zu leben hat – und dieser wiederum erträgt nicht, dass sich seine Mutter nicht von ihm regieren lässt. Doch genug davon – Schopenhauers Buch handelt nicht von wirklichen Wurzeln und ist somit keine Schrift, die sich für Apotheker eignet. *** Die Dissertation ist kantisch gehalten. Schopenhauer erwähnt hier mit keinem Wort das ›bessere Bewusstsein‹, allerdings will er mit seiner Schrift gerade diesem seinen Ort zuweisen – er steckt die Grenzen des empirischen Bewusstseins ab (s. Safranski 2010:230). »Worauf es ihm ankommt, ist genau das, wovon er nicht spricht. Er wird auf seine Weise Kantianer, um – wiederum auf seine Weise – Platoniker bleiben zu können.« (Safranski 2010:231) Das empirische und das bessere Bewusstsein werden klar geschieden, womit der Kritizismus (=Kants Transzendentalphilosophie) ein Liebesdienst am ›besseren Bewusstsein‹ ist (s. Safranski 2010:232) Meistens lesen wir nicht die Schrift von 1813, sondern Schopenhauers ergänzte und erweiterte Ausgabe von 1847, was auch für die Suhrkamp-Ausgabe gilt, aus der ich zitiere. Die beiden Ausgaben unterscheiden sich v.a. dadurch, dass Schopenhauer in der Fassung von 1813, die seiner eingereichten Dissertation entspricht, nicht hemmungslos über seine Philosophenkollegen herzieht (s. z.B. VW:67: die ›Professoren-Philosophie der Philosophie-Professoren‹) und sie recht unflätig beschimpft (z.B. VW:136: Hegel als ›frecher Unsinnschmierer‹). Nachdem Schopenhauer in der Einleitung Platon als ›göttlich‹ und Kant als ›erstaunlich‹ bezeichnet hat, zitiert Schopenhauer Wolffs Version des Satzes vom zureichenden Grunde mit den Worten: ›Nihil est sine ratione, cur potius sit quam non sit.‹ (›Nichts ist ohne Grund, warum es sei und nicht vielmehr nicht sei.‹) Schopenhauer sieht im Satz vom Grunde den ›gemeinschaftlichen Ausdruck mehrerer a priori gegebener Erkenntnisse‹ (VW:15). Schopenhauer sucht also einen ›Ur-Grundsatz aller Erkenntnis‹ (VW:16), den Platon mit den Worten auf den Punkt gebracht hat, dass ›alles, was geschieht, notwendig vermöge einer Ursache geschehen, denn keiner Sache ist es möglich, ohne eine Ursache ins Dasein zu treten‹ (VW:16). Allerdings riecht schon die Vier-Zahl weniger nach Platon, als vielmehr nach Aristoteles, der in der Physik (Kapitel II 3) vier Gründe unterscheidet: Seite | 40 Materialursache (causa materialis): »woraus als etwas schon Vorhandenem etwas entsteht« (194 b). Gemeint ist der Stoff, aus dem ein Gegenstand besteht, z.B. im Fall einer silbernen Statue das Metall. Formursache (causa formalis): Die »Form und das Modell« (ebd.) des Gegenstandes, im Fall der Statue die Gestalt eines Pferdes. Wirkursache (causa efficientis): »woher der anfängliche Anstoß zu Wandel oder Beharrung kommt« (ebd.). Dies wäre beim Beispiel der Statue der Bildhauer. Zweckursache (causa finalis): »das Ziel, d.h. das Weswegen« (ebd.). Der Zweck der Statue ist, dass sie das Zimmer schmückt. Schopenhauer selbst zitiert die Analytica posteriora (94a): »Es gibt vier Arten von Gründen: der erste besteht in dem, was das Wesen der Sache ausmacht; der zweite in dem, was, wenn er vorhanden ist, notwendig (als Substrat) vorausgesetzt werden muß; der dritte in dem, was etwas zuerst bewegt; der vierte, um dessentwillen etwas ist.« (Aristoteles, zitiert in VW:17f) Die aristotelische Ursachenlehre hängt untrennbar mit einer statischen Ontologie zusammen, die bereits Kant durchbrochen hat; Schopenhauer reformuliert also nicht einfach Aristoteles, sondern ist eher von der Vier-Zahl inspiriert, modelt aber aristotelisches Denken problemlos in Kantische Philosophie um – hierin zeigt sich die kreative Denkkraft des jungen, gerade dissertierenden Schopenhauers. Die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde fasst Schopenhauer wie folgt: »Unser erkennendes Bewusstsein, als äußere und innere Sinnlichkeit (Rezeptivität), Verstand und Vernunft auftretend, zerfällt in Subjekt und Objekt und enthält nichts außerdem. Objekt für das Subjekt sein und unsere Vorstellung sein ist dasselbe. Alle unsere Vorstellungen sind Objekte des Subjekts, und alle Objekte des Subjekts sind unsere Vorstellungen. Nun findet sich, dass alle unsere Vorstellungen unter einander in einer gesetzmäßigen und der Form nach a priori bestimmbaren Verbindung stehn, vermöge welcher nichts für sich Bestehendes und Unabhängiges, auch nichts Einzelnes und Abgerissenes Objekt für uns werden kann. Diese Verbindung ist es, welche der Satz vom zureichenden Grund in seiner Allgemeinheit ausdrückt. […] Die demselben zum Grunde liegenden, im folgenden näher nachzuweisenden Verhältnisse sind es daher, welche ich die Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde genannt habe. Diese sondern sich […] in bestimmte von einander sehr verschiedene Gattungen, deren Anzahl sich auf vier zurückführen läßt, indem sie sich richtet nach den vier Klassen, in welche alles, was für uns Objekt werden kann, also alle unsere Vorstellungen zerfallen.« (VW:41) Seite | 41 Alle Objekte, die Objekte fürs Subjekt und somit unsere Vorstellungen sind, stehen in gesetzmäßigen Verbindungen a priori; hier merkt man Kants Erbe überdeutlich. Nach diesen Verbindungen lässt sich in vierfacher Weise fragen – dass sie in Verbindung stehen, entspricht dem Satz vom Grunde, und dass sich die Verbindungen in vierfacher Weise befragen lassen, entspricht dessen vierfacher Wurzel. Die vier Wurzel des Satzes vom Grund sind (Safranski 2010:234f): Bei allem, was in der Körperwelt geschieht, fragen wir nach einem Grund, warum es geschieht. Wir fragen also nach einem Grund des Werdens. Das ist die Frage nach der Kausalität im engeren Sinn. Bei allen Urteilen (Erkenntnissen, Begriffen) fragen wir nach dem, worauf sich dieses Urteil stützt. Wir fragen hier also nicht, warum etwas so sei, sondern wir fragen, warum wir behaupten, dass es so sei. Wir fragen also nach dem Erkenntnisgrund. Die dritte Art des Satzes vom zureichenden Grunde bezieht sich auf das Gebiet der reinen Geometrie und Arithmetik. Hier gilt weder ein Grund des Werdens noch ein Erkenntnisgrund. Warum auf die Zahl ›1‹ die Zahl ›2‹ folgt oder warum jedes über einem Kreisdurchmesser errichtete Dreieck, mit Eckpunkt auf der Kreislinie, einen rechten Winkel hat, lässt sich durch das So-Sein des anschaulichen Raumes (Geometrie) und der unmittelbar erfahrenen Zeit (Zählen, Arithmetik) demonstrieren. Es geht hier um eine nicht weiter hinterfragbare Evidenz. Für Schopenhauer ist das der ›Satz vom zureichenden Grunde des Seyns‹. Die vierte Art des Satzes vom zureichenden Grunde bezieht sich auf das menschliche Handeln: Wir fragen bei allem, was getan wird, nach dem Motiv, weshalb es getan wird. In der zweiten, wesentlich erweiterten Auflage der Dissertation wird Schopenhauer dafür den ungemein erhellenden Ausdruck verwenden: ›die Kausalität von innen‹. Beim Durchgang durch die vierfache Wurzel des Satzes vom Grunde – Schopenhauer widmet jedem Grund/jeder Vorstellungsklasse ein Kapitel mit mehreren Paragrafen – möchte ich ein paar besonders eindringliche Gedanken herausgreifen, sozusagen die ›Gustostückerl‹ der Dissertation diskutieren. *** Die erste Klasse möglicher Gegenstände unseres Vorstellungsvermögens ist die der ›anschaulichen, vollständigen, empirischen Vorstellungen‹ – ›anschaulich‹ im Gegensatz zu ›gedacht‹. Die Formen der Anschauung sind Zeit und Raum (VW:42). Anschauungen sind wahrnehmbar, und wahrnehmbar wiederum ist die Materie. Daraus entspringt nun die spannende Aufgabe, die Materie aus den beiden Anschauungsformen zu explizieren – was Schopenhauer mühelos gelingt. Seite | 42 »Wäre die Zeit die alleinige Form dieser Vorstellungen; so gäbe es kein Zugleichsein und deshalb nichts Beharrliches und keine Dauer. Denn die Zeit wird nur wahrgenommen, sofern sie erfüllt ist, und ihr Fortgang nur durch den Wechsel des sie Erfüllenden. Das Beharren eines Objekts wird daher nur erkannt durch den Gegensatz des Wechsels anderer, die mit ihm zugleich sind. Die Vorstellung des Zugleichseins aber ist in der bloßen Zeit nicht möglich, sondern zur andern Hälfte bedingt durch die Vorstellung vom Raum; weil in der bloßen Zeit alles nacheinander, im Raum aber nebeneinander, ist: dieselbe entsteht also erst durch den Verein von Zeit und Raum. Wäre andererseits der Raum die alleinige Form der Vorstellungen dieser Klasse; so gäbe es keinen Wechsel: denn Wechsel oder Veränderung ist Sukzession der Zustände, und Sukzession ist nur in der Zeit möglich.« (VW:43) Zeit ist für Sukzession, Raum für Beharrlichkeit verantwortlich; weder kann es reine Sukzession geben, noch reine Beharrlichkeit – alles ändert sich, aber das, was sich ändert, muss davor beharrt haben. Veränderung ist nur vor der Folie des Bestandes denkbar. Wenn sich ein Zustand verändert, muss dieser Veränderung ein anderer Zustand vorangegangen sein bzw. jede Veränderung ist die Wirkung einer Ursache (VW:48). Es gibt keine Veränderung außerhalb der Ursachenkette – Veränderungen sind nur in einer geschlossenen ›Kette der Kausalität‹ (VW:49), als ›Kausalnexus‹ (VW:51) denkbar. Diese Kausalitätskette ist folglich auch ›notwendig anfangslos‹ (VW:49). Dabei gilt zu bedenken – hierin ist Schopenhauer ein Funktionsdenker wie Kant –, dass nicht Objekte, sondern Zustände Ursachen sind (VW:50). Aus dieser Überlegung folgt, dass der Begriff einer ›causa prima‹ oder einer ›causa sui‹ ein Widerspruch in sich, eine ›contradiction in adiecto‹ ist (VW:52). »Das Gesetz der Kausalität ist also nicht so gefällig, sich brauchen zu lassen wie ein Fiaker, den man, angekommen, wo man hingewollt, nach Hause schickt. Vielmehr gleicht es dem von Goethes Zauberlehrling belebten Besen, der, einmal in Aktivität gesetzt, gar nicht wieder aufhört zu laufen und zu schöpfen.« (VW:53) Aus dem Gesetz der Kausalität ergeben sich ›zwei wichtige Korollarien‹ (VW:57), die ›über allen Zweifel erhaben‹ sind: das Gesetz der Trägheit und das der Beharrlichkeit der Substanz. »Das erstere besagt, daß jeder Zustand, mithin sowohl die Ruhe eines Körpers als auch seine Bewegung jeder Art unverändert, unvermindert, unvermehrt fortdauern und selbst die endlose Zeit hindurch anhalten müsse, wenn nicht eine Ursache hinzutritt, welche sie verändert oder aufhebt. – Das andere aber, welches die Sempiternität der Materie ausspricht, folgt daraus, daß das Gesetz der Kausalität sich nur auf die Zustände der Körper, also auf ihre Ruhe, Bewegung, Seite | 43 Form und Qualität bezieht, indem es dem zeitlichen Entstehn und Vergehn derselben vorsteht; keineswegs aber auf das Dasein des Trägers dieser Zustände, als welche man, eben um seine Exemtion von allem Enstehn und Vergehn auszudrücken, den Namen Substanz erteilt hat. Die Substanz verharrt: d.h. sie kann nicht entstehn noch vergehn, mithin das in der Welt vorhandene Quantum derselben nie vermehrt, noch vermindert werden.« (VW:58) Wobei ›Substanz‹ ein Synonym von ›Materie‹ (VW:60) ist. Die Kausalkette ist die Summe der Veränderungen an der Materie, die sich selbst nicht ändert, die also im Hintergrund der Veränderungen beharrlich bleibt – hier findet man Kants Unterscheidung von Ding an sich und Erscheinung wieder, wobei Schopenhauer die Dinge an sich als beharrende Substanz/Materie anspricht. Neben der beharrenden Materie ist noch etwas dem Kausalnexus enthoben, nämlich die Naturkräfte selbst. Die Naturkräfte sind außerhalb der Zeit und des Raumes, und sie sind ›überall vorhanden, allgegenwärtig und unerschöpflich‹ (VW:60). »Die Naturkraft […] ist ein Allgemeines, Unveränderliches, zu aller Zeit und überall Vorhandenes. Z.B. Daß der Bernstein jetzt die Flocke anzieht, ist die Wirkung: ihre Ursache ist die vorhergegangene Reibung und jetzige Annäherung des Bernsteins; und die in diesem Prozeß tätige ihm vorstehende Naturkraft ist die Elektrizität.« (VW:61) Schopenhauer differenziert hier klar zwischen Ursache-Wirkungs-Relation und Naturkraft. Die Naturkraft ist keine Wirkung, sie erscheint bloß als solche, und die Naturkraft ist mit den konkreten Ursache-Wirkungsrelationen durch das ›Band des Naturgesetzes‹ verknüpft (VW:61). Hier kündigt sich bereits ein wichtiger Gedanke an, den Schopenhauer später ausführt – dass nämlich die Welt der Erscheinungen durch eine ungreifbare Kraft durchwaltet wird, die selbst nie Erscheinung ist und sich dennoch in den Erscheinungen manifestiert; Schopenhauer nennt diese Kraft den Willen (s.u.). In der Dissertation schreibt er (es liest sich wie ein Versprechen, das er einlösen wird): »Jede echte, also wirklich ursprüngliche Naturkraft aber, wozu auch jede chemische Grund-Eigenschaft gehört, ist wesentlich qualitas occulta, d.h. keiner physischen Erklärung weiter fähig, sondern nur noch einer metaphysischen, d.h. über die Erscheinung hinausgehenden.« (VW:61f) Die Kausalität, ›dieser Lenker aller und jeder Veränderung‹ (VW:62), wird von Schopenhauer nun dreifach differenziert – in (i) Ursache im engeren Sinn, (ii) Reiz und (iii) Motiv. Die Kausalität wirkt im unorganischen Reich als Ursache, im organischen Reich (i.e. im Leben der Pflanzen und im vegetativen, daher Seite | 44 bewusstlosen Teil des tierischen Lebens) als Reiz und im eigentlichen animalischen Leben als Motiv. Hier kündigt sich einerseits eine unzeitgemäße Aufwertung des Tieres in der Philosophie an, denn Schopenhauer spricht den Tieren Erkennen und Vorstellen zu (VW:63); andererseits eine Parallelisierung des Menschen mit dem Tier, was auf Charles Darwin vorausweist (Darwin publiziert The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life 1859). Damit ist der Mensch in seinem Handeln durch Motive der Kausalität nicht enthoben, vielmehr ist der Mensch gerade dann, wenn er motiviert handelt, im Kausalnexus gefangen – darin weist Schopenhauer zugleich auf Freud, der die Psychoanalyse explizit als ›Naturwissenschaft‹ auffasst, also nicht ›verstehen‹, sondern ›erklären‹ will. Schopenhauer fasst die Ausdifferenzierung der Kausalität in Ursache, Reiz und Motivation wie folgt. »Der Unterschied zwischen Ursache, Reiz und Motiv ist offenbar bloß die Folge des Grades der Empfänglichkeit der Wesen; je größer diese, desto leichterer Art kann die Einwirkung sein: der Stein muß gestoßen werden; der Mensch gehorcht einem Blick. Beide aber werden durch eine zureichende Ursache, also mit gleicher Notwendigkeit bewegt. Denn die Motivation ist bloß die durch das Erkennen hindurchgehende Kausalität: der Intellekt ist das Medium der Motive, weil er die höchste Steigerung der Empfänglichkeit ist. Allein hierdurch verliert das Gesetz der Kausalität schlechterdings nichts an seiner Sicherheit und Strenge. Das Motiv ist eine Ursache und wirkt mit der Notwendigkeit, die alle Ursachen herbeiführen. Beim Tier, dessen Intellekt ein einfacher, daher nur die Erkenntnis der Gegenwart liefernder ist, fällt jene Notwendigkeit leicht in die Augen. Der Intellekt des Menschen ist doppelt: er hat zur anschaulichen auch noch die abstrakte Erkenntnis, welche nicht an die Gegenwart gebunden ist, d.h. er hat Vernunft. Daher hat er eine Wahlentscheidung, mit deutlichem Bewußtsein: nämlich er kann die einander ausschließenden Motive als solche gegen einander abwägen, d.h. sie ihre Macht auf seinen Willen versuchen lassen, wonach sodann das stärkere ihn bestimmt und sein Tun mit eben der Notwendigkeit erfolgt wie das Rollen der gestoßenen Kugel.« (VW:63f) Diesen Ansatz wird Schopenhauer in seiner Preisschrift über die menschliche Freiheit weiter verfolgen – ich werde daher die Diskussion des Leib-SeeleProblems auf später verschieben. *** Schopenhauer verlässt die unmittelbaren Vorstellungen (Zeit und Raum bestimmt) und widmet den § 21 der Apriorität des Kausalitätsbegriffs, näherhin der Intellektualität der empirischen Anschauung. Schopenhauer folgt hier nun Seite | 45 völlig Kant, für den die Gegenstandskonstitution im Zusammenspiel von Anschauung und Begriff liegt. Folgende Zeilen können bis heute als das Argument gegen einen sensualistischen Empirismus gelesen werden – sie haben an Gültigkeit nichts verloren: »Man muß von allen Göttern verlassen sein, um zu wähnen, daß die anschauliche Welt da draußen, wie sie den Raum in seinen drei Dimensionen füllt, im unerbittlich strengen Gange der Zeit sich fortbewegt, bei jedem Schritte durch das ausnahmslose Gesetz der Kausalität geregelt wird, in allen diesen Stücken aber nur die Gesetze befolgt, welche wir vor aller Erfahrung davon angeben können – daß eine solche Welt da draußen ganz objektiv-real ohne unser Zutun vorhanden wäre, dann aber durch die bloße Sinnesempfindung in unseren Kopf hineingelangte, woselbst sie nun, wie da draußen, noch einmal dastände. Denn was für ein ärmliches Ding ist doch die bloße Sinnesempfindung! Selbst in den edelsten Sinnesorganen ist sie nichts mehr als ein lokales, spezifisches, innerhalb seiner Art einiger Abwechselung fähiges, jedoch an sich selbst stets subjektives Gefühl, welches als solches gar nichts Objektives, also nichts einer Anschauung Ähnliches enthalten kann. […] Die Empfindung in den Sinnesorganen ist eine durch den Zusammenfluß der Nervenenden erhöhte, wegen der Ausbreitung und der dünnen Bedeckung derselben leicht von außen erregbare und zudem irgendeinem speziellen Einfluß – Licht, Schall, Duft – besonders offenstehende: aber sie bleibt bloße Empfindung.« (VW:68) Durch die Sinnesorgane affizieren uns die Dinge an sich – doch dann setzen sich Anschauungsformen und Verstandesformen ins Werk und konstituieren das Objekt, das immer Objekt-für-ein-Subjekt ist. Die Vorstellungen sind zugleich objektiv und subjektiv. Soweit bleibt Schopenhauer ganz Kantianer. Doch dann folgt eine interessante Wegbewegung – Schopenhauer will den Erkenntnisvollzug selbst in terms of causality fassen, was Kant ja vermieden hat: Der Verstand fasst die gegebene Empfindung des Leibes als Wirkung auf, wobei er unter Zuhilfenahme des äußeren Sinnes, d.i. des Raumes, die Ursache als außerhalb des Organismus auffasst. Der Verstand konstruiert die Affektionen als Ursachen auf den Körper im Raum (VW:69). »Bei allen dem geben diese Data durchaus noch keine Anschauung; sondern diese bleibt das Werk des Verstandes. Drücke ich mit der Hand gegen den Tisch, so liegt in der Empfindung, die ich davon erhalte, durchaus nicht die Vorstellung des festen Zusammenhangs der Teile dieser Masse, ja gar nichts dem Ähnliches; sondern erst indem mein Verstand von der Empfindung zur Ursache derselben übergeht, konstruiert er sich einen Körper, der die Eigenschaft der Solidität, Undurchdringlichkeit und Härte hat.« (VW:72) Dieser Sachverhalt wird bei Bewegungen noch deutlicher: Seite | 46 »Läßt man durch seine geschlossene Hand einen Strick laufen; so wird [der Verstand] als Ursache der Reibung und ihrer Dauer bei solcher Lage seiner Hand einen langen, zylinderförmigen, sich in einer Richtung gleichförmig bewegenden Körper konstruieren. Nimmermehr aber könnte ihm aus jener bloßen Empfindung in seiner Hand die Vorstellung einer Bewegung, d.i. der Veränderung des Ortes im Raum mittelst der Zeit entstehn: denn so etwas kann in ihr nicht liegen noch kann sie allein es jemals erzeugen. Sondern sein Intellekt muß vor aller Erfahrung die Anschauungen des Raumes, der Zeit und damit der Möglichkeit der Bewegung in sich tragen und nicht weniger die Vorstellung der Kausalität, um nun von der allein empirisch gegebenen Empfindung überzugehn auf eine Ursache derselben und solche dann als einen sich also bewegenden Körper von der bezeichneten Gestalt zu konstruieren. Denn wie groß ist doch der Abstand zwischen der bloßen Empfindung in der Hand und den Vorstellungen der Ursächlichkeit, Materialität und der durch die Zeit vermittelten Bewegung im Raum!« (VW:73) Ausdehnung, Undurchdringlichkeit, Kohäsion, Gestalt, Härte, Weiche, Ruhe und Bewegung sowie die Grundlage der objektiven Welt können unmöglich durch die Sinne entstehen. Für Schopenhauer steht fest: Die Grundqualitäten kommen durch den Verstand in die Welt, der zwar nicht die Dinge an sich erschafft, aber doch die Empfindungen, die von den Dingen an sich auf den Körper einwirken, zu den Erscheinungen ummodelt. Raum, Zeit und das Gesetz der Kausalität – »das bereits fertige und aller Erfahrung vorhergängige Dasein dieser Formen macht eben den Intellekt aus« (VW:73). Dem lässt Schopenhauer nun eine völlig unkantische Idee folgen: »Physiologisch ist [der Verstand] eine Funktion des Gehirns, welche dieses sowenig erst aus der Erfahrung erlernt wie der Magen das Verdauen oder die Leber die Gallenabsonderung.« (VW:73) Schopenhauer lässt offen, was das bedeuten soll – dass der Verstand eine Funktion des Gehirns ist. Schopenhauer huldigt nicht dem Vulgärmaterialismus, demgemäß das Denken auf Gehirntätigkeit reduzieren wird; aber er macht nicht klar, in welcher Beziehung das Gehirn zur transzendentalen Leistung der Gegenstandskonstitution steht. Außerdem ist hier eine petitio principii eingeschummelt: Das Gehirn als Organ ist in seiner Gegenständlichkeit vom transzendentalen Verstand konstituiert, und den Verstand als dessen Funktion zu erklären, heißt, die eigentliche Ursache von ihrer Funktion her zu begreifen. Wie dem auch sei, diese Passage zeigt, wie sehr Schopenhauer von den Naturwissenschaften fasziniert ist – und mehr noch, wie gut er sich in diesem Gebiet auskennt. Davon legen die folgenden Passagen in der Dissertation Zeugnis ab: Im Anschluss an das Postulat vom Verstand als Funktion des Gehirns Seite | 47 diskutiert Schopenhauer die Leistungen, die der Verstand vollbringt, um aus den visuellen Empfindungen die ›so unerschöpflich reiche und vielgestaltete sichtbare Welt‹ (VW:75) hervorzubringen. Zunächst dreht der Verstand das verkehrte Bild auf der Retina um (VW:75) – dass die Objekte verkehrt auf der Retina stehen, gilt bis lange ins 20. Jahrhundert als wichtige Erkenntnis. Danach vereinigt der Verstand die beiden Bilder, die die beiden Augen aufnehmen (VW:76). Drittens, der Verstand macht aus den Flächen Körper (VW:82). Viertens, der Verstand erkennt die Entfernung der Objekte von uns (VW:83). Schopenhauer betont, dass der rein formale Teil der empirischen Anschauung, also Raum, Zeit und Kausalität, a priori im Intellekt liegt; dass aber die Anwendung derselben auf die empirischen Data durch ›Übung und Erfahrung‹ erlangt werden (VW:90). »Daher kommt es, daß neugeborene Kinder zwar den Licht- und Farbeindruck empfangen, allein noch nicht die Objekte apprehendieren und eigentlich sehn; sondern sie sind die ersten Wochen hindurch in einem Stupor befangen, der sich alsdann verliert, wann ihr Verstand anfägt, seine Funktion an den Datis der Sinne, zumal des Getasts und Gesichts zu üben, wodurch die objektive Welt allmählich in ihr Bewußtsein tritt.« (VW:90) Dieses Zitat erinnert an Jean Piagets ›sensu-motorische‹ Intelligenzstufe und ist markiert zugleich den Standpunkt des Nativismus unter transzendentalphilosophischen Vorzeichen. Schopenhauer ist sich der Tatsache bewusst, dass seine Kausalitätskonzeption Kant widerspricht (VW:101). Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es in Kants Konzeption das Problem mit der Affektion, die ja nicht ursächlich gedacht werden soll. Dies hat nicht nur Hegel in der 1807 publizierten Phänomenologie des Geistes irritiert und zu Kritik veranlasst, sondern eben auch Schopenhauer, der wohl in Kenntnis von Hegels Werk – er spricht von »Hegelianern und ähnliche Ignoranten« (VW:105) – behauptet, dass er selbst der erste sei, der diesen Missstand in Kants Konzeption aufdeckt. Schopenhauer kritisiert an Kant, dass er »bei der Betrachtung jenes Verhältnisses immer nur den Übergang von der Erscheinung zum Dinge an sich, nicht aber das Entstehen der Anschauung selbst im Auge gehabt hat. […] Die Wahrnehmung ist nämlich bei Kant etwas ganz Unmittelbares, welches ohne alle Beihülfe des Kausalnexus und mithin des Verstandes zustande kommt: er identifiziert sie geradezu mit der Empfindung.« (VW:102) Und dies ist für Schopenhauer eine ›äußerst fehlerhafte Kantische Ansicht‹ (VW:103). Dem hält er entgegen: Seite | 48 »Aber immer und immer besteht die Leistung des Verstandes in unmittelbarem Auffassen der kausalen Verhältnisse: zuerst […] zwischen dem eigenen Leib und den andern Körpern, woraus die objektive Anschauung hervorgeht: dann zwischen diesen objektiv angeschauten Körpern unter einander, wo nun […] das Kausalitätsverhältnis unter drei verschiedenen Formen auftritt, nämlich als Ursache, als Reiz und als Motiv, nach welchen dreien sodann alle Bewegung auf der Welt vorgeht und vom Verstand allein verstanden wird.« (VW:98) Darin sieht Schopenhauer die alleinige Form und Funktion des Verstandes begründet; es bedarf keineswegs das »komplizierte Räderwerk der zwölf Kantischen Kategorien, deren Nichtigkeit ich nachgewiesen habe« (VW:98). Für Schopenhauer ist der ›organische Leib‹ das ›unmittelbare Objekt‹, weil der Leib der Ausgangspunkt für die Anschauung aller anderen Objekte ist (VW:106). Hier nun thematisiert Schopenhauer die oben genannte petitio principii – als Objekt wird der Leib nämlich ebenso wie alle anderen Objekte mittelbar erkannt, »indem er gleich allen andern Objekten sich im Verstande oder Gehirn (welche eins ist) als erkennende Ursache subjektiv gegebener Wirkung und ebendadurch objektiv darstellt« (VW:106). Diese wohl wegen ihrer Widersprüchlichkeit komplizierte Textpassage will Schopenhauer durch die Selbstwahrnehmung erklären – Teile des Leibes erkennen andere Teile desselben Leibes, wie das Auge sehend die Hand und die Hand tastend den Rumpf etc. Nicht nur für mich ist die Konzeption reichlich unverständlich; Schopenhauer dürfte hier sehr unvollständig seine spätere Idee vor-formulieren, die darin liegt, dass der Leib die erste Objektivation des Wille ist. *** Im fünften Kapitel kommen die zweite Klasse von Objekten und die spezifische Ausprägung des Satzes vom zureichenden Grunde auf die Diskussionsliste. Es handelt sich um den Menschen, der sich vom Tier dadurch unterscheidet, dass er eine Klasse von Vorstellungen zusätzlich aufweist, nämlich die Begriffe bzw. die abstrakten Vorstellungen (VW:120). Begriffe sind ›Vorstellungen von Vorstellungen‹ und setzen das voluminöse Gehirn des Menschen voraus (VW:121). Schopenhauer beschreibt die Begriffsbildung wie folgt (Schopenhauer meint natürlich ›empirische‹ Begriffe, keineswegs die transzendentalen Begriffe des Verstandes): »[B]ei ihrer Bildung zerlegt das Abstraktionsvermögen die […] anschaulichen Vorstellungen in ihre Bestandteile, um diese abgesondert, jeden für sich, denken zu können als die verschiedenen Eigenschaften oder Beziehungen der Dinge. Bei diesem Prozesse nun aber büßen die Vorstellung notwendig die Anschaulichkeit ein wie Wasser, wenn in seine Bestandteile zerlegt, die Flüssigkeit und die Sichtbarkeit. Denn jede also ausgesonderte (abstrahierte) Eigenschaft läßt sich für Seite | 49 sich allein wohl denken, jedoch darum nicht für sich allein auch anschauen. Die Bildung eines Begriffs geschieht überhaupt dadurch, daß von dem anschaulich Gegebenen vieles fallengelassen wird, um dann das übrige für sich allein denken zu können: derselbe ist also ein Weniger-Denken, als angeschaut wird.« (VW:121) Die Beschreibung der Begriffsbildung, die Schopenhauer hier wiedergibt, ist durchaus traditionell und entspricht der Auffassung von Begriffsbildung, die heute vorzuherrschen scheint: Gemeinsame Eigenschaften der Einzeldinge werden herausgehoben und zu einer Klasse zusammengefasst, die begrifflich fixiert wird – Begriffe sind ›Inbegiffe‹ von etwas, sie drücken das Wesen bzw. die Quintessenz der Entitäten aus. Die Überwindung dieser Begriffsauffassung, die eine statische Ontologie voraussetzt, wird erst von Wittgenstein (1989a:278; 1989b:37ff) durchbrochen, der statt Abstraktion von ›Familienähnlichkeiten‹ spricht und derart philosophischen Verzicht leistet. Schopenhauer folgt der seit der Antike vertretenen Idee der Begriffsbildung, die darin besteht, vom Besonderen, Zufälligen, Unwesentlichen abzusehen, um das Allgemeine, Notwendige, Wesentliche zu erhalten (s. Regenbogen & Meyer 2005:9). Hier fehlt Schopenhauer jeder Funktionsgedanke; der Funktionsbegriff ist für den Verstand reserviert. Darin hat Schopenhauer sicherlich recht: Dem Hund überhaupt, der Farbe überhaupt, der Triangel überhaupt oder der Zahl überhaupt entspricht keine Vorstellung (VW:126). Die Fähigkeit, zu einen gegebenen anschaulichen Fall den Begriff (die Regel) oder zum Begriff (zur Regel) den besonderen Fall zu finden, heißt seit Kant ›Urteilskraft‹, die Schopenhauer als ›Vermittlerin zwischen der anschauenden und der abstrakten Erkenntnis‹ (VW:127) bezeichnet. Das Denken ist zwar vom Anschauen getrennt, ja denken basiert nicht auf ›blassen Vorstellungen‹ oder ›Ideen‹ – so die empiristische Auffassung –, aber abstraktes und vorstellendes Denken sind für Schopenhauer nicht völlig geschieden: »Nur soviel läßt sich behaupten, daß jede wahre und ursprüngliche Erkenntnis, auch jedes echte Philosophem zu ihrem innersten Kern oder ihrer Wurzel irgendeine anschauliche Auffassung haben muß.« (VW:128) Im Reich des Denkens im engeren Sinn, also dort, wo nur noch abstrakte Begriffe herrschen, geht es um deren Verbindung oder Trennung im Urteil. Das Urteil spricht die Erkenntnis aus, womit sich der Satz vom zureichenden Grund hier als ›principium rationis sufficientis cognoscendi‹ ausdrückt (VW:129). »Als solcher besagt er, daß, wenn ein Urteil eine Erkenntnis ausdrücken soll, es einen zureichenden Grund haben muß: wegen dieser Eigenschaft erhält es so- Seite | 50 dann das Prädikat wahr. Die Wahrheit ist also die Beziehung eines Urteils auf etwas von ihm Verschiedenes, das sein Grund genannt wird.« (VW:129) Schopenhauer unterscheidet in weitere Folge (VW:129ff) (i) die logische Wahrheit – ein Urteil hat ein anderes Urteil zum Grunde (Satz von der Identität, Satz vom ausgeschlossenen Dritten und Satz vom zureichenden Grunde des Erkennens) –, (ii) die empirische oder materiale Wahrheit (gründet unmittelbar in der Erfahrung), (iii) die transzendentale Wahrheit (das Urteil gründet auf den in uns gelegenen Bedingungen) und (iv) die metalogische Wahrheit (die sich von der transzendentalen Wahrheit nicht recht unterscheiden lässt, aber nicht auf den Verstand, sondern die Vernunft zielt). Das Verhältnis von Vernunft zur Empirie fasst Schopenhauer wie folgt zusammen: »Also alles Materielle in unserer Erkenntnis, d.h. alles, was sich nicht auf subjektive Form, selbst-eigene Tätigkeitsweise, Funktion des Intellekts zurückführen läßt, mithin der gesamte Stoff derselben kommt von außen, nämlich zuletzt aus der von der Sinnesempfindung ausgehenden objektiven Anschauung der Körperwelt. Diese anschauliche und dem Stoffe nach empirische Erkenntnis ist es, welche sodann die Vernunft, die wirkliche Vernunft zu Begriffen verarbeitet, die sie durch Worte sinnlich fixiert und dann an ihnen den Stoff hat zu ihren endlosen Kombinationen mittelst Urteilen und Schlüssen, welche das Gewebe unserer Gedankenwelt ausmachen. Die Vernunft hat also durchaus keinen materiellen, sondern bloß einen formellen Inhalt, und dieser ist der Stoff der Logik, welche daher bloße Formen und Regeln zu Gedankenoperationen enthält. Den materiellen Inhalt muß die Vernunft bei ihrem Denken schlechterdings von außen nehmen, aus den anschaulichen Vorstellungen, die der Verstand geschaffen hat. An diesen übt sie ihre Funktion an aus, indem sie, zunächst Begriffe bildend, von den verschiedenen Eigenschaften der Dinge einiges fallen läßt und anderes behält und es nun verbindet zu einem Begriff. Dadurch aber büßen die Vorstellungen ihre Anschaulichkeit ein, gewinnen dafür jedoch an Übersichtlichkeit und Leichtigkeit der Handhabung […] – Dies also und dies allein ist die Tätigkeit der Vernunft: hingegen Stoff aus eigenen Mitteln liefern kann sie nimmermehr.– Sie hat nichts als Formen: sie ist weiblich, sie empfängt bloß, erzeugt nicht. Es ist nicht zufällig, daß sie sowohl in den lateinischen wie den germanischen Sprachen als weiblich auftritt, der Verstand hingegen als männlich.« (VW:141) *** Im sechsten Kapitel wendet sich Schopenhauer der dritten Klasse von Objekten zu, den a priori gegebenen Anschauungen und spürt der spezifischen Ausprägung des Satzes vom zureichenden Grunde unter diesen Vorzeichen nach. Hier die Definition: Seite | 51 »Das Gesetz nun, nach welchem die Teile des Raumes und der Zeit in Absicht auf jene Verhältnisse einander bestimmen, nenne ich den Satz vom zureichenden Grunde des Seins, principium rationis essendi.« (VW:158) Dieses Kapitel widmet sich vornehmlich der Begründung von Geometrie und Arithmetik, weswegen ich es hier überspringen werde. Das siebente Kapitel ist der vierten Klasse von Objekten gewidmet, nämlich dem Subjekt des Wollens, »welchem für das erkennende Subjekt Objekt ist, und zwar nur dem inneren Sinn gegeben« (VW:168). Es handelt sich also um uns selbst, womit diese Klasse »für jeden nur ein Objekt, nämlich das unmittelbare Objekt« (VW:168) umfasst. Schopenhauer thematisiert die Selbsterkenntnis nicht als ›Erkennen von Erkenntnis‹, sondern als ›Erkennen von Wollen‹. »Jede Erkenntnis setzt unumgänglich Subjekt und Objekt voraus. Daher ist auch das Selbstbewußtsein nicht schlechthin einfach; sondern zerfällt eben wie das Bewußtsein von andern Dingen […] in ein Erkanntes und Erkennendes. Hier tritt nun das Erkannte durchaus und ausschließlich als Wille auf. Demnach erkennt das Subjekt sich selbst nur als ein Wollendes, nicht aber als ein Erkennendes. Denn das vorstellende Ich, das Subjekt des Erkennens, kann, da es als notwendiges Korrelat aller Vorstellungen Bedingung derselben ist, nie selbst Vorstellung oder Objekt werden […].« (VW:168) Das Bewusstsein erkennt sich selbst nicht als erkennendes, sondern hinsichtlich seiner Bestimmtheit als Wille. Schopenhauer versteht in seiner Dissertation ›Wille‹ noch in den Bahnen der herkömmlichen philosophischen Begriffsverwendung. Dieser gemäß erlebt sich der Mensch im Wollen als bewusstes einheitliches Ichzentrum (s. Regenbogen & Meyer 2005:734). Folgende Stelle sei als Beleg dafür zitiert: »Der Wille des Individuums aber ist es, der das ganze Getriebe in Tätigkeit versetzt, indem er dem Interesse, d.h. den individuellen Zwecken der Person gemäß den Intellekt antreibt […]. Die Tätigkeit des Willens hiebei ist jedoch so unmittelbar, daß sie meistens nicht ins deutliche Bewußtsein fällt; und so schnelle, daß wir uns bisweilen nicht einmal des Anlasses zu einer also hervorgerufenen Vorstellung bewußt werden.« (VW:171) Es gibt Stellen, wo man wohl die beiden Ausgaben von 1813 und 1847 vergleichen muss, um festzustellen, was Schopenhauer als Dissertant geschrieben hat. Folgende Stelle könnte durchaus aus den frühen Jahren stammen: »Wenn wir in unser Inneres blicken, finden wir uns immer als wollend. Jedoch hat das Wollen viele Grade vom leisesten Wunsche bis zur Leidenschaft […].« (VW:171) Seite | 52 Bei der nächsten Passage allerdings dürfte die Entdeckung, dass das Ding an sich mit dem Willen zu identifizieren ist, aus der späteren Perspektive hinzugesetzt sein. Hier lesen wir: »Die Identität nun aber des Subjekts des Wollens mit dem erkennenden Subjekt, vermöge welcher (und zwar notwendig) das Wort ›Ich‹ beide einschließt und bezeichnet, ist der Weltknoten und daher unerklärlich. Denn nur die Verhältnisse der Objekte sind uns begreiflich […]. Hier hingegen, wo vom Subjekt die Rede ist, gelten die Regeln für das Erkennen der Objekte nicht mehr, und eine wirkliche Identität des Erkennenden mit dem als wollend Erkannten, also des Subjekts mit dem Objekte, ist unmittelbar gegeben. Wer aber das Unerklärliche dieser Identität sich recht vergegenwärtigt, wird sie mit mir das Wunder nennen.« (VW:171) Der Satz vom zureichenden Grunde erfährt damit eine besondere Zuspitzung bezogen auf diese Klasse von Objekten. Da der Mensch nicht nur Erscheinung, sondern auch Ding an sich ist und in diesem Ding-an-sich-Sein nicht gegenständlich erkannt, sondern unmittelbar erfahren wird (von jedem Mensch für sich selbst), wird das Motiv quasi spiegelhaft gebrochen. Das Motiv ist für Schopenhauer ja eine Ursache – es ist gültig für die erste Klasse der Objekte, die Anschauungen. Der Mensch ist nun eine Anschauung für andere Menschen, aber zugleich ist er Ding an sich, und in diesem Modus wird das Motiv nicht als Ursache gesehen, sondern als ›Kausalität von innen‹ erlebt und der Satz vom zureichenden Grund ist eben das Gesetz der Motivation bzw. principium rationis sufficientis agendi (VW:173) »Die Einwirkung des Motivs also wird von uns nicht bloß wie die aller andern Ursachen von außen und daher nur mittelbar, sondern zugleich von innen, ganz unmittelbar und daher ihrer ganzen Wirkungsart nach erkannt. Hier stehn wir gleichsam hinter den Kulissen und erfahren das Geheimnis, wie dem innersten Wesen nach die Ursache die Wirkung herbeiführt; denn hier erkennen wir auf einem ganz andern Wege, daher in ganz andrer Art. […] Die Motivation ist die Kausalität von innen gesehen.« (VW:173) Wenn Schopenhauer dann noch hinzusetzt, dass diese Einsicht der »Grundstein meiner ganzen Metaphysik« (VW:173) ist, dann lesen wir sicherlich den späten Schopenhauer. *** In seiner Dissertation nimmt Schopenhauer den Faden auf, den Kant ihm in die Hand gibt: Wie ist Metaphysik möglich, wenn die Welt der Objekte durch den Satz vom zureichenden Grunde in seiner vierfachen Ausprägung regiert wird, gleichzeitig auf der Subjektseite die Wesenserkenntnis durch die Unerkennbarkeit des Erkenntnissubjekts erschwert bzw. vereitelt wird? Mit der Identität Seite | 53 vom Subjekt der Erkenntnis und dem Subjekt des Wollens scheint sich eine Lösung anzubieten, doch Schopenhauer betreibt, hier in krassem Gegensatz zu Kant, nicht eine affirmative Einschätzung des Willens, sondern verlagert in der Welt als Wille und Vorstellung das Wesen des Menschen ganz vom erkennenden Subjekt weg hin in das Wollen (s. Malter 1988:21). Diese Verschiebung ist eine kreative, originale Leistung. »Angesichts der abendländischen Metaphysiktradition ereignet sich bei Schopenhauer eine Umkehrung alles bislang Gekannten. Das Wesen des Menschen ist nicht der Geist, nicht die Materie, sondern der Wille – und dieses Wesen wird nicht (analog zur Bejahung des Wesens in den überlieferten idealistischen oder materialistischen Positionen) als das, was sein soll, erkannt und anerkannt, es wird vielmehr, weil es nicht sein soll, negiert. Die Ethik, die aus Schopenhauers Metaphysik folgt, steht darin, daß sie dem Wesen des Menschen absagt, in scharfem Gegensatz zu allen anderen metaphysikbedingten Ethiken, die für die menschliche Praxis realisieren, was als Wesen theoretisch erkannt wurde.« (Malter 1988:21) In der Dissertation ist davon allerdings noch nichts zu spüren; hier ist Schopenhauer noch sehr von Kants Intelligibilität des Willens eingenommen. »In der Tat geht Schopenhauers Denken in der Frühzeit ein Stück in die Kantisch-Fichtesche Richtung: nicht in der gegebenen, unter dem Satz vom Grund stehenden Vorstellungswelt, nicht in der Sphäre des Subjekts der theoretischen Vernunft, sondern in der Fähigkeit zu wollen eröffnet sich das, was der Mensch unabhängig von der Zeitlichkeit, in die er durch das im Satz vom Grund sich ausdrückende Gesetz aller Erscheinungen gebunden ist, an sich selbst ist. Auf diese Art der Ermöglichung metaphysischen Wissens deutet die Dissertation von 1813.« (Malter 1988:22) Seite | 54 Dritte Vorlesung Die Dresdner Geburtssituation Mit der Dissertation ist Schopenhauer trotz seines Hochgefühls nicht der entscheidende Durchbruch geglückt; doch Schopenhauer hat ein starkes Vorgefühl, dass er es schaffen wird, die Philosophie in wesentlichen Punkten voranzubringen und sich selbst auf die Liste der ›großen‹ Philosophen zu setzen (s. Safranski 2010:242). Der Durchbruch lässt sich benennen: Er findet in dem Moment statt, in dem Schopenhauer Kants ›Ding an sich‹ mit dem ›Willen‹ gleichsetzt – und das passiert 1815, zwei Jahre nach Fertigstellung der Dissertation, in der er bereits das Subjekt des Erkennens und das Subjekt des Wollens als vereinigt in dem einen Individuum thematisierte. In Schopenhauers Manuskriptbuch findet sich der lakonische Satz: »Der Wille ist Kants Ding an sich: und die Platonische Idee ist die völlig adäquate und erschöpfende Erkenntnis des Dings an sich.« (Schopenhauer zit. nach Safranski 2010:242) Das bessere Bewusstsein, das sich über das transzendental abgesteckte Feld des empirischen Bewusstseins erhebt, ist Schopenhauer richtungweisend. Mit dem Verschwinden des Satzes vom Grunde eröffnet sich ein Grund, der jenseits von Zeit, Raum und Kausalität angesiedelt ist – ein Abgrund. Mit der Entdeckung des Willens findet Schopenhauer den Ausdruck für diese Einsicht, mit der er sich vom philosophischen Zeitgeist und damit den von ihm verachteten Idealisten Fichte, Schelling und Hegel absetzt (s. Safranski 2010: 243). »Man suchte das Warum, statt das Was zu betrachten; man strebte nach der Ferne, statt das überall Nahe zu ergreifen; man gieng nach Außen in allen Richtungen, statt in sich zu gehen, wo jedes Räthsel zu lösen ist.« (Schopenhauer zitiert nach Safranski 2010:245) Nach dem Zerwürfnis mit der Mutter kommt Schopenhauer 1814 nach Dresden, in eine Stadt, die von den Franzosen verwüstet und ausgehungert darniederliegt. Schopenhauer bezieht Quartier in der Großen Meißenschen Gasse 35, übrigens in der Nähe des ›Schwarzen Tores‹, aus dem E.T.A. Hoffmann im Goldenen Topf den Anselmus herausrennen lässt. Schopenhauer meidet das gesellige Leben, ist aber bald in der Oper bekannt – allerdings steht er Carl Maria von Webers Musik ablehnend gegenüber, der zu dieser Zeit das Dresdner Opernhaus leitet. Schopenhauer macht keine Freunde, und es stört ihn nicht (s. Safranski 2010:289ff). »Arthur Schopenhauer spielt in Dresden die Rolle des wenig geliebten, meist respektierten, manchmal bewunderten, oft gefürchteten Sonderlings, der, wie man sagte, die ›ganze Philosophie umwerfen wolle‹. Was Seite | 55 er denn positiv zu lehren beabsichtigte, wusste man nicht, wollte es auch nicht so genau wissen, war doch in Dresden mit Schellings WELTSEELE der philosophische Hunger gestillt.« (Safranski 2010:292) Die vier Dresdner Jahre bezeichnet Schopenhauer im Rückblick als die produktivsten seines Lebens – hier arbeitet er die Metaphysik des Willens aus. Trotz seiner Zurückgezogenheit lässt sich feststellen: »Und doch: Schopenhauers geselliger Umgang, seine öffentliche Existenz verbergen mehr, als sie zum Vorschein bringen. In der Hauptsache lebte er […] mit seinen Büchern und Studien fast gänzlich isoliert und ziemlich einförmig. Hinter den Verschanzungen der Einförmigkeit und Isolation aber ereignet sich das große Abenteuer im Leben Arthur Schopenhauers: die ›Wollust der Konzeption‹ und die schließliche Vollendung des großen Werks.« (Safranski 2010:295) Das Ergebnis der Dresdner Jahre ist Die Welt als Wille und Vorstellung, die Schopenhauer mit folgenden Worten seinem Verleger ankündigt: »Mein Werk also ist ein neues philosophisches System: aber neu im ganzen Sinn des Worts: nicht neue Darstellung des schon Vorhandenen: sondern eine im höchsten Grade zusammenhängende Gedankenreihe, die bisher noch nie in irgend eines Menschen Kopf gekommen.« (Schopenhauer in Safranski 2010:296) In den Tagebüchern fahndet Safranski nach dem Grund, warum Schopenhauer bei seinem Durchbruch darauf kommt, das Was der Welt als Wille zu titulieren. Das Wollen bzw. der Wille tritt in den Notizen dieser Entwicklungszeit durchaus negativ auf, und zwar als dasjenige, was die Welt regiert und aus dem das bessere Bewusstsein Erlösung verschafft (s. Safranski 2010:298f). Der Wille ist in dieser Zeit noch nicht das ›Zauberwort für die Entschlüsselung der Welt‹, aber er ist schon der Name für alles Feindliche. Schopenhauers Entfaltung der Metaphysik des Willens wird auch darauf hinauslaufen, dass er den Willen verneint und darin eine Erlösungsfigur sieht. Schopenhauer leidet zuerst am Willen, der die Welt regiert und von dem er sich durch das bessere Bewusstsein zu lösen versucht; danach erkennt er den Willen als das Ding an sich, womit der Wille die universelle Wirklichkeit ist, die allen Erscheinungen zu Grunde liegt (s. Safranski 2010:200). »In der Darstellung des Hauptwerkes kommt Schopenhauer von der Entdeckung des Willens als Wesen der Welt zu seiner Verneinung; existentiell aber kommt er von der Verneinung des Willens (›besseres Bewußstsein‹) zu der Einsicht, dass es der Wille ist, der in allem Wirklichen erscheint. Indem Schopenhauer also im Namen seines ›besseren Bewußtseins‹ von diesem ›Willen‹ loskommen möchte, entdeckt er in ihm den Einheitspunkt des ganzen Seins. Mit dieser Bewegung, die das Feindliche in den Kern der Welt setzt, die den als quälend erlebten Wil- Seite | 56 len mit dem ›Ding an sich‹ identifiziert, ereignet sich die Geburt der Schopenhauerschen Metaphysik des Willens.« (Safranski 2010:299) Nachdem die Welt der Erscheinungen erklärt werden kann, die Welt des Willens aber das zu Grunde liegende Substratum ausmacht, kann der Wille nicht ›erklärt‹ werden. Tatsächlich ist sich Schopenhauer der Differenz von ›erklären‹ und ›verstehen‹ bewusst und strebt das ›Verstehen‹ des Willens an; im Verstehen wird nicht das Objekt Wille hinsichtlich eines kausalen Grundes erfasst, sondern nach der eigentlichen Bedeutung des Objekts gefragt, das sich dem reflektierenden Individuum in seinem So-sein darbietet. Folglich ist Schopenhauers Metaphysik des Willens eine ›Hermeneutik des Daseins‹ (s. Safranski 2010:305f). Den Willen erkennt man nicht, den Willen kann der Mensch nur unmittelbar erleben, und zwar am eigenen Leib. Als Leib ist der Mensch objektivierter Wille, und als Leib erfährt der Mensch nicht nur die Perspektive der Objekte, sondern ist zugleich ein Objekt – der Mensch kennt an sich das ›Ding an sich‹. Im Menschen fallen ›Ding an sich‹ und ›Erscheinung‹ zusammen, wobei die Dimension der Willenserfahrung niemals ein Erkennen ist (Erkennen ist auf die Erscheinungen beschränkt). Safranski verweist hier auf folgende ›kühne‹ Wendung in den Notizbüchern, die sich allerdings auch in Die Welt als Wille und Vorstellung findet (Seitenzahlen von mir in eckiger Klammer eingefügt): »›Spinoza sagt daß der durch Stoß bewegt Stein, wenn er Bewußtseyn hätte, meinen würde sich aus seinem Willen zu bewegen. Ich setze hinzu daß der Stein Recht hätte.‹ [WWV:191] Wir sind verkörperter Wille, der sich außerdem noch seiner selbst bewußt wird. Nur das Bewußtsein, nicht aber das Wille-Sein unterscheidet uns beispielsweise vom Stein.« (Safranski 2010:308) Was ist dieser Wille, den Schopenhauer der Welt als Vorstellung gegenübersetzt – und zwar als das Ding an sich, das ›hinter‹ den Erscheinungen liegt bzw. die wahre Quintessenz der Welt ausmacht? Zu Schopenhauers Verwendung von ›Wille‹ Schopenhauer weiß, dass er den Begriff ›Wille‹ anders gebraucht, als dies üblich ist – und diese Abweichung trägt nicht nur zu einem erschwerten Verständnis von Schopenhauers Philosophie bei, sondern gar zu Missverständnissen. Üblicher Weise wird der Willensbegriff mit ›Absicht‹, ›Zweck‹ und/oder ›Ziel‹ verbunden: Wenn ich etwas will, dann strebe ich etwas an, und dieses angestrebte Etwas ist zuvor vorgestellt, ausgedacht, ersehnt etc.; das Gewollte ist im Geist, ehe es zur Aktion des Wollens kommt – der Wille ist, mit einem Wort, intel- Seite | 57 lektualisiert. Dieses übliche Willensverständnis findet sich bei Schopenhauer eben nicht (s. Safranski 2010:307) – Schopenhauer will nicht die intellektualisierte Willensauffassung auf die Natur übertragen und demgemäß die Natur vergeistigen, sondern umgekehrt den Geist naturalisieren. »Schopenhauer muß gegen den Strom der spontanen Assoziationen zum Begriff ›Wille‹ ankämpfen. […] Wille ist eine primäre, vitale Strebung und Bewegung, die sich im Grenzfall auch noch ihrer selbst bewußt werden kann und dann erst das Bewußtsein eines Zieles, einer Absicht, eines Zweckes gewinnt.« (Safranski 2010:307) Birnbacher (2009:28ff) widmet der adäquaten Bestimmung des Willens einige Seiten seines Schopenhauer-Büchleins, denn es ist entscheidend, Schopenhauers Begriffsverwendung von ›Willen‹ von Anfang an richtig zu verstehen. Schopenhauer verwendet ›Wille‹ als Bezeichnung für das Was der Welt – die Welt ist Wille. Unter Welt sind Menschen, Tiere, Pflanzen und natürlich auch Mineralien oder Gewässer zu verstehen, woraus sich leicht das Missverständnis ableitet, dass Schopenhauer natürlich ablaufende Prozesse illegitimer Weise aus den bewusst ablaufenden Willensakten herleitet. Was Safranski als falsche Intellektualisierung der Welt anspricht, ist für Birnbacher zwar um nichts weniger richtig, aber immerhin ›nicht ganz unbegründet‹. »Spricht Schopenhauer […] von einem ›Willen in der Natur‹, dann scheint es, als anthropomorphisiere er die Natur und projiziere charakteristisch menschliche Regungen in bewusstseinslose Wesen wie Tiere, Bäume und Dinge hinein. Indem er den Begriff ›Wille‹ auch – und sogar primär – auf psychische Prozesse im Menschen anwendet, deren sich das Subjekt nicht bewusst ist oder nicht einmal bewusst werden kann, erzeugt er den Eindruck, als lege er in den Menschen eine Art Homunkulus hinein, der unabhängig vom bewussten Ich wollen und dessen bewusste Willensregungen sogar konterkarieren kann. Sind das lediglich poetisierende Sprechweisen oder sollte sich Schopenhauer tatsächlich ins Märchenland verirrt haben, wo Tiere, Bäume und Dinge nicht nur wollen und handeln, sondern auch denken und sprechen können?« (Birnbacher 2009:28) Das ist natürlich eine rhetorische Frage, denn die Redeweise vom ›Willen‹ lässt sich wesentlich un-märchenhafter verstehen. Schopenhauer operiert mit offenkundigen Analogien, die zwischen bewusstem menschlichen Wollen und anderen Prozessen einer gerichteten Dynamik in der äußeren Natur bestehen; diese Analogien rechtfertigen die Verwendung eines Wortes, eben des ›Willens‹. Was in der Alltagssprache ›Wollen‹ heißt, was wir also üblicherweise unter ›Wille‹ verstehen, kommt mitnichten ein Sonderstatus zu – der menschliche Wille ist vielmehr eine Dimension der in der Welt herrschenden Dynamik (s. Birnbacher 2009:28f). Seite | 58 Triebdruck und verschiedene Formen eines ›dunklen Drangs‹, den wir beizeiten verspüren, lassen sich trefflich mit Prozessen in der Natur vergleichen. In dieser Feststellung liegt ein Affront verborgen, den Schopenhauer gegen die abendländische Philosophietradition begeht, der uns Heutigen aber schon in Fleisch und Blut übergegangen ist: Traditioneller Weise wird auf das charakteristisch unterscheidende Merkmal des Menschen vis-à-vis der Natur (Dinge, Pflanzen, Tiere) fokussiert, das in der Vernunftbegabung des Menschen liegt: Kraft seines rationalen Denkens und seiner vernünftig-ethischen Entscheidungen nimmt der Mensch eine ontologische Sonderstellung ein. Doch Schopenhauer will die Kluft zwischen Mensch und dem Rest der Welt nicht länger bestehen lassen, er richtet den Blick auf die Gemeinsamkeiten aller Entitäten. Das Wesentliche ist ihm nicht länger das Unterschiedene, sondern das Gemeinsame. Natürlich leugnet Schopenhauer nicht die bislang als wesentlich angesehenen Eigenschaften des Menschen, doch eine einseitige Betonung dieser Eigenschaften korrigiert er (s. Birnbacher 2009:29). Der Mensch ist ein Wesen dieser Welt. »Diesem und keinem anderen Zweck dient der Aufweis der Gemeinsamkeiten zwischen menschlicher und natürlicher Dynamik im Zeichen des ›Willens‹. Was der Mensch in sich als Wollen erfährt, ist lediglich eine – durch ihre unmittelbare Erfahrbarkeit herausgehobene – Facette eines übergreifenden, die Natur in ihrer Gesamtheit durchherrschenden Prozesses.« (Birnbacher 2009:29) Zu diesem ersten Punkt – die strukturelle Ähnlichkeiten zwischen bewusstem Wollen und anderen Formen natürlicher Dynamik – gesellt sich ein weiterer Punkt hinzu, der die unübliche Verwendungsweise von ›Wille‹ rechtfertigt. Schopenhauer will durchaus darauf hinweisen, dass menschliches Wollen und tierische Instinkte, pflanzliche Entwicklungsprinzipien und kosmischen Bewegungsgesetze auf dieselbe Quelle zurückgehen. Die Entstehung des menschlichen Wollens ist nicht aus einer vermeintlichen Sonderstellung des Menschen im Kosmos abzuleiten (s. Birnbacher 2009:30). Trotz dieser guten Gründe, die Schopenhauer wohl zu der unüblichen Verwendung von ›Wille‹ motivieren, bleibt ein Restrisiko, nämlich die fälschliche Personifizierung von natürlichen Prozessen. Darüber hinaus unterscheidet Schopenhauer nicht immer hinreichend zwischen verschiedenen Stufen der Ausweitung von ›Wille‹, von denen er implizit ausgeht – es gibt nicht nur den Willen im alltagssprachlichen Sinn und den Weltwillen im Sinne übergreifender Entwicklungsdynamiken, sondern eine Reihe von Zwischenstufen (s.u.) (s. Birnbacher 2009:30) (s. Birnbacher 2009:30). *** Seite | 59 Schopenhauers Wille hat zwei über den Alltagssinn hinausgehende Bedeutungen: i. Im ersten Sinn meint ›Wille‹ die Summe aller psychischen Phänomene, die man der Sphäre der Antriebe und Gefühle zurechnen kann. Hier gibt es für Schopenhauer Motive, Wünsche, Strebungen, Gefühle, Stimmungen und gefühlshaft betonte Einstellungen, Lust- und Unlustempfindungen. Diese Phänomene sind für die Verhaltensmotivation wichtig und derart Vorbereitungen zu Willensakten (s. Birnbacher 2009:31). ii. In der zweiten Bedeutung meine ›Wille‹ so etwas wie ›Triebenergie‹ oder ›psychische Energie‹. Dieser Begriff erinnert an den Begriff ›conantus‹, den Spinoza eingeführt hat. ›Conatus‹ meint einen ohne Zutun des Bewusstseins ablaufenden und auf Selbsterhaltung und Fortpflanzung gerichteten Prozess (s. Birnbacher 2009:31). (›Conatus‹, lat. ›Anlauf‹, ›Unterfangen‹, die eingeschlagene Richtung, das Streben, die Tendenz) In beiden Bedeutungen ist ›Wille‹ etwas von der jeweiligen Person Unabhängiges und Autonomes. Die motivationalen und emotionalen Phänomene, für die ›Wille‹ in seiner ersten Bedeutung steht, sind zumindest teilweise dem Bewusstsein zugänglich; mehr noch, sie sind uns unmittelbar bekannt und vertraut. Aber der so verstandene Wille ist nur zu einem verschwindenden Teil ›unser‹ Wille. Der Wille wirkt zwar in uns, ist und bleibt aber nur in Grenzen steuerbar. Oder, anders ausgedrückt: Der Mensch ist dem Willen in seiner ersten Bedeutung ausgesetzt – die Mehrzahl der Motivationen, Emotionen, Stimmungen, Lust- beziehungsweise Unlustempfindungen entzieht sich einem willentlichen Zugriff und stellt sich dem bewussten Willen mitunter auch entgegen (als übermächtiges Gefühl, unwiderstehliches Verlangen oder unüberwindbare Hemmung) (s. Birnbacher 2009: 31f). »Den Großteil der Willensphänomene in Schopenhauers erster Bedeutung machen Widerfahrnisse aus, denen gegenüber wir nur in engen Grenzen souverän sind. Bezeichnend dafür ist, dass Schopenhauer gerade das sexuelle Verlangen zum Paradigma des Willens macht. Dieser ›Wille‹ ist anders als der Wille im alltagssprachlichen Sinn nichts, was aktiv und autonom in die Welt eingreift, sondern eine passio, etwas Erlittenes. Er ist darüber hinaus etwas hochgradig Unpersönliches, Überindividuelles, Ursprüngliches.« (Birnbacher 2009:32) Wendet man sich der zweiten Bedeutung von ›Wille‹ als Triebenergie zu, so lässt sich auch hier feststellen, dass der Wille unpersönlich ist. Schopenhauer bezieht sich auf den Willen in dieser Bedeutung in hydraulischen Metaphern: Der Trieb verhält sich wie eine Flüssigkeit in einem Röhrensystem, die ›anflutet‹, ›abebbt‹, ›Druck erzeugt‹ und das Bewusstsein gelegentlich ›über- Seite | 60 schwemmt‹; der Strom psychischer Energie bewegt sich in einem ›beständigen Ebben und Fluten‹; solange dieser Energiefluss ungehindert fließt, verspüren wir Lust, sobald er gehemmt wird, treten Unlustgefühle auf (s. z.B. Zürcher Ausgabe, Band VI: 52). Freud favorisiert übrigens ebenfalls eine hydraulische Redeweise (s. Birnbacher 2009:32). Pointiert zusammenfassend lässt sich festhalten: »Mit seinem erweiterten Willensbegriff gibt Schopenhauer der Einsicht Ausdruck, dass wir meistenteils von Strebungen geleitet sind, die dauerhaft unbewusst bleiben und dennoch insofern gerichtet sind, als sie auf die Herstellung bestimmter Zustände zielen. Diese Strebungen nehmen eine Zwischenstellung zwischen autonomen Prozessen im Nervensystem und bewussten Vorgängen ein. Die Eigenschaft, dem Bewusstsein unzugänglich zu sein, haben sie mit den im Nervensystem ablaufenden autonomen Prozessen gemeinsam, die Eigenschaft, gerichtet zu sein, mit den intentional auf bestimmte Handlungen bezogenen Willensakte im Alltagssinn. Am ehesten ähneln sie den auf die Erreichung bestimmter vorgegebener Gleichgewichtszustände gerichteten physiologischen Prozessen, die seit Claude Bernard ›homöostatisch‹ genannt werden, unterscheiden sich von ihnen jedoch dadurch, dass sie, obwohl selbst dauerhaft unbewusst, mit Bewusstseinsvorgängen in engem Zusammenhang stehen. Anders als rein physiologische, auf die Herstellung von Gleichgewichten gerichtete Systeme wie der ›Wärmehaushalt‹ des Körpers lassen sich die psychischen Gleichgewichte und Ungleichgewichte aus dem, was im Bewusstsein vorgeht, zumindest teilweise erschließen, so wie diese umgekehrt das, was sich im Bewusstsein abspielt, zumindest teilweise erklären.« (Birnbacher 2009:32f) Ein Beispiel für eine gerichtete und insofern willensähnliche, aber gegen das Bewusstsein abgeschirmte Aktion des ›Willens‹ ist die ›Verdrängung‹ (Birnbacher 2009:33) unerwünschter Bewusstseinsinhalte. Schopenhauer schreibt: »Wir können Jahre lang einen Wunsch hegen, ohne ihn uns einzugestehn, oder auch nur zum klaren Bewußsteyn kommen zu lassen; weil der Intellekt nicht davon erfahren soll; indem die gute Meinung, welche wir von uns selbst haben, dabei zu leiden hätte: wird er aber erfüllt, so erfahren wie an unserer Freude, nicht ohne Beschämung, daß wie Dies gewünscht haben: z.B. den Tod eines nahen Anverwandten, den wir beerben. Und was wir eigentlich fürchten, wissen wir bisweilen nicht; weil uns der Muth fehlt, es uns zum klaren Bewßtseyn zu bringen.« (Zürcher Ausgabe, Band III: 244 zitiert nach Birnbacher 2009:33f) Die Inhalte, die aus dem Bewusstsein getilgt oder erst gar nicht zur Kenntnis genommen werden, weil sie die Selbstachtung durchaus beeinträchtigen und das seelische Gleichgewicht aus dem Lot bringen, sind für Schopenhauer also unerwünschte Wünsche, oder Motive wie Todeswünsche gegen nahe Ver- Seite | 61 wandte, oder Motive wie Schadenfreude und Rache; diese sind nicht nur öffentlich tabuisiert, sondern durchaus vor einem selbst zu verheimlichen (s. Birnbacher 2009:33). Schopenhauer interpretiert die Schizophrenie als Verdrängungszustand (s. Birnbacher 2009:34): In seiner Berliner Zeit interessiert er sich für diese Erkrankung und strebt eine empirische Erklärung an, was im Gegensatz zu der damaligen psychiatrischen Herangehensweise steht. Schopenhauer besucht in der Berliner Charité zwei Patienten und beschäftigt sich eingehend mit ihnen. Er kommt zum Resultat, dass Schizophrenie – vornehmlich aufgrund der Symptome Realitätsverlust und Rückzug in die Privatwelt von Halluzinationen – eine Reaktion des Organismus auf unerträgliche biografische Erfahrungen ist: Der Geist tilgt, weil er die seelischen Qualen nicht ertragen kann, und füllt die Erinnerungslücken mit Wahngebilden (s. auch Zentner 1995). Die Sexualität wird von Schopenhauer ebenfalls als unbewusste Dynamik mit schwerwiegenden Folgen für das bewusste Erleben konzeptualisiert. Sexualität ist ein gerichteter Vorgang, der vom Subjekt in seiner biologisch programmierten Zielrichtung nicht notwendiger Weise und auch nur bruchstückhaft erkannt wird. Die Sexualität ermöglicht Schopenhauer übrigens eine beeindruckende Demonstration der These, dass bewusste und unbewusste Absichten in verschiedene Richtungen gehen und wir uns über die ›Quasiabsichten‹, die die Natur mit unserem Gefühlsleben verfolgt, nachhaltig täuschen. Dem Individuum geht es um den Liebenspartner, der Natur geht es allein um das Wohl der Gattung (s. Birnbacher 2009:35). Schopenhauer schreibt: »Was […] den Menschen hiebei leitet, ist wirklich ein Instinkt, der auf das Beste der Gattung gerichtet ist, während der Mensch selbst bloß den erhöhten eigenen Genuß zu suchen wähnt.« (Zürcher Ausgabe, Band IV: 631 zitiert nach Birnbacher 2009:35) Damit, so Birnbacher (2009:35), antizipiert Schopenhauer neueste Forschungsergebnisse der evolutionären Psychologie, deren paradigmatischen Grundhaltungen gegenüber ich höchst skeptisch bin. Birnbacher sieht darin etwas Positives; doch diese Parallele ist wohl überstrapaziert. Wichtiger scheint die Parallele zur Biologie des 19. Jahrhunderts – weniger zu Charles Darwin (der erst nach Schopenhauer seine Evolutionstheorie formuliert, s.o.), sondern mehr zu den französischen Materialisten und JeanBaptiste Lamarck. Die Abstammung des Menschen vom Affen steht für Schopenhauer außer Frage; die Vernunft fasst er durchaus als ein Produkt der Evolution auf, die sich wie die physischen Fähigkeiten als ein Mittel der blinden Natur zur Erhaltung und Fortpflanzung ihrer Wesen entwickelt hat. Das Bewusstsein ist eine Errungenschaft, die die Natur nicht von Anfang an besitzt Seite | 62 (womit sich Schopenhauer gegen die christliche Gottesvorstellung wendet); die Vernunft tritt auf, wenn sie für die Erhaltung einer Gattung unerlässlich ist. Das Bewusstsein entsteht aus dem Unbewussten, i.e. aus natürlichen Vorgängen der Fortpflanzung und Arterhaltung, bzw. es emergiert aus diesen (s. Birnbacher 2009:37). Schopenhauer fasst diesen Vorgang wie folgt: »Der Wille, der bis hieher im Dunkeln, höchst sicher und unfehlbar, seinen Trieb verfolgte, hat sich auf dieser Stufe ein Licht angezündet.« (Zürcher Ausgabe, Band I: 202 zitiert nach Birnbacher 2009:37) Dass der hier angesprochene Weltwille nicht personifiziert zu denken ist, sollte klar sein – Schopenhauer identifiziert den Willen nicht mit Gott, sondern immer mit einem blinden Drängen. Daher darf der Wille nicht als tätiges Subjekt verstanden werden – Schopenhauers nette Formulierung sollte ausschließlich metaphorisch verstanden werden. Schopenhauer sieht in der Entwicklung des Bewusstseins, das aus dem Gehirn entspringt, allerdings keinen Fortschritt zum Besseren oder Höheren, sondern eine Verschärfung und Intensivierung der dem Prozess inhärenten Sinnlosigkeit und Absurdität: »Da der ›Weltwille‹ lediglich Selbsterhaltung und Fortpflanzung als Zwecke kennt, dreht sich die durch ihn angetriebene Entwicklung fortwährend im Kreis. Mit dem Bewusstsein verschärft sich diese Sinnlosigkeit, denn mit ihm tritt das Leiden in die Welt, zunächst bei den Tieren in Gestalt von Schmerz, Angst und Frustration, dann im Menschen in der verschärften Form des Leidens an der Unerfülltheit von Hoffnungen, der Heimsuchung durch Bosheit und Grausamkeit und des Leidens an der Sinnlosigkeit der Welt. Der ›Weltwille‹ ist, metaphorisch gesprochen, ein Egoist. Er will seine eigene Erhaltung, nicht das Glück seiner Geschöpfe. Vernunft und Bewusstsein des Menschen sind für ihn lediglich Mittel, nicht Zweck.« (Birnbacher 2009:38) Die Vernunft bleibt dem Affekt ›dienstbar‹ (Birnbacher 2009:38). »Gegen die mächtige Stimme der Natur vermag die Reflexion wenig.« (WWV:388f) Selbst dort, wo sich das Individuum autonom und souverän erlebt, ist die Vernunft als evolutionäres Produkt des Willens ein willfähriges Werkzeug unbewusster Willensstrebungen. Der Primat des Affektiven zeigt sich in einer Allgegenwart des Gefühlshaften, das nach dem Ermüden des Intellekts sofort aufscheint – erkennend verhalten wir uns eben nur zeitweilig (s. Birnbacher 2009:39). Aufgrund der Tatsache, dass dem Menschen das Denken große Mühe bereitet, schließt Schopenhauer, dass uns Menschen das rationale Denken nicht wirklich liegt. Und sollte es das den Menschen auszeichnende Charakteristikum Seite | 63 sein – dafür ist es ausgesprochen fehleranfällig (s. Birnbacher 2009:39). Die ›Anthropologie des Primats des Willens‹, die hier bloß angedeutet ist und die ich später noch eingehender diskutieren werde, steht in Zusammenhang mit Schopenhauers Auffassung von der Identität des Bewusstseins mit körperlichen Prozessen. Birnbacher (2009:40) bezeichnet dies als ›bahnbrechende Auffassung‹; ich sehe hierin eher die eben angesprochene Fehleranfälligkeit des menschlichen Denkens... *** Ich möchte noch einmal zu Schopenhauers Weltwillen zurückkehren, dessen Ähnlichkeit zum personalen christlichen Schöpfergott oben kurz angesprochen wurde. Hierzu formuliert Birnbacher folgende Überlegung: »Könnte es nicht sein, dass Schopenhauers nihilistische Metaphysik eines blinden ›Weltwillens‹ ganz ebenso als Illusion abgetan werden müsste, gewissermaßen als Antithese zur optimistisch orientierten Metaphysik der Ideen, Götter und Geiser – mit dem einzigen Unterschied, dass in diesem Fall nicht Wünsche und Hoffnungen, sondern Ängste und Enttäuschungen den Ton angeben? Ist eine Metaphysik, auch wenn sie die Vorzeichen umkehrt, nicht ebenfalls eine unbewusste oder halbbewusste Projektion des konkret Erfahrenen in eine aller Erfahrung entrückte Welt jenseits von Raum und Zeit? Betätigt sich nicht auch Schopenhauer, indem er etwa den Weltwillen mit dem außerhalb von Raum und Zeit existierenden kantischen ›Ding an sich‹ identifiziert, als ›Zauberer‹, der seinen Lesern etwas vorgaukelt – so wie es ihm Ludwig Marcuse mit folgender Bemerkung unterstellte: ›Schopenhauer […] zauberte noch einmal – ein letztes Mal – mit der Entzauberung‹? Diese Frage lässt sich zuspitzen, indem man darauf hinweist, dass auch Schopenhauers Metaphysik des ›Weltwillens‹ nicht konsequent pessimistisch ist, sondern eine ganze Reihe der lebensbejahenden Funktionen übernimmt, die er der abendländischen Metaphysiktradition zum Vorwurf macht. Denn eigentümlicherweise wird der ›Weltwille‹ bei Schopenhauer nicht durchwegs dämonisiert. In seiner Ethik ist die Einsicht in die Einheit des Willens in allen bewusstseinsfähigen Wesen das Eingangstor zur wahren Moralität; in seiner Ästhetik ist die Musik die höchste unter den Künsten, weil sie das Wesen des Willens am adäquatesten zur Darstellung bringt; in seiner Erlösungslehre und Todeskonzeption wird die Auflösung des individuellen Willens in den Gesamtwillen keineswegs als Verschärfung von Abhängigkeit und Verfallenheit, vielmehr wird sie im Gegenteil als Befreiung und Erlösung aufgefasst – so, als wäre das Eingehen in den Ursprung aller Dinge auch hier eine Art ›Eingehen in Gott‹. Muss sich Schopenhauer nicht insofern dieselbe Art projektiven und illusionistischen Denkens vorhalten lassen, die er an seinen Widersachern, den deutschen Idealisten, zu kritisieren nicht müde wird?« (Birnbacher 2009:47f) Seite | 64 Die Antworten werden letztlich auf Ja lauten. Schopenhauer ist der letzte große Metaphysiker und Systemdenker. Nach ihm wird sich die Einsicht durchsetzen, dass die Welt nur noch in fragmentarischen Brocken zu erfassen ist. Die ›große Erzählung‹ wird untergehen – nicht erst in der Postmoderne. Gedankengang und Komposition von WWV Folgendes Zitat soll in aller Kürze an Kontinuität und Bruch zwischen Frühwerk und reifem Werk erinnern: »Die Schopenhauersche Frühphilosophie bereitet die Explikation dieser Gedankenbewegung insofern vor, als sie ständig von einem Prozeß handelt, dessen Struktur im Hauptwerk explizit als Prozeß zwischen Erkenntnis- und Willenssubjekt abläuft. Wie nämlich in der Frühphilosophie das zur Einheit des Ichs vereinigte empirische und bessere Bewußtsein sich gegenläufig zueinander sich verhalten und das Bewußtsein selbst auf Überwindung seiner empirischen Gestalt drängt, so werden in der ›Welt als Wille und Vorstellung‹ […] Wollen und Erkennen, die beide ein und demselben Subjekt angehören (›Ich‹), in eine Bewegung gebracht, in der das Wollen (das Wesen des Ichs) durch seine eigene Erscheinung (das Erkennen) überwunden und darin Erlösung erreicht wird. Schopenhauers Philosophie stellt sich so von Anfang an als eine Befreiungs(Erlösungs-)Philosophie dar. Erlösung kommt durch Weltaufhebung. Wie sie erfolgt, ist zunächst vage, mehr und mehr jedoch konkretisiert sich der Modus der Weltaufhebung bis zu dem Punkt, an dem endgültig feststeht, was das Aufzuhebende (›Welt‹) an sich ist (nämlich Wille) und wer die Aufhebung leistet (das Subjekt des Erkennens).« (Malter 1988:28f) Schopenhauers Denken entzündet sich an der Frage: Was ist die Welt, der solches Dasein angehört? Natürlich behauptet Schopenhauer, auf diese Frage eine Antwort gegeben zu haben – nicht eine, sondern die Antwort. Er hat also das Was der Welt gefunden, womit sich Schopenhauer zugleich affirmativ zur Metaphysik bekennt, zu jener Art des Philosophierens also, die Kant als ›Kampfplatz‹ bezeichnet. Doch Schopenhauer will das Was beantworten, er will nicht bloß von den Erscheinungen handeln, sondern von den Dingen an sich; er will sich an der Wahrheit berauschen. »›Die Welt als Wille und Vorstellung‹ ist die literarische Fixierung der schon Jahre vor ihrem Erscheinen gefundenen Auflösung des Rätsels ›Welt‹.« (Malter 1988:30). Wenn die Welt für eine erkennende Instanz da ist, die identisch mit dem Subjekt des Wollens ist, so bieten sich am Leitfaden der Frage nach dem Was der Welt zwei Betrachtungsarten der Welt an: Zum einen die Betrachtung der Welt, insofern sie für das erkennende Subjekt ist – die Betrachtung der Welt als Seite | 65 Vorstellung; zum anderen insofern, als demselben Subjekt des Erkennens als leiblich-individuell Erkennendes die Welt in ihrem Charakter als Wollen aufgeht; das Subjekt des Erkennens erfasst unmittelbar seine Identität mit dem Wollenssubjekt – die Betrachtung der Welt als Wille (s. Malter 1988:32f). Schopenhauer eröffnet Die Welt als Wille und Vorstellung mit dem Hinweis darauf, dass sein Werk – in der Suhrkamp-Ausgabe immerhin 558 Seiten, mit Anhang gar 715 Seiten stark – die Darstellung eines Gedankens ist. »Was durch [dieses Buch] mitgeteilt werden soll, ist ein einziger Gedanke. […] Ich halte jenen Gedanken für dasjenige, was man unter dem Namen der Philosophie sehr lange gesucht hat […]. Je nachdem man jenen einen mitzuteilenden Gedanken von verschiedenen Seiten betrachtet, zeigt er sich als das, was man Metaphysik, das, was man Ethik und das, was man Ästhetik genannt hat; und freilich müsste er auch dieses alles sein, wenn er wäre, wofür ich ihn, wie schon eingestanden, halte. […][E]in einziger Gedanke muß, so umfassend er auch sein mag, die vollkommene Einheit bewahren.« (WWV:7) Weil sein Werk ›organisch, nicht kettenartig‹ gebaut ist, empfiehlt Schopenhauer dem/r LeserIn »das Buch zweimal zu lesen, und zwar das erste Mal mit vieler Geduld, welche allein zu schöpfen ist aus dem freiwillig geschenkten Glauben, daß der Anfang das Ende beinahe so sehr voraussetze als das Ende den Anfang […]« (WWV:8). Nach diesem Tipp hat Schopenhauer weitere Forderungen an den/die LeserIn parat: Man muss seine Dissertation ›Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde‹ gelesen haben – »[o]hne Bekanntschaft mit dieser Einleitung und Propädeutik ist das eigentliche Verständnis gegenwärtiger Schrift ganz und gar nicht möglich« (WWV:9). Außerdem sollte der/die LeserIn von Die Welt als Wille und Vorstellung auch mit Kants Schriften vertraut sein; die epochale Zeitenwende durch die Kritik der reinen Vernunft und der folgenden kritischen Schriften fasst Schopenhauer in folgendem Bild: »Die Wirkung, welche [die Hauptschriften Kants] in dem Geiste, zu welchem sie wirklich reden, hervorbringen, finde ich in der Tat […] der Staroperation am Blinden gar sehr zu vergleichen: und wenn wir das Gleichnis fortsetzen wollen, so ist mein Zweck dadurch zu bezeichnen, daß ich denen, an welchen jene Operation gelungen ist, eine Starbrille habe in die Hand geben wollen, zu deren Gebrauch also jene Operation selbst die notwendige Bedingung ist.« (WWV:10) Außer der Lektüre des ›großen Kant‹ empfehlen sich intime Kenntnisse des ›göttlichen Platon‹. Und Schopenhauer fordert auch Kenntnisse der indischen Veden, was ›vorteilshaft‹ sei (WWV:11). Seite | 66 Koketterie ist Schopenhauer nicht völlig fremd; nach dem finanziellen Debakel seiner Dissertation, die sich als Buch nicht wirklich verkaufte, formuliert er gegen Ende der Einleitung folgende Worte: »Welcher Gebildete dieser Zeit […] könnte es ertragen, fast auf jeder Seite Gedanken zu begegnen, die dem, was er doch selbst ein für allemal als wahr und ausgemacht festgesetzt hat, geradezu widersprechen? […] Daher mein Rat ist, das Buch nur wieder wegzulegen. Allein ich fürchte selbst so nicht loszukommen. Der bis zur Vorrede, die ihn abweist, gelangte Leser hat das Buch für bares Geld gekauft und frägt, was ihn schadlos hält? – Meine letzte Zuflucht ist jetzt, ihn zu erinnern, daß er ein Buch, auch ohne es gerade zu lesen, doch auf mancherlei Art zu benutzen weiß. Es kann, so gut wie viele andere, eine Lücke seiner Bibliothek ausfüllen, wo es sich, sauber gebunden, gewiß gut ausnehmen wird. Oder auch er kann es seiner gelehrten Freundin auf die Toilette oder den Teetisch legen. Oder endlich er kann ja, was gewiß das beste von allem ist und ich besonders rate, es rezensieren.« (WWV:13) Dennoch, diese Koketterie ist nicht das Ende der Einleitung; diese beendet Schopenhauer vielmehr mit einem gewichtigeren Gedanken, der dann wieder voller Ernst ist: »Aber das Leben ist kurz und die Wahrheit wirkt ferne und lebt lange: sagen wir die Wahrheit.« (WWV:13) *** Die Welt als Wille und Vorstellung untergliedert sich in vier Bücher: Erstes Buch Der Welt als Vorstellung erste Betrachtung: Die Vorstellung, unterworfen dem Satz vom Grunde: Das Objekt der Erfahrung und Wissenschaft Zweites Buch Der Welt als Wille erste Betrachtung: Die Objektivation des Willens Drittes Buch Der Welt als Vorstellung zweite Betrachtung: Die Vorstellung, unabhängig vom Satz des Grundes: Die Platonische Idee: Das Objekt der Kunst Viertes Buch Der Wille zweite Betrachtung: Bei erreichter Selbsterkenntnis, Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben Besonders schön sind die Motti zum ersten und zum vierten Buch. Dem ersten Buch stellt Schopenhauer folgende Worte von Jean-Jacques Rousseau (aus La Nouvelle Héloise) voran: Seite | 67 »Sors de l’enfance, ami, réveille-toi! [Laß hinter dir die Kindheit, Freund, erwache!]« (WWV:29) Dem vierten Buch wird eine Weisheit aus den Upanishaden vorangestellt: »Tempore, quo cognitio simul advenit, amor e medio supersurrexit. [Zur Zeit, da sich die Erkenntnis einstellte, hat die Begierde sich von dannen gehoben.]« (WWV:371) Das erste Buch der WWV handelt vom Unterworfensein der Welt als Vorstellung unter das Grundprinzip (i.e. die vierfache Wurzel vom Satz des zureichenden Grundes). Das zweite Buch hat als Thema die Betrachtung des sich selbst in unterschiedlichen Gestalten entfaltenden Willens; es handelt vom Willen in seinem Wollen. Hier legt Schopenhauer seine Metaphysik und die aus ihr resultierende Naturphilosophie dar. Dem Willen in seinem Wollen ist der Satz vom Grund nicht inhärent, gleichwohl die Objektivation des Willens den Satz vom Grund insofern aktiviert, als diese Objektivation für das erkennende Subjekt ist und die Objektbestimmtheit durch das Grund-Prinzip kommt (s. Malter 1988: 33). Das Unterworfensein der Vorstellung (im Sinne des erkannten Objekts) unter den Satz vom Grunde ist eine transzendente Frage, deren Beantwortung Schopenhauer im dritten Buch nachgeht; hier wird nun Platon in Anschlag gebracht. Nicht in gleichem Ausmaß transzendent, aber eben doch, ist die Frage nach der Befreiung des Individuums aus der Unterworfenheit unter dem Satz vom Grunde und damit von der mit dem Satz vom Grunde synthetisch verbundenen Willensherrschaft; hiervon handelt das vierte Buch (s. Malter 1988: 34). Die beiden ersten Bücher stellen Schopenhauers ›Elementarlehre‹ dar und nennen die Momente der negativen Bewusstseinsverfassung: Wille und Satz vom Grunde. Die beiden hinteren Bücher lassen sich als Schopenhauers ›Freiheitslehre‹ bezeichnen und nennen die Voraussetzungen für die Überwindung der theoretischen Resultate der Elementarlehre: Durchschauen des Satzes vom Grunde und Verneinung des Willens, beides ermöglicht durch Erkenntnis (s. Malter 1988:34). »Auf den Punkt gebracht, kann man die Hauptthematik der beiden großen Hälften (Erstes/Zweites – Drittes/Viertes Buch), wenn man sie in ihrem prozessualen Charakter kennzeichnen will, so formulieren: ›Von der Unfreiheit des Subjekts des Wollens zur Freiheit des Subjekt des Erkennens‹.« (Malter 1988:34) Dank der Identität von Erkenntnis- und Wollenssubjekt spielt sich der Weltprozess zwischen den beiden Polen Unfreiheit des Subjekts des Wollens und Freiheit des Subjekt des Erkennens ab; dabei sind die beiden Pole und ihre Iden- Seite | 68 tität Faktizitäten, der Weltprozess mithin nicht erschlossen durch Begriffe (s. Malter 1988:35). In diesem Sinn notiert Schopenhauer in seinem Notizbuch: »Meine Philosophie wird nie im Mindesten das Gebiet der Erfahrung, d.h. des Wahrnehmbaren, im ganzen Umfang des Begriffs, überschreiten. Denn sie wird, wie jede Kunst, bloß die Welt wiederholen.« (Schopenhauer in Malter 1988:35) *** Die ›Reflexionsphilosophie‹, i.e. die philosophischen Systeme von Kants Nachfolgern Fichte, Schelling und Hegel, hat auf das Ding an sich in das Denken gesetzt (daher: ›Deutscher Idealismus‹ – was im Geist ist, ist real). Schopenhauer entdeckt das Ding an sich im Willen – die ›Rück-Seite der Vor-Stellung‹ ist nicht Geist, der sich bei der Arbeit zuschaut, sondern Natur. Dabei handelt es sich um die erlebte Natur in uns, nicht um die Natur als äußeres Objekt (s. Safranski 2010:301). »Der Wille, der allem zugrunde liegt, ist eben nicht Geist, der sich verwirklicht, sondern ein blindes, wucherndes, ziellos, sich selbst zerfleischendes Treiben, ohne Transparenz auf etwas Gemeintes, auf etwas Sinnvolles hin. Das Wirkliche wird nicht von Vernunft, sondern von solchem ›Willen‹ durchherrscht.« (Safranski 2010:310f) Als Beispiel für dieses blinde, ziellos-wuchernde und sich selbst zerfleischende Treiben nennt Schopenhauer Napoleon, dessen ansichtig Hegel in Jena 1806 vom ›Weltseele zu Pferde‹ (bzw. ›Weltgeist zu Pferd‹) gesprochen hat. Dergleichen ist für Schopenhauer nachgerade lächerlich – Napoleon hat das von Schopenhauer so geliebte Dresden in Schutt und Asche gelegt. »Bonaparte ist wohl eigentlich nicht schlechter als viele Menschen, um nicht zu sagen die meisten. Er hat eben den ganz gewöhnlichen Egoismus sein Wohl auf Kosten Anderer zu suchen. Was ihn auszeichnet ist bloß die größere Kraft diesem Willen zu genügen. Dadurch daß ihm diese seltne Kraft gegeben ist, hat er die ganze Bosheit des menschlichen Willens offenbart: und die Leiden seines Zeitalters, als die nothwendige andre Seite davon, offenbarten den Jammer der mit dem bösen Willen, dessen Erscheinung im Ganzen diese Welt ist, unzertrennlich verknüpft ist.« (Schopenhauer in Safranski 2010:311) Verbindung und Bruch zwischen Frühwerk und reifem Werk liegt für Safranski (2010:323) übrigens darin, dass Schopenhauer vom ›Willensdrang‹ zum ›Willensschauspiel‹ übergeht. Schließlich ist die Selbsterfahrung des eigenen Leibes »der einzige Punkt, wo ich erfahren kann, was die Welt ist, außer daß sie meine Vorstellung ist« (Safranski 2010:317). Mit der unmittelbaren Selbsterfahrung des Willens taucht das Individuum in eine Dimension ein, die unter dem ›principium individuationis‹ angesiedelt Seite | 69 ist. Damit ist zugleich Schopenhauers großes Problem angesprochen: Weil jeder von uns das Ding an sich ist, können wir es nicht von außen sehen – ebenso wenig wie sich das Auge selbst sehen kann. Von welchem Ort kann man den Willen, i.e. das Ding an sich erfassen, ohne selbst Wille zu sein? Die Individualität muss abgestreift werden, weil sonst das Erfassen im Gestrüpp der Erscheinung hängen bleibt. Die Lösung dieses Problem bezeichnet Safranski (2010:324) als Schopenhauers ›pfiffige Wendung‹ und beschreibt sie wie folgt: »Das Subjekt des Wollens, als das unterindividuelle ›Ding an sich‹, kann nur angeschaut werden vom Über-individuellen, nämlich vom reinen Subjekt der Erkenntnis; ›rein‹ heißt hier: gelöst vom Willen und damit von den empirischen Interessen des Individuums. Also: willenlose Anschauung des Willens. Zwischen dem Unterindividuellen und dem Überindividuellen vollzieht sich eine heikle Transaktion: Der metaphysische Charme des Willens (seine Raum-Zeit-Grundlosigkeit) soll in den Anschauungsakt hinüberwandern, nicht aber die Substanz dieses Willens, sein Begehren, Drängen, Treiben. Schopenhauer jongliert mit Begriffen. Es wird nun alles darauf ankommen, ob es ihm gelingt, […] die Existenz einer solchen Anschauung aufzuweisen. Es geht nicht darum, ob solches Anschauen denkbar ist, sondern ob es das gibt. Und um zu wissen, ob es das gibt, muß man es bei sich selbst kennengelernt haben. Schopenhauer hat es kennengelernt, und er will in Begriffen davon reden. Seine ganze Philosophie redet davon.« (Safranski 2010:324) Seite | 70 Vierte Vorlesung Lektüre der WWV: Die Welt als Vorstellung Das erste Buch von Die Welt als Wille und Vorstellung diskutiert die Welt als Vorstellung; hier thematisiert Schopenhauer die Kantische Philosophie in der von ihm selbst vorgenommenen Variation. »Keine Wahrheit ist also gewisser, von allen andern unabhängiger und eines Beweises weniger bedürftig als diese, daß alles, was für die Erkenntnis daist, also die ganze Welt, nur Objekt in Beziehung auf das Subjekt ist, Anschauung des Anschauenden, mit einem Wort: Vorstellung.« (WWV:31) So wahr diese Betrachtung auch sein mag – Schopenhauer hält fest, dass diese Betrachtung ›einseitig‹ (WWV:32) ist; schließlich hat die Welt noch eine andere Seite, nämlich die Rückseite zur Vor-Stellung. Schopenhauers thematisiert hier die Welt explizit als ›für die Erkenntnis daseiend‹, und in dieser Hinsicht ist die Welt Vorstellung, wobei zur Gegenstandskonstitution zwei Instanzen gehören, nämlich Subjekt und Objekt; die subjektive Idealität ist objektiv real. Diese kantische Position wirft für Schopenhauer die Frage auf, ob zwischen Traum und Wachzustand zu unterscheiden ist. Darauf antwortet Schopenhauer: »Das allein sichere Kriterium zur Unterscheidung des Traumes von der Wirklichkeit ist in der Tat kein anderes als das ganz empirische des Erwachens, durch welches allerdings der Kausalzusammenhang zwischen den geträumten Begebenheiten und denen des wachen Lebens ausdrücklich und fühlbar abgebrochen wird.« (WWV:48) In diesem ersten Buch entfaltet Schopenhauer auf ca. 120 Seiten (gemäß der Suhrkamp-Ausgabe) seine Erkenntnistheorie, die uns bereits aus der Dissertation bekannt ist. Malter (1988:35ff) untergliedert Schopenhauers Argumentationsstrategie in diesem ersten Buch in fünf Schritte, die hier allerdings nicht wiedergegeben werden, weil von der Erkenntnistheorie hinreichend ausführlich die Rede war. Es sei hier in aller Kürze die Verbindung von Zeit, Raum und Kausalität erinnert. Schopenhauer hält fest, dass Sukzession das ›ganze Wesen‹ der Zeit ist, während die Lage bzw. die wechselseitige Bestimmtheit seiner Teile das ›ganze Wesen‹ des Raumes ist (WWV:37f). Neben Zeit und Raum, die Kantischen Anschauungsformen, ist für Schopenhauer eine Kantische Kategorie von Bedeutung – die Kausalität. Die Kausalität ist ›das ganze Wesen‹ der Materie. Aus dieser Erklärung resultiert eine nette Fassung dessen, was ›Wirklichkeit‹ heißt: Seite | 71 »[Materie] ist durch und durch nichts als Kausalität, welches jeder unmittelbar einsieht, sobald er sich besinnt. Ihr Sein nämlich ist ihr Wirken: kein anderes Sein derselbe ist auch nur zu denken möglich. Nur als wirkend füllt sie den Raum, füllt sie die Zeit: ihre Einwirkung auf das unmittelbare Objekt (das selbst Materie ist) bedingt die Anschauung, in der sie allein existiert: die Folge der Einwirkung jedes andern materiellen Objekts auf ein anderes wird nur erkannt, sofern das letztere jetzt anders als zuvor auf das unmittelbare Objekt einwirkt, besteht nur darin. Ursache und Wirkung ist also das ganze Wesen der Materie: ihr Sein ist ihr Wirken […]. Höchst treffend ist daher im Deutschen der Inbegriff alles Materiellen Wirklichkeit genannt, welches Wort viel bezeichnender ist als Realität.« (WWV:38) Zeit und Raum werden von der Materie vorausgesetzt, beide sind ohne Materie vorstellbar, allerdings nicht die Materie ohne jene (WWV:38). Die Materie ist aber mehr, sie ist die Vereinigung von Zeit und Raum (WWV:39). Wenn das Wesen der Materie ihr Wirken, i.e. Kausalität ist, dann führt sie Zeit und Raum zusammen. »Alle gedenkbaren, unzähligen Erscheinungen und Zustände nämlich könnten im unendlichen Raum, ohne sich zu beengen, neben einander liegen, oder auch in der unendlichen Zeit, ohne sich zu stören, auf einander folgen; daher dann eine notwendige Beziehung derselben auf einander und eine Regel, welche sie dieser gemäß bestimmte, keineswegs nötig, ja nicht ein Mal anwendbar wäre: folglich gäbe es alsdann, bei allem Nebeneinander im Raum und allem Wechsel in der Zeit, so lange jede dieser beiden Formen für sich, und ohne Zusammenhang mit der andern ihren Bestand und Lauf hätte, noch gar keine Kausalität, und da diese das eigentliche Wesen der Materie ausmacht, auch keine Materie. – Nun aber erhält das Gesetz der Kausalität seine Bedeutung und Notwendigkeit allein dadurch, daß das Wesen der Veränderung nicht im bloßen Wechsel der Zustände an sich, sondern vielmehr darin besteht, daß an demselben Ort im Raum jetzt ein Zustand ist und darauf ein anderer, und zu einer und derselben bestimmten Zeit hier dieser Zustand und dort jener: nur diese gegenseitige Beschränkung der Zeit und des Raums durch einander gibt einer Regel, nach der die Veränderung vorgehn muß, Bedeutung und zugleich Notwendigkeit. Was durch das Gesetz der Kausalität bestimmt wird, ist also nicht die Sukzession der Zustände in der bloßen Zeit, sondern diese Sukzession in Hinsicht auf einen bestimmten Raum, und nicht das Dasein der Zustände an einem bestimmten Ort, sondern an diesem Ort zu einer bestimmten Zeit. Die Veränderung, d.h., der nach dem Kausalgesetz eintretende Wechsel, betrifft also jedesmal einen bestimmten Teil des Raumes und einen bestimmten Teil der Zeit zugleich und im Verein. Demzufolge vereinigt die Kausalität den Raum mit der Zeit.« (WWV:39) Seite | 72 Dass die Materie Wirken und Wirken nur als kausale Wirkung aufzufassen ist, mag etwas verwirrend klingen. Tatsächlich liegt der Verwirrung das Zusammenziehen mehrerer Kantischer Kategorien in die eine der Kausalität zu Grunde – durchaus nach dem Motto, dass die Philosophie »ein Ungeheuer mit vielen Köpfen« (WWV:151) ist. Die Verwirrung soll hier nicht zerstreut werden, indem diese Zusammenführung der Kantischen Kategorien, vornehmlich diejenigen der Abteilung Relation, nachgezeichnet wird, sondern durch folgenden Hinweis: Schopenhauers Realität der Materie ist durch und durch dynamisch; sie ist Wirklichkeit, weil sie wirkt. Schopenhauers Schachzug liegt bereits im ersten Buch, in dem es um die Welt als Vorstellung geht, darin, das Wirken zur alleinigen Kategorie zu stilisieren, die die Anschauungsformen Zeit und Raum synthetisiert. Das Wirken bringt zusammen, was ansonsten getrennt vorgestellt wird. Schopenhauer hält gegen Materialismus und Idealismus im Streit um die Realität der Außenwelt fest, »…erstlich, daß Objekt und Vorstellung dasselbe sind; dann, daß das Sein der anschaulichen Objekte eben ihr Wirken ist, daß eben in diesem des Dinges Wirklichkeit besteht und die Forderung des Daseins des Objekts außer der Vorstellung des Subjekts und auch eines Seins des wirklichen Dinges, verschieden von seinem Wirken, gar keinen Sinn hat und ein Widerspruch ist; daß daher die Erkenntnis der Wirkungsart eines angeschauten Objekts eben auch es selbst erschöpft, sofern es Objekt, d.h. Vorstellung ist, da außerdem für die Erkenntnis nichts an ihm übrigbleibt.« (WWV:45) Von diesem Wirklichkeitsbegriff ist es nur ein kleiner Schritt zu einem An-sich, das das Wirken von seinem ursächlichen Status befreit und in ein blindes Treiben mutiert. Schopenhauer macht diesen Schritt im zweiten Buch. Lektüre der WWV: Der Leib als objektivierter Wille Im zweiten Buch geht es um den Willen. Der §18 macht klar, dass der Mensch eine Doppelstellung hat, die ihm das Reich des Willens eröffnet. »In der Tat würde die nachgeforschte Bedeutung der mir lediglich als meine Vorstellung gegenüberstehende Welt […] zu dem, was sie noch außerdem sein mag, nimmermehr zu finden sein, wenn der Forscher selbst nichts weiter als das rein erkennende Subjekt (geflügelter Engelskopf ohne Leib) wäre. Nun aber wurzelt er selbst in jener Welt, findet sich nämlich in ihr als Individuum, d.h. sein Erkennen, welches der bedingende Träger der ganzen Welt als Vorstellung ist, Seite | 73 ist dennoch durchaus vermittelt durch einen Leib, dessen Affektionen […] dem Verstande der Ausgangspunkt der Anschauung jener Welt sind.« (WWV:156f) Dem als Individuum erscheinenden Subjekt des Erkennens ist ›ein Wort‹ als Rätsel aufgegeben – »und dieses Wort heißt Wille« (WWV:157). Das Rätsel löst sich, indem der Leib als Vorstellung und Wille zugleich gedacht wird, womit der sichtbare Leib der objektivierte Wille, d.h. der in die Anschauung getretene Akt des Willens ist (WWV:158). »Ich werde daher den Leib […] die Objektivität des Willens nennen. Auch kann man daher in gewissem Sinne sagen: der Wille ist die Erkenntnis a priori des Leibes und der Leib die Erkenntnis a posteriori des Willens. […] In der Reflexion allein ist Wollen und Tun verschieden: in der Wirklichkeit sind sie eins. Jeder wahre, echte, unmittelbare Akt des Willens ist sofort und unmittelbar auch erscheinender Akt des Leibes; und diesem entsprechend ist andererseits jede Einwirkung auf den Leib sofort und unmittelbar auch Einwirkung auf den Willen.« (WWV:158) Schopenhauer hält fest, dass ›mein Leib und mein Wille‹ eins sind, dass ›mein Leib die Objektivität meines Willens‹ ist (WWV:161). Es ist die Eigenart von Schopenhauers Metaphysik, dass sie weder das Subjekt noch die Objektwelt überschreitet, wenn sie nach dem Wesen der Rück-Seite der Vor-Stellung fragt. Schopenhauer geht vom erkennenden Subjekt aus und befragt das fragende Subjekt danach, was es außer Erkennen noch ist. Die derart gestellte Frage ist leicht zu beantworten, denn das fragende Subjekt erlebt unmittelbar, was es außer Erkennen noch ist – eben Leib. Auf den Leib kann sich das Subjekt als erkennendes richten; unter dieser Perspektive ist der Leib Objekt unter Objekten. Aber der Leib kann auch unter der Perspektive des Erlebens erkundet werden – das Individuum muss sich darauf besinnen, dass und wie es leiblich erlebt. Das subjektive leibliche Erleben ist Wille (s. Malter 1988: 51f). »Der Wille wird hierdurch nicht etwa auf die Vorstellung (Anschauung) ›Leib‹ reduziert (was den Willen selbst zur Modifikation der Welt als Vorstellung machen hieße), es soll vielmehr gesagt werden, daß im Horizont des Vorstellens ein Nichtvorstellungshaftes auf unmittelbare Weise auftaucht. Das Leiberleben ist zwar auch ein Vorstellen, es unterscheidet sich jedoch von allem anderen Vorstellen dadurch, daß es sich in ihm das gänzlich von der Vorstellung Geschiedene, das Lust- und Unlusthafte, das sich qualitativ nicht auf Erkennen reduzieren läßt, kund gibt. Der Philosoph kann die Wesensfindung nicht demonstrieren, er kann den Fragenden nur auf diese Andersartigkeit der Einstellung des fragenden Subjekts zu sich selbst hinweisen. Bestreiten könnte das Nicht-nur-erkennend-sein nur derjenige, welcher die Absurdität behaupten würde, er sei ›geflügelter Engelskopf ohne Leib‹.« (Malter 1988:53) Seite | 74 Der §18 beruft sich auf unmittelbares Erleben: Das erkennende Subjekt erkennt, dass es, insofern es unmittelbar Lust-Unlust-Erleben ist, noch etwas anderes als Erkennen ist – es ist Erkennen und Wollen. Mit der wichtigen Differenz: Dass das Subjekt erkennend ist, weiß es nur mittelbar, vermittelt über das Objekthaben; dass es will, weiß es unmittelbar objekthaft am Leibsein. Dass diese Subjektidentität zweier absolut verschiedener Funktionen möglich ist, liegt nicht bloß im Bereich des Denkbaren, sondern wird in seiner Wirklichkeit erlebend vollzogen (s. Malter 1988:54). »Metaphysik, die sich auf die erlebte Identität von Erkenntnis- und Willenssubjekt gründet, braucht die gegebene Welt nicht zu verlassen. Sie handelt nicht von anderen Welten, sie redet von dem, was das erkennende Subjekt außer seinem Erkennen-sein noch ist. Sie existiert von einer alltäglichen Einsicht, an der die Philosophen, wenn sie das Wesen suchen, vorbeizulaufen pflegen: Es bedarf, um das Wesen der Welt zu erkennen, nur der Aktivierung des unmittelbaren, jederzeit vollziehbaren Leiberlebens für die Wesensfrage, um schon die Antwort zu haben. Und hat die fragende Vernunft das sie selbst tragende Leibsubjekt als das objektivierte Wesen entschlüsselt, so ist die gesamte Natur in ihrem Willenscharakter offenbar.« (Malter 1988:54) Der Wille, der einen Menschen zu einer bestimmten Tat treibt, ist nicht mit der Motivation zu verwechseln. Die Akte des Willens haben einen ›Grund außer sich‹, in den Motiven (WWV:165), und Motive sind, gemäß der Dissertation von 1813, Formen der Kausalität, also bestimmte Ausprägungen des Satzes vom Grunde, der die Vorstellungswelt regiert. Der Wille ist das Wesen des Menschen, dessen sichtbare Handlungen durch Motive begründet sind. Der Wille objektiviert sich in den Motiven – so ließe sich dieser feine Unterschied fassen. Schopenhauer erklärt ihn wie folgt: »[Die Motive bestimmen] nie mehr als das, was ich zu dieser Zeit, an diesem Ort, unter diesen Umständen will; nicht aber daß ich überhaupt will, noch was ich überhaupt will, d.h. die Maxime, welche mein gesamtes Wollen charakterisieren. Daher ist mein Wollen nicht seinem ganzen Wesen nach aus den Motiven zu erklären; sondern diese bestimmen bloß seine Äußerung im gegebenen Zeitpunkt, sind bloß der Anlaß, bei dem sich mein Wille zeigt: dieser selbst hingegen liegt außerhalb des Gebietes des Gesetzes der Motivation: nur seine Erscheinung in jedem Zeitpunkt ist durch dieses notwendig bestimmt.« (WWV: 166) Wenn jede Aktion des Leibes Erscheinung eines Willensaktes ist, so ist die Bedingung sine qua non der Aktion Erscheinung des Willens; und jene Bedingung ist der Leib selbst (WWV:166). Daraus resultiert für Schopenhauer eine ›teleologische Erklärbarkeit des Leibes‹: Seite | 75 »Die Teile des Leibes müssen deshalb den Hauptbegehrungen, durch welche der Wille sich manifestiert, vollkommen entsprechen, müssen der sichtbare Ausdruck derselben sein: Zähne, Schlund und Darmkanal sind der objektivierte Hunger; die Genitalien der objektivierte Geschlechtstrieb; die greifenden Hände, die raschen Füße entsprechen dem schon mehr mittelbaren Streben des Willens, welches sie darstellen. Wie die allgemeine menschliche Form dem allgemeinen menschlichen Willen, so entspricht dem individuell modifizierten Willen, dem Charakter des einzelnen die individuelle Korporisation.« (WWV:168) Lektüre der WWV: Die Objektivationen des Willens Die Lektüre des zweiten Buches von Die Welt als Wille und Vorstellung ist damit gerade erst eröffnet. Im Weiteren geht es Schopenhauer um den Willen, und wie er sich in auf mannigfaltige Weise objektiviert. Die unmittelbare Einsicht in das, was das Subjekt außer Erkennen noch ist, eröffnet zugleich die Einsicht in das, was die Natur in ihrem Gestaltenreichtum ist: Die Welt ist nichts als Wille. »Ding an sich […] ist allein der Wille: als solcher ist er durchaus nicht Vorstellung, sondern toto genere von ihr verschieden: er ist es, wovon alle Vorstellung, alles Objekt, die Erscheinung, die Sichtbarkeit, die Objektivität ist. Er ist das Innerste, der Kern jedes Einzelnen und ebenso des Ganzen: er erscheint in jeder blindwirkenden Naturkraft: er auch erscheint im überlegten Handeln des Menschen; welcher beide große Verschiedenheit doch nur den Grad des Erscheinens, nicht das Wesen des Erscheinenden trifft.« (WWV:170) Daraus resultiert nun mitnichten eine monotone Einheit und Ungeschiedenheit: Das Ding an sich, i.e. der Wille (Schopenhauer singularisiert hier den Kantischen Plural von den ›Dingen an sich‹), ist nur präsent in der Gestalt der Erscheinungen, d.h. unter bestimmten Formen, die alle nur die Form schlechthin, also den Satz vom zureichenden Grund, ausdrücken. »Die Natur, die diese Erscheinungen darstellt, enthält, bedingt durch die Herrschaft des ›principium individuationis‹ (Zeit und Raum), eine unermeßliche Vielheit von Individuen, die infolge der (aus Zeit und Raum sich ergebenden) Kausalität in den Nexus des Entstehens und Vergehens gebunden sind. Da der Wille nicht unter dem Satz vom Grund steht, bleibt er vom Kommen und Gehen der Individuen unberührt; gleichwohl ist er es, der in allen Individuen zur Erscheinung kommt – in ihnen sich objektiviert.« (Malter 1988:55). »Ob aber die dem Individuo nur als Vorstellungen bekannten Objekte dennoch gleich seinem eigenen Leibe Erscheinungen eines Willens sind; dies ist […] der Seite | 76 eigentliche Sinn der Frage nach der Realität der Außenwelt: dasselbe zu leugnen ist der Sinn des theoretischen Egoismus, der ebendadurch alle Erscheinungen außer seinem eigenen Individuum für Phantome hält. […] Der theoretische Egoismus ist zwar durch Beweise nimmermehr zu widerlegen: dennoch ist er zuverlässig in der Philosophie nie anders denn als skeptischer Sophisma, d.h. zum Scheine gebraucht worden.« (WWV:163) Es lässt sich für Schopenhauer nicht sinnvoll leugnen, dass in den anderen Individuen derselbe Wille zum Ausdruck kommt. Dabei bleibt Schopenhauers Begriff ›Individuum‹ nicht bei Menschen und Tieren stehen, sondern schließt alle Entitäten ein. »Nicht allein in denjenigen Erscheinungen, welche seiner eigenen ganz ähnlich sind, in Menschen und Tieren wird [der Leser] als ihr innerstes Wesen jenen nämlichen Willen anerkennen; sondern die fortgesetzte Reflexion wird ihn dahin leiten, auch die Kraft, welche in der Pflanze treibt und vegetiert, ja die Kraft, durch welche der Kristall anschießt, die, welche den Magnet zum Nordpol wendet, die, deren Schlag ihm aus der Berührung heterogener Metalle entgegenfährt, die, welche in den Wahlverwandtschaften der Stoffe als Fliehn und Suchen, Trennen und Vereinen erscheint, ja zuletzt sogar die Schwere, welche in aller Materie so gewaltig strebt, den Stein zur Erde und die Erde zur Sonne zieht – diese alle nur in der Erscheinung für verschieden, ihrem innern Wesen nach aber als dasselbe zu erkennen, als jenes ihm unmittelbar so intim und besser als alles andere Bekannte, was da, wo es am deutlichsten hervortritt, Wille heißt.« (WWV:170) Man muss eine Erweiterung des Begriffs ›Wille‹ vollziehen, um nicht im ›immerwährenden Missverständnis‹ gefangen zu bleiben (WWV:171); gegen die Vermutung, dass dieser neue Willensbegriff eine neue, okkulte Kraft anspricht, setzt Schopenhauer folgende Worte: »Nun aber bezeichnet das Wort Wille, welches uns wie ein Zauberwort das innerste Wesen jedes Dinges in der Natur aufschließen soll, keineswegs eine unbekannte Größe, ein durch Schlüsse erreichtes Etwas; sondern ein durchaus unmittelbar Erkanntes und so sehr Bekanntes, daß wir, was Wille sei, viel besser wissen und verstehn als sonst irgend etwas, was immer es auch sei. – Bisher subsumierte man den Begriff Wille unter den Begriff Kraft: dagegen mache ich es gerade umgekehrt und will jede Kraft in der Natur als Wille gedacht wissen.« (WWV:172) Der Wille entzieht sich der Individuation, er ist als Ding an sich von seinen Erscheinungen gänzlich verschieden (WWV:173); zwischen dem Willen und den individuierten Objekten der Erscheinungswelt klafft der Graben der ontologischen Differenz. Seite | 77 Der Wille ist grundlos, und aus dieser Grundlosigkeit folgt auch, dass der Mensch frei ist – am Menschen, besser: im Menschen stellen wir den Willen zu allererst fest. Obgleich der Mensch frei ist, sind seine Handlungen mitnichten frei, denn die Handlungen sind in der objektivierten Welt sichtbar und derart dem Satz vom Grunde unterworfen, und zwar in dessen erster Gestalt, der Kausalität. Jede Handlung ist motiviert, und Motive sind die Weise, in der Kausalität auf menschlichem Niveau auftreten. Schopenhauer trennt scharf zwischen dem Grund als Ding an sich und dem Begründeten als durch Zeit, Raum und Kausalität Individuiertem: »Die Grundlosigkeit des Willens hat man auch wirklich da erkannt, wo er sich am deutlichsten manifestiert, als Wille des Menschen, und diesen frei, unabhängig genannt. Sogleich hat man aber auch über die Grundlosigkeit des Willens selbst die Notwendigkeit, der seine Erscheinung überall unterworfen ist, übersehn und die Taten für frei erklärt, was sie nicht sind, da jede einzelne Handlung auf der Wirkung des Motivs auf den Charakter mit strenger Notwendigkeit folgt. […] Weil aber im Selbstbewußtsein der Wille unmittelbar und an sich erkannt wird, so liegt auch in diesem Bewußtsein das der Freiheit. Allein es wird übersehn, daß das Individuum, die Person, nicht Wille als Ding an sich, sondern schon Erscheinung des Willens ist […].« (WWV:174) Schopenhauer lässt den Willen auch da wirken, wo keine Erkenntnis ihn leitet (WWV:175). Er erweitert damit den üblichen Gebrauch von ›Willen‹ (s.o.). »Allein daß der Wille auch da wirkt, wo keine Erkenntnis ihn leitet, sehen wir zu allernächst an dem Instinkt […] der Tiere. […] [S]o werden wir das Wirken des Willens nun auch leichter in Fällen wiedererkennen, wo es weniger augenfällig ist, und dann z.B. sowenig das Haus der Schnecke einem ihr selbst fremden, aber von Erkenntnis geleiteten Willen zuschreiben, als das Haus, welches wir selbst bauen, durch einen andern Willen als unsern eigenen ins Dasein tritt; sondern wir werden beide Häuser für Werke des in beiden Erscheinungen sich objektivierenden Willens erkennen, der in uns nach Motiven, in der Schnecke aber noch blind als nach außen gerichteter Bildungstrieb wirkt. Auch in uns wirkt derselbe Wille vielfach blind: in allen den Funktionen unsers Leibes, welche keine Erkenntnis leitet, in allen seinen vitalen und vegetativen Prozessen, Verdauung, Blutumlauf, Sekretion, Wachstum, Reproduktion. […] [A]lles, was [im Leib] vorgeht, muß daher durch Wille vorgehn, obwohl hier dieser Wille […] blind [wirkt].« (WWV:176) Die Natur ist folglich die Sichtbarkeit bzw. die Objektivität des Willens. Die Willensobjektivationen erfolgen in festgelegten Stufen, (i) anorganische Natur, (ii) Pflanzen, (iii) Tiere und (iv) Mensch. Es bleibt eigentlich nur noch die Natur, die noch nicht thematisiert wurde. Hierzu ist in der WWV zu lesen: Seite | 78 »Wir müssen also den Schlüssel zum Verständnis des Wesens an sich der Dinge, welchen uns die unmittelbare Erkenntnis unsers eigenen Wesens allein geben konnte, auch an diese Erscheinungen der unorganischen Welt legen, die von allen im weitesten Abstande von uns stehn. – Wenn wir sie nun mit forschendem Blicke betrachten, wenn wir den gewaltigen, unaufhaltsamen Drang sehn, mit dem die Gewässer der Tiefe zueilen, die Beharrlichkeit, mit welcher der Magnet sich immer wieder zum Nordpol wendet, die Sehnsucht, mit der das Eisen zu ihm fliegt, die Heftigkeit, mit welcher die Pole der Elektrizität zur Wiedervereinigung streben […]; wenn wir den Kristall schnell und plötzlich anschießen sehn, mit so viel Regelmäßigkeit der Bildung […] – so wird es uns keine große Anstrengung der Einbildungskraft kosten, selbst aus so großer Entfernung unser eigenes Wesen wiederzuerkennen, jenes Nämliche, das in uns beim Lichte der Erkenntnis seine Zwecke verfolgt, hier aber in den schwächsten seiner Erscheinungen nur blind, dumpf, einseitig und unveränderlich strebt.« (WWV:180f) An die Kräfte der Natur, die bestimmte Wirkungsart der Dinge, die Qualität, der Charakter der Erscheinung, das Grundlose – daran darf sich keine Erklärung wagen (WWV:185). Die Naturwissenschaften bleiben beschränkt, bzw. der Naturwissenschaften Erklärungsmodelle müssen metaphysisch untermauert werden. »Mechanik, Physik, Chemie lehren die Regeln und Gesetze, nach denen die Kräfte der Undurchdringlichkeit, Schwere, Starrheit, Flüssigkeit, Kohäsion, Elastizität, Wärme, Licht, Wahlverwandtschaften, Magnetismus, Elektrizität usw. wirken, d.h. das Gesetz, die Regel, welche diese Kräfte in Hinsicht auf ihren jedesmaligen Eintritt in Zeit und Raum beobachten: die Kräfte selbst aber bleiben dabei […] qualitates occultae. Denn es ist eben das Ding an sich, welches, indem es erscheint, jene Phänomene darstellt.« (WWV:185) Der Wille steht außer Zeit und Raum (natürlich auch außerhalb der Kausalität) und ist daher nicht dem principium individuationis unterworfen; dieses bestimmt über die Vereinzelung bzw. darüber, dass die Vorstellungen aus einzelnen Entitäten bestehen; diese Einzelheit setzt gleichzeitig Vielheit voraus, denn nur wenn es mehrere Entitäten gibt, können die einzelnen erkannt werden. Der Wille entzieht sich der Vielheit und muss daher einer sein. Diese Einheit unterscheidet sich von derjenigen, die durch das principium individuationis geschaffen wird: »[Der Wille liegt] außer der Zeit und dem Raum und kennt demnach keine Vielheit, ist folglich einer; doch […] nicht wie ein Individuum, noch wie ein Begriff eins ist; sondern wie etwas, dem die Bedingung der Möglichkeit der Vielheit, das principium individuationis, fremd ist. […] Nicht etwa ist ein kleinerer Teil [vom Willen] im Stein, ein größerer im Menschen: da das Verhältnis von Teil und Seite | 79 Ganzem ausschließlich dem Raume angehört und daher keinen Sinn mehr hat, sobald man von dieser Anschauungsform abgegangen ist.« (WWV:193) An anderer Stelle, nämlich im §27, erläutert dies Schopenhauer mit folgender Metapher: »Wie eine Zauberlaterne viele und mannigfaltige Bilder zeigt, es aber nur eine und dieselbe Flamme ist, welche ihnen allen die Sichtbarkeit erteilt; so ist in allen mannigfaltigen Erscheinungen, welche nebeneinander die Welt füllen oder nacheinander als Begebenheiten sich verdrängen, doch nur der eine Wille das Erscheinende […]: er allein ist das Ding an sich.« (WWV:226) Wenn der Wille auf der einen Seite die unbändige Grundkraft ohne Grund und außerhalb von Zeit, Raum und Kausalität steht, dann muss es andererseits so etwas wie ein Scharnier geben, das den Willen mit den Vorstellungen zusammenbringt. Außer dem Erlebnis des Willens als das Ding an sich, das der Mensch an seinem Leib macht, führt der Schluss dahin, dass es derselbe Wille ist, der als Ding an sich hinter den Vorstellungen waltet – also benötigt es einen Link. Wie ver-äußert sich der Wille in die Vielheit der Dinge-an-sich und dann in die einzelnen Vorstellungen? Zur Lösung dieses Problems greift Schopenhauer nun auf Platon zurück. Die Objektivationen des Willens sind ›abgestuft‹ (WWV:194) – natürlich nicht der Wille selbst. Die Abstufung bezieht sich zuallererst auf die ›zahllosen Individuen‹ vs. die ›unerreichten Musterbilder‹ (WWV:195), womit Platons Ideenreich unvermittelt angesprochen ist. »Ich verstehe also unter Idee jede bestimmte und feste Stufe der Objektivation des Willens, sofern er Ding an sich und daher der Vielheit fremd ist, welche Stufen zu den einzelnen Dingen sich allerdings verhalten wie ihre ewigen Formen oder ihre Musterbilder.« (WWV:195) Auf der niedrigsten Stufe der Objektivation des Willens lokalisiert Schopenhauer die allgemeinen Kräfte der Natur, also Schwere, Undurchdringlichkeit, Starrheit, Flüssigkeit, Elastizität, Elektrizität, Magnetismus, chemische Eigenschaften und Qualitäten jeder Art (WWV:196). Diese sind unmittelbare Erscheinungen des Willens, und es ist ›unverständig‹, nach einer Ursache der Schwere, der Elektrizität etc. zu fragen, denn es sind ursprüngliche Kräfte, »deren, Äußerungen zwar nach Ursache und Wirkung vor sich gehen […]; keineswegs aber ist die Kraft selbst Wirkung einer Ursache noch auch Ursache einer Wirkung« (WWV:196). Auf den oberen Stufen der Objektivität des Willens lokalisiert Schopenhauer die Individualität ›deutlich hervortreten, besonders beim Menschen‹ (WWV:197). Die große Verschiedenheit der individuellen, menschlichen Cha- Seite | 80 raktere führt, gemäß der Verbindung von Wille und dessen Objektivation, zu großen Unterschieden in der Physiognomie. Die menschliche Individualität übertrifft ›bei weitem‹ diejenige eines jeden Tieres: »[N]ur die oberen Tiere haben einen Anstrich [von Individualität], über den jedoch der Gattungscharakter noch ganz und gar vorherrscht, ebendeshalb auch nur wenig Individualphysiognomie. Je weiter abwärts, desto mehr verliert sich jede Spur von Individualcharakter in den allgemeinen Spezies […].« (WWV:197) Die starke Ausprägung des Individualcharakters im Menschen führt Schopenhauer dahin, jedes menschliche Individuum als ›besonders bestimmte und charakterisierte Erscheinung des Willens‹ zu bestimmen – ja so weit zu gehen, jeden Menschen gewissermaßen als ›eine eigene Idee anzusehn‹ (WWV:198). Im unorganischen Reich ist von Individualität dann nichts mehr festzustellen, mit einer Ausnahme – den Kristallen. »Bloß der Kristall ist noch gewissermaßen als Individuum anzusehen: er ist eine Einheit des Strebens nach bestimmten Richtungen, von der Erstarrung ergriffen, die dessen Spur bleibend macht.« (WWV:198) Das Verhältnis von Naturkraft und Naturgesetz, das bereits in der Dissertation von 1813 angesprochen wurde, fasst Schopenhauer im §26 wie folgt: »Jede allgemeine ursprüngliche Naturkraft ist also in ihrem innern Wesen nichts anderes als die Objektivation des Willens auf einer niedrigen Stufe: wir nennen eine jede solche Stufe eine ewige Idee in Platons Sinn. Das Naturgesetz aber ist die Beziehung der Idee auf die Form ihrer Erscheinung. Diese Form ist Zeit, Raum und Kausalität, welche notwendigen und unzertrennlichen Zusammenhang und Beziehung auf einander haben. Durch Zeit und Raum vervielfältigt sich die Idee in unzählige Erscheinungen: die Ordnung aber, nach welcher dies in jene Formen der Mannigfaltigkeit eintraten, ist fest bestimmt durch das Gesetz der Kausalität: dieses ist gleichsam die Norm der Grenzpunkte jener Erscheinungen verschiedener Ideen.« (WWV:201) Ein Naturgesetz ist und bleibt ›bloß die Natur abgemerkte Regel‹ (WWV:210). *** Schopenhauer diagnostiziert in der Natur ›überall Streit, Kampf und Wechsel des Sieges‹ (WWV:218) – wieder eine Stelle, die sich in Verbindung zu Darwins ›struggle for life‹ setzen ließe. Interessant daran ist, wie Schopenhauer diesen Negativ-Befund argumentiert, denn hier wird der Unterschied von Materie und Wille ebenso wie die Idee der Höher- bzw. Weiterentwicklung des Willens in seinen Objektivationen deutlich. »Wenn von den Erscheinungen des Willens auf den niedrigeren Stufen seiner Objektivation, also im Unorganischen, mehrere unter einander in Konflikt gera- Seite | 81 ten, indem jede am Leitfaden der Kausalität sich der vorhandenen Materie bemächtigen will; so geht aus diesem Streit die Erscheinung einer höheren Idee hervor, welche die vorhin dagewesenen unvollkommeneren alle überwältigt, jedoch so, daß sie das Wesen derselben auf eine untergeordnete Weise bestehn läßt, indem sie ein Analogon davon in sich aufnimmt; welcher Vorgang eben nur aus der Identität des erscheinenden Willens in allen Ideen und aus seinem Streben zu immer höheren Objektivationen begreiflich ist.« (WWV:215) Diesen Gedanken formuliert Schopenhauer, um eine ›Verirrung‹ in den Naturwissenschaften den richtigen Weg zu weisen (WWV:212). Es handelt sich hierbei um die richtig angesetzte ›Aitiologie‹ (i.e. Ätiologie, Lehre von den Ursachen): Schopenhauer bekämpft den Reduktionismus der Naturkräfte auf immer niedrigere Formen, d.h. die Vitalität auf die Chemie, die Chemie auf die Physik etc. Schopenhauer formuliert mit seiner Konflikt-Theorie eine Erklärung, warum das naturwissenschaftliche inspirierte Reduktionismusprogramm überhaupt angedacht werden kann: Die siegreiche Idee nimmt von der besiegten Idee ein Analogon in sich auf. »Die aus solchem Siege über mehrere niedere Ideen oder Objektivationen des Willens hervorgehende vollkommenere gewinnt eben dadurch, daß sie von jeder überwältigten ein höher potenziertes Analogon in sich aufnimmt, einen ganz neuen Charakter: der Wille objektiviert sich eine neue deutlichere Art: es entsteht […] nachher durch Assimilation an den vorhandenen Keim organischer Saft, Pflanze, Tier, Mensch. Also aus dem Streit niedrigerer Erscheinungen geht die höhere, sie alle verschlingende, aber auch das Streben aller in höhere, sie alle verwirklichende hervor.« (WWV:216) Im Organismus lassen sich folglich die Spuren chemischer und physischer Wirkungsarten nachweisen; er wird sich aus diesen aber nie erklären lassen, »weil [der Organismus] keineswegs ein durch das vereinigte Wirken solcher Kräfte, also zufällig hervorgebrachtes Phänomen ist, sondern eine höhere Idee, welche sich jene niedrigeren durch überwältigende Assimilation unterworfen hat; weil der in allen Ideen sich objektivierende eine Wille, indem er zu höchstmöglichen Objektivation strebt, hier die niedern Stufen seiner Erscheinung, nach einem Konflikt derselben, aufgibt, um auf einer höhern desto mächtigeren zu erscheinen.« (WWV:216) Diesen Sieg trägt die höhere Idee oder Willensobjektivation nicht kampflos davon; die höhere Idee erleidet den Widerstand der niederen, die dann immer noch strebt, zur unabhängigen und vollständigen Äußerung ihres Wesen zu gelangen – obgleich sie ›zur Dienstbarkeit gebracht‹ wurde (WWV:216f). Schopenhauer verortet damit nicht nur das Reduktionismusprogramm innerhalb seiner Metaphysik, sondern gibt gleichzeit auch einen Grund dafür an, warum Seite | 82 sich höhere Willensobjektivationen wieder den niedrigeren angleichen, warum z.B. das Leben wieder dem anorganischen Prozess verfällt, sobald der Organismus gestorben ist. »Daher also überhaupt die Last des physischen Lebens, die Notwendigkeit des Schlafes und zuletzt des Todes, indem endlich, durch Umstände begünstigt, jene unterjochten Naturkräfte dem selbst durch den steten Sieg ermüdeten Organismus die ihnen entrissene Materie wieder abgewinnt und zur ungehinderten Darstellung ihres Wesens gelangt. Man kann daher auch sagen, daß jeder Organismus die Idee, deren Abbild er ist, nur darstellt nach Abzug des Teiles seiner Kraft, welche verwendet wird auf Überwältigung der niedrigeren Ideen, die ihm die Materie streitig machen.« (WWV:217) Je höher die Objektivation des Willens in der von Schopenhauer nicht weiter erläuterten Hierarchie stehen, desto mehr niedrigere Kräfte müssen überwunden und niedergehalten werden, denn die Willensobjektivationen kämpfen um dieselbe Materie, die sie zu ihrer Objektivierung benötigen. Die Objektivationen streiten um Materie, worin zugleich auch eine wesentliche Entzweiung des Willens mit sich selbst (WWV:218) zum Ausdruck kommt. »So sehn wir in der Natur überall Streit, Kampf und Wechsel des Sieges und werden ebendarin weiterhin die dem Willen wesentliche Entzweiung mit sich selbst deutlicher erkennen. Jede Stufe der Objektivation des Willens macht der andern die Materie, den Raum, die Zeit streitig. Beständig muß die beharrende Materie die Form wechseln, indem am Leitfaden der Kausalität mechanische, physische, chemische, organische Erscheinungen, sich gierig zum Hervortreten drängen, einander die Materie entreißen, da jede ihre Idee offenbaren will. Durch die gesamte Natur läßt sich dieser Streit verfolgen, ja sie besteht eben wieder nur durch ihn.« (WWV:218) Dieser Streit als Offenbarung der dem Willen wesentlichen Entzweiung wird am deutlichsten in der Tierwelt sichtbar, die die Pflanzenwelt zur Nahrung hat und in der jedes Tier Beute eines anderen werden kann – die Materie, in der eine Idee sich darstellt, muss an eine andere Idee abgetreten werden (WWV:218). Der ›Wille zum Leben‹ zehrt an sich selbst und ist ›in verschiedenen Gestalten seine eigene Nahrung‹ (WWV:218). Im Tier entdeckt Schopenhauer den Willen zum Leben ›nackter‹ als im Menschen, weil er hier von Erkenntnis ›überkleidet‹ wird und durch die Fähigkeit zur Vorstellung ›umhüllt‹ wird. Allerdings muss das Tier, um seiner Idee nach erkannt zu werden, bereits in seinem Tun und Treiben beobachtet werden; das Tier ist also wesentlich weniger nackt als die Pflanze – hier zeigt sich der Wille zum Leben als ›bloßer, blinder Drang zum Dasein ohne Zweck‹ (WWV:230). Seite | 83 »[Die Pflanze] offenbart ihr ganzes Wesen dem ersten Blick und mit vollkommener Unschuld, die nicht darunter leidet, daß sie die Genitaliten, welche bei allen Tieren den verstecktesten Platz erhalten haben, auf ihrem Gipfel zur Schau trägt. Diese Unschuld der Pflanze beruht auf ihrer Erkenntnislosigkeit: nicht im Wollen, sondern im Wollen mit Erkenntnis liegt die Schuld. Jede Pflanze zählt von ihrer Heimat, dem Klima derselben und der Natur des Bodens, dem sie entsprossen ist. Daher erkennt selbst der wenig Geübte leicht, ob eine exotische Pflanze der tropischen oder der gemäßigten Zone angehöre und ob sie im Wasser, im Sumpfe, auf Bergen oder auf der Heide wachse. Außerdem aber spricht jede Pflanze noch den speziellen Willen ihrer Gattung aus und sagt etwas, das sich in keiner andern Sprache ausdrücken läßt.« (WWV:230f) Der Wille zum Leben ist auf der Stufe des Menschen durch Erkenntnis umkleidet; während sich auf pflanzlichem Niveau ein dumpfer Drang objektiviert, ist dies im Menschen eben durch Motive gebrochen – von der dreifachen Auffächerung der Kausalität war bereits die Rede (s.o.). Beim Menschen objektiviert sich der Wille u.a. im Organ Gehirn, das nichts als eine Objektivation des Willens ist, d.i. eine besondere Strategie im Kampf um die Materie. Durch die Erkenntnis kann der Mensch Oberhand über die im untertänige Pflanzen- und Tierwelt erlangen. Die Erkenntnis ist als Willensobjektivation nicht Selbstzweck (s. Malter 1988:59). »Der Wille, der bis hieher im Dunkeln höchst sicher und unfehlbar seinen Trieb verfolgte, hat sich auf dieser Stufe ein Licht angezündet.« (WWV:223) Wie sehr Schopenhauers Objektivationen des Willens und der Kampf um die Materie an die Schöpfungsgeschichte im ersten Buch Mose erinnern, muss hier nicht ausgeführt werden; selbst die Erkenntnis als spezifisches Kennzeichen des Menschen, das ihn zum Bösen fähig macht, wird ausgesprochen. Schopenhauer selbst erwähnt zeitweise die Verwandtschaft zur Bibel und zu anderen religiösen Schriften, obwohl er die Fixierung von religiösen Ideen durch Kirchen stets ablehnt. Als abschließende Bemerkung für besondere LiebhaberInnen von Begriffsableitungen: Wittgensteins Sprachauffassung geht ab von der Abstraktionstheorie hin zu der Auffassung, dass im Begriff nicht das Wesentliche der Entitäten ausgesprochen wird, das zu erfassen eine Ideenwelt oder dergleichen postulieren hieße, sondern bloß bestimmte, lebensweltlich relevante Charakteristika herausgehoben und derart die Entitäten aufgrund von Familienähnlichkeiten einem Begriff zugeordnet werden. Der Begriff der ›Familienähnlichkeit‹ findet sich expressis verbis bei Schopenhauer, dessen Schriften, wie anfangs erwähnt, im Wien des fin-de-siècle bekannt sind – und wohl vom jungen Wittgenstein, einem Philosophiestudenten, eifrig gelesen werden. Schopenhauer Seite | 84 bringt den Begriff ›Familienähnlichkeit‹ in Anschlag, um Analogien auszudrücken – darin Wittgenstein nicht völlig entfernt. »[D]ie Erkenntnis der Einheit des Willens als Dinges an sich [gibt] in der unendlichen Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit der Erscheinungen allein den wahren Aufschluß über jene wundersame, unverkennbare Analogie aller Produktionen der Natur, jene Familienähnlichkeit, die sie als Variationen desselben nicht mitgegebenen Themas betrachten läßt […].« (WWV:227f) Lektüre der WWV: Kontemplation & Befreiung Schopenhauer sieht im Willen etwas Negatives. Der Wille ist jene Macht, die sich in der Welt objektiviert, die ein Jammertal ist. Für Schopenhauer ist »das An-sich des Lebens, der Wille, das Dasein selbst, ein stetes Leiden und teils jämmerlich, teils schrecklich« (WWV:372). »Alles Wollen entspringt aus Bedürfnis, also aus Mangel, also aus Leiden. Diesem macht die Erfüllung ein Ende; jedoch gegen einen Wunsch, der erfüllt wird, bleiben wenigstens zehn versagt: ferner, das Begehren dauert lange, die Forderungen gehen ins unendliche [sic]; die Erfüllung ist kurz und kärglich bemessen. […] Dauernde, nicht mehr weichende Befriedigung kann kein erlangtes Objekt des Wollens geben: sondern es gleicht immer nur dem Almosen, das, dem Bettler zugeworfen, sein Leben heute fristet, um seine Qual auf Morgen zu verlängern.« (WWV:279) Es gilt, aus diesem Jammertal auszubrechen; doch diesen Befreiungsschlag lässt der Wille nicht zu. Einerseits ist das Individuum Subjekt der Erkenntnis und damit in der Vorstellungswelt verfangen; andererseits ist das Individuum Subjekt des Wollens und derart in den Kampf der Objektivationen eingebunden. Im dritten Buch nun zeigt Schopenhauer die Befreiung, die für ihn in der Erkenntnis liegt, wenngleich einer etwas anderen Erkenntnis als derjenigen, die die Vorstellungswelt liefert. Daher der Untertitel des dritten Buches: ›Die Vorstellung, unabhängig vom Satze des Grundes: die Platonische Idee: Das Objekt der Kunst.‹ »Die Befreiung gelingt nur, wenn das Weltgesetz, vermittels dessen der Wille in Individuen zeitlich-räumlich und unter dem Kausalnexus zur Erscheinung kommt, außer Kraft gesetzt wird. Solange der Wille mit dem Satz vom Grund zusammengeht, steht auch das Erkennen, dessen Objektseite durch den Satz vom Grund determiniert wird, im Dienst des Willens.« (Malter 1988:60) Seite | 85 Das Erkennen, das Ausdruck des Willens ist und auf seiner Objektseite durch den Satz vom Grund bestimmt wird, muss sich vom Willen lösen. Die Möglichkeit dieser Lösung liegt darin, indem man das Wollen und das Vorstellungsobjekt in seiner Satz-vom-Grunde-Bestimmtheit beiseitelässt und nur auf das fokussiert, was übrig bleibt – das Subjekt des Erkennens. »Das Subjekt des Erkennens will nicht, und es ist vom Satz des Grundes nicht bestimmt. Schopenhauer redet daher von einer ›Veränderung‹, die im Subjekt vor sich gehen müsse, wenn die Leidensexistenz überwunden werden soll.« (Malter 1988:60) Es gibt Phänomene innerhalb der durch den Satz vom Grund beherrschten Willenswelt, die Zeichen für eine weltbefreiende Veränderung im Subjekt sind – und diese Phänomene sind Kunstwerke. Sie gehen aus einem besonderen Akt des Subjekts hervor – aus dem Akt der ›ästhetischen Kontemplation‹. In dieser reißt sich das Subjekt von seiner Bezogenheit auf das einzelne Ding los, das ihm in der Anschauung begegnet; durch die Vergessenheit der Einzelheit des Objekts durch das völlige Eintauchen in dasselbe tritt das Weltwesen in Form der platonischen Idee hervor, und das Subjekt wird zum ›reinen, willenlosen, schmerzlosen, zeitlosen Subjekt des Erkennens‹ (s. Malter 1988:61). Diese Argumentation verdient eine genauere Betrachtung. Schopenhauer benötigt eine Erkenntnis der Ideen, nicht der Vorstellungen. Das spricht er klar im §33 aus: »Da wir nun also als Individuen keine andere Erkenntnis haben, als die dem Satz vom Grunde unterworfen ist, diese Form aber die Erkenntnis der Ideen ausschließt; so ist gewiß, daß, wenn es möglich ist, daß wir uns von der Erkenntnis einzelner Dinge zu der der Ideen erheben, solches nur geschehn kann dadurch, daß im Subjekt eine Veränderung vorgeht, welche jenem großen Wechsel der ganzen Art des Objekts entsprechend und analog ist und vermöge welcher das Subjekt, sofern es eine Idee erkennt, nicht mehr Individuum ist.« (WWV:254) Die Erkenntnis der Idee löst das Individuum von seiner Individualität – das ist der Plot von Schopenhauers Argumentationsstrategie. Das Subjekt löst sich vom Dienst des Willens los und hört auf, ein bloß individuelles Subjekt zu sein, wenn es sich in eine feste Kontemplation des dargebotenen Objekts begibt (WWV:256). In dieser ›festen Kontemplation‹ verliert sich die Relation des Subjekts zum Willen und wird zum reinen Subjekt der Erkenntnis. Schopenhauer fasst dies wie folgt in Worte: »Wenn man, durch die Kraft des Geistes gehoben, die gewöhnliche Betrachtungsart der Dinge fahrenläßt, […] also nicht mehr das Wo, das Wann, das Warum und das Wozu an den Dingen betrachtet; sondern einzig und allein das Seite | 86 Was; auch nicht das abstrakte Denken, die Begriffe der Vernunft, das Bewußtsein einnehmen läßt; sondern statt alles diesen die ganze Macht seines Geistes der Anschauung hingibt, sich ganz in diese versenkt und das ganze Bewußtsein ausfüllen läßt durch die ruhige Kontemplation des gerade gegenwärtigen natürlichen Gegenstandes […], sich gänzlich in diesen Gegenstand verliert, d.h. eben sein Individuum, seinen Willen vergißt und nur noch als reines Subjekt, als klarer Spiegel des Objekts bestehen bleibt; so daß es ist, als ob der Gegenstand allein dawäre, ohne jemanden, der ihn wahrnimmt, und man also nicht mehr den Anschauenden von der Anschauung trennen kann, sondern beide eines geworden sind, indem das ganze Bewußtsein von einem einzigen Bilde gänzlich gefüllt und eingenommen ist; wenn also solchermaßen das Objekt aus aller Relation zu etwas außer ihm, das Subjekt aus aller Relation zum Willen getreten ist; dann ist, was also erkannt wird, nicht mehr das einzelne Ding als solches; sondern es ist die Idee, die ewige Form, die unmittelbare Objektität des Willens auf dieser Stufe: und ebendadurch ist zugleich der in dieser Anschauung Begriffene nicht mehr Individuum; denn das Individuum hat sich eben in solche Anschauung verloren; sondern er ist reines, willenloses, schmerzloses, zeitloses Subjekt der Erkenntnis.« (WWV:257) Das Korrelat des reines Subjekts der Erkenntnis ist die Idee, und beide sind aus den Verstrickungen des Satzes vom Grunde herausgelöst (WWV:258). Diese ›tiefere Einsicht in das Wesen der Welt‹ (WWV:261), das sich durch und in der Kontemplation darbietet, ist mitnichten in den Wissenschaften zu finden, die für Schopenhauer den Relationen nachspürt; die tiefere Einsicht in das Wesen der Welt liegt in der Kunst. »Während die Wissenschaft, dem rast- und bestandlosen Strom vierfach gestalteter Gründe und Folgen nachgeht, bei jeden erreichten Ziel immer wieder weiterverwiesen wird und nie ein letztes Ziel […] finden kann […]; so ist dagegen die Kunst überall am Ziel. Denn sie reißt dem Objekt ihrer Kontemplation heraus aus dem Strome des Weltlaufs und hat es isoliert vor sich: und dieses Einzelne, was in jenem Strom ein verschwinden kleiner Teil war, wird ihr ein Repräsentant des Ganzen […]: sie bleibt daher bei diesem Einzelnen stehn.« (WWV:265) Die Kunst ist damit die ›Betrachtungsart der Dinge, unabhängig vom Satze des Grundes‹ (WWV:265). Diese Betrachtungsart ist nicht jedem möglich, schon gar nicht dem gewöhnlichen Menschen, den Schopenhauer abschätzig als ›Fabrikware der Natur, wie sie solche täglich zu Tausenden hervorbringt‹ (WWV:268) bezeichnet. Nein, es braucht schon Genie, um als ›rein erkennendes Subjekt, als klares Weltauge‹ (WWV:266) übrigzubleiben. Seite | 87 »[D]urch die […] reine Kontemplation werden Ideen aufgefaßt, und das Wesen des Genius besteht eben in der überwiegenden Fähigkeit zu solcher Kontemplation: da nun diese ein gänzliches Vergessen der eigenen Person und ihrer Beziehungen verlangt; so ist Genialität nichts anderes als die vollkommenste Objektivität, d.h. objektive Richtung des Geistes, entgegengesetzt der subjektiven, auf die eigene Person, d.i. den Willen gehende. Demnach ist Genialität die Fähigkeit, sich rein anschauend zu verhalten, sich in die Anschauung zu verlieren und die Erkenntnis, welche ursprünglich nur zum Dienste des Willens daist, diesem Dienste zu entziehen.« (WWV:266) Dabei ist ein wesentlicher Bestandteil des Genius ›Phantasie‹ (WWV:267). Dennoch muss Schopenhauer konzedieren, dass diese Fähigkeit allen Menschen innewohnt, wenngleich in unterschiedlichen Graden – ansonsten wäre nicht erklärlich, wie diese sonst fähig sind, die Werke der Kunst zu genießen (WWV:278). Aber der Geniale hat diese Fähigkeit in ausgezeichneterem Maße, und wiederholt er seine Erkenntnisart, so ist das Kunstwerk geschaffen (WWV: 278). »Der Künstler läßt uns durch seine Augen in die Welt blicken.« (WWV:278) In der willenlosen Anschauung liegt für Schopenhauer Seligkeit (WWV:283). Die subjektive Seite des ästhetischen Wohlgefallens ist der Eindruck des Erhabenen (WWV:284). Das Gefühl des Erhabenen stellt sich ein, weil beim Schönen das reine Erkennen ›ohne Kampf‹ die Oberhand gewinnt – man ist über dem verlassenen Gegenstand im eigentlichen Sinn des Wortes erhaben (WWV:287). Die Erhebung muss mit Bewusstsein nicht nur gewonnen, sondern auch erhalten werden, womit die Erinnerung an den Willen nicht völlig verblasst ist. An einem netten Beispiel beschreibt das Schopenhauer wie folgt: »Sehn wir nun im strengen Winter bei der allgemeinen Erstarrung der Natur die Strahlen der niedrigstehenden Sonne von steinernen Massen zurückgeworfen, wo sie erleuchten, ohne zu wärmen, also nur der reinsten Erkenntnisweise, nicht dem Willen günstig sind; so versetzt die Betrachtung der schönen Wirkung des Lichtes auf diese Massen uns wie alle Schönheit in den Zustand des reinen Erkennens, der jedoch hier durch die leise Erinnerung an den Mangel der Erwärmung durch ebenjene Strahlen, also des belebenden Prinzips schon ein gewissen Erheben über das Interesse des Willens verlang.« (WWV:289) Angesichts einer Gegend, die die Natur in stürmischer Bewegung zeigt, notiert Schopenhauer: »Unsere Abhängigkeit, unser Kampf mit der feindlichen Natur, unser darin gebrochener Wille tritt uns jetzt anschaulich vor Augen: solange aber nicht die persönliche Bedrängnis die Oberhand gewinnt, sondern wir in ästhetischer Be- Seite | 88 schauung bleiben, blickt durch jenen Kampf der Natur, durch jenes Bild des gebrochenen Willens das reine Subjekt des Erkennens durch und faßt ruhig, unerschüttert, nicht mitgetroffen (unconcerned) an eben den Gegenständen, welche dem Willen drohend und furchtbar sind, die Ideen auf. In diesem Kontext eben liegt das Gefühl des Erhabenen.« (WWV:291) Schopenhauers Theorie des Erhabenen ist, wie so vieles, von der Kritik der Urteilskraft beeinflusst; diese Kritik ist Kants ästhetisches Hauptwerk, in dem u.a. das Schöne und das Erhabene diskutiert werden; in beiden Punkten ist Schopenhauer Kantianer – allerdings einer, der etwas von Kunst versteht. Drei Zitate sollen diese Behauptung plausibel machen, wenngleich nicht erschöpfend erklären: »Geschmack ist das Beurteilungsvermögen eines Gegenstandes oder einer Vorstellungsart durch ein Wohlgefallen, oder Mißfallen, o h n e a l l e s I n t e r e s s e . Der Gegenstand eines solchen Wohlgefallens heißt s c h ö n .« (Kant 1989:124) »Schön ist das, was ohne Begriff allgemein gefällt.« (Kant 1989:134) »Schön ist das, was in der bloßen Beurteilung (also nicht vermittelst der Empfindung des Sinnes nach einem Begriffe des Verstandes) gefällt. Hieraus folgt von selbst, daß es ohne alles Interesse gefallen muß. Erhaben ist das, was durch seinen Widerstand gegen das Interesse der Sinne unmittelbar gefällt. […] Man kann das Erhabene so beschreiben: es ist ein Gegenstand (der Natur), dessen Vorstellung das Gemüt bestimmt, sich die Unerreichbarkeit der Natur als Darstellung von Ideen zu denken.« (Kant 1989:193) *** Für Schopenhauer variiert die Quelle des ästhetischen Genusses; sie oszilliert zwischen der Auffassung der erkannten Idee und »der Seligkeit und Geistesruhe des von allem Wollen und dadurch von aller Individualität und der aus ihr hervorgehenden Pein befreiten reinen Erkenntnis« (WWV:301). Schopenhauer widmet mehrere Paragraphen der Diskussion einzelner Kunstrichtungen; er fängt im §43 mit der Baukunst an, gefolgt von der Gartenkunst, der Tiermalerei und der Tierbildhauerei im §44, gefolgt von Historienmalerei und Skulptur (»Menschliche Schönheit ist ein objektiver Ausdruck, welcher die vollkommenste Objektivität des Willens auf der höchsten Stufe seiner Erkennbarkeit bezeichnet, die Idee des Menschen überhaupt, vollständig ausgedrückt in der angeschauten Form.« – WWV:311); daran schließt er Überlegungen zur Allegorie (§50), zur Poesie (§51) und gelangt schließlich zur Musik (§52). Die Musik ist für Schopenhauer eine ›so große und überaus herrliche Kunst‹, die mächtig auf das Innerste des Menschen wirkt; diesem Wirken liegt Seite | 89 eine ganz allgemeine Sprache zugrunde, deren Deutlichkeit ›sogar die der anschaulichen Welt selbst übertrifft‹; der Musik ist eine ›ernstere und tiefere, sich auf das innerste Wesen der Welt beziehende Bedeutung‹ zu attestieren (WWV:357). Die herausragende Stellung der Musik argumentiert Schopenhauer wie folgt: »Die adäquate Objektivation des Willens sind die (Platonischen) Ideen; die Erkenntnis dieser durch Darstellung einzelner Dinge […] anzuregen […] ist der Zweck aller anderen Künste. Sie alle objektivieren also den Willen nur mittelbar, nämlich mittelst der Ideen: und da unsere Welt nichts anderes ist als die Erscheinung der Ideen in der Vielheit mittelst Eingang in das principium individuationis […]; so ist die Musik, da sie die Ideen übergeht, auch von der erscheinenden Welt ganz unabhängig, ignoriert sie schlechthin, könnte gewissermaßen, auch wenn die Welt gar nicht wäre, doch bestehn: was von den andern Künsten sich nicht so sagen läßt. Die Musik ist nämlich eine so unmittelbare Objektivation und ein Abbild des ganzen Willens, wie die Welt selbst es ist, ja wie die Ideen es sind […]. Die Musik ist also keineswegs gleich den andern Künsten das Abbild der Ideen; sondern Abbild des Willens selbst […]: deshalb eben ist die Wirkung der Musik so sehr viel mächtiger und eindringlicher als die der andern Künste: denn diese reden nur vom Schatten, sie aber vom Wesen.« (WWV:359) Die Musik kündet den Willen selbst. Schopenhauer hört den Willen wie folgt: »Ich erkenne in den tiefsten Tönen der Harmonie, im Grundbaß, die niedrigsten Stufen der Objektivation des Willens wieder, die unorganische Natur, die Masse des Planeten. Alle die hohen Töne, leicht beweglich und schneller verklingen, sind bekanntlich anzusehn als entstanden durch die Nebenschwingungen des tiefen Grundtones […]. Dieses ist nun dem analog, daß die gesamten Körper und Organisationen der Natur angesehn werden müssen als entstanden durch die stufenweise Entwickelung aus der Masse der Planeten. […] Die Tiefe hat eine Grenze, über welche hinaus kein Ton mehr hörbar ist: dies entspricht dem, daß keine Materie ohne Form und Qualität wahrnehmbar ist […]: also wie vom Ton als solchem ein gewisser Grad der Höhe unzertrennlich ist, so von der Materie ein gewisser Grad der Willensäußerung. […] Nun ferner in den gesamten die Harmonie hervorbringenden Ripienstimmen, zwischen dem Basse und der leitenden, die Melodie singenden Stimme, erkenne ich die gesamte Stufenfolge der Ideen wieder, in denen der Wille sich objektiviert.« (WWV:360) Das Streben des Willens, das kurzzeitig von Befriedigung unterbrochen wird, um weiterzustreben, findet sein musikalisches Pendant in der Melodie, deren Wesen in der steten Abweichung, Abirren vom Grundton und dem Zurückkehren zum Grundton liegt (WWV:363). Die Erfindung der Musik bedarf naturgemäß eines besonderen Menschen: Seite | 90 »Der Komponist offenbart das innerste Wesen der Welt und spricht die tiefste Wahrheit aus, in einer Sprache, die seine Vernunft nicht versteht […]. Daher ist in einem Komponisten mehr als in irgendeinem andern Künstler der Mensch vom Künstler ganz getrennt und geschieden.« (WWV:363) Die Musik drückt das innere Wesen, das An-sich der Erscheinungen, den Willen selbst aus. Sie drückt nicht diese Freude, diese Betrübnis oder diesen Schmerz aus, »sondern die Freude, die Betrübnis, den Schmerz, das Entsetzen, den Jubel, die Lustigkeit, die Gemütsruhe selbst« (WWV:364). »[Ü]berall drückt die Musik nur die Quintessenz des Lebens und seiner Vorgänge aus, nie diese selbst. […] Gerade diese ihr ausschließlich eigene Allgemeinheit bei genauester Bestimmtheit gibt ihr den hohen Wert, welchen sie als Panakeion [Allheilmittel] aller unserer Leiden hat.« (WWV:365) Folglich spricht Schopenhauer gleichermaßen von der Welt als ›verkörperte Musik‹ und ›verkörpertem Willen‹ (WWV:366). Die Musik öffnet die Tore zu einem fernen Paradies. »Das unaussprechlich Innige aller Musik, vermöge dessen sie als ein so ganz vertrautes und doch ewig fernes Paradies an uns vorüberzieht, so ganz verständlich und doch so unerklärlich ist, beruht darauf, daß sie alle Regungen unsers innersten Wesens wiedergibt, aber ganz ohne die Wirklichkeit und fern von ihrer Qual.« (WWV:368) Diese Passage macht die Verbindung von Kontemplation und Befreiung abschließend überdeutlich. Die Wandlung des Subjekts und die Fixierung des paradiesischen Befreiungserlebnisses lassen sich wie folgt abschließend zusammenfassen. »Das mit dem Wollenssubjekt identische Erkenntnissubjekt kann sich, solange diese Identität besteht – und das heißt in letzter Instanz: solange das Individuum leibhaft lebt –, dem Drang des Wollens nicht entziehen. Das Wollen gewinnt wieder die Herrschaft über das Bewußtsein, die Individualität meldet sich mit mächtigem Anspruch auf Triebbefriedigung; im gleichen Zuge verhüllt das Netz der Relationen die Objekte, und an die Stelle der Ideen treten die vielfach bestimmten vielen Einzelobjekte: Wille und Satz vom Grunde holen das in seine Freiheit geflüchtete Subjekt des Erkennens wieder ein. Das Leben geht seinen gewöhnlichen Leidensgang weiter. Gänzlich aber muß das in der ästhetischen Kontemplation Erfahrene nicht untergehen. Es besteht die Möglichkeit, das (durch Vergessen der Satz-vomGrund-Determination) erschaute Wesen der Dinge auch unter den Bedingungen der inadäquaten Objektivität des Willens, der gewöhnlichen Welt, im nachhinein zu fixieren. Das Phänomen, welches innerhalb der durch Wille (Was) und Satz vom Grund (Wie) bestimmten Welt die ästhetische Kontemplation fort- Seite | 91 setzt und ihre vergängliche Schau fest bewahrt, ist die Kunst. Ihre Werke machen das Gefüge aus Wille und Satz vom Grund, den Stoff, durchsichtig für die Idee – sie wiederholen die Idee im Stoff.« (Malter 1988:72) Fünfte Vorlesung Lektüre der WWV: Bejahung & Verneinung des Willens Mit dem §53 fängt Schopenhauer das vierte und letzte Buch an, das er als das ›ernsteste‹ bezeichnet. Es geht hier, bei erreichter Selbsterkenntnis, um Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben; damit geht es zugleich um praktische Philosophie, wenngleich sie den theoretischen Boden nicht völlig verlassen wird (WWV:375) – der eine Gedanke wird also auf das Handeln des Menschen angewendet. Sollte diese Ankündigung es insinuieren, so wehrt Schopenhauer gleich ab – er wird keine Pflichtenlehre und kein Moralprinzip liefern (WWV:376), denn der Wille ist nicht nur frei, »sondern sogar allmächtig: aus ihm ist nicht nur sein Handeln, sondern auch seine Welt; und wie er ist, so erscheint sein Handeln, so erscheint seine Welt« (WWV:377). Der eine Gedanke trägt auch hier: »Die echte philosophische Betrachtungsweise der Welt, d.h. diejenige, welche uns ihr inneres Wesen erkennen lehrt und so über die Erscheinungen hinausführt, ist gerade die, welche nicht nach dem Woher und Wohin und Warum, sondern immer und überall nur nach dem Was der Welt frägt […].« (WWV:379) In der Welt als Vorstellung begegnet sich der Wille quasi wie in einem Spiegel und erkennt sich mit zunehmender Deutlichkeit – etwas unscharf beim Tier, wesentlich präziser beim Menschen (WWV:379). Der Wille, dieser ›dumpfe, blinde und unaufhaltsame Drang‹ (WWV:380) will eines, nämlich das Leben, weil dieses »nichts weiter als die Darstellung jenes Wollens für die Vorstellung ist« (WWV:380). Statt ›Wille‹ lässt sich auch sagen ›Wille zum Leben‹; beides ist synonym. Der Unterschied zwischen Ding an sich und Vorstellung, zwischen Wille und Leben, führt zu einer interessanten Pointe: der Wille stirbt nicht, selbst wenn das Individuum stirbt. »Dem Wille zum Leben ist also das Leben gewiß, und solange wir von Lebenswillen erfüllt sind, dürfen wir für unser Dasein nicht besorgt sein, auch nicht beim Anblick des Todes. Wohl sehn wir da Individuum entstehn und vergehn: aber das Individuum ist nur Erscheinung […]: für diese freilich empfängt es sein Leben wie ein Geschenk, geht aus dem Nichts hervor, leidet dann durch den Tod den Verlust jenes Geschenks und geht ins Nichts zurück. Aber wir wollen ja eben das Leben philosophisch […] betrachten, und da werden wir finden, daß Seite | 92 weder der Wille, das Ding an sich in allen Erscheinungen, noch das Subjekt des Erkennens, der Zuschauer aller Erscheinungen, von Geburt und Tod irgend berührt werden. Geburt und Tod gehören eben zur Erscheinung des Willens, also zum Leben, und es ist diesem wesentlich, sich in Individuen darzustellen, welche entstehn und vergehn […].« (WWV:380) Es ist sicherlich nicht Schopenhauers Absicht, mit diesen Worten Trost auszusprechen. Allerdings führt dieser Gedanke nicht unweit an die Unsterblichkeit der Seele hin, wie sie in vielen Religionen bekannt ist und hier sehr wohl tröstlich sein soll – sowohl für den Sterbenden als auch für die Hinterbliebenen. Doch der Ernst der Thematik des vierten Buches ist klargestellt. Schopenhauer argumentiert gemäß der Idee, die er bereits in der Dissertation von 1813 formuliert hat, dass die Materie Substanz ist und als solche in der Menge keiner Änderung fähig ist – die Substanz bleibt immer gleich, mögen sich auch die erscheinenden Entitäten ändern; Substanz ist das beharrende Moment. Ebenso gehören Zeugung und Tod zum Leben bei Konstant-Haltung der Materie. »[Das Leben] ist durch und durch nichts anderes als ein steter Wechsel der Materie unter festen Beharren der Form: und ebendas ist die Vergänglichkeit der Individuen bei ihrer Unvergänglichkeit der Gattung.« (WWV:382) Dem hängt Schopenhauer die ernstgemeinte, aber doch abstrus-witzig anmutende Bemerkung an: »Die beständige Ernährung und Reproduktion ist nur dem Grade nach von der Zeugung und die beständige Exkretion nur dem Grade nach vom Tode verschieden. […] Wie wir nun hiebei allezeit zufrieden sind, die Form zu erhalten, ohne die abgeworfene Materie zu betrauern; so haben wir uns auf gleiche Weise zu verhalten, wenn im Tode dasselbe in erhöhter Potenz und im ganzen geschieht, was täglich und stündlich im einzelnen bei der Exkretion vor sich geht […].« (WWV:383) Den menschlichen Metabolismus bzw. den Stuhlgang mit dem Tod qualitativ, wenngleich nicht quantitativ gleichzusetzen, ist gleichermaßen sonderlich wie dem einen Gedanken entsprechend. Wer handelt, will, und wer will, will das Leben: Darin liegt die Bejahung des Willens. Bejahung des Willens heißt schlicht: leben wollen. Vor der Folie der Bejahung des Willens, also vor der Folie des Leben-wollens stellt sich die Angst vor dem Tod besonders bedrohlich dar. Denn im Tod geht das Individuum unter; Schmerz ist da schon fast ein Begleitphänomen. »Was wir im Tode fürchten ist keineswegs der Schmerz: denn teils liegt dieser offenbar diesseits des Todes; teils fliehn wir oft vor dem Schmerz zum Tode Seite | 93 ebensowohl als wir auch umgekehrt bisweilen den entsetzlichsten Schmerz übernehmen, um nur dem Tode, wiewohl er schnell und leicht wäre, noch eine Weile zu entgehn. Wir unterscheiden also Schmerz und Tod als zwei ganz verschiedene Übel: was wir im Tode fürchten, ist in der Tat der Untergang des Individuums, und da das Individuum der Wille zum Leben selbst in einer einzelnen Objektivation ist, sträubt sich sein ganzes Wesen gegen den Tod.« (WWV:391) Der Wille als solcher entsteht und vergeht nicht; darin ist er nicht allein – das Weltauge öffnet und schließt sich ebenso wenig (um das poetisch auszudrücken). »[A]uch dem reinen Subjekt des Erkennens, dem ewigen Weltauge, kommt so wenig ein Beharren als ein Vergehn zu, da dieses in der Zeit allein gültige Bestimmungen sind, jene aber außer der Zeit liegen. Schopenhauer fasst die Bejahung und die Verneinung des Willens wie folgt: »Der Wille bejaht sich selbst, besagt: indem in seiner Objektität, d.i. der Welt und dem Leben, sein eigenes Wesen ihm als Vorstellung vollständig und deutlich gegeben wird, hemmt diese Erkenntnis sein Wollen keineswegs; sondern ebendieses so erkannte Leben wird auch als solches von ihm gewollt, wie bis dahin ohne Erkenntnis als blinder Drang, so jetzt mit Erkenntnis, bewußt und besonnen. – Das Gegenteil hievon, die Verneinung des Willens zum Leben, zeigt sich, wenn auf jene Erkenntnis das Wollen endet, indem sodann nicht mehr die erkannten einzelnen Erscheinungen als Motive des Wollens wirken, sondern die ganze durch Auffassung der Ideen erwachsene Erkenntnis des Wesens der Welt, die den Willen spiegelt, zum Quietiv des Willens wird und so der Wille frei sich selbst aufhebt.« (WWV:393) Lektüre der WWV: Streben und Leiden Im §56 wendet sich Schopenhauer der Bestimmung des Willens als Streben und den daraus entspringenden Korollarien zu. Ein weiteres Mal betont Schopenhauer, dass der Wille auf allen Stufen seiner Erscheinung »eines letzten Zieles und Zweckes ganz entbehrt, immer strebt, weil Streben sein alleiniges Wesen ist« (WWV:423). Dieses Streben erfährt allerdings da und dort seine Hindernisse, und diese Hemmung ist nichts anderes als Leiden; das Streben erreicht auch gesetzte Ziele (im Bereich der Objektivationen des Willens), und dann tritt Befriedigung ein (WWV:425). Doch den letztgenannten Zustand sieht Schopenhauer nur selten. Seite | 94 »Das Streben sehn wir überall vielfach gehemmt, überall kämpfend; so lange also immer als Leiden; kein letztes Ziel des Strebens, also kein Maß und Ziel des Leidens.« (WWV:425) Weil im Menschen der Wille immer deutlicher hervortritt, tritt auf der Stufe des Menschen auch das Leiden deutlich hervor (WWV:425). Diese Stufenfolge des Leidens erklärt sich wie folgt: »In der Pflanze ist noch keine Sensibilität, also kein Schmerz: ein gewiß sehr geringer Grad von Leiden wohnt den untersten Tieren […] ein: sogar in den Insekten ist die Fähigkeit zu empfinden und zu leiden noch beschränkt: erst mit dem vollkommenen Nervensystem der Wirbeltiere tritt sie in hohem Grade ein, und in immer höherem, je mehr die Intelligenz sich entwickelt. In gleichem Maße also, wie die Erkenntnis zur Deutlichkeit gelangt, das Bewußtsein sich steigert, wächst auch die Qual, welche folglich ihren höchsten Grad im Menschen erreicht […].« (WWV:425) Alles Leben ist Leiden – so bringt Schopenhauer den einen Gedanken an dieser Stelle auf den Punkt (WWV:426). Beim Menschen lässt sich auch feststellen, dass sein Wollen beizeiten auf Objekte und Ziele gerichtet ist, die sehr leicht zu erreichen sind. Sind sie erreicht, ist die Befriedigung der Bedürfnisse auch schon wieder vorbei, und eine ›furchtbare Leere und Langeweile‹ befällt den Menschen. Schopenhauer sieht den Menschen zwischen den beiden Polen Leid und Langeweile hin und her pendeln. »Sein Leben schwingt also gleich einem Pendel hin und her zwischen dem Schmerz und der Langeweile.« (WWV:428) »[Es ist] sehr bemerkenswert, daß einerseits die Leiden und Qualen des Lebens leicht so anwachsen können, daß selbst der Tod […] wünschenswert wird […]; und andererseits wieder, daß, sobald Not und Leiden dem Menschen eine Rast vergönnen, die Langeweile gleich so nahe ist, daß er des Zeitvertreibes notwendig bedarf.« (WWV:429) Der menschliche Leib ist der objektivierte Wille zum Leben, ja die vollkommenste Objektivation des Willens. Damit ist der Mensch zugleich das bedürftigste unter allen Wesen – er ist ›konkretes Wollen und Bedürfen durch und durch, ist ein Konkretem von tausend Bedürfnissen‹ (WWV:428). Die Befriedigung der Wünsche ist nur ein scheinbares Quietiv, denn mit der Erreichung des Ziels bricht schon der nächste Wunsch auf und bestätigt einmal mehr, dass Leben Leiden ist – der Wunsch ist daher seiner Natur nach Schmerz (WWV:430). Was am meisten Befriedigung verspricht, sind intellektuelle Genüsse, doch die sind ›dem bei weitem größten Teile der Menschen‹ Seite | 95 nicht zugänglich (WWV:431) – dass Schopenhauer von seinen Mitmenschen nicht unbedingt das Beste denkt, darauf habe ich bereits verwiesen; diese Misanthropologie spricht Schopenhauer auch in der folgenden Passage aus: »Es ist wirklich unglaublich, wie nichtssagend und bedeutungsleer, von außen gesehn, und wie dumpf und besinnungsleer, von innen empfunden, das Leben der allermeisten Menschen dahinfließt. Es ist ein mattes Sehnen und Quälen, ein träumerisches Taumeln durch die vier Lebensalter hindurch zum Tode, unter Begleitung einer Reihe trivialer Gedanken.« (WWV:441) Das Glück entpuppt sich niemals als schlussendliche Befriedigung; es ist nur ein kurzzeitiges Überpinsel des unmittelbar gegebenen Mangels bzw. Leidens. Man kann die Sache drehen und wenden, wie man will – »[d]ie unaufhörlichen Bemühungen, das Leiden zu verbannen, leisten nichts weiter, als daß es seine Gestalt verändert« (WWV:432). »Aber was auch Natur, was auch das Glück getan haben mag; wer man auch sei und was man auch besitze; der dem Leben wesentliche Schmerz läßt sich nicht abwälzen.« (WWV:431) Die elementaren Grundzüge des Menschlebens liegen ergo darin, dass dieses der ›ganzen Anlage nach keiner wahren Glückseligkeit fähig‹ ist (WWV:443). Diese Betrachtung ist ›niederschlagend‹ (WWV:432). Und der Optimismus erscheint Schopenhauer »als eine wahrhaft ruchlose Denkungsart […], als ein bitterer Hohn über die namenlosen Leiden der Menschheit« (WWV:447). Lektüre der WWV: Bejahung und Sexualität Die Erkenntnis steht im Dienste des Willens – und das gilt in besonderem Maße von der Sexualität, »die als überindividuelle Macht das Individuum zappeln lässt« (Safranski 2010:338). Obwohl die WWV der Sexualität nur wenige Seiten widmet, legt Schopenhauer hier die Wurzel für seine späteren, umfangreichen Studien zur Sexualität in den Parerga und Paralipomena, wo er den sexuellen Antrieben »in entlegeneren Lebensbereichen, wo man sie nicht vermuten würde« (Safranski 2010:338), nachspürt (womit Schopenhauer Nietzsche und Freud vorarbeitet). »Die Bejahung des Willens ist das von keiner Erkenntnis gestörte beständige Wollen selbst, wie es das Leben des Menschen im allgemeinen ausfüllt. Da schon der Leib des Menschen die Objektität des Willens, wie er auf dieser Stufe und in diesem Individuo erscheint, ist; so ist sein in der Zeit sich entwickelndes Wollen gleichsam die Paraphrase des Leibes, die Erläuterung der Bedeutung des Ganzen Seite | 96 und seiner Teile, ist eine andere Darstellungsweise desselben Dinges an sich, dessen Erscheinung auch schon der Leib ist. Daher können wir statt Bejahung des Willens auch Bejahung des Leibes sagen.«(WWV:447f) Der Mensch ist von Anfang an wollend (nur so tritt er in den Fokus der Selbsterkenntnis); die Erkenntnis sieht Schopenhauer ›in der Regel‹ in dieser Beziehung zum Willen verharren – der Mensch sucht die Objekte seines Wollens und prüft die Mittel, die zu deren Erreichung notwendig sind. Die Erkenntnis steht also ganz unter dem Primat des Wollens. »So ist das Leben fast aller Menschen: sie wollen, wissen, was sie wollen, streben danach mit so vielem Gelingen, als sie vor Verzweiflung, und so vielem Mißlingen, als sie vor Langerweile und deren Folgen schützt. Daraus geht eine gewisse Heiterkeit, wenigstens Gelassenheit hervor […]. Sie treibt vorwärts, mit vielem Ernst, ja mit wichtiger Miene: so treiben auch die Kinder ihr Spiel.« (WWV:449) Der Mensch bejaht den Willen nicht nur in der Erhaltung seines Leibes, sondern erhält seinen Leib auch über seine je individuelle Existenz hinaus – Schopenhauer ist beim ›Geschlechtstrieb‹ gelandet. In dessen Befriedigung liegt die Bejahung des Lebens ›über den Tod des Individuums in eine unbestimmte Zeit‹ (WWV:449) hinaus. Im Sexualakt darf folglich die ›entschiedenste Bejahung des Willens zum Leben‹ gesehen werden, und diese Bejahung fällt ›rein und ohne weiteren Zusatz‹ aus (WWV: 449). Die Bestätigung dafür, dass der Geschlechtstrieb die stärkste Bejahung des Lebens ist, liegt auch darin, dass er für Mensch und Tier ›der letzte Zweck, das höchste Ziel‹ (WWV:451) ist. Schopenhauer antizipiert moderne biologische Paradigmen, wenn er notiert: »Selbsterhaltung ist [des Menschen] erstes Streben, und sobald er für diese gesorgt hat, strebt er nur nach Fortpflanzung des Geschlechts: mehr kann er als bloß natürliches Wesen nicht anstreben.« (WWV:451) Schopenhauer hat ja bereits im zweiten Buch von Die Welt als Wille und Vorstellung die Genitalien als Objektivation des Willens hinsichtlich des Geschlechtstriebes bestimmt. Hier nun, im vierten Buch, entdeckt Schopenhauer in den Genitalien den ›eigentlichen Brennpunkt‹ (WWV:452) des Willens, der dem Erkenntnisstreben am entferntesten ist; im Gegensatz zum Gehirn, wo sich er Wille hinsichtlich seiner Erkenntnisfunktion objektiviert. »Die Genitalien sind viel mehr als irgendein anderes äußeres Glied des Leibes bloß dem Willen und gar nicht der Erkenntnis unterworfen: ja der Wille zeigt sich hier fast so unabhängig von der Erkenntnis wie in den auf Anlaß bloßer Reize, dem vegetativen Leben, der Reproduktion dienenden Teilen, in welchen der Wille blind wirkt wie in der erkenntnislosen Natur.« (WWV:452) Seite | 97 Die Sexualität ist für Schopenhauer das Modell des als quälend empfundenen Willensgeschehens; im Sexualakt – in der Be-Gattung – wird der Mensch zum Gattungswesen, geht also seiner Individualität verlustig; und der Mensch hat dabei das Pech, dass ihm dies bewusst wird. Der Mensch erfährt, wie gleichgültig er als Individuum der Natur ist, und das erzeugt Qualen (s. Safranski 2010:338f). Schopenhauers Sicht der Sexualität dürfte auf Jean-Paul Sartre gewirkt haben; dieser notiert in Das Sein und das Nichts: »Der Mensch, sagt man, sei ein geschlechtliches Wesen, weil er ein Geschlecht besitzt. Und wenn es umgekehrt wäre? Wenn das Geschlecht nur das Instrument und gleichsam das Bild einer fundamentalen Sexualität wäre? Wenn der Mensch ein Geschlecht nur besäße, weil er ursprünglich und fundamental ein geschlechtliches Wesen ist als Wesen, das in der Welt in Verbindung mit anderen Menschen existiert?« (Sartre 1994:671) In Sartres Überlegungen zur Obszönität klingt Schopenhauer schwach nach, und zwar der Schopenhauer, der viel Wert auf die Individualität des Menschen legt. Sartre bestimmt Anmut als »das objektive Bild eines Seins, das Grund seiner selbst, um zu…« (Sartre 1994:699) ist; das Individuum ist dann anmutig, wenn es sich durch und durch bestimmt zu sein, der/die es sein will. »Bei der Anmut ist der Körper das Instrument, das die Freiheit manifestiert.« (Sartre 1994:699) Wo diese individuelle Determination fehlt, tritt das Obszöne auf. Wo der Körper von der determinierten Bewegung zum wabbelnden Fleisch wird, realisiert sich das Obszöne. »Das Obszöne erscheint, wenn der Körper Stellungen einnimmt, die ihn seiner Akte völlig entkleiden und die Inertheit seines Fleisches enthüllen. Der Anblick eines nackten Körpers von hinten ist nicht obszön. Aber ein gewisses unwillkürliches Wabbeln des Pos ist obszön.« (Sartre 1994:701) Verliert eine Körperpartie ihre individuelle Bestimmtheit, trägt sie zur Handlung nichts mehr bei, dann gibt ihre Bewegung keine Auskunft über die Intention des Individuums und jener Körperteil verfällt der Obszönität. Dabei ist Sartre nicht zimperlich und subsumiert unter das ›Wabbeln‹ jede Form des Übergewichts. Seite | 98 Lektüre der WWV: Quietiv des Willens Das Ziel von Die Welt als Wille und Vorstellung ist das ›große Nein‹ (Safranski 2010:347), das Schopenhauer dem Willen entgegnet. Wie die Willensverneinung allerdings möglich sein soll, angesichts der nicht zu leugnenden Macht des Willens über den Menschen, ist nicht auf den ersten Blick zu erfassen – auch nach der Bekanntschaft mit den Möglichkeiten, die die Kunst aufgezeigt hat. Die Verneinung des Willens ist ein Geschehen des Willens selbst, denn die radikale Immanenz der Willensmetaphysik verbietet es Schopenhauer, eine höhere Macht eingreifen zu lassen, die dem Menschen die Verneinung ermöglicht (s. Safranski 2010:348). »Schopenhauer wird die Verneinung des Willens primär nicht als Erkenntnisgeschehen, sondern als Seinsgeschehen begreiflich machen müssen. Weil Wille alles ist, wird der Wille nicht von etwas anderem als er selbst verneint werden können. Für den Metaphysiker des Willens kann die Verneinung des Willens nur als Selbstaufhebung des Willens denkbar.« (Safranski 2010:348) (Es sei erwähnt, dass Safranski nicht nur hier Schopenhauers Denken in jenen Begriffen fasst, die Dieter Henrich auf Hegel angewandt hat. Safranski schlägt also implizit vor, Schopenhauer in den Bahnen des deutschen Idealismus zu verstehen, was zwar Schopenhauers Selbstverständnis, nicht aber den Tatsachen widerspricht.) Das Verständnis der Mystik der Willensverneinung bereitet Schopenhauer mit der Theorie des Mitleids vor (s. Safranski 2010:349). Das Mitleid ist weniger eine moralische Forderung, als vielmehr eine Erfahrung, die gelegentlich aufblitzt – »die Erfahrung nämlich, daß alles außer mir ebenso Wille ist und alle Schmerzen und alle Qual ebenso leidet wie ich selbst« (Safranski 2010:349). »Wenn uns nun aber als eine seltene Ausnahme ein Mensch vorkommt, der etwan ein beträchtliches Einkommen besitzt, von diesem aber nur wenig für sich benutzt und alles übrige den Notleidenden gibt, während er selbst viele Genüsse und Annehmlichkeiten entbehrt, und wir das Tun dieses Menschen uns zu verdeutlichen suchen; so werden wir […] als den einfachsten allgemeinen Ausdruck und als den wesentlichen Charakter seiner Handlungsweise finden, daß er weni- ger, als sonst geschieht, einen Unterschied macht zwischen sich und den anderen.« (WWV:506) In diesem ›weniger-Unterschied-machen‹ liegt begründet, dass das principium individuationis nicht länger seine volle Macht über den Menschen ausübt – der Mitleidende, den Schopenhauer den ›Edlen‹ (WWV:507) nennt, befängt nicht länger die Vereinzelung, sondern das Leiden, das er an anderen sieht, das ihm Seite | 99 aber so nah geht, als litte er selbst. Darin ereignet sich die Erkenntnis des Willens, der ich selbst bin, auch im anderen. »[Der Edle] erkennt unmittelbar und ohne Schlüsse, daß das An-sich seiner eigenen Erscheinung auch das der fremden ist, nämlich jener Wille zum Leben, welcher das Wesen jeglichen Dinges ausmacht und in allem lebt; ja daß dieses sich sogar auf die Tiere und die ganze Natur erstreckt: daher wird er auch kein Tier quälen.« (WWV:507) Es ist nicht unbedeutend zu bemerken, dass Schopenhauer im obigen Zitat von einer ›unmittelbaren‹ Erkenntnis spricht, die ›ohne Schlüsse‹ aufblitzt. In dieser Unmittelbarkeit liegt die Selbsterfahrung des Willens, nicht eine langwierig durch das Denken vermittelte Überlegung. Es ist kein abstrakter Schluss, sondern der Wille erfährt sich selbst in den anderen Entitäten waltend. Der, der Mitleid empfindet, wird die ›Werke der Liebe‹ tun; ihm ist der Schleier der Maja durchsichtig geworden: »[J]enem, der die Werke der Liebe übt, ist der Schleier der Maja durchsichtig geworden, und die Täuschung des principii individuationis hat ihn verlassen. Sich, sein Selbst, seinen Willen erkennt er in jedem Wesen, folglich auch in dem Leidenden. Die Verkehrtheit ist von ihm gewichen, mit welcher der Wille zum Leben, sich selbst verkennend, hier in einem Individuo flüchtige, gauklerische Wollüste genießt, und dafür dort in einem andern leidet und darbt und so Qual verhängt und Qual duldet, nicht erkennend, daß er wie Thyestes sein eigenes Fleisch gierig verzehrt und dann hier jammert über unverschuldetes Leid und dort frevelt ohne Scheu vor Nemesis […].« (WWV:507f) In der uneigennützigen Liebe gegen andere wird dem Menschen der andere gleichwertig, womit das principium individuationis partiell außer Kraft gesetzt wird; diese reine Liebe ist ihrer Natur nach Mitleid (WWV:511). Aus derselben Quelle nun, aus der Güte, Liebe, Tugend und Edelmut entspringen, geht auch dasjenige hervor, »was ich die Verneinung des Willens zum Leben nenne« (WWV:514). Safranski (2010:351) weist darauf hin, dass Schopenhauer auf die christliche Terminologie der ›Gnadenwahl‹ zurückgreift, um das Mysterium der Verneinung nicht als Resultat einer Entschiedenheit, sondern als Widerfahrnis zu denken ist. Dies bemerkt man bereits, wenn Schopenhauer das ›Quietiv alles und jedes Wollens‹ das erste Mal thematisiert: »Der Wille wendet sich nunmehr vom Leben ab; ihn schaudert jetzt vor dessen Genüssen, in denen er die Bejahung desselben erkennt. Der Mensch gelangt zum Zustande der freiwilligen Entsagung, der Resignation, der wahren Gelassenheit und gänzlichen Willenlosigkeit.« (WWV:515) S e i t e |100 Welche Rolle dabei die Erkenntnis spielt, ist durchaus widersprüchlich (s. Safranski 2010:351): Einerseits bezeichnet es Schopenhauer immer wieder als Erkenntnis, die den Schleier der Maja lüftet; andererseits ist es der Wille selbst, der sich vom Leben abwendet. Dem obigen Zitat gehen die Wort voran, dass es die ›Erkenntnis des Ganzen, des Wesens der Dinge an sich‹ ist, die zum Quietiv alles und jedes Wollen werden (WWV:515). »Vergleichen wir das Leben mit einer Kreisbahn aus glühenden Kohlen mit einigen kühlen Stellen […]; so tröstet den im Wahn Befangenen die kühle Stelle, auf der er jetzt eben steht oder die er nahe vor sich sieht, und er fährt fort, die Bahn zu durchlaufen. Jener aber, der, das principium individuationis durchschauend, das Wesen der Dinge an sich und dadurch das Ganze erkennt, ist solchen Trostes nicht mehr empfänglich: er sieht sich an allen Stellen zugleich und tritt heraus. – Sein Wille wendet sich, bejaht nicht mehr sein eigenes sich in der Erscheinung spiegelndes Wesen, sondern verneint es.« (WWV:516) *** Die Verneinung des Willens zeigt sich im Übergang von der Tugend zur Askese. Es ist für den Edlen nicht länger ausreichend, die anderen rein zu lieben und für sie so viel zu tun wie für sich selbst; nein, es entsteht eine Abscheu vor dem Wesen, dessen Erscheinung er ist, also eine Abscheu vor dem Willen zum Leben (WWV:516). »Sein Leib, gesund und stark, spricht durch Genitalien den Geschlechtstrieb aus, aber er verneint den Willen und straft den Leib Lügen: er will keine Geschlechtsbefriedigung, unter keiner Bedingung. Freiwillig vollkommene Keuschheit ist der erste Schritt zur Askese oder der Verneinung des Willens zu Leben.« (WWV:517) Im Geschlechtstrieb ist der Wille zum Leben in besonderem Maße zum Ausdruck gekommen, weil es hier nicht nur um das Individuum geht, sondern auch um dessen Nachkommen, mithin um das Bestehen der Gattung. So ist der erste asketische Schritt, die freiwillig Keuschheit, nicht nur eine Verneinung des Willens zum Leben auf individueller Basis, sondern auf Gattungsebene. Die Askese zeigt sich dann in ›freiwilliger und absichtlicher‹ Armut; sie entsteht nicht, weil der Reichtum weggegeben wird, um das Leid anderer zu mildern, sondern um ihrer selbst; sie ist sich Zweck an sich (WWV:518). Diese beiden Schritte der Askese findet Schopenhauer sowohl bei christlichen Heiligen als auch bei den Heiligen, wie sie in den Werken der Sanskritsprache geschildert werden (WWV:518ff). »In der Ethik der Hindus […] auf das mannigfaltigste und kräftigste ausgesprochen finden in den Veden, Puranas, Dichterwerken, Mythe, Legenden ihrer Hei- S e i t e |101 ligen, Denksprüche und Lebensregeln, sehn wir vorgeschrieben: Liebe des Nächsten mit völliger Verleugnung aller Selbstliebe; die Liebe überhaupt nicht auf das Menschengeschlecht beschränkt, sondern alles Lebende umfassend; Wohltätigkeit bis zum Weggeben des täglich sauer Erworbenen; grenzlose Geduld gegen alle Beleidiger; Vergeltung alles Bösen, so arg es auch sein mag, mit Gutem und Liebe; freiwillige und freudige Erduldung jeder Schmach; Enthaltung aller tierischen Nahrung; völlig Keuschheit und Entsagung aller Wollust für den, welcher eigentliche Heiligkeit anstrebt; Wegwerfung alles Eigentums, Verlassung jedes Wohnorts, aller Angehörigen, tiefe gänzliche Einsamkeit, zugebracht in stillschweigender Betrachtung, mit freiwilliger Buße und schrecklicher, langsamer Selbstpeinigung zur gänzlichen Mortifikation des Willens, welche zuletzt bis zum freiwilligen Tode geht durch Hunger, auch durch Entgegengehen den Krokodilen, durch Herabstürzen vom geheiligten Felsengipfel des Himalaja, durch lebendig Begrabenwerden […].« (WWV:527) Eine ähnliche Liste von asketischen Selbstkasteiungen schlägt Schopenhauer implizit den gegenwärtigen Willens-Verneinern vor, wobei Schopenhauer den Selbstmord explizit ausnimmt. Schopenhauer empfiehlt niemandem, einem Krokodil entgegenzuwaten und derart den sicheren Tod findet. Für Schopenhauer ist der Selbstmord »ein Phänomen starker Bejahung des Willens« (WWV:541). Die Verneinung des Willens »hat ihr Wesen nicht darin, daß man die Leiden, sondern daß man die Genüssen des Lebens verabscheut« (WWV:541). Daher ist der aus Askese gewählte Hungertod für Schopenhauer durchaus in Ordnung (WWV:544). Der Preis dafür, so Schopenhauer, sind unerschütterlicher Friede, tiefe Ruhe und innige Heiterkeit. »[D]er, in welchem die Verneinung des Willens zum Leben aufgegangen ist, so arm, freudlos und voll Entbehrung sein Zustand von außen gesehn auch ist, [ist] voll innerer Freudigkeit und wahrer Himmelsruhe. Es ist nicht mehr der unruhige Lebensdrang, die jubelnde Freude, welche heftiges Leiden zur vorhergegangenen oder nachfolgenden Bedingung hat […]; sondern es ist ein unerschütterlicher Friede, eine tiefe Ruhe und innige Heiterkeit, ein Zustand, zu dem wir, wenn er uns vor die Augen oder die Einbildungskraft gebracht wird, nicht ohne die größte Sehnsucht blicken können […].« (WWV:530) »Wahres Heil, Erlösung vom Leben und Leiden ist ohne gänzliche Verneinung des Willens nicht zu denken. Bis dahin ist jeder nichts anderes als dieser Wille selbst […].« (WWV:540) Es gibt drei Lebensstrategien, die zum Heil führen: (i) die von strenger Askese begleitete mystische Versenkung, (ii) die philosophische Kontemplation und S e i t e |102 (iii) die Begegnung mit dem Schönen und Erhabenen in Kunst und Natur; die Askese preist Schopenhauer aber am höchsten (s. Birnbacher 2009:108). Schopenhauer schließt Die Welt und Wille als Vorstellung mit den Worten: »Wir bekennen es vielmehr frei: was nach gänzlicher Aufhebung der Willens übrigbleibt, ist für alle die, welche noch des Willens voll sind, allerdings nicht. Aber auch umgekehrt ist denen, in welchen der Wille sich gewendet und verneint hat, diese unsere so sehr reale Welt mit allen ihren Sonnen und Milchstraßen – nichts.« (WWV:558) Safranski (2010:352) hält mit spitzer Feder gegen Schopenhauer fest, dass dieser bei der ›Verneinungsekstase‹, der die letzten Paragrafen der WWV gewidmet sind, Zaungast bleibt. Schopenhauer ist weder Heiliger noch Asket, der Umgang mit schönen Frauen, das gemütliche, sukkulente Essen und auch Geiz sind ihm durchaus eigen. »Leben ›als ob‹ und Verneinen ›als ob‹: In dieser Balance hält sich der ganz unasketische, ganz unheilige Schopenhauer. Bevor der gefräßige Arthur sein opulentes Mittagsmahl im Gasthaus verzehrt, spielt er eine Stunde lang auf der Flöte: die ›Himmelsmusik‹ Rossinis. Das ›bessere Bewußtsein‹ Schopenhauers kennt nur die befristete Ekstase. Die Heiligkeit oder andere Dauerekstasen hält er sich vom Leibe.« (Safranski 2010:353) *** Birnbacher (2009:104) stellt die Frage, ob man Schopenhauers pessimistische Diagnose der aufs äußerte begrenzten Glücksmomente zustimmen kann. Wenngleich sich einige psychologische Momente in Schopenhauers Analysen durchaus aus der Sicht der modernen Psychologie und Soziologie bestätigen lassen, ist Schopenhauers durchweg negative Bewertung des unerfüllten Wollens ›fragwürdig‹. Dem sei entgegenzuhalten: »[Schopenhauer] scheint vorauszusetzen, dass nicht nur unsere Wünsche, sondern auch unsere Strebungen so weit über die real verfügbaren Befriedigungsmöglichkeiten hinausschießen, dass sie überwiegend enttäuscht werden. Die meisten Menschen leiden aber weniger an der Unerfülltheit oder Unerfüllbarkeit ihrer Wünsche als an den vergeblichen Versuchen, ihre zur Verwirklichung ausgewählten Wünsche aktiv zu realisieren. […] Außerdem ist es keinem zu wünschen, dass allzu viele oder sämtliche seiner Wünsche erfüllt werden: Ein Horizont der Unerfülltheit scheint eine wesentliche Voraussetzung des Glücks zu sein. […] Es gibt auch ›selige Sehnsucht‹.« (Birnbacher 2009:105) S e i t e |103 Ob man dieser Gegendiagnose nun zustimmen mag oder nicht – fest steht, dass nicht jeder Zustand der Unbefriedigtheit als Leid gelten kann. Es gilt auch nicht die Vorfreude vor der Erfüllung eines Wunsches außer Acht zu lassen. Schopenhauers Alternative zum Leiden ist allerdings mehr als nur zweifelhaft. Der Quietiv des Wollens zielt auf die Schwächung, ja auf die Abtötung der Leidenschaften und der mit ihnen einhergehenden Wünsche und Strebungen – und das widerspricht wohl der Grundidee, die wir von unseren Mitmenschen haben. »Was Schopenhauer pompös ›Willensverneinung‹ nennt, ist bei Licht besehen keineswegs eine Schwächung oder Abtötung sämtlicher Formen des ›Willens‹ – also aller emotional getönten psychischen Phänomene. Sie richtet sich vielmehr auf die heftigen, mit Unruhe und Erregtheit einhergehenden Strebungen und Zustände, die Leidenschaften und Affekte. ›Willensverneinung‹ ist bei Schopenhauer insofern das Pendant zu Epikurs Ataraxie, dem Zustand, in dem die Seele nicht mehr durch heftige Affekte und Begierden erschüttert wird, und nicht das Gegenstück zur Apathie der Stoiker, dem Zustand völligen Verschwindens von Befühlen und gefühlsgetönten Befindlichkeiten.« (Birnbacher 2009:106) Schopenhauer ist also nicht immer wörtlich zu nehmen; er wettert im Grund gegen die mit heftiger Erregtheit verbundenen Affekte, die durch ruhigere Gestimmtheiten abgelöst werden sollen (s. Birnbacher 2009:107). Schopenhauer dürfte nicht für eine Zustand der Abstumpfung und Unlebendigkeit, sondern für Gelassenheit plädieren. »Die pessimistische Beurteilung der menschlichen Existenz und der Existenz im ganzen steht im Dienst des Denkens, das dort, wo es dem Pessimismus Raum gibt, schon umgeschlagen ist in das Bewußtsein der Erfüllung, die sich von dem Leben, das durch den Pessimismus kritisiert und in Frage gestellt wird, nicht mehr versteht, sondern nur noch in der Abwendung von ihm vollziehen läßt. Pessimismus ist die Haltung, die der Weltentsagende gegenüber der Welt einnimmt. Die Negativität dieser Haltung ist daher nicht mehr ihr primäres Kennzeichen; was sie freilich positiv ausmacht, entzieht sich der Kenntnis der noch Weltzugewandten. Ihre Chance besteht nach Schopenhauer allein darin, so zu werden wie der, dem die Weltzugehörigkeit bloß noch Gegenstand der Kritik ist.«(Malter 1988:115) Individueller Charakter und kolossaler Egoismus Im Jahr 1837 nimmt sich Schopenhauer des Problems der Freiheit an. 1837 stößt er auf die in der Hallischen Literaturzeitung ausgeschriebene Preisfrage S e i t e |104 der Königlich-Norwegischen Gesellschaft der Wissenschaft zur Drontheim, die lautet: ›Lässt sich die Freiheit des menschlichen Willens aus dem Selbstbewusstsein beweisen?‹ Bevor Schopenhauer noch seine Schrift fertig gestellt hat, erfährt er von einem weiteren Ausschreiben; die Königlich Dänische Societät der Wissenschaft will wissen: ›Ist die Quelle der Grundlage der Moral in einer unmittelbar im Bewusstsein (oder Gewissen) liegenden Idee der Moralität und ihrer Analyse zu suchen?‹ Schopenhauer arbeitet fleißig und schickt die erste Schrift Ende 1838 ab; er erhält im Jänner 1839 den ersten Preis, worüber er sich ›wie ein Kind‹ freut. Die Antwort auf die zweite Preisfrage schickt er im Frühsommer 1839 ab, siegessicher; doch diese Schrift wird nicht mit einem Preis gekrönt, obgleich sie die einzig Schrift ist, die auf das Ausschreiben hin eingegangen ist. Der empörte Schopenhauer lässt die beiden Abhandlungen unter dem Gesamttitel Die beiden Grundprobleme der Ethik, behandelt in zwei Akademischen Preisschriften 1841 bei einer kleinen Frankfurter Verlagsbuchhandlung erscheinen – und vergisst dabei weder zu erwähnen, dass die erste Preisschrift Über die Freiheit des Willens gekrönt ist, noch, dass die zweite Preisschrift Über die Grundlage der Moral nicht gekrönt ist (s. Safranski 2010:465ff). Beide Schriften gelten als ›Ergänzungsschriften‹ (s. Malter 1988:116) zu Die Welt als Wille und Vorstellung – Schopenhauer entwickelt hier nicht einen neuen Ansatz der Freiheitsproblematik und der Ethik, sondern führt seine Gedanken systematisch unter dem Gesichtspunkt der leitenden Fragestellung zusammen. Beide Schriften setzen die Kenntnis des Hauptwerks voraus und zeichnen die Hauptthesen getreu nach. Man ist nicht erstaunt, wenn Schopenhauer das Selbstbewusstsein als die Erkenntnis seiner selbst als Wollenden definiert (GE:529), wenn er die Gerichtetheit des Willens auf äußere Gegenstände hervorhebt und dies als Motiv auffasst (GE:531) – das Motiv ist seit der Dissertation von 1813 die Ausprägung der ersten Wurzel des Satzes vom zureichenden Grund, der Kausalität, auf der Ebene des Menschen. Auch der Primat des Affekts vor der Vernunft, i.e. die Vorgängigkeit des Willens vor dem Selbstbewusstsein (GE:532ff), ist nichts Neues und soll daher nicht weiter behandelt werden. Ich werde aus den beiden Preisschriften zwei besondere Glanzstücke herausgreifen, Schopenhauers Diskussion des Charakters aus der ersten und die Mitleidsethik aus der zweiten Preisschrift, und füge dem an, dass sich beides in Die Welt und Wille als Vorstellung nachlesen lässt. *** Aus der ersten Preisschrift mit dem Titel Über die Freiheit des Willens wähle ich die Thematik ›Motive und Charakter‹ als das ›Gustostückerl‹ aus, auf das ich einzig näher eingehe. S e i t e |105 Die Motivation ist die Form der Kausalität, die durch das Medium der Erkenntnis hindurchgeht (GE:567). Aber die Ursachen bestimmen »nichts weiter als das Wann und Wo der Äußerung ursprünglicher unerklärlicher Kräfte« (GE:567) – und die ursprüngliche, nicht weiter zu erklärende Kraft beim Menschen ist der Wille. Dieser, so betont Schopenhauer auch hier, ist dem Individuum nicht nur von außen, sondern auch von innen bekannt (man erinnere sich an die Dissertation von 1813, wo Schopenhauer den Begriff der ›Kausalität von innen‹ eingeführt hat, ebenso die ›qualitates occultae‹). Der Wille ist bei jedem Menschen unterschiedlich objektiviert. Aus dieser ›speziell und individuell bestimmten Beschaffenheit des Willens‹ (GE:568) resultiert, dass die Reaktionen der Individuen auf dieselben Motive unterschiedlich sind. Die individuelle Beschaffenheit des Willens und die unterschiedlichen Reaktionen nennt Schopenhauer den Charakter bzw. den ›empirischen Charakter‹ (GE:568). »Durch [den empirischen Charakter] ist zunächst die Wirkungsart der verschiedenartigen Motive auf den gegebenen Menschen bestimmt. Denn er liegt allen Wirkungen, welche die Motive hervorrufen, so zum Grunde wie die allgemeinen Naturkräfte den durch Ursachen im engsten Sinn hervorgerufenen Wirkungen und die Lebenskräfte den Wirkungen der Reize. Und wie die Naturkräfte, so ist auch er ursprünglich, unveränderlich, unerklärlich.« (GE:568) Der Charakter zeichnet sich durch folgende Merkmale aus (GE:568ff): Er ist (i) individuell, (ii) empirisch, (iii) konstant und (iv) angeboren. Die Individualität des Charakters ist aufgrund der obigen Bestimmungen selbstverständlich. Was die Empirie des Charakters betrifft, hält Schopenhauer interessanter Weise fest, dass man nicht nur den Charakter der anderen durch Erfahrung kennen lernen muss, sondern auch den eigenen. Man muss sich und die anderen kennen lernen, was bedeutet, dass man im Vorhinein nicht mit Bestimmtheit zu sagen vermag, wie ein anderer oder man selbst handeln wird (auch ein Gedanke, der auf Sartres Existenzialismus vorausweist). »Daher […] kann keiner wissen, wie ein anderer, und auch nicht, wie er selbst in irgendeiner bestimmten Lage handeln wird, ehe er darin gewesen: nur nach bestandener Probe ist er des andern und erst dann auch seiner selbst gewiß. Dann aber ist er es: erprobte Freunde, geprüfte Diener sind sicher. […] Wer einmal etwas getan, wird es vorkommendenfalls wieder tun, im Guten wie im Bösen. […] Gleichermaßen erwächst erst aus der Erfahrung, und wenn die Gelegenheit kommt, die Bekanntschaft mit uns selbst […].« (GE:569) Wenn man sich in vielen Lebenslagen als so und so handelnd erlebt, dann erhält der eigene Charakter die Eigenschaft der Erworbenheit. Das Individuum S e i t e |106 mit einem ›erworbenen Charakter‹ kennt seine Handlungen dann fast im Vorhinein, unabhängig davon, ob der jeweilige Handlungsstil gut oder böse ist (GE:570). Aus dem erworbenen Charakter folgt unmittelbar dessen Konstanz; der Mensch ist charakterlich fixiert ›wie ein Krebs in seiner Schale‹ – der »Mensch ändert sich nie« (GE:570). Daher kann man sich auf den erprobten Freund ja verlassen, denn dieser ändert sich nicht. Muss man allerdings die (suboptimale) Erfahrung machen, dass sich eine Person, deren Charakter man sehr gut zu kennen vermeinte, anders verhält, als man von ihr annahm, dann neigt man laut Schopenhauer nicht zum Gedanken, dass sich diese Person geändert hat, sondern man wird vielmehr konstatieren, dass man diese Person falsch eingeschätzt hat (GE:571) – womit die Konstanz des Charakters einer Person zu unseren lebensweltlichen Grundüberzeugungen gehört. Dennoch gesteht Schopenhauer dem konstanten Charakter ein wenig Plastizität zu, dann nämlich, wenn es um Erziehung geht. Die Plastizität bzw. Formbarkeit ergibt sich aus der Intellektualität der Motive. »Der Charakter ist unveränderlich, die Motive wirken mit Notwendigkeit: aber sie haben durch die Erkenntnis hindurchzugehn, als welche das Medium der Motive ist. Diese aber ist der mannigfaltigsten Erweiterung, der immerwährenden Berichtigung in unzähligen Graden fähig: dahin arbeitet alle Erziehung. Die Ausbildung der Vernunft durch Kenntnisse und Einsichten jeder Art ist dadurch moralisch wichtig, daß sie Motiven, für welche ohne sie der Mensch verschlossen bliebe, den Zugang öffnet. Solange er diese nicht verstehen konnte, waren sie für seinen Willen nicht vorhanden.« (GE:572) Die moralische Einwirkung erstreckt sich nicht weiter als auf die Berichtigung der Erkenntnis; Charakterfehler der Menschen lassen sich durch ›Reden und Moralisieren‹ nie und nimmer verbessern (GE:573). Dennoch, Schopenhauer räumt relativ viel Elastizität des ach so konstanten Charakters ein, wobei er diese vornehmlich bei Leuten mit guter Bildung realisiert sieht. Beides, die Anwendung der Tugendlehre des Aristoteles mit der Verbindung des Bildungsgedanken, der im 19. Jahrhundert mehr und mehr zu dominieren beginnt, ist beachtlich pointiert. Aus diesen Überlegungen folgt die letzte Bestimmung wie von selbst – oder umgekehrt, die vierte Bestimmung, dass der Charakter angeboren ist, stellt eigentlich die Grundlage für die drei anderen Bestimmungen dar. »Daher legen bei der allergleichesten Erziehung und Umgebung zwei Kinder den grundverschiedensten Charakter auf deutlichste an den Tag: es ist derselbe, den sie als Greise tragen werden. Er ist sogar, in seinen Grundzügen, erblich, aber nur vom Vater, die Intelligenz hingegen von der Mutter […].« (GE:573) S e i t e |107 Die Bestimmungen des empirischen Charakters, wie Schopenhauer sie vornimmt, führen natürlich dorthin, dass es die Willensfreiheit nicht gibt. Tugenden und Laster sind angeboren: Der Mensch wird sich in einer bestimmten Situation nicht aufgrund der postulierten Willensfreiheit verhalten, sondern aufgrund determinierter Prozesse, die in der Wechselwirkung von Motiven und Charakter ablaufen. »Woraus hingegen unter der Annahme der Willensfreiheit Tugend und Laster oder überhaupt die Tatsache, daß zwei gleich erzogene Menschen unter völlig gleichen Umständen und Anlässen ganz verschieden, ja entgegengesetzt handeln, eigentlich entspringen soll, ist schlechterdings nicht abzusehn. Die tatsächliche, ursprüngliche Grundverschiedenheit der Charaktere ist unvereinbar mit der Annahme einer solchen Willensfreiheit, die darin besteht, daß jedem Menschen in jeder Lage entgegengesetzte Handlungen gleich möglich sein soll.«(GE:575) Für Schopenhauer gibt es die Willensfreiheit, das ›liberum arbitrium indifferentiae‹, nicht; jede Tat eines Menschen ist »das notwendige Produkt seines Charakters und des eingetretenen Motivs« (GE:577). »Die Willensfreiheit bedeutet, genau betrachtet, eine existentia ohne essentia; welches heißt, daß etwas sei und dabei doch nichts sei, welches wiederum heißt, nicht sei, also ein Widerspruch ist.« (GE:579) Widerspruch hin oder her: Es wird ein Kennzeichen der Existenzphilosophie des 20. Jahrhunderts sein, das Wesen des Menschen in der Existenz zu sehen und ohne eine Essenz auszukommen; die Existenz wird zur Essenz des Menschen. Dabei ist es nicht nötig, allzu viele Verschiebungen in Schopenhauers Argumentationslogik vorzunehmen; man streiche den Willen als die Essenz der Welt, i.e. das allen Erscheinungen zugrundeliegende Was weg und interpretiere den folgenden Satz vor der entstehenden Essenz-losigkeit: »Durch das, was wir tun, erfahren wir bloß, was wir sind.« (GE:581) In diesem Zitat ist nur das ›bloß‹ zu streichen und das ›was wir sind‹ durch ein ›wer wir sind‹ zu ersetzen, und Schopenhauer hat die Grundformel für Heidegger und Sartre ausgesprochen – aber das ist eine andere Geschichte ☺. *** Aus der zweiten Preisschrift mit dem Titel Über die Grundlage der Moral wende ich mich der Frage des kolossalen Egoismus und der Mitleidsethik zu. Bezüglich der Ethik besteht zwischen Schopenhauer und dem ›erstaunlichen‹ Kant ein fundamentaler Unterschied, für dessen Grundlegung der Ethik Schopenhauer nur Kritik übrig hat (GE:655ff). Schopenhauer entdeckt im kategorischen Imperativ eine Gehorsamkeitsaufforderung, i.e. das implizite Motto dem S e i t e |108 Gesetz zu gehorchen, was immer es auch besagt (GE:662); und das geht Schopenhauer gegen den Strich. Übrigens hat auch Günther Anders im kategorischen Imperativ die Grundlage für die Befehlserfüllung im Dritten Reich gesehen – hier wohl in Kenntnis von Schopenhauers Kant-Kritik. Schopenhauer schlägt folgenden Weg vor, um das Fundament der Ethik zu finden: »Daher bleibt zur Auffindung des Fundaments der Ethik kein anderer Weg als der empirische, nämlich zu untersuchen, ob es überhaupt Handlungen gibt, denen wir echten moralischen Wert zuerkennen müssen – welches die Handlungen freiwilliger Gerechtigkeit, reiner Menschenliebe und wirklichen Edelmuts sein werden.« (GE:726) Gegen Kant und gegen die von ihm verhassten deutschen Idealisten formuliert Schopenhauer das Programm einer empirischen Ethikbegründung. Die Bedeutung des empirischen Nach-vollziehens aller Grundsätze, die er in Die Welt und Wille und Vorstellung ausgesprochen hat, findet sich auch hier – der eine Gedanke trägt noch. Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Dingfestmachung der Grundtriebfeder ›im Menschen wie im Tiere‹ – und das ist der Egoismus (GE:727). Alle Handlungen entspringen ›in der Regel‹ aus Egoismus. Diese Grundtriebfeder ist naturgemäß ›antimoralisch‹; nicht auf ihr, sondern sie überwindend wird Schopenhauer seine Ethik fundieren. »Der Egoismus also ist die erste und hauptsächlichste, wiewohl nicht die einzige Macht, welche die moralische Triebfeder zu bekämpfen hat.«(GE:730) Der Egoismus ist durch zwei Charakteristika ausgezeichnet; er ist grenzenlos und kolossal. »Der Egoismus ist seiner Natur nach grenzenlos: der Mensch will unbedingt sein Dasein erhalten, will es von Schmerzen […] unbedingt frei, will die größtmögliche Summe von Wohlsein und will jeden Genuß, zu dem er fähig ist, ja such wo möglich noch neue Fähigkeiten zum Genusse in sich zu entwickeln. Alles, was sich dem Streben seines Egoismus entgegenstellt, erregt seinen Unwillen, Zorn, Haß: er wird es als seinen Feind zu vernichten suchen.« (GE:727) Der Egoismus ist kolossal: er überragt die Welt. Denn wenn jedem einzelnen die Wahl gegeben würde zwischen seiner eigenen und der übrigen Welt Vernichtung; so brauche ich nicht zu sagen wohin sie bei den allermeisten ausschlagen würde. Demgemäß macht jeder sich zum Mittelpunkte der Welt, bezieht alles auf sich […]. Keinen größeren Kontrast gibt es als den zwischen dem hohen und exklusiven Anteil, den jeder an seinem eigenen Selbst nimmt, und der Gleichgül- S e i t e |109 tigkeit, mit der in der Regel alle andern eben jenes Selbst betrachten; wie er ihres.« (GE:728) Das beste Zeichen für ein ›schlechtes Herz‹ und ›tiefe moralische Nichtswürdigkeit‹ sieht Schopenhauer in der ›reinen, herzlichen‹ Schadenfreude (GE: 731). Sie geht weiter über das Übelwollen geringeren Grades und auch über den Neid hinaus und ist die theoretische Grausamkeit, während Grausamkeit die praktische Schadenfreude ist (GE:732). Angesichts dieser Grundtriebfeder – wie ist es denkmöglich, dass es ›wahrhaft ehrliche Leute‹ gibt? Z.B. Leute, die helfen, ohne sich davon etwas zu erwarten – was Schopenhauer als Handlungen mit moralischem Wert bezeichnet (GE:735). »Die Abwesenheit aller egoistischen Motivation ist also das Kriterium einer Handlung von moralischem Wert.« (GE:736) Wenn jede Handlung moralisch gut sein soll, dann muss sie vom eigenen ›Wohl und Wehe‹ absehen und das ›Wohl und Wehe‹ eines anderen bezwecken; der andere wird damit zum letzten Zweck meiner Handlung. Man will das Wohl des anderen so unmittelbar wie das eigene. Das setzt naturgemäß Mitleid voraus. »Dies erfordert aber, daß ich auf irgendeine Weise mit ihm identifiziert sei, d.h. daß jener gänzliche Unterschied zwischen mir und jedem andern, auf welchem gerade mein Egoismus beruht, wenigstens in einem gewissen Grade aufgehoben sei. […] Dieses Mitleid ganz allein ist die wirkliche Basis aller freien Gerechtigkeit und aller echten Menschenliebe. Nur sofern eine Handlung aus ihm entsprungen ist, hat sie moralischen Wert.« (GE:740) Doch wie kann man in der Welt, die dem Satz vom zureichenden Grunde und damit dem principium individuationis unterworfen ist, mit dem anderen mitleiden im Sinne eines unmittelbaren Fühlens von dessen Schmerzen? Schopenhauer bezeichnet die Möglichkeit des Mitleides daher als ›mysteriös‹, ja als das ›Mysterium der Ethik‹, als ihr ›Urphänomen und Grenzstein‹ (GE:741). Wie lässt sich die ›Scheidewand‹ zwischen den Individuen aufheben, wie wird das Nicht-Ich zum Ich? »Dies […] setzt voraus, daß ich mit dem andern gewissermaßen identifiziert habe und folglich die Schranke zwischen Ich und Nicht-Ich für den Augenblick aufgehoben sei; nur dann wir die Angelegenheit des andern, sein Bedürfnis, seine Not, sein Leiden unmittelbar zum meinigen; dann erblicke ich ihn nicht mehr, wie ihn doch die empirische Anschauung gibt, als ein mir Fremdes, mir Gleichgültiges, von mir gänzlich Verschiedenes; sondern in ihm leide ich mit, trotzdem daß seine Haut meine Nerven nicht einschließen.« (GE:763) S e i t e |110 Ein mysteriöser Vorgang, der allerdings aus Die Welt als Wille und Vorstellung bereits bekannt ist. Der tugendhafte Mensch, der Menschenlieber bzw. der Mitleid-volle, blickt hinter den Vorhang der Maja; er erkennt, dass in allen Individuen derselbe Wille steckt. Bezüglich des mitleidenden Charakters stellt Schopenhauer fest: »Gehen wir aber auf das Wesentliche eines solchen Charakters zurück; so finden wir es unleugbar darin, daß er weniger als die übrigen einen Unterschied zwischen sich und andern macht. Dieser Unterschied ist in den Augen des boshaften Charakters so groß, daß ihm fremdes Leid unmittelbar Genuß ist, den er deshalb ohne weitern eigenen Vorteil, ja selbst diesem entgegen sucht. Derselbe Unterschied ist in den Augen des Egoisten noch groß genug, damit er, um einen kleinen Vorteil für sich zu erlangen, großen Schaden anderer als Mittel gebrauche.« (GE:803) Wobei anzumerken ist, dass Schopenhauer drei Grundtriebfedern des Handelns kennt, eben (i) Egoismus, (ii) Bosheit und (iii) Mitleid (GE:742). In der Selbsterkenntnis erkennt sich das Individuum als wollend, und ihm geht darin auf, dass es derselbe Wille ist, der die ganze Welt durchwaltet und damit auch den anderen. Die Unterschiede zwischen den Individuen wird nichtig, auch übrigens der Unterschied zwischen Tier und Mensch – der mitleidige Charakter quält nie und nimmer Tiere. »Mein wahres inneres Wesen existiert in jedem Lebenden so unmittelbar, wie es in meinem Selbstbewußtsein sich nur mir selber kundgibt.« (GE:809) Schopenhauer identifiziert das Mysterium der ethischen Grundlegung als ›praktische Mystik‹ und notiert: »Denn daß einer auch nur ein Almosen gebe, ohne dabei auf die entfernteste Weise etwas anderes zu bezwecken, als daß der Mangel, welcher den andern drückt, gemindert werde, ist nur möglich, sofern er erkennt, daß er selbst es ist, was ihm jetzt unter jener traurigen Gestalt erscheint, also daß er sein eigenes Wesen an sich in der fremden Erscheinung wiedererkenne.« (GE:811) Die Grundlagen der Ethik liegen in der Überwindung der je eigenen Individualität; nur wenn man unmittelbar das Wohl des anderen will, ohne dabei sein eigenes Wohl mitzuwollen, handelt man ethisch gut. Für Schopenhauer stellt sich diese Begründung wie die Kantische Frage nach der Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis dar – denn dass es gute Handlung gibt, steht für Schopenhauer von Anfang an fest; nur wie es gute Handlungen geben kann, ist von Interesse. Gute Handlungen gibt es, weil der Mensch das principium individuationis überwinden kann, weil er immer schon die Kausalität von innen kennt, S e i t e |111 weil er in seinem Leib unmittelbar den Willen erfährt, weil er hinter den Schleier der Maja blicken kann. »Gehört demnach Vielheit und Geschiedenheit allein der bloßen Erscheinung an und ist es ein und dasselbe Wesen, welches in allem Lebenden sich darstellt; so ist diejenige Auffassung, welche den Unterschied zwischen Ich und Nicht-Ich aufhebt, nicht die irrige: vielmehr muß die ihr entgegengesetzte dies sein. Auch finden wir diese letztere von den Hindus mit dem Namen Maja, d.h. Schein, Täuschung, Gaukelbild, bezeichnet.« (GE:808) *** Ein letztes Zitat zum Abschluss »Je heftiger der Wille, desto greller die Erscheinung seines Widerstreites: desto größer also das Leiden. Eine Welt, welche die Erscheinung eines ungleich heftigeren Willens zum Leben wäre als die gegenwärtige, würde um soviel größere Leiden aufweisen: sie wäre also eine Hölle.« (WWV:537) Versprechen: Ich plane, eine sechste Vorlesung zu schreiben, die sich mit dem Verhältnis von Schopenhauer und Freud auseinandersetzt. Dieses Vorhaben möchte ich bis Mitte Februar 2012 realisiert haben. Ich freue mich über jedeN LeserIn. S e i t e |112 Literaturverzeichnis Siglenverzeichnis VW = »Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde« = Schopenhauer (1986a) WWV = »Die Welt als Wille und Vorstellung« = Schopenhauer (1986b) GE = »Die beiden Grundprobleme in der Ethik = Schopenhauer (1986c) Bücher Abendroth, Walter (2007). Arthur Schopenhauer. (21. Auflage) Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. Adorno, Theodor W. (1990). Negative Dialektik (6. Aufl.). Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Birnbacher, Dieter (2009). Schopenhauer. Stuttgart: Reclam. Cassirer, Ernst (1923). Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchung über die Grundfragen der Erkenntniskritik. Berlin: Verlag Bruno Cassirer. Coreth, Emerich & Schöndorf, Harald (1983). Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts. Stuttgart: Kohlhammer. Freud, Simund (1987). Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse. In ders., Darstellungen der Psychoanalyse (130-138). Frankfurt a.M.: Fischer. Freud, Sigmund (1999). Selbstdarstellung. In ders., Gesammelte Werke. Vierzehnter Band: Werke aus den Jahren 1925–1931 (31-97). Frankfurt a.M.: Fischer. Hume, David (1990). Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand [An Enquiry Concerning Human Understanding]. Stuttgart: Reclam. Janik, Allan, & Toulmin, Stephen (1989). Wittgensteins Wien. (2. Auflage) München: Piper. Kant, Immanuel (1988a). Kritik der reinen Vernunft [herausgegeben von Wilhelm Weischedel] (10. Auflage). Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Kant, Immanuel (1988b). Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. In: Schriften zur Metaphysik und Logik 1 [Band V der Werkausgabe in 12 Bänden, hrsg. von Wilhelm Weischedel] (113-264). Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Kant, Immanuel (1989). Kritik der Urteilskraft (10. Auflage) [Werkausgabe in 12 Bänden, herausgegeben von Wilhelm Weischedel]. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Malter, Rudolf (1988). Der eine Gedanke: Hinführung zur Philosophie Arthur Schopenhauers. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Noerr Schmid, Gunzelin (2006). Geschichte der Ethik. Grundwissen Philosophie. Reclam: Leipzig. Platon (1973). Der Staat [deutsch von August Horneffer]. Stuttgart: Kröner. Pongratz, Ludwig J. (1984). Problemgeschichte der Psychologie (2. Aufl.). München: Franke. S e i t e |113 Regenbogen, Arnim & Meyer, Uwe (Hrsg.).(2005). Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Hamburg: Meiner. Safranski, Rüdiger (2010). Schopenhauer und Die wilden Jahre der Philosophie. Eine Biographie. München: Hanser. Sartre, Jean-Paul (1994). Das Sein und das Nichts. [Gesammelte Werke, Philosophische Schriften I, Band 3]. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. Schnädelbach, Herbert (2005). Kant. Leipzig: Reclam. Schopenhauer, Arthur (1986a). Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. In ders., Kleinere Schriften. Sämtliche Werke Band III (7-192). Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Schopenhauer, Arthur (1986b). Die Welt als Wille und Vorstellung. Sämtliche Werke Band I. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Schopenhauer, Arthur (1986c). Die beiden Grundprobleme der Ethik. In ders., Kleinere Schriften. Sämtliche Werke Band III (483-816). Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Spierling, Volker (2003). Schopenhauer-ABC. Leipzig: Reclam. Strauss, Daniёl Francois Melherbe (2005). Paradigmen in Mathematik, Physik und Biologie und ihre philosophischen Wurzeln [ins Deutsche übertragen von M.J. Jandl]. Frankfurt a.M.: Peter Lang. Suhr, Martin (2001). Platon. (2., vollständig überarbeitete Auflage) Frankfurt a.M.: Campus. Weischedel, Wilhelm (1987). Die philosophische Hintertreppe. 34 große Philosophen in Alltag und Denken. (15. Auflage) München: dtv. Wittgenstein (1963). Tractatus logico-philosophicus [erste Auflage]. Frankfurt a.M.: edition suhrkamp. Wittgenstein, Ludwig (1989a). Philosophische Untersuchungen. Werkausgabe in acht Bänden, Band 1 (225-618). (6. Aufl.) Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Wittgenstein, Ludwig (1989b). Das blaue Buch. Werkausgabe in acht Bänden, Band 5. (6. Aufl.) Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Zentner, Marcel (1995). Die Flucht ins Vergessen. Die Anfänge der Psychoanalyse Freuds bei Schopenhauer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Zimmer, Robert (2010). Arthur Schopenhauer. Ein philosophischer Weltbürger. München: dtv. S e i t e |114