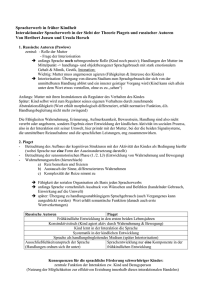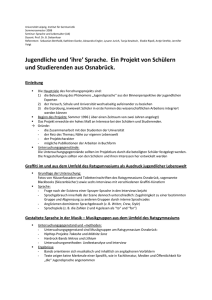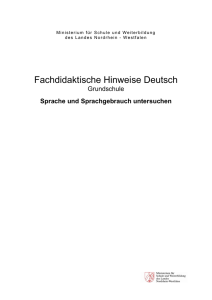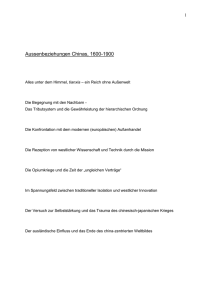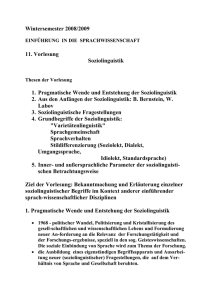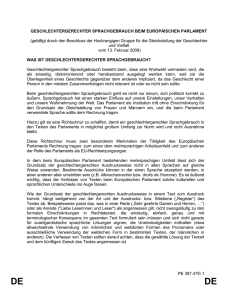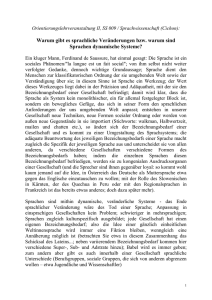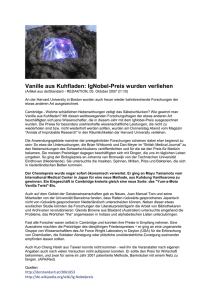Norm und Differenz
Werbung
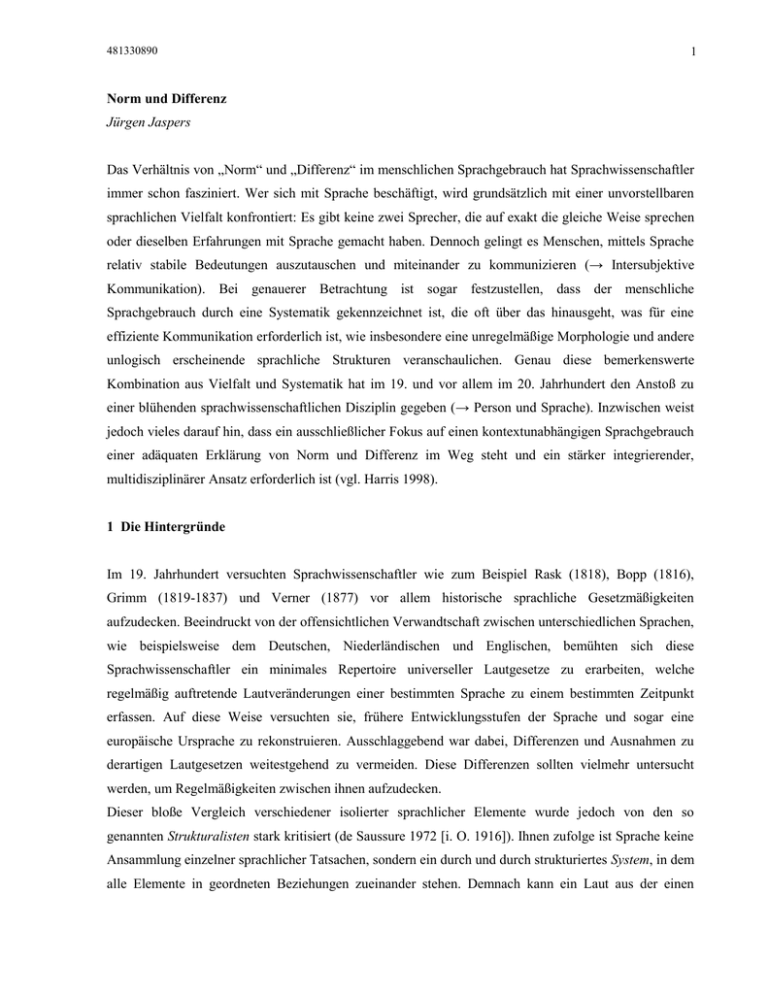
481330890 1 Norm und Differenz Jürgen Jaspers Das Verhältnis von „Norm“ und „Differenz“ im menschlichen Sprachgebrauch hat Sprachwissenschaftler immer schon fasziniert. Wer sich mit Sprache beschäftigt, wird grundsätzlich mit einer unvorstellbaren sprachlichen Vielfalt konfrontiert: Es gibt keine zwei Sprecher, die auf exakt die gleiche Weise sprechen oder dieselben Erfahrungen mit Sprache gemacht haben. Dennoch gelingt es Menschen, mittels Sprache relativ stabile Bedeutungen auszutauschen und miteinander zu kommunizieren (→ Intersubjektive Kommunikation). Bei genauerer Betrachtung ist sogar festzustellen, dass der menschliche Sprachgebrauch durch eine Systematik gekennzeichnet ist, die oft über das hinausgeht, was für eine effiziente Kommunikation erforderlich ist, wie insbesondere eine unregelmäßige Morphologie und andere unlogisch erscheinende sprachliche Strukturen veranschaulichen. Genau diese bemerkenswerte Kombination aus Vielfalt und Systematik hat im 19. und vor allem im 20. Jahrhundert den Anstoß zu einer blühenden sprachwissenschaftlichen Disziplin gegeben (→ Person und Sprache). Inzwischen weist jedoch vieles darauf hin, dass ein ausschließlicher Fokus auf einen kontextunabhängigen Sprachgebrauch einer adäquaten Erklärung von Norm und Differenz im Weg steht und ein stärker integrierender, multidisziplinärer Ansatz erforderlich ist (vgl. Harris 1998). 1 Die Hintergründe Im 19. Jahrhundert versuchten Sprachwissenschaftler wie zum Beispiel Rask (1818), Bopp (1816), Grimm (1819-1837) und Verner (1877) vor allem historische sprachliche Gesetzmäßigkeiten aufzudecken. Beeindruckt von der offensichtlichen Verwandtschaft zwischen unterschiedlichen Sprachen, wie beispielsweise dem Deutschen, Niederländischen und Englischen, bemühten sich diese Sprachwissenschaftler ein minimales Repertoire universeller Lautgesetze zu erarbeiten, welche regelmäßig auftretende Lautveränderungen einer bestimmten Sprache zu einem bestimmten Zeitpunkt erfassen. Auf diese Weise versuchten sie, frühere Entwicklungsstufen der Sprache und sogar eine europäische Ursprache zu rekonstruieren. Ausschlaggebend war dabei, Differenzen und Ausnahmen zu derartigen Lautgesetzen weitestgehend zu vermeiden. Diese Differenzen sollten vielmehr untersucht werden, um Regelmäßigkeiten zwischen ihnen aufzudecken. Dieser bloße Vergleich verschiedener isolierter sprachlicher Elemente wurde jedoch von den so genannten Strukturalisten stark kritisiert (de Saussure 1972 [i. O. 1916]). Ihnen zufolge ist Sprache keine Ansammlung einzelner sprachlicher Tatsachen, sondern ein durch und durch strukturiertes System, in dem alle Elemente in geordneten Beziehungen zueinander stehen. Demnach kann ein Laut aus der einen 481330890 2 Sprache nicht einfach mit einem ähnlichen Laut aus einer anderen Sprache verglichen werden, da die Position dieser beiden Laute im jeweiligen sprachlichen System, in dem sie eine Rolle spielen, nicht zwingend dieselbe ist. Folglich müssen nicht individuelle Lautveränderungen untersucht werden, sondern sprachliche Systeme und Veränderungen zwischen diesen. De Saussure unterscheidet dabei zwischen dem „Sprachsystem“ (langue) und dem individuellen, veränderlichen „Sprachgebrauch“ (parole), welcher ihm zufolge auf dem Sprachsystem basiert. Seiner Auffassung nach sollten sich Sprachwissenschaftler aus diesem Grund vor allem dem Studium der langue widmen, auch wenn sich dieser nur über die Unregelmäßigkeiten der parole angenähert werden kann (→ Sprache und Sprechen). Eine Systematik wurde dabei ausschließlich der Sprache und nicht dem Sprachgebrauch zugesprochen, welcher eine Form menschlichen Handelns darstellt. Diese Art Strukturalismus brachte eine vorübergehende Neuorientierung mit sich: Kontemporäre sprachliche Elemente wurden nicht mehr, wie noch im 19. Jahrhundert, mit älteren Sprachelementen in einen diachronen (den historischen Entwicklungsverlauf betrachtenden) Zusammenhang gestellt, sondern synchron (den zeitgleichen, gegenwärtigen Stand betrachtend) in Beziehung zu anderen zeitgenössischen Elementen derselben Sprache gesetzt. Das heißt, anstelle einer Entstehungsgeschichte wurde eine Art sprachliche Momentaufnahme erstellt. Im Prinzip ist diese jedoch bereits zu dem Zeitpunkt, in dem sie gemacht wird, Vergangenheit. Um dieses Problem zu lösen, abstrahierten die Strukturalisten die tatsächliche Zeit und fixierten die zu untersuchende Sprache für einen kurzen Moment – was ihnen später als Installation eines statischen, undynamischen Sprachkonzeptes vorgeworfen wurde. Chomsky (1965) nahm in seinen Arbeiten zur Generativen Grammatik eine vergleichbare Idealisierung des konkreten sprachlichen Kontextes vor. Er war der Ansicht, dass eine effiziente Beschreibung der sprachlichen Struktur nur ohne den „Rausch“ und die Restriktionen möglich sei, die der konkrete Sprachgebrauch (→ Sprache und Sprechen) in einem spezifischen sozio-kulturellen Kontext mit sich bringt. Darum gründete er seine Untersuchungen auf „ideale Sprecher und Hörer in einer vollständig homogenen Sprachgemeinschaft“ (Chomsky 1965, 3). Heterogenität und Differenz wurden zwar nicht geleugnet, jedoch lediglich als Oberflächenerscheinungen betrachtet, die für die Erklärung der tieferen sprachlichen Systematik irrelevant seien. Auch hier ist Systematik oder Normativität ein sprachinhärentes (und kognitives) Phänomen. Der tatsächliche Sprachgebrauch stellt lediglich eine sekundäre und variable Materialisation des ihm zugrunde liegenden sprachlichen Systems dar. Diese Idealisierung wird jedoch seit den 1960er-Jahren in Disziplinen wie der Soziolinguistik (Labov 1966, 1972), der Sprachsoziologie (Fishman 1972) und der linguistischen Anthropologie (Hymes 1972) stark kritisiert. Man wies darauf hin, dass sprachliche Homogenität weder in einer Sprachgemeinschaft noch innerhalb der individuellen Grammatik existiert. Des Weiteren lässt das Arbeiten mit diesem theoretischen Konstrukt die Systematik des Sprachwandels unbeleuchtet. Durch die Abstraktion von der 481330890 3 wirklichen Zeit kann sprachliche Evolution nicht erklärt werden – es sei denn auf Kosten eines diskontinuierlichen Wechsels von einem zum anderen intern strukturierten System (vgl. Meeuwis & Brisard 1993, 15ff.). In der linguistischen Anthropologie betonte man zudem, dass der Sprachgebrauch immer vom soziokulturellen Kontext durchdrungen ist, in dem er verwendet wird. Um „kompetent“ kommunizieren zu können, genügt nicht allein die (kognitive) Kenntnis des sprachlichen Systems, sondern ist auch eine soziokulturelle, kommunikative Kompetenz sowie die Kenntnis sozialer Verhaltensregeln erforderlich, ohne die syntaktische Regeln nahezu sinnlos sind. Neu und von zentralem Interesse war, dass Labov und andere nachweisen konnten, dass der Sprachgebrauch durch eine strukturierte und nicht durch eine willkürliche Variation gekennzeichnet ist. In seiner Untersuchung (Labov 1966) zum postvokalischen r des New Yorker Englisch (wie in far oder fourth) wurden Verkäufer gefragt, wo sich bestimmte, in der vierten Etage erhältliche Artikel befinden: „Excuse me, where are the women’s shoes?“, worauf der Verkäufer „fourth floor“ antwortete. Es stellte sich heraus, dass Verkäufer in Kaufhäusern mit hohem Prestige das postvokalische r (→ Hören und Sprechen) mit einer hohen Frequenz produzierten, hingegen in Kaufhäusern, die vornehmlich von durchschnittlich verdienenden oder ärmeren Kunden besucht wurden, die Aussprachefrequenz des [r] geringer oder sehr gering war. Des Weiteren zeigte Labov auf, dass Menschen, die gewöhnlich kein postvokalisches r produzieren, dies sehr wohl in Situationen tun, die als formell empfunden werden und sie sich auf diese Weise symbolisch mit einem höheren Prestige oder Status schmücken. Es scheint demnach eine systematische Korrelation zwischen sozialen Variablen (Kaufkraft, Geschlecht) und sprachlichen Variablen (der Realisierung eines bestimmten Lautes) des Sprechers zu bestehen, die zudem dynamische soziolinguistische Muster aufweist: Der Gebrauch bestimmter, mit höheren sozialen Schichten korrelierender Laute durch weniger kaufkräftige Gruppen kann zunehmen, einen Einfluss auf andere Laute ausüben und auf diese Weise sprachliche Veränderungen herbeiführen. Labov konnte durch diese Ergebnisse nachweisen, dass der konkrete Sprachgebrauch (parole), der zuvor lediglich als Oberflächenerscheinung des ihm zugrundeliegenden Sprachsystems (langue) betrachtet wurde, nicht nur strukturiert ist, sondern sogar einen Einfluss auf eben dieses System ausübt. Die „korrelationale Soziolinguistik“ Labovs ist bis heute sehr weit verbreitet. Trotz seines Bestrebens hat sie die synchron und sprachsystematisch ausgerichtete Linguistik jedoch nicht ersetzt. Dennoch stellt sie eine unverkennbare Nische der Forschung dar, innerhalb derer die Untersuchung strukturierter sprachlicher Heterogenität, des Zusammenhanges zwischen Sprache und sozialer Bedeutung und die Frage, wie dieser Zusammenhang (durch die Übernahme prestigereicher Formen) sprachlichen Wandel hervorbringen kann, im Vordergrund stehen. Die Übernahme prestigereicher Formen geschieht jedoch nicht zwangsläufig und manche Gruppen bevorzugen weiterhin den Gebrauch eigener, weniger prestigereicher Formen. Aus diesem Grund wird in der Soziolinguistik zwischen Formen mit „offenem“ 481330890 4 Prestige (von jedem als Form mit hohem Status anerkannt) und Formen mit „verborgenem“ Prestige (innerhalb einer spezifischen, lokal begrenzten Gemeinschaft) unterschieden. Mit anderen Worten: Zur Erklärung von Differenz bezieht man sich in der Regel auf das Konzept der sozialen Norm oder Gruppennorm. 2 Soziale Normen In der korrelationalen Linguistik – sowie in älteren linguistisch-anthropologischen und sprachsoziologischen Studien – werden soziale Normen im Allgemeinen als Konsens einer Sprachgemeinschaft definiert, was als normaler, angemessener oder gewünschter Sprachgebrauch empfunden wird. Die einzelnen Mitglieder solcher Gemeinschaften hegen in der Regel eine gewisse Loyalität gegenüber diesen Gewohnheiten – es sei denn, sie streben nach negativen Sanktionierungen. Je stabiler eine Gemeinschaft, desto stärker ist auch das Festhalten an Gruppennormen (→ Behinderung und Vulnerabilität) und der Wunsch, sich an den gemeinsamen Sprachgebrauch anzupassen, bzw. desto größer ist die Chance, dass bestimmte Formen ein verborgenes Prestige besitzen. In loseren Netzwerken haben exogene Formen mit offenem Prestige eine große Chance auf Übernahme und Verbreitung. Aus dieser Perspektive werden mehrsprachige (→ Interkulturalität und Mehrsprachigkeit) oder multidialektale Gruppen als Gemeinschaften betrachtet, in denen sich individuelle Sprecher an verschiedene Normen in unterschiedlichen Bereichen anpassen und auf diese Weise eine vielfältige kommunikative Kompetenz entwickeln. In westlich geprägten Städten kommen beispielsweise Mitglieder anderssprachiger Minderheiten meistens mit Normen des häuslichen Sprachgebrauchs innerhalb familiärer Kontexte oder während religiöser Aktivitäten in Berührung, während sie sich in der Schule oder am Arbeitsplatz an die Standardsprache anpassen. Veränderungen in diesem stabilen System entstehen, wenn der Wert einer bestimmten Varietät durch externe Faktoren verändert wird und sich innerhalb der mehrsprachigen Gemeinschaft neue Evaluationsmuster entwickeln. So zeigte Gal (1979) in einer ethnographischen Studie, dass die problemlose Koexistenz des Ungarischen und des Deutschen in der österreichischen Oberwart – jede Sprache mit ihrem eigenen lokalen Prestige und ihrer eigenen Funktion – sich unter dem Einfluss der industriellen Entwicklung zu einer diglossischen (zweisprachigen) Situation entwickelte, in der dem Deutschen ein hoher und dem Ungarischen ein niedriger Status zugesprochen wurde, was die Marginalisierung und allmähliche Verdrängung des Ungarischen innerhalb dieser mehrsprachigen Gemeinschaft zur Folge hatte. Viele dieser Erklärungen gestalten sich dennoch als problematisch, weil sie unter anderem von der grundlegenden Annahme ausgehen, dass Gruppen klar voneinander abgegrenzt werden können und ihre jeweiligen Mitglieder mehr oder weniger gleich gestellt sind: Aufgrund ihrer Mitgliedschaft in einer 481330890 5 spezifischen Gruppe produzieren die Mitglieder quasi automatisch und auf gleiche Weise einen Sprachgebrauch, der die Identität dieser Gruppe widerspiegelt bzw. signalisiert; oder aber diese Gewohnheit wurde durch Sozialisierung verinnerlicht. Zusätzlich werden Differenz und Abweichung von der Norm meist als vorübergehende Erscheinungen betrachtet: Auf die Einführung einer sprachlichen Abweichung – wie beispielsweise eine neue Bedeutung eines bereits existierenden Wortes – folgt eine Periode der relativen Unsicherheit über das, was der Norm entspricht, welche jedoch schließlich in einen neuen Konsens und in eine allgemeine Akzeptanz dieses neuen Gebrauchs übergeht (vgl. Milroy 1992) – es sei denn, die Variation wird als symptomatisch für eine andere, bisher unbeachtete Subgruppe innerhalb dieser Sprachgemeinschaft betrachtet, wie dies oft bei der Jugendsprache der Fall ist (vgl. 5). Auf diese Weise schleicht sich jedoch die, in den Arbeiten der Strukturalisten kritisierte Homogenität erneut in soziolinguistische und ethnographische Erklärungen von Norm und Differenz ein. Sprachgemeinschaften werden zwar als heterogen betrachtet, aber ihre verschiedenen Teile als homogene (oder homogen handelnde und denkende) Gruppen, innerhalb derer ein Konsens herrscht oder aber sich ihre Mitglieder auf dem Weg zu einem solchen Konsens befinden. Variation und Konflikt werden vor allem zwischen homogenen Gruppen bemerkt, aber innerhalb dieser Gruppen werden sie regularisiert, idealisiert oder zumindest nicht weiter beachtet (Rampton 1998, 18). Nach Cameron (1995, 15) führten all diese Bemühungen schließlich zu zwei vorherrschenden Erklärungsansätzen für das Verhältnis von Norm und Differenz: 1. Der Sprachgebrauch ist ein Spiegel von Gruppe(n) oder eines sprachlichen Netzwerkes, dem man angehört (aus diesem Grund können Korrelationen zwischen sprachlichen und sozialen Variablen gezogen werden); oder 2. Menschen signalisieren ihre Mitgliedschaft zu einer bestimmten sozialen, geschlechtlichen, ethnischen, religiösen oder altersspezifischen Gruppe durch ihren Sprachgebrauch. Problematisch an diesen beiden Erklärungsansätzen ist, dass der Sprachgebrauch als bloße Reflexion oder Signalisierung bereits bestehender Identitäten betrachtet wird (→ Person und Sprache). So wird Sprachgebrauch im Hinblick auf eine primäre, in diesem Fall soziale Systematik, erneut als sekundär betrachtet. Schwieriger gestaltet sich jedoch die Tatsache, dass diese Erklärungen auf einer deterministischen Auffassung von sozialer Normativität beruhen. Obwohl in soziolinguistischen Arbeiten die theoretischen Prämissen, auf denen die Bezugnahme auf soziale Normen gründet, nie besonders expliziert werden (und sogar versucht wird, einer öffentlichen Interaktion mit soziologischer Theoriebildung konsequent auszuweichen; vgl. Hudson 1996, 4; Williams 1992) sind diese Prämissen zumindest teilweise durch den Sozialfunktionalimus Parsons (1937) inspiriert, der soziale Normen als verinnerlichte Sozialisierungsprozesse betrachtet. Soziale Handlungen und psychologische Profile sind in 481330890 6 dieser Hinsicht isomorph (strukturgleich). Garfinkel et al. (1967) weisen jedoch darauf hin, dass eine solche Auffassung eine Reduzierung der Menschen auf so genannte „judgemental dopes“ bedeutet, das heißt, auf Wesen ohne eigene Rationalität und Reflexivität, welche lediglich ausführen, was sie verinnerlicht haben (vgl. Heritage 1984). Bewusste Variation oder Widerstand sind in diesem Rahmen nur schwer erklärbar, weil diese gerade das Beurteilungsvermögen voraussetzen, welches den Individuen zur Erklärung ihres normativen Verhaltens abgesprochen wird. Die vorangegangenen Ausführungen verdeutlichen, dass eine Erklärung von normativem und variablem Sprachgebrauch trotz der Wichtigkeit der sozialen Bedeutung sprachlicher Phänomene und ihres unverkennbaren Zusammenhanges mit Normativität, nicht ohne eine angemessene Erklärung des normativen menschlichen Verhaltens auskommt. Soziale Phänomene wie Normen können also nicht lediglich als Mittel dienen, um Muster im Sprachgebrauch zu erklären, sondern müssen selbst Gegenstand der Untersuchung sein. Die Frage, woher Normen kommen und wie diese „in“ den Menschen „hineingeraten“ und feste soziale Muster hervorbringen, ist daher keineswegs überflüssig. Eine relativ aktuelle, aber fundamental „poststrukturalistische“ Reorientierung der Annahmen, auf denen wissenschaftliche Untersuchungen beruhen (vgl. Foucault 1970), beschäftigt sich mit exakt denselben Fragen. In Disziplinen wie der Philosophie, Soziologie und Kulturtheorie werden Konzepte wie Normativität und Identitäten, soziale Schicht oder Geschlecht immer häufiger als relativ instabile Konstrukte betrachtet (→ Behinderung und Vulnerabilität), die selbst erst einer Erklärung bedürfen, bevor sie bei der Analyse von anderen Phänomenen eingesetzt werden können. Weniger als der Endpunkt wird Sprache dabei vielmehr als ein Teil dieser Erklärung betrachtet. 3 Eine postmoderne Perspektive Im soziologisch inspirierten Sozialkonstruktivismus (Giddens 1984) wird suggeriert, dass Sprache nicht das Resultat, sondern im Gegenteil, einen Teilaspekt sozialen Handelns darstellt und einen konkreten Einfluss auf die alltägliche soziale Struktur ausübt. Sozial-Konstruktivisten vertreten die Ansicht, dass Menschen keine wehrlosen Opfer für sie unbegreiflicher und unkontrollierbarer Mächte sind, aber ebenso wenig allmächtige Erschaffer ihrer eigenen Umstände darstellen. Genauer gesagt, gestalten Menschen die (ungleiche, sozial-stratifizierte) Gesellschaft in ihren alltäglichen Interaktionen zumindest teilweise je aufs Neue, wobei Sprache dabei ein wesentlicher Baustein ist. Diese Interaktionen finden jedoch nicht im luftleeren Raum statt, sondern sind durch „Routinisierung“ gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass Menschen ein Bedürfnis nach Routine und Vorhersagbarkeit haben und sie sich gegenseitig auch fortlaufend für das Reproduzieren dieser Routinen sowie der persönlichen Identitäten und (Macht)Verhältnisse, die durch diese Routinen gewährleistet werden, verantwortlich machen (vgl. Giddens 1984, 481330890 7 Garfinkel 1967). Variation ist in dieser Hinsicht von elementarer Bedeutung: Jeden Tag, jeden Moment finden neue und kreative sprachliche Handlungen statt, auch wenn diese durch die menschliche Wahrnehmung von dem, was als akzeptables, vorhersehbares Verhalten gilt, geformt werden. So betrachtet sind soziale Normen weder als ein begrenztes Repertoire bereits bestehender Regeln, noch als ein verinnerlichtes, von den Menschen lediglich ausgeführtes Programm zu verstehen, sondern als alltägliche Produkte menschlicher face-to-face-Interaktionen, die in neuen Interaktionen stets bestätigt werden müssen. Als Folge dessen wird die Mitgliedschaft in einer Gruppe nicht mehr als eine feststehende Tatsache oder ein unvermeidbares Erbe betrachtet, sondern als ein Produkt, das fortlaufend im „Hier und Jetzt“ rekonstruiert wird. Weniger als ein bloßer Spiegel oder die Betonung einer bereits bestehenden Gruppenidentität, wird der Sprachgebrauch (→ Sprache und Sprechen) vielmehr als Teil einer komplexen kommunikativen Praxis betrachtet, in der in konkreten Situationen bestimmte Gruppenidentitäten mit unterschiedlicher Kaufkraft und Zugangsberechtigung hervorgerufen, vermieden oder erneut konfiguriert werden und innerhalb derer die Sprecher Co-Partizipierende in Diskursen darstellen, durch die ihnen in den Gesellschaften, in denen Grenzen und Möglichkeiten ungleich verteilt sind (Rampton 1998, 12), schließlich unterschiedliche Positionen zugewiesen werden. Eine solche Auffassung menschlichen Verhaltens verdeutlicht, dass ein Konsens das Ergebnis menschlicher Interaktion darstellt, die nicht für jeden Teilnehmer gleichermaßen vorteilhaft ist. Wenn menschliche Interaktion zwischen ungleich gestellten Teilnehmern stattfindet, ist eine Re-Konstruktion der gesellschaftlichen Verbindung oder der darin gültigen Routinen, die diese Ungleichheit aufrecht erhalten, nachteilig für diejenigen, die als Folge dessen häufiger mit Restriktionen und geringeren Möglichkeiten konfrontiert werden. Ein „Konsens“ oder eine „Norm“ ist das Produkt einer Auseinandersetzung zwischen Ungleichen und bleibt daher nie unangefochten. Variation und Konflikt sind unvermeidlich. Die wohl sicherlich wichtigste Veränderung, die mit einer postmodernen Perspektive einhergeht, ist die Tatsache, dass nicht nur Handlungen, sondern auch die Wahrnehmung derselben zum Gegenstand der Untersuchung geworden ist (→ Sprache und Wahrnehmung). Handlungen und Wahrnehmung werden zudem als untrennbar betrachtet. Innerhalb dieser Perspektive verfügen Sprecher über metalinguistische Konzeptualisierungen, das heißt, sie besitzen Vorstellungen über Qualität, Funktion, Status oder „Geschmack“ bestimmter sprachlicher Formen und Varietäten und deren Verbindung zu bestimmten sozialen Gruppen. Diese Konzeptualisierungen begleiten das kommunikative Verhalten der Sprecher maßgeblich und führen zu Handlungen, in denen diese Konzeptualisierungen erneut produziert werden (vgl. Calvet 2006). In Übereinstimmung mit dem oben Gesagten werden diese Vorstellungen und Assoziationen jedoch als Konfliktstätten oder Erwartungshaltungen bezeichnet, die als konstituierend für 481330890 8 soziologisch-politische Prozesse betrachtet werden und die einen konkreten Einfluss darauf haben, wem ein bestimmter Sprachgebrauch zugeschrieben wird (Blommaert 2005). Die Einsicht, dass Handlungen und Perzeption sich reziprok beeinflussen, hat auch die Sprachwissenschaft als wissenschaftliche Disziplin nicht unbeeinflusst gelassen. Wenn alles durch den Filter der menschlichen Wahrnehmung betrachtet wird, besteht folglich keine ideologiefreie Plattform, von der aus andere Phänomene beobachtet werden können. Im Gegensatz etwa zu „Spektakel“, Zufälligkeit oder der Loslösung der Sprache von der sozialen Welt, wurde beispielsweise das Interesse für die grammatikalische Systematik und Kohärenz, welches früher in sprachwissenschaftlichen Untersuchungen als ausschlaggebend und selbstverständlich betrachtet wurde, als charakteristisch für eine modernistische Perspektive auf Sprache und ihre Erforschung betrachtet. Diese zuletzt genannte Perspektive wurde von diesem Zeitpunkt an selbst zum Gegenstand – und nicht zum Ausgangspunkt – der Untersuchung und hat damit den Anstoß zu sprachideologischen Untersuchungen gegeben, in denen argumentiert wird, dass Sprachen keine natürlichen oder objektiven Entitäten sind, sondern unter anderem durch Sprachwissenschaftler benannt und ins Leben gerufen werden und einen Einfluss auf den konkreten Sprachgebrauch ausüben (Calvet 2006, Harris 1998, Schieffelin et al. 1998). Diese postmoderne Wende brachte eine deutliche Interessensverschiebung bei der Untersuchung des Sprachgebrauches mit sich. So ist seit Anfang der 1990er Jahre eine deutliche Zunahme mikroanalytischer Studien von Interaktionspraktiken fest zu stellen, welche reflexive und ambivalente erfinderische Improvisation und situierte Interpretation in kleinen „Handlungsgemeinschaften“ erforschen (Lave & Wenger 1991), wobei sprachliche Konventionen oder Strukturen nur als ein Mittel zur Konstruktion von Bedeutung in Interaktionen betrachtet werden (Pratt 1987, Rampton 1998). Ebenso hat ein postmoderner Blickwinkel es sehr viel weniger selbstverständlich werden lassen, eine Beschreibung des „Sprachgebrauchs von X“ oder des „Sprachgebrauchs von dieser oder jener sozialen Gruppe“ zu erstellen (Rampton 2006, 17). Daneben ist deutlich geworden, dass objektive Kategorien wie „Alter“ oder „Ethnizität“ nicht per se Sprachgebrauchsmuster verursachen, sondern dass Regelmäßigkeiten durch die Art und Weise hervorgebracht werden, wie Sprecher diese Kategorien wahrnehmen und sowohl sich selbst als auch andere dazu bewegen, sich dementsprechend zu verhalten. Diese postmoderne Anerkennung von Diversität und Pluralismus (→ Behinderung und Vulnerabilität) steht jedoch in einem Kontrast zu weit verbreiteten, dominanten Auffassungen von Sprachgebrauch in spätmodernen westlichen Gesellschaften, die ein Höchstmaß an Uniformität, Homogenität und Standardisierung anstreben. Diese werden meist aus Vorstellungen der Aufklärung und Romantik gespeist. 4 Standardisierung: Aufklärung und Romantik 481330890 9 Obwohl Standardsprachen in der Regel als quasi natürlich auftretende Phänomene betrachtet werden, sind sie unverkennbar mit der Aufklärung, den damit einhergehenden rationalistischen Ideen über Sprache (u. a. von John Locke) (→ Person und Sprache) und über deren Zusammenhang mit Politik und Wissenschaft verbunden – insbesondere mit der Notwendigkeit eines modernen Staates nach einem Kommunikationsmittel, das frei von sozialer Indexikalität (bestimmten Bedeutungen und Beiklängen), Ambiguität, Frivolität oder der Inkonsistenz, den Verwirrungen, Missverständnissen und politischen Konflikten ist, die daraus entstehen können. Nach dieser Auffassung muss Sprache ein referentiell präzises Instrument sein: Eine sprachliche Realisierung rationalen Denkens (→ Kognition und Emotion), auf der durch wissenschaftlichen Kenntniserwerb individuelle Aufklärung und schließlich sozialer Fortschritt gegründet werden können. Wenn eine „Sprache der Vernunft“ entwickelt und auf ein öffentliches Forum übertragen werden könnte, bestünde die Möglichkeit, dass Wahrheit und Vernunft dort für Einheit, Gleichheit und Frieden sorgen könnten – die Sprachpolitik des französischen Staates nach der Revolution (welche die Ausrottung aller Variation zum Vorteil des Französischen als Einheitssprache zum Ziel hatte) stellt hierfür ein Paradebeispiel dar. Die diskursiven Praktiken jedoch, die als Vorbild der modernen, „zivilen“ Kommunikation galten und auf der die Standardvarietät gründen musste, wurden ursprünglich (und auch heute noch) in sehr geschlossenen, elitären sozialen Netzwerken situiert. Auf diese Weise wurden (und werden) genau diejenigen Gruppen ausgeschlossen, deren Sprachgebrauch als „provinziell“, „chaotisch“, „frivol“, „folkloristisch“, „ungebildet“ oder „mehrdeutig“ und aus diesem Grund als „ungeeignet“ betrachtet wurde, um einen Beitrag zu Fortschritt und Bildung leisten zu können – nämlich Frauen, Arme, Leute „vom Land“, Analphabeten und Nicht-Europäer. Die Bezeichnung des Sprachgebrauchs einer spezifischen Gruppe als „modern“ rechtfertigt auf diese Weise ungleiche soziale Verhältnisse (Baumann & Briggs 2003). Diese modernistischen Auffassungen von Sprache sind dennoch in großen Teilen Europas (und darüber hinaus) weit verbreitet und haben zu „Regimes sprachlicher Säuberung“ geführt (vgl. Bauman & Briggs 2003, Cameron 1995, Silverstein 1998). Diese Regimes fordern von ihren Sprechern eine fortlaufende Selbstdisziplin und den Gebrauch (der einzigen) korrekten und präzisen Formen, von denen angenommen wird, dass sie zu einer geistigen Entfaltung und schließlich Emanzipation führen – was wiederum mit einer Stigmatisierung „unsauberer“, dialektaler Sprachformen einhergeht. Dieser Emanzipationsprozess wird zudem vor allem als ein individuelles Geschehen betrachtet: Menschen werden als rationale, mit einem freien Willen ausgestattete Wesen betrachtet, den sie im Prozess des wissenschaftlichen Kenntniserwerbs beliebig einschalten können. Diejenigen, denen diese Selbstdisziplin fehlt oder die sich nicht ausreichend bemühen, „verdienen“ so gesehen die 481330890 10 Marginalisierung und Ausgrenzung (vgl. Foucault 1970, Baumann & Briggs 2003, Blommaert 2005) (→ Behinderung und Vulnerabilität, → Dialogaufbau unter schweren pathologischen Bedingungen). Daneben wird in verschiedenen Regionen Standardisierung auch stark durch das romantischnationalistische Streben nach sprachlicher Homogenität genährt. In der romantischen Auffassung werden Traditionen als Träger des lebendigen volkspoetischen Ausdrucks betrachtet, die für eine kollektive emotionale Verbundenheit (→ Kognition und Emotion) und Vaterlandsliebe sorgen können. Authentische Traditionen müssen daher weitestgehend bewahrt und anerkannt werden, um die Basis oder gar die „Seele" einer authentischen und lebenskräftigen nationalen Standardsprache bilden zu können. Korrumpierte, nicht volkseigene Traditionen müssen dagegen vermieden oder beseitigt werden. Natürlich bringt auch dieses Streben ein Regime der Säuberung mit sich, in dem „abweichender“ und „substandardisierter“ Sprachgebrauch problematisiert, nur vorübergehend geduldet oder als Mangel an Stolz und Vaterlandsliebe betrachtet wird. Ebenso sind Urteile über die Authentizität von Traditionen Stätten einer reellen Machtausübung (Bauman & Briggs 2003). 5 Globalisierung und Jugendsprache Diese homogenisierenden Tendenzen geraten in spätkapitalistischen Gesellschaften jedoch in Konflikt mit der so genannten „Globalisierung“ (→ Person und Sprache). Diese Bezeichnung zielt auf die explosionsartig zugenommenen Transport- und Kommunikationsmöglichkeiten sowie auf die Tatsache, dass sich verschiedene soziale Prozesse – beispielsweise Arbeit, die moderne technologische Kulturindustrie (→ Medien) – nicht mehr lediglich innerhalb nationaler Grenzen entwickeln, sondern transnationalen Dynamiken entsprechen. Folglich entsteht eine äußerst intensive Wechselwirkung und ein Austausch zwischen lokalen und nicht-lokalen Ebenen, auf denen sehr unterschiedliche sprachliche Produkte und Identitäten zirkulieren, die ihre lokalen oder weniger lokalen Kontexte übersteigen oder durchkreuzen, in neue Kontexte integriert und mit den dort geltenden Wahrnehmungen und Evaluationsgewohnheiten konfrontiert werden (Blommaert 2005). Globalisierung führt mit anderen Worten zu einer Zunahme oder zumindest verstärkten Sichtbarkeit der Heterogenität, durch die das Streben nach sprachlicher und ethnischer Homogenität unter Druck gesetzt wird (→ Behinderung und Vulnerabilität). In diesem Zusammenhang kann in den letzten 20 Jahren eine signifikante Veränderung kommunikativer Muster festgestellt werden. So ist der öffentliche Diskurs einer zunehmenden „Konversationalisierung“ unterworfen (Fairclough 1995). Fachleute und fachspezifischer Sprachgebrauch erhalten dabei weniger Beachtung, was unter anderem eine Zunahme substandardisierten Sprachgebrauchs in denjenigen Bereichen zur Folge hat, in denen früher der Gebrauch der Standardsprache vorherrschte, wie beispielsweise im Fernsehen oder in Schulklassen. Zusätzlich hat die 481330890 11 aktive Kritik von Soziolinguisten an einer allzu strengen Präskription von Standardvarietäten im Unterricht für eine zumindest vorübergehende Anerkennung von Varietäten gesorgt. Im Allgemeinen wird (sprachliche) Differenz also sichtbarer und scheinbar auch anerkannt. Zugleich führt ihre Wahrnehmung jedoch zu moralischen Ängsten und verstärkten Standardisierungsimpulsen, die oft in Kombination mit „strengen“ politischen Koalitionen (Cameron 1995) auftreten. Aber auch in einem „milderen“ Diskurs, in dem Staaten ausdrücklich eine Regierung der Chancengleichheit befürworten und auf diese Weise die Integration, Emanzipation und Aktivierung traditioneller Problemgruppen unterstützen, besteht kein Zweifel an der Qualität des Sprachgebrauchs, der die Basis eines solchen Emanzipationsprozess bilden sollte (→ Sprachförderung im Förderschwerpunkt Lernen). Schließlich werden im Unterricht Sprachen ethnischer Minderheiten in der Regel nicht als Mittel zum Wissenserwerb und seiner Weiterentwicklung eingesetzt (→ DaZ) – genau so wie die Standardversion der nationalen Sprache, trotz ihrer manchmal geringen Beachtung am Arbeitsplatz, für gewöhnlich als das Tor zu sozialem Aufstieg und Erfolg auf dem Arbeitsmarkt betrachtet wird (Blommaert 2005). In diesem Spannungsfeld werden in europäischen Städten immer mehr Phänomene wie „Straßensprache“, „Jugendsprache“, oder ethnisch-gemischter und/oder substandardisierter Sprachgebrauch bei Jugendlichen registriert, die regelmäßig zum Thema der gesellschaftlichen Debatte und Besorgnis werden (vgl. Androutsopolous & Georgakopoulou 2003; Androutsopolous 2005, 2006; Jaspers 2005, 2006; Rampton 2006). Migrations- und Flüchtlingsströme haben in europäischen Städten Schulen und multiethnische (meist arme) Bezirke entstehen lassen, in denen Jugendliche mit diversen sprachlichen Hintergründen miteinander (und mit der dominanten Sprachvarietät) in Kontakt kommen. In diesen Kontexten findet häufig ein intensiver Austausch von Sprachmaterial statt: Jugendliche nehmen ihren gegenseitigen Sprachgebrauch in Codewechseln auf, vermischen diese mit ihrem eigenen Sprachgebrauch oder stilisieren ihren gegenseitigen Sprachgebrauch zu spektakulären oder ästhetischen Verformungen. Die Auswirkungen dieser Sprachkontaktsituation werden vermehrt in den Medien thematisiert oder weiter stilisiert – wie beispielsweise im Fall des „Türken-Deutsch“ (vgl. Zaimoğlu 2007). Ihrerseits können diese Stilisierungen in Netzwerken von Jugendlichen erneut aufgegriffen und weiterverarbeitet werden. Darüber hinaus weisen Sprachwissenschaftler darauf hin, dass sowohl der häusliche Sprachgebrauch von Jugendlichen, als auch der Gebrauch der dominanten sprachlichen Varietät durch diese Kontaktsituation gefärbt sein kann und auf phonologischer, morpho-syntaktischer sowie lexikalischer Ebene signifikant von der Standardvarietät abweicht, was zur Identifikation von Ethnolekten wie „Marokkaner-Niederländisch“, „Polen-Englisch“ oder „Türken-Deutsch“ geführt hat. Andere Autoren machen darauf aufmerksam, dass diese Ethnolekte – ebenso wie das Konzept der „Jugendsprache“ – erneut dazu führen, dass einer von vornherein abgegrenzten und als homogen bezeichneten Gruppe, in der ein Identitätsmerkmal (z.B. „Jugend“, „Ethnizität“) zum Nachteil anderer 481330890 12 hervorgehoben wird, eine bestimmte Art zu sprechen zugewiesen wird. Darum präferieren sie, zu untersuchen, wie Jugendliche sich anhand ihres Sprachgebrauchs untereinander und gegenüber ihnen vertrauten Erwachsenen positionieren und sich in den verschiedenen soziokulturellen Stilen und Prozessen ihrer Umgebung situieren. Untersuchungen weisen darauf hin, dass der kreative Sprachgebrauch von Jugendlichen viele nützliche metalinguistische Informationen über die Wahrnehmung und Bedeutung spezifischer sprachlicher Formen innerhalb etablierter sozialer Routinen und Hierarchien enthält. Weniger als eine „neue Varietät“ muss der Sprachgebrauch Jugendlicher daher vielleicht vielmehr als ein Ort betrachtet werden, welcher die sprachideologischen Bruchlinien der Gesellschaft sichtbar macht (→ Behinderung und Vulnerabilität), wo Jugendliche sich symbolisch von lokalen und anderen Erwartungen, Stilen und Routinen abgrenzen, diese aufnehmen oder kommentieren und auf diese Weise versuchen, den negativen Auswirkungen dieser Erwartungen und Routinen zu entkommen, diese spielerisch anzuprangern oder selbst eine dominante Position (und den dazugehörigen Sprachgebrauch) auf Kosten anderer in ihrer Umgebung anzustreben. Androutsopoulos, J. (2005): Und jetzt gehe ich chillen: Jugend- und Szenesprachen als lexikalische Erneuerungsquellen des Standards. In: Eichinger, L. M. & Kallmeyer, W. (Hrsg.): Standardvariation. Wie viel Variation verträgt die deutsche Sprache? (171-206). Berlin: de Gruyter. Androutsopoulos, J. (2006):Jugendsprachen als kommunaitive soziale Stile. Schnittstellen zwischen Mannheimer Soziostilistik und Jugendsprachenforschung. Deutsche Sprache 1, 2, 106-121. Androutsopoulos, J. & Georgakopoulou, A. (2003): Discourse constructions of youth identities. Amsterdam: Benjamins. Bauman, R. & Briggs, C. L. (2003): Voices of modernity. Language ideologies and the politics of inequality. Cambridge: Cambridge University Press. Bopp, F. (1816): Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache. Frankfurt a. M.: Andreä. Blommaert, J. (2005): Discourse. A critical introduction. Cambridge: Cambridge University Press. Calvet, J. L. (2006): Towards an ecology of world languages. Cambridge: Polity Press. Cameron, D. (1995): Verbal hygiene. London: Routledge. Chomsky, N. (1965): Aspects of the theory of syntax. Cambridge (Ma): MIT Press. Fairclough, N. (1995): Critical discourse analysis. London: Longman. Fishman, J. (1972): The sociology of language. Rowley (Ma): Newbury House. Foucault, M. (1970): The order of things. An archaeology of the human sciences. New York: Vintage. 481330890 13 Gal, S. (1979): Language shift. Social determinants of linguistic change in bilingual Austria. New York: Academic Press. Garfinkel, H. (1967): Studies in ethnomethodology. Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall. Giddens, A. (1984): The constitution of society. Outline of the theory of structuration. Cambridge: Polity Press. Grimm, J. (1819-1837): Deutsche Grammatik. 4 Bände. Göttingen: Dieterich. Harris, R. (1998): Introduction to integrational linguistics. Oxford: Pergamon. Heritage, J. (1984): Garfinkel and ethnomethodology. Oxford: Blackwell. Hudson, R. A. (1996): Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press. Hymes, D. (1972): On communicative competence. In: Pride, J. & Holmes, J. (Eds.): Sociolinguistics (269-293). London: Penguin. Jaspers, J. (2005): Linguistic sabotage in a context of monolingualism and standardization. Language and Communcation 25, 3, 279-297. Jaspers, J. (2006): Stylizing standard Dutch by Moroccan boys in Antwerp. Linguistics and Education 17, 2, 131-156. Labov, W. (1966): The social stratification of English in New York city. Washington DC: Center for Applied Linguistics. Labov, W. (1972): Sociolinguistic patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Lave, J. & Wenger E. (1991): Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press. Meeuwis, M. & Brisard, F. (1993): Time and the diagnosis of language change. Antwerp Papers in Linguistics 72. Milroy, L. (1992): Linguistic variation and change. On the sociolinguistics of English. Cambridge (Ma): Blackwell. Parsons, T. (1937): The structure of social action. New York: McGraw-Hill. Pratt, M. L. (1987): Linguistic utopias. In: Fabb, N., Attridge, D., Durant, A. & McCabe, C. (Eds.): The linguistics of writing (48-66). Manchester: Manchester University Press. Rampton, B. (1998): Speech community. In: Verschueren, J., Östman, J. O., Blommaert, J. & Bulcaen, C. (Eds.): Handbook of pragmatics (1-34). Amsterdam: Benjamins. Rampton, B. (2006): Language in late modernity. Cambridge: Cambridge University Press. Rask, R. K. (1818): Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse [Untersuchung zum Ursprung der altnordischen oder isländischen Sprache]. Kopenhagen: Gyldendal. Saussure, F. de (1972 [i. O. 1916]): Cours de linguistique générale. Lausanne: Payot. 481330890 14 Schieffelin, B., Woolard, K. & Kroskrity, P. (1998): Language ideologies. Practice and theory. New York: Oxford University Press. Silverstein, M. (1996): Monoglot ‘Standard’ in America. Standardization and metaphors of linguistic hegemony. In: Brenneis, D. & Macaulay R. (Eds.): The matrix of language. Contemporary linguistic anthropology (284-306). Boulder: Westview Press. Verner, K. (1877): Eine Ausnahme der ersten Lautverschiebung, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 23, 97. Williams, G. (1992): Sociolinguistics. A sociological critique. London: Routledge. Zaimoğlu, F. (72007): Kanak Sprak. 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft. Hamburg: Rotbuch.