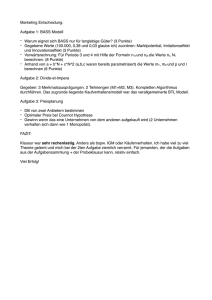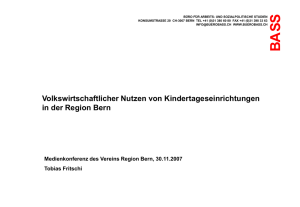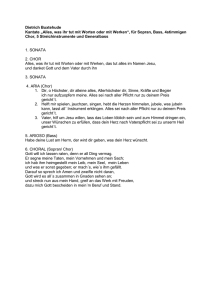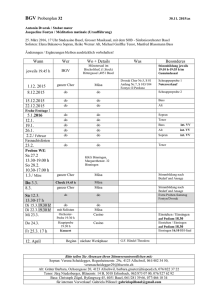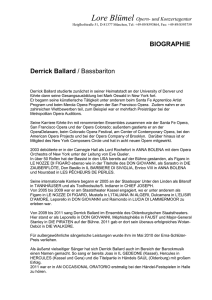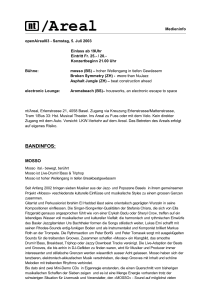Ole Hübner: „f*** bass f*** bass“ (2014) Partitur
Werbung

Ole Hübner: „f*** bass f*** bass“ (2014) Partitur, Live-Elektronik, Audio- und Videozuspiel zu f*** bass f*** bass entstanden etwa zwischen Februar und September 2014. Der Titel ist eine Variation von f*** trance f*** trance, dem Namen meines unmittelbar zuvor entstandenen Stücks für Saxophonoktett, der wiederum an den Mitte der 1990er-Jahre veröffentlichten Track Fuck Trance des niederländischen GabberMusikers Angerfist angelehnt ist. Zwar unterscheiden sich die beiden Stücke in Hinblick auf Besetzung, Technik (das Saxophonoktett ist bis heute mein letztes Stück ohne jegliche Elektronik) und Klangresultat enorm voneinander, doch liegt beiden die Beschäftigung mit den musikalischen Eigenschaften von Techno, Hardcore und Gabber zugrunde. Während in f*** trance f*** trance die acht Saxophone als eine Art Orgel genutzt werden, auf die die minimalistisch-repetitive Klanggewalt des Hardcore recht plakativ übertragen wird, die aber dank ihrer immensen dynamischen Bandbreite dennoch in der Lage sind, sehr differenzierte, beinahe elektronisch wirkende Sounds und, gewissermaßen, „Filter“ wie im Techno zu erzeugen, arbeitet f*** bass f*** bass mit Zuspielungen „echter“ Techno-Samples, deren Übertragung auf das klassische, heterogene Instrumentalensemble zwar wohl eine größere Distanz zum Sujet innewohnt als der „Saxophonorgel“, doch auch die Möglichkeit zu einem erheblich vielschichtigeren Umgang mit die sem. Der von vielen (kurioserweise, angesichts der Fülle von „fuck“-basierten Stücknamen selbst in der prüden neuen Musik1) als unangebracht empfundene Titel spielt natürlich vor allem auf die zahlreichen basslastigen Samples im Verlauf des Stücks an, auf die Härte des Techno und das Provokationspotenzial, das jenem, zumindest in seiner Anfangszeit in den 1990er-Jahren einmal, innewohnte, erschließt sich aber auch aus dem Kontrast der Sopranblockflöte, die am Ende des Stücks ein zweiminütiges, recht virtuoses Solo spielt, zu der vorangegangenen Soundzusammenstellung heraus – also im Sinne einer Negierung oder Abwertung durch das „f***“: „Scheiß Bass Scheiß Bass“. Im Gegensatz zu f*** trance f*** trance“ zielen die musikalischen Referenzen an Techno und Hardcore in f*** bass f*** bass weniger auf permanenten Schalldruck und Wiederholungslastigkeit ab, sondern vielmehr auf die ihm innewohnende Statik, auf das Begreifen eines stehenden Beats als akustischen „An“-Zustand mit dem „Aus“-Zustand als dualem Gegensatz. Die Ähnlichkeit dieses Gedankens zu den oben beschriebenen Überlegungen, die die Grundlage zum technischen und ästhetischen Konstrukt von der offizielle bilden, ist nicht zufällig, denn f*** bass f*** bass entstand direkt davor und leistete in Hinblick auf das Denken in audio-visuellen Zuständen und Situationen wertvolle Vorarbeit. Auch das Stroboskoplicht, in der offizielle und simon & malte als 1 Niclas Thobaben: pretty fucking badass piece, Matthias Krüger: fuckin' A!, Remmy Canedo: fuck, Arno Lücker: I was like: 'oh my god' and she was like: 'what the fuck' and we were like: 'oh my god, what the fuck!', Sidney Corbett: oversexed and underfucked und so weiter. formbildendes Element mit zwei möglichen, klar voneinander abgegrenzten Zuständen (ruhig/aus, bewegt/an) eingesetzt, kommt in f*** bass f*** bass erstmals in dieser Rolle vor. Das Stück wird von zwei Videosequenzen eingerahmt: Zu Beginn bin ich selber in einem Badezimmerspiegel zu sehen, wie ich meine Haare mit einer großen Portion Haarwachs modelliere und Lidschatten auftrage; dazu spielt das Radio die typische Collage aus mal mehr, mal weniger starkem Rauschen und undeutlichen Songfragmenten, die man erhält, wenn der Empfänger auf eine unbelegte Frequenz zwischen zwei Sendern eingestellt ist. Dann verlasse ich das Badezimmer, Licht und Radio gehen aus. Scheinbar aus meiner Sicht wandert das Bild nun einen Flur entlang, eine Tür wird geöffnet und ein Zimmer kommt zum Vorschein, in dem ich allerdings bereits am Schreibtisch sitze und an meinem Rechner mit einem technoartigen Beatsample arbeite. Diese Sequenz bricht schlagartig in dem Moment ab, in dem das Ensemble diesen Beat übernimmt, fortführt und nacheinander durch zeitliche Verschiebung der zunächst homophonen Stimmen gegeneinander dekonstruiert. Am Ende des Stücks sieht man, wieder in der allerersten Kameraeinstellung, im Spiegel die Badezimmertür aufgehen, aus dem Flur scheint ein wenig Licht in den dunklen Raum herein. Mit diesem Bild endet das Stück. Bereits die hier beschriebenen ersten eineinhalb Minuten reiner Videozuspielung kratzen an der Oberfläche einer Vielzahl von für mich künstlerisch interessanten und relevanten Themen, ohne dabei bereits in die Tiefe zu gehen, handelt es sich schließlich „nur“ um einen – wenngleich natürlich nicht minder wichtigen – durchgestalteten Rahmen für das Stück. (Das Thema „Rahmen“ beziehungsweise „Rahmung“ ist für mich grundsätzlich von enormen Interesse.) Zunächst einmal stellt diese Sequenz einen eindeutigen Alltagsbezug her: Man sieht den Komponisten in seinem privaten Badezimmer bei einer „Rahmenhandlung“ des Alltags; seine Privatwohnung ist nicht nur sein Arbeitsplatz, sondern auch sein „privates Backstage“, in dem er sich für seinen Alltag rüstet wie auch für Anlässe wie etwa Konzerte, bei denen er üblicherweise nach der Aufführung seines Stücks auf die Bühne gerufen wird.2 Eine folgerichtige Konsequenz war es deshalb für mich, bei der Uraufführung von f*** bass f*** bass dieselben Kleidungsstücke anzuziehen wie im Video, um auf diese Weise einen scheinbaren kausalen Zusammenhang zwischen der scheinbar der Privatsphäre entrissenen, in Wirklichkeit selbstverständlich gerade zum Zweck der Veröffentlichung geschauspielerten, in jedem Fall nun im künstlerischen Kontext definitiv öffentlich gemachten Badezimmersituation und der ohnehin öffentlichen Konzertsituation herzustellen. Das Haarstyling und natürlich insbesondere das Schminken können fernerhin durchaus 2 Die künstlerische Darstellung eines realen oder fiktiven „Backstage“-Bereichs interessiert mich bereits seit langem – genauer gesagt: seit der Uraufführung von Trond Reinholdtsens Musiktheater Musik bei den Donaueschinger Musiktagen 2012. Dort beginnt in demselben Moment, in dem alle Musikerinnen die Bühne verlassen haben eine ebenfalls „zu Hause“ gedrehte Filmsequenz, die aber nicht die Wohnung des Komponisten darstellt, sondern auf cartoonhafte Weise, mit selbstgebastelten Fassaden und Handpuppen, vorgibt, der Backstage-Bereich zu sein, in dem gerade das gesamte Ensemble verschwunden ist, einschließlich des Komponisten, der im Video sofort wieder als Handpuppe „auftaucht“. als queere Anspielungen verstanden werden (und wurden sie auch von einigen Konzertbesucherinnen). Spiegel sowie die Techniken des Spiegelns überhaupt stellen für mich im visuellen und gleichermaßen im akustischen Zusammenhang enorm reichhaltige Beschäftigungsfelder in theoretischer und konzeptueller Hinsicht wie auch in Gestalt konkreter künstlerischer Werkzeuge dar. Exemplarisch seien hier als einige Faszinosa die folgenden genannt: Die exakte Umkehrung akustischer Abläufe durch das Spiegeln und ihre technische Manipulierbarkeit; der Spiegel im Spiegel und die Labilität des Bildes durch Veränderung der Größen- und Perspektivverhältnisse zweier opponierender Spiegel zueinander; die eigentliche natürliche Unüberlistbarkeit und das durch technische Fakes dennoch ermöglichte Austricksen des Spiegels; die generelle Eigenschaft des Spiegelbilds als das Medium, das es ist, niemals das Original, sondern immer „nur“ dessen horizontal umgekehrte Projektion sein zu können, demzufolge stets Distanz und Mittelbarkeit zu schaffen – und auch keinen eigenen Willen zu haben; die Eigenschaft des Spiegels, ein und derselbe zu sein und dennoch zwei Personen mit verschiedenen Positionen im Raum im selben Moment zwei komplett verschiedene Bilder zu zeigen. Von all diesen Eigenschaften spielenin der Anfangssequenz zu f*** bass f*** bass zwar allenfalls diejenigen der Mittelbarkeit und der Verschiedenenheit der Bilder eine Rolle, doch bereits die (symbolische) Präsenz des Spiegels in dieser Szene halte ich aufgrund seiner besonderen künstlerischen Bedeutung, die er für mich hat, für erwähnenswert. Das kleine Spiel mit der filmischen Perspektive ist ein weiterer wichtiger Punkt dieser Videosequenz. Nachdem ich das Badezimmer verlassen habe, entsteht der Eindruck, der darauffolgende, mit wackeliger Handkamera gefilmte Gang durch den Flur würde aus meiner eigenen Perspektive dargestellt werden: schließlich stellt er die tatsächliche örtliche Verbindung zwischen dem Badezimmer und dem Zimmer dar, in dem ich dann aber, als sich die Tür öffnet, bereits am Schreibtisch sitze und arbeite. Lässt man die selbstverständlich völlig simplen filmischen Mittel einmal außer Acht, mit denen dieser kurze Irritationsmoment erzeugt wird, gäbe es, streng logisch folgernd, zwei Erklärungen: Entweder wurde mein eigener Weg aus dem Badezimmer ins Arbeitszimmer übersprungen und die zeitliche Kontinuität dieser Videosequenz steht plötzlich infrage – in diesem Fall muss es aber auch eine zweite Person geben, aus deren Perspektive der Gang durch den Flur tatsächlich dargestellt wird. Oder aber es wird die Illusion eines zweiten, am Schreibtisch arbeitenden Ichs erzeugt, das nicht identisch und auch nicht vereinigt ist mit dem Ich, das gerade aus dem Badezimmer gekommen ist, und diese beiden begegnen sich in dem Moment, in dem das Badezimmer-Ich die Tür öffnet und das Schreibtisch-Ich erblickt. Die Annahme dieser Version für den Bruchteil einer Sekunde beim Publikum würde einen erfolgreich erzielten Verwirrungsmoment bedeuten, der im Entfernten dem ähnelt, was Žižek als „späte Erkenntnis“ bezeichnet und was „[z]u den Standardgags amerikanischer TV-Komödien gehört […]: Jemand beobachtet, wie ein Auto abgeschleppt wird, lacht schadenfroh über das Unglück des Besitzers, um dann ein paar Sekunden später überrascht aufzuschrecken und zu rufen: 'Halt, Moment, das ist mein Auto!' Die elementarste Form dieses Gags ist natürlich die verzögerte Selbsterkenntnis: Ich komme an einer Glastür vorbei und meine dahinter eine hässliche, entstellte Gestalt zu sehen; ich lache, und plötzlich merke ich, dass das Glas ein Spiegel war und die Gestalt ich selbst.“3 Voraussetzung für eine derartige Funktionsweise dieses kurzen Augenblicks ist natürlich, dass die Zuschauerin annimmt, die Perspektive, die ihr während des Gangs durch den Flur gezeigt wird, sei meine, und bereit ist, sich unter der Bedingung des Akzeptierens, dass es meine Perspektive ist, von außen in sie hineinzuversetzen. Nebenbei greift diese auf der Annahme einer Illusion fußende Erklärung die Situation im Badezimmer wieder auf, denn auch dort werde ich ja nicht unmittelbar, sondern als Illusion, als scheinbare visuelle Verdopplung meiner selbst im Spiegel dargestellt, die offenkundig auch nicht dem Bild entspricht, das ich selber in diesem Moment sehe – sonst wäre der Blick meines Spiegelbilds ja auf die Kamera gerichtet. Selbstverständlich wird der Zuschauerin sehr schnell klar, dass jemand anderes den Gang durch den Flur gefilmt haben muss, doch in dem Moment, in dem sich diese Erkenntnis offenbart, beeinflusst sie doch rückwirkend die Bewertung der filmischen Perspektive der wenigen Sekunden, in der „jemand“, nicht ich, durch den Flur läuft, und es findet eine kurze Irritation statt, die zur nachträglichen Änderung des perspektivischen Erlebens führt. Ihr wird also in dem Moment, in dem die Arbeitszimmertür sich öffnet, klar, dass der Perspektivwechsel nicht erst jetzt vonstatten geht, sondern schon in dem Moment erfolgte, in dem sich die Badezimmertür schloss. Wie auch immer diese Abfolge von Bildern letztlich individuell empfunden wird – in jedem Fall wurde ihr durch technische Manipulation der Schein einer zeitlich-räumlichen Kontinuität auferlegt, in welcher sie in der Realität so nicht möglich wäre. Oder einfach formuliert: In der Videosequenz gibt es einen kleinen, harmlosen filmisch-perspektivischen Fake. Schlussendlich fällt noch das rauschende Radio als Schallkulisse der Badezimmersituation auf. Diese Fläche aus Geräusch und Songfragmenten ist nicht komponiert oder nachträglich bearbeitet (es wurden lediglich an einigen Stellen wenige Sekunden sowohl der Bild- als auch der Tonspur herausgeschnitten), sondern entspricht exakt dem Klang, der zufällig im Moment der 3 Slavoj Žižek, Weniger als nichts, Suhrkamp Verlag, Berlin 2014, Seite 202, Kursivstellung im Original. Im Zusammenhang einer „Nicht-Vereinigung“ des Ichs mit sich selbst ist auch Hölderlins Gedankengang zur Nichtidentität von „absolutem Sein“ und Identität infolge der „Ur-Teilung“ von Subjekt und Objekt interessant, den Žižek im selben Buch zitiert: „Wenn ich sage: Ich bin Ich, so ist das Subjekt (Ich) und das Objekt (Ich) nicht so vereiniget, daß gar keine Trennung vorgenommen werden kann, ohne, das Wesen desjenigen, was getrennt werden soll, zu verletzten; im Gegenteil das Ich ist nur durch diese Trennung des Ichs vom Ich möglich. Wie kann ich sagen: Ich! ohne Selbstbewußtsein? Wie ist aber Selbstbewußtsein möglich? Dadurch daß ich mich mir selbst entgegensetze, mich von mir selbst trenne, aber ungeachtet dieser Trennung mich im entgegengesetzten als dasselbe erkenne. Aber inwiefern als dasselbe? Ich kann, ich muß so fragen; denn in einer andern Rücksicht ist es sich entgegengesetzt. Also ist die Identität keine Vereinigung des Objekts und Subjekts, die schlechthin stattfinde, also ist die Identität nicht = dem absoluten Sein.“ (Friedrich Hölderlin, „Urteil und Sein“, zitiert nach Slavoj Žižek, Weniger als nichts, Seite 29). Videoaufnahme vom Radio wiedergegeben und von der Kamera aufgezeichnet wurde. Das bedeutet, dass ich die Kontrolle über den Sound zu Beginn des Stücks zu einem großen Teil abgebe und eine Minute lang nur fremdes Klangmaterial wiedergebe, das ich nicht einmal ausgesucht habe, sondern das im Moment der Videoaufnahme einfach da war: statt diesem speziellen, mit Pop gemischten Rauschen hätte das Radio auch ein ganz anders gefärbtes Rauschen mit beispielsweise Metal, Folk oder Klassik spielen können. Die technische Vorkehrung zur Erzeugung einer solchen Soundfläche habe ich freilich vor Beginn der Videoaufzeichnung getroffen, indem ich den Radioempfänger auf eine Frequenz zwischen zwei Sendern eingestellt und mich damit einer gewissermaßen konzeptuellen Technik bedient habe, einer Maschine nämlich, die, einmal sorgfältig präpariert, als analoger Synthesizer selbstständig, fortlaufend und nicht kontrollierbar neues Audiomaterial aus bereits existenter Musik und Störsignalen generiert. Der Dualismus zwischen „An“- und „Aus“-Zustand ist hier ein doppelter, denn das „An“ des produzierenden Geräts ist identisch mit dem „An“ der amorphen Soundfläche selber. Und auch des Lichts, das exakt im selben Moment ausgeht wie das Radio, und dies nicht aufgrund eines künstlerischen Konstrukts oder Konzepts, sondern einer einfachen elektrotechnischen (und nebenbei zufällig intermedialsynästhetischen) Verknüpfung von Badezimmerlampe und Radio im selben Schaltkreis. Diese von Besucherinnen oftmals bewunderte Schönheit jener wunderbaren Präparation meines Badezimmers wird durch ihre künstlerische Behandlung nun auch öffentlich zugänglich. Nach der einleitenden Videosequenz beginnt das eigentliche Stück, zu dessen Betrachtung grundsätzlich zwischen der musikalischen und der visuellen Ebene unterschieden werden muss. Die musikalische Ebene spaltet sich wiederum in den Ensemblepart und die Elektronik auf, die visuelle in Stroboskop und Video. Alle vier Elemente kennen verschiedene Grundzustände, nämlich im wesentlichen „An“ und „Aus“, im Elektronik- und im Videopart ist der „An“-Zustand nochmals ausdifferenziert in „ruhig“ (beziehungsweise „inaktiv“) und „bewegt“ (beziehungsweise „aktiv“). Was nun stattfindet, ist im Wesentlichen die Montage aller Zustände in allen denkbaren Kombinationen miteinander. Dabei steht im Grunde jeder Zustandsabschnitt jedes Parameters in Kontrast zu seinem gesamten Umfeld, sowohl zum jeweils vorhergehenden und nachfolgenden Abschnitt als auch mal mehr, mal weniger zu den Zuständen der anderen Parameter. Am auffälligsten ist in dieser Hinsicht sicherlich der ständige Bruch zwischen den Videosequenzen, in denen eine Gruppe von etwa zehn Menschen ausgelassen tanzt, und denjenigen, in denen dieselben Menschen völlig apathisch und regungslos auf einem Sofa „rumhängen“ und Chips und Salzstangen in sich reinstopfen. Beide Zustände wiederum gehen ihrerseits sowohl zu den etwas ruhigeren als auch zu den sehr dichten und energetischen Klangzuständen Beziehungen ein, die, je nach energetischer „Übereinstimmung“, als mal mehr, mal weniger passend wahrgenommen werden. Die Brüche zwischen gegensätzlichen akustischen und gegensätzlichen visuellen Zuständen finden im Verlauf des Stücks sowohl parallel zueinander als auch völlig unabhängig voneinander statt, können sehr schnell aufeinander folgen oder auch nach längerem Verharren in einem Zustand sehr plötzlich geschehen. Kurz vor dem Blockflötensolo findet eine Verdichtung paralleler stattfindender visueller und musikalischer Brüche statt, bei denen mehrmals in sehr kurzen Abständen zwischen jeweils zwei Zuständen hin- und hergewechselt wird, deren audio-visuelle Zuordnung stets dieselbe bleibt und sich dadurch sehr schnell als zusammengehörig in der Wahrnehmung der Zuhörerin einprägt. Ebenfalls damit synchronisiert ist ein ständiger Wechsel zwischen „An“ und „Aus“ des Stroboskops, der die Blockhaftigkeit zusätzlich unterstützt. Grundsätzlich besteht die musikalische Struktur des Stücks vor allem aus Beatstrukturen, die zunächst durch Technosamples vorgestellt und anschließend vom Ensemble aufgegriffen, verfremdet und modifiziert werden – oder aber, im Gegenteil, bereits im Ensemblepart auftauchen, bevor die Zuhörerin mit der Originalquelle vertraut gemacht wird. Ist jedes Hinzukommen eines neuen Beats in den ersten Minuten des Stücks noch recht einfach zu bemerken und seine weitere Entwicklung gut nachzuvollziehen, ist sehr bald eine solche Fülle von Beats und kurzen, sich wiederholenden melodischen Motiven verschiedenster Tempi und Soundcharakteristika erreicht, dass das daraus entstandene pulsierende Gefüge hörend kaum mehr entworren werden kann, sondern vielmehr zu einer amorphen, polyrhythmischen Soundmasse verschmilzt, die, als aus mehreren Ur-Zuständen neu entstandene Situation, wie ein Gefüge ineinandergreifender Zahnräder gebündelt abbrechen und ebenso schlagartig, quasi wie auf Knopfdruck, wieder „losrattern“ kann. Diese Art vertikaler Verdickung stellt gewissermaßen das Gegenstück zur oben beschriebenen horizontalen Verdichtung dar, deren Intensität sich vor allem in der zeitlichen Abfolge statt in der strukturellen Komplexität und internen Zerrissenheit der Klangereignisse äußert. Neben den einerseits tanzenden, andererseits chipsessenden Personen werden im Video auch einzelne Musiker an verschiedenen Orten in Köln gezeigt: David Schmitz, Violine, im Innenhof der Hochschule für Musik und Tanz Köln; Alexander Dawo, Kontrabass, auf dem Ottmar-Pohl-Platz vor der Halle Kalk; Jonas Lippert, Posaune, unter der Severinsbrücke an der Deutzer Werft. Auf der einen Seite werden damit verschiedene urbane Atmosphären beziehungsweise lokale Zustände in das Stück integriert und damit ein Pendant geschaffen zu dem zwar alltäglich anmutenden, aber doch vor einer anonymen, künstlich-leeren und eindeutig nicht alltäglichen Kulisse stattfindenden Tanzen und Chipsessen – im Gegenzug ist in den Solo-Sequenzen zwar die Kulisse eine alltäglichere, nicht aber der Akt des Spielens an solchen öffentlichen Plätzen. Die Öffentlichkeit des Ortes wird in dem unter der Severinsbrücke entstandenen Material zusätzlich durch ein im Hintergrund langsam durchs Bild fahrende Schiff untermauert sowie sogar durch ein Mann, der, wohlwissend um die Präsenz einer aufnehmenden Kamera, direkt vor dieser durchs Bild läuft – etwas Besseres hätte mir bei dem Videodreh kaum passieren können. Auf der anderen Seite wird dieses Videomaterial verwendet, um auf verschiedene Arten und in Zusammenspiel mit der Musik audio-visuelle Irritationen zu erzeugen. Der Violinist und der Kontrabassist spielen auf ihren Instrumenten verschiedene repetitive Motive aus dem Stück; die stummen Videoaufnahmen werden dann mit denselben, aber von anderen Instrumenten gespielten Motiven unterlegt. So sieht man etwa Alexander Dawo rhythmisch auf seinem Bass zupfen, hört aber die dazu passenden Töne von der live spielenden Piccoloflöte. Durch diese einfache Form eines audio-visuellen Fakes entsteht eine gewisse Irritation: Bild und Ton werden zwar anhand gewisser übereinstimmender Parameter miteinander in Verbindung gebracht, passen aber in Hinblick auf Oktavlage und Instrumentalklang überhaupt nicht zueinander. Der Posaunist hingegen wird mehrfach beim Spielen eines langen Tons gezeigt. Diese ebenfalls stumme Videoaufnahme wird mit einem schnurgeraden Sägezahnton kombiniert, der, zumal eingebettet in ein Gewirr aus Beats, einem tiefen Posaunenton gar nicht unähnlich klingt, sich aber in seiner Starrheit doch recht schnell als synthetisch entpuppt. Das „An“ des Sägezahntons wird durch seine unmittelbare Verbindung mit dem „An“ (also dem Ansetzen und Angesetzthalten) des Posaunisten in einen scheinbaren kausalen Zusammenhang mit diesem und damit in die Nähe des kausalen Zusammenhangs von Badezimmerlampe und Radio aus der Eingangssequenz gerückt, doch er ist ein Fake – im Gegensatz zu demjenigen im Badezimmer, der jedoch viel schwächer wirkt, weil man das tatsächlich kausalitätserzeugende Element, nämlich den gemeinsamen Schalter von Lampe und Radio, nicht sieht – den spielenden Posaunisten dagegen schon. An einer Stelle im Stück wird der Sägezahnton vom spielenden Posaunisten abgetrennt, indem er stehenbleibt, während das Bild wechselt. Damit wird der gefakte Kausalzusammenhang zwar nicht eindeutig widerlegt, wohl aber abgeschwächt und vom Publikum möglicherweise auch rückwirkend anders bewertet.4 Der dröhnende Sägezahnton sowie ein vor allem am Anfang eingesetztes weißes Rauschen stellen unter den akustischen die beiden stärksten in einem, wie in der offizielle, umfangreichen Pool von Elementen dar, die in erster Linie in Hinblick auf die ihnen innewohnende Möglichkeit zum dualen Gegensatz „An“ und „Aus“ genutzt werden. Im Video werden, zusätzlich zu der oben beschriebenen audio-visuellen Horizontalverdichtung, verschiedene Verdichtungstechniken angewandt, bei denen teils nicht eindeutig zwischen 4 In dem grandiosen und zurecht mit Auszeichnungen überhäuften Film Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) des mexikanischen Regisseurs Alejandro González Iñárritu aus dem Jahr 2014 wird mit der Filmmusik gewissermaßen „umgekehrt“ verfahren: Über die gesamte Dauer des Films hört man immer wieder einen schweren, düsteren Schlagzeuggroove ohne die entsprechende visuelle Information, also im Sinne einer ganz „normalen“, vom Bild und Handlung entkoppelten Filmmusik „aus dem Off“ zur Erzeugung von Stimmungen und Atmosphären. An einigen wenigen Stellen im Film sieht man dann jedoch den Schlagzeuger selbst, jedes Mal mit seinem Drumset an einem anderen Ort sitzend und ohne jegliche Funktion in der eigentlichen Filmhandlung, ebenjenen Groove spielen und wird auf diese Weise gezwungen, die Filmmusik rückwirkend als ein direkt aus der Handlung entstammendes „Nebenprodukt“ zu bewerten, das im Zusammenhang seines dramaturgischen Ursprungs im Grunde komplett „unwichtig“ ist, durch die Ausbreitung des von jenem und somit von seiner visuellen Ebene entkoppelten klingenden Resultats auf die Dauer des gesamten Films allerdings zu einem ganz und gar unverzichtbaren und tragenden Element für das schlussendliche Gesamtkunstwerk emporgehoben wird. „horizontal“ und „vertikal“ unterschiedenen werden kann. So werden kurz vor Schluss in zwei getrennten Bildhälften der „inaktive“ Zustand des Chipsessens und der „aktive“ Zustand des Tanzes gleichzeitig gezeigt und so der eigentlich zeitlich-sequenzielle in einen auf räumlicher Anordnung basierenden Gegensatz umgewandelt: „Zum Raum wird hier die Zeit!“. 5 Auch gibt es, kombiniert mit einer eher ruhigen, weniger impulsiven und strukturkomplexen Musik, einen Abschnitt enorm schnell aufeinanderfolgender Videoschnitte, bei denen auch die Inhalte der beiden Bildhälften hinund herwechseln und Musiker aus dem Video heraus- und wieder hineingeschnitten werden. Plötzlich offenbart sich, dass auch die scheinbar unverfälschten, am Stück aufgenommenen Videosequenzen technischen Manipulationen unterzogen und so zu Bildabfolgen umgestaltet wurden, die in der Realität so keinesfalls möglich wären. Mehr noch: Die Grenze zwischen Musik und Bild wird brüchig, denn das Bild, in starker Übertreibung der oben beschriebenen Ton-BildSynchronizität, wird nun selbst zu einem rhythmisch-pulsierenden, quasi „musikalischen“ Part, der das Blockflötensolo wie ein dröhnender Beat unterlegt. An einer Stelle innerhalb dieses Abschnitts bin ich selber für den Bruchteil einer Sekunde zu sehen, wie ich im Rahmen des Videodrehs mit dem Posaunisten Jonas Lippert unter der Kölner Severinsbrücke rede. Dies ist weit mehr als ein kleiner Gag: Es bettet das gestellte Video in den lebenswirklichen Kontext seiner eigenen Produktionsgeschichte ein und zeigt, dass nicht nur die Kunstrezeption, sondern auch die Kunstproduktion ein Vorher, Nachher und Mittendrin hat, bei denen unzählige Grenzen zwischen Realität und Fiktion überschritten und manche auch ignoriert werden. Dieses kurze Videofragment ist quasi ein „Outtake“, das nicht im Anschluss an das Kunstwerk, sondern bereits im Kunstwerk gezeigt wird; ein kurzer Sprung vom Künstlichen ins Dokumentarische – oder besser: ins Indexikalische, denn es erfüllt in diesem Video exakt dieselbe Funktion wie die oben erwähnten Diederichsenschen „Index-Sounds“ in der vervielfältigbaren Aufnahme eines Pop-Songs. Schlussendlich kommt noch die Live-Elektronik zum Einsatz, in Gestalt der von Orm Finnendahl entwickelten Software „quo“. Im Grunde handelt es sich dabei um eine simple Programmiersprache, mit der sich Aufnahmen, Wiedergaben und eventuelle Verfremdungen exakt im zeitlichen Verlauf definieren und zugleich digitale graphische Partituren erzeugen lassen, die es den Ausführenden anhand eines fortlaufenden Cursors ermöglichen, jederzeit die aktuelle zeitliche Position abzulesen. Daher eignet sich das Programm vor allem für den Einsatz in Verbindung mit 5 Richard Wagner, Parsifal, 1. Aufzug. In eine etwas andere Richtung gehend, aber in diesem Zusammenhang dennoch sehr aufschlussreich sind auch die Ausführungen Žižeks zu raumgewordener Zeit und quasi-räumlicher Bewegung zwischen den Zeit-Zuständen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft in Literatur und Film (unter anderem „Was nicht gesagt werden kann, muss gezeigt werden“, in: Slavoj Žižek, Weniger als nichts, Seiten 39ff.). „Zustand“ ist hier durchaus vergleichbar zu meinem Gebrauch dieses Begriffs zu verstehen. Was meine Ausführungen zu Realität und Fiktion in Hinblick auf das Eminem-Sample angeht, könnte ich übrigens auf beinahe jede Seite von Žižeks Buch verweisen: Überall fände sich mindestens ein kluger Satz über Erscheinung, Schein und Maskierung sowie über Reales, Realität, Fiktion und deren Verschränkungen in- und nebeneinander. Gerade auch meine Ausführungen zur Rolle des Videos in meinem Stück simon & malte (unter 5.) sind stark von Žižeks Überlegungen beeinflusst. einem Clicktrack zur präzisen Synchronisation oder aber, sozusagen im Gegenteil, als unflexible, stabile „Rahmung“ von freier Improvisation. Ersteres ist in f*** bass f*** bass der Fall, wenngleich die Live-Elektronik nicht mit dem gesamten Ensemble, sondern fast ausschließlich mit der Sopranblockflöte interagiert. Das von quo aufgenommene Material beschränkt sich auf zweieinhalb Sekunden ganz zu Beginn, in denen die Streicher fünfmal laut schnipsen – eine singuläre Stelle in diesem Stück, die sich erst durch ihre Wiederkehr in der späteren liveelektronischen Zuspielung erschließt –, sowie ein paar weitere, schnipselartige Takes im weiteren Verlauf des Stücks. In dem Moment, in dem die Software beginnt, zunächst zaghaft, dann sehr rasch in großer Fülle verfremdete Samples wiederzugeben, setzt das gesamte Ensemble aus, mit Ausnahme der Blockflöte, die nun ihr virtuoses Solo beginnt. In diesem Abschnitt werden längere Teile aus dem bisherigen Verlauf des Stücks aufgegriffen und in Hinsicht auf Tonhöhen und Rhythmus sehr präzise wiederholt. Der Unterschied allerdings, der ein über einzelne Motive hinausgehendes, zusammenhängendes Wiedererkennen nahezu unmöglich macht, ist, dass die Blockflöte alle zentralen motivischen und rhythmischen Bewegungen der jeweiligen Abschnitte übernimmt, der Rest des Ensembles hingegen durch die Live-Elektronik und somit mit völlig anderem Soundmaterial Note für Note „nachgebaut“ und auf diese Weise gewissermaßen „gefakt“ wird. Dieser Fake erlangt sogar noch eine weitere, eher zufällige Dimension: Während der Proben zur Uraufführung mit dem Ensemble Garage stellte es sich aus verschiedenen Gründen als sinnvoll heraus, die Live-Elektronik nicht als echte „Live“-Elektronik einzusetzen, sondern unter Verwendung derselben Software eine zusätzliche Zuspieldatei vorzuproduzieren und diese im Konzert wiederzugeben. Das klingende Resultat ist also ein Produkt derselben technischen Abläufe, die ursprünglich in Echtzeit ablaufen sollten, nun aber bereits zu einer vorherigen Zeit an einem anderen Ort stattgefunden haben; das Audiomaterial ist nicht der hohe Akkord der Holzbläser und das Schnipsen der Streicher, sondern der Akkord stammt aus meinem E-Piano und das Schnipsen ist mein eigenes. Auf diese Weise ist diese kurze elektronische Musik weder echte „Zuspielung“ noch echte „Live-Elektronik“, sondern der Schein des originär Gegenwärtigen durch Mittel, die hinsichtlich ihrer Produktionsbedingungen in der (nahen, nicht historischen) Vergangenheit verortet sind.6 Am Schluss laufen alle Maschinerien aus, das Stück endet ausgedünnt, erschöpft und leise. 6 Ein Vergleich zu den Live-Video-Konzepten von Michael Beil, etwa exit to enter und vor allem swap, scheint da nicht abwegig, wird doch durch die Projektion von im vorherigen Verlauf des Stücks aufgenommenen Videosamples in Verbindung mit teilweise sogar komplett vorproduzierten, beim Hören aber durchaus als live-elektronisch wahrnehmbaren Audiozuspielungen der Schein von Gegenwärtigkeit erzeugt, nämlich in Form der scheinbaren Gegenwart zusätzlicher Musikerinnen, die in Wahrheit die virtuellen Verdopplungen der realen sind, innerhalb der Realität der Aufführungssituation. Tatsächlich aber ist alles, was dort wiedergegeben und projiziert wird, in der Vergangenheit entstanden – einerseits durch kontrollierbare Vorproduktion, anderseits durch die weitaus weniger kontrollierbare Live-Video-Maschinerie, die jede falsche Bewegung unbarmherzig wiederholt und somit vom Vergessenwerden im Nebel harmloser Fehltritte der Vergangenheit abhält.