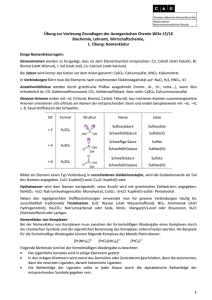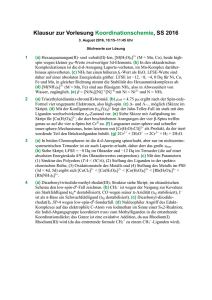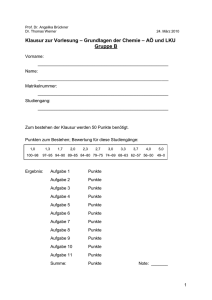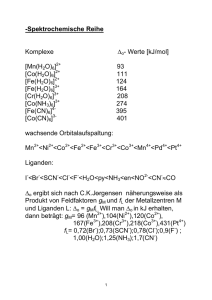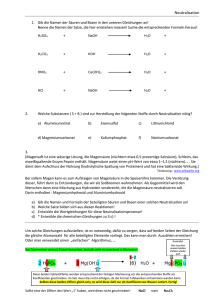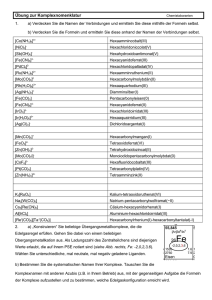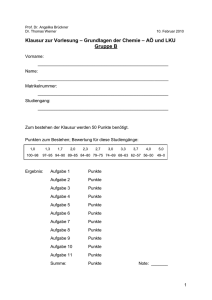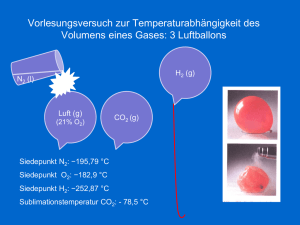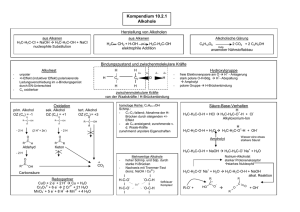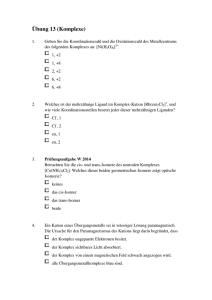Allgemeine Chemie 1 HS 2010 - Willem H. Koppenol
Werbung

Allgemeine Chemie 1 HS 2010 Grundlagen der Anorganischen Chemie Begleitliteratur: C.E. Mortimer, U. Müller Chemie 9. Auflage, Thieme Verlag, Stuttgart, 2007 Allgemeine Chemie 1 HS 2010 .................................................................................................. 1 Chemie ............................................................................................................................... 4 Frühgeschichte ................................................................................................................... 5 Antike und Mittelalter ........................................................................................................ 5 Frühe Neuzeit ..................................................................................................................... 5 Neuzeit ............................................................................................................................... 6 Die Auferstehung der Atomtheorie .................................................................................... 6 Im Atom drin ...................................................................................................................... 7 WYSIWYG – What you see is what you get ..................................................................... 8 Atomtheorie und Periodensystem ...................................................................................... 9 Stöchiometrie ................................................................................................................... 12 Stoffe – Valenzelektronen – Struktur ............................................................................... 14 Schalenbau – Konsequenzen: Aufbauprinzip und Elektronegativität .............................. 15 Chemischer Formalismus ................................................................................................. 17 Strukturformeln ................................................................................................................ 17 Lösungen .......................................................................................................................... 19 Der Lösungsprozess ......................................................................................................... 20 Lösung und Energie ......................................................................................................... 22 Der gelöste Zustand .......................................................................................................... 23 Konzentrationsbegriff....................................................................................................... 25 Konzentrationsabhängige Phänomene in der Chemie: Reaktionsraten............................ 26 Das chemische Gleichgewicht ......................................................................................... 27 Heterogene Gleichgewichte ............................................................................................. 29 Gekoppelte Gleichgewichte ............................................................................................. 30 Metathese-Reaktionen ...................................................................................................... 32 Löslichkeitsprodukt und Fällungsreaktionen ................................................................... 33 Säuren und Basen ............................................................................................................. 35 Säuren und Basen in Wasser ............................................................................................ 36 Säurestärke ....................................................................................................................... 37 Anorganische Arrhenius-Säuren und -Basen ................................................................... 39 Brønsted - Lowry Säuren und Basen................................................................................ 40 Lewis Säuren und Basen .................................................................................................. 41 Säure- und Basenstärke im Brønsted – Lowry Konzept als Funktion des molekularen Aufbaus ............................................................................................................................ 42 Arrhenius-Säuren und -Basen als Produkte der Hydrolyse von Oxiden ......................... 46 Quantitative Beschreibung von Säure-Base Reaktionen in Wasser ................................. 47 Anwendung der quantitativen Säure-Base Theorie: Titrationen ...................................... 49 Puffer ................................................................................................................................ 54 Säuren mit mehreren Dissoziationsstufen ........................................................................ 54 Hochverdünnte Säuren ..................................................................................................... 56 Nichtwässrige Lösungsmittel ........................................................................................... 56 Redoxreaktionen............................................................................................................... 57 Redoxreaktionen in wässriger Lösung ............................................................................. 60 Elektrochemie................................................................................................................... 64 Elektrolyse ........................................................................................................................ 65 Quantitative Elektrolysen ................................................................................................. 70 Galvanische Zellen ........................................................................................................... 72 Anwendung der Nernst-Gleichung................................................................................... 79 Konzentrationszellen ........................................................................................................ 80 Elektrolyse und Elektrodenpotential ................................................................................ 83 Kommerzielle galvanische Zellen .................................................................................... 84 Redox-Diagramme ........................................................................................................... 86 Werners Analysemethoden .............................................................................................. 89 Vorkommen von Metallkomplexen und Funktion ........................................................... 89 Bindungen in Komplexen................................................................................................. 90 Ligandfeld-Aufspaltung ................................................................................................... 93 Reaktionen von Komplexen ............................................................................................. 95 Komplexgleichgewichte ................................................................................................... 95 Spezielle Komplexformen ................................................................................................ 97 Lewis Säuren – Basen Affinität ..................................................................................... 100 Anhang: Komplex-Isomere ............................................................................................ 102 Chemische Reaktionen in Lösung .................................................................................. 103 Komplexe – noch einige Details .................................................................................... 111 Aktivität .......................................................................................................................... 115 Chemie Die heutige Chemie ist eine exakte Naturwissenschaft, in etwa die zweitexakteste nach der Physik, jedenfalls nach dem Selbstverständnis der Chemiker. Die Mathematik ist übrigens keine Naturwissenschaft, sondern eine Geisteswissenschaft. Es gibt zwar eine experimentelle Mathematik, doch werden die Versuche nicht an physischen Objekten, sondern an abstrakten Konstrukten in einem Computer durchgeführt. Die Chemie kann als eine stark ausgebaute Spezialdisziplin der Physik aufgefasst werden, nämlich die Beschäftigung mit den Elektronenhüllen der Atome und Moleküle, den kleinsten unmittelbaren Bausteinen wahrnehmbarer Materie. Sofern theoretische Betrachtungen im Vordergrund stehen, ist von den Grundkräften nur die elektromagnetische Wechselwirkung von Bedeutung. Praktische Laborarbeit wird hingegen auch von der Schwerkraft beeinflusst. Chemie ist also eine Beschäftigung mit Materie, und doch nicht Materialwissenschaft. Den Materialwissenschaftler interessiert der innere Aufbau seines Stoffs nur soweit, als er dadurch die gewünschten makroskopischen Eigenschaften erzielen oder verbessern kann. Er handelt also als Ingenieur. Der Chemiker will hingegen, wie der Physiker, Regeln und Prinzipien im Zusammenspiel der Materiebausteine entdecken und formulieren. Im Extremfall betreibt er „wertfreie“ (von Ökonomen oft als „wertlos“ gedeutete) Grundlagenforschung. Der Übergang zwischen reinem Machen und zweckfreiem Forschen ist in der Realität aber kontinuierlich. Manchmal (eher selten) ergibt sich beim Machen eine fundamentale Erkenntnis, ein Andermal (eher häufiger) findet man beim freien Forschen etwas Verwertbares. Der Grund dafür ist einfach: Der Macher ist auf sein Ziel fokussiert und sieht oft nicht, was nebenbei läuft, er hängt seiner Erwartung nach. Zudem wählt er kleine „sichere“ Schritte, weil er „Erfolg“ haben muss, macht also keine ausgefallenen oder mutigen Experimente, weil ihm dann der Geldhahn zugedreht wird. Ökonomischer Druck generiert i.a. nicht bessere Forschung, sondern aufwendigere. Chemiker wollen vor allem: Den inneren Aufbau von Materie verstehen, dies nennt man Strukturchemie, und die Umwandlung von einem Stoff zu einem andern zu modellieren, das nennt man Reaktionsdynamik. Um zu verstehen, warum wir heute Naturwissenschaften betreiben, muss man ihre Entstehungsgeschichte betrachten. Zu Beginn gab es keine Disziplinentrennung, wie wir sie gewohnt sind. Frühgeschichte Die bewusste handwerkliche Herstellung und Umwandlung von Stoffen betreibt der Mensch schon seit prähistorischer Zeit. Beispiele dafür sind die Reduktion von Metallerzen in Bronzeund Eisenzeit, Umwandlung von Mineralfarben, das Brennen von Ton und mehr. Dies wurde nach Erfahrungsrezepten getan, die in der Familie weiter gegeben wurden. Die Hintergründe der Umwandlungen wurden nicht gesucht. Antike und Mittelalter Auf der andern Seite versuchten schon in der Antike (vielleicht auch früher) Philosophen, das Wesen der materiellen Existenz zu ergründen. Diese Denker brachten zwei fundamental verschiedene Theorien zum Aufbau der Materie hervor: (1) Der Aufbau kommt durch die variable Mischung von Grundprinzipien (meist 4) zustande. (2) Der Aufbau enthält kleinste Grundeinheiten. Für jeden Stoff gibt es eine charakteristische Einheit. Die erste Theorie fand zunächst mehr Anhänger, genannt Alchemisten (von arab. al-khimia, das vermutlich selbst wieder vom griech. chymeia oder ägypt. kemet stammt). Diese versuchten, die bekannten Umwandlungen im Rahmen dieser Theorie zu verbessern und erweitern, um schliesslich wertvolle Materialien wie Gold oder Heilmittel aus einfachem Ausgangsmaterial herzustellen. Die Erlangung dieser Fähigkeit sollte mit einer spirituellen Wandlung und einem Gewinn an Weisheit des Alchemisten einhergehen. Das scheiterte prinzipiell, doch hat diese Zeit einige unerwartete Entdeckungen neuer Materialien gebracht, z.B. des Phosphors. Die Laboratoriumstechnik entstand durch die Alchemie, weil Reaktionsgefässe für spezielle oder extreme Bedingungen entwickelt werden mussten. Methoden wie die Destillation und Kristallisation wurden perfektioniert. Frühe Neuzeit Nach Ende des Mittelalters begannen einige Naturphilosophen mit der quantitativen Untersuchung der Natur. Der erste Gegenstand waren makroskopische Bewegungsvorgänge: So stellte Galileo Galilei zur Verwunderung seiner Zeitgenossen fest, dass der Fall eine 5 beschleunigte und nicht etwa eine kontinuierliche Bewegung ist. Johannes Kepler erklärte die Planetenbahnen durch ein viel simpleres Modell als die antiken Himmelsbeobachter, gestützt auf die präzisen Messungen von Tycho Brahe. Der irische Naturphilosoph Robert Boyle erkannte den Zusammenhang von Druck und Volumen bei Gasen. Boyle ist auch der Autor von „The Sceptical Chymist“. Darin betonte er die Unverzichtbarkeit von Experimenten zur Begründung wissenschaftlicher Theorien. Die frühen Physiker waren demnach Initiatoren des empirischen Denkens. Neuzeit Die stofforientierten Philosophen folgten Ende 18. Jh. durch die Untersuchungen von Antoine Lavoisier und seiner Frau Marie, die zeigten, dass bei Stoffumwandlungen keine Masse entsteht oder verschwindet. Sie studierten Verbrennungsprozesse, wobei sie als erste die Massen der Gas-Umsätze bestimmten. Die Lavoisiers kamen zum Schluss, dass eine Komponente der Luft, die sie „Oxygenium“ nannten, bei allen Verbrennungsprozessen beteiligt sein musste, und zwar als Reaktionspartner. Damit war die bisher favorisierte Theorie, die einen entweichenden „Feuerstoff“ vorsah, das so genannte Phlogiston, widerlegt. Typisch für die neue Arbeitsweise war, dass sich die Lavoisiers für die damalige Zeit extrem genaue Waagen und volumetrische Gefässe anfertigen liessen. Eine weitere Grosstat war der Nachweis, dass Wasser die Verbindung zweier Gase, nämlich Wasserstoff und Sauerstoff, ist. Damit waren die Systeme mit kleiner Zahl Elemente nicht mehr haltbar. Wasser ist unter der neuen Sichtweise eine Verbindung, kein Element, und das Feuer ist kein Stoff, sondern eine Begleiterscheinung des Reaktionsvorgangs. Es war von nun an klar, dass Elemente nur materiell sein konnten. Die Auferstehung der Atomtheorie Der innere Aufbau von Materie war damit immer noch nicht erschlossen, doch der Franzose Joseph-Louis Proust und der Engländer John Dalton taten bald den nächsten Schritt. Proust fand heraus, dass Stoffe, die er durch Destillieren und Kristallisieren nicht weiter reinigen konnte, bei der chemischen Zerlegung in die Elemente diese immer in konstanten Verhältnissen lieferte. Dalton ging noch weiter und formulierte das Gesetz der multiplen festen Proportionen für die Reaktionsprodukte von Elementen, d.h. ganzzahlige Vielfache einer Grundmenge reagieren miteinander. Er stellte fest, das sich dies zwanglos mit dem atomistischen Modell der antiken Philosophen erklären liess: Der Begriff der Stöchiometrie 6 entstand. Atome waren die Grundbestandteile der Elemente, und man konnte sie miteinander verbinden. Dalton stellte auch eine erste Tabelle der relativen Elementmassen auf, indem er willkürlich Wasserstoff die Masse 1 zuordnete (heute ordnen wir 12C die Masse 12 zu). Daltons Feststellungen: 1. Jedes Element besteht aus kleinsten, nicht weiter teilbaren Teilchen, den Atomen. 2. Alle Atome eines Elements haben die gleiche Größe und die gleiche Masse. Die Atome unterschiedlicher Elemente unterscheiden sich in ihrer Masse. 3. Atome sind unzerstörbar. Sie können durch chemische Vorgänge weder vernichtet noch erzeugt werden. 4. Bei chemischen Reaktionen werden die Atome der Ausgangsstoffe neu angeordnet und in bestimmten Anzahlverhältnissen miteinander verknüpft. Im Atom drin Die nächste Frage war dann die nach der Natur der Atome und den Regeln, nach denen sie Verbindungen eingehen. Zuerst stellte man sich Atome als Kugeln vor, wusste aber nicht, wodurch die unterschiedlichen Eigenschaften der Elemente begründet waren. Die Physiker hatten inzwischen gezeigt, dass man im Vakuum aus Materie geladene Teilchen, die Elektronen genannt wurden, durch elektrische Spannung herausholen konnte, und dass entgegengesetzt geladene Materie zurückblieb. Damit wurde vermutet, dass Atome zwei Komponenten enthalten, eben Elektronen, und noch einen Stoff mit der Gegenladung. Dessen Struktur blieb unklar bis zum genialen Experiment des Neuseeländers Ernest Rutherford, der die Bahnen von α-Teilchen durch eine Goldfolie bestimmte. Er wusste, dass α-Teilchen die entgegengesetzte Ladungsart zu Elektronen trugen, also dieselbe wie der Grundstoff der Atome. Die α-Teilchen wurden beim Durchtritt durch die Folie meistens gar nicht abgelenkt, wenn aber doch, dann sehr stark. Das lässt sich nur so deuten, dass die Ladungen des Grundstoffs sich in sehr stark konzentrierten Zentren befinden und dazwischen viel Raum liegt, der den fast körperlosen Elektronen zur Verfügung steht. Das Atommodell mit Kern und Hülle war geboren. Diese Anordnung produziert ein Katastrophenszenario im Rahmen der klassischen Physik: Wenn die Elektronen zwischen den Kernen sich bewegten, dann müssten sie das auch in Kurven, d.h. beschleunigten Bewegungen. Beschleunigte Ladungsträger strahlen aber elektromagnetische Energie ab, werden also gebremst. Damit müssten die Elektronen in die Kerne fallen und die Atome kollabieren. Würden die Elektronen ruhen, 7 wäre das eine äusserst delikate labile Situation, die durch die kleinste Störung ebenfalls zum Zusammenbruch führen würde. Diese Ungereimtheit war neben andern Beobachtungen der Anstoss für die Entwicklung der Quantenmechanik. Mit deren Ansatz ergibt sich ein Atommodell, das für die Elektronen der Hülle nur bestimmte Zustände zulässt, deren Energien fixiert sind, solange die Elektronen nicht gestört werden. Nur beim Wechsel zwischen Zuständen wird elektromagnetische Energie ausgetauscht. Anfänglich stellte man sich die Zustände als Bahnen in bestimmten Abständen um den Kern vor. Die Ablenkung eines externen Elektronenstrahls an Elektronenhüllen legt jedoch nahe, dass es sich eher um eine Wahrscheinlichkeitsverteilung handelt. Nahe am Kern sind Elektronen eher anzutreffen als weiter entfernt. Der Österreicher Erwin Schrödinger entwickelte dazu eine mathematische Beschreibung, die den Zustand der Elektronenhülle als stehende Welle mit abnehmender Amplitude bei zunehmendem Abstand vom Kern behandelt. Diese Zustandsfunktion lässt sich näherungsweise in ein Produkt aus Teilfunktionen, die man einzelnen Elektronenzuständen zuordnet, zerlegen. Die Teilfunktionen nennt man Orbitale. Das ist das heute noch übliche „state-of-the-art“ Modell. Es sei nicht verschwiegen, dass es alternative mathematische Atombeschreibungen gibt, die das Verhalten genauso gut erfassen wie das SchrödingerModell. Sie sind aber unter Chemikern nicht gebräuchlich. WYSIWYG – What you see is what you get Hier lohnt es sich, kurz innezuhalten und Bescheidenheit zu üben. Der Mensch, insbesondere der moderne homo multimedialis ist ein Augentierchen, das unbedingt getäuscht werden will. Wer vermutet, dass wir nach den vorgehenden Ausführungen Atome „gesehen“ oder gar in sie „hineingeschaut“ haben, der irrt. Wir haben, kriminalistisch gesehen, nur eine einigermassen lückenlose Indizienkette, auf die wir unsere Modelle aufbauen. Dennoch werden nun bunte Bilder von Orbitalen gemalt und ernsthaft über ihre „Form“ und „Vorzugsrichtungen“ und ähnliches diskutiert (nicht von Physikern, deshalb ist Chemie auch nur die zweitexakteste Naturwissenschaft). Es gibt keine Orbitale Es gibt erst recht keine leeren Orbitale Es gibt Orbitalfunktionen. Diese enthalten aber keine Elektronen, sondern beschreiben nur in etwa deren Zustand. Wir können mit Schrödingers Werkzeug zu diesen Funktionen Energien bestimmen, die man dann den Elektronen des entsprechenden Zustands zuordnet. Die Parameter für ein Elektron im Orbitalmodell sind dieselben wie für das naive Bahnmodell: 8 Hauptquantenzahl n, Drehimpulsquantenzahl l, Magnetquantenzahl m und Spinquantenzahl s. Orbitale erklären entgegen verbreiteter Meinung auch nicht die Ausrichtung der Bindungen eines Atoms. Aus einem Satz Lösungsfunktionen des Schrödinger-Modells kann man durch lineare Kombination dieser Lösungen beliebige weitere gültige Lösungen generieren. Wenn Sie die Bilder des d xy -Orbitals und des d z 2 -Orbitals in einem Chemiebuch vergleichen, so suggeriert Ihnen das vielleicht unterschiedliche Eigenschaften der damit assoziierten Elektronen. Das ist aber nicht so, diese Orbitale sind mathematisch aequivalent. Die Bilder stellen sowieso nur einen Teil der gesamten Orbitalfunktion dar. Eigentlich ist jede Orbitalfunktion das Produkt einer radialen Funktion und einer drehwinkelabhängigen Funktion. Die Abbildungen repräsentieren entweder Flächen, auf denen der winkelabhängige Teil oder das Quadrat des winkelabhängigen Teils einen bestimmten Wert haben. Die radialen Teile werden nicht gezeigt, sie sind immer kugelsymmetrisch. Aber wir können doch heute mit dem Rasterkraftmikroskop Atome sehen! Können wir nicht. Genauso wenig, wie die Auswertung des Röntgenbeugungsmusters eines Kristalls ein Foto dessen Gitters ist. Wenn man den Abtastvorgang im Rasterkraftmikroskop näher betrachtet, erkennt man auch nur die Deutung eines Messergebnisses, das mit dem makroskopischen Sehvorgang wenig zu tun hat. Als Messung kommt noch das Elektronenmikroskop am nächsten an den Sehvorgang heran. Der Mehrwert des Orbitalmodells liegt in der korrekten Beschreibung, dass die Elektronenverteilung eines Atoms eine Wahrscheinlichkeitsdichte ist, und dass die spektralen Eigenschaften richtig wiedergegeben werden. Atomtheorie und Periodensystem Dalton hatte formuliert, dass sich Atom-Arten und damit Elemente durch ihre Masse unterscheiden. Andere Chemiker hatten bemerkt, dass sich die Elemente nach ihrem chemischen Verhalten gruppieren lassen. Ohne Kenntnis des innern Aufbaus begannen sie, Ordnungsschemata aus den Verbindungstypen, die die Elemente eingingen, abzuleiten. Der Erfolgreichste war der Russe Dmitri Mendeleev, dessen Schema heute noch benutzt wird. Der Trick bestand darin, die Elemente nach Atommasse aufzureihen und zu sehen, an welchen Stellen sich die Eigenschaften wiederholten. Wenn man an diesen Stellen die Zeile umbrach, ergaben sich vertikale Reihen von Elementen mit ähnlicher Chemie, so genannte Gruppen. Mendeleev konnte noch nicht alle Elemente kennen, doch er war so kühn, für die Lücken in seinem System unentdeckte Elemente zu postulieren und aufgrund der Periodizität ihre Eigenschaften vorherzusagen. Wie wir wissen, war das erfolgreich und hat die Forschung beflügelt. 9 Rutherford hatte schon bemerkt, dass die Zahl der Elementarladungen des von ihm gefundenen Atomkerns oft etwa im Verhältnis 1:2 zur relativen Atommasse stand. Der Niederländer Antonius van den Broek fand, dass im Periodensystem geordnet nach dieser Kernladungszahl statt der Masse einige Ungereimtheiten bei schweren Elementen verschwanden. Nachdem der Engländer Henry Moseley Kernladungszahlen mittels Ionisation durch Röntgenstrahlung genau bestimmt hatte, war klar, dass van den Broeks Ordnungszahl die Situation korrekt beschreibt. Aufgrund der Quantenzahlen der Atome, die ihr Austauschverhalten mit elektromagnetischer Energie (Licht, Röntgenstrahlen) korrekt beschrieben, konnte man die Periodizität mit der energetischen Quantisierung im Atom erklären: n l m 1 0 0 2 0, 1 -1, 0, 1 3 0, 1, 2 -2, -1, 0, 1, 2 etc. Die erste Periode kann demnach 2 Elemente enthalten, die zweite 2 + 2 · 3 = 8, die dritte 2 + 2 · 3 + 2 · 5 = 18 etc. weil je 2 Elektronen mit Spinquantenzahl +½ und –½ die Basiszustände innehaben können. Zustände mit l = 0 nennt man s, mit l = 1 heissen sie p, l = 2 wird durch d und l = 3 durch f symbolisiert. Höhere Nebenquantenzahlen haben praktisch keine Bedeutung. Die Buchstabenkürzel stammen aus der Spektroskopie, der Methode, mit der die Quantisierung bestätigt wurde. Ein Besetzungsschema kann so geschrieben werden: Hauptquantenzahl, dann Drehimpuls-Symbol mit hochgestellter Elektronenzahl für diesen Zustand: Atom-Beispiel Schema H 1s1 Li 1s22s1 abgekürzt [He] 2s1 C 1s22s22p2 abgekürzt [He] 2s22p2 Ne 1s22s22p6 abgekürzt [Ne] Mg 1s22s22p63s2 abgekürzt [Ne] 3s2 K 1s22s22p63s23p64s1 abgekürzt [Ar] 3s1 Th 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65d106s26p66d27s2 ; [Rn] 6d27s2 10 Interessant hier ist bei Kalium K, dass 4s vor 3d besetzt wird. Dazu später. Elemente am Ende einer Periode, bei denen alle für die entsprechende Hauptquantenzahl möglichen Zustände mit Elektronen besetzt sind, sind chemisch sehr reaktionsträge. Sie sind die Einzigen, die in der Natur nur als freie Atome vorkommen und werden auch Edelgase genannt. Die Füllreihe für eine Hauptquantenzahl vom Beginn der Periode bis zum Edelgas nennt man auch Schale. Die Elektronen der Schale mit der höchsten Hauptquantenzahl nennt man auch Valenzelektronen, weil nur sie die chemische Reaktivität ausmachen. Wir werden in unseren weiteren Ausführungen nur diese Elektronen betrachten. Die relativen Massen im Periodensystem sind nicht genau ganzzahlig. Die Atomkerne selbst sind aus 2 Teilchenarten, den Protonen und Neutronen aufgebaut. Die elektrische Ladung und damit die Ordnungszahl wird nur durch die Protonenzahl bestimmt. Die Zahl der Neutronen ist etwa gleich gross wie die der Protonen, kann aber in einem engen Bereich variieren. Da die Masse der Neutronen etwa gleich der der Protonen ist, gibt es chemisch aequivalente Atome mit leicht unterschiedlicher Masse, so genannte Isotope. Viele Elemente sind aus mehreren Isotopen zu unterschiedlichen Anteilen zusammengesetzt, somit ergeben sich nicht ganzzahlige Durchschnittsmassen. Dies erklärt auch die Irregularitäten, wenn man das Periodensystem nach relativen Atommassen statt nach Kernladungszahl ordnet. Periodensystem der IUPAC (2005) 11 Stöchiometrie Eine Konsequenz der relativen Atommasse ist, dass gleiche gewogene Massen verschiedener Elemente nicht gleich viele Atome enthalten. Die Erkenntnisse der Lavoisiers, Prousts und Daltons besagen aber, dass Atome in ganzzahligen Verhältnissen Verbindungen bilden. Es drängte sich also auf, ein Zählmass für Stoffmengen anstelle der Stoffmasse zu etablieren. Der Pionier hier war der Italiener Amedeo Avogadro. Er stellte fest, dass die Massen gleicher Volumina zweier Gase im selben Verhältnis zueinander standen wie ihre relativen molekularen Massen, die sich aus den Atommassen zusammensetzen. Daraus folgt, dass die beiden Volumina gleich viele molekulare Teilchen enthalten mussten. Avogadro war auch der erste, der strikt die molekularen Verbindungseinheiten von den atomaren Bausteinen unterschied. Leider dauerte es fast 100 Jahre, bis sich seine Erkenntnisse breit durchsetzten. In der Zwischenzeit hatte der österreichische Physiker Josef Loschmidt die mittlere Grösse eines Gasmoleküls der Luft geschätzt. Damit konnte man zusammen mit Avogadros Gesetz die Zahl der Moleküle in einer der relativen Atommasse numerisch entsprechenden Masse des Stoffs ausrechnen. Diese Zahl wird heute Mol genannt und wurde immer genauer bestimmt. Eine wesentliche Konsequenz der Einführung des Zählmasses ist, dass wir schreiben können: 2 H2 + O2 → 2 H2O und meinen damit, dass 2 Moleküle Wasserstoff zusammen mit einem Molekül Sauerstoff 2 Moleküle Wasser bilden, was formal korrekt ist, aber so nicht abläuft (dazu siehe später). Es besagt aber auch, dass gelten muss 2 M H 2 M O2 2 M H 2O Wir müssen nur die Umrechnungsfaktoren M, die Masse jeweils eines Mols eines Stoffs, kennen, um Voraussagen über zu erwartende Masseumsätze machen zu können. Wie stellt man eine stöchiometrische Reaktionsgleichung auf? Dazu muss man zuerst wissen, was die Produkte sind (die Ausgangsstoffe, auch Edukte genannt, sollte man kennen). Gibt man Flusssäure HF zu Calciumcarbonat CaCO3, so entstehen Calciumfluorid CaF2 und Kohlendioxid CO2 sowie Wasser H2O. HF + CaCO3 → CaF2 + CO2 + H2O Auf der Produktseite stimmt die Zahl der F und H nicht mit der Eduktseite überein. Deshalb müssen wir zu 12 2 HF + CaCO3 → CaF2 + CO2 + H2O korrigieren. Damit verschwinden und entstehen keine Atome auf dem Weg von den Edukten zu den Produkten. Ausserdem besagt die stöchiometrisch korrekte Gleichung, dass ich zum vollständigen Umsetzen von z.B. 0.05 mol CaCO3 0.1 mol HF brauchen werde. Eine andere Frage wäre, wie viele Liter O2 man zur vollständigen Verbrennung von 1 Liter Benzin braucht. Benzin ist eine Mischung von so genannten Kohlenwasserstoffen und hat ungefähr eine Dichte vom 700g/Liter. Als reiner Kohlenwasserstoff kommt dem das Octan, C8H18 mit einer Dichte von 703 g/Liter bei 25°C sehr nahe. Wir können also exemplarisch 1 Liter, d.h. 703 g Octan, ganz verbrennen. Also C8H18 + O2 → 2 C8H18 + 25 O2 CO2 + H2O → wird stöchiometrisch richtig 16 CO2 + 18 H2O Pro Mol Octan werden 12.5 Mol O2 benötigt. Die Molmasse von Octan berechnet sich zu MOctan = 8·12 g/mol + 18·1 g/mol = 114 g/mol (mit genäherten Massen). Wir haben deshalb n Octan = m Octan 703g mol Mole an Octan, also 6.17 mol Octan zu verbrennen, was 12.5 mal 114 g M Octan mehr Mole O2 benötigt, nämlich 77.08 mol. Unter der Annahme, dass für O2 das ideale Gasgesetz pV nRT gilt, ist dann V nRT . Mit R = 8.314 JK-1mol-1, T = 298 K und p p = 101.3 kPa erhält man V = 1.89 m3 = 1890 Liter O2-Gas. Das ist schon beeindruckend. Ein Beispiel für komplexe Stöchiometrie ist die Thermit-Reaktion, bei der Aluminium Al das Eisenoxid Fe3O4 zu Fe umsetzt und selbst zu Aluminiumoxid Al2O3 wird. Al + Fe3O4 → 8 Al + 3 Fe3O4 Al2O3 + Fe → daraus wird 4 Al2O3 + 9 Fe 13 Stoffe – Valenzelektronen – Struktur Chemiker teilen Materie, die ihnen in die Hände gerät, in verschiedene Kategorien ein: Gemische o Heterogene Gemische (Mischung auf makroskopischer Ebene) o Homogene Gemische (Mischung auf molekularer Ebene, Beispiel: Lösung) Reine Stoffe o Verbindungen o Elementare Verbindungen (z.B. Cl2) o Atomare Elemente (z.B. Edelgase) Heterogene Gemische können Komponenten in verschiedenen Aggregatzuständen (flüssig, fest, gasförmig) enthalten. Homogene Gemische und reine Substanzen können auch simultan in mehreren Aggregatzuständen vorliegen, man spricht dann von Phasen des jeweiligen Aggregatzustands (Beispiel: In Wasser schwimmendes Eis mit Wasserdampf darüber). Reine Stoffe lassen sich grob in 3 Kategorien einteilen: Molekulare Substanzen o Eine relativ geringe Anzahl Atome ist fest miteinander über untereinander geteilte Valenzelektronen verbunden. Diese Bindung nennt man kovalent. Die Moleküle wiederum bilden mehr oder weniger feste Verbunde als weiche Festkörper, Flüssigkeiten oder Gase. Beispiele: Wasser, Ammoniak, Glucose, Octan, Kohlendioxid Salze o Valenzelektronen sind praktisch vollständig von einer Atom- oder Molekülart auf den Bindungspartner übergegangen. Es herrschen grosse elektrische Potentiale zwischen den Komponenten, Kationen (Elektronenverlust, positiv geladen) und Anionen (Elektronengewinn, negativ geladen). Die starken 14 elektrostatischen Kräfte sorgen dafür, dass der Stoff meist fest oder höchstens flüssig ist. Beisiele: Natriumchlorid (Kochsalz), Titandioxid, Kaliumacetat Metalle o Ein Teil oder auch alle Valenzelektronen sind von den Atomen gelöst und bewegen sich einigermassen frei zwischen den verbliebenen Kationen. Diese werden durch die bewegliche Ladungswolke ziemlich fest zusammengehalten. Solche Stoffe sind meist fest oder auch flüssig. Durch die beweglichen Elektronen leiten Metalle Wärme und elektrischen Strom. Beispiele: Eisen, Quecksilber, Natrium Selbstverständlich gibt es Grenzfälle und Mischformen. Salze, bei denen die Elektronen nicht so vollständig zwischen Kation und Anion ausgetauscht sind, haben einen gewissen kovalenten Anteil. Ebenso existieren Salze mit Metallcharakter, bei denen einige Elektronen nicht auf das Anion übergehen, sondern sich frei im Kristall bewegen. Ein Salz muss nicht notwendigerweise aus ionisierten Atomen bestehen, es kann sich auch aus geladenen molekularen Gruppierungen zusammensetzen, die in sich kovalent gebunden sind. Beispiel: Ammoniumnitrat. Schalenbau – Konsequenzen: Aufbauprinzip und Elektronegativität Metalle sind Elemente, deren Atome die Valenzelektronen eher schlecht binden. Sie sind im Periodensystem auf der linken Seite konzentriert. Der Grund dafür ist die gute Abschirmung der Kernladung durch die tiefer liegende Elektronenschalen bei Beginn einer neuen Schale. Mit steigender Kernladung in der Periode wird die Wirkung der Kernladung auf derselben Schale grösser, die Elektronen werden fester gebunden. Erst durch den Übergang zur nächsten Hauptquantenzahl vergrössert sich der mittlere Abstand der äusseren Elektronen zum Kern wieder so, dass die Abschirmung grösser wird. Eine Durchmischung der Schalen tritt allerdings ab der 3. Periode auf. Die 3d-Orbitalfunktionen sind besser abgeschirmt vom Kern als die 4s-Funktion, weil ihre grösste Elektronendichte relativ weit vom Kern liegt, während s-Funktionen immer eine hohe Dichte in Kernnähe aufweisen. Deshalb gehen 2 Valenzelektronen zuerst in den 4s-Zustand, bevor 3d-Zustände auftreten. Die Elemente mit Auffüllung der 3d-Zustände gehören deshalb zur 4. Periode, die mit 4d-Zuständen zur 5. 15 Periode etc. Für ein Atom mit nur einem Elektron (H, He+, Li2+ etc.) gilt allerdings das ideale Orbitalschema, weil es in einem solchen Atom keine Elektron-Elektron Abstossung gibt. Das lässt sich durch Anregung solcher Atome mit Licht (Spektroskopie) verifizieren, Die abnehmende Abschirmung nach rechts im Periodensystem hat auch zur Folge, dass die Elektronen von Bindungspartnern stärker gebunden werden. Damit wird die kovalente Bindung unsymmetrisch, ein statischer elektrischer Dipol entsteht: qd , wobei q der Betrag der partiellen Ladung auf den Enden des Dipols ist und d der Abstand, hier gerichtet als Vektor. q q d Diese Art Moleküle trägt immer ein kleines elektrisches Feld mit sich, das die gegenseitige Anziehung verstärkt. Stoffe dieser Art nennt man in der Chemie polar. Die Teilladungen q+ und q- sind stets kleiner als die Elementarladung, welche das kleinste freie Ladungsquant repräsentiert, und eine Eigenschaft der Elektronen und Protonen (Wasserstoff-Kerne) ist. Die Eigenschaft, Partnerelektronen stark zu binden, wird semiquantitativ durch die so genannte Elektronegativität beschrieben. Es gibt davon 5 Definitionen, gebräuchlich ist die des Amerikaners Linus Pauling, der ein fundamentales Werk der Chemie verfasst hat: The Nature of the Chemical Bond. Obwohl 1939 erschienen, ist es immer noch aktuell! Das Paulingsche Mass wird aus der Differenz von Bindungsenergien zweier Atomarten A und B bestimmt, wofür man die Dissoziationsenergien von A-B, A-A und B-B in die Atome misst. Als Referenzelement dient das Fluor, das am stärksten elektronenziehende Element, dem willkürlich der Wert 3.98 zugeordnet wird. In Molekülen, die mehr als zwei Atome enthalten, kann man das gesamte Dipolmoment durch Vektor-Addition der Bindungsdipolmomente der verbundenen atomaren Nachbarn darstellen. Das führt dazu, dass z.B. das gesamte Dipolmoment von BF3 gleich Null ist, weil die Fluoratome ein gleichseitiges Dreieck um das Bor bilden. Die Bindungsdipole sind stark, die EN von F ist 3.98, während Bor nur den Wert 2.04 aufweist. NH3 hingegen hat ein Netto-Dipolmoment, weil das N nicht in der Ebene der 3 H liegt. Der Grund für die andersartige Geometrie sind nicht gebundene Elektronen in der Valenzschale des N. 16 Chemischer Formalismus Die Elemente einer Verbindung werden in Formeln durch die im Periodensystem zugeordneten Abkürzungen repräsentiert. Die Anzahl der Atome einer Art wird durch einen nach und tief gestellten Index angegeben. Bei Salzen und metallischen Verbindungen gibt man die kleinste Einheit mit ganzzahligen Verhältnissen an, da sich diese Fragmente im Kristallgitter fortwährend wiederholen. Bei molekularen Verbindungen baut man etwas lokale Strukturinformation ein. Beispiel: Wasserstoffperoxid kann man stöchiometrisch als HO angeben, also eine Verbindung aus gleichviel Wasserstoff und Sauerstoff. In einem Wasserstoffperoxid-Molekül sind jedoch 2 Wasserstoffatome mit 2 Sauerstoffatomen verbunden, deshalb schreibt man H2O2. Man kann auch HOOH angeben, was die Lage der Bindungen zwischen den Atomen verdeutlicht. Die Brutto- oder Summenformeln sind nützlich, um aus den relativen Atommassen bequem die relative Molekülmasse zu berechnen, oder um einen Überblick über die Zusammensetzung zu bekommen. Strukturformeln Um die tatsächlichen Verhältnisse in einem Molekül oder Kristall genauer zu beschreiben, brauchen wir jedoch Strukturformeln. Dafür gibt es einfache Modelle, bei denen die Valenzelektronen durch Punkte und Striche symbolisiert werden, oder komplexe, die Orbtitaldiagramme verwenden. Wasser, brutto H2O, sieht dann so aus: H O H Die zwei Striche repräsentieren je ein Paar Elektronen die zwischen H und O geteilt werden. Jedes H steuert ein Elektron bei (mehr kann es nicht bieten), das O 2 Stück von den 6, die es besitzt (laut Ordnungszahl). Die Bindungselektronen gehören immer zu beiden Partneratomen. Also haben die beiden H nun 2 Elektronen, der Sauerstoff 8. Das ist die jeweilige maximale Elektronenzahl für die Hauptquantenzahl ihrer Valenzschalen. Beide Atomarten haben so die Elektronenkonfiguration ihres zugehörigen Edelgases, H die von He und O die von Ne. Dieser Zustand wird angestrebt, weil er die elektrostatische Energie für die Valenzschalen minimiert. Für Atome der zweiten Periode ist dies immer erfüllt, wenn sie 8 Elektronen in der Valenzschale tragen, man nennt dies auch Oktettregel. Für Wasserstoff mit seiner MiniSchale ist es eine Duett-Regel. Ab der dritten Periode wird es kompliziert, weil die Schalen zu mischen beginnen. Es bleibt noch die kleine Frage, warum das H2O oben gewinkelt abgebildet wird und nicht etwa linear. Die Antwort liegt bei den 4 Elektronen des O, die nicht 17 für die Bindung verwendet wurden. Wohin damit? Elektronen stossen sich gegenseitig ab, so sehr sie sich auch vom Kern angezogen fühlen. Damit wandert wegen der Elektronendichte zwischen O und H, den Bindungen, die sich gegenseitig abstossen, Elektronenladungsdichte der Valenzschale des O möglichst weit davon weg. Elektronen bleiben dabei gepaart im nahezu gleichen Quantenzustand, sie unterscheiden sich nur durch ihre Spinquantenzahlen von + ½ und – ½. Diese Paare verhalten sich ähnlich wie Bindungen und stossen sich auch gegenseitig ab. Damit sich alle 4 Elektronenpaare möglichst weit voneinander entfernen und so die elektrostatische Abstossung minimieren, bildet sich ungefähr die Geometrie eines : : Tetraeders aus, wobei an 2 Ecken H sitzen und an den beiden andern ungebundene O Elektronenpaare. Man symbolisiert das einfach als H H wobei die Punkte die O ungebundenen Elektronen darstellen, oder pseudo-dreidimensional H Hier werden H die ungebundenen Elektronenpaare durch die Bindungsstriche ohne Atom repräsentiert. Die Geometrie erklärt denn auch zusammen mit den Elektronegativitätsdifferenzen, warum H2O eine polare Substanz ist. Beispiele mit komplexeren Bindungsverhältnissen: Nitrit NO2−: N hat 5 Valenzelektronen (VE), jedes O hat 6. Dazu kommt ein extra Elektron wegen der negativen Ladung, total 18 VE. O O O O N N Die negative Ladung ist aufgrund der 2 gleichwertigen Formeln auf beide O gleichmässig verteilt. Die ungebundenen Valenzelektronen am N sorgen dafür, dass es gewinkelt ist. Ein Dipolmoment hat es hingegen nicht: Geladene Moleküle (= Ionen) haben kein Dipolmoment, sondern einfach eine Ladung. Mit einem weiteren O gelangt man zum Nitrat, das dann kein ungebundenes Elektronenpaar am N besitzt. O O + O O + O O + N N N O O O Die Repräsentation von Elektronen durch Punkte und von gepaarten Elektronen durch Striche ist die Notation nach Lewis. Die Ableitung der räumlichen Molekülstruktur aus der gegenseitigen Abstossung der Bindungselektronen und der ungebundenen Elektronen heisst 18 VSEPR-Modell (valence shell electron pair repulsion). Bisher haben wir Moleküle bzw. Ionen betrachtet, die Elemente der 1. und 2. Periode enthalten und die Oktettregel erfüllen. Beim Übergang zur 3. Periode können auch Bindungen aufgrund der Besetzung von d-Zuständen gebildet werden, z.B. im Sulfat: O O S O O Der Schwefel hat hier 10 Valenzelektronen, der Sauerstoff jedoch 8, wie es strikt für die 2. Periode gilt. Interessant ist, dass d-Zustände in einem Molekül schon in der 3. Periode besetzt werden können, in den freien Atomen aber nicht. Elemente können auch weniger als 8 Valenzelektronen tragen. Eine Variante ist der Verlust aller Valenzelektronen bei den Elementen niedriger Elektronegativität, wenn sie mit einem Element hoher Elektronegativität eine ionische Verbindung (Salz) eingehen. Die Valenzelektronen des schwach elektronegativen Elements werden gänzlich in die Valenzschale der stark elektronegativen Elements transferiert, da dann zu einem Anion mit entsprechender Edelgaskonfiguration wird. Das „Spenderatom“ wird zum Kation und trägt nun die Edelgaskonfiguration der vorgehenden Periode. Die Edelgaskonfiguration ist die energetisch am tiefsten liegende Besetzung einer Periode, deshalb streben molekül- oder ionenbildende Systeme dorthin. Beispiel: NaCl = [Ne]+ [Ar]–. Der andere Fall ist die Verbindung von Elementen ähnlicher Elektronegativität mit wenigen Valenzelektronen, z.B. BH3: H B H H Solche Verbindungen können ein Molekül mit einem ungebundenen Elektronenpaar durch dieses binden, indem sie es in ihre eigene Valenzschale einbauen. Lösungen Zur Durchführung einer Reaktion lieben die Chemiker nichts mehr als eine Lösung (die eines Problems sowieso). Lösungen sind homogene Mischungen und bieten deshalb einige Vorteile gegenüber Festkörpern oder Gasen als Reaktionsmedium, wobei der Nachteil der Festkörper schwerer wiegt. In Festkörpern sind Moleküle, Ionen oder Atome auf einer menschenkompatiblen Zeitskala ortsfest. Wenn man zwei Festkörperoberflächen 19 zusammenpresst, wird eine Reaktion dort höchstens sehr langsam ablaufen, und die Ansammlung der Produkte wird den Prozess zu Erliegen bringen. In Gasen ist die Vermischung von Reaktanden kein Problem, es kann sogar zu schnell gehen, so dass exotherme (wärmeproduzierende) Reaktionen explosionsartig verlaufen können. Eher Schwierigkeiten bieten die Behälter, die dicht sein müssen, weil die Reaktionsmischung sonst entweicht. Nachteilig ist auch, dass nur wenige Stoffe bei unsern Umweltbedingungen gasförmig sind, und dass das Verdampfen normalerweise flüssiger oder gar fester Stoffe viel Energie benötigt und dabei auch zur Zersetzung führen kann, bevor die erwünschte Reaktion eintritt. Lösungen lösen all diese Probleme: Die Moleküle sind mobil und können sich treffen, somit reagieren. In einer Lösung können Festkörper bzw. ihre Komponenten vorliegen, aber auch Gase, alle molekular verteilt. Im Falle heftiger exothermer Reaktion dient das Lösungsmittel als Moderator, es kann Energie absorbieren und durch Verdünnung die Reaktionsrate absenken. Nicht zuletzt ist auch die Sache mit dem Behälter viel einfacher als bei Gasen: Im einfachsten Fall genügt ein Becherglas, es braucht kein geschlossenes System mit Überdrucksicherung. Deshalb beginnen sehr viele chemische Arbeitsvorschriften mit: Man löst … In unserer nicht so perfekten Welt (eigentlich ist sie perfekt, wir sind nur zu ungeschickt) gibt es natürlich auch ein paar Haken bei der Nutzung von Lösungen. Es gibt z.B. Stoffe, die sich partout kaum in irgendeiner Flüssigkeit lösen. Es gibt Stoffe, die sind so reaktionsfreudig, dass sie mit allen bekannten Lösungsmitteln reagieren (oder zumindest mit denen, in denen sich der zweite gewählte Reaktand wohlfühlt). Aus diesen Gründen gibt es dann auch exotischere Arbeitsvorschriften, in denen Lösungen mit Festkörpern, Gase mit Festkörpern oder Gase mit Gasen zur Reaktion gebracht werden. Als besonders harte Methode bietet es sich auch an, zwei Festkörper zusammen zu schmelzen. Der Lösungsprozess Wenn man mit Lösungen arbeiten will, lohnt es sich, einmal den Lösungsprozess für Festkörper und Gase in unterschiedlichen Lösungsmitteln näher zu betrachten, ebenso den Zustand des gelösten Materials. Bei der Lösung von Gasen oder eines flüssigen Stoffs in Flüssigkeit handelt es sich um einen Transfer zwischen Phasen mit hoher Mobilität der Moleküle. Dieser geht ziemlich zwanglos per Diffusion vonstatten, wogegen das Aufbrechen eines Festkörpers ein komplexer Vorgang ist. Man muss hier zwischen dem Lösen polarer und apolarer Stoffe unterscheiden. Apolare Substanzen haben schwache nicht-kovalente 20 Bindungen zwischen den Molekülen in einem Kristall, diese Kristalle sind entsprechend weich. Moleküle treten relativ leicht aus der Oberfläche aus, viele solche Stoffe haben sogar einen deutlichen Dampfdruck (Iod, Naphthalin etc.). Kommt ein solches Material mit dem Lösungsmittel in Berührung, so treten Moleküle in die flüssige Phase über und verteilen sich darin. Gleichzeitig wird die „Lücke“ an der Kristalloberfläche mit Lösungsmittel „gestopft“, so dass eine Rückkehr sehr unwahrscheinlich ist. Der Vorgang setzt sich immer weiter fort, bis die Lösung gesättigt ist. Diese Bedingung umschreibt, dass die Dichte (Konzentration) des gelösten Stoffs so gross geworden ist, dass er wieder Aggregate bildet, d.h. kristallisiert. Dies ist das Lösungsgleichgewicht. Seine Lage hängt vom Verhältnis der Bindungskräfte zwischen zwei Stoffmolekülen zu denjenigen zwischen Stoffmolekülen und Lösungsmittelmolekülen ab. Hier sei kurz angemerkt, dass es dazu keine statischen Dipole braucht. Symmetrische Moleküle wie I2 lösen sich sehr gut in symmetrischen Lösungsmitteln wie CCl4. Die Kraft zwischen zwei solchen Partnern ist zwar schwach, doch immer anziehend, und wird Londonsche Dispersionskraft genannt. Dies ist nicht die van der Waals Kraft, sondern nur ein Teil davon! Sie kommt dadurch zustande, dass die Verteilung der Elektronen in einem Molekül (oder Atom) zeitlich nicht konstant ist. Es besteht ein zeitlich variables elektrisches Feld, das sich mit dem entsprechenden Feld des Nachbarmoleküls synchronisiert (grob vergleichbar mit dem makroskopischen Phänomen der elektrostatischen Influenz). Bei polaren Stoffen ist das Lösen mehr von den zwischenmolekularen Kräften abhängig, am extremsten wird das beim Lösen von Salzen oder starken Säuren unter elektrolytischer Dissoziation. Aus der Oberfläche eines Ionenkristalls treten praktisch keine Teilchen bei Raumtemperatur aus, zu gross sind die elektrostatischen Kräfte zwischen Kationen und Anionen. Ein Lösungsmittel, dessen Moleküle ein kräftiges statisches Dipolmoment besitzen, kann die Struktur jedoch aufbrechen. Man kann sich das wie folgt vorstellen: 21 Die Lösungsmitteldipole werden zunächst an der Oberfläche des Kristalls adsorbiert. Dabei richten sie sich antiparallel zu benachbarten Kationen und Anionen aus, was das lokale elektrische Feld eines solchen Paars schwächt. Die gesamte Bindungskraft an der Oberfläche wird vermindert. Durch die Schwingungen der Ionen im Kristallgitter können jetzt einzelne von ihnen austreten und werden sofort von Lösungsmitteldipolen eingehüllt. Verlässt ein Kation den Kristall oder umgekehrt ein Anion, muss wegen der Elektroneutralität gleich ein Gegenion austreten. Die Lücke wird mit einem Lösungsmitteldipol gefüllt, und der Abbauprozess geht weiter. Die bereits gelösten Ionen werden durch Dipole so eingehüllt, dass ihre wechselseitigen elektrostatischen Kräfte sehr gering werden: Wir haben eine Elektrolytlösung. Die Ionen sind zu einem grossen Grad gegeneinander beweglich, die Lösung leitet elektrischen Strom. Die Grenze der Löslichkeit wird auch hier erreicht, wenn die Konzentration der Ionen so gross wird, dass wieder Kristalle gebildet werden. Dies wiederum hängt davon ab, wie stark die Bindungskraft im Kristall im Vergleich zur Bindung der Ionen durch die Lösungsmitteldipole ist. Die Auflösung von polaren molekularen Stoffen in polaren Lösungsmitteln verläuft ähnlich, nur sind die Kräfte geringer. Die schlechte Löslichkeit von apolaren Gasen oder Flüssigkeiten in polaren Lösungsmitteln erklärt das auf den zwischenmolekularen Bindungskräften beruhende Modell ebenfalls: Im polaren Lösungsmittel herrschen stärkere Kräfte zwischen den Lösungsmittelmolekülen als die, die zwischen Gelöstem und Lösungsmittel möglich sind. Die Lösungsmittelmoleküle „kleben“ also zusammen und lassen das zu Lösende nicht herein. Die Löslichkeit ist also immer eine Frage der relativen Bindungskräfte zwischen und innerhalb von zwei Phasen. Lösung und Energie Lösungsvorgänge sind Zustandsänderungen und damit auch Energieumsatz begleitet. Die Energieänderung, gemessen in einem Kalorimeter mit Druckausgleich (p = const.) nennt man Enthalpie ΔH. Die Lösungsenthalpie ΔSH° für ein Salz setzt sich additiv zusammen aus der Gitterenergie ΔsublH°, die die Bindungsenergie des Kristalls darstellt, und der Solvatationsenthalpie ΔsolvH°, die die Bindung der Lösungsmitteldipole an die Ionen repräsentiert. ΔsublH° steht bei Lösung eines Salze wie KCl(s) in H2O für KCl(s) → K+(g) + Cl–(g) ΔsublH° = 701.2 kJ/mol Der Vorgang für ΔsolvH° ist K+(g) + Cl–(g) → K+(solv, l) + Cl–(solv, l) ΔsolvH° = -684.1 kJ/mol Total ergibt sich KCl(s) → K+(solv, l) + Cl–(solv, l) ΔSH° = 17.1 kJ/mol 22 Hier sei noch angemerkt, dass ΔsolvH° nicht nur die Energie beinhaltet, die beim Binden des Lösungsmittels an die Ionen frei wird, sondern auch den Energieverbrauch, um die an die Ionen zu bindenden Moleküle dem Lösungsmittelverband zu entziehen. Der zweite Anteil ist einiges kleiner als der erste, weil Dipol-Dipol Wechselwirkungen schwächer als Ion-Dipol Wechselwirkungen oder gar Ion-Ion Wechselwirkungen sind. Die Vorzeichen der ΔH-Werte sind systemegoistisch zu interpretieren: Negative Werte bedeuten, dass Wärme freigesetzt wird, positive, dass Wärme aufgenommen wird, d.h. das System Gelöstes - Lösungsmittel sich abkühlt. Obwohl der Lösungsvorgang für KCl externe Energie benötigt, läuft er spontan ab. Der Grund dafür ist der Gewinn an Beweglichkeit für die Ionen des Festkörpers, der durch die Entropieänderung ΔS ausgedrückt wird. Die Entropie ist eine Funktion, die die Freiheitsgrade der Bewegung in einem molekularen System repräsentiert bzw. im invertierten Sinn seinen Ordnungsgrad. Die Funktion, die beides, ΔH und ΔS zusammenfasst, ist ΔG = ΔH - T ΔS, genannt Gibbs-Energie. Damit ein Vorgang spontan abläuft, muss sein ΔG negativ sein. Im Gegensatz zur Lösung von Festkörpern oder Flüssigkeiten in Flüssigkeiten ist die Lösung von Gasen in Flüssigkeiten (oder Festkörpern) immer exotherm, d.h. ΔH ist negativ, weil der Übergang stets von schwach bis gar nicht gebundenem Zustand zu einem stärker gebundenen verläuft. Der gelöste Zustand Der flüssige Aggregatzustand ist der komplexeste, weil Ordnung und Chaos zugleich herrschen, und auch die strukturelle Komplexität verschiedener Flüssigkeiten ist sehr variabel. Apolare Flüssigkeiten gleichen einem sehr dichten Gas, gelöste Stoffe darin sind einfach dispergiert. Die Moleküle des Gelösten sind kaum stärker an die Lösungsmittelmoleküle gebunden als diese untereinander. Mit zunehmender Polarität erhöht sich die Ordnung im Lösungsmittel selbst, die Moleküle sind zwar immer noch sehr beweglich, aber es gibt bevorzugte gegenseitige Ausrichtungen. Im Extremfall treten so genannte „Wasserstoffbrücken“ auf. Diese Bedingung ist immer gegeben, wenn das Lösungsmittelmolekül ein sehr elektronegatives Element, an das H direkt gebunden ist, enthält, und das elektronegative Element mindestens ein ungebundenes Valenzelektronenpaar besitzt. Der Klassiker ist Wasser, H2O. Organische Abkömmlinge von H2O, die Alkohole, besitzen diese Eigenschaft ebenfalls, dazu kann man NH3(l) und seine organischen Derivate, die Amine, sowie HF und HCN(l) nennen. HF und HCN(l) gehören wie H2O zu den polarsten aller Lösungsmittel, allerdings sind die ersteren aus anderweitigen Gründen höchst unpopulär. 23 Die Wasserstoffbrücke ist eine Bindung zwischen einem der H-Atome eines Moleküls und dem ungebundenen Valenzelektronenpaar des elektronegativen Elements eines andern Moleküls. Diese Bindung ist stark gerichtet und praktisch linear. Sie sorgt dafür, dass Lösungsmittel, die sie bilden, stark strukturiert sind und hohe Siedepunkte haben. Beispiel H2O: O H O H O H H O H H O H H O H O H H H H H O H H Die Wasserstruktur ist natürlich in Wirklichkeit dreidimensional, mit den O-Atomen in Zentren von Tetraedern, die durch die H gebildet werden. Stoffe mit niedrigem Dipolmoment werden kaum eingelassen, weil das zu einer Erhöhung der Gesamtenergie führen würde, sie sind schlecht löslich in Wasser. Die Struktur wird gebrochen, wenn Ionen in sie eingebaut werden, weil die elektrostatische Kraft zwischen Ionen und Dipolen grösser ist als zwischen Dipolen allein. Sie wird auch gestört, wenn polare Substanzen mit ähnlichem Dipolmoment wie H2O eingefügt werden. Durch das Lösen von Ionen wird die Flüssigkeit lokal inhomogen. Die direkt am Ion liegenden Wassermoleküle sind in seinem elektrostatischen Feld ausgerichtet: H2O H2O OH2 H2O OH 2 H2O eigentlich 3-D 1. Solvathülle 1. + 2. Solvathülle Für Anionen liegen die Wasser-Dipole natürlich umgekehrt. Wie dick die Lösungsmittelschicht, die durch die Ionen ausgerichtet wird, tatsächlich ist, hängt von der Art 24 der Ionen selbst ab. Je kleiner der Radius und je grösser die Ladung, desto grösser die Ladungsdichte an der „Oberfläche“ eines Ions, und desto stärker die Solvatationsbindung. Dies führt zum nur scheinbar paradoxen Effekt, dass Ionen, die im Kristallgitter wenig Raum einnehmen, in Messungen an Lösungen grösser erscheinen als Ionen, die im Kristall viel Platz brauchen. Eine solche Messung betrifft z.B. die elektrische Leitfähigkeit, bei der die Ionen durch ein externes elektrisches Feld zur Wanderung gezwungen werden. Anionen haben bei gleicher Ladung meist eine kleinere Ladungsdichte als Kationen, weil der negative Ladungsüberschuss auf Grund der gegenseitigen Elektronen-Abstossung die Elektronenhülle aufbläht, während in Kationen der positive Ladungsüberschuss die Elektronenhülle kontrahiert. Die Folge davon ist, dass die partielle Solvatationsenthalpie des Kations die Löslichkeit von Salzen stark beeinflusst. Konzentrationsbegriff Um die Präsenz eines gelösten Stoffs im Lösungsmittel zu charakterisieren, genügt eine einfache Mengenangabe, auch als sehr praktischer Wert in Mol, nicht mehr. Etwas geschickter ist es, die Zahl der Mole auf eine bestimmte Masse des Lösungsmittels anzugeben. Die Zahl der Mole pro kg Lösungsmittel heisst Molalität. Das hat den Vorteil, dass die Zahl Lösungsmittelmoleküle pro Mol Gelöstes temperaturunabhängig ist, im Gegensatz zum Mass der Molarität, das als Mole pro Liter Lösungsmittel definiert ist. Die Zahl der Lösungsmittelmoleküle pro Volumen ist temperaturabhängig, weil die Massendichte der meisten Stoffe sich stark mit der Temperatur ändert. Eine sehr clevere Konzentrationsdefinition ist der Molenbruch: Er ist bestimmt als die Molzahl der anzugebenden Komponente im Verhältnis zur Summe der Mole aller Komponenten eines Lösungs- oder Gasgemischs. Für Arbeiten in wässriger Lösung hat sich die Molarität eingebürgert, trotz der Schwäche mit der Temperaturabhängigkeit. Man behilft sich, indem man thermochemische oder kinetische Werte auf so genannte Standardbedingungen, in diesem Fall T = 298.15 K (25°C) und p = 101.3 kPa (1 atm), bezieht. Bei physikalisch-chemischen Bestimmungen wird eher die Molalität bzw. der Molenbruch verwendet. Allen Konzentrationsmassen ist gemeinsam, dass sie beschreiben, wie wahrscheinlich man eine bestimmte Molekülart in einer normierten Teilmenge eines Gemischs antrifft. Diese Eigenschaft ordnet die Konzentrationsmasse allgemeiner als Masse einer Dichte im physikalischen Sinn ein. In Gasen kann man als Konzentrationsmass den Partialdruck verwenden: Der Gesamtdruck eines Gasgemischs setzt sich additiv aus den Mol-Anteilen der 25 Komponenten zusammen, was direkt aus Avogadros Befunden hervorgeht. Der Teildruck entspricht also genau dem Molanteil, gleicht somit als Mass dem Molenbruch. In den folgenden Betrachtungen werden wir als Konzentrationsmasse die Molarität M der Dimension [M] = mol l-1 und den Partialdruck p (Pa) verwenden. Da die Definition der Konzentration c= n für die Molarität ist, ist die Menge leicht als n=cV zu errechnen. Molare V Konzentrationen während einer Reaktion A+B → C werden als [A], [B] und [C] symbolisiert. Die totalen analytischen Anfangskonzentrationen werden mit cA und cB bezeichnet. cC ist gleich Null. Verläuft die Reaktion genau wie notiert, so gilt die ganze Zeit [A] + [C] = cA und [B] + [C] = cB wegen der Massenerhaltung. Konzentrationsabhängige Phänomene in der Chemie: Reaktionsraten Anstelle des Begriffs Reaktionsrate ist im deutschsprachigen Raum auch „Reaktionsgeschwindigkeit“ üblich. „Geschwindigkeit“ ist aber intuitiv so sehr an mechanische Ortsveränderungen gebunden, dass Reaktionsrate eher der Beobachtung gerecht wird, wenn ein Stoffumsatz gerade abläuft. Im Englischen heisst es denn auch „reaction rate“. Definieren kann man das auf zwei Arten: Entweder ist es der Mengenumsatz pro Zeiteinheit, oder ein Konzentrationsumsatz pro Zeiteinheit. Es stellte sich empirisch früh heraus, dass sich die mathematische Beschreibung des Mengenumsatzes schlecht zur Verallgemeinerung und zur Übertragung auf Messgrössen eignet. Im Gegensatz dazu haben sich konzentrationsbasierte Beschreibungen sehr bewährt. Die Pioniere der chemischen Kinetik sind heute ziemlich vergessen: Der Erste, der den zeitlichen Verlauf einer chemischen Reaktion beschrieb, war Ludwig Wilhelmy. Er leitete schon 1850 auch die korrekte mathematische Beschreibung her. Diese Arbeit wurde bestätigt durch die gemeinsamen Studien von Augustus Harcourt und William Esson. Für eine Reaktion wie oben beschrieben, A+B → wurde gefunden, dass C [C] k[A][B] , wenn man [A], [B] und [C] in regelmässigen, im t Vergleich zur gesamten Reaktionszeit kurzen Zeitintervallen bestimmte. Das funktionierte natürlich nur mit recht langsamen Reaktionen, war aber dennoch eine sehr wichtige Erkenntnis. Aus der Abhängigkeit vom Produkt der Konzentrationen der Reaktanden wurde durch Max Trautz die Kollisionstheorie der chemischen Reaktionen entwickelt, welche auch 26 auf der statistischen Mechanik von Ludwig Boltzmann basiert. Die Konzentration beschreibt, wie wahrscheinlich es ist, eine bestimmte Molekülart in einem normierten Volumen anzutreffen. Das Produkt zweier Konzentrationen beschreibt deshalb die Anzahl aller möglichen Kontakte zweier Molekülarten im Einheitsvolumen. Man kann das aus der Kombinatorik ableiten: Haben wir ein geschlossenes Gefäss (das Einheitsvolumen) und darin beispielsweise 6 rote und 3 blaue Kugeln, so berechnet sich die Anzahl aller möglichen Berührungen zwischen roten und blauen Kugeln, falls wir das Gefäss bewegen, zu 6 x 3. Diese Zahlen repräsentieren aber gerade auch die „Konzentration“ roter und blauer Kugeln im Einheitsvolumen. Der Faktor k ist die so genannte Geschwindigkeitskonstante. Wie schon Wilhelmy fand, hängt sie von der Temperatur (und auch vom Druck) ab. Gemäss Kollisionstheorie ist k eine Erfolgswahrscheinlichkeit. Um eine Kollision von A mit B erfolgreich zum Produkt C zu bringen, müssen noch mehr Bedingungen als die schlichte Tatsache der Begegnung von A und B erfüllt sein. Die kinetische Bewegungsenergie der Moleküle muss einen Mindestwert besitzen, und nicht alle räumlich verschiedenen Begegnungen führen zum Erfolg, weil Moleküle stark strukturiert sein können. Wilhelmy hat sein Gesetz auch richtigerweise in eine Differentialgleichung überführt: d [C] d [A] d [B] k[A][B] dt dt dt Dies ist die noch heute übliche Art, Gesetze für Reaktionsraten zu notieren. Die Differentialquotienten stehen für die Rate, der Term k[A][B] für die Konzentrationsabhängigkeit der Rate. Die Zeitabhängigkeit lässt sich durch Integration erhalten, dazu jedoch später. Das chemische Gleichgewicht Es gibt Reaktionen, die nie im Sinne von A+B → C A und B gänzlich zu C umwandeln. Die Reaktion scheint „abzubrechen“ doch das kann nicht sein, weil es keine physikalischen Gründe für einen Stopp gibt (Magie wäre noch möglich). Die einzige rationale Erklärung besteht darin, eine Gegenreaktion C → A+B in Betracht zu ziehen. Nach einem gewissen Umsatz von A und B zu C steigt die Konzentration von C so sehr, dass sie die Rate der Gegenreaktion die Bildungsrate von C kompensiert: Wir haben Gleichgewicht, genau genommen dynamisches Gleichgewicht, die einzige Form in der Chemie, denn statische Gleichgewichte wurden bis heute nicht gefunden. 27 Man könnte so ein dynamisches Gleichgewicht auch mit „rasendem Stillstand“ umschreiben, weil die Stoffumsätze in beiden Richtungen sehr hoch sein können, ohne dass äusserlich etwas geschieht. Wir schreiben jetzt d [C] 0 k f [A][B] kr [C] dt um auszudrücken, dass sich [C] nicht mehr ändert. –kr stammt vom Gesetz für die Rückreaktion, d [C] kr [C] , das den Zerfall von C beschreibt. kf ist das k aus der dt ursprünglichen Formulierung, da wir jetzt zwei Reaktionen betrachten, müssen wir ihre kFaktoren unterscheiden. f steht für forward und r für reverse. 0 k f [A][B] kr [C] kann man umformen zu k [C] f K eq [A][B] kr Das ist das Massenwirkungsgesetz (MWG, Law of Mass Action), wie es zuerst 1864 von Guldberg und Waage formuliert wurde. Es besagt, in welchem Verhältnis [A], [B] und [C] für konstante Umgebungsbedingungen (Temperatur, Druck) zueinander stehen, sobald Gleichgewicht erreicht ist. Die Reaktionsgleichung wird jetzt auch entsprechend C A+B geschrieben. Die Gleichgewichtskonstante Keq ist keine echte Konstante, sondern eigentlich eine Funktion der Temperatur und des Drucks, genauso wie die Geschwindigkeitskonstanten, aus denen sie errechnet wird. Das Massenwirkungsgesetz ist auch die exakte Form, mit der sich die Konzentrationsabhängigkeit des Prinzips von Le Châtelier begründen lässt. Dieses besagt, dass ein chemisches Gleichgewichtssystem immer auf einen ausgeübten Zwang hin ausweicht. Erhöhung der Temperatur verschiebt ein Gleichgewicht in Richtung der endothermen Teilreaktion, Abkühlen in Richtung der exothermen. Bei Gasreaktionen treibt Erhöhung des Drucks das Gleichgewicht auf die Seite mit der kleineren Anzahl Moleküle, weil dann das Volumen abnimmt. Bei gleicher Zahl Moleküle geschieht nichts. Die Wirkung von Konzentrationsänderungen lässt sich mit dem Massenwirkungsgesetz illustrieren: Für [C] K eq erhöht die Zugabe von A die Konzentration [C], und [B] nimmt ab. Gibt [A][B] man C zu, steigen [A] und [B]. 28 Heterogene Gleichgewichte Dieser Fall liegt vor, wenn bei einer Reaktion Moleküle, Atome oder Ionen zwischen Phasen bzw. Aggregatzuständen übertreten. Typische Fälle sind Bildung oder Zersetzung von Festkörpern in Lösung, Austausch zwischen Gas und Festkörper oder Gas und Lösung. In der Lösung können wir unser normales Konzentrationsmass verwenden, in der Gasphase den Partialdruck. Ein sehr praktischer Zusammenhang besteht auch darin, dass die gelöste Konzentration eines Gases in einer Flüssigkeit oder einem Festkörper in erster Näherung proportional zu seinem Partialdruck ist. Die schwierigere Frage ist die nach der Konzentration eines Festkörpers. Dazu kann man feststellen, dass, weil ein Festkörper nur Austauschreaktionen an der Grenzfläche zu einer Lösung oder einem Gas eingehen kann, sich die Konzentration innerhalb der festen Phase nicht ändert, bis der Festkörper aufgebraucht ist. Das ist anders für Gas in Kontakt mit Lösung oder Kontakt zwischen zwei nicht mischbaren Lösungen. Dort führt die molekulare Bewegung zu einem ständigen Konzentrationsausgleich in den Phasen, wenn etwas über die Grenzfläche ein- oder auswandert. Eine Lösung oder ein Gas über einem Festkörper „sieht“ hingegen immer eine konstante Konzentration des Feststoffs. Das schlägt sich dann in einer einfacheren Schreibweise des MWG nieder. Beispiel: Die Auflösung von CaCO3 in CO2-haltigem Wasser. Das ist das Phänomen, das zur Wasserhärte führt und zur Bildung von Karst-Erscheinungen. Das Gleichgewicht besteht zwischen 3 Phasen. Ca2+ + 2 HCO3– CaCO3 + H2O + CO2 [Ca 2+ ][HCO3 ]2 K [CO2 ][H 2 O] Man sieht hier, dass CaCO3 gar nicht im MWG auftaucht. Da seine „Konzentration“ nicht variiert, solange festes Material da ist, wurde es gleich in die Konstante einbezogen. Manche Lehrbücher schreiben, die Konzentration eines Festkörpers sei immer gleich 1, was aber so nicht stimmt (Mortimer hat’s richtig). Weil Chemiker gern vereinfachen, kann man an diesem MWG noch weiter basteln. Falls H2O das Lösungsmittel ist, ist seine Konzentration im Gegensatz zum Gelösten so gross, dass sie selbst bei einem gewissen Umsatz nahezu konstant bleibt. Also weg damit und rein in die Konstante [Ca 2+ ][HCO3 ]2 K' [CO 2 ] Wie schon erwähnt, ist die Konzentration eines gelösten Gases etwa proportional zum Partialdruck, und CO2 ist ein Gas, darum endet man bei 29 [Ca 2+ ][HCO3 ]2 pCO 2 K" Ein Beispiel für ein Festkörper-Gasphase Gleichgewicht ist das Exponieren von NH4HS in einer Vakuumkammer. Dabei treten NH3 und H2S aus dem Festkörper in die Gasphase über: NH3(g) + H2S(g) NH4HS(s) K p pNH3 pH 2 S MWG: Gibt man NH3 und H2S gleichmässig zu (entspricht Kompression der Gasphase), so bildet sich einfach mehr NH4HS, bis die Partialdrucke wieder gleich sind wie vorher. Gibt man NH3 allein zu, so wird so lange NH4HS gebildet, bis die Partialdrucke wieder Kp erfüllen, dabei ist dann pNH3 pH 2 S . Zugabe von nicht reagierenden Gasen oder NH4HS ändert nichts an den Partialdrucken. Wegnahme von NH3 oder H2S bewirkt Verdampfen von NH4HS, bis das Produkt der Partialdrucke wieder Kp erfüllt. Temperaturerhöhung verstärkt die Verdampfung, Kp und damit die Partialdrucke werden grösser, weil Kp bezüglich Temperatur eben keine Konstante ist! Die Konstante des Lösungsgleichgewichts von in Wasser schwerlöslichen Salzen besitzt eine spezielle Bezeichnung: Löslichkeitsprodukt. Der Name rührt daher, dass der Nenner des MWG eigentlich nur die „Festkörperkonzentration“ enthält, die aber in der Konstante verschwindet und somit immer ein Produkt verbleibt. Beispiele: Ba2+ + SO42− BaSO4 L(BaSO4 )=[Ba 2+ ][SO 42- ] 2 Ag+ + CrO42− Ag2CrO4 L(Ag 2 CrO 4 )=[Ag + ]2 [CrO 42- ] Das Löslichkeitsgleichgewicht spielt nur, solange Festkörper vorhanden ist! Ist die Verdünnung so gross, dass kein Salz ausfällt, ist das Löslichkeitsprodukt bedeutungslos. Gekoppelte Gleichgewichte Falls für eine Molekül- oder Ionenart in einer Lösung 2 (oder gar mehr) unterschiedliche Reaktionen möglich sind, so sind die dazugehörigen Gleichgewichte gekoppelt. Beispiel: H NH3 + B(OH)3 H + H N H O - B O H O (H3NB(OH)3) K1 [H3 NB(OH)3 ] [NH 3 ][B(OH)3 ] K2 [NH +4 ] [NH 3 ][H + ] H NH3 + H+ NH4+ 30 Beide MWGs enthalten die Konzentration [NH3] und können somit unter Elimination dieser Variablen ineinander eingesetzt werden: K1 [H 3 NB(OH)3 ][H + ] K3 K2 [NH +4 ][B(OH)3 ] Dieses Gleichgewicht ist zentral für die Bestimmung von Amin-Stickstoff in organischem Material nach Kjeldahl. 31 Metathese-Reaktionen Generell handelt es sich dabei um Austauschreaktionen im Gleichgewicht: AX + EZ AZ + EX wobei A, X, E und Z Ionen oder molekulare Teilgruppen sein können. Für die Metathese zwischen verschiedenen Olefinen wurde 2005 der Chemie-Nobelpreis verliehen. Wir wollen hier die wesentlich länger bekannte Reaktion zwischen (meist gelösten) Salzen anschauen. Dann kann man eigentlich A+ + X− + E+ + Z− A+ + Z− + E+ + X− schreiben. Hier geschieht gar nichts. Die ionische Metathese funktioniert nur, wenn eine der Kombinationen auf der Produktseite (AZ oder EX) aus dem Gleichgewicht entfernt wird. Dafür gibt es 3 Möglichkeiten: 1. Bildung eines schwerlöslichen Salzes 2. Bildung eines schlecht löslichen Gases 3. Bildung eines molekularen Stoffs Der erste Fall betrifft das schon erwähnte Löslichkeitsprodukt. Eine typische Reaktion ist z.B. Pb(NO3)2 + 2 KI PbI2 + 2 KNO3 Diese Schreibweise ist allerdings unglücklich, sie sollte tunlichst vermieden werden, da überhaupt nicht klar gestellt wird, welche Komponente sich spontan abtrennt. Besser ist schon Pb2+ + 2 NO3− + 2 K+ + 2 I− PbI2 + 2 K+ + 2 NO3− Alle Ionen seien hier solvatisiert, dieser Zustand wird normalerweise nicht explizit angegeben, sondern wird vorausgesetzt, da Lösung das häufigste Reaktionsmedium ist. In der ionischen Form der Gleichung ist wenigstens ersichtlich, dass PbI2 ausfällt. Dennoch ist die Gleichung noch voller Ballaststoff, und man kann zu Pb2+ + 2 I− PbI2 verbessern. Dazu gehört dann auch L(PbI 2 )=[Pb 2+ ][I- ]2 , und es ist klar, dass man z.B. alternativ Bleiacetat und Natriumiodid einsetzen könnte. Ein Beispiel mit Gasbildung: 2 NaCl(s) + H2SO4(l) 2 HCl(g) + Na2SO4(s) Obwohl HCl die stärkere Säure ist (dazu später) als H2SO4, kann man auf diese Art bequem HCl-Gas erzeugen, das sich spontan aus der Mischung fest-flüssig entfernt. In wässriger Lösung würde diese Reaktion nicht ablaufen, weil HCl in H2O sehr gut löslich ist. MetatheseReaktionen mit Gasbildung in wässriger Lösung sind eher selten, weil die schwerlöslichen Gase kaum in einfachen reversiblen Reaktionen gebildet werden, und die Produktion gut 32 löslicher Gase beim Gleichgewicht stehen bleibt. Annähernd vollständig läuft noch die Entwicklung von CO2 ab: K2CO3 + 2 HBr 2 KBr + H2O + CO2 Besser 2 K+ + 2 Br– + H2O + CO2 2 K+ + CO32– + 2 H+ + 2 Br– Wie man erkennen kann, lässt sich festes KBr isolieren, wenn man das Wasser nach Reaktionsende verdampft. Eine häufige Version der dritten Form der Ionen-Metathese ist die Neutralisationsreaktion zwischen Säuren und Basen, z.B. K2S + H2O 2 KOH + H2S Besser 2 K+ + S2− + H2O 2 K+ + 2 OH− + H2S Es ist hier zu beachten, dass H2S eine sehr schwache Säure ist und nicht wie HBr im Beispiel oben weitgehend ionisiert vorliegt. Aus H2S und OH− wird H2O gebildet, eine noch schwächere Säure, und gleichzeitig das Lösungsmittel. Nach Verdampfen des H2O kann K2S isoliert werden. Noch ein Beispiel für Fall 3.: 2 NaCH3COO + H2SO4 Na2SO4 + 2 CH3COOH Besser 2 Na+ + SO42− + 2 CH3COOH 2 Na+ + 2 CH3COO− + 2 H+ + SO42− Auch hier ist wichtig, dass H2SO4 eine stark dissoziierte Säure ist, die Essigsäure CH3COOH aber nicht. Die Salze der Essigsäure und anderer schwacher Säuren sind hingegen weitgehend dissoziiert, sofern die Anionen H+ weniger stark binden als das OH− tut. Löslichkeitsprodukt und Fällungsreaktionen Bei der Einführung des Massenwirkungsgesetzes (MWG) wurde bereits der Sonderfall des Löslichkeitsprodukts erwähnt. Diese Form ist sehr geeignet, die Fällung und Löslichkeit schwerlöslicher Salze zu beschreiben. Ein Salz ist schwerlöslich, wenn die Gitterenergie (Bindungsenergie im Festköper) gross im Vergleich zur Solvatationsenthalpie seiner Ionen ist. Die Solvatationsentropie ist nicht massgebend, sie ist immer sehr ähnlich. Für eine hohe Gitterenergie kann es drei Gründe geben: - Anionen und Kationen haben ähnliche Radien, damit ist die elektrostatische Kraft im Gitter sehr homogen. Beispiele: BaSO4, NH4ClO4 33 - Hohe Ladungen der Ionen verursachen grosse Gitterkräfte. Beispiele: Al(OH)3, Fe2(SO4)3 - Die Kombination kleiner Kationen mit hoher Ladungsdichte mit grossen Anionen geringer Ladungsdichte führt zu einer Polarisation des Anions und damit einem partiellen Rücktransfer von Ladung auf das Kation: Die Bindung wird teilweise kovalent. Beispiele: AgI, PbI2 Unabhängig von der Ursache der Schwerlöslichkeit kann man, sofern die Stoffe ionisiert in Lösung gehen, für Salze aus zwei Ionenarten allgemein formulieren L(M m X x )=[M n x+ ]m [X n m- ]x n ist ein ganzzahliger Faktor (meist 1). Rechnet man den Term [M n x+ ]m [X n m- ]x , der auch Ionenprodukt genannt wird, für eine gegebenen Satz Konzentrationen aus, so kann man 3 Fälle unterscheiden: [M n x+ ]m [X n m- ]x L(M m X x ) : Das Salz ist vollkommen in Lösung [M n x+ ]m [X n m- ]x L(M m X x ) : Die Lösung ist gesättigt, aber es gibt noch keinen Festkörper [M n x+ ]m [X n m- ]x L(M m X x ) : Festkörper fällt aus, bis [M n x+ ]m [X n m- ]x L(M m X x ) erfüllt ist Das Löslichkeitsprodukt ist nicht nur ein Mass für die Löslichkeit eines Salzes, es beschreibt auch das Ausweichen des Feststoff – Lösungssystems bei nicht stöchiometrischer Mischung der Ionen nach dem Prinzip von Le Châtelier, wenn die Ionenkonzentrationen durch externe Massnahmen manipuliert werden. Beispiel: L(Ca(O 2 CCO 2 )) [Ca 2 ][O 2 CCO 2 2 ] 1010 M 2 ist das Löslichkeitsprodukt von Calciumoxalat. Das ist eines der beiden häufigen Materialien, aus denen Nierensteine bestehen. Die typische Konzentration von Ca2+ in Urin ist ca. 10−3 M, woraus folgt, dass die Konzentration von Oxalat 10−7 M nicht übersteigen sollte, um die Bildung von festem Calciumoxalat zu verhindern. Aus dem Löslichkeitsprodukt lässt sich auch errechnen, wie gross die Konzentrationen von Ca2+ und O2CCO22− werden, wenn man festes Calciumoxalat in Wasser gibt. Da beim Auflösen immer zugleich je ein Ca2+ und ein (O2CCO2)2− Ion ins Wasser übertreten, sind die beiden Konzentrationen hier gleich. Setzen wir x = [Ca2+] = [O2CCO22−], so ist x= L(Ca(O2 CCO 2 )) =10-5 M . Etwas komplizierter ist das z.B. bei Ag2CrO4 mit L(Ag 2 CrO 4 ) [Ag + ]2 [CrO 42- ] 91012 M 3 . 34 Hier kann man x = [CrO42−] und [Ag+] = 2x ansetzen. Man erhält L(Ag 2 CrO 4 ) (2x) 2 x=4x 3 91012 M 3 . Nach x gelöst: x 3 91012 M 3 1.31104 M . 4 Vorsicht mit den Einheiten von Löslichkeitsprodukten! Zum Vergleich: Die Löslichkeit von AgCl, errechnet aus dem Löslichkeitsprodukt L(AgCl) = [Ag+][Cl–] = 10–10 M2, ist 10–5 M. Obwohl der Zahlenwert des Löslichkeitsprodukts für Ag2CrO4 kleiner ist als für AgCl ist die Löslichkeit von AgCl geringer. Deshalb kann man Chromat als Indikator für die argentometrische Titration von Chlorid einsetzen. Säuren und Basen Der Begriff „Säure“ ist uralt und mit der Geschmacksempfindung verknüpft, die wässrige Lösungen dieser Stoffklasse erzeugen. Ein anderes Merkmal ist die Verfärbung gewisser Pflanzenfarbstoffe wie Lackmus durch Säuren. Das Gegenstück, die Base, wird noch nicht so lange unter dieser Bezeichnung geführt. Älter ist der Begriff „Alkali“, der auch heute noch synonym verwendet wird. Im 17. Jahrhundert wurde durch Anhänger des Paracelsus zum ersten Mal vermutet, dass Säuren und Basen zueinander komplementär sind, doch erst die moderne Chemie hat diesen Zusammenhang exakt nachgewiesen. Heute ist der Säure-Base Begriff in der Chemie universell, doch die frühen Studien und auch die ausgefeiltesten Theorien sind mit der wässrigen Lösung verbunden. Die wichtigste Voraussetzung war die Entdeckung der elektrolytischen Dissoziation durch Svante Arrhenius 1884. Er wies in seiner Dissertation nach, dass Säuren und Basen, deren wässrige Lösungen den elektrischen Strom gut leiten, in der Lösung vollständig in Ionen dissoziiert sein müssen. Das Experiment ist ebenso genial wie einfach und kann im 1.Semester-Labor nachvollzogen werden: Man misst die Reaktionsenthalpie der gegenseitigen Neutralisation für verschiedene Paare solcher starker Säuren und Basen. Dabei erhält man immer denselben Wert! Wären die Säuren und Basen in der Lösung molekular vorliegend, würde das unterschiedliche Energiemengen zum Brechen der Bindungen in den Edukten erfordern. Da die Bindungen aber schon gebrochen sind, findet nur noch eine Reaktion zwischen den Teilchen statt, die das saure bzw. basische „Prinzip“ repräsentieren, und die sind offensichtlich immer dieselben. Wenn dies Ionen sind, erklärt die Beobachtung zwanglos die gute elektrische Leitfähigkeit der Lösungen. Arrhenius bemerkte auch, dass die Leitfähigkeit der Produktlösung geringer als die der eingesetzten Säuren und Basen ist. Da er die elementare Zusammensetzung seiner Säuren, Basen und salzigen Produkte kannte, wusste er auch, das H2O das Produkt der 35 Neutralisationsreaktion sein musste. Somit konnte er die Ionen H+ und OH− als Träger der sauren bzw. basischen Eigenschaft identifizieren. Arrhenius definierte Säuren als H+-Donoren und Basen als OH−-Donoren. Die Idee wurde später noch zweimal weiter verallgemeinert, zuerst wieder für wässrige Lösungen und schliesslich für jedes chemische System. Die erste Erweiterung kam von Brønsted und Lowry. Sie bemerkten, dass auch andere Moleküle bzw. Ionen als OH− mit H+ reversible Bindungen eingehen, z.B. NH3: NH4+ NH3 + H+ Brønsted und Lowry definierten Säuren als H+-Donoren und Basen als H+-Akzeptoren. Mit dem Befund, dass z.B. B(OH)3 keine H+ in Wasser abgibt, aber dennoch die Konzentration der H+ in der Lösung anhebt, und zwar durch die Reaktion B(OH)4− + H+ B(OH)3 + H2O wurde die letzte Verallgemeinerung durch Lewis eingeführt, die überall gilt. Lewis definierte eine Säure als Elektronenpaar-Akzeptor und eine Base als Elektronenpaar-Donor. Die Borsäure baut eine Bindung zum Wassermolekül auf, indem sie ein ungebundenes Elektronenpaar des Wassers in die Valenzschale des Bors, die alleine die Oktettregel nicht erfüllt, einbaut. Dabei kann durch die Polarisierung des Wassers H+ abgespalten werden. Lewis-Säuren bilden in Wasser automatisch H+ und erfüllen damit auch die älteren Definitionen. Säuren und Basen in Wasser Wasser, H2O, ist selbst eine Säure auch eine Base. Im Gegensatz zu apolaren organischen Lösungsmitteln wie Kohlenwasserstoffen hat Wasser eine gewisse elektrische Leitfähigkeit. Diese rührt von einer schwach ausgeprägten Dissoziation her: H3O+ + OH− 2 H2O Die Reaktion wird Autoprotolyse genannt und findet auch in andern polaren Lösungsmitteln statt, in denen H-Atome an stark elektronegative Atome gebunden sind. H3O+ entspricht übrigens dem, was wir salopp als H+ schreiben. Beide Schreibweisen werden der Realität nicht gerecht, das solvatisierte H+ enthält mehr als ein H2O-Molekül. Die Gleichung oben vernachlässigt zudem, dass auch OH− eigentlich ein sehr stark solvatisiertes Ion ist. Analog können wir für die Dissoziation einer Säure nach Arrhenius notieren: HCl + H2O H3O+ + Cl− 36 Die entsprechenden MWGs lauten: K ' H 2O [H3O+ ][OH ] [H 2 O]2 und K ' HCl [H3O+ ][Cl ] [H 2 O][HCl] Weil die Konzentration des Lösungsmittels [H2O] viel grösser ist als die der übrigen Komponenten, werden beide Seiten mit [H2O] multipliziert, um die gängige Schreibweise zu erhalten, dazu wird statt H3O+ einfach H+ verwendet, damit: K H 2O [H + ][OH ] K H' 2O [H 2 O] [H 2 O] und K HCl [H + ][Cl ] ' K HCl [H 2 O] [HCl] K H2O kann noch weiter vereinfacht werden, weil immer noch die konstante [H2O] im Nenner steht, kann nochmals mit diesem Wert beidseitig multipliziert werden und man erhält Kw = [H+][OH−] = K H2O [H2O] Der Wert Kw wird Ionenprodukt des Wassers genannt und ist eine charakteristische Grösse bei fester Temperatur. Bei 25°C und 101.3 kPa (chem. Standardbedingungen) beträgt Kw = 10−14 M2. Für K H2O erhält man Kw 1014 M 2 1.81016 M . [H 2 O] 55.5M Die für HCl hier beispielhaft gezeigte Konstante K HCl wird Säuredissoziationskonstante genannt und gilt hier natürlich für Wasser, 25°C und 101.3 kPa. Für andere Lösungsmittel und Bedingungen hat man den Wert von neuem zu bestimmen. Säurestärke Aus den MWGs für die Eigendissoziation des Wassers und die Säuredissoziation kann man ersehen, dass jede Säure, für die Ka [H + ][A - ] [H + ][OH - ] K H2O [HA] [H 2 O] ist, [H+] deutlich über den durch die Eigendissoziation verursachten Wert anhebt, d.h. in Wasser als H+-Donor auftritt. Ka ist ein Mass dafür, wie gut ein Stoff H-Atome als Kationen auf H2O übertragen kann. K H2O ist ein Mass dafür, wie gut H2O das mit sich selbst kann. Für die nächste Betrachtung schreiben wir der Anschaulichkeit halber wieder H3O+ statt H+. Die Gleichung H2O + H3O+ H3O+ + H2O beschreibt den Transfer von H+ innerhalb des Wassers selbst. Wir folgen der schon vorher verwendeten Vereinfachung, dass [H2O] ≈ const. und notieren wie für K H2O 37 K H O 3 [H3O+ ][H 2 O] [H 2 O] 55.5 M [H3O ] Dieses MWG beschreibt die Fähigkeit von H3O+, das H+ auf ein anderes Wassermolekül zu übertragen. Wenn für eine Säure gilt, dass Ka > K H O , dann überträgt sie beim Lösen in 3 Wasser ihre H+ praktisch vollständig auf H2O. Solche Säuren nennt man sehr starke Säuren. Für ein gegebenes Lösungsmittel ist die protonierte Form des Lösungsmittels die stärkstmögliche Säure. Säuren, die im Prinzip stärker wären, konvertieren ihre H+ beim Lösen zu dieser Spezies. Komplementär gilt, dass die deprotonierte Form des Lösungsmittels die stärkstmögliche Base in diesem ist, im Fall von Wasser ist das OH−. Schon Arrhenius unterschied starke und schwache Säuren, allerdings benutzte er nicht die Gleichgewichtskonstanten dafür, weil er [H+] nicht genau messen konnte. Er stellte fest, dass manche Säuren bei einer vorgegebenen Konzentration den elektrischen Strom viel besser leiteten als andere, und dass die Lösungen der besser leitenden Lösungen saurer schmeckten und Lackmus stärker röteten. Er unterschied zwischen demnach zwischen starken und schwachen Elektrolyten, wobei er auch Salze zu den starken Elektrolyten zählte. Unter diesen Salzen waren unter anderem Basen wie das Kaliumhydroxid. Zusammenfassend konnte er feststellen, dass es starke und schwache Elektrolyte gibt, und dass diejenigen unter ihnen, die H+ als Kation vollständig freisetzen, stark sauer sind, und andere, die OH− vollständig freisetzen, stark basisch reagieren. Heutzutage gibt man die Säurestärke mittels des Ka-Werts an, bzw. des pKa-Werts. Der pKa ist definiert als der negative dekadische Logarithmus von Ka. Dies geschieht in Analogie zur Definition des pH-Werts, der der negative dekadische Logarithmus von [H+] ist. pH log10 [H ] pK a log10 K a Damit kann das MWG für die Säuredissoziation auch so geschrieben werden: pH pK a log10 o Je kleiner der pH-Wert, desto grösser [H+] o Je kleiner der pKa, desto stärker die Säure. [A - ] [HA] Säurestärke sehr stark stark schwach sehr schwach pKa-Bereich < −2 −2 bis 3 > 3 bis 9 >9 38 Anorganische Arrhenius-Säuren und -Basen Atomare Säuren HF, HCl, HBr, HI, H2O, H2S, H2Se … Oxido-Säuren H2CO3, HNO2, HNO3, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, H3PO3, H3PO4, H2SO4 ... Fluorido-Säuren HBF4, HPF6 Oxido-Mischformen HSO3F, HSO3Cl, H2PO3F, HPO2F2 … Allen Verbindungen hier ist gemeinsam, dass sie aus stark elektronegativen Elementen aufgebaut sind. Dadurch wird die Bindung zwischen H und dem H-tragenden Atom so polarisiert, dass H+ abgespalten werden kann. Auffällig ist der grosse Anteil an Stoffen, die eine H-O Bindung aufweisen. Das ist kein Zufall, O hat die zweitgrösste Elektronegativität aller Elemente und normalerweise 2 Bindungen. „Oxygenium“ (von altgriech. oxys, was scharf, spitz oder sauer heissen kann) ist der Name, den die Lavoisiers dem Element zugewiesen haben, weil sie vermuteten, dass alle Säuren es enthalten müssen, was sich als fast richtig herausgestellt hat. Fluor kann aufgrund der Kombination hoher Elektronegativität und der Zahl von 7 Valenzelektronen nur eine Bindung ausbilden, damit kann nur eine Verbindung mit einer F-H Bindung existieren. HBF4 und HPF6 können nur als salzartige Hydrate isoliert werden, es existieren keine F-H Bindungen. Arrhenius-Basen spalten OH− ab, deshalb handelt es sich ausnahmslos um Metallhydroxide. Die Elektronegativität der Metalle ist i.a. so klein, dass sie ihre Valenzelektronen gänzlich dem Sauerstoff überlassen und damit bei der Lösung in H2O das OH− freisetzen. Alkali-Hydroxide LiOH, NaOH, KOH … Erdalkali-Hydroxide Be(OH)2, Mg(OH)2, Ca(OH)2 … Übergangsmetall-Hydroxide Mn(OH)2, Fe(OH)2, Zn(OH)2 … Diese Gruppen unterscheiden sich stark in ihrer Löslichkeit: Alkali-Hydroxide sind sehr gut wasserlöslich, Erdalkali-Hydroxide mässig und Übergangsmetall-Hydroxide meist schlecht. Die Gründe dafür werden im Abschnitt Lewis-Säuren und Basen beschrieben. 39 Brønsted - Lowry Säuren und Basen In dieser Definition wird die Säure ebenfalls als H+-Donor charakterisiert, die Base aber viel allgemeiner als H+-Akzeptor. Die Base kann demnach auch ein anderes Molekül oder Ion als OH− sein. Mit diesem Konzept wird der Begriff des konjugierten Säure-Basepaars eingeführt: Das nach der Deprotonierung einer Säure zurückbleibende Teilchen ist die konjugierte Base zu der Säure. Damit sind in diesem Rahmen die schwachen Säuren und Basen konsistenter zu behandeln, weil die Arrhenius-Definition als Base nur OH− vorsieht. Brønsted – Lowry Basen entfalten ihre Basenwirkung in wässriger Lösung übrigens auch über die Freisetzung von OH−, einerseits ist OH− selbst eine Brønsted – Lowry Base, andererseits reagieren Basen wie NH3 mit H2O: NH3 + H2O NH4+ + OH− In dieser Gleichung ist die konjugierte Base zu H2O das OH–, und die konjugierte Säure zu NH3 ist das NH4+. Eine Brønsted – Lowry Säure/Base Reaktion kann generisch so geschrieben werden: Base(a) + Säure(b) konj. Säure(a) + konj. Base(b) Die Lage des Gleichgewichts kann aus den relativen Säure- bzw. Basenstärken geschätzt werden: Ist die konjugierte Säure(a) schwächer als die Säure(b), dann liegt das Gleichgewicht rechts. Völlig identisch ist die Aussage: Ist die konjugierte Base(b) schwächer als die Base(a), so liegt das Gleichgewicht rechts. Für ein konjugiertes Säure/Base-Paar bedeutet das ganz allgemein: o Die konjugierte Base einer starken Säure ist eine schwache Base o Die konjugierte Base einer schwachen Säure ist eine starke Base o Die konjugierte Säure einer starken Base ist eine schwache Säure o Die konjugierte Säure einer schwachen Base ist eine starke Säure Im Brønsted – Lowry Konzept sind Säuren, ganz einfach betrachtet, protonierte Basen. 40 Lewis Säuren und Basen Gilbert N. Lewis verallgemeinerte das Brønsted – Lowry Konzept noch weiter. Die neue Definition steht nicht neben den alten Konzepten, sondern schliesst sie ein. Sie ist dazu äusserst simpel: o Säuren sind Stoffe, die zu Substanzen mit nicht bindenden Elektronenpaaren eine reversible Bindung eingehen: Elektronenpaarakzeptor o Basen sind Stoffe mit nicht bindenden Elektronenpaaren: Elektronenpaardonor Brønsted – Lowry Säuren im Lewis-Konzept H3O+ + OH− 2 H2O NH3 + H3O+ NH4+ + H2O gekoppelte Gleichgewichte (über H3O+) ____________________________ NH3 + H2O NH4+ + OH− Im gezeigten Beispiel ist H+ anfänglich an OH− gebunden, d.h. in einem H2O-Molekül. Es geht auf ein nichtbindendes Elektronenpaar eines andern H2O-Moleküls über, bildet H3O+. Von H3O+ geht es schliesslich an das nicht bindende Elektronenpaar von NH3 und bildet NH4+. Alle diese Schritte sind umkehrbar. H+ ist demnach eine Lewis-Säure. Lewis-Basen in dem System sind OH−, H2O, NH3. Weil OH− die stärkere Base ist als H2O, liegt das erste Gleichgewicht links. Das zweite liegt rechts, weil H3O+ stärker sauer ist als NH4+. Um die Gesamtlage zu beurteilen, muss man die beiden Gleichgewichtskonstanten kennen und die Gesamtkonstante berechnen. Eine Lewis Säure-Base Reaktion ganz ohne H+ und OH− ist z.B. die Dimerisierung von AlCl3. Im AlCl3 trägt das Aluminium nur 6 Valenzelektronen, kann also noch ein Elektronenpaar binden. Tatsächlich liegt AlCl3 nicht in monomerer Form vor, sondern als Dimer: Cl Cl Al Cl + Cl - Al Cl + - Cl Nichtbindende Elektronenpaare des Chlors werden zur Sättigung der Valenzschale des Al verwendet. Gibt man zu Al2Cl6 (so müsste es richtig geschrieben werden) Diethylether, CH3CH2OCH2CH3, so wird die Struktur geöffnet und Al bindet an nichtbindende 41 Elektronenpaare des Sauerstoffs im Diethylether, weil dies die stärkere Lewis-Base ist als das Chlorid: H3C H3C Al H3C Cl Cl Al Cl + Cl Cl - Al Cl - Cl + + - O Al Cl Cl Al O + CH3 H3C - Cl + H3C O H3C Cl H3C - Cl + O Cl + Cl Cl Cl Cl CH3 Al - O + Cl CH3 Kationen-Solvatation als Lewis Säure-Base Reaktion Eine Lewis Säure-Base Verbindung ist auch die die Kombination der Lösungsmittelmoleküle mit einem Metall-Kation in dessen 1. Solvathülle, wenn das Lösungsmittel nichtbindende Elektronenpaare besitzt (s. auch S.21, „Der gelöste Zustand“). Das Metall-Kation spielt dabei die Rolle des Elektronenpaar-Akzeptors, das Lösungsmittel die des Donors. Beispiel: [Cu(H2O)6]2+ in H2O, [Cu(NH3)4]+ in NH3(l), [K(CH3OCH2CH2OCH3)3]+ in CH3OCH2CH2OCH3 etc. Lewis Säure-Base Reaktionen unter Nichtmetallverbindungen PF5 + F− PF6− BF3 + NH3 F3BNH3 ICl3 + Cl− ICl4− CO2 + OH− HCO3− etc. Säure- und Basenstärke im Brønsted – Lowry Konzept als Funktion des molekularen Aufbaus Die Tendenz, H+ abzugeben bzw. aufzunehmen hängt stark von der Zusammensetzung eines Moleküls oder Ions ab. Die grösste Rolle spielen dabei die Ladung und die Elektronegativitäten der beteiligten Elemente. 42 o Ein stark positiv geladenes Ion, das H-Atome enthält, wird eher H+ freisetzen als ein tiefer oder gar negativ geladenes. Dies gilt auch für Lewis Säure-Base Addukte, die HAtome enthalten, und Moleküle mit positiven Formalladungen. o H-Atome, die an stark elektronegative Atome gebunden sind, werden leichter als H+ abgegeben als von weniger elektronegativen. o H-Atome, die an Atome mit grossem Radius gebunden sind, werden leichter als H+ abgegeben als von kleinen Atomen, weil der Kern-Kern Abstand beim grossen Atom grösser ist und somit die Bindung schwächer. Beispiele: - Wassermoleküle in der ersten Solvathülle eines Kations können H+ unter dessen Einfluss freisetzen. Das Gleichgewicht [Cr(H2O)5(OH)]2+ + H+ liegt weiter rechts als [Cr(H2O)6]3+ [Cr(H2O)5(OH)]+ + H+ wegen der höheren Ladung des Cr. [Cr(H2O)6]2+ - H2S ist stärker sauer als PH3, weil S elektronegativer als P ist. - HBrO3 ist saurer als HOBr, weil das Br in HBrO3 eine formale Ladung von +1 trägt, HO O Br in HOBr aber 0. O + HO Br - Hinweis: Die formale Ladung der Atome einer kovalenten Verbindung wird bestimmt, indem man die Lewis-Strichformel unter Einhaltung der Oktettregel zeichnet, also ignoriert, dass ab der 3. Periode auch d-Orbitalfunktionen an der Bindung teilnehmen. Schwefelsäure H2SO4, H O H O die wir eigentlich als zeichnen sollten, wird S O O O H2SO3 wird anstelle von S O S O 2+ - O O dargestellt als S O - H O H H O H H O H O + - 43 - HI ist viel saurer als HF, weil der Atomradius von I viel grösser als der von F ist. Die grössere Elektronegativität des F kann das nicht kompensieren. Jedoch ist HF saurer als die analoge Verbindung des weniger elektronegativen Nachbarn in der gleichen Periode, H2O. Linus Pauling hat 2 Regeln aufgestellt, mit denen man die pKa-Werte von Oxido-Säuren, der weitaus grössten Gruppe, abschätzen kann. Diese Regeln sind nicht zu verwechseln mit den bekannteren 5 Pauling-Regeln, die dazu dienen, die Struktur von ionischen Kristallen zu bestimmen. Regel 1: Der 1. pKa-Wert einer Oxido-Säure vom Typ (HO)nEOm beträgt etwa pKa(1) = 7 − 5m Regel 2: Jede folgende Dissoziationsstufe (sofern noch HO- Gruppen vorhanden) hat einen etwa um 5 Einheiten höheren pKa-Wert, also pKa(i) = pKa(i-1) + 5 Beispiele: H2SO3 → (HO)2SO, also n = 2 und m = 1. pKa(1) = 7 − 5·1 = 2 pKa(2) = 7 − 5·1 + 5 = 7 H3PO4 → (HO)3PO, n = 3 und m = 1. pKa(1) = 7 − 5·1 = 2 pKa(2) = 7 − 5·1 + 5 = 7 pKa(3) = 7 − 5·1 + 2·5 = 12 HBrO3 → (HO)BrO2, n = 1 und m = 2. pKa(1) = 7 − 5·2 = -3 Experimentelle Werte für diese Säuren: pKa(1) pKa(2) pKa(3) H2SO3 1.81 6.91 _ H3PO4 2.12 7.21 12.67 HBrO3 <0 _ _ Die einfachen Regeln sind erstaunlich tauglich für die Abschätzung! Allerdings versagen sie, wenn die Elektronegativität des Elements E, beteiligt an der HO-E Bindung in der allgemeinen Oxido-Verbindung (HO)nEOm, in der Grössenordnung derjenigen von H oder gar tiefer ist. Beispiel: Für (HO)3B ist n = 3 und m = 0, also müsste pKa(1) = 7 sein. 44 Experimentell wird pKa(1) = 9.14 gefunden. Es stellt sich auch heraus, dass (HO)3B gar nicht H+ dissoziiert, sondern H2O spaltet: (HO)3B + H2O (HO)4B− + H+ Die Polarisierung der O-E Bindung ist also wesentlich für die Acidität der HO- Gruppe. 45 Arrhenius-Säuren und -Basen als Produkte der Hydrolyse von Oxiden Die Polarisierung der H-O-E… (E ist irgendein Element) Funktionalität durch Elektronegativitätsdifferenzen bestimmt, ob diese Gruppierung in H2O (oder andern Lösungsmitteln) nach H-O-E… H+ + −O-E… HO− + E+… oder H-O-E… zerfällt. Eine einfache Voraussage lässt sich anhand des entsprechenden Stamm-Oxids machen. Alle Oxido-Säuren und Arrhenius-Basen (= Hydroxid-Basen) lassen sich durch Reaktion eines Oxids mit H2O herstellen. Ist die O-E Bindung im Oxid kovalent, so ist das Produkt eine Oxido-Säure. Ist die O-E Bindung hingegen ionisch, also das Oxid ein Salz, so ist das Produkt eine Arrhenius-Base. Der Übergang geschieht, wenn die Elektronegativität des Elements E ähnlich oder kleiner wird als die von H (2.2). Beispiele: K2O + H2O 2 KOH basisch MgO + H2O Mg(OH)2 basisch H2O + H*HO H*HO + H2O amphoter (H*: “markiertes H”) ZnO + H2O Zn(OH)2 N2O3 + H2O 2 HONO SO3 + H2O (HO)2SO2 (H2SO4) stark sauer amphoter (HNO2) schwach sauer Amphoter nennt man übrigens Stoffe, die einen bestimmten Reaktionstyp komplementär eingehen können, hier also, dass der Stoff sowohl als Säure als auch als Base reagieren kann. Im Spezialfall Säure-Base Reaktion nennt man solche Stoffe Ampholyte oder auch amphiprotisch. Zu dieser Klasse gehören u.a. alle Lösungsmittel, die Autoprotolyse aufweisen, also H2O, NH3(l), Alkohole etc. Diese Lösungsmittel tauschen H+ sehr rasch zwischen ihren Molekülen aus. 46 Quantitative Beschreibung von Säure-Base Reaktionen in Wasser Wir rufen uns in Erinnerung, dass H2O eine Autoprotolyse eingeht: H3O+ + OH− 2 H2O Damit wird festgelegt, dass OH− die stärkste Base in H2O ist, und H3O+ die stärkste Säure. Die Dissoziationskonstante von H3O+ ist K H O 55.5 M , oder pK H O+ 1.74 . Jede Säure, 3 3 die stärker H+ auf H2O überträgt, wird beim Lösen vollständig zu H3O+ konvertiert. Ebenso werden alle Basen, die stärker als OH− sind, zu diesem konvertiert. Die Gleichgewichtskonstante K OH 55.5 M dafür ist numerisch dieselbe wie K H O 55.5 M , 3 weil die Dissoziationsgleichung analog ist: − OH + H2O H2O + OH− und damit K OH- [OH ][H 2 O] [H 2 O] 55.5 M [OH ] Für eine in H2O eingebrachte Säure HA ist das MWG Ka [H + ][A ] [HA] Kb [OH ][HB ] [B] und für eine Base entsprechend Da alle Säure-Base Reaktionen in H2O reversible Gleichgewichte sind, benötigen wir zur Beschreibung des Verhaltens nur Massenwirkungsgesetze. Zur allgemeinen Formulierung des Verhaltens eine Säure HA setzen wir an: [H + ][A - ] [HA] MWG Ka Kw = [H+][OH−] cA = [A−] + [HA] [H+] = [A−] + [OH−] Ionenprodukt H2O Massenerhaltung Ladungsneutralität Zuerst wird die Massenbilanz ins MWG eingesetzt: Ka [H + ][A ] [H + ]([H ] [OH ]) . , dann die Ladungsneutralitätsbedingung: K a c A [A ] c A ([H ] [OH ]) Um eine Gleichung nur für [H+] zu erhalten, wird Kw verwendet: Kw ) [H + ] Ka K c A ([H ] w+ ) [H ] [H + ]([H ] 47 Nach algebraischer Umformung erhält man [H ]3 [H ]2 K a [H ]( K w K a c A ) K w K a 0 Diese Gleichung beschreibt das Verhalten einer beliebigen Säure HA in H2O, leider ist sie als Gleichung 3. Grads schwierig zu lösen. Chemiker vereinfachen jedoch gern, und man kann hier etwas tun, sofern cA nicht sehr klein ist und Ka weder sehr kleine noch grosse Werte annimmt. Weil Kw auf jeden Fall sehr klein ist, kann man dann schreiben [H ]3 [H ]2 K a [H ]K a c A 0 was noch durch [H+] dividiert eine quadratische Gleichung zurücklässt [H ]2 [H ]K a K a c A 0 [H ] deren Lösung Ka Ka 2 4 Ka cA 2 ist. Die zweite Lösung mit negativem Vorzeichen vor der Wurzel ist chemisch sinnlos, weil sie eine negative Konzentration ergibt. Falls auch noch cA >> Ka gegeben ist, kann man weiter vereinfachen [H ] zu 4 K a cA 2 K a cA Für cA ≥ 10−3 M und 10−9 M < Ka < 10−3 M bekommt man recht gute Schätzungen für [H+] mit dem vereinfachten Ausdruck. Analog erhält man für eine Base den Ausdruck [OH ] und die Vereinfachung [OH ] K b K b 2 4 K b cB 2 4K bcB 2 K b cB Zwischen Ka und Kb gibt es einen Zusammenhang. Wenn A− die konjugierte Base von HA ist, kann man Ka [H + ][A ] [HA] und Kb Ka Kb [OH ][HA] [A ] ansetzen. Demnach ergibt sich [H + ][A ] [OH ][HA] [H + ][OH ] K w [HA] [A ] Man braucht also Kb nicht zu bestimmen oder zu tabellieren, es lässt sich aus Ka der konjugierten Säure und Kw errechnen. Die logarithmierte Version ist noch einfacher: pKa + pKb = pKw = 14 48 Anwendung der quantitativen Säure-Base Theorie: Titrationen Für Titrationen verwenden wir vorzugsweise nicht die Konzentration [H+], sondern den pHWert, weil dieser direkt gemessen werden kann. Eine Titration ist die Umsetzung eines Stoffs mit einem geeigneten Reagenz bis zum (nahezu) vollständigen Umsatz unter Anzeige dieser Vollständigkeit. Die Endpunktanzeige kann physikalisch oder chemisch geschehen. Angesichts dieser Definition ist schon klar, welche Kombination sich in der Säure-Base Chemie nicht für Titrationen eignet: Schwache Säure mit schwacher Base. Wegen der unvollständigen Dissoziation beider Komponenten ist keine vollständige Umsetzung zu erwarten. Es bleiben also die Kombinationen starke Säure – starke Base, schwache Säure – starke Base und starke Säure – schwache Base, die alle tatsächlich verwendet werden. Wir behandeln zuerst die physikalische Umsatzanzeige, indem wir die Änderung des pH-Werts während der Reagenzzugabe messen. Beispiel 1: Titration starker Säure mit starker Base Wir setzen 50 ml starke Säure der Konzentration cA = 0.01 M an und geben schrittweise eine Hydroxidbase der Konzentration cB = 0.1 M zu. Die Natur der Säure und der Base spielen keine Rolle, da beide vollständig dissoziiert sind. Die Reaktion ist einfach H+ + OH− H2O Die Konzentration [H+] als Funktion der Basenzugabe berechnet sich als [H ] c A V0 c B V V0 V Zugabe Base / ml Volumen/ml [H+]/M pH 0 1 2 3 3.5 4 4.25 4.5 4.75 4.9 4.99 4.999 4.9999 50 51 52 53 53.5 54 54.25 54.5 54.75 54.9 54.99 54.999 54.9999 2.0 2.1 2.2 2.4 2.6 2.7 2.9 3.0 3.3 3.7 4.7 5.7 6.7 1.00E-02 7.84E-03 5.77E-03 3.77E-03 2.80E-03 1.85E-03 1.38E-03 9.17E-04 4.57E-04 1.82E-04 1.82E-05 1.82E-06 1.82E-07 49 Titrationskurve: Starke Säure mit starker Base 14.0 12.0 pH 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 0 2 4 6 8 10 ml Base Am Endpunkt bei 5 ml Zugabe ist der pH-Wert einfach der des Wassers, also 7. Weitere Basenzugabe erniedrigt die [H+] des Wassers noch mehr. Beispiel 2: Titration schwacher Säure mit starker Base Wir setzen diesmal 50 ml schwache Säure der Konzentration cA = 0.01 M an und geben wieder schrittweise eine Hydroxidbase der Konzentration cB = 0.1 M zu. Die Natur der Säure wird durch den pKa-Wert bestimmt. Dieser habe hier den Wert 5. Die Reaktion ist diesmal HA + OH– A– + H2O weil die schwache Säure nur zu einem winzigen Bruchteil dissoziiert ist. Vor der Basenzugabe wird der pH-Wert nur durch die unvollständige Dissoziation der schwachen Säure bestimmt: [H ] K a c A . Sobald die Deprotonierung von HA durch OH–-Zugabe signifikant wird, gilt das MWG, das wir praktischerweise in logarithmischer Form schreiben: pH pK a log10 mit [HA] c A V0 c B V und V0 V [A ] [HA] [A ] pH pK a log10 c B V V0 V c B V c A V0 c B V was dann ergibt. 50 Am Endpunkt liegt fast die ganze Säure HA konvertiert zu A– vor. Da es sich um die konjugierte Base einer schwachen Säure handelt, wird sie das Wasser ein wenig deprotonieren: A– + H2O mit K b HA + OH– K [OH ][HA] . Weil aufgrund der Reaktionsgleichung [HA] = [OH–] und K b w [A ] Ka K w2 K K [H ]2 sowie [OH ] w bekommt man w , was schliesslich zu Ka [A ] [H ] [H ] K w Ka [A ] führt. Da am Titrationsendpunkt einfach das Salz der schwachen Säure vorliegt, gibt diese Gleichung auch den pH-Wert wieder, der sich einstellt, wenn man ein solches Salz in Wasser löst. Zugabe Base / ml Volumen/ml [H+]/M pH 0 0.25 0.5 0.75 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.25 4.5 4.75 4.9 4.99 4.999 4.9999 50 50.25 50.5 50.75 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.25 54.5 54.75 54.9 54.99 54.999 54.9999 3.5 3.7 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.3 6.7 7.7 8.7 9.7 3.16E-04 1.90E-04 9.00E-05 5.67E-05 4.00E-05 2.33E-05 1.50E-05 1.00E-05 6.67E-06 4.29E-06 2.50E-06 1.76E-06 1.11E-06 5.26E-07 2.04E-07 2.00E-08 2.00E-09 2.00E-10 Berechnet man bei 5 ml Zugabe (Endpunkt) die [H+] mit dem Ausdruck [H ] K w Ka , so [A ] erhält man pH = 8.5. Das ist im Widerspruch zu den pH-Werten bei 4.999 ml und 4.9999 ml Zugabe in der Tabelle. Der Grund dafür ist, dass pH pK a log10 [A ] bei der Annäherung [HA] 51 and den Endpunkt gegen ∞ strebt, weil [A ] immer grösser wird. In Wirklichkeit produziert [HA] HA + OH– ein wenig HA, das den Quotienten nicht die Rückstellreaktion A– + H2O über alle Grenzen wachsen lässt. Das einfache MWG berücksichtigt diesen Einfluss des Wassers nicht. Der wahre pH am Endpunkt ist 8.5. Das Problem ist ein ähnliches wie die Frage nach dem pH-Wert einer 10−9 M HCl. Titrationskurve: Schwache Säure mit starker Base 14.0 12.0 pH 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 0 2 4 6 8 10 ml Base Die Titration schwacher Basen mit starker Säure verläuft analog, nur umgekehrt. Am einfachsten berechnet man das Gleichgewicht mit dem pKa der konjugierten Säure. Die Titrationskurven schwacher Säuren bzw. schwacher Basen mit stark dissoziierten Reagenzien enthalten noch eine andere Information als die Quantität. Auf dem halben Weg von Beginn der Zugabe bis zum Endpunkt ist [HA] = [A−]. Daraus folgt pH pK a log10 1 pK a Die Aufnahme von Titrationskurven ist die beste Methode zur Bestimmung von Ka-Werten schwacher Säuren. Um Titrationen nur zur quantitativen analytischen Bestimmung zu nutzen, ist es nicht notwendig, die ganze Reagenzzugabe zu verfolgen. Man kann dafür einen so genannten Säure-Base Indikator verwenden. Diese Stoffe sind selbst konjugierte Paare schwacher 52 Säuren und Basen, doch sind die Säure und die konjugierte Base unterschiedlich gefärbt. Wichtig ist auch, dass mindestens eine der beiden Spezies sehr stark farbig ist. HInd Ind− + H+ pH pK Ind log10 [Ind ] [HInd ] Um einen Titrationsendpunkt korrekt anzuzeigen, sollte der Indikator zu 90% in der einen oder andern Form vorliegen, also nicht die Mischfarbe zeigen. Damit kann man den pKInd des Indikators schätzen, wenn der pKa der zu titrierenden Säure bekannt ist. Graphisch ist es einfach zu erkennen: 14.0 12.0 pH 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 0 2 4 6 8 10 ml Base Der pKInd sollte etwa eine pH-Einheit über dem pKa der zu titrierenden Säure liegen, damit die Anzeige nicht zu früh erfolgt. Mehr als 2 Einheiten sollten es auch nicht sein, weil die Anzeige sonst verschleppt wird. Nicht besonders kritisch ist der pKInd für Titrationen starker Säuren mit starken Basen oder umgekehrt, weil die pH-Änderung am Endpunkt etwa 5-6 pHEinheiten umfasst. Nur extrem hohe oder tiefe pKInd sind eventuell untauglich. Für die Titration schwacher Basen mit starker Säure muss der pKInd mindestens 1 pH-Einheit unter dem pKa der konjugierten Säure zur titrierten Base liegen. Die Anforderung der starken Intensität mindestens einer Indikatorfarbe kommt daher, dass die Zugabemenge des Indikators minimal gehalten werden muss. Ansonsten verbrauchen nicht nur die titrierte Säure oder Base, sondern auch der Indikator signifikante Mengen an Reagenz. 53 Puffer Starke Säuren und Basen können bei höherer Konzentration (≥ 0.1 M) tiefe bzw. hohe pHWerte in wässriger Lösung stabilisieren. Die Stabilisierung mittlerer pH-Werte in Wasser gelingt nicht ohne weiteres, weil sowohl [H+] als auch [OH−] relativ klein sind, d.h. keine „Pufferkapazität“ vorhanden ist. Die vorgehende Titrationskurve einer schwachen Säure zeigt den Ausweg auf: Um den pKa-Wert herum ist die Kurve flach, der pH-Wert ändert sich nur wenig über einen grossen Bereich an Basenzugabe. Dasselbe gilt auch für die Zugabe starker Säure zu schwachen Basen. Eine 1:1 Mischung einer schwachen Säure mit ihrer konjugierten Base oder einer schwachen Base mit ihrer konjugierten Säure stabilisiert also den pH-Wert im Bereich um den pKa-Wert. Man sagt, die Lösung „puffert“. Dieser Effekt ist um so stärker, je höher die Konzentration der Puffersubstanz ist. Man nennt dies die Pufferkapazität. Weil es viele solche Säure-Base Paare mit den unterschiedlichsten pKa-Werten gibt, findet man meist ein geeignetes System. Restriktionen können auftreten, wenn die Puffersubstanzen andere Reaktionen als Säure-Base Reaktionen mit den übrigen Komponenten der Lösung eingehen. Solche Kombinationen sind unbrauchbar. Man sagt dann, der Puffer sei nicht inert. Viel benutzte Puffersysteme: Name Phosphatpuffer sauer Formiatpuffer Acetatpuffer Phosphatpuffer Standard Tris-(hydroxymethyl)aminomethan Boratpuffer Ammoniakpuffer Carbonatpuffer Phosphatpuffer basisch Säure/Base H3PO4/ H2PO4− HCOOH/HCOO– CH3COOH/CH3COO− H2PO4−/ HPO42− (HOCH2)3CNH3+/(HOCH2)3CNH2 B(OH)3/ B(OH)4− NH4+/NH3 HCO3−/CO32− HPO42−/PO43− pKa (25°C) 2.1 3.7 4.8 6.9 (≥ 0.1 M) 8.1 9.2 9.3 10.3 12.7 Säuren mit mehreren Dissoziationsstufen Einige Säuren können mehr als ein H+ pro Molekül freisetzen. Dabei steigt der pKa sukzessive mit jeder Stufe (siehe auch die Regeln von Pauling für Oxido-Säuren). Beispiele (in Klammern pKa-Werte): H2S (7.0/12.9), H2SO4(<0/1.5), H3PO4(2.1/7.2/12.7), H2CO3(3.7*/10.3), H2SeO3(2.6/8.3) 54 *für CO2 + H2O scheinbar pKa = 6.4, weil nur 0.2% als H2CO3 vorliegen. Die Berechnung der Spezieskonzentrationen in einem mehrprotonigen System ist relativ aufwendig. Zum Glück kann man in der Praxis oft Vereinfachungen anwenden. Am Beispiel des CO2-HCO3−-CO32− Gleichgewichts, das biologisch sehr wichtig ist, soll das Prinzip des Ansatzes und der vereinfachten Lösung gezeigt werden. Am Anfang stehen wieder die MWGs und die Massenbilanz: HCO3− + H+ CO2 + H2O K a1 CO32− + H+ HCO3− [H + ][HCO3 ] [CO 2 ] K a2 [H + ][CO32 ] [HCO3 ] c A [CO 2 ] [HCO3 ] [CO32 ] Man ersetzt nun z.B. [HCO3−] und [CO32−] in der Massenbilanz mit den MWGs, so dass nur noch [CO2] vorkommt: c A [CO 2 ] K a1[CO 2 ] K a1 K a2 [CO 2 ] [H ] [H ]2 cA K K K 1 a1 a1 a2 [H ] [H ]2 [CO 2 ] und erhält nach Umformen Dies ist die sogenannte Partitionsfunktion für CO2. Damit kann man die [CO2] für jede Kombination von pH und cA berechnen. Analog erhält man cA K a1 [H ] 1 [H ] K a2 [HCO3 ] und cA [CO32 ] [H ] [H ] 1 K a1 K a2 K a2 2 Leider wird die Berechnung der Konzentrationen knifflig, wenn die [H+] nicht unmittelbar gegeben ist. Eine solche Frage wäre z.B. die nach den Gleichgewichtskonzentrationen von CO2, HCO3−, CO32− und H+, wenn man einfach eine bestimmte analytische Konzentration cA an CO2 oder HCO3− löst. Falls man CO2 löst, gilt dann dazu [H ] [HCO3 ] 2[CO32 ] , nimmt man HCO3−, so ist die Bedingung [H ] [CO32 ] einzusetzen, und das ist noch ohne Berücksichtigung der Eigendissoziation des Wassers. Man bekommt dann Gleichungen höheren Grads aus den Partitionsfunktionen. Wir betrachten Vereinfachungen für den Fall, dass man CO2 in Wasser gesättigt löst (0.033 M bei 25°C). Die Ka-Werte liegen um etwa 104 auseinander (pKa1=6.4, pKa2=10.3), so dass man getrost annehmen kann, dass fast alle H+ von der ersten Dissoziationsstufe stammen. 55 Also [H ] K a1c A 106.4 M 0.033M 1.1104 M was etwa pH=3.9 ergibt. Die zweite Dissoziationsstufe wird von dieser [H+] dominiert, also kann man [HCO3 ] [H ] mit dem 2. MWG kombinieren: K a2 [CO32 ] . Hochverdünnte Säuren Bei starken Säuren ist die pH-Berechnung in der Regel einfach, weil [H+] ≈ cA. Nähert sich die Konzentration cA jedoch der Autoprotolyse-Konzentration des Wassers, also 10−7 M, so funktioniert diese Vereinfachung nicht mehr. Die Eigendissoziation trägt wesentlich zur Bestimmung des pH-Werts bei. Für cA ≤ 10−6 M können wir bilanzieren: [H+] = cA + x, wobei x der Anteil aus der Autoprotolyse ist. Damit ist auch [OH−] = x. Mit Kw ergibt sich Kw = (cA + x)x = x2 + cAx Damit x c A c A2 4 K w 2 Mit steigender cA wird x = [OH−] sehr rasch klein, wie das in einer Lösung mit starker Säure sein muss. Für schwache Säuren ist die Situation in hoher Verdünnung fast dieselbe, denn unter diesen Umständen sind auch sie fast ganz dissoziiert. Nichtwässrige Lösungsmittel Das Säure-Base Konzept des Lösungsmittels mit einem Säure-Basepaar kann allgemeiner gefasst werden: Lösungsmittel Säure Base COCl2 COCl+ Cl− NH3 NH4+ NH2− CH3COOH CH3COOH2+ CH3COO− HCN H2CN+ CN− Solche Systeme können benutzt werden, um die relative Stärke von Säuren zu bestimmen, die in H2O alle als starke Säuren auftreten. CH3COOH ist weniger basisch als H2O (darum tritt es darin als Säure auf), wenn man starke Säuren darin löst, dissoziieren sie weniger, werden zu schwachen Säuren. Wenn man ihre Dissoziationgrade messen kann, kennt man auch ihre relativen Säurestärken. 56 Redoxreaktionen And now for something completely different … Redoxreaktionen unterscheiden sich von Säure-Base Reaktionen in mehrfacher Hinsicht. Die meisten von ihnen laufen nicht in einem Schritt ab und führen zu massiven Strukturveränderungen. Deshalb sind sie auch mehrheitlich nicht reversibel und mit grossen Entropieänderungen verbunden. Die Zahl der transferierten Elektronen ist für eine bestimmte Reaktion nicht auf Paare beschränkt. Oft gehen die transferierten Elektronen ganz auf den Reaktionspartner über und werden nicht nur in kovalenter Bindung geteilt. In der Regel sind die Energieumsätze bei Redoxreaktionen deutlich grösser als bei Säure-Base Reaktionen. Die meisten Reaktionen, die zur Energieerzeugung benutzt werden, sind deshalb Redoxreaktionen. Redoxreaktionen beinhalten immer 2 Teilreaktionen, die Reduktion und die Oxidation. Manchmal ist es möglich, diese Reaktionen räumlich zu trennen, wenn man eine galvanische Zelle mit ihnen aufbauen kann. Prinzipiell gilt: Reduktion ist immer mit Elektronenaufnahme durch das betreffende Atom oder Molekül verbunden, Oxidation mit Elektronenabgabe. Die Ladungsbilanz bleibt stets ausgeglichen, es werden keine Elektronen freigesetzt. Um die Stöchiometrie von Redoxreaktionen einfach beschreiben zu können, wurde das Konzept der Oxidationszahl (auch Oxidationsstufe genannt) eingeführt. Um Oxidationszahlen den Atomen einer Verbindung zuzuordnen, wird wieder das Konzept der Elektronegativität beigezogen. Ausgangspunkt ist der elementare Zustand. In diesem erhält jedes Atom die Oxidationszahl 0. In Verbindungen aus verschiedenen Atomen ordnet man den elektronegativsten Elementen negative Oxidationszahlen zu. Dabei teilt man die Elektronen kovalenter Verbindungen auf, als ob sie intern ionisiert wären, d.h. die elektronegativen Atome streben ein Oktett an. Die weniger elektronegativen Elemente erhalten entsprechende positive Oxidationszahlen, so dass die Summe der Oxidationszahlen aller Atome eines Moleküls oder Ions dessen Gesamtladung ergibt. Oxidationszahlen werden mit römischen Ziffern notiert, um sie von Ladungen bzw. formalen Ladungen zu unterscheiden. Bei einatomigen Ionen sind Oxidationszahlen mit der Ladung identisch. Es gibt durchaus Fälle, bei denen alternative Notationen möglich sind, wenn z.B. die Elektronegativitätsunterschiede zwischen 2 Nachbaratomen klein sind. Auf die formalen Reaktionsgleichungen hat das aber keinen Einfluss. 57 Beispiele: Verbindung Oxidationszahlen Na+Cl− Na+I Cl-I H2O H+I O-II H+I H2O2 H+I O-I O-I H+I O O MnO4– _ -II -II +VII Mn O O -II -II -I Cl ICl3 -I Cl Cl -I I +III +I H -II -II O O H3AsO4 +V As +I H H -II O H +I 0 HCOOH: EN(C) ≈ EN(H) H -II -II -II O +I O O C H +III +II C O -II O -II -II -II O 2– S2O3 : Nach EN oder analog SO4 2− -II O S +IV O 2 0 S -II O S +VI 2 -II S O O -II -II HOCl H +I +I H+I O-II Cl+I EN: Elektronegativität Diese Oxidationszahlen können eingesetzt werden, um den Elektronentransfer bei Redoxreaktionen formal korrekt zu beschreiben. Es ist hier zu bemerken, dass Oxidationszahlen kein Modell sind, mit dem man Reaktionsverläufe vorhersagen kann. Dazu braucht es eine energetische Betrachtung, die wir anschliessend anstellen. 58 Als erstes wollen wir die thermische Zersetzung von Kaliumchlorat KClO3 näher ansehen. KClO3 ist ein Salz, das relativ leicht schmilzt und in der Hitze O2 abgibt. Zurück bleibt bei Vervollständigung KCl. Also empirisch → KClO3 O2 + KCl Stöchiometrisch ist das nicht korrekt, beschreibt aber die Beobachtungen qualitativ. Wir ordnen jetzt den Atomen in Edukt und Produkten die Oxidationszahlen zu. Für die Produkte ist das sehr einfach: K+I, Cl-I, O20 -II O K+I, Das Edukt: -II Cl +V O - O -II Dem K+ geschieht gar nichts, das ist sehr typisch für Alkalimetall-Kationen, die nur unter extremen Bedingungen an Redoxreaktionen teilnehmen. Der einzige Reaktand ist das Chloration, dessen Komponenten ihre Oxidationszahlen wechseln. Wir tun so, als ob das Chlorat aus Cl5+ und 3 O2– zusammengesetzt wäre und schreiben für die Reduktion, die dem Chlor geschieht ClO3– + 6 e– → Cl– + 3 O2– Die Oxidation betrifft O2– selbst: 2 O2– → O2 + 4 e– Diese Schreibweise nennt man historisch Halbzellenreaktionen, warum das so ist, werden wir bald näher kennen lernen. Wichtig ist, dass man die einfachste stöchiometrisch korrekte Form niederschreibt, d.h. die Massenbilanz auf beiden Seiten stimmt, genauso wie die Ladungsbilanz. Eine Unstimmigkeit besteht noch: Die Zahl der transferierten Elektronen in den Teilreaktionen sind verschieden. Man muss das kleinste gemeinsame Vielfache dieser beiden Zahlen finden und die Gleichungen zueinander anpassen, dann können sie zur BruttoReaktionsgleichung zusammengefasst werden: vereinfacht ClO3– + 6 e– → Cl– + 3 O2– |x2 2 O2– → O2 + 4 e– |x3 2 ClO3– + 6 O2– → 2 Cl– + 6 O2– + 3 O2 2 ClO3– → 2 Cl– + 3 O2 Durch die Anpassung auf das kleinste gemeinsame Vielfache verschwinden die Elektronen in der Bilanz. Am Ende bleibt die tatsächliche Reaktionsgleichung übrig. Etwas komplizierter ist die Reaktion zwischen Na2SO3 und Ce(SO4)2 in Schmelze. Diese Reaktion startet nicht, wenn man Na2SO3 schmilzt und das Ce(SO4)2 zugibt, obwohl man 59 erwarten würde, dass Ce4+ zu Ce3+ reduziert und SO32− zu SO42− oxidiert wird. Durch Notation der richtigen Halbzellenreaktionen können wir erkennen, woran das liegt. Zuerst aber noch die Oxidationszahlen in den beteiligten Ionen: Ce+IV, S+IV und O-II in SO32−, S+VI und O-II in SO42−. Na+ nimmt nicht teil. Ce4+ + e− SO3 2− → 2− +O → Ce3+ 2− SO4 + 2 e Reduktion − Oxidation Die Oxidation kann nur ohne weiteres funktionieren, wenn eine Quelle von O2− vorhanden ist, also irgendein Oxid, das sich in der Schmelze löst. Man kann hier Na2O verwenden, und tatsächlich läuft die Reaktion dann ab. Wir werden bei Systemen in wässriger Lösung noch sehen, dass solche „Hilfsstoffe“ oft essentiell für den Ablauf von Redoxreaktionen sind. Ce4+ + e− → SO32− + O2− → 2 Ce4+ + SO32− + O2− → Ce3+ |x2 SO42− + 2 e− | x 1 2 Ce3+ + SO42− Wenn man die Schmelze sehr stark aufheizt, läuft die Reaktion schliesslich auch ohne zusätzliches O2− ab: 2 Ce4+ + SO32− → 2 Ce3+ + SO3 Dabei treibt die Verdampfung von SO3 die Reaktion voran, es wirkt das Prinzip von Le Châtelier. Redoxreaktionen in wässriger Lösung Beim Übergang zu Reaktionen in wässriger Lösung müssen wir beachten, dass das Lösungsmittel manchmal an der Reaktion teilnimmt, oft in erwünschter Art und Weise. Ein einfaches Beispiel ohne Einfluss des Mediums ist z.B. 2 [Fe(CN)6]4− + Br2 → 2 [Fe(CN)6]3− + 2 Br− Oxidationszahlen in [Fe(CN)6]4−: Fe+II, C+II, N-III ; in [Fe(CN)6]3−: Fe+III, C+II, N-III Halbzellenreaktionen: Br2 + 2 e− → 2 Br− Reduktion |x1 [Fe(CN)6]4− → [Fe(CN)6]3− + e− Oxidation |x2 Mit Teilnahme des Mediums läuft die Oxidation von Fe2+ durch Chromat CrO42− unter Bildung von Cr3+ und Fe3+. Oxidationszahlen in CrO42−: Cr+VI, O-II. 60 Halbzellenreaktionen: CrO42− + 3 e− + 8 H+ Fe Cr3+ + 4 H2O → 2+ CrO42− + 3 Fe2+ + 8 H+ 3+ |x1 − → Fe + e |x3 → Cr3+ + 3 Fe3++ 4 H2O Die Bruttoreaktion verbraucht H+, und tatsächlich funktioniert sie nur, wenn man die Mischung aus Fe2+ und CrO42− ansäuert. Diese pH-Abhängigkeit ist sehr häufig zu finden, wenn Oxido-Ionen beteiligt sind, weil formal O2– freigesetzt wird, wenn die Oxidationszahl des zentralen Atoms sinkt. Da O2– eine sehr starke Base ist, muss sie durch H+ neutralisiert werden. Der Aufbau von Oxido-Ionen hingegen verbraucht H2O, und es werden H+ freigesetzt. Solche Reaktionen werden vorangetrieben, wenn das Milieu basisch ist. Beispiel, Halbzellenreaktionen: OCl– + 2 H+ + 2 e– 3+ Cr + 4 H2O → → Cl– + H2O 2− |x3 − + CrO4 + 3 e + 8 H | x 2 3 OCl– + 6 H+ + 2 Cr3+ + 8 H2O → 3 Cl– + 3 H2O + 2 CrO42− + 16 H+ 3 OCl– + 2 Cr3+ + 5 H2O → 3 Cl– + 2 CrO42− + 10 H+ Eine pH-abhängige Redoxreaktion wird auch benutzt, um Lösungen von I2 mit genau bekannter Konzentration herzustellen, die verbreitet für quantitative Bestimmungen benutzt werden (Iodimetrie, Iodometrie und Karl-Fischer-Titration). I2 ist ein molekularer Festkörper mit hohem Dampfdruck und lässt sich deshalb nicht genau wägen. In Wasser löst sich I2 auch nicht besonders gut, doch da gibt es zum Glück eine Reaktion, die die Löslichkeit stark erhöht, ohne die Redoxeigenschaften zu ändern: I3– I2 + I– Dieses Gleichgewicht liegt weit rechts (K ≈ 103 M–1), stellt sich aber sehr schnell ein, so dass man so tun kann, als ob [I2] = [I3–] für die Redoxreaktion des I2, dank dem Prinzip von Le Châtelier. (Quizfrage: Zu welcher Reaktionsklasse gehört dieses Gleichgewicht?). Die Präpration der I2-Lösung erfolgt durch Mischen von KIO3, einem nicht hygroskopischen Salz, und einem Überschuss KI (Oxidationszahlen von I sind +V in Iodat, –I in Iodid un 0 in I2). Halbzellenreaktionen: 2 IO3– + 12 H+ + 10 e– → I2 + 6 H2O |x1 2 I– → I2 + 2 e– |x5 2 IO3– + 12 H+ + 10 I– → 6 I2 + 6 H2O IO3– + 6 H+ + 5 I– → 3 I2 + 3 H2O Die praktische Ausführung ist dennoch nicht simpel. Wenn man die Salze vor der Säurezugabe nicht gründlich löst, bilden sich Klumpen von I2 um die nicht gelösten Kristalle, 61 was wegen der hydrophoben Eigenschaft des I2 dann die Vervollständigung des Prozesses verhindert. Erst nach Auflösen und Mischen der Salzlösungen kann Säure zugegeben werden, worauf sich I2 in so feiner Verteilung bildet, dass in grossem Überschuss von I– sofort I3–, welches löslich ist, entsteht. Eine sehr clevere Anwendung der Abhängigkeit von Redoxreaktionen von „Hilfsstoffen“ ist die schon erwähnte Titration nach Karl Fischer. Diese dient zur Bestimmung kleiner Konzentrationen von H2O in nichtwässrigen Lösungsmitteln oder in Festkörpern. Als Lösungsmittel für diese Titration dient meist ein getrockneter Alkohol, in der Regel Methanol CH3OH. Dazu kommt noch eine Base, die das eine Hauptreagenz, SO2, sowie das Produkt, SO3, bindet. Typischerweise wird eine organische Stickstoffverbindung, ein Amin, das ähnlich wie NH3 als Lewis-Base reagiert, verwendet. Im Folgenden sei B: diese Base. Halbzellenreaktionen: I2 + 2 e– → 2 I– B:SO2 + H2O + 2 B: → B:SO3 + 2 BH+ + 2 e– I2 + B:SO2 + H2O 2 I– + B:SO3 + 2 BH+ → Da noch CH3OH als Lösungsmittel vorhanden ist, bildet sich ein so genannter Ester (AlkoholSäure-Verbindung), der im Gegensatz zu Sulfat in Methanol löslich ist: B:SO3 + CH3OH → CH3OSO3– + BH+ Die Lewis-Säuren SO2 und SO3 sind in CH3OH immer an die Base B: gebunden. Der Endpunkt der Titration wird durch das Auftauchen von unverbrauchtem Iod angezeigt. Dazu verwendet man ein ampèrometrisches Verfahren, das als Überleitung zum nächsten Abschnitt hier illustriert sei. Wir halten uns noch einmal den Aufbau der Karl-Fischer-Titration vor Augen: Das Titriergefäss enthält Methanol, Base und SO2 sowie die Probe. Dazu wird I2-Lösung gegeben, die, solange H2O im Titriergefäss vorhanden ist, durch SO2 zu I– reduziert wird. Zusätzlich entsteht also nicht weiteres als I– und H+ im Titriergefäss. Erst wenn kein H2O mehr da ist, kann I2 im Titriergefäss verbleiben. Zur Anzeige des Endpunkts taucht man dicht nebeneinander 2 Platinstifte in die Lösung im Titrirgefäss und legt eine kleine elektrische Gleichspannung aus einer Stromquelle zwischen ihnen an, dadurch wird ein Stift positiv geladen (Anode), der andere negativ (Kathode). Gemessen wird nun der Strom, der durch die Lösung fliesst und in einem organischen Lösungsmittel sehr klein ist, weil die elektrolytische Dissoziation wegen der geringen Polarität nicht ausgeprägt ist. An der Anode könnte nun folgendes geschehen: Kommt I– an die Anode, so könnte es ein Elektron an das Metall abgeben und mit einem zweiten I–, dem dasselbe geschieht, I2 bilden. 62 2 I– → I2 + 2 e– Damit die Ladungsneutralität in der Stromquelle gewahrt bleibt, müssten nun 2 Elektronen aus der Kathode treten und auf irgendein Ion oder Molekül in der Lösung übergehen. Am einfachsten wäre die Reaktion 2 BH+ + 2 e– → B + H2 Diese wird vermieden, indem die Spannung klein gehalten wird. Wenn nun aber kein I2 mehr mit SO2 reagiert, wenn alles H2O verbraucht ist, ist plötzlich I2 im Titriergefäss vorhanden und die viel leichter laufende Reaktion I2 + 2 e– 2 I– → an der Kathode möglich (das ist die komplementäre Reaktion zu der an der Anode). Somit beginnt signifikant mehr Strom zu fliessen, was den Endpunkt anzeigt. Da I2 nun kontinuierlich an einem Platinstift verbraucht und am andern gebildet wird, ist diese Anzeige auch stabil. I _ + Ampère- Stromquelle meter 2 e– I2 2 e– 2 I– 2 I– I2 Pt Pt 63 Elektrochemie Mitte 18. Jahrhundert entdeckten Naturphilosophen das Phänomen der Kontaktpotentiale zwischen Metallen. Wurden zwei verschiedene Metalle direkt oder durch eine Lösung eines Elektrolyten (Salz, Säure oder Base) in Wasser in Verbindung gebracht, so konnte man eine elektrische Spannung zwischen den Metallen messen, das sogenannte Volta-Potential. Der Mediziner Luigi Galvani benutzte ein Kontakt-Element aus Fe und Cu, um präparierte Froschschenkel zum Zucken zu bringen. Damit demonstrierte er als erster, dass Lebewesen elektrische Potentiale zur Steuerung benutzen (Bioelektrizität). Die Kontakt-Elemente hatten einen grossen Vorteil gegenüber bisher benutzten rein elektrostatischen Spannungsquellen: Sie lieferten stundenlang Elektrizität, zwar bei niedriger Spannung, aber nicht nur kurze Pulse. Der eigentliche Protagonist auf dem Gebiet war aber nicht Galvani, sondern der Physiker Alessandro Volta. Er untersuchte Metall-Elektrolyt Kombinationen systematisch und baute 1800 schliesslich seine berühmte Voltasche Säule, die erste echte Batterie, die aus einem Stapel alternierend geschichteter Kupfer- und Zinkplättchen bestand, mir elektrolytgetränktem Filz oder Karton dazwischen. Die Abbildung links zeigt eine originale Säule Voltas aus dem Volta-Museum in Como. Auf Grund der schon erwähnten Studien verschiedener Metall-Kombinationen stellte Volta bereits eine Spannungsreihe der Metalle auf. Sein spannungsstärkstes Einzelelement bestand aus Silber und Zink. Ausgestattet mit Voltas Batterien entdeckten andere Forscher in Kürze, dass Salzlösungen sowie wässrige Säuren und Basen nicht nur den Strom leiteten (das konnte man schon mit den elektrostatischen Quellen feststellen), sondern bei Dauerexposition auch chemische Reaktionen eingingen: Die Elektrolyse war entdeckt. Bereits ein knappes Jahr nach Voltas Publikation der Batterie zerlegten Nicholson und Carlisle Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff (die Zusammensetzung kannte man schon durch die Lavoisiers). Die Anwendung der Elektrolyse auf Schmelzen von Salzen wurde in grossem Stil durch Humphry Davy ausgenutzt. Er isolierte damit die Elemente Kalium, Natrium, Barium, Calcium and Magnesium. 64 Elektrolyse Obwohl die chemische Erzeugung elektrischer Energie vor der Elektrolyse entdeckt wurde (geht gar nicht anders, denn die kontinuierliche Erzeugung von Elektrizität durch brauchbare mechanische Generatoren erfolgte noch später, 1867), sehen wir uns zuerst die Wirkung von Elektrizität auf chemische Systeme an, weil das einfacher zu verstehen ist. Das Provozieren einer chemischen Reaktion durch elektrischen Strom wird einfach bewerkstelligt, indem man zwei elektrische Leiter, die mit den beiden Polen einer Spannungs- und Stromquelle verbunden sind, in den flüssigen Elektrolyten eintaucht. Will man eine echte Elektrolyse ausführen, nimmt man vorzugsweise eine Gleichstromquelle. Mit Wechselstrom alterniert die Reaktion an den beiden eingetauchten Leitern, auf jeder Seite entsteht eine Produktmischung. Nimmt man Wechselstrom höherer Frequenz (≥ 1000 Hz), so findet gar keine Reaktion mehr statt, dennoch fliesst Strom. Diese Anordnung eignet sich, um den elektrischen Widerstand von Elektrolyten zu messen (Konduktometer). Wir definieren an dieser Stelle einige Begriffe, die in der Elektrochemie immer wiederkehren. Begriff Symbol(e) Einheit Elektrische Ladung Q, q, e (Elementarladung) Coulomb (C) Elektrischer Strom I (Physik) oder i (Elektrochemie) Ampère (A) Elektrische Spannung U (Differenz) Volt (V) Elektrisches Potential E (Spannung gegen Referenz) Volt (V) Überspannung η Volt (V) Elektrischer Widerstand R Ohm (Ω) Leitfähigkeit G Siemens (S) Leistung P Watt (W) Es gelten dazu folgende einfachen Gesetze: U = RI (Ohmsches Gesetz) P = UI G 1 I R U Technische Begriffe der Elektrochemie Elektrolyt: Elektrisch leitendes Medium, das Strom nicht mittels Elektronen transportiert. Elektrode: Leitendes Material, das den Kontakt zum Elektrolyten herstellt. 65 Anode: Elektrode am positiven Anschluss der Stromquelle. Kathode: Elektrode am negativen Anschluss der Stromquelle. Zelle: Reaktionskammer, die Elektrolyt und Elektroden enthält. Halbzelle: Reaktionskammer, die nur eine Elektrode und Elektrolyt enthält, und durch eine leitende Diffusionsbarriere mit der andern Halbzelle verbunden ist. Anodenraum: Die Halbzelle der Anode. Kathodenraum: Die Halbzelle der Kathode. Elektrolytbrücke: Kammer zwischen Anoden- und Kathodenraum, die Elektrolyt enthält und an beide Halbzellen über Diffusionsbarrieren (Membran, Glaswattepfropf, Glasfritte, etc.) angeschlossen ist. Eine typische Elektrolysezelle (hier mit einer NaCl-Schmelze) ist wie abgebildet aufgebaut: I U Kathode Anode e– e– Na+ Cl– Na Na+ Na+ Cl– Cl– Na+ Cl– Na Cl2 Na+ Na+ Na+ Na Gleich-Spannungs/Stromquelle Cl– Cl– Cl– Cl– + + – Cl– Na+ 66 Wenn man die Gleichstromquelle einschaltet, geschieht eventuell noch gar nichts. Erst wenn die Spannung auf einen Schwellenwert eingestellt wird, die so genannte Überspannung, beginnt erkennbarer Stoffumsatz an den beiden eingetauchten Leitern. In unserem Fall wird man silberne Tropfen von geschmolzenem Na-Metall um die Kathode herum treiben sehen, und an der Anode entsteht Chlorgas. Es ist sehr wichtig, Anode und Kathode hier räumlich gut zu trennen, weil die Reaktion von Na mit Cl2 heftig und exotherm ist. Ausserdem würde sie auch gleich unsere Produkte wieder zerstören. Wir haben es offensichtlich mit Redoxreaktionen zu tun: An der Anode geben Chloridionen Elektronen ab, an der Kathode nehmen Natriumionen genausoviel Elektronen wieder auf. Also: 2 Cl– → Cl2 + 2 e– Anodenreaktion = Oxidation Na+ + e– → Na Kathodenreaktion = Reduktion U/I 2 Na 2 Cl 2 Na Cl2 Bruttoreaktion An der Kathode entstehen tatsächlich 2 Natriumatome pro Chlormolekül. Nach aussen ist die Ladungsbilanz ausgeglichen. Technisch ist eine Elektrolyse gar nicht so einfach durchzuführen. Die Elektroden müssen aus einem Material bestehen, das nicht spontan mit dem Elektrolyten oder den Produkten reagiert. Das Gefäss darf von der Schmelze auch nicht angegriffen werden. Die Trennung der Produkte gelingt hier einfach, weil sich beide nicht in der Schmelze lösen und Chlor ein Gas ist. Zum Vergleich sehen wir uns die Elektrolyse von NaCl in wässriger Lösung an. An der Anode entsteht wieder Chlor, doch an der Kathode wird ebenfalls ein Gas gebildet und kein Metall. Nehmen wir einmal an, es bilde sich Na-Metall. Dieses ist in Wasser instabil und reagiert: 2 Na+ + 2 OH– + H2 2 Na + 2 H2O → Zusammengefasst: 2 Cl– 2 H2O + 2 e → – → Cl2 + 2 e– Anodenreaktion = Oxidation – H2 + 2 OH Kathodenreaktion = Reduktion Es lässt sich leider bis heute experimentell nicht entscheiden, ob H2 direkt gebildet wird oder ob Na als Zwischenprodukt existiert. Weil die Reaktionen bei Elektrolysen nur in einer extrem dünnen Schicht an den Elektroden stattfinden, ist das Studium der Reaktionsmechanismen sehr schwierig. Chemische Synthesen per Elektrolyse erzielen deshalb auch nur gute Umsätze, wenn der Elektrolyt ständig bewegt (gerührt wird). Bei all den genannten Nachteilen sind elektrochemische Synthesen trotzdem beliebt, weil man keine 67 Reagenzien braucht und die Produkte deshalb wenig verunreinigt sind, was Zeit und Kosten bei der Isolierung spart. Die Elektrolyse von wässriger NaCl-Lösung ist übrigens ein richtiges Arbeitspferd der chemischen Industrie. Als Produkt entstehen NaOH und H2, wie man aus den Gleichungen oben ableiten kann. NaOH ist wohl die meist verwendete starke Base überhaupt. Der Bedarf an Wasserstoff ist ebenfalls riesig. Ein Problem dieser Synthese ist das dritte Produkt, Chlor. Früher wurde es gleich an Ort und Stelle für die Chlorierung organischer Stoffe in grossem Massstab verwendet, was uns all die inzwischen verbotenen chlorierten Kohlenwasserstoffe und Phenole wie DDT, Lindan, PCBs, Pentachlorphenol sowie als Abfall noch das gefürchtete 2,3,7,8-Tetrachlordioxin beschert hat. Heute wird das Chlor nur für die Herstellung noch zugelassener Stoffe verwendet, der Rest dient als Oxidationsmittel oder zur Produktion von HCl und wird dadurch wieder zu Chlorid. Was geschieht, wenn wir statt NaCl-Lösung eine Na2SO4-Lösung elektrolysieren? 2 H2O → 2 H2O + 2 e– → O2 + 4 H+ + 4 e– Anodenreaktion = Oxidation H2 + 2 OH– Kathodenreaktion = Reduktion Da H2O leichter oxidierbar ist als SO42– und leichter reduzierbar als Na+, kommt das auf eine Wasserelektrolyse heraus. Das Na2SO4 sorgt als Elektrolyt für einen guten Stromfluss. Die ganze Wahrheit ist es aber doch nicht. Bei längerer Elektrolyse findet man auch S2O82– in der Lösung, ein wichtiges Nebenprodukt: 2 SO42– → S2O82– + 2 e– 2. Anodenreaktion! Dieses Peroxodisulfat (sytematisch µ-dioxido-bis(trioxidosulfat)(2-) bezeichnet) ist ein starkes Oxidationsmittel, das anderweitig gar nicht hergestellt werden kann. Elektrolysen können Stoffe produzieren, die mit Reaktionen zwischen normalen Chemikalien überhaupt nicht erreichbar sind. Der Grund liegt an den hohen Spannungen, die man an den Elektroden anlegen kann. Damit werden für chemische Verhältnisse hohe lokale Energien erreicht. Wenn es dann noch gelingt, das Produkt stabil zu halten, kann es isoliert werden. Zum Vergleich: eine starke kovalente Bindung hat eine Bindungsenthalpie von 200 – 1000 kJmol–1. Eine Spannung von nur 1 V erteilt einem Elektron aber bereits eine Energie von ca. 100 kJmol–1! 68 Bis jetzt haben wir angenommen, dass die Elektroden nicht an den Reaktionen teilnehmen sollen. Zum Teil ist das aber eine Illusion, und manchmal ist es auch erwünscht. Als Beispiel sehen wir die Elektrolyse einer Kupfersulfat-Lösung mit 2 Kupfer-Elektroden an. I U Cu-Kathode Cu-Anode e– e– Cu2+ SO42Cu2+ Cu2+ SO42Cu2+ Cu2+ Gleich-Spannungs/Stromquelle 2+ Cu + Cu2+ 2 H2O – O2+4H+ Cu → Cu2+ + 2 e– Anodenreaktion = Oxidation Cu2+ + 2 e– → Cu Kathodenreaktion = Reduktion sind die Hauptreaktionen. Dabei findet Stofftransport statt: Die Anode wird immer leichter, die Kathode immer schwerer. Die Konzentration des Cu2+ in der Lösung bleibt wegen des Elektroneutralitätsprinzips konstant. Als Nebenreaktionen findet man die Oxidationen des Wassers zu O2 und des Sulfats zu S2O82–, wie schon oben beschrieben. Derartige Metallabscheidungen auf der Kathode können auch auf Fremdmetallen erzeugt werden, mit geeigneten Bedingungen bekommt man homogene mikrometerdünne und stabile Beschichtungen. Diese Art Prozesse nennt man Galvanotechnik. 69 Quantitative Elektrolysen Einige Elektrolysen laufen mit hoher und eindeutiger Ausbeute ab. Dies wurde schon früh bemerkt und von Michael Faraday mit einer Gleichung beschrieben: m Q M F z Diese Gleichung besagt, dass die abgeschiedene Masse an der Kathode oder die aufgelöste Masse an der Anode proportional zu der in der Elektrolyse geflossenen Ladungsmenge Q ist. M ist die Molmasse bzw. die Atommasse des elektrolysierten Stoffs, F ist eine Konstante und beschreibt die Gesamtladung eines Mols an Elementarladungen, also F N A e 6.023 1023 mol1 1.602 1019 C 96485Cmol1 z ist eine Ganzzahl, es stellte sich heraus, dass es sich um Zahl der Elektronen handelt, die in der Elektrolyse pro Molekül bzw. Ion übertragen werden. Die Ladungsmenge Q wird t bestimmt durch Q i( )d . Weil i(τ) mit geringem Aufwand konstant gehalten werden 0 kann, vereinfacht sich dieses Integral zu Q it . Man braucht also nur ein Strommessgerät (Ampèremeter) und eine genaue Uhr, um die umgesetzte Stoffmenge in solch effizienten Elektrolysen zu bestimmen. Das gilt auch für Reaktionen, die nicht von einer Abscheidung oder Auflösung an einer Elektrode begleitet sind, sondern nur in der Lösung umsetzen. Aus diesen Erkenntnissen können quantitative Bestimmungsmethoden abgeleitet werden, die unter dem Begriff Coulometrie (Ladungsmessung) zusammengefasst werden. Die älteste Version ist das Silbercoulometer, das nicht einmal einen konstanten Strom braucht, weil es echt integrierend arbeitet. Dazu wird eine Kathode aus Silber verwendet, an der Ag aus Ag+ gebildet wird. Diese Zelle, die auch noch eine Anodenreaktion ausführt, wird in Serie mit dem zu untersuchenden Elektrolysesystem geschaltet, damit passiert der ganze Strom das Silbercoulometer. Vor der Elektrolyse wir die trockene Silberkathode gewogen. Wenn die Elektrolyse beendet ist, wird die Silberkathode gewaschen und wieder getrocknet, um die Gewichtsdifferenz zu bestimmen. Aus dieser lässt sich dank bekannter Atommasse und z=1 die Ladungsmenge Q errechnen, und damit natürlich auch der Umsatz im untersuchten System. Moderne Coulometer arbeiten entweder mit einer Konstantstromquelle und messen einfach die verstrichene Zeit bis zum Ende der Elektrolyse, oder sie integrieren elektronisch. Dies wird erreicht, indem durch einen Strom-Spannungswandler eine dem Strom proportionale Spannung generiert wird. Diese Spannung wird durch einen Analog/DigitalKonverter in im Vergleich zur ganzen Messzeit kurzen konstanten Intervallen vermessen und 70 durch Zahlen dargestellt, die von einem Mikroprozessor aufsummiert werden. Die Summe am Ende entspricht dem Integral Q. Silbercoulometer Vermessene Reaktion: 2 Cl– → Cl2 + 2 e– Anodenreaktion = Oxidation 2 H+ + 2 e– → H2 Kathodenreaktion = Reduktion U I Kathode e Anode – e H+ e Anode – Ag H+ Cl H2 - H+ H+ Kathode – Cl- e SO42- Ag+ 2 H2O Cl- O2 Ag Cl2 Cl – + 4 H+ O2 + SO42- - Ag+ H+ 4H 2 H2O Gleich-Spannungs/Stromquelle + – ClAg+ Coulometer- Reaktion: 2 H2O → O2 + 4 H+ + 4 e– Anodenreaktion = Oxidation Ag+ + e– → Ag Kathodenreaktion = Reduktion Wird gewogen 71 Galvanische Zellen Wir kehren zurück zum Beginn der Elektrochemie und sehen uns die Konstruktion von Alessandro Volta näher an. Die galvanische Zelle müsste eigentlich voltasche Zelle heissen, wenn man die (oben geschilderte) Entwicklungsgeschichte betrachtet. Was geschieht hier eigentlich? Da wir am einen Ende einer Volt-Säule einen Elektronenüberschuss erzeugen (Minus-Pol) und am andern ein Defizit (Plus-Pol), muss eine Elektronen verschiebende chemische Reaktion ablaufen, also eine Redoxreaktion. Wie wir schon wissen, muss diese aus zwei Teilreaktionen, einer Reduktion und einer Oxidation, bestehen. Die klassische VoltaSäule besteht aus einem Stapel alternierender Zink- und Kupferplättchen, die paarweise durch mit neutralem oder saurem Elektrolyt getränkten Filz- oder Kartonplättchen getrennt sind: _ + In der Abbildung sind je zwei Kupferplatten (braunrot) und Zinkplatten (grau) durch Elektrolyt (farblos) getrennt. Es handelt sich um zwei in Serie geschaltete galvanische Elemente, jedes besteht aus Zn-Platte, Elektrolyt-Filz und Cu-Platte. Der interne Kontakt wird direkt zwischen Kupfer- und Zinkplatte hergestellt, man könnte hier auch auftrennen und einen Draht einsetzen. Volta stellte fest, dass die Zinkplatten korrodiert werden und an Gewicht verlieren, während die Kupferplatten höchstens blanker werden, ohne Masse abzugeben. Zn → Zn2+ + 2 e– erklärt die Beobachtung am Zinkplättchen. Am Kupfer gibt es mehrere Möglichkeiten: Falls das Kupfer noch passiviert war (zu Voltas Zeit sehr wahrscheinlich), trug es eine Schicht aus Cu2O. Damit Cu2O + 2 H+ + 2 e– → 2 Cu + H2O Die Volta-Säule funktioniert aber auch mit blanken Cu-Platten: O2 + 4 H+ + 4 e– → 2 H2O Es handelt sich also um einen Vorläufer der heute noch gebräuchlichen Zink-Luft Batterie. Wir können das etwas eleganter aufbauen, indem wir eine Vorrichtung wie bei der Elektrolyse benutzen. Um präzise Aussagen zu erhalten, muss man zwischen den beiden 72 Räumen um die Elektroden noch eine Barriere gegen völlig freie Diffusion einfügen, damit keine rasche Durchmischung des Elektrolyten aus den beiden Zonen stattfindet. U _ + Cu Membran oder Diaphragma Zn Zn2+ 2+ Cu SO42- SO42- Bei der abgebildeten galvanischen Zelle handelt es sich um ein so genanntes Daniell-Element, einer verbesserten Version der Volta-Säule. Sie war eine Zeit lang die Standard-Stromquelle für Telegraphen, als es noch keine Dynamos gab. So wie sie hier beschaltet ist, liefert sie allerdings keinen Strom. Ein Voltmeter, wie das Spannungsmessgerät genannt wird, hat theoretisch (und heute auch beinahe praktisch) einen unendlichen elektrischen Widerstand. Die Spannung kommt durch eine Ladungsverschiebung zustande, die dadurch verursacht wird, dass Zn eigentlich als Zn2+ in Lösung gehen möchte, während Cu2+ sich unter Elektronenaufnahme als Cu absetzen will. Zu einem winzigen Teil geschieht das auch, damit akkumulieren sich elektrische Ladungen auf den Elektroden, bis die Reaktion zum Stillstand durch Anwachsen der elektrischen Feldstärke kommt, also Gleichgewicht herrscht. Dies ist wieder ein dynamisches Gleichgewicht, ist es erreicht, so ist die Austauschgeschwindigkeit zwischen Metall und Metallkationen auf beiden Seiten gleich schnell. Die Richtung der Ladungsverschiebung und ihr Ausmass werden durch die Austrittsarbeiten der beiden Metalle festgelegt. Die Austrittsarbeit ist die Energie, die benötigt wird, um Elektronen aus dem 73 Metall herauszulösen. Sie ist um so grösser, je elektronegativer das Metall ist. Am leichtesten treten Elektronen aus Alkalimetallen aus, sie sind stark reduzierend, und entsprechend wenig oxidierend sind ihre Kationen. Weiter rechts im Periodensystem findet man die Edelmetalle, die eine hohe Austrittsarbeit aufweisen und deren Kationen kräftig oxidierend wirken. Die Spannung, die man am Voltmeter misst, ist deshalb eigentlich ein Mass dafür, wie „gerne“ die Reaktion ablaufen würde, bei der die ganze Zinkelektrode aufgelöst und gleichviel Kupfer (in Mol) auf die andere Elektrode abgeschieden wird. Den Wert der Spannung nennt man Potentialdifferenz ΔE. Ein Potential selbst wäre der Wert der Spannung einer der Teilreaktionen (Halbzellenreaktionen) gegenüber einem Referenzwert. Ein historischer Begriff für diese Spannung ist „elektromotorische Kraft“ (EMK). ΔE drückt direkt aus, wieviel Energie frei würde, wenn wir die Reaktion durch Kurzschliessen des Voltmeters bis ins finale Gleichgewicht laufen liessen. Weil keine Wärme beim Messen von ΔE frei wird, ist ΔE direkt ein Mass für das ΔG der Reaktion, die bei Kurzschluss eintreten würde. ΔG = –nFΔE wobei n für die Zahl der pro Atom oder Molekül transferierten Elektronen und F für ein Mol Elementarladungen steht. Dass der Ausdruck ein Energiemass ist, kann einfach gezeigt t werden: P UI U dQ , damit W U I(t) dt UQ . nF ist eine Ladungsmenge, ΔE ist eine dt 0 Spannung. Weil ΔG° = –RT lnK ist, muss auch der Konzentrationsausdruck des Massenwirkungsgesetzes mit ΔE°, der Potentialdifferenz unter Standardbedingungen, verknüpft sein: E° RT ln K . Die Konzentrationsabhängigkeit von ΔG, falls nicht finales nF Gleichgewicht herrscht, ist ΔG = ΔG° + RT lnκ. κ ist ein Ausdruck analog zum MWG der entsprechenden Reaktion, enthält aber die Konzentrationen zur Zeit der Messung und nicht die des Gleichgewichts. In der Thermodynamik-Literatur wird statt κ oft Q als Symbol verwendet, was im Zusammenhang mit der Elektrochemie zu Verwechslung mit der Ladungsmenge führen kann. Im finalen Gleichgewicht ist ΔG = 0, also 0 = ΔG° + RT lnκ, womit lnK = lnκ, da ΔG° = –RT lnK. Unsere Bruttoreaktion im Daniell-Element ist Cu2+ + Zn Cu + Zn2+ also [Zn 2 ] . [Cu 2 ] Zusammengefasst: –RT lnK + RT lnκ = –nFΔE oder E RT RT RT RT 1 RT 1 ln K ln ln K ln E ln nF nF nF nF nF 74 Dies ist die Gleichung von Otto Nernst. Sie dient dazu, die Konzentrationsabhängigkeit der EMK zu beschreiben. Für das Daniell-Element RT [Cu 2 ] ln E E mit n = 2. nF [Zn 2 ] Leider ist ΔE eine Spannung, also ein U-Wert. Um Potentiale zu erhalten, mit denen man rechnen und vergleichen kann, muss man ein Bezugsystem definieren, weil es gemäss der speziellen Relativitätstheorie keine absoluten Bezugspunkte geben kann. Physiker definieren die Erde als Bezug für elektrische Potentialmessung (oder irgendein passendes lokales System), für die Chemie ist es sinnvoller, eine bestimmte Halbzellenreaktion zu wählen. Dabei hat man sich für 2 H+ + 2 e– H2 entschieden. Das ist eine „schöne“ Wahl, weil das Element Nr. 1 als Standard dient. Praktisch gesehen ist es eher ein Desaster, weil die Halbzelle schwierig zu handhaben ist. Unsere Potentiale müssen für festgelegte Standardbedingungen gelten, d.h. Konzentrationen und Partialdrucke müssen für die Messung fixiert werden. Das ist für das System H+/H2 alles andere als einfach, weil p H2 101.3kPa und [H+] = 1 M erfüllt sein müssen. Zudem ist H2 ein explosionsgefährlicher Stoff. Nichtsdestotrotz ist das Halbzellen-System Pt | H2 | H+ || die Normalwasserstoff-Elektrode (Normal Hydrogen Electrode NHE) der Standard mit E° ≡ 0 V bei [H+] = 1 M , p H2 101.3kPa und T = 298.15 K (25 °C). Die gezeigte Notation ist eine praktische Konvention. Der senkrechte Strich | steht für eine Phasengrenze, der senkrechte Doppelstrich || für eine Diffusionsbarriere. Das nächste Bild zeigt die Messung des Elektrodenpotentials bei Standardbedingungen für die Halbzelle Cu | Cu2+ || des Daniell-Elements. Die gesamte „Kette“ wird als Pt | H2 | H+ || Cu2+ | Cu notiert. Als Anion in den Halbzellen wird oft Chlorid verwendet, weil es die Einstellung der Potentiale beschleunigt, d.h. als Katalysator wirkt. Als solcher beeinflusst es thermodynamische Kennwerte wie ΔE nicht. Bildet Cl– jedoch Komplexe mit Metallionen, muss es vermieden werden, weil die Komplexbildung die Thermodynamik ändert. Diese Einflüsse werden wir im nächsten Kapitel ausführlich besprechen. Weil in der gezeigten Anordnung [H+] = 1 M und [Cu2+] = 1 M ist der Nernst-Ausdruck für die Bruttoreaktion Cu + 2 H+ Cu2+ + H2 E E RT [Cu 2 ] ln E 2 F [H ]2 75 U Diaphragma H2 101.3 kPa Cu Pt KCl Lösung [H+] 1M NHE [Cu2+] 1M Vergleichs-Halbzelle Weil aber E 0H /H 0 V ist E 0 E 0Cu 2 /Cu . Auf diese Weise lassen sich beliebige 2 Redoxgleichgewichte vermessen. Auch Systeme ohne feste Metallkomponenten sind zugänglich. Fe3+/Fe2+ können mittels einer Pt-Elektrode gemessen werden. Erforderlich ist [Fe3+] = [Fe2+] = [H+] = 1 M in der Halbzelle. Man kann sich die Abtastung durch das Pt so vorstellen, dass die Elektronen beim Austausch zwischen Fe3+ und Fe2+ zum Teil über das Metall transferiert werden und die Elektrode so die Ladungen „fühlt“. Die Sammlung der Potentiale bei Standardbedingungen wird „Elektrochemische Spannungsreihe“ genannt. Die offizielle Bezeichnung der Potentiale selbst ist „Standard-Elektrodenpotential“. Ältere sinngemässe Bezeichnungen sind „Normalpotential“und „Standard-Reduktionspotential“. Alle diese Potentiale sind der Reduktionsreaktion der Halbzelle zugeordnet: Red Ox + n e– Es gibt ältere Tabellen mit Standard-Oxidationspotentialen, diese haben einfach das inverse Vorzeichen. Die Bezeichnung „Redoxpotential“ ist unsinnig und wird oft in der Biochemie verwendet. Gemeint sind in der Regel Standard-Elektrodenpotentiale. Für das Daniell- 76 Element findet man E 0Cu 2 /Cu 0.34 V und E 0Zn 2 / Zn 0.76 V . Somit beträgt ΔE° = 0.34 V - (–0.76 V) = 1.10 V, falls die Konzentrationen 1 M sind. E +0.34 V 0.000 V + 1.10 V - 0.76 V Für andere Konzentrationen muss man E E 0Cu 2+ /Cu E 0Zn 2+ /Zn RT [Cu 2 ] ln 2 F [Zn 2 ] mit der Nernst-Gleichung rechnen. Nernst-Gleichungen kann man auch für Halbzellen schreiben und sie nachher zu den Gesamtzellen durch Differenzbildung kombinieren. Für die NHE lautet die Gleichung E E 0H+ /H 2 RT [H + ]2 ln 2F pH2 in der konventionellen Richtung der Reduktion. In dieser Schreibweise steht im konzentrationsabhängigen Term die oxidierte Form immer im Zähler und die reduzierte im Nenner. Eventuelle „Hilfsreagenzien“ wie H+ oder OH– müssen ebenfalls in der Gleichung stehen, sie beeinflussen das Potential erheblich. H2O wird nicht notiert, seine Überschusskonzentration ist stets so hoch, dass es in die Konstanten integriert wird (hier in E°). Das gilt nicht in nichtwässriger Lösung, in der früher erwähnten Karl-Fischer Reaktion von SO2 zu SO3 in methanolischer Lösung als Beispiel ist H2O natürlich ein limitierender Faktor. Alternative Referenzsysteme Die Wahrscheinlichkeit, dass man in seinem Chemikerleben eine leibhaftige NHE zu Gesicht bekommt, ist recht klein. Trotzdem kann man ab und zu in Verlegenheit kommen, ein 77 Potential zu messen. Dazu verwendet man ein „Referenzelektrode“ als zweite Halbzelle. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass sie unter auch misslichen Umständen i.A. ein stabiles Potential relativ zur NHE aufweist. Es existierten einige Varianten, doch unter diesen hat sich die Silber/Silberchlorid-Elektrode klar durchgesetzt und ist für wässrige Lösung praktisch alleine gebräuchlich. Für Messungen in organischen Lösungsmitteln verwendet man das Ferrocenium/Ferrocen System Fe(cp)2+/Fe(cp)2 mit Pt-Abgriff. Die Silber/Silberchlorid-Elektrode (Ag/AgCl) beruht auf dem Löslichkeitsprodukt des AgCl, das die [Ag+] über einen weiten Bereich von Bedingungen fast konstant hält. Das AusgangsRedoxpaar ist Ag Ag+ + e– E 0Ag /Ag 0.800 V Mit K so (AgCl) [Ag ][Cl ] 1010 M 2 kann man [Ag+] in der Nernst-Gleichung substituieren: E E 0Ag+ /Ag RT ln[Ag ] F → E E 0Ag+ /Ag K RT ln so [Cl ] F Wenn man [Cl–] konstant macht, indem man gesättigte KCl (ca. 3 M) verwendet, hat man ein äusserst stabiles Potential von +0.200 V. Schema: Ag | AgCl | KCl || Eine ältere, in der Literatur noch oft zu findende Referenzhalbzelle ist die so genannte Kalomel-Elektrode. Kalomel ist Hg2Cl2, ein schwerlösliches Salz des Hg22+ Ions. „Kalomel“ heisst „schönes Schwarz“, obwohl der frisch hergestellte Stoff rein weiss ist. Licht oder Alkali lösen aber eine Disproportionierungsreaktion aus: Hg2Cl2 → Hg + HgCl2 Weil das Quecksilber dabei fein verteilt abgeschieden wird, erscheint die Substanz dann schwarz. Das AgCl der Silber/Silberchlorid-Elektrode unterliegt ebenfalls der Photolyse, womit die Packung der Elektrode nach einiger Zeit braun erscheint, weil Ag ausgeschieden wird. In beiden Fällen wird die Funktion nicht beeinträchtigt, weil die Umsetzung durch Licht nur an der Oberfläche geschieht. Der grösste Teil der Masse bleibt immer noch das potentialbestimmende Metallsalz. Die Kalomel-Elektrode wird beschrieben als Pt | Hg | Hg2Cl2 | KCl || Ein Pt-Draht taucht in flüssiges Hg-Metall, das mit einer KCl-Lösung (gesättigt), die die Hg2Cl2-Suspension enthält, kontaktiert ist. Im Gegensatz zur Ag/AgCl-Elektrode gibt es hier 2 Flüssigkeiten, was die Handlichkeit einschränkt. 78 Anwendung der Nernst-Gleichung Mit Hilfe der Nernst-Gleichung und den tabellierten Werten der Spannungsreihe können wir, wenn wir auch die Konzentrationen im Elektrolyten kennen, die zu erwartende Spannung des galvanischen Elements einer Kombination von Halbzellen berechnen. Sei E1 E10 RT [Ox1 ] ln nF [Red1 ] und E 2 E 02 RT [Ox 2 ] ln mF [Red 2 ] Falls n ≠ m muss das kleinste gemeinsame Vielfache k = a•n = b•m bestimmt werden. Daraus folgt b RT [Ox 2 ] E2 E ln kF [Red 2 ] a RT [Ox1 ] E1 E ln und kF [Red1 ] 0 1 ΔE = E1 – E2 für Daraus folgt 0 2 Ox1 + ne– → Red1 und Red2 somit → Ox2 + me– a [Ox ] b RT [Ox1 ] 2 ln E E1 E 2 E E ln kF [Red1 ] [Red ] 2 0 1 0 2 Zusammengefasst a b RT [Ox1 ] [Red 2 ] E E E ln kF [Red1 ] [Ox 2 ] mit [Ox ] a [Red ] b 1 2 G kF E kF (E E ) RT ln [Red ] [Ox 1 2] 0 1 0 2 0 1 0 2 Wir können also die Spannung ΔE genauso wie die Gibbs-Energie der Reaktion auf diese Weise berechnen. Die oben stehende Formulierung bezieht sich auf die Annahme, dass Reaktion 1 die erwartete Reduktion repräsentiert und Reaktion 2 die erwartete Oxidation. Ist ΔE positiv, und somit ΔG negativ, wird die Reaktion spontan ablaufen. Bei umgekehrten Vorzeichen läuft die Reaktion rückwärts, bei ΔE = 0 V herrscht Gleichgewicht und es tritt keine Reaktion ein. Wir können auch Potentiale berechnen, die wir nicht messen können, Beispiel: Bekannt sind Fe3+ + 3e– → Fe Fe2+ + 2e– → Fe E 0Fe2+ /Fe 0.44 V Fe3+ + e– → Fe2+ E 0Fe3+ /Fe2 0.77 V Wir erinnern uns, dass E 0 1 RT 1 [Fe 2 ] , und K3 3 K ln K . K1 2 2 3 [Fe ] [Fe ] [Fe ] nF 79 Damit ist K 3 K1 K 2 und ln K 3 ln K1 ln K 2 . E 0Fe3+ /Fe 0 0 RT RT RT 2 FE Fe2+ /Fe FE Fe3+ /Fe2 ln K 3 ln K1 ln K 2 3F 3F 3F RT RT Zusammengefasst E 0 Fe3+ /Fe 2E 0Fe2+ /Fe E 0Fe3+ /Fe2 3 2(0.44 V) (0.77 V) 0.11V 0.037 V 3 3 Konzentrationszellen Es braucht nicht unbedingt 2 verschiedene Stoffe, um eine Potentialdifferenz zu erzeugen. Konzentrationsunterschiede genügen. Wir betrachten folgende Anordnung: U Diaphragma Cu Cu KCl Lösung [Cu2+] 1M Hohe Konzentration [Cu2+] 0.01 M Tiefe Konzentration Hier erhält man für die Zellspannung 80 E RT RT RT [Cu 2 ]links , weil E° natürlich gleich ist. ln[Cu 2 ]links ln[Cu 2 ]rechts ln 2F 2F 2 F [Cu 2 ]rechts Dennoch ergibt sich ein messbarer Wert von ca. 0.06 V bei Raumtemperatur bei den angegebenen Konzentrationen. Die wohl bekannteste Konzentrationszelle ist die Glaselektrode. Glas ist eigentlich ein Isolator, wie kann man da eine Elektrode herstellen? Nun, es muss bei einer potentiometrischen Messung ja kein Strom fliessen, eine Ungleichverteilung von Ladungen genügt. Glas ist ein Na-Ca Silikat und besitzt damit Ionen austauschende Gruppen. Am besten bindet Glas H+, ansonsten aber auch Na+ und K+. Oberfläche - OH O Si Si O Si Si O O O O O Si - Si Si O O O O OH2 Si O O + OH O O Si Si Inneres Die Si-O– Gruppen an der Glasoberfläche können mit H+, Na+ oder gar 2 H+ belegt sein. Ist die kontaktierende Lösung sauer, so nimmt die Zahl der doppelt mit H+ belegten Funktionen zu, es baut sich eine schwache positive Ladung auf. In Kontakt mit alkalischer Lösung wird die Oberfläche deprotoniert, die äussere Ladungsneutralität wird nur durch lose gebundene Alkali-Ionen hergestellt. Wenn man eine dünnwandige Glaskugel (Wandstärke 0.2-0.4 mm) verwendet, kann man über die Glaswand eine Potentialdifferenz erzeugen, falls innere und äussere Lösung verschiedene pH-Werte besitzen. Diese Differenz ist sehr stabil, weil das Glas eben gerade nicht gut leitet. Der Aufbau wird vervollständigt durch eine Ableitelektrode, die eine galvanische Halbzelle sein muss. Meist wird eine Ag/AgCl-Elektrode eingesetzt. Die Abbildung 21.9. im Lehrbuch ist irreführend, man kann nicht einfach einen namenlosen Draht in die Innenlösung stecken. Das Schaltschema ist Ag | AgCl | 3 M KCl, 10-7 M H+ | Glas | unbekannte [H+] || 3 M KCl | AgCl | Ag Das Potential der Kette ist, weil abgesehen von der Glasmembran zwei identische Halbzellen gegeneinander geschaltet sind, 81 E RT [H ]aussen ln [H ]innen F Weil [H+]innen konstant gehalten wird durch die Pufferfüllung, ist das Potential nur noch von [H+]aussen abhängig. Bei äusserem pH = 7 sollte das System E = 0 V anzeigen. U Ag Ag KCl 3 M Puffer pH=7 KCl 3 M AgCl Messlösung Diaphragma Wenn wir also eine Säure-Base Reaktion mit der Glaselektrode verfolgen (d.h. kontinuierlich E ln[H ] messen), benutzen wir eine elektrochemische Konzentrationszelle. Dies funktioniert auch mit andern Elektroden. Mit einer Ag-Elektrode kann man [Ag+] verfolgen, mit einer Pt-Elektrode homogene Redoxsysteme wie Fe3+/Fe2+. Dabei muss man allerdings darauf achten, dass immer ein Redoxpaar dominiert, weil die Pt-Elektrode nicht diskriminiert (ausser für Pt enthaltende Spezies, was kein häufiger Fall sein wird). Die Verfolgung der [Ag+] mit Hilfe einer Ag-Draht-Elektrode wird häufig bei Fällungstitrationen mit Ag+ durchgeführt. 82 Glaselektrode Kombinierte Glaselektrode Ableitelektrode: Meist Ag/AgCl 3 M KCl Glasmembrane: Austauscher für + + + Na /K und H Porzellanfritte + [H ] innen Puffer pH = 7 mit 3 M KCl + [H ] innen + [H ] + + aussen Äussere Ableitelektrode: Meist Ag/AgCl + + + + + + ++ + ++++ + + + + + + + + +++ + + + + + +=H + Bei der kombinierten Glaselektrode ist die zweite elektrochemische Halbzelle, die Referenzelektrode, schon enthalten. Meistens ist sie in einem Mantelgefäss um den eigentlichen Elektrodenschaft eingebaut und enthält eine Ag/AgCl Elektrode in 3M KCl. Der Kontakt der Referenzelektode zur Messlösung wird durch eine poröse Porzellanfritte knapp oberhalb der Glaskugel hergestellt. Elektrolyse und Elektrodenpotential Man könnte in Versuchung kommen und behaupten, mit der Messung von StandardElektrodenpotentialen und der Verwendung der Nernst-Gleichung liesse sich der Ablauf einer Elektrolyse vorhersagen. Es kann funktionieren, ist aber nicht die Regel. Der Grund dafür sind die Mechanismen und Kinetik der Elektrodenreaktionen, die bei der Potentialmessung überhaupt nicht berücksichtigt werden, weil man die Reaktionen nicht wirklich ablaufen lässt. Beispiel von früher: Wenn wir NaCl-Lösung elektrolysieren, entsteht an der Anode Chlor statt Sauerstoff, obwohl 83 E 0O2 /H2O 1.23V und E 0Cl 2 /Cl 1.36 V Der Aufbau von O2 aus H2O ist mechanistisch komplexer als die Bildung von Cl2 aus Cl–, deshalb „gewinnt“ der thermodynamisch anspruchsvollere Prozess das kinetische Rennen. Die Regel, dass Abläufe mit weniger Schritten schneller sind, ist intuitiv einsichtig und mit wenigen Ausnahmen für vergleichbare Reaktionen gültig. Auch wenn keine konkurrierenden Systeme für eine Reaktion vorliegen, benötigt man oft eine grosse Überspannung η gegenüber dem Gleichgewichtspotential, um eine Reaktion mit feststellbarer Geschwindigkeit voranzutreiben. Einen bedeutenden Einfluss übt auch das Elektrodenmaterial aus. Reaktionen zwischen gelösten Metallionen und der elementaren Metallelektrode haben eine niedere Aktivierungsenergie, brauchen wenig Überspannung. Das gilt aber nur beschränkt für Metalle, die sich an der Luft mit einer Oxidschicht überziehen, und das sind alle, deren Standard-Elektrodenpotentiale etwa gleich dem des Kupfers oder negativer sind. Die isolierende Oxidschicht wirkt als Reaktionsbarriere und verlangt das Anlegen einer Überspannung zum Treiben der Reaktion. Kommerzielle galvanische Zellen Brennstoffzelle H2 → 2 H+ + 2 e– O2 + 4 H+ + 4 e– → 2 H2O 84 Leclanché-Element Zn → Zn2+ + 2 e– 2 MnO2 + 2 NH4+ + 2 e– → Mn2O3•H2O + 2 NH3 Jerry Crimson Mann & Andel Früh 2006 Li-Ionen Akkumulator Li(Cgraphit) → Li+ + e– + Cgraphit Li1-nCoO2 + n Li+ + n e– → LiCoO2 Cepheiden 2008 Es existieren weitere Typen mit andern Metalloxiden als Li+ Akzeptor. 85 Redox-Diagramme Um eine Übersicht über die Oxidationszahlen von durch Redoxreaktionen ineinander überführbaren Ionen oder Molekülen zu erhalten, wurden graphische Darstellungen eingeführt. Die ältere und einfachere Version stammt von W. M. Latimer. Dabei werden die Spezies nach sinkender Oxidationszahl von links nach rechts geordnet und durch Pfeile, über denen das Standard-Elektrodenpotential der entsprechenden Halbzelle geschrieben wird, verbunden. Beispiel: O2, HO2, H2O2, H2O, Standardbedingungen: 0.70 V 0.13V 1.51V 1.78V O 2 HO 2 H 2 O 2 H 2O 1.23 V O3 kann nicht hier einbezogen werden, weil es eine andere Form des elementaren Zustands von Sauerstoff ist. Weiteres Beispiel: Mangan, Standardbedingungen: 1.23 V 1.54V 1.185V MnO MnO MnO 2 Mn 3 Mn 2 Mn 4 0.56V 2 4 2.09V 0.95V 1.51 V Um mehr Information unmittelbar sichtbar zu machen, muss man eine zweidimensionale Version verwenden. Die gebräuchlichste Version ist das Diagramm nach A. A. Frost. Dabei bezeichnet die Abszisse die Oxidationszahl und die Ordinate die Gibbs-Energie ΔG der Reaktion, oder nE, da dieser Ausdruck zu ΔG proportional ist. Ausgehend vom Element an der Position 0 wird der entsprechende Wert nE° schrittweise als Differenz mit Vorzeichen aufgetragen. Im Folgenden das Frost-Diagramm von Mangan, Standardbedingungen: 6 MnO4(-) 5 HMnO4(-) 4 3 nE° 2 1 Mn 0 MnO2 -1 Mn(3+) -2 Mn(2+) -3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 z 86 Die Steigung der Verbindungslinie zwischen zwei Oxidationszahlen ist dann E° der Reaktion. Das gilt auch für nicht benachbarte Spezies, man kann also die Elektrodenpotentiale nicht gemessener Reaktionen graphisch schätzen, statt wie oben gezeigt, berechnen. In einem FrostDiagramm ist sofort ersichtlich, welches die thermodynamisch stabilste Spezies des Elements ist. Im Falle von Mangan ist das Mn2+. Ebenso kann man die Möglichkeit zur Disproportionierung ablesen: Liegt ein Punkt über der Verbindungslinie seiner beiden Nachbarn, so neigt die zugeordnete Spezies zum Zerfall in diese beiden Nachbarn. Bei Mangan ist dies der Fall für Mn3+ und HMnO4−, was auch den Beobachtungen entspricht. Das nächste Diagramm zeigt die Redoxverhältnisse für chlorhaltige Oxido-Spezies und Chlorid unter Standardbedingungen. Cl− ist die stabilste Form, was bei der Elektronegativität des Chlors nicht verwundert. Die einzige zur Disproportionierung neigende Spezies ist HClO2, was auch den Beobachtungen entspricht. 11 10 HClO4 9 8 HClO3 7 6 5 nE° HClO2 4 3 2 HClO 1 Cl2 0 -1 Cl(-) -2 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 z Frost-Diagramme können auch für Elektrodenpotentiale, die sich nicht auf Standardbedingungen beziehen, erstellt werden, jedoch müssen alle eingetragenen Potentiale denselben Bedingungen entsprechen. 87 Komplexchemie (Koordinationschemie) Um 1893 gelang es Alfred Werner an der Universität Zürich, eine Erklärung zu finden, warum eine bekannte Verbindung der Zusammensetzung CoCl3•6NH3 stabil war, obwohl es nie gelungen war, CoCl3 zu isolieren (Warum geht das nicht?). Die Schreibweise der stabilen Verbindung ist analog zu der von Stoffen mit so genanntem Kristallwasser, wie z.B. CrCl3•6H2O. Solche Verbindungen waren damals schon zuhauf bekannt, doch niemand konnte sich den Grund für die Präsenz des H2O bzw. NH3 vorstellen. Werner fand auch ein Paar von Verbindungen der Zusammensetzung CoCl3•4NH3, von denen eine grün und die andere violett ist. Da CoCl3•6NH3 nicht zerfiel, postulierte Werner, dass das Co3+ durch NH3Moleküle vor den Cl– Ionen abgeschirmt wird, sie das Metall einhüllen. Die einfachste Anordnung von 6 Molekülen um ein Atom ist das Oktaeder mit je einem Molekül an den Ecken: NH3 NH3 NH3 3+ Co NH3 NH3 NH3 Mit diesem Ansatz konnte er zwanglos auch die beiden verschiedenfarbigen CoCl3•4NH3 erklären: NH3 Cl NH3 Cl 3+ - NH3 3+ Co NH3 cis NH3 Co Cl NH3 - - NH3 NH3 Cl - trans Demnach handelt es sich um 2 Strukturisomere. Werners Ideen wurden vielfach bestätigt, und die Art der Bindung wurde später durch Lewis erklärt: Es handelt sich um Säure-Base Verbindungen, wobei das Metall in der Regel als Säure auftritt und die daran gebundenen Moleküle und Ionen als Basen. Werner nannte diese Gruppen Liganden, was immer noch gebräuchlich ist. 88 Werners Analysemethoden Die Methoden, die Alfred Werner zur Erkenntnis führten, dass es Komplexe gibt, sind noch heute gebräuchlich, allerdings nicht zur Strukturbestimmung. Die heute üblichen spektroskopischen Untersuchungsmethoden waren damals unbekannt. Er benutzte Leitfähigkeitsmessungen und Titrationstechniken zur Festlegung stöchiometrischer Zusammenhänge, und die elementare Zusammensetzung konnte damals schon recht genau durch Pyrolyse- und Verbrennungstechniken bestimmt werden. Dabei wurden die Zersetzungsgase aufgefangen und quantitativ gemessen, eine Technik, die schon die Lavoisiers perfektioniert hatten (und heute noch benutzt wird). Den Metallgehalt erhielt man meist mit gravimetrischen Methoden, indem man das Metall nach Zersetzung der Verbindung in eine bekannte Form, z.B. ein Oxid oder Sulfat überführte und dessen Masse genau bestimmte. Man muss hier anmerken, dass Werner in erster Linie so genannt kinetisch inerte Komplexe studierte. Das war keine Absicht, aber auch kein Zufall. Die viel zahlreicheren kinetisch labilen Komplexe lassen sich meist nicht in der Form, in der sie in Lösung vorliegen, als Festkörper isolieren. Die kinetisch inerten Komplexe zerfallen ähnlich langsam wie organische Moleküle, also kann man klar zwischen koordinierten Molekülen und Ionen und solchen, die zur Erhaltung der Elektroneutralität vorhanden sind, unterscheiden. Jene dissoziieren in der Lösung und können durch geeignete Reaktionen der qualitativen Analytik direkt nachgewiesen werden, die am Metallion gebundenen hingegen nicht. Ausserdem kann man diese Gegenionen zum Komplex titrieren, sofern eine geeignete Reaktion existiert, die nicht durch den inerten Komplex gestört wird. Durch Messung der Aequivalentleitfähigkeit (Leitfähigkeit pro Konzentrationseinheit) kann man alternativ erkennen, wie viele dissoziierte Ionen vorliegen. Anhand der Feststellung, dass bei gleicher Zusammensetzung verschiedene Farben auftreten können, schloss Werner auf das Vorhandensein von Isomeren. Man könnte also behaupten, Werner habe „Spektroskopie“ im rudimentären Sinn eingesetzt. Vorkommen von Metallkomplexen und Funktion Metallkomplexe kommen an vielen Orten vor: In Mineralien, im Oberflächen- und Grundwasser, in Organismen, und selbstverständlich in Gewerbe und Industrie. Am seltensten sind sie in der Atmosphäre, es gibt wenige flüchtige Verbindungen dieser Art. Ebenso 89 vielfältig ist ihre Funktion: In Mineralien sind sie strukturbestimmende Bestandteile, im Wasser sind sie schlicht die Formen, in denen Metallionen darin überhaupt existieren, in Organismen sind sie Zentren in Katalysatorfunktionen (Enzyme). In der Technik dienen sie ebenfalls als Katalysatoren, als Farbpigmente und vieles Andere. Das Leben benötigt Kohlenstoff, Licht und Wasser. Ohne Metallkomplexe würde jedoch nicht viel laufen: Die essentiellen Prozesse der Photosynthese und Zellatmung beruhen alle auf Metallkomplexen, neben Tausenden von weiteren biochemischen Prozessen. Bindungen in Komplexen Das Auffälligste an den Metallkomplexen ist die in der Regel grosse Zahl von Bindungen an einem zentralen Atom. Alfred Werner selbst hatte noch kein Modell dafür, die Geometrie der Verbindungen bestimmte er nur über die von ihm so bezeichnete Koordinationszahl, das ist die Zahl der unmittelbar am Metall gebundenen Liganden. Er argumentierte völlig korrekt, dass sich die Liganden aus energetischen Gründen in eine Anordnung geringster Raumforderung und Abstossung begeben würden. Für 6 Liganden ist das ein Oktaeder, für 4 ein Tetraeder. Ausserdem kennt man Komplexe mit 2 und 5 Liganden sowie 7-12 Liganden bei sehr grossen Metallatomen. Eher selten ist die Koordinationszahl 3. Bei der Koordinationszahl 4 wurden auch Strukturen gefunden, die quadratisch planar sind. Bei näherer Betrachtung stellt sich bei diesen heraus, dass sie eigentlich Oktaeder sind, die auf einer Achse keine oder nur sehr lose gebundene Liganden tragen. Häufige Komplexformen mit je einem Beispiel: 5 2 [AgCl2]¯ Fe(CO)5 3 [HgI3]¯ [SnCl3]¯ 4 6 [Co(NH3)6]3+ [Zn(NH3)4]2+ [Ni(CN)4]2¯ 90 Die elektronische Natur der Metall-Ligand Bindung wurde bald als Interaktion von nichtbindenden Elektronenpaaren der Liganden mit den an Elektronen defizitären Metallzentren erkannt, i.a. fehlen ihnen zumindest die s- und p-Elektronen der Valenzschale, und oft noch ein Teil der d-Elektronen der nächst tieferen Schale. Es gibt zwar Komplexe mit tiefen Oxidationsstufen von Metallen, aber nur mit sehr speziellen Liganden und nicht in Lösungsmitteln, die selbst als Liganden auftreten können. Eine Besonderheit ist auch das gelegentliche Auftreten von C=C Doppelbindungen als Liganden anstelle von Atomen mit nichtbindenden Elektronenpaaren. Wir kennen solche Bindungen schon von früher, sie entsprechen dem Säure-Base Konzept von G. N. Lewis. Der Unterschied zu damals besteht darin, dass der Elektronenpaar-Akzeptor, das Metall, mehrere Elektronenpaar-Donoren, also Basen bzw. Liganden, binden kann. Tatsächlich binden die meisten Liganden auch H+. Damit lassen sich die Bindungsverhältnisse mit dem VSEPR-Modell meist korrekt behandeln wie bei kovalenten Verbindungen, obwohl die Bindungen selbst oft eher ionischen Charakter besitzen. Je nach Koordinationszahl und Zahl der d-Elektronen sieht die Besetzung etwas anders aus. Auf jeden Fall besetzen Ligand-Elektronenpaare zuerst die 4s- und 4p-Zustände (bis zu 8 e−) im Metall (der 4. Periode), bevor weitere Elektronen in die 3d-Zustände gehen. Sind die 3d-Zustände im Metall schon besetzt, so wird Besetzung der 4d-Zustände angenommen. Das ist eher etwas unrealistisch, solche Komplexe haben ziemlich ionischen Charakter. Ti 3d 4s 4p 4d 3d 4s 4p 4d 3d 4s 4p 4d 3d 4s 4p 4d 3d 4s 4p 4d Ti3+(H2O)6 FeCl4- CoF63- Co(NH3)63+ Metall-Elektronen Donor-Elektronenpaare 91 LCAO-MO-Modell der Bindung in oktaedrischen, tetraedrischen und quadratisch-planaren Komplexen: Wir kombinieren 4 oder 6 Ligandorbitale, i.a. vom s- oder σ-Typ, mit den 4sund 4p- Orbitalen des Metalls (aus der 4. Periode). Die 3d-Elektronen tragen normalerweise nicht viel zum bindenden Anteil bei, die Bindungselektronen stammen, wie bei der normalen Säure-Base Reaktion, ausschliesslich vom Donor (Base). Es existiert allerdings eine Interaktion zwischen den d-Orbitalen, die auf die Donororbitale ausgerichtet sind. Diese ist antibindender Art, die betreffenden d-Orbitale werden energetisch angehoben. Im Falle von Koordinationszahl 6 sind dies im selben Ausmass das d x2 y 2 und das d z 2 Orbital. Im Falle des quadratisch-planaren Komplexes ist es hauptsächlich das d x2 y 2 Orbital und weniger das d z 2 Orbital. Bei Koordinationszahl 4 und tetraedrischer Geometrie werden die d xy , d xz und d yz Orbitale energetisch ungünstig, dafür d x2 y 2 und d z 2 nicht. Nebenstehend ist das MOSchema eines rel. Energie symmetrischen oktaedrischen Komplexes dargestellt, die bindenden 4p 4s Orbitale sind energetisch 3d näher den LigandLiganden-MOs Donororbitalen. Die Energie der d-Elektronen wird charakteristisch aufgeteilt in drei nichtbindende und zwei schwach antibindende Zustände, wie vorgehend beschrieben. Das nächste Schema zeigt den quadratisch planaren Fall, wo nur noch 4 rel. Energie Ligandorbitale beteiligt sind, was strenggenommen 4p 4s nicht korrekt ist, weil es 3d sich um gestreckte Liganden-MOs Oktaeder handelt. Eine tiefer gehende Behandlung würde den Rahmen der Basisvorlesung sprengen. 92 Detaillierte Betrachtungen sind späteren Spezialvorlesungen vorbehalten. Mit 4 Liganden und tetraedrischer Geometrie rel. Energie sieht das MO-Schema nochmals anders aus, wie links gezeigt. Hier kehrt 4p 4s sich die energetische 3d Verteilung der dLiganden-MOs Funktionen um, aus den Gründen, die schon weiter oben dargelegt wurden. Die energetische Verschiebung der d- Elektronen hat wenig Einfluss auf die Ligandbindungsstärke, jedoch auf physikalische Eigenschaften des Komplexes und sein reaktionskinetisches Verhalten. Ligandfeld-Aufspaltung Wie schon oben erwähnt, wird unter dem Einfluss der Donor-Elektronen der Liganden die Energie der d-Zustände im Metall verändert. Die Liganden werden einerseits vom Metallzentrum elektrostatisch angezogen, andererseits stossen sie sich mit der Elektronendichte der d-Zustände ab. Besetzung dieser Zustände, wenn die Orbitalgeometrie Vorzugsrichtungen auf die Bindungsachsen der Donoren aufweist, vermindert die Stabilität des Systems. Das Phänomen wird Ligandfeldaufspaltung der d-Energien genannt. In einem symmetrischen oktaedrischen Komplex wird der entstandene Energieunterschied Δo genannt, in einem symmetrischen tetraedrischen System Δt. In der Regel ist Δo > Δt, weil 6 Liganden ein stärkeres elektrisches Feld erzeugen als 4. Wenn Δo grösser wird als die Energie, die es kostet, zwei Elektronen mit antiparallelem Spin in einem Energiezustand unterzubringen (Spin-Paarungsenergie), dann werden die d-Elektronen so weit wie möglich gepaart. Dadurch verschwindet das magnetische Moment des Spins dieser Elektronen, und das gesamte magnetische Moment des Metalls nimmt ab. Sind alle d-Elektronen gepaart, ist das Metall diamagnetisch. Komplexe mit maximal gepaarten d-Elektronen nennt man low-spin, solche mit maximal ungepaarten high-spin. Unterschiedliche Aufspaltung Δo hat noch weitere Folgen: Obwohl die Absorption eines Lichtquants (Photons) durch einen Übergang eines Elektrons von einem d-Zustand zu einem andern d-Zustand quantenmechanisch verboten ist, 93 weil sich die Symmetrie des Elektronenzustands nicht ändert, gibt es eine Restwahrscheinlichkeit o < Ep high spin o dafür. Der Grund dafür sind geringe Abweichungen von der perfekten oktaederischen Form. Deshalb wird dennoch etwas Licht von spezifischer Wellenlänge absorbiert, was den Übergangsmetallkomplexen ihre charakteristischen, aber nicht allzu kräftigen o o > Ep low spin Farben verleiht. Das gilt auch für quadratischplanare und tetraedrische Komplexe. Ein noch stärkeres Verbot betrifft die Spinumkehr bei der Anregung von Elektronen. Bei einer d5-high spin Konfiguration können deshalb keine Übergänge stattfinden, diese Ionen sind farblos. h h d6 high spin d5 high spin Die d3 Konfiguration und die d6 low spin Konfiguration zeigen aufgrund ihrer hohen Symmetrie eine bemerkenswerte Trägheit bei Austauschreaktionen von Liganden. Um einen Liganden austreten und einen neuen eintreten zu lassen, müsste die hohe Symmetrie kurzfristig aufgehoben werden. Dies geschieht nur selten, also ist die Reaktionsrate gering. Diese Art Komplexe nennt man, wie schon erwähnt, kinetisch inert. Alfred Werners erste Studienobjekte waren die d6 low spin Komplexe von CoIII. d3 d6 low spin Die Grösse von Δo und Δt hängt wesentlich von der Donorstärke der Liganden ab. Je stärkere Lewisbasen sie sind, desto grösser wird die Aufspaltung der d-Energien. Grosse Aufspaltung bedeutet dann Lichtabsorption bei kurzen Wellenlängen, weil viel Energie zur Anregung 94 benötigt wird. Es bedeutet auch Tendenz zu low spin Systemen, weil die Stabilisierung der Bindung die Paarung der Elektronen erlaubt. Reaktionen von Komplexen Metallkomplexe gehen in erster Linie zwei Arten von Reaktionen ein: Ligandaustauschreaktionen, die man auch als Lewis Säure-Base Reaktionen auffassen kann, und Redoxreaktionen, die vor allem das Metallion betreffen. [Cu(H2O)6]2+ + 4 NH3 [Cu(NH3)4]2+ + 6 H2O Ligandaustausch 2 [Fe(CN)6]4– + Br2 2 [Fe(CN)6]3– + 2 Br– Redoxreaktion Komplexgleichgewichte Weil es sich bei Lewis Säure-Base Reaktionen immer um Gleichgewichte handelt, können wir im Zusammenhang mit Komplexbildungsreaktionen und damit gekoppelten Vorgängen wieder das Massenwirkungsgesetz anwenden. Die „Komplexbildung“ selbst ist eigentlich eine Ligandaustauschreaktion. Geht ein festes Metallsalz in Lösung, so tritt das Metallkation tatsächlich aus einem Komplex mit den Anionen (oder dem Kristallwasser) im Kristall über in einen Komplex mit Lösungsmittelmolekülen. Gibt man dann zur Lösung einen Donor stärker als das Lösungsmittel, wird dieses ausgetauscht und wir haben die „Komplexbildung“, wie sie üblicherweise gemeint ist. Alle Komplexbildungen sind Stufenreaktionen, sofern mehr als ein Ligand gebunden wird. Beispiel: Ein Metallion M2+ liegt hydratisiert vor und tauscht bei der Zugabe des Liganden L mit steigender Konzentration das H2O gegen den Liganden aus. Wir nehmen Koordinationszahl 6 an. [M(H2O)6]2+ + L [ML(H2O)5]2+ + H2O K1 [ML(H2O)5]2+ + L [ML2(H2O)4]2+ + H2O K2 [ML2(H2O)4]2+ + L [ML3(H2O)3]2+ + H2O K3 [ML3(H2O)3]2+ + L [ML4(H2O)2]2+ + H2O K4 [ML4(H2O)2]2+ + L [ML5(H2O)]2+ + H2O K5 [ML5(H2O)]2+ + L [ML6]2+ + H2O K6 Falls der Ligand L ein Anion ist, ändert sich natürlich fortlaufend die Ladung. Oft kann man die einzelnen K nicht richtig bestimmen, sondern nur Bruttoreaktionen bis zu einer 95 bestimmten Stufe. Die Bruttobildungskonstante bis zu einer Komplexbildungsstufe n berechnet sich zu n K1 K 2 K 3 K n , wie man einfach durch Kombinieren der zu den KWerten gehörigen Massenwirkungsgesetze herausfindet. Die Konstanten nehmen in der Regel mit zunehmendem Koordinationsgrad ab. Komplexbildungsgleichgewichte können mit andern Gleichgewichten gekoppelt sein. Typisch ist das für die Protonierungsgleichgewichte der Liganden. Mit Säure kann man manchen Komplex wieder zerlegen. Beispiel: [Cu(NH3)4]2+ Cu2+ + 4 NH3 lg K1 =4.25; lg K2 =3.61; lg K3 =2.98; lg K4=2.24 lg β4 =13.1 NH3 + H+ NH4+ lg Ka = -9 Setzt man das MWG für die Säuredissoziation in das Brutto-Komplexbildungsgleichgewicht ein, erhält man 4 4 [Cu(NH 3 ) 24 ][H ]4 . Das kann man noch zu [Cu 2 ][NH 4 ]4 K a4 K a4 [Cu(NH 3 ) 24 ] 4' umschreiben und erhält das pH-abhängige β4’. Bei pH = 4 2 4 4 [H ] [Cu ][NH 4 ] z.B. beträgt β4’ = 10 ' 4 13.1 1036 107.9 M 4 . Das bedeutet, dass bei diesem pH praktisch M 16 10 4 kein Komplex existiert. Bei pH=9 sieht das anders aus, 10 ' 4 13.1 1036 1013.1 M 4 , der M 36 10 4 Komplex ist voll ausgebildet. Ein weiteres Beispiel demonstriert den Einfluss von Komplexbildungen auf Elektrodenpotentiale. Das Standardelektrodenpotential für Fe3+ + e– Fe2+ E 0Fe3 /Fe2 0.77 V weist Fe3+ als Oxidationsmittel aus. Komplexiert man Fe3+ mit dem Citration, dem Anion der Zitronensäure, so sieht das ganz anders aus. Fe3+ bindet ein Citration mit K1 = 1012. K1 [Fe(cit ) ][H ] [Fe(cit ) ][H ] 12 3 10 wird aufgelöst und in die Nernstgleichung [Fe ] [Fe3 ][Hcit 3 ] K1[Hcit 3 ] eingesetzt: E = E 0Fe3 /Fe2 E=E 0 Fe3 /Fe2 RT [Fe(cit ) ][H ] Weil K1 eine Konstante ist, kann man ln F K1[Hcit 3 ][Fe 2 ] RT 1 RT [Fe(cit ) ][H ] separieren und ein neues E°’ definieren: ln ln F K1 F [Hcit 3 ][Fe 2 ] E 0' = E 0Fe3 /Fe2 RT 1 0.77 V 0.71V 0.06 V . Das Elektrodenpotential wird nahezu 0! ln F K1 96 Wenn man dann noch einen hohen pH-Wert einstellt, kann man das Fe3+ in diesem Komplex nur noch schlecht zu Fe2+ reduzieren, was beim Aqua-Ion kein Problem ist. Auch Löslichkeitsprodukte werden beeinflusst. Kso(AgCl) = 10–10 M2 =[Ag+][Cl–], aber 2 (AgCl2 ) 105 M 2 [AgCl2 ] [Ag ] 1 und damit . Man sieht, dass [Ag+] 2 [AgCl2 ] 2 [Cl ]2 [Ag ][Cl ] durch β2 und die [Cl–] abgesenkt werden, was bei genügend [Cl–] zur Unterschreitung des Löslichkeitsprodukts führt, weil die Komplexbildung von [Cl–]2 abhängt, Kso aber nur linear. Eine andere Darstellungsform dieses Sachverhalts zeigt die algebraische Umformung des Komplexbildungs-MWG unter Separation des Ionenprodukts: [AgCl2 ] [Ag ][Cl ] 2 [Cl ] Falls das Ionenprodukt links Kso überschreitet, findet Fällung statt. Unter hoher [Cl–] wird das aber nicht der Fall sein, weil der Bruch rechts mit steigender [Cl–] immer kleiner wird. [AgCl2–] ist begrenzt durch [Ag+]0, die totale Konzentration an Ag+, auch wenn immer mehr Cl– zugefügt wird. Spezielle Komplexformen Rückbindung Wenn ein Metallzentrum elektronenreich ist, was bei niedrigen Oxidatonszahlen gegeben ist, so kann es bei bestimmten Liganden dazu kommen, dass das das Metall als Donor auftritt. Das Donor-Orbital ist dann ein besetztes d-Orbital, das Akzeptor-Orbital kann ein π*-Orbital oder ein unbesetztes d-Orbital eines Nichtmetalls der 3. oder höheren Periode sein. Es handelt sich im zweiten Fall um ein ähnliches Phänomen wie die zu Beginn beschriebene Hypervalenz in der Valenzbindungstheorie von Atomen in Perioden > 2. Ein typischer Ligand mit π*-Rückbindung ist das Kohlenmonoxid CO, das Komplexe mit Übergangsmetallen der Oxidationszahlen –I, 0, I und II bilden kann (Ni(CO)4, Fe(CO)5, Porphyrin-Fe(II)-CO, etc.). Diese Bindungsart tritt in Ergänzung der σ-Donorbindung des Liganden auf, nicht allein. 97 C CO -Orbital (p kombiniert mit p) besetzt O Metall d-Orbital besetzt C O C O CO -Orbital (p kombiniert mit p) unbesetzt d - Rückbindung Mehrzähnige Liganden – Chelate Metalle binden mehrere Liganden, das ist soweit klar. Wenn das Metall aber mehrere Bindungsstellen hat, kann ein Ligand mit mehr als einer Lewis Base-Funktion und geeigneter Struktur auch mehrere dieser Bindungsstellen besetzen, und es entstehen Ringstrukturen. Den Verbindungstyp nennt man Chelat, von griech. chelè, was „Klaue“ oder „Krebsschere“ bedeutet, weil der Ligand das Metall wie mit einer Zange „packt“. Die Basen eines mehrfach bindenden Liganden werden auch Zähne genannt, es wird von mehrzähnigen Liganden gesprochen. Auffällig dabei ist, dass die Stabilität mit der Zahl der Zähne zunimmt. Das scheint zwar intuitiv richtig zu sein, kann aber dennoch auf verschiedene Weise begründet werden. Die der Intuition näher stehende Begründung besagt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich mehrere Zähne zugleich ablösen, wenn der Ligand einmal gebunden ist. Die Komplexbildung verläuft nämlich, experimentell belegt, auch für solche Liganden schrittweise, und deshalb auch die Dissoziation. Weil der Ligand sich nicht auf einmal lösen kann, ist die Wahrscheinlichkeit der erneuten Bindung eines dissoziierten Zahns hoch, also kann sich der gesamte Ligand schlecht aus der Koordinationssphäre lösen. Die zweite Begründung stützt sich auf die Entropie-Änderung ΔS bei der Komplexbildung. Die Entropiefunktion eines molekularen Systems hängt von den so genannten BewegungsFreiheitsgraden ab. Davon existieren translatorische, rotatorische und vibratorische Freiheitsgrade. Jedes Molekül hat 3 translatorische (Bewegung im Raum) sowie 2-3 98 rotatorische Freiheitsgrade (linear oder dreidimensional). Dazu kommen noch 3n-6 vibratorische Freiheitsgrade (3n-5 bei linearen Molekülen), wobei n die Zahl der Atome des Moleküls ist. Diese Bewegungs-Freiheitsgrade machen die Fähigkeit eines Stoffs, Energie zu speichern, aus. Die physikalische Grösse, die dies ausdrückt, ist die Wärmekapazität dS cp T . Ein normaler 2-zähniger Ligand beispielsweise hat 3 translatorische und 3 dT p rotatorische Freiheitsgrade sowie die vibratorischen. Wenn er koordiniert wird, treten 2 Lösungsmittelmoleküle aus, die bis zu diesem Zeitpunkt keine eigenen translatorischen und rotatorischen Freiheitsgrade hatten. Für den Verlust von 3 rotatorischen und 3 translatorischen Freiheitsgraden des neuen Liganden werden je 2 mal 3 rotatorische und translatorische Freiheitsgrade erzeugt, die Gesamtzahl der Freiheitsgrade des Systems steigt und damit seine Entropie. Die vibratorischen Freiheitsgrade bleiben mehr oder weniger erhalten, weil sie ein intramolekulares Phänomen sind. Weil G H TS und bei positivem ΔS das ΔG negativ wird, bevorzugt die Entropieänderung den 2-zähnigen Liganden in der gebundenen Form, der Komplex ist thermodynamisch stabiler als mit 2 einzähnigen Liganden. Beispiele für mehrzähnige Liganden und ihre Komplexe: NH2 O - H2N O 1,2-Diaminoethan Ethylendiamin (en) O - O + NH + O NH OH O N - O CH3 CH3 - O O 1,2- Dimethyl-3-hydroxypyrid-4(1H)-on Deferipron 2-[2-(Bis(carboxymethyl)amino)ethyl-(carboxymethyl) amino]acetat Ethylendiamin-Tetraacetat (EDTA) O - O O P HO P O Si CH3 P Tris(diphenylphosphanomethyl)-methylsilan Siliphos O O - - 3-carboxylato-3-hydroxy-pentan-1,5dicarboxylat Citrat 99 H2N O O NH2 O NH2 O NH2 - - N H2N O H2N - N O O oktaedrischer tris-en Komplex - O oktaedrischer EDTA-Komplex O O H2N NH2 - H2N Cl - Cl - NH2 - H2O O 3+ - Fe H2O O O O Cl Cl NH2 - - O Fe(III)-Citrat-Komplex NH2 - H2N H2N Enantiomerenpaar eines oktaedrischen bis-en-dichlorido-Komplexes Lewis Säuren – Basen Affinität Um die Affinität („Vorliebe“) einer Base für Protonen zu charakterisieren, verwenden wir die Dissoziationskonstanten Ka. Für Lewis Säure-Base Kombinationen existiert so etwas nicht. Es lässt sich aber feststellen, dass gewisse Ligandtypen sich stärker an bestimmte Metalltypen binden als an andere, es gibt also auch hier unterschiedliche Affinitäten. In den 1960er Jahren verglich R. G. Pearson die Bildungskonstanten zahlreicher Komplexe mit den verschiedensten Liganden. Dabei kam er zum Schluss, dass kleine, schlecht polarisierbare Ligandatome sich stärker an kleine, stark geladene Metallionen binden als an solche mit niedriger Ladung und grossem Radius. Umgekehrt bilden grosse, gut polarisierbare Ligandatome sehr stabile Komplexe mit grossen, wenig geladenen Metallionen. „Gleich und gleich gesellt sich gern!“ Pearson nannte die grossen, gut polarisierbaren Ionen und Atome „weich“, wegen der Beweglichkeit ihrer Elektronenhülle (entspricht der Polarisierbarkeit). Die kleinen, schlecht polarisierbaren Partikel nannte er analog „hart“. Die Idee ist als „hart-weich Konzept der Lewis Säuren und Basen“ oder HSAB (hard and soft acids and bases) bekannt geworden. Die Regel ist gut brauchbar, z.B. bildet Al3+ (sehr hart) eigentlich nur stabile Komplexe mit F– und O-Liganden (sehr hart). Cd2+ (weich) bildet stabile Komplexe mit R-S– Liganden 100 (Thiolate, weich), ebenso weich ist Ag+. Die Metallionen der Perioden 5 und 6 sind auf Grund ihrer grossen Radien weich, ausser sie tragen Ladungen > +2. Sehr interessant ist der Effekt bei Wechsel der Oxidationszahl des Metalls: Fe3+ ist wie Al3+ sehr hart und komplexiert wirklich gut nur F– und O-Liganden. Nach der Reduktion zu Fe2+ ist die Stabilität mit F– praktisch verschwunden, und O-Liganden werden nur noch schlecht gebunden. Dafür werden jetzt Amin-Liganden angenommen, was Fe3+ nur tut, wenn auch noch O dabei ist, oder das Ligandgerüst so steif wie bei einem Porphyrin. Amine gelten zwar noch als hart, sind das aber schon viel weniger als O. Eine Anomalie findet man bei niedrig geladenen Metallionen der 6. Periode. Au+, Hg2+ und Pb2+ binden weiche Liganden sehr gut, aber merkwürdigerweise auch sehr harte wie OH– oder Carboxylate R-COO–. Au+ reagiert mit H2O unter Freisetzung von H+, der pKa für diese Reaktion ist 4, also saurer als Essigsäure, und das trotz der geringen Ladung von +1! Der Grund dafür ist, dass sich hier Quantenmechanik und spezielle Relativität treffen: Das primäre Akzeptororbital der genannten anomalen Ionen ist das 6s, das wie alle s-Funktionen eine ziemlich hohe Dichte am bei diesen grossen Atomen hoch geladenen Kern besitzt. Die eingespeisten Donorelektronen erfahren also eine sehr grosse elektrostatische Kraft. Berechnet man die scheinbare Geschwindigkeit dieser Elektronen, so liegt der Wert nahe bei der Lichtgeschwindigkeit. Ob sich diese Elektronen nun tatsächlich „bewegen“ oder nicht, der relativistische Effekt der Zeitdilatation in Kernnähe ist vorhanden, damit halten sich die Elektronen von aussen gesehen länger nahe am Kern auf als unter nicht-relativistischer Betrachtung. Der Effekt bewirkt eine stärkere Bindung der Donorelektronen als unter nichtrelativistischen Bedingungen erwartet, das Ion ist eine starke Lewis Säure. 101 Anhang: Komplex-Isomere Konstitutionsisomere Ionisationsisomere [Co(NH3)5(SO4)]Br oder [Co(NH3)5(Br)]SO4 Hydratisomere [Cr(OH2)6]Cl3 oder [Cr(OH2)4Cl2 ]Cl•2H2O oder [Cr(OH2)5Cl ]Cl2•H2O Koordinationsisomere [PtII(NH3)4][PtIVCl6] oder [PtIV(NH3)4Cl2][PtIICl4] Bindungsisomere M − NO2 oder M − ONO dioxidonitrato-κN oder dioxidonitrato-κO M – CN oder M – NC cyanido-κN oder cyanido-κO M – SCN oder M – NCS thiocyanato-κS oder thiocyanato-κN Stereoisomere Diastereoisomere NH3 [PtCl2(NH3)2] cis und trans Cl Pt NH3 [CoCl2(NH3)4] cis und trans - NH3 2+ Cl Pt Cl - Cl - 2+ - NH3 Enantiomere (Spiegelbild-Isomerie) [CoCl2(en)2]+ und cis-trans H2N Cl - Cl - Cl Cl NH2 NH2 - NH2 Cl - NH2 3+ Co 3+ 3+ Co H2N H2N NH2 Co - H2N H2N Cl NH2 - NH2 102 Chemische Reaktionen in Lösung Energieumsätze Chemische Reaktionen können quantitativ durch die Angabe des Energieumsatzes, des Wärmeumsatzes und durch die verursachte Entropieänderung charakterisiert werden. Dabei hängen diese Grössen über das einfache Gesetz G H TS zusammen. ΔG, die GibbsEnergie, ist ein Mass für die Tendenz eines chemischen Systems, von einem gegebenen Ausgangszustand in einen andern Zustand überzugehen, das heisst, zu reagieren. Dabei versucht das System, seinen Energieinhalt zu erniedrigen, also Energie an die Umgebung abzugeben. Ein negativer ΔG-Wert charakterisiert diese Situation. Ist ΔG = 0, so herrscht im System (inklusive im Kontakt zur Umgebung) Gleichgewicht. Ist ΔG > 0, läuft die Reaktion, wenn überhaupt, entgegen der notierten Richtung ab. ΔG wird negativ, wenn ΔH stark negativ ist, die Reaktion also Wärme produziert, oder wenn ΔS stark positiv ist, das System durch die Reaktion viele Freiheitsgrade gewinnt. Sind beide Bedingungen erfüllt, wird die Reaktion ein sehr negatives ΔG annehmen. ΔG ist ein idealer Parameter, um das energetische Potential einer chemischen Reaktion zu beschreiben. Leider kann man ΔG nur für gewisse Reaktionen einfach bestimmen, weil es keine direkte Messtechnik für die Erfassung von ΔS gibt. ΔH kann man sehr gut mit einem Kalorimeter erhalten, ein spezielles Gefäss, in dem der Wärmeumsatz anhand von Temperaturänderungen und bekannten Wärmekapazitäten gemessen wird. ΔG kann direkt für Redoxreaktionen bestimmt werden, indem man eine entsprechende galvanische Zelle aufbaut und ΔE misst, welches direkt proportional zu ΔG ist. Mit ΔH aus der Kalorimetrie derselben Reaktion erhält man indirekt ΔS. Eine weitere Möglichkeit, ΔG zu erhalten, besteht in der Ermittlung von Gleichgewichtskonstanten. Dazu muss man aber die Konzentrationen der beteiligten Spezies im Gleichgewicht störungsfrei bestimmen können, was oft nicht möglich ist. Weil die Funktionen ΔG und ΔH Zustandsfunktionen sind, muss ihre gesamte Änderung von einem Ausgangszustand über mehrere Zwischenzustände wieder zum Ausgangszustand verschwinden. Eine solche Kette ist geschlossen und wird thermodynamischer Kreisprozess genannt. Dieser ist durchaus vergleichbar mit den Kreisprozessen für Wärmekraftmaschinen. Leider ist die Anwendbarkeit oft auf ΔH limitiert, weil zu wenige ΔG-Werte bekannt sind. Mit einem Kreisprozess kann man den unbekannten ΔH-Wert (oder ΔG-Wert) eines 103 Reaktionsschritts errechnen, wenn die entsprechenden Werte aller andern Schritte bekannt sind, weil die Summe aller Schritte 0 ergeben muss. Als Beispiel sehen wir uns die Sublimationswärme von NH4Cl(s) an. Dieses Salz verdampft beim Erhitzen direkt aus der festen Phase unter Zerfall in HCl(g) und NH3(g), welche sich beim Abkühlen wieder zu NH4Cl(s) vereinigen. Leider ist die Kalorimetrie von Festkörpern nicht so einfach, besser geht das mit Lösungen, die eine viel grössere Wärmeleitfähigkeit als die meisten Feststoffe, mit Ausnahme der Metalle, besitzen. Die Lösungsenthalpien von HCl(g), NH3(g) und NH4Cl(s) in Wasser sind tabelliert oder nicht schwer zu messen, ebenso die Reaktionsenthalpie von HCl(aq) mit NH3(aq). Wir stellen auf: Hsubl NH4Cl(s) 16.3 NH4+(aq) HCl(g) NH3(g) -75.1 Cl-(aq) -50.3 HCl(aq) -34.6 NH3(aq) Man rechnet H subl H aq (HCl) H aq (NH 3 ) H rxn (HCl+NH 3 ) H aq (NH 4 Cl) 0 ΔHaq(NH4Cl) wird mit negativem Vorzeichen addiert, weil der Reaktionsweg entgegen zur Kreisprozessrichtung verläuft. Also H subl H aq (HCl) H aq (NH 3 ) H rxn (HCl+NH 3 ) H aq (NH 4 Cl) und H subl (75.1) (34.6) (50.3) 16.3 176.3 Alle Zahlenangaben sind in kJ mol–1. Die Kenntnis von ΔH ist nützlich, um eventuelle starke Wärmeentwicklung bei einer Reaktion vorherzusehen, was die Hauptursache von Laborunfällen ist, und entsprechende Kühlungs- oder Moderationstechniken bei solch exothermen Vorgängen vorzusehen. Es hilft auch, die Heizquelle bei endothermen (ΔH positiv) Reaktionen entsprechend zu wählen. ΔG liefert, wie schon gesagt, eine Information über die Ausführbarkeit einer Reaktion. Entsprechende Begriffe sind „exergonisch“ (spontan ablaufend) und „endergonisch“ (nicht spontan bzw. rückwärts laufend). Eine negative Gibbs-Energie ΔG sagt jedoch gar nichts darüber aus, ob eine Reaktion schnell oder langsam abläuft. Man kann zwar die Faustregel 104 anwenden, dass eine Reaktion mit einem sehr negativen ΔG vermutlich schneller abläuft als eine mit einem weniger negativen, aber ein Gesetz ist das nicht. Besonders tückisch ist das bei der Betrachtung der so genannten Kettenreaktionen, als Beispiel diene die Reaktion zwischen H2 und O2 zu H2O. Die Reaktion hat ein negatives ΔG° = -475 kJ mol−1, läuft aber spontan nicht ab, wenn man H2 und O2 mischt. Erst wenn man der Mischung an einem Punkt etwas Energie zuführt, startet die Kette und entlädt sich dem ΔG gemäss in einer wuchtigen Explosion. Im Zusammenhang mit chemischen Reaktionen findet man anstelle der Zustandsfunktionen H und G auch U und F. Die beiden ersteren beschreiben Energieänderungen in chemischen Systemen unter konstantem Druck, dem häufigsten Fall bei der Laborchemie. U und F sind die analogen Funktionen zu H und G für Bedingungen unter konstantem Volumen. Diese Zustände trifft man in geschlossenen Gefässen wie Autoklaven oder Industrie-Reaktoren an. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die Funktionen bei konstantem Druck einen Arbeitsterm pV enthalten: F = U – TS G = H – TS H = U + pV → G = U + pV – TS = F + pV Das wird einsichtig, wenn man sich die Reaktionsbedingungen vor Augen hält: Das abgebildete Reaktionsgefäss hat einen gegen die Umgebung beweglichen Stempel. Tritt während der Reaktion z.B. eine Gasentwicklung auf, so ergibt sich eine Volumenzunahme ΔV. In einem ganz geschlossenen System (Stempel fixiert) würde der Druck steigen. Hier aber wird der Stempel unter Leistung von Arbeit W = pΔV nach oben gestossen, damit p konstant bleibt. Es macht übrigens keinen Unterschied, wenn das Gefäss vollkommen offen gegenüber der Aussenatmosphäre ist. Das Austreten des Gases benötigt denselben 105 Arbeitsaufwand wie das Hinausstossen des Stempels. Wir können jetzt auch einsehen, dass bei Reaktionen in Lösung ohne Gasaustritt oder –verbrauch, also ΔV ≈ 0, die Enthalpieänderung ΔH etwa gleich der Änderung der inneren Energie ΔU ist. Chemische Kinetik – Teil 2 Wir haben schon früh in dieser Vorlesung die Abhängigkeit der Reaktionsraten von den Konzentrationen der beteiligten Reaktanden angesehen (Skript S. 23). Dabei haben wir das allgemeine Geschwindigkeitsgesetz für eine Reaktion A+B → C d [C] d [A] d [B] k[A][B] dt dt dt und auch ein entsprechendes Gleichgewicht C A + B d [C] 0 k f [A][B] kr [C] dt aufgestellt. Mit Hilfe der Kinetik können wir tatsächliche Reaktionsraten behandeln und angeben, wann eine Reaktion „fertig“ ist (eigentlich wird sie nur unmessbar langsam, falls kein Gleichgewicht vorliegt). Wenn [A], [B] oder [C] während des Reaktionsverlaufs messbar sind, z.B. über eine physikalische Grösse, kann man die entsprechenden Konzentration/Zeit-Profile analysieren. Es hängt sehr von der Geschwindigkeit ab, welche Konzentrationsbestimmung angewandt wird: Dauert die Reaktion Minuten bis Stunden, so kann man Quench-Techniken mit anschliessender statischer Bestimmung einsetzen. Ein Klassiker hierfür ist die EsterHydrolyse RCOOR’ + H3O+ + H2O → RCOOH + R’OH + H3O+, welche säurekatalysiert ist: Man setzt den Ester mit der wässrigen Säure an und nimmt von Zeit zu Zeit Stichproben aus der Mischung, in denen man die Reaktion durch Neutralisierung der Säure stoppt (Quenching). Danach kann man die bereits freigesetzte Säure durch Titration (schnell arbeiten, weil wieder Hydrolyse beim Titrieren einsetzt) oder den Alkohol oder den verbliebenen Ester mittels Gaschromatographie bestimmen. Bei schnelleren Reaktionen muss man direkt an der Reaktionsmischung messen, und deshalb existieren auch spezielle Apparaturen dafür. Zur Konzentrationsmessung werden Kernresonanzspektroskopie, Infrarotspektroskopie, optische Spektroskopie und, falls sich Ionenkonzentrationen während der Reaktion ändern, Leitfähigkeitsmessung angewandt. Die Kernresonanzspektroskopie, die die detaillierteste Strukturinformation liefert, ist leider wenig empfindlich und relativ 106 langsam, nur Konzentrationen über 10−3 M bei Reaktionszeiten von mehr als 30 Sekunden können verlässlich bestimmt werden. Die übrigen direkten physikalischen Messtechniken erfassen Reaktionszeiten bis zu einer Mikrosekunde herab bei entsprechendem technischem Aufwand. Aus den Messungen erhält man Signal/Zeit-Profile, die die Konzentrationsänderungen mindestens zum Teil abbilden. Diese Kurven sind in der Regel nicht linear. Die Analyse der Profile kann auf zwei grundsätzlich verschiedene Arten erfolgen. Beim ersten Verfahren bestimmt man die Rate ganz zu Beginn unter der Bedingung dass [A] und [B] den eingesetzten Startkonzentrationen entsprechen und [C] = 0 gilt. Das ist die Methode der Anfangsraten und sehr verlässlich bei bisher unbekannten Reaktionssystemen. Es gilt für unsere allgemeine Beispielreaktion d [A] d [B] k[A]0 [B]0 dt dt Wenn man also bei bekannten [A]0 und [B]0 beispielsweise die Anfangssteigung d [A] d [B] bestimmt, kann man k berechnen. Wenn auch gemessen werden kann, dt t 0 dt t 0 d [C] hat man eine Kontrolle. Falls die Anfangs-Bildungsrate den Abnahmeraten für A dt t 0 und B genau entspricht, weiss man, dass man kein feststellbares Zwischenprodukt bekommt. Für eine komplexere Reaktion wie z.B. 2A + B → D mit dem Geschwindigkeitsgesetz d [D] 1 d [A] d [B] k[A]2 [B] dt 2 dt dt ist die Schwundrate von A doppelt so gross ist wie die von B, weil 2 A pro B verbraucht werden. Die Reaktionsordnungen, die Exponenten von [A] und [B], können mit der Methode der Anfangsraten bestimmt werden, indem man den Logarithmus der Anfangsraten gegen den Logarithmus der Variation einer der entsprechenden Anfangskonzentrationen aufzeichnet, d [A] gegen lg[A]0. Diese Kurve wird für unser zweites Beispiel die Steigung 2 z.B. lg dt t 0 d [A] gegen lg[B]0 für diverse [B]0 haben, für das erste die Steigung 1. Tragen wir lg dt t 0 auf, finden wir in beiden Fällen die Steigung 1. 107 Die zweite Methode zur Analyse der Signal/Zeit-Profile besteht in der Bestimmung einer zeitabhängigen Konzentrationsfunktion, z.B. [A](t) = f(t), und dem Vergleich dieser Funktion mit den experimentellen Daten. Um die zeitabhängige Konzentrationsfunktion zu erhalten, muss die Differentialgleichung integriert werden. Dies ist nur einfach für die Differentialgleichungen a) d [A] k[A] dt b) 1 d [A] k[A]2 und 2 dt a) wird gelöst, indem man umformt 1 d [A] k dt [A] c) d [A] k[A][B] mit [A]0 = [B]0 dt 1 d [A] kdt und beide Seiten integriert [A] mit der allgemeinen Lösung ln[A] kt C . Um C zu erhalten, setzen wir die Anfangsbedingung in die allgemeine Lösung ein: t = 0 → [A] = [A]0. Also ln[A]0 C , was wir dann wieder in die allgemeine Lösung einsetzen: ln[A] kt ln[A]0 oder ln [A] kt . Das ist eigentlich schon die gesuchte Funktion, doch in logarithmischer [A]0 Schreibweise. Bekannter ist [A] [A]0 e kt . Das ist eine recht einfache Exponentialfunktion, und deshalb versuchen Experimentatoren, den Ansatz so zu gestalten, dass diese Funktion anwendbar ist. Zuerst aber die Lösung von b) Wieder wird umgeformt 1 1 1 1 kt C , dann die d [A] k dt und integriert zu 2 2 [A] 2 [A] Anfangsbedingung t = 0 → [A] = [A]0 eingesetzt: 1 1 1 1 kt 2 [A] 2 [A]0 1 1 C . Schliesslich resultiert 2 [A]0 oder als einfachste Schreibweise 1 1 2kt . [A] [A]0 c) hat eine ähnliche Lösung wie b), da jederzeit [B] = [A], nur der Faktor 2 entfällt. Es existieren Lösungen für kompliziertere Fälle, doch meistens lohnt sich der Aufwand nicht. Besser ist es, den experimentellen Ansatz so zu wählen, dass man die Analyse vereinfachen kann. Wenn man für A+B → C d [C] d [A] d [B] k[A][B] dt dt dt 108 das Experiment mit [B]0 >> [A]0 durchführt, dann ist [B] während des Experiments praktisch konstant, weil B kaum verbraucht wird gemessen an seiner Anfangskonzentration. Man kann dann d [A] k[A][B]0 dt mit k[B]0 = k’ zu d [A] k '[A] vereinfachen, was dt die Lösung [A] [A]0 e k 't besitzt. Dies lässt sich variieren, indem man unter [A]0 >> [B]0 ebenfalls misst. Die Technik wird Rückführung auf pseudo-erste Ordnung genannt, weil nur noch eine variable Konzentration im Gesetz der Rate vorkommt. Man kann das für kompliziertere Systeme anwenden, indem man eine Anfangskonzentration gegenüber allen übrigen tief wählt. Kinetik und Mechanismus Was erzählt uns ein Geschwindigkeitsgesetz über den Reaktionsmechanismus? Im Grunde genommen gar nichts. Es ist z.B. möglich, dass unser Basisbeispiel A+B → C eigentlich als A+B → Z → C abläuft, wobei Z ein Zwischenprodukt ist. Falls der Reaktionsschritt A+B → Z viel langsamer ist als der Folgeschritt, so wird Z nie direkt erfasst, obwohl es real ist. Ein möglicher Trick, um das erhellen, besteht darin, ein Reagenz R zu finden, das mit Z die Reaktion Z+R → D eingeht und die viel schneller sein muss als Z → C Durch die Isolation von D lässt sich dann der Beweis für die Existenz von Z erbringen. Auch ein Gesetz wie d [D] 1 d [A] d [B] k[A]2 [B] dt 2 dt dt zur Reaktion 2A + B → D hat seine speziellen Haken. Termolekulare Reaktionen, bei denen 3 Moleküle gleichzeitig aufeinander treffen, sind eher selten und entsprechend langsam, weil die Wahrscheinlichkeit dieser Treffen so klein ist. Ist die Reaktion schnell, so sind folgende Schemata wahrscheinlicher: 109 2A Z+B Z → D oder A+B Z’ Z’ + A → D Das Dumme ist nur, das das Geschwindigkeitsgesetz hier keine Möglichkeit zur Unterscheidung bietet, weil K von [Z] [A]2 K' eingesetzt in d [D] k1[Z][B] k1 K [A]2 [B] sich formal nicht unterscheidet dt [Z'] eingesetzt in [A][B] d [D] k2 [Z'][A] k2 K '[A]2 [B] . dt Kinetische Untersuchungen zeigen immer nur einen Teil des Ganzen, ausser man hat eine Elementarreaktion vor sich. Dennoch leisten sie einen wertvollen Beitrag zur Aufklärung von Reaktionen. Es existieren Geschwindigkeitsgesetze der Form d [P] k . Was bedeutet das? Das Produkt P entsteht mit einer konstanten Rate aus einer dt eigentlich beliebigen Zahl von Edukten. Unter welchen Umständen ist das möglich? Klar ist, dass die Eduktkonzentrationen keine Rolle spielen, also kann es sich nicht um eine simple Kollisions-Reaktion handeln. Die einfachste Vermutung besteht darin, dass die Zahl der Orte, an denen P entstehen kann, im System stark limitiert ist. Wenn es sich bei diesen Orten um katalytisch aktive Teilchen handelt, die nur in sehr geringer Konzentration vorhanden sind, tritt das beschriebene Verhalten auf: Der Katalysator wird nicht verbraucht, aber er wird nach jeder Umsetzung gleich wieder vom Riesenüberschuss der Edukte besetzt, arbeitet also immer „am Anschlag“. Das führt genau zu der beobachteten konstanten Produktionsrate, die auch die Maximalgeschwindigkeit für das System darstellt. Das Verhalten wird oft bei Enzymen gefunden, die ja eigentliche Bio-Katalysatoren sind. 110 Komplexe – noch einige Details Ligandfeld-Aufspaltung Im oktaedrischen Ligandfeld werden die Energieniveaus der d-Orbitale, wie schon gesehen, zu zwei eg (axiale) und drei t2g (zwischenaxialen) Orbitalen aufgespalten. Die Aufspaltungsenergie Δo wird willkürlich in 10 Dq-Einheiten aufgeteilt. Wegen der Energieerhaltung liegen die eg Orbitale 6 Dq über der Aufspaltung in einem kugelsymmetrischen Feld und die t2g Orbitale 4 Dq darunter. Damit ergeben sich je 3 x 4 = 12 Dq Stabilisierungs-Energie und 2 x 6 = 12 Dq Destabilisierungs-Energie. Bei der tetraedrischen Aufspaltung ist das Verhältnis genau umgekehrt, weil 3 d-Orbitale destabilisiert werden und nur 2 stabilisiert. 111 25 High spin Low spin E (Dq) 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z (d) Die obenstehende Grafik zeigt die relative Stabilisierung durch das oktaedrische Ligandfeld im Vergleich zur Kugelsymmetrie. Dabei muss natürlich für die Besetzungen d4 bis d7 zwischen dem high spin und low spin Fall unterschieden werden. 15 12 High spin lg K 10 6 5 lg K 8 E (Dq) 10 4 2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z (d) Die zweite Grafik zeigt die Logarithmen der Bildungskonstanten der 1:1 Komplexe von V2+ bis Zn2+ mit 1,2-Diaminoethan (en) verglichen mit der Ligandfeldstabilisierung. Diese Komplexe sind alle high spin. Der Verlauf ist in etwa parallel, mit Ausnahme der lg K Werte für d4 und d9, die höher als erwartet ausfallen. Die Erklärung dafür ist eine Abweichung von der oktaedrischen Geometrie, die aufgrund der d-Elektronenkonfiguration zustande kommt. 112 d4 high spin d9 Die Zuordnung eines Elektrons in den eg Zuständen ist nicht eindeutig, man sagt „entartet“. Deshalb verzieht das Oktaeder seine Geometrie im Sinne einer Streckung, womit die energetische Gleichheit der eg Zustände (und auch der t2g) aufgehoben wird. Damit erhalten die destabilisierenden d-Elektronen wieder eindeutige Zustandsenergien. d4 high spin verzerrt d9 verzerrt Das Phänomen wird Jahn-Teller Verzerrung nach der ersten theoretischen Beschreibung genannt. Sowohl Ligandfeldstabilisierung als auch Verzerrung wirken sich auch auf kinetische Eigenschaften aus. Im folgenden Bild sind die Wasseraustauschgeschwindigkeiten von V2+ bis Zn2+ gegen die Ligandfeldstabilisierung aufgezeichnet. Bei der geringsten Stabilisierung (d5 und d10) finden wir die grösste Austauschrate. Ausnahmen stellen die JahnTeller verzerrten Systeme dar: Sie tauschen H2O-Liganden noch schneller aus als die Konfigurationen ohne Ligandfeldstabilisierung. 113 Der Grund für den extrem schnellen Wasseraustausch in verzerrten Oktaedern liegt an der vergrösserten Labilität der beiden durch die Verzerrung loser gebundenen Liganden, diese werden aufgrund ihrer schlechten Bindung extrem leicht ausgetauscht. Es sei noch bemerkt, dass diese beiden speziellen Positionen nicht „fixiert“ sind. Die Verzerrung ist ein mittlerer Zustand, in Wirklichkeit vibriert der Komplex mit ca. 10 THz, und die Spezialpositionen tauschen dabei ihre Plätze. Deshalb ist der Wasseraustausch für alle 6 Liganden beschleunigt. 114 Aktivität Bei quantitativen Untersuchungen an ionenhaltigen Lösungen, also Bestimmungen von Gleichgewichtskonstanten oder Elektrodenpotentialen, wurde schon früh bemerkt, dass diese im Gegensatz zur den Aussagen der Theorie auch von den Gesamtkonzentrationen abhängen, und nicht nur von den Konzentrationsverhältnissen. Zudem stellte man fest, dass Gleichgewichte von ungeladenen Stoffen diese Erscheinung nicht zeigen. Die Effekte werden umso stärker, je höher die beteiligten Ionen geladen sind und je grösser die totale Ionenkonzentration ist. Die Zugabe von Elektrolyten, die gar nicht an der Reaktion teilnehmen, verursacht dieselben Phänomene. Es dauerte eine Zeit lang, bis man diese Erscheinungen modellieren konnte. Die Deutung ist folgende: Eine Ionenlösung behält lose den Charakter der Salz-Gitterstruktur aufgrund der Ionenladungen. Daraus folgt, dass die Lösung lokal inhomogen sein muss, weil sich gleichsinnig geladene Ionen nicht zu gleicher Zeit am gleichen Ort aufhalten können. Dafür nähern sich gegensinnig geladene Ionen im Zeitmittel häufiger und dichter aneinander an und neutralisieren dabei teilweise ihre Ladung gegenseitig. Der makroskopische Effekt besteht darin, dass die in der Reaktion aktive Konzentration gegenüber der eingemessenen (analytischen) Konzentration vermindert erscheint, man sagt, die Aktivität sei gegenüber der Konzentration erniedrigt. Um diese Aktivität physikalisch zu erfassen, wurde der Aktivitätskoeffizient, ein Faktor, mit dem die Konzentration zu multiplizieren ist, eingeführt. Dieser Koeffizient liegt normalerweise zwischen 0 und 1. Bei sehr verdünnten Lösungen (ctot < 0.01 M) ist er nahe oder gleich 1, weil die mittlere Distanz zwischen den Ionen so gross ist, dass die elektrischen Feldeffekte gegenüber der thermischen (brownschen) Bewegung vernachlässigbar werden. Die Aktivitätskoeffizienten aller Ionen einer Lösung hängen von der gesamten Konzentration aller Ionen ab, dazu noch von den individuellen Ladungen der ionischen Spezies. Als Basisgrösse für die physikalische Beschreibung der Aktivität wurde deshalb das Mass der Ionenstärke definiert, das die bestimmenden Parameter vereinigt: I (manchmal auch ) 1 ci zi2 2 i wobei zi die Ladung der i-ten Spezies ist und ci ihre analytische Konzentration. Die Berechnung der Aktivitätskoeffizienten aus dieser Grösse erfordert eine aufwendige Analyse des gesamten elektrischen Felds in der Lösung, wobei hier in Vergleich zum Kristall noch die Dipoleffekte des Lösungsmittels hinzukommen („Ionenwolke-Modell“). Das 115 Resultat ist die Debye-Hückel Theorie der Elektrolytlösungen, die in den 20er Jahren von Peter Debye und Erich Hückel an der ETH Zürich formuliert wurde. Der Aktivitätskoeffizient berechnet sich demnach zu lg fi Azi2 I 1 Bri I 3 1 e2 2 2 N A 2 1 mit A 2 4 kT ln10 und B 2 N Ae2 . In diesen kT Ausdrücken sind e die Elementarladung, NA die Avogadro-Zahl, k die Boltzmann-Konstante, T die Temperatur und ε die Dielektrizitätskonstante des Lösungsmittels. ri ist der Radius des entsprechenden Ions. Für ein gegebenes Lösungsmittel sind A und B Konstanten bei chemischen Standardbedingungen (25°C). Die Berechnung der Aktivitätskoeffizienten wird in der Praxis eher selten verwendet. Um den Effekt der konzentrationsabhängigen Aktivität zu eliminieren, wurden viele Gleichgewichtskonstanten und Elektrodenpotentiale bei verschiedenen Ionenstärken gemessen und die resultierenden Wertereihen gegen I = 0 M extrapoliert. Eine ebenfalls verbreitete Angabe ist der entsprechende Wert bei einer Standard-Ionenstärke, häufig wird I = 0.1 M oder I = 1 M verwendet. Man findet deshalb Arbeitsvorschriften zur Bestimmung von Geschwindigkeitskonstanten, Potentialen und Gleichgewichtskonstanten, bei denen ein nicht reagierendes Salz zugesetzt wird, um die Standard-Ionenstärke einzustellen. 116