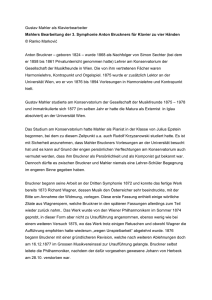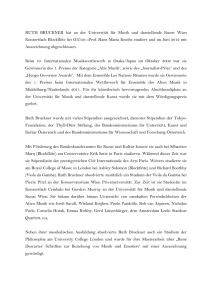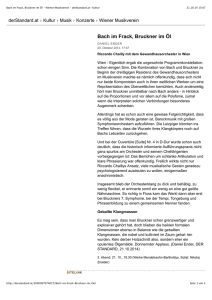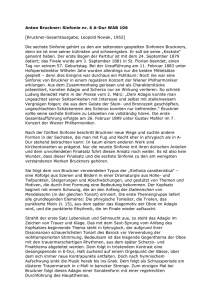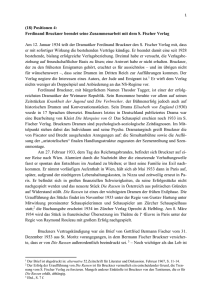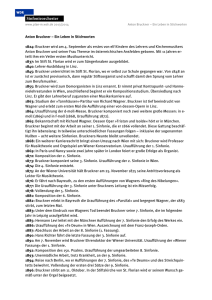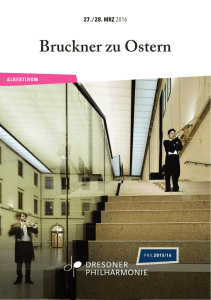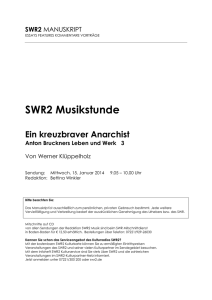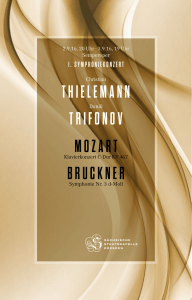Anton Bruckner - Originalgenie oder Wagner
Werbung

Doebel: Anton Bruckner - Originalgenie oder Wagner-Epigone? 1 Anton Bruckner - Originalgenie oder Wagner-Epigone? Gedanken zu Richard Wagners Einfluß auf Leben und Werk Anton Bruckners Richard Wagner gehört zweifellos zu den vielschichtigsten Künstler-Persönlichkeiten der gesamten abendländischen Kulturgeschichte. Wie wohl kein anderer Musiker hat er das Geistesleben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beeinflußt und Mitwelt wie Nachwelt zu einer Beschäftigung mit seiner Person und seinem Werk herausgefordert, die in dieser Form einzigartig ist. Nicht wenige Künstler, Dichter und Philosophen ließen sich durch diese Beschäftigung zu eigenem Schaffen inspirieren. Wie alle großen Geister forderte auch Richard Wagner durch sein Werk und Wirken die Zeitgenossen zu oftmals heftigen Reaktionen heraus. Der Achtung und des Respekts jedoch konnte Wagner sich bis auf wenige Ausnahmen sicher sein. Anton Bruckner hingegen mußte sich die Achtung seiner Zeitgenossen erst mühsam erringen. Nonkonformist gegenüber den ästhetischen Strömungen und dem Musikbetrieb seiner Zeit, galt er seinen Mitmenschen als schrulliger Sonderling, ja wurde von seinem Schüler August Stradal sogar als „Parzival der Tonkunst“ bezeichnet. Lange Zeit begnügte man sich mit der Rezeption von Vorurteilen, die durch eine von Anekdoten geradezu durchtränkte Brucknerliteratur wohl genährt wurden. Noch bis weit in unser Jahrhundert hinein war das Brucknerbild der breiteren Öffentlichkeit geprägt von einer Mischung aus Ignoranz und Unverständnis. Ebenso hartnäckig hielt sich das Vorurteil von Bruckner, dem ‚Epigonen Wagners’. Der Wiener Kritiker Eduard Hanslick, Freund von Brahms und erklärter Gegner der Musikästhetik Wagners und der Neudeutschen Schule, faßte seine Kritik an Bruckner in dem apodiktischen Satz zusammen, Bruckner übertrage „Wagner’s dramatischen Styl auf die Symphonie“ - ein Verdikt, welches sich wie ein roter Faden durch alle Bruckner-Kritiken Hanslicks zieht. Bemühte sich Hanslick bisweilen aber noch um objektive und differenzierende Kritik, so gelangte der Verriß der VII. Symphonie Bruckners durch Gustav Dömpke gerade wegen seines besonders polemischen Tonfalls zu trauriger Berühmtheit. In ihm werden Bruckner Eigenschaften zugeschrieben, die sich gerade zu wie eine Lehrbuch-Definition des Epigonen-Begriffs ausnehmen: „Bruckner komponiert wie ein Betrunkener; er ist ein virtuoser Anempfinder, dessen Phantasie von den heterogensten Niederschlägen Beethovenscher und Wagnerscher Musik überschwemmt worden ist, ohne das Gegengewicht einer Intelligenz, welche diese Eindrücke ihrem Wert und Wesen nach zu unterscheiden wüßte und vollends ohne die künstlerische Kraft, sie sich als einer eigenen, selbständigen Individualität zu assimilieren.“ Erst in Bruckners letztem Lebensjahrzehnt begann sich langsam die Einsicht durchzusetzen, daß Bruckner kein Wagner-Epigone war, sondern ein Originalgenie, welches an künstlerischer Individualität und Größe auf dem Gebiet der Symphonie dem Musikdramatiker Wagner absolut ebenbürtig war. Und bis diese Einsicht Allgemeingut einer kunstverständigen Öffentlichkeit wurde, sollten noch einige weitere Jahrzehnte vergehen. Insofern besitzt die Titelfrage dieses Aufsatzes heute nur mehr rhetorische Qualität; sie bezieht sich auf eine frühe Phase der Brucknerrezeption. Gleichwohl läßt sie doch Fragen offen. Bruckner sprach nämlich von Wagner stets voller Ehrfurcht und sah in ihm die höchste künstlerische Autorität. Warum aber führte diese Verehrung nicht zu einer epigonalen Aneignung der Wagnerschen Musiksprache? Warum ist Bruckner in seinem Schaffen das Originalgenie geblieben, welches eben nicht „von den heterogensten Niederschlägen Beethovenscher und Wagnerscher Musik überschwemmt“ wurde? Die Antworten auf diese Fragen sind in Wagners und Bruckners Herkunft, ihrer künstlerischen wie persönlichen Entwicklung und ihrer daraus resultierenden Weltanschauung zu suchen. Der Frage, was an der Musik Anton Bruckners tatsächlich ‚wagnerisch’ ist und was nicht, ist der zweite Teil dieses Aufsatzes gewidmet. Doebel: Anton Bruckner - Originalgenie oder Wagner-Epigone? 2 1. Lebenswege — Persönlichkeiten Der 10. Juni 1865 ging als Tag der Uraufführung von Wagners Oper „Tristan und Isolde“ in die Musikgeschichte ein. Ursprünglich für den 15. Mai geplant, mußte die Aufführung wegen einer Erkrankung der Hauptdarstellerin immer wieder verschoben werden. Bruckner war bereits zu diesem ursprünglichen Termin nach München gereist und traf schon drei Tage später, am 18. Mai 1865, zum ersten Mal in seinem Leben mit Richard Wagner zusammen. Welchen Verlauf hatte das Leben der beiden Komponisten bis zu diesem Tag genommen, und wie sollte sich ihre weitere Bekanntschaft gestalten, die sich immerhin über einen Zeitraum von 17 Jahren erstreckte? 1.1 Richard Wagner Richard Wagner war zu diesem Zeitpunkt 52 Jahre alt, und obwohl kein Wunderkind wie Mozart, Schubert oder Mendelssohn, konnte er bereits auf ein umfangreiches dichterisches, kunstästhetisches und nicht zuletzt kompositorisches Werk verweisen. Das Wissen um seine geniale Begabung und ein ausgeprägtes Sendungsbewußtsein veranlaßten ihn, die Verwirklichung seiner künstlerischen Visionen mit allen Mitteln voranzutreiben. Daß er sich dadurch zahlreiche und zum Teil tiefe Feindschaften eintrug, überrascht nicht. Unterordnung unter bestehende Strukturen jedenfalls war Wagners Sache nicht, weshalb er lange Zeit ein unstetes Leben im Exil oder auf der Flucht vor seinen Gläubigern und der Polizei führen mußte. Dieses Leben hatte ihn 1865 bereits durch ganz Europa geführt. Das Ziel dieser Wanderjahre war zunächst 1872 mit der Übersiedlung nach Bayreuth, endgültig am 28. April 1874 mit dem Einzug in das neu erbaute Domizil erreicht: „Hier wo mein Wähnen Frieden fand, Wahnfried sei dieses Haus von mir benannt“, lautet die programmatische Inschrift auf der Fassade. Mit seinen vielseitigen intellektuellen Interessen und Begabungen entsprach Wagner dem Bildungsideal des romantischen Menschen, welches von fast allen bedeutenden Komponisten der Epoche geteilt wurde. So verfügten z. B. Johannes Brahms, Robert Schumann, Franz Liszt, Claude Debussy oder Gustav Mahler über zum Teil sehr umfangreiche private Bibliotheken, und diesem Interesse am geschriebenen Wort entsprang oftmals die Neigung, sich auch selbst zu den unterschiedlichsten Themen der Zeit schriftlich zu äußern. Dieses gleichsam fächerübergreifende Interesse an Geschichte, Politik, Literatur, Theater, Kunst und Philosophie wirkte aber auch in mannigfaltiger Weise auf das musikalische Schaffen der jeweiligen Komponisten zurück; im Falle Wagners resultiert daraus die Konzeption und der universalistische Anspruch des Gesamtkunstwerkes - dieser „Vereinigung aller Künste zu dem einzig wahren, großen Kunstwerke“, wie Wagner selbst es immer wieder formulierte. 1.2 Anton Bruckner Anton Bruckner war zum Zeitpunkt seiner ersten Begegnung mit Richard Wagner 40 Jahre alt. Unter den Kompositionen des Linzer Organisten und Leiters der Liedertafel „Frohsinn“ befand sich zu diesem Zeitpunkt lediglich ein wirklich bedeutendes, auf das spätere Schaffen vorausweisende Werk: die Messe in d-Moll. Über die Grenzen seines Heimatlandes war Bruckner 1865 noch nicht hinausgekommen. Sein bisheriger Lebensweg war, vor allem gemessen an dem Richard Wagners, unspektakulär, konventionell, in geregelten Bahnen verlaufen. 1824 in dem kleinen oberösterreichischen Dorf Ansfelden bei Linz geboren, wuchs Bruckner in der behüteten Welt des österreichischen Vormärz auf. Erzogen zu unbedingter Anerkennung staatlicher und kirchlicher Autorität, wurde der junge Anton nach dem Tode des Vaters im Alter von 13 Jahren als Sängerknabe in das benachbarte Augustiner-Chorherrenstift St. Florian aufgenommen. Doebel: Anton Bruckner - Originalgenie oder Wagner-Epigone? 3 Bruckner wollte, so wie vor ihm Vater und Großvater, den Lehrerberuf ergreifen, und nach abgeschlossener Ausbildung übte er diesen Beruf von 1845 bis 1855 in St. Florian aus. Obwohl Bruckner von 1850 bis 1855 auch provisorischer Stiftsorganist in St. Florian war, legte er noch im Januar 1855, im Alter von 30 Jahren, die Hauptschullehrerprüfung ab, schlug ein Jahr später aber doch endgültig den Weg des Berufsmusikers ein: Er trat die Stellung des Linzer Dom- und Stadtpfarr-Organisten an, die er bis zu seiner Übersiedelung nach Wien im Herbst 1868 innehaben sollte. Daß Bruckner so lange am Berufswunsch des Lehrers festhielt, steht nicht im Widerspruch zu seiner schon damals als außerordentlich erkannten musikalischen Begabung: Ein kaiserliches Dekret aus dem Jahre 1805 regelte, daß „der Kirchendienst überall, wo thunlich, mit dem Schuldienst verbunden seyn soll“. In einem gewissen Sinne hat Anton Bruckner sein ganzes Leben hindurch diese Personalunion von Schullehrer und Kantor verkörpert, ja sogar in jedem der beiden Bereiche die höchstmögliche Stufe erreicht: auf der einen Seite als Professor für Harmonielehre und Kontrapunkt am Wiener Konservatorium und Lektor an der Universität, auf der anderen Seite als Organist der kaiserlichen Hofmusikkapelle. Auch alle Lehrer Bruckners waren fest in dieser Tradition der österreichischen Kirchenmusik verankert. Das gilt auch noch für Simon Sechter, bei dem Bruckner von 1855 bis 1861 in Wien Theorie und Kontrapunkt studierte. Erst mit dem Unterricht bei Otto Kitzler sollte Bruckners Genie die entscheidenden Impulse erhalten. Der aufgeschlossene und weltgewandte Kapellmeister des Linzer Theaters, der sich leidenschaftlich für die Musik Richard Wagners einsetzte, unterrichtete Bruckner von November 1861 bis Juli 1863 in Formenlehre und Instrumentation. Am 12. Februar 1863 führte Otto Kitzler in Linz Wagners Tannhäuser auf. In seinen Lebenserinnerungen beschrieb er den kolossalen Eindruck, den Wagners Musik auf seinen damals achtunddreißigjährigen Schüler machte: „Bruckner hatte, meines Wissens bis dahin noch keine Wagner’sche Oper gehört, denn während seiner bei Sechter absolvierten Studien, welche ihm durch kurzen Urlaub nach Wien ermöglicht wurden, war Bruckner von seinen Studien so in Anspruch genommen, so daß er kaum die Hofoper besuchen konnte, um eine Oper von Wagner zu hören, von einem Meister, dessen Richtung Bruckner damals ganz fremd sein mußte. Sein Erstaunen war daher nicht gering, als ich ihm sagte, daß ich Wagner’s ‘Tannhäuser’ aufführen wollte, und wuchs, als ich ihm die Partitur brachte und ihn auf die Schönheit des Werkes, auf die Neuheit der Instrumentation aufmerksam machte. […] Ich fand ihn in dieser Zeit in einem Zustande musikalischer Erregung, welchen ich später niemals mehr an ihm zu beobachten Gelegenheit hatte.“ Nach dieser kurzen biographischen Skizze verwundert es sicher nicht, daß auch die Persönlichkeiten Bruckners und Wagners in wichtigen Punkten gravierende Unterschiede aufwiesen. So strebte Bruckner zwar zeit seines Lebens nach materieller Sicherheit und gesellschaftlicher Anerkennung, aber dieses Streben stellte die Gesellschaft und ihre Hierarchien nicht in Frage. Gewaltsame Auflehnung gegen die geltende Ordnung oder gar revolutionäre Gedanken waren seinem Wesen fremd. Bruckner verfügte auch nicht über eine umfangreiche Bibliothek, und die von ihm erhaltenen ca. 500 Briefe nehmen sich neben den über 10.000 des Vielschreibers Richard Wagner sehr bescheiden aus. Von Bruckner sind auch so gut wie keine Äußerungen überliefert, die sich auf sein Werk im speziellen oder auf kunsttheoretische, musikästhetische oder gar philosophische Fragen im allgemeinen beziehen. Auch Theateraufführungen oder sonstige kulturelle Veranstaltungen besuchte Bruckner allem Anschein nach kaum. Das mag aber nicht nur daran gelegen haben, daß dem frommen jungen Mann schon in der Linzer Zeit das Theater „von den Geistlichen als eine ‚Brutstätte des Teufels' dargestellt wurde“ oder Bruckner schlicht die Zeit fehlte, während seiner kurzen Aufenthalte in Wien die Oper zu besuchen, wie Otto Kitzler berichtete. Vielmehr erleben wir in Bruckner einen Menschen, der vor allem in den Wiener Jahren seine ganze Zeiteinteilung konsequent und zielstre- Doebel: Anton Bruckner - Originalgenie oder Wagner-Epigone? 4 big der kompositorischen Arbeit unterordnete und gleichsam nur für sein Werk lebte. Um sich von entsprechend langen und ermüdenden Arbeitstagen zu erholen, verbrachte Bruckner die Abende gern im Kreise seiner Schüler in geselliger Runde im Wirtshaus und reagierte sogar gekränkt, wenn seine Schüler einen Theaterbesuch der abendlichen Gesellschaft vorzogen. Bruckners verhältnismäßig geringes Interesse an übergreifenden politischen Zusammenhängen schließlich resultiert sicher auch aus seiner vormärzlichen Erziehung, die ihn gelehrt hatte, die bestehenden Ordnungen nicht zu hinterfragen. Sein Interesse richtete sich mehr auf konkrete, punktuelle Ereignisse, besonders auf solche, zu denen er eine direkte, persönliche Beziehung aufbauen konnte. Bruckner entsprach also nicht dem Typus des universell gebildeten und interessierten Komponisten der Romantik, wie ihn E. Th. A Hoffmann dem 19. Jahrhundert vorgelebt hatte. Er entsprach aber auch nicht dem Ideal des Bildungsbürgers, und fast könnte man mit Blick auf Wagner formulieren: Das, was Wagner an ‚Bürger’ fehlte, fehlte Bruckner an ‚Bildung’. Dieses geringe oder doch zumindest einseitige Interesse an intellektuellen Dingen führte aber dazu, daß sogar Bruckners Anhänger ihm einen „Mangel an jeglicher Klugheit“ und an Intelligenz bescheinigten und Bruckner mit dem Attribut ‚naiv’ ausstatteten. So entstand das Bild von Bruckner, dem liebenswürdig-kindlichen Tölpel; ein Bild, welches eine objektive Bruckner-Rezeption noch lange Zeit massiv behindern sollte. In solchen Darstellungen wirkte jedoch auch eine Zweckgebundenheit: Für die intellektualisierte Wiener Gesellschaft des Fin de siècle sollte Bruckner, gleichsam als Gegenpol zur eigenen Situation, das naive, ‚naturbelassene’ Genie sein, welches „in der parfümierten Atmosphäre der Großstadt“ gigantische und für den Intellekt unerklärliche Kunstwerke schafft. Und von dieser Position aus ist der Weg zum nächsten Klischee, zu Bruckner, dem Mystiker, nicht mehr weit. Zudem wurde Bruckner von seinen Anhängern als das arme, unschuldige und hilflose Opfer der bösartigen Wiener Presse in eine Art MärtyrerRolle gedrängt. Heute käme niemand mehr ernsthaft auf die Idee, Bruckner mangelnde Intelligenz zu unterstellen, und daß Bruckner darüber hinaus auch das Gegenteil eines rein intuitiv schaffenden Musikers war, erkennt man schnell, wenn man sich mit seinen Werken und den Prozessen ihrer Entstehung befaßt. Seine Intellektualität jedoch blieb auf die Erschaffung seiner Werke konzentriert, und sein manchmal provinziell anmutendes, oft unterwürfiges und linkisch ungeschicktes, bisweilen aber auch bauernschlau auf den eigenen Vorteil berechnetes Auftreten in der Öffentlichkeit mußte vor allem in aufgeklärten städtischen Wiener Kreisen deplaciert und antiquiert wirken. 1.3 Chronologie der Begegnungen Bruckner und Wagner, diese ihrem Wesen nach so grundverschiedenen Persönlichkeiten, kamen also zum ersten Mal im Mai 1865 in München zusammen. Doch der nächste Kontakt zwischen ihnen sollte zweieinhalb Jahre auf sich warten lassen: Die von Bruckner geleitete Linzer Liedertafel „Frohsinn“ suchte ein geeignetes Chorstück zu ihrem Gründungsfest am 4. April 1868. Man wandte sich mit der Bitte an Wagner, einen Chor zu komponieren oder der Liedertafel einen geeigneten zu überlassen. Wagner antwortete Bruckner, daß er der Liedertafel die Schlußszene der „Meistersinger“ zur Verfügung stellen wolle, und so erklang diese Schlußszene, zweieinhalb Monate vor der offiziellen Uraufführung, unter Bruckners Leitung mit großem Erfolg in Linz. Fünfeinhalb Jahre später, im Herbst 1873, kam es zu einem für Bruckner sehr bedeutenden Ereignis: zur Widmungsannahme der III. Symphonie durch Wagner. Die näheren Umstände dieser Begebenheit spielten sich nach Bruckners eigenen Erinnerungen wie folgt ab: Morgens um neun Uhr ging Bruckner zu Wagner, wurde aber abgewiesen, versuchte es dann gegen Mittag ein zweites Mal und wurde nun empfangen. Wagner rea- Doebel: Anton Bruckner - Originalgenie oder Wagner-Epigone? 5 gierte zunächst unwirsch, als er hörte, daß Bruckner ihm etwas widmen wollte, meinte, er sei nicht der Einzige, aber als Bruckner nicht nachgab, warf Wagner einen kurzen Blick in die Partituren der II. und III. Symphonie. Daraufhin zeigte er sich interessierter, bat sich aber Bedenkzeit aus. Schon am Nachmittag bestellte er Bruckner wieder zu sich, war nun sehr freundlich zu ihm und sagte: „Ihr Werk […] ist ein Meisterstück und es ehrt und freut mich, daß Sie es mir zugedacht haben.“ Bruckner blieb noch bis zum Abend bei Wagner und wurde von ihm großzügig mit Bier bewirtet. Aufgrund dieses Biergenusses konnte sich Bruckner jedoch am nächsten Morgen nicht mehr entsinnen, welche der beiden Symphonien Wagner zur Widmung angenommen hatte! Diesem Umstand verdankt die Musikwelt das Kuriosum des berühmten Doppelautographs, auf dem die Handschriften zweier großer Komponisten verewigt sind (Bruckner: „Symfonie in D moll, wo die Trompete das Thema beginnt.“ Wagner: „Ja, ja! Herzlichen Gruss!“). Weitere Begegnungen zwischen Bruckner und Wagner kamen im Rahmen der Uraufführung des „Ring des Nibelungen“ zustande, mit dem vom 13. bis 17. August 1876 die ersten Bayreuther Festspiele eröffnet wurden. Bruckner, auf persönliche Einladung Wagners angereist, nahm auch an den Soireen in Haus Wahnfried teil, die zweimal wöchentlich abgehalten wurden und als Treffpunkt der mitwirkenden Künstler und der FestspielProminenz dienten. Mit der Uraufführung des „Parsifal“ wurden sechs Jahre später, am 26. Juli 1882, die zweiten Bayreuther Festspiele eröffnet, und hier begegneten sich Bruckner und Wagner ein letztes Mal. Ein gutes halbes Jahr darauf, am 13. Februar 1883, starb Richard Wagner in Venedig. „Die Kunde von Richard Wagners plötzlichem Tode hat unsere musikalischen Kreise schmerzlich überrascht und erschüttert. […] Das Verschwinden einer so außerordentlichen Persönlichkeit ist und bleibt ein Verlust.“ So formulierte es Eduard Hanslick, dem sicher nicht eine besondere Verbundenheit mit Wagner nachgesagt werden kann. Für die Verehrer Wagners aber brach mit der Todesnachricht geradezu eine Welt zusammen. Bruckner war einer von diesen Verehrern, und er war besonders schmerzlich getroffen. In Wien gerade wegen seines offenen, ja glühenden Bekenntnisses zu Wagner oftmals bedrängt und angefeindet, machte er sich immer wieder Sorgen um seine Zukunft und die seiner Werke. Dabei war der Glaube an die Loyalität seines berühmten und einflußreichen, „heißgeliebten Meisters und Ideals“ in besonders ausweglos erscheinenden Situationen ein Rettungsanker für Bruckner: Hatte doch Wagner Bruckner immer wieder versichert, wie wohlgesonnen er ihm sei, sogar mehrfach geäußert, Bruckner wäre der einzige lebende Komponist, dessen Gedanken an Beethoven heranreichten, und Bruckner versprochen, sich für die Aufführung seiner Symphonien zu verwenden. Bruckner setzte also große Hoffnungen in Wagner, und diese Hoffnungen hatten sich nun von einem Augenblick zum nächsten zerschlagen. Als Bruckner die Todesnachricht erhielt, war die Arbeit am Adagio seiner VII. Symphonie gerade bis zum Buchstaben X der Partitur gediehen. Dieses Adagio, vor allem aber der Tuben- und Hörnersatz ab Buchstabe X, ist Denkmal für Bruckners tief empfundene Trauer. Auf den inhaltlichen Bezug dieser Passage zum Tode Richard Wagners wies Bruckner immer wieder hin. So bezeichnete er den Blechbläsersatz ab Buchstabe X als „Trauer-Musik für Tuben und Hörner“, oder er sprach von der „Trauermusik zum Andenken an des Meisters Hinscheiden.“ Nach Bruckners Aussage war sogar der ganze Satz in einer Art Vorahnung auf den Tod Wagners geschrieben, und so ist es sicherlich kein Zufall, daß Bruckner hier zum ersten Mal in einer seiner Symphonien Wagner-Tuben verwendete, die schon vom ersten Takt des Satzes an eine tragende Rolle spielen. Bruckner brachte in seinen Äußerungen die Tuben immer in Verbindung mit einer Trauermusik - und was hätte näher gelegen, als seine Trauer über Wagners Tod durch ein Instrument zu verdeutlichen, das für Bruckner besonders typisch für die Musik Richard Doebel: Anton Bruckner - Originalgenie oder Wagner-Epigone? 6 Wagners war, ja das Wagner sogar eigens für den „Ring des Nibelungen“ hatte bauen lassen? Mit Wagners Tod endete die Zeit der siebzehnjährigen, persönlichen Bekanntschaft. Doch die Verbindung zu Bayreuth hielt Bruckner aufrecht: Schon im Juli desselben Jahres war er wieder Gast der Festspiele und ließ auch keines der sechs folgenden aus. Zu einem festen Ritus wurden dabei auch die Besuche an Wagners Grab. Im Juli 1892 schließlich führte Bruckners Weg ein letztes Mal nach Bayreuth, wo er wie im Vorjahre „Parsifal“ und „Tannhäuser“ hörte. In den Jahren 1894 und 1896 erlaubte es ihm sein Gesundheitszustand jedoch nicht mehr, die Anstrengungen einer längeren Reise und der Festspiele auf sich zu nehmen. Am 11. Oktober 1896 starb Anton Bruckner, 13 1/2 Jahre nach Richard Wagner, und wurde vier Tage darauf seinem Wunsch gemäß in der Stiftskirche St. Florian in der Gruft unter der großen Orgel beigesetzt. 1.4 Bruckners Wagnerrezeption Wagner und Bruckner verkörpern das Idol und seinen Verehrer, und diese Konstellation sollte für den gesamten Zeitraum der persönlichen Bekanntschaft der beiden Komponisten prägend bleiben. Die Frage aber, auf welche Weise Bruckner das Werk Richard Wagners in sich aufnahm, wird bis heute kontrovers diskutiert. So vertrat der Wiener Musikwissenschaftler und Brucknerforscher Alfred Orel die Auffassung, daß „nicht das textlich inhaltliche Moment dieser Kunst, sondern das absolut musikalische Element darin“ Bruckner faszinierte. Zur Stützung dieser These wird gern auf die bekannte Anekdote zurückgegriffen, wonach Bruckner bei einer Aufführung der „Walküre“ gefragt haben soll, warum Brünnhilde am Ende verbrannt werde. Außerdem bevorzugte Bruckner bei seinen seltenen Besuchen der Hofoper die Stehplätze der vierten Galerie, von denen aus man zwar nicht die Bühne einsehen, dafür aber umso besser das Orchester hören und beobachten konnte. Indes belegen eine ganze Reihe von Bemerkungen Bruckners, daß ihm auch Details der Handlung durchaus nicht entgingen, und August Stradal berichtet, daß Bruckner im „Siegfried“ an der Stelle geweint habe, an der Siegfried seiner toten Mutter gedenkt und über diese Passage auch auf der Orgel improvisiert habe. Diese Anteilnahme an der Handlung kann hier aber auch auf persönliche Betroffenheit zurückgeführt werden. Der Tod der eigenen Mutter am 11. November 1860 nämlich traf Bruckner hart, und bis an sein Lebensende hing in seiner Wohnung ein Bild der Mutter, das diese auf dem Sterbebett zeigte. Hier war Bruckners Interesse an der Handlung des „Siegfried“ also auf eine Einzelheit gerichtet, die ihn persönlich tief berührte und ihm die Möglichkeit der Identifikation mit dem um seine Mutter trauernden Siegfried bot. Nach einem weiteren Bericht Stradals war diese persönliche Identifikation mit dem Helden auch im Fall von Liszts Symphonischer Dichtung „Tasso - Lamento e Trionfo“ für eine tiefe emotionale Reaktion Bruckners verantwortlich. Wie bereits erwähnt, war Bruckner in literarischen oder philosophischen Fragen kaum bewandert. Mit der Handlung der Wagnerschen Musikdramen verbindet sich aber als wesentliches Element ein musikästhetisch-philosophischer Überbau, der wesentlich aus Wagners Auseinandersetzung mit den Werken Schopenhauers und Feuerbachs resultiert. Ob Bruckner dieser vielschichtigen und komplexen Geisteswelt Interesse entgegenbrachte, ist mehr als ungewiß. Die Wagner-Rezeption des neunzehnten Jahrhunderts jedenfalls, die Wagners Werke gleichsam ganzheitlich rezipierte und sein Ideengebäude zu einer umfassenden Weltanschauung stilisierte, ja Wagners Werk nur allzugern als Kunstreligion und somit Ersatz-Religion aufnahm, war nicht die Sache des strenggläubigen Katholiken Anton Bruckner. Allerdings riefen weder manche Aspekte des Wagnerschen Werkes noch Wagners Privatleben, welches für einen nach den Geboten der katholischen Kirche lebenden Menschen zahlreiche Angriffsflächen geboten hätte, Doebel: Anton Bruckner - Originalgenie oder Wagner-Epigone? 7 Bruckners Widerspruch hervor, weswegen der Wiener Bruckner-Forscher Manfred Wagner vermutete, Bruckner müsse wohl eine Art „Immunsystem“ dagegen entwickelt haben. Bruckners Wagnerrezeption muß daher als eine Selektive Rezeption bezeichnet werden: Bruckner setzte den Schwerpunkt eindeutig auf die musikalischen Aspekte des Wagnerschen Gesamtkunstwerkes - was nicht bedeutet, er habe sich nicht für die konkreten Handlungen interessiert oder gar deren Verlauf geistig nicht zu erfassen vermocht. 1.5 Wie dachte Richard Wagner über Anton Bruckner? Bruckners grenzenlose Verehrung für Richard Wagner ist in der Bruckner-Literatur, vor allem in der Erinnerungsliteratur, ein zentrales Thema. Wie aber verhält es sich mit dem Thema in der Wagner-Literatur? Im Hermes-Handlexikon Richard Wagner findet sich unter dem Stichwort ‚Bruckner’ folgender Text: „Der österreichische Komponist war ein Verehrer Wagners; er besuchte die Meistersinger-Uraufführung in München 1868 sowie die Bayreuther Festspiele 1876 und 1882. In seinen Symphonien verwandelte sich die Wagnersche Orchestermelodie zurück ins Absolute. Am 13./14. September 1873 suchte er Richard Wagner in Bayreuth auf, um ihm die Widmung seiner 3. Symphonie in d-Moll anzutragen. Wagner nahm die Widmung an.“ Diese knappe und überdies unpräzise Art der Abhandlung des Themas ist symptomatisch für einen Großteil der Wagner-Literatur. Doch entspricht sie auch Wagners persönlicher Einstellung zu Anton Bruckner? Wie ernst nahm Wagner Bruckner als Mensch und vor allem als Künstler wirklich? - Auch bei sorgfältigem Abwägen aller Fakten sind diese Fragen nicht restlos zu klären und führen immer wieder in den Bereich der Spekulation. Ist es wirklich so, daß „das Genie des Musikdramas das Genie der Symphonie erkannt hatte“, wie der Nürnberger Musikwissenschaftler Thomas Röder erst kürzlich schrieb? Wagners Scherz, er werde die ihm gewidmete III. Symphonie als Zwischenaktmusik in der „Walküre“ aufführen, ließe einen anderen Schluß zu. Tatsache ist zumindest, daß keine einzige Symphonie Bruckners durch Vermittlung Wagners aufgeführt wurde. Die Schwierigkeiten gehen weiter, wenn man bedenkt, daß Wagners Äußerungen größtenteils von Bruckner selbst überliefert sind. Durch die Bedeutung, die Bruckner der Person Richard Wagners im Hinblick auf die Verbreitung seiner Symphonien beimaß, fand eine Überhöhung und Idealisierung statt, die bei einer Bewertung der Brucknerschen Aussagen berücksichtigt werden muß. Andererseits spricht nichts dafür, Bruckner hätte die höchst anerkennenden Aussagen Wagners über ihn völlig frei erfunden. Daß Wagner Bruckner als Mensch durchaus schätzte und sich auch seiner Bedeutung als Künstler bewußt war, könnte man daraus ableiten, daß er ihm ein Vierteljahr vor der Uraufführung die Schlußszene der „Meistersinger“ überließ, oder daß er die Widmung der III. Symphonie annahm. (Die Partitur der III. Symphonie Bruckners ist die einzige Widmungspartitur, die im Richard-Wagner-Archiv Bayreuth vorhanden ist.) Im Jahre 1873 war Wagner zudem vollauf damit beschäftigt, ein kleines Provinzstädtchen namens Bayreuth gleichsam über Nacht zu einem der musikalischen Zentren Europas zu machen. Diese Erfüllung seines Lebenstraumes aber absorbierte alle seine Kraft, wodurch sogar die Arbeit an der Ring-Tetralogie nochmals erheblich verzögert wurde. Daher ist fraglich, ob Wagner überhaupt Zeit hätte aufwenden können, um sich ernsthaft und intensiv um Bruckner und die Verbreitung seiner Werke zu kümmern. Andererseits ist in den gesammelten Schriften und den Briefen Wagners, in denen dieser immer wieder auf das musikalische Tagesgeschehen und die Komponisten seiner Zeit zu sprechen kam, Bruckner mit keinem Wort erwähnt. Auch bemühte Wagner sich niemals, mit Bruckner einen Briefwechsel aufzubauen, und in den Tagebüchern Cosimas, die sich über einen Zeitraum von vierzehn Jahren erstrecken, wird Bruckner nur zweimal erwähnt - im Gegensatz zu Bach, Mozart, Beethoven, Weber, Mendelssohn, Liszt, Berlioz oder auch Brahms. Unter dem Datum des 8. Februar 1875, also immerhin ein Dreivierteljahr, nachdem Wagner von Doebel: Anton Bruckner - Originalgenie oder Wagner-Epigone? 8 Bruckner die Widmungspartitur der III. Symphonie erhalten hatte, schrieb Cosima in ihr Tagebuch: „Wir nehmen die Symphonie von dem armen Organisten Bruckner aus Wien vor, welcher von den Herren Herrbeck und anderen beiseite geschoben worden ist, weil er hier in Bayreuth war, um seine Symphonie-Widmung anzubringen! Es ist jammervoll, wie es in dieser musikalischen Welt steht.“ Cosima nahm hier Bruckner und seine Symphonie zum Anlaß, den „jammervollen Zustand der musikalischen Welt“ zu beklagen, nämlich die Tatsache, daß Bruckner in Wien durch sein Bekenntnis zu Wagner erheblichen Anfeindungen ausgesetzt war. Aber es findet sich kein Wort über das Werk an sich. Dieser Umstand überrascht umso mehr, als daß Cosima sonst die kritischen Äußerungen ihres Mannes durchaus der Überlieferung für würdig befand, wovon schon der nächste Satz ihres Tagebuches beredtes Zeugnis ablegt: Dort zitierte sie ihn mit einer durchaus wertenden Bemerkung über die Rheinische Symphonie Robert Schumanns. Auch die zweite der Tagebucheintragungen hilft uns wenig, etwas über Wagners Einstellung Bruckner gegenüber zu erfahren: Bruckners Trinkfestigkeit, seine ebenso ausgeprägte Frömmigkeit und seine vor allem Wagner gegenüber devoten Umgangsformen nämlich verfolgten diesen sogar bis in den Schlaf und vermengten sich dort zu einem skurrilen Traumbild: „Freitag, 22ten April 1881: Richard träumt, daß ein Papst mit dem Aussehen von dem Musiker Bruckner ihn besuche, […] , und wie Richard ihm die Hand küssen will, küßt sie ihm seine Heiligkeit und nimmt darauf eine Flasche Cognac mit.“ 2. Beziehungen im Werk Alfred Orel bezeichnete im Jahre 1925 die oberösterreichische Heimat, das Stift St. Florian und die Orgel als die ersten drei elementaren Erlebnisse im Leben Anton Bruckners. Er schreibt weiter: „Richard Wagner ist das vierte und vielleicht das letzte große innere Erlebnis, das Bruckners Schaffen in hervorragendem Maße beeinflußte.“ Daneben war natürlich auch das Werk anderer Komponisten prägend für Bruckner. So nannte er neben dem Trauermarsch aus der „Götterdämmerung“ immer auch zwei Werke der Wiener Klassik als seine Lieblingskompositionen: Beethovens „Eroica“ und Mozarts Requiem. Darüber hinaus lassen sich auch zu anderen Komponisten direkte und indirekte Linien ziehen: in der Kirchenmusik zur katholischen Tradition eines Palestrina, Bach und Haydn bis zu Franz Liszt, in der Symphonie von Beethoven über Schubert, Liszt und Berlioz, zu Beginn auch zu Mendelssohn oder Schumann. Bruckners Werk ausschließlich vom „Erlebnis Wagner“ herleiten zu wollen, würde also zu kurz greifen. Und wenn man Bruckners Musik auf ihre innere Struktur hin untersucht, dann fallen sogar erhebliche Unterschiede ins Auge. So ließen sich Bruckner und Wagner offenbar von gegensätzlichen Klangidealen leiten. 2.1 Wagners Klangwelt Stellt man die Frage, was die Klangwelt Richard Wagners charakterisiert, so kann man auf ziemlich dezidierte Ausführungen Wagners zu diesem Thema zurückgreifen. Wagners „Tristan und Isolde“ ist nicht nur ein Schlüsselwerk des neunzehnten Jahrhunderts, sondern nimmt auch im Gesamtschaffen des Komponisten einen zentralen Platz ein. Im Jahre nach der Vollendung von „Tristan und Isolde“ veröffentlichte Wagner seine Schrift „Zukunftsmusik“, in der er sein künstlerisches Schaffen in drei verschiedene Phasen einteilte. In der ersten Phase, die die romantischen Opern umfaßt, sei sein „eigentlichstes System“, wie Wagner es nennt, noch kaum zur Anwendung gelangt. Seine „Theorie“ sei erst in der nächsten Phase, während der Arbeit am „großen Nibelungen-Drama“ entstanden. Die dritte Schaffensphase schließlich werde in „Tristan und Isolde“ manifest: „An dieses Werk nun erlaube ich die strengsten, aus meinen theoretischen Behauptungen fließenden Anforderungen zu stellen.“ Doebel: Anton Bruckner - Originalgenie oder Wagner-Epigone? 9 Als immanente Merkmale dieses „eigentlichsten Systems“ fällt neben dem Melodiebegriff, den Wagner mit dem Terminus der unendlichen Melodie in Verbindung bringt, auch die Bedeutung der Dynamik ins Auge. Wagner schrieb: „[ich war] stets bemüht, […] durch vorbereitende dynamische Ausgleichungen das Fremdartige dermaßen zu verdecken […], daß es wie mit naturgemäßer Folgerichtigkeit“ erscheine. Diese Aussage korrespondiert mit dem oft zitierten Brief an Mathilde Wesendonk vom 29. Oktober 1859. Dort formulierte Wagner die berühmten Sätze: „Meine feinste und tiefste Kunst möchte ich jetzt die Kunst des Überganges nennen, denn mein ganzes Kunstgewebe besteht aus solchen Übergängen: das Schroffe und Jähe ist mir zuwider geworden; […] Mein größtes Meisterstück in der Kunst des feinsten allmählichen Überganges ist gewiß die große Szene des zweiten Aktes von Tristan und Isolde.“ Bei der Umsetzung dieser „Kunst des feinsten allmählichen Überganges“ kommt auch der Instrumentation eine tragende Rolle zu. Wagner selbst spricht in Oper und Drama von dem „unwillkürlichen Reize einer sehr wechselvollen und mannigfaltigen Instrumentation“, von dem das Publikum in seinen Musikdramen gefesselt werde. Diese Instrumentation ist dem Ideal des Mischklanges verpflichtet. Sinn und Zweck dieser Gestaltungsmittel, dessen Ergebnis Claude Debussy etwas sarkastisch mit einem „bunten, fast gleichmäßig aufgetragenen Farbkitt“ verglich, „in dem […] der Klang einer Geige von dem einer Posaune nicht mehr zu unterscheiden sei“, ist feinste Nuancierung und Verschmelzung der Klänge zu einem gerundeten Gesamtklang. So wird Wagners Orchester zu einer Stimme, die jedoch über eine fast unüberschaubar große Palette an Farbabstufungen und -schattierungen verfügt. 2.2 Bruckners Klangwelt Dieser Orchestersprache Wagners, die auf höherer, musikästhetischer Ebene mit der Vereinigung aller Künste zum Gesamtkunstwerk korrespondiert, steht auf Seiten Anton Bruckners eine klare periodische Gliederung und die Verwendung reiner Klangfarben gegenüber. Bruckners Klangvorstellung ist wesentlich von seiner Affinität zum Orgelklang und der Spielweise der Orgel geprägt, weshalb seine Instrumentation gern als Registerinstrumentation bezeichnet wird. Das bedeutet erstens die Beibehaltung einer einmal gewählten Klangfarbe für die Dauer eines Abschnitts, zweitens übergangslose, plötzliche Wechsel zwischen diesen einzelnen Abschnitten, oft auch in Verbindung mit Generalpausen, drittens eine gleichsam chorische Behandlung der einzelnen Orchestergruppen (d. h., es wird den verschiedenen Orchestergruppen in der Regel auch unterschiedliches thematisches Material zugeordnet), und viertens schroffe dynamische Kontraste, die zu den auffälligsten Merkmalen der Brucknerschen Kompositionsweise gehören. Ebenfalls von der Orgel scheinen sich auch jene gewaltigen Klangblöcke herzuleiten, die in ihrem Schwelgen in mächtiger Klangpracht wesentlich zu dem Eindruck der Monumentalität Brucknerscher Musik beitragen und an das volle Werk einer Orgel denken lassen. Durch die innere Gleichförmigkeit und die Geschlossenheit ihrer flächigen Anlage nach außen entsteht der Eindruck einer Statik, einer Klang-Hermetik, die einige Forscher an die Bauweise gotischer Kathedralen gemahnte. Bruckners säulenhaft aufragende Klangblöcke haben tatsächlich etwas von der Betonung der Senkrechten, himmelwärts Strebenden der gotischen Architektur. Hinzu kommt, daß Bruckner diese Klangsäulen oft ‚frei im Raum' stehen läßt, das heißt, daß er sie durch Generalpausen von der Umgebung abgrenzt - eine Bauweise, deren Architektonik nicht nur Gustav Mahler als „Zerstücktheit“ empfand! Aus Bruckners Kompositionsweise resultiert ein sehr charakteristisches Partiturbild, und gerade im Vergleich mit einer Wagnerpartitur ergibt die Analyse durchaus Parallelen zum Klangbild: Während Wagners Notenbild, beispielsweise im Vorspiel zu „Tristan und Isol- Doebel: Anton Bruckner - Originalgenie oder Wagner-Epigone? 10 de“, von zahlreichen kleineren, über alle Stimmen verteilten Pausen durchsetzt ist, was für fast jeden Takt eine neue Klangfarbe hervorruft, weist eine Partiturseite aus einer Symphonie Anton Bruckners gänzlich andere Charakteristika auf. Oftmals läßt sich eine Aneinanderreihung von unterschiedlichsten, dabei aber in sich geschlossenen Bausteinen beobachten, die auf dem Notenpapier geometrische, rechtwinklige Strukturen schafft. Durch Tutti-Blöcke, aber auch durch Registerinstrumentation entstehen schärfste Kontraste auf engstem Raum. Wie ein Organist die Manuale, wechselt Bruckner übergangslos von einer Orchestergruppe in die nächste. Bruckners blockhafte, architektonische Bauweise wird auch dadurch unterstrichen, daß den einzelnen Formteilen bestimmte, ostinate Rhythmen zugeordnet werden. Und unter dem Aspekt des Rhythmischen ist auch die Strukturierung seiner monumentalen Klangblöcke von Bedeutung, deren Oberfläche durch die Ornamentik der Begleitfigurationen und durch charakteristische Rhythmen gleichsam aufgerauht erscheint. Besonders in den Erstfassungen seiner Symphonien experimentierte Bruckner förmlich mit unglaublich modern anmutenden Strukturen. Wir erleben rhythmisch strukturierte Klangflächen, hinter denen die Bedeutung der thematisch-melodischen Elemente zurücktritt. 2.3 Bereiche der Überschneidung Schon immer wurden in der Bruckner-Forschung - je nach Standpunkt und Zweckmäßigkeit - die Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten zwischen der Musik Wagners und der Bruckners herausgestellt. Eduard Hanslick suchte die vermeintlichen Ähnlichkeiten, um Bruckner als Epigonen abstempeln zu können, zugleich aber sahen andere in ihm das Originalgenie und hoben deshalb auf die Herausstreichung der Gegensätze und der jeweils eigenen Tonsprache Wagners wie Bruckners ab. Tatsächlich finden sich in Bruckners Musik zahlreiche Anklänge an die Tonsprache Wagners. Am bekanntesten sind wohl die Zitate aus „Walküre“, „Tristan“ und „Lohengrin“, welche Bruckner nach Annahme der Widmung durch Wagner in die III. Symphonie eingearbeitet hatte. Auch im Adagio der VIII. Symphonie begegnet man einem verbürgten Zitat: dem Beginn des Siegfried-Motivs, welches Bruckner „zur Erinnerung an den Meister“ zweimal erklingen ließ. Wesentlich häufiger vertreten sind jedoch Reminiszenzen an die Musik Wagners. Diese reichen von der Übernahme charakteristischer Motive, die bisweilen fast noch die Prägnanz von Zitaten besitzen, bis zu Wagnertypischen Figuren und Begleitfloskeln wie den herabstürzenden Ton-Kaskaden der „Tannhäuser“-Ouvertüre im Kopfsatz der I. Symphonie Bruckners. Oft werfen solche Reminiszenzen das Problem ihrer Identifizierung auf, und das gilt auch für vermeintliche Zitate. Als Beispiel sei hier nur an ein Motiv erinnert, welches Bruckner im Adagio der ersten Fassung der III. Symphonie verwandte (ab T. 231, zuerst in den Holzbläsern, dann in Trompeten und Posaunen) und von dem Leopold Nowak meinte, darin ein Zitat aus „Lohengrin“ entdecken zu können, nämlich die Chorpassage „Gesegnet sollst Du schreiten“ aus der vierten Szene des zweiten Aktes. Ob Bruckner hier ein konkretes Wagnersches Motiv im Sinn hatte, ist nicht eindeutig zu ermitteln. Assoziationen an die Klangwelt Wagners stellen sich aber auch dort ein, wo kein bestimmtes Thema oder Motiv Wagners anklingt, sondern wo Bruckner ganz allgemein klangliche, formale oder satztechnische Stilmittel Wagners adaptiert und damit eine Wagnersche Atmosphäre schafft. Neben Bruckners Vorliebe für Streicher-Tremoli in höchster Lage, die an den Klang der im Flageolett spielenden Violinen zu Beginn des „Lohengrin“-Vorspiels erinnern und die Bruckner in allen nur erdenklichen Varianten einsetzt, haben auch Wagners weit ausladende Steigerungszüge, wie sie etwa im zweiten „Tristan“-Akt, zu Beginn des „Rheingold“ oder am Schluß der „Götterdämmerung“ anzutreffen sind, Eingang in Bruckners Symphonien gefunden. Doebel: Anton Bruckner - Originalgenie oder Wagner-Epigone? 11 Auch in der Instrumentation finden sich bisweilen Berührungspunkte. So existieren auch bei Bruckner, vor allem in seinen letzten Symphonien, einzelne Passagen, die dem Ideal des Mischklangs, ja selbst der „Kunst des feinsten Überganges“ verpflichtet zu sein scheinen. Auf satztechnischem Gebiet übernahm Bruckner von Wagner Anregungen zu einer teilweise exzessiven Chromatik und einer sehr farbigen Harmonik. „Mit ihrer Fülle an terzverwandschaftlichen Beziehungen, an kühnen Modulationen und Ausweichungen, an Alterationen und Rückungen gehören Bruckners Symphonien zur ‚progressivsten’ Musik, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschrieben wurde.“ Mit diesem Satz faßte Constantin Floros die Modernität Bruckners zusammen, und man könnte hinzufügen, daß Bruckner, dessen Orchesterbesetzung im Vergleich zu Wagner eher konservativ gehalten ist, in den angesprochenen Punkten bisweilen sogar deutlich über Wagner hinausging — was in Anbetracht der Tatsache, daß er Wagner um 13 1/2 Jahre überlebte, nicht überrascht. 2.4 Noch einmal: Unterschiede Wenn von Brucknerähnlichen Strukturen in der Musik Wagners die Rede ist, wird immer wieder auf den „Parsifal“ verwiesen. Theodor W. Adorno bemerkte dazu: „Der Meister des Übergangs schreibt am Ende eine statische Partitur. […] Das statische Wesen des Parsifal […] heißt kompositorisch: […] Verzicht auf fließenden Verlauf und treibende Dynamik.“ Die Orchesterbehandlung „ist weit chorischer als in den Musikdramen zuvor; Brucknerischer, könnte man sagen.“ Solche Beobachtungen, so zutreffend sie im Detail auch sein mögen, dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß natürlich auch der „Parsifal“ in erster Linie wagnerisch ist. Registerhafte, chorische, an Bruckner gemahnende Instrumentation stellt nämlich auch hier die Ausnahme von der Regel dar. Insofern ist der Vergleich mit Bruckner unglücklich gewählt: Wagners Musik ist niemals ‚brucknerisch’ in dem Sinne, in dem Bruckners Musik Wagnersche Einflüsse aufweist. Wagners oberflächliche Kenntnis der III. Symphonie hätte dies wohl kaum zu bewirken vermocht. Das zeigt sich äußerlich schon darin, daß das Gesamtwerk Wagners und Bruckners in Bezug auf die verwendeten Gattungen so gut wie keine Berührungspunkte aufweist: Bruckner komponierte neben elf Symphonien in insgesamt 18 verschiedenen Fassungen lediglich drei große Messen, ein Tedeum und eine Fülle von kleineren weltlichen und geistlichen Chorwerken, während Wagner dagegen fast ausschließlich musikdramatische Werke schuf. Überschneidungen finden sich lediglich in der Negation: Beide komponierten keine nennenswerte Klavier- oder Kammermusik - von Bruckners Streichquintett, bei dem es sich um ein Auftragswerk handelte, einmal abgesehen. Zwar trug Bruckner sich gegen Ende seines Lebens mit Opernplänen, ja er hatte bereits wegen eines geeigneten Librettos briefliche Verhandlungen mit einer Dichterin aufgenommen, von der er sich einen Stoff „à la Lohengrin, romantisch, religiös-misteriös und besonders frei von allem Unreinen!“ wünschte (damit deckte sich seine Auffassung mit der Thomas Manns, für den der „Lohengrin“ ebenfalls „den Gipfel der Romantik“ verkörperte); und Wagner wiederum äußerte ein gutes Jahr vor seinem Tode zu Cosima, wohl nicht ganz ernst gemeint, er wolle, wenn überhaupt, nur noch einsätzige Symphonien schreiben, aber diese Aussagen können für uns nur von hypothetischer Bedeutung sein: Beiden Komponisten war es nicht mehr vergönnt, solche Pläne zu verwirklichen. Im Falle Wagners hätten diese Pläne auch seinen ursprünglichen Intentionen geradezu diametral entgegengestanden: lehnte Wagner doch aus prinzipiellen ästhetischen Anschauungen heraus Instrumentalmusik ab - egal, ob sie als Programmusik im Sinne Berlioz' oder Liszts oder als absolute Musik in Erscheinung trat. Für Wagner hatte das Komponieren von Symphonien in der IX. Symphonie Beethovens seine Erfüllung und seinen Doebel: Anton Bruckner - Originalgenie oder Wagner-Epigone? 12 Abschluß zugleich gefunden. In Beethovens letzter Symphonie sah er den Schlüssel für das Kunstwerk der Zukunft, von dem aus der Weg der Kunst zwangsläufig in die Erschaffung des (Wagnerschen) Gesamtkunstwerkes münden müsse. An diesem Ziel sind auch Wagners kompositorische Mittel ausgerichtet, welche Musik, Sprache und darstellerische Aktion untrennbar zu einer Einheit fügen sollten. Somit sind Wagners häufige Klangfarbenwechsel und die reiche, bewegliche Harmonik und Instrumentation semantisch legitimiert. Folgerichtig ging Wagner von der Unvereinbarkeit seines „eigentlichsten Systems“ mit reiner Instrumentalmusik aus: „Das [im Drama] Ermöglichte wiederum auf die Symphonie anwenden zu wollen, müßte demnach aber zum vollen Verderb derselben führen; denn hier [in der Symphonie] würde sich als ein gesuchter Effekt ausnehmen, was dort [im Drama] eine wohlmotivierte Wirkung ist. […] Erstaunen wir […] über die Unbegrenztheit dieser Fähigkeiten, sobald sie in richtiger Verwendung auf das Drama entfaltet werden, so verwirren wir jene Gesetze, wenn wir die Ausbeute der musikalischen Neuerungen auf dem dramatischen Gebiete auf die Symphonie […] übertragen wollen.“ 3. Schlußbetrachtung Wie sind nun im Lichte dieser eindeutigen Warnung die Wagner-Reminiszenzen in der Musik Anton Bruckners zu bewerten? Kommt Bruckner überhaupt als Adressat dieser Warnung in Frage? Übertrug er wirklich, um noch einmal Hanslick zu zitieren, „Wagner’s dramatischen Styl auf die Symphonie“? Zunächst ist festzuhalten, daß Anton Bruckner sich stets den Komponisten der Neudeutschen Schule auf das Tiefste verbunden fühlte. Mit den theoretischen Maximen dieser Bewegung allerdings, mit den ästhetischen Schriften Wagners oder Liszts, war er nicht vertraut. Bruckner war vielmehr fasziniert von den musikalischen Neuerungen in den Werken eines Berlioz, Liszt oder Wagner. Bedenkt man ferner, daß Bruckner die Musik Wagners erst im Alter von 38 Jahren kennenlernte, so wird es nicht überraschen, daß Bruckners Vorstellungen von Satz und Klang seiner Musik zu diesem Zeitpunkt schon viel zu ausgereift waren, als daß er sich plötzlich zum Wagner-Epigonen hätte wandeln können. Andererseits kann nicht genug hervorgehoben werden, daß das „Erlebnis Wagner“ auf den künstlerischen Werdegang Bruckners wie ein Katalysator wirkte. So wie dieses Erlebnis ungeahnte Kräfte in ihm freisetzte, löste es aber auch innere Spannungen zwischen der verspürten künstlerischen Sendung und der im menschlichen wie im künstlerischen Bereich konservativen Erziehung aus. Nach außen hin bewahrte Bruckner nämlich ererbte Traditionen. So lebte er nicht das Leben eines Bohemien, sondern das eines Staatsbeamten, und er komponierte niemals Musikdramen oder Symphonische Dichtungen, sondern hielt an der Komposition von Instrumentalmusik fest, die sich am klassischen, viersätzigen Symphonie-Schema orientierte. Gleichzeitig aber fühlte Bruckner sich so sehr zu Wagners Kunst hingezogen, daß er durch ihn und die ‚modernen’ Komponisten der Neudeutschen Schule den Mut fand, auch sehr progressive Elemente in seine Tonsprache einfließen zu lassen. Vielleicht ist einer der Gründe für Bruckners Wagnerverehrung gerade darin zu suchen, daß Wagner, gleichsam als Gegenpol zu Bruckners strenggläubiger katholischer Erziehung und dem antiquierten Theoriegebäude Simon Sechters, in seiner Musik all das verkörperte, was Bruckner zunächst durch seine Erziehung versagt bleiben mußte. War Wagner für Bruckner also das Ventil, um aus einer respektierten, aber im Grunde ungeliebten und als überholt empfundenen Tradition auszubrechen? Bruckner jedenfalls erfaßte jedesmal eine große Genugtuung, wenn er in den Werken Liszts oder Wagners einen Verstoß gegen die strengen Regeln seines alten Lehrers Simon Sechter aufspürte. Bruckner fand für sich eine Lösung dieser inneren Spannung, indem er die Einflüsse seiner oberösterreichischen Heimat, seiner vormärzlichen Erziehung, seiner tiefen Gläubig- Doebel: Anton Bruckner - Originalgenie oder Wagner-Epigone? 13 keit, des Orgelklangs und der österreichischen symphonischen Tradition eines Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert mit den Einflüssen der Neudeutschen Schule und denen Wagners zu einer Einheit verschmolz. Diese Einheit charakterisiert die revolutionäre künstlerische Vision Anton Bruckners, eine Vision des Klanges und der Form, die er mit der Schöpferkraft seines Genies in all seinen Symphonien konsequent und doch jedesmal aufs neue umsetzte. Die Frage, wie Anton Bruckner ohne das „Erlebnis Wagner“ komponiert hätte, ist müßig. Wir wissen nur, wie Bruckner mit diesem Erlebnis komponiert hat: es verhalf ihm dazu, seine persönliche Musiksprache zu formulieren, seinen eigenen Weg zu gehen. © Wolfgang Doebel 2008