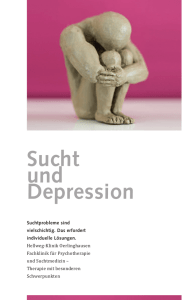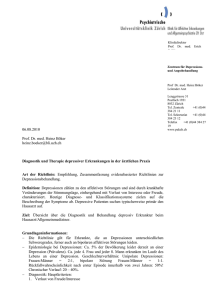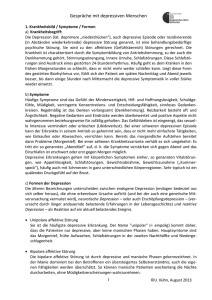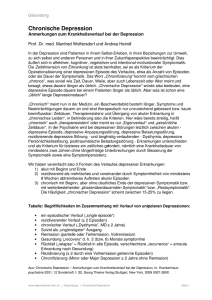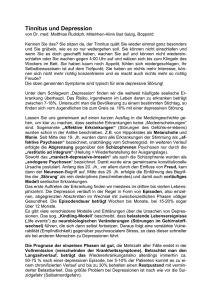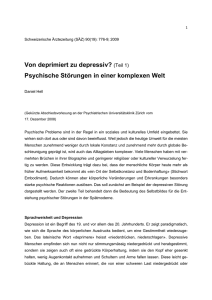Depression - Medizinische Psychologie
Werbung

Dr. Götz Fabry Vorlesung Medizinische Psychologie 15.12.2010: Emotionen: Depression Im Kontext der Vorlesung Medizinische Psychologie können natürlich nur wenige ausgewählte Aspekte des Themas Depression angesprochen werden, weitere Informationen sind aber z.B. in Lehrbüchern der Psychiatrie und Psychotherapie leicht zu finden. Wie Folie 1 zeigt ist die Depression eine der häufigsten psychischen Störungen. Nimmt man alle Erkrankungen (körperliche wie psychische) zusammen, dann ist die Depression sogar diejenige Erkrankung, die weltweit (!) die größte „Krankheitslast“ verursacht (gemessen als sogenannt YDLs – „years lost due to disability“, eine Größe, in die die Zahl der Erkrankten, sowie die Schwere und Dauer der Erkrankung einfließt). Von daher ist es keine Übertreibung zu sagen, dass die Depression eines der drängendsten medizinischen Probleme unserer Zeit ist. Folie 1 Depression: eine der häufigsten psychischen Störungen • Inzidenz: etwa 1% aller Erwachsenen • Lebenszeitprävalenz: etwa 10% bis 20% für schwere depressive Phase • Frauen erkranken etwa doppelt so häufig an einer Depression wie Männer • 50% aller Depressionen treten zum ersten Mal vor dem 40. Lebensjahr auf • nur 10% aller Patienten erkranken erstmalig nach dem 60. Lebensjahr. Spießl et al. 2006 Depression ist allerdings noch kein sehr präziser Begriff, da es sehr unterschiedliche Verläufe und Schweregrade einer depressiven Störung gibt, was auf Folie 2 beispielhaft dargestellt ist. Typischerweise verläuft diese Störung in Episoden, d.h. depressive Zustände wechseln sich mit störungsfreien Intervallen ab. Die Häufigkeit von depressiven Episoden kann dabei sehr unterschiedlich sein. Manche Menschen erleben nur eine einzige depressive Episode in ihrem Leben, andere erleben vier oder fünf, manche Patienten sogar unzählige. Treten mehrere depressive Episoden auf, dann spricht man von einer rezidivierenden (also einer wiederauftretenden) depressiven Störung. Auch die Dauer der Episoden kann variabel sein, durchschnittlich liegt sie bei etwa fünf Monaten. Folie 2 Depression Verlaufsformen Quelle: Kompetenznetz Depression © Dr. Götz Fabry, Abteilung für Medizinische Psychologie, Freiburg. www.medizinische-psychologie.de 1 / 10 Neben dem episodenhaften Verlauf mit Phasen schwerer Depressivität gibt es auch Verlaufsformen, die weniger schwerwiegend verlaufen, dafür aber kaum jemals einen emotionalen Normalzustand aufweisen, die sogenannte „Dysthymie“ („Verstimmtheit“ von griech. thymos = Lebenskraft, Gemütslage). Schließlich ist es häufig so, dass Patienten nicht nur depresssive Episoden erleiden sondern zwischendurch auch manische Episoden, in denen die Stimmung über das Normalmaß hinaus gesteigert ist. Dann spricht man von einer bipolaren affektiven Störung. Die Depression ist ein äußerst vielgestaltiges Krankheitsbild, bei der eine Fülle nicht nur psychischer Symptome auftreten kann (Folie 3). Folie 3 Wie äußert sich eine Depression? Erschöpfung, Energieverlust verminderter Antrieb Niedergeschlagenheit Traurigkeit Verlust von Interesse, Freude, sexuellem Interesse Reduzierte Mimik & Gestik Appetit- und Gewichtsveränderungen Gefühl der Wertlosigkeit, Schuld Schlafstörungen Konzentrationsstörungen Entscheidungsschwierigkeiten Unruhe oder Apathie Todesgedanken, Todeswünsche, Suizidpläne körperliche Beschwerden Abbildung: Wellcome Images Keines dieser Symptome ist spezifisch für die Depression, denn sie können auch im Rahmen anderer psychischer Störungen auftreten und in isolierter und vorübergehender Form sogar im „normalen“ Alltag. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wann aus klinischer Sicht dann eigentlich von einer Depression oder besser gesagt von einer depressiven Episode die Rede sein kann. Da diese Problematik für praktisch alle psychischen Störungen gilt, hat man sich weltweit auf Kriterienkataloge geeinigt, in denen genau beschrieben ist, welche Voraussetzungen vorliegen müssen, damit die Diagnose einer depressiven Störung gestellt werden darf. Zwei solcher Kataloge für psychische Störungen sind gebräuchlich: Zum einen die International Classification of Diseases (ICD) in der gegenwärtig 10. Auflage und zum anderen das Diagnostic and Statistic Manual (DSM) der American Psychiatric Association, dessen fünfte Auflage gerade vorbereitet wird. Die ICD-Kriterien für die Depression sind auf Folie 4 dargestellt. Folie 3 Depression Diagnostische Kriterien nach ICD-10 Hauptsymptome Andere häufige Symptome 1. Gedrückte Stimmung 1. Konzentration vermindert 2. Interessen-/Freudlosigkeit 2. Selbstwertgefühl vermindert 3. Antriebsstörungen, Müdigkeit 3. Schuldgefühl 4. negative Zukunftsperspektive 5. Selbstschädigung 6. Schlafstörungen 7. Appetitminderung 2 oder 3 Hauptsymptome müssen vorhanden sein 2 bis 4 andere Symptome müssen vorhanden sein Dauer: mindestens 2 Wochen Im Hinblick auf die vielfältige Symptomatik der Depression verdienen zwei Aspekte besondere Aufmerksamkeit: Zum einen die Tatsache, dass die Depression mit einer Fülle von körperlichen Symptomen einhergehen kann (Folie 4). Diese körperlichen Beschwerden, die eher unspezifisch sind und somit auf eine ganze Reihe von Erkrankungen hinweisen könnten, stehen mitunter so stark im Vordergrund, dass © Dr. Götz Fabry, Abteilung für Medizinische Psychologie, Freiburg. www.medizinische-psychologie.de 2 / 10 die zugrundeliegende depressive Störung gar nicht als solche erkannt wird. In diesem Zusammenhang wurde daher häufig von einer „larvierten“ Depression gesprochen, einer Depression mit Maskierung (Larve) also. Heute spricht man dagegen von einer depressiven Episode mit somatischem Syndrom (Syndrom = Symptomenkomplex). Folie 4 Körperliche Beschwerden bei Depression Kopfschmerzen Ohrgeräusche Übelkeit Magenschmerzen Muskelkrämpfe. Schwindel Kreislaufbeschwerden Herzbeschwerden Störungen der Sexualfunktion Ein zweiter wichtiger Aspekt ist die Gefahr von Suiziden. Wie Folie 5 verdeutlicht, ist die Depression die wichtigste Ursache von Suiziden überhaupt. Daher muss mit depressiven Patienten unbedingt über das etwaige Vorliegen von Todeswünschen, Suizidgedanken und –plänen gesprochen werden. Dabei muss man sich unbedingt von dem Vorurteil verabschieden, dass das Ansprechen von solchen Gedanken den Patienten erst auf solche bringen oder gar einen Suizid auslösen könnte. Das Gegenteil ist richtig: Häufig sind Patienten entlastet, wenn sie offen und ohne negative Wertungen mit dem Arzt über das Thema sprechen können (auch und gerade deshalb, weil Scham- und Schuldgefühle dabei eine große Rolle spielen und daher die Angst der Patienten, für ihre Gedanken verurteilt zu werden, sehr groß sein kann). Folie 5 Suizidgefahr bei Depression • pro Jahr nehmen sich in Deutschland etwa 11.000 Menschen das Leben, (Dunkelziffer bis zu zehnmal größer?) • 2/3 der Menschen, die sich das Leben nahmen, litten an einer Depression • 80% aller depressiven Patienten haben Todeswünsche • 40% aller depressiven Patienten versuchen, sich das Leben zu nehmen • bis zu 15% aller depressiven Patienten bringen sich um. Aber: die Suizidrate ist seit 1983 (18.711) um 40% gesunken (2002: 11.163)! Erfolg von Präventionsarbeit und antidepressiver Behandlung? vgl. Wolfersdorf 2008, Spießl et al. 2006 Dass die Zahl der Suizide insgesamt zurückgeht könnte zum einen auf eine verbesserte Behandlung depressiver Störungen zurückzuführen sein, zum anderen aber auch auf eine bessere Präventionsarbeit. Ein Faktor ist dabei besonders wichtig, nämlich die Art und Weise, wie über Suizide in den Medien berichtet wird. Aus der Erkenntnis, dass die Gefahr von Nachahmersuiziden insbesondere dann sehr groß ist, wenn über Suizide ausführlich und detailliert berichtet wird, besteht bei den Medien die stillschweigende Übereinkunft, dass in der Regel keine solchen Berichte erscheinen. In Ausnahmefällen, wie z.B. nach dem Suizid des Fußballtorwarts Robert Enke, muss damit gerechnet werden, dass die Berichterstattung eine Reihe von Nachahmersuiziden auslösen wird. Dieses Phänomen wird auch als „Werther-Effekt“ bezeichnet, weil sich nach Erscheinen von Goethes Roman „Die Leiden des jungen Werther“ zahlreiche © Dr. Götz Fabry, Abteilung für Medizinische Psychologie, Freiburg. www.medizinische-psychologie.de 3 / 10 junge Leute in ganz Europa nicht nur so kleideten wie dessen Protagonist sondern diesem leider auch in den Tod folgten und sich umbrachten. Doch was sind eigentlich die Ursachen für eine Depression? Wie bei praktisch allen anderen psychischen Störungen auch geht man heute davon aus, dass dafür ein komplexes Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren verantwortlich ist, das bislang nur teilweise verstanden ist (Folie 6): Zum einen spielen genetische Faktoren eine Rolle, wobei nicht nur an eine Vererbung von direkt mit der Depression in Zusammenhang stehenden Merkmalen (z.B. bestimmten neurobiologischen oder hormonellen) gedacht werden muss, sondern auch an bestimmte Persönlichkeitsmerkmale und Charaktereigenschaften, die das Risiko für eine Depression indirekt vergrößern können, weil sie zu ungünstigen Erlebens- und Verhaltensmustern führen. Unbestritten ist auch der Einfluss der individuellen Lebensgeschichte, aus der in einem Wechselspiel von Entwicklung, Erziehung und (sozialen) Erfahrungen mehr oder weniger starke Ressourcen für die Bewältigung von negativen Emotionen, Stress und kritischen Lebensereignissen resultieren. Kritische Lebensereignisse selbst spielen vor allem als Auslöser depressiver Episoden eine Rolle, als Ursachen im eigentlichen Sinn können sie vor allem dann gelten, wenn sie während bestimmter kritischer Lebensabschnitte z.B. während der Kindheit und gehäuft aufgetreten sind, so dass zum einen eine angemessene Bewältigung nicht möglich war und zum anderen damit die Entwicklung einer stabilen psychischen Struktur verhindert wurde. Die verschiedenen Ursachen führen zu einer Reihe von Veränderungen, die sich sowohl auf psychischer Ebene (z.B. in Form bestimmter kognitiver Bewertungsmuster oder emotionaler Reaktionen, siehe unten) als auch auf neurobiologischer Ebene (z.B. in Form von Auffälligkeiten auf hormoneller Ebene oder in bestimmten Neurotransmittersystemen des ZNS) manifestieren und letztendlich in eine depressive Störung münden. Mittlerweile liegt eine Fülle von Erkenntnissen zu diesen Veränderungen vor, auf deren Grundlage wirkungsvolle pharmakologische wie auch psychotherapeutische Interventionen entwickelt werden konnten. Dennoch fehlt bis heute ein kohärentes Erklärungsmodell für die Depression (wie auch für die meisten anderen psychischen Störungen). Folie 6 Ursachen einer Depression Lebensgeschichte Genetische Faktoren Persönlichkeit Psychische + neurobiologische Veränderungen aktuelle Belastungen (Stress) Depressive Störung Nachfolgend sollen einige wenige dieser Erkenntnisse exemplarisch dargestellt werden. Die Folien 7 und 8 zeigen die Ergebnisse einer sehr aufwändigen Studie, in der Nachkommen depressiver Eltern über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren beobachtet wurden. Dabei zeigte sich, dass im Vergleich zu einer entsprechenden Kontrollgruppe ohne depressive Eltern, nicht nur die Rate an depressiven Erkrankungen erhöht war (Folie 7) sondern dass auch Angst- und Suchterkrankungen häufiger auftraten (Folie 8). Insgesamt war jedoch die Mehrzahl der Nachkommen depressiver Eltern (nämlich etwa 60%) während des Zeitraums der Untersuchung nicht in psychiatrischer Behandlung, was darauf hinweist, dass die familiäre Belastung das Risiko für eine Depression zwar erhöht, diese aber nicht im eigentlichen Sinne verursacht. © Dr. Götz Fabry, Abteilung für Medizinische Psychologie, Freiburg. www.medizinische-psychologie.de 4 / 10 Folie 7 Depression: familiäre Belastung Beobachtungszeitraum: 20 Jahre Eltern ohne depressive Störung (N=50) Anteil der Nachkommen mit depressiver Störung Eltern mit depressiver Störung (N=101) Alter bei Beginn der Depression Weissman et al. 2006 Folie 8 Depression: familiäre Belastung Anteil der Nachkommen mit Angsterkrankungen Anteil der Nachkommen mit Suchterkrankungen Weissman et al. 2006 Alter bei Beginn der Störung Welche Faktoren neben den genetischen dafür verantwortlich sein könnten, dass Kinder depressiver Eltern ein höheres Risiko haben, selbst an einer Depression zu erkranken, ist Gegenstand aktueller Forschung, wie die folgenden Studien exemplarisch verdeutlichen sollen. Im Zusammenhang mit den individuellen Ressourcen zur Bewältigung von Stress wurde bereits auf das von Seligman formulierte Prinzip der erlernten Hilflosigkeit verwiesen (Folie 9). Folie 9 erlernte Hilflosigkeit (Seligman) Stromstöße Barriere shuttle box keine Stromstöße Abbildung aus Comer 22001 © Dr. Götz Fabry, Abteilung für Medizinische Psychologie, Freiburg. www.medizinische-psychologie.de 5 / 10 Zur Erinnerung: Hunde, die zuvor die Erfahrung gemacht hatten, dass sie schmerzhaften Elektroschocks ihres Käfigbodens auf keinerlei Weise entgehen konnten, machten im weiteren Verlauf auch dann keine Versuche mehr, über eine Barriere in einen anderen Käfigteil zu springen, wenn ihnen das die schmerzhaften Erfahrung erspart hätte. Die Erfahrung, in einer bestimmten Situation hilflos zu sein, verursachte offensichtlich die Erwartung, dass dies auch zukünftig so sein wird und führte damit zu einem passiven Verhalten. Auch wenn dieses Modell sicherlich zu einfach ist, um das Entstehen einer depressiven Störung zu erklären, macht es doch deutlich, wie Erfahrungen zu bestimmten ungünstigen Verhaltensmustern führen können. Ein Bereich, in dem solche ungünstigen Verhaltensmuster im Kontext psychischer Störungen besonders relevant sind, ist die emotionale Regulation. In der einführenden Vorlesung zum Thema Emotionen wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich die Fähigkeit, Emotionen regulieren zu können, in der Interaktion mit den primären Bezugspersonen (also in aller Regel den Eltern) herausbildet. Wie die auf den folgenden Folien dargestellten Studienergebnisse zeigen, könnte gerade dieser interaktive Prozess bei Kindern mit depressiven Eltern gestört sein. Untersucht wurde hier eine Gruppe von Kindern im Alter von 4 bis 7 Jahren, deren Mütter eine depressive Störung hatten, wobei das erste Auftreten dieser Störung bereits im Kindesalter der Mütter lag. Verglichen wurden diese Kinder mit einer entsprechenden Kontrollgruppe von Kindern mit gesunden Müttern. Die Kinder wurden in eine Situation gebracht, in der negative Emotionen auftreten und zwar mussten sie einige Minuten auf eine versprochene Belohnung warten (Keks oder Spielzeug). Beobachtet wurde, welche Strategien die Kinder in der Wartezeit einsetzen, um ihre Emotionen zu regulieren (die dabei beobachteten Strategien sind auf Folie 10 aufgeführt). Folie 10 Emotionale Regulation im Kindesalter • 49 Kinder depressiver Mütter (Erstmanifestation im Kindesalter), Vergleichsgruppe (N=37), Alter: 4-7J • Aufgabe: 3-7 min auf versprochenen Keks bzw. Spielzeug warten (Objekt ist dabei sichtbar) • beobachtete Strategien: – aktives Ablenken (Spielen, Singen, Phantasieren…) – Fokus auf Objekt (Hinschauen, darüber reden, Versuch, es zu bekommen…) – passives Warten – Informieren (Fragen stellen zur Situation) – Suche nach Kontakt (Mutter anfassen, Wunsch nach Kontakt…) Silk et al. 2006 Als Ergebnis (Folie 11) zeigte sich zunächst, dass die Kinder beider Gruppen am häufigsten die Strategie „aktives Ablenken“ anwandten. Folie 11 Emotionale Reaktion im Kindesalter am häufigsten benutzte Strategie in beiden Gruppen: - aktives Ablenken signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen: - Fokus auf Objekt (häufiger bei Kindern depressiver Mütter) Silk et al. 2006 © Dr. Götz Fabry, Abteilung für Medizinische Psychologie, Freiburg. www.medizinische-psychologie.de 6 / 10 Diese Strategie ist gut geeignet, um Emotionen zu regulieren, weil durch die Ablenkung die Aufmerksamkeit von dem emotionsauslösenden Objekt abgezogen wird. Es fand sich aber auch ein Unterschied zwischen beiden Gruppen: Die Kinder depressiver Mütter wandten häufiger die Strategie „Fokus auf Objekt“ an, das heißt, sie versuchten z.B., sich selbst in den Besitz des Gegenstands zu bringen oder die Mutter dazu zu bringen, die Wartezeit abzukürzen. Diese Strategie ist weniger geeignet, Emotionen zu regulieren, da die Aufmerksamkeit weiterhin auf das emotionsauslösende Objekt gerichtet bleibt. Besonders interessant waren weitere Auswertungen, in die sowohl die Schwere der depressiven Störung der Mutter mit einbezogen wurde als auch das Geschlecht der Kinder. Letzteres ist deshalb wichtig, weil man aus anderen Studien weiß, dass es bei der Vermittlung emotionaler Regulationsfähigkeit durch die Eltern Geschlechterunterschiede gibt, die weitgehend gängigen Geschlechterstereotypen folgen (Mädchen werden eher soziale Strategien, Jungen eher Ablenkungsstrategien vermittelt). In der Auswertung der Daten zeigte sich ein Interaktionseffekt zwischen der Schwere der Depression der Mutter (gemessen an der Zahl depressiver Episoden) und dem Geschlecht der Kinder (Folie 12 und 13): So machten Mädchen umso seltener von Ablenkungsstrategien Gebrauch, je schwerer die depressive Störung ihrer Mutter war (Folie 12). Umgekehrt machten Mädchen umso häufiger Gebrauch von passivem Abwarten, je schwerer die depressive Störung der Mutter war (Folie 13). (Auch das passive Abwarten ist keine besonders gute Strategie, um Emotionen zu regulieren, weil auch hier die Aufmerksamkeit auf das emotionsauslösende Objekt gerichtet bleibt.) Folie 12 Emotionale Regulation im Kindesalter Geschlecht der Kinder: Häufigkeit von aktivem Ablenken Zahl der depressiven Episoden der Mutter Folie 13 Silk et al. 2006 Emotionale Regulation im Kindesalter Geschlecht der Kinder: Häufigkeit von passivem Warten Zahl der depressiven Episoden der Mutter Silk et al. 2006 Diese Befunde verdeutlichen exemplarisch einen psychischen Mechanismus, der das erhöhte Depressionsrisiko von Kindern depressiver Eltern erklären kann. Der gefundene Geschlechterunterschied steht im Einklang mit anderen Studienergebnissen, die gezeigt haben, dass dieses Risiko für Mädchen tendenziell größer ist als für Jungen. © Dr. Götz Fabry, Abteilung für Medizinische Psychologie, Freiburg. www.medizinische-psychologie.de 7 / 10 Betrachten wir dazu noch einen weiteren Befund, diesmal auf neurophysiologischer Ebene (Folie 14): In dieser Untersuchung wurde die EEG-Aktivität von 15-18 Monate alten Kindern von depressiven bzw. nicht-depressiven Müttern während verschiedener Bedingungen gemessen: „baseline“: 1 min Stille während die Kinder herabfallende Seifenblasen beobachteten und die Mutter still hinter dem Kind sitzt. „mother play“: 1 min während die Mutter dem Kind frontal gegenübersitzt und mit ihm spielt. „stranger approach“: 45 s während eine fremde Person den Raum betritt, sich dem Kind nähert, sich ihm gegenüber hinsetzt und dann den Raum wieder verlässt. „experimenter play“: 1 min während der dem Kind bereits vertraute Assistent diesem frontal gegenüber sitzt und mit ihm spielt. „maternal separation“: die Mutter verabschiedet sich, verlässt den Raum und kommt nach 30 s zurück. In der Baseline-Bedingung sowie bei den beiden Spielbedingungen zeigte sich bei den Kindern depressiver Mütter im Vergleich zur Kontrollgruppe eine im Seitenvergleich reduzierte Gehirnaktivität links-frontal. Dieser Befund wird folgendermaßen interpretiert: Die fraglichen Situationen rufen üblicherweise positive Emotionen hervor, die über die linke Gehirnhemisphäre vermittelt werden (dort also mit einer höheren Aktivität einhergehen). Die Kinder der depressiven Mütter zeigen eine schwächere Reaktion, offenbar fällt es ihnen also schwerer, emotional positiv zu reagieren. Man könnte auch sagen, dass die Schwelle für positive Emotionen bei diesen Kindern höher liegt als bei anderen. Offensichtlich hat also die emotionale Störung der Mutter Konsequenzen für das Interaktionsverhalten des Kindes und zwar selbst in solchen Situationen, in denen die Mutter gar nicht beteiligt ist („experimenter play“). Folie 14 Kinder depressiver Mütter Unterschiede in frontaler EEG-Aktivität kindliche EEG-Aktivität frontal EEG-Power rechts – links (log.) n=159 Mutter-Kind Paare, Kinder 15-18 Monate alt 90 Mütter depressiv (CES-D Score ≥ 16) 69 Mütter nicht-depressiv (CES-D Score ≤ 8) Dawson et al. 1999 Diese Beispiele zeigen eindrucksvoll, wie sich aus der Interaktion mit den primären Bezugspersonen bestimmte Verhaltens- und Erlebensmuster entwickeln und wie dabei bestimmte Muster entstehen können, die z.B. die späteren Fähigkeiten eines Individuums, mit belastenden Lebensereignissen zurecht zu kommen, beeinträchtigen können. Auf der Grundlage solcher Erkenntnisse lassen sich möglicherweise auch präventive Strategien entwickeln, um kindlichen Fehlentwicklungen möglichst frühzeitig entgegenwirken zu können. Folie 15 zeigt noch einen weiteren Baustein psychologischer Erkenntnisse zu Depressionen: Dem amerikanischen Psychologen Aaron T. Beck (geb. 1921) war bei der psychotherapeutischen Behandlung von depressiven Patienten aufgefallen, dass diese typische „Denkfehler“ machten, von denen Beck annahm, dass sie eine depressionsförderliche Wirkung haben könnten. Seine Beobachtungen erweiterte Beck zu einem bis heute sehr einflussreichen kognitiven Modell der Depression: Hintergrund der depressiven Denkfehler sind Beck zufolge negative kognitive Schemata, die sich im Lauf der Lebensgeschichte (besonders wichtig ist hier erneut die Kindheit) herausgebildet haben. Solche Schemata enthalten beispielsweise Einstellungen wie „Mein Wert als Person hängt davon ab, wie erfolgreich ich bin.“ oder „Wenn ich versage, verliere ich die Zuneigung der anderen.“ Es ist leicht einsehbar, dass solche Einstellungen für die Bewältigung bereits der „normalen“, alltäglichen Aufgaben nicht günstig sind, weil von ihnen ein permanenter innerer Druck ausgeht. Unter wiederholten widrigen Umständen oder ausgelöst durch ein kritisches Lebensereignis z.B. den Verlust einer nahen Bezugsperson, können diese negativen Schemata so prominent werden, dass sich bei den Betroffenen eine umfassende negative Sicht ihrer selbst, der Umwelt und ihrer Zukunft breit macht (die sogenannte kognitive Triade): Sie fühlen sich © Dr. Götz Fabry, Abteilung für Medizinische Psychologie, Freiburg. www.medizinische-psychologie.de 8 / 10 selbst als wertlos und unzulänglich, sehen ihre Umwelt als eine Belastung und auch ihre Zukunft als negativ an. Diese umfassende negative Bewertung wird durch die typischen depressiven Denkfehler aufrechterhalten: Willkürliches Schlussfolgern führt dazu, dass aus alltäglichen, in vielfältiger Weise interpretierbaren Begebenheiten Beweise für die negative Weltsicht werden. Sieht ein Depressiver z.B. einen Bekannten in der Stadt, der ihn aber nicht grüßt (z.B. weil dieser ihn gar nicht bemerkt hat), so ist er davon überzeugt, dass der Bekannte nichts mit ihm zu tun haben will. Durch selektive Abstraktion werden aus einer Fülle von Fakten gerade die negativen herausgepickt, die wiederum als Beweis des eigenen Versagens angesehen werden können (z.B. sieht ein Lehrer, der an einem Tag nach fünf erfolgreichen Schulstunden eine weniger gute Stunde erlebt gerade diese als Beweis seiner Unfähigkeit an). Übergeneralisierung beschreibt ein ähnliches Phänomen, hier werden aus kleinen Begebenheiten (z.B. einer Verspätung um wenige Minuten) weitreichende Schlüsse gezogen („Ich bin unzuverlässig.“). Durch Maximierung und Minimierung wird die Bedeutung positiver Ereignisse unterschätzt, die negativer Ereignisse dagegen überschätzt. So würde z.B. ein Student, der ein schwieriges Testat bestanden hat, seinen Erfolg minimieren, indem er diesen der Großzügigkeit des Prüfers zuschreibt während er andererseits eine schlechtere Bewertung in einer Hausarbeit als ein derart großes Problem ansieht, dass er sich mit dem Gedanken trägt, das Studium abzubrechen (Maximierung). Mit Personalisierung ist schließlich gemeint, dass depressive Personen dazu neigen, den Fehler selbst dann bei sich zu suchen, wenn sie objektiv gar nicht dafür verantwortlich sein können. Die depressiven Denkfehler führen wiederum dazu, dass sich die negativen Schemata stabilisieren und verstärken, so dass sich die Patienten in einem Teufelskreis befinden, den sie aus eigener Kraft meistens nicht durchbrechen können. Die negativen Gedanken drängen sich förmlich „automatisch“ auf und laufen gebetsmühlenhaft im Kopf der Patienten ab: „ich bin unfähig….“, „ich bin nichts wert…“, „ich schaffe das nicht…“ usw. Folie 15 Depression: negatives Denken (A. Beck) negative kognitive Schemata lebensgeschichtliche Erfahrungen kognitive Triade: negative Bewertung von: Umwelt Ich Zukunft Depressive Denkfehler: willkürliches Schlussfolgern selektive Abstraktion Übergeneralisierung Maximierung und Minimierung Personalisierung Für das Modell von Beck gibt es mittlerweile einige empirische Belege, wie Folie 15 verdeutlicht. Demnach könnten solche negativen Gedanken sowohl bei der Entstehung zumindest depressiver Stimmung, vor allem aber beim Aufrechterhalten einer depressiven Störung eine wichtige Rolle spielen. Insofern wäre es naheliegend, diese kognitiven Verzerrungen auch zum Gegenstand der Psychotherapie bei Depression zu machen, was tatsächlich auch geschieht. Aufbauend auf den Erkenntnissen von Beck ist das „kognitive Umstrukturieren“ ein wesentlicher Bestandteil in der Psychotherapie mit depressiven Patienten. Dazu müssen zunächst die beschriebenen depressiven Denkfehler im Erleben des Patienten identifiziert werden, indem Alltagssituationen, Begegnungen, Erlebnisse des Patienten sehr genau im Hinblick auf die dabei erfahrenen Gedanken und Gefühle analysiert werden. Dieser erste Schritt dient also dazu, dem Patienten sein einseitiges depressives Denken bewusst zu machen, so dass er es auch im Alltag bei sich selbst zunehmend besser bemerken kann (dabei ist es natürlich von zentraler Bedeutung das Denken des Patienten nicht als falsch oder irrational zu bewerten, sondern als Ausdruck seiner Depression). In einem zweiten Schritt können dann mit dem Patienten alternative kognitive Bewertungsmuster erprobt und regelrecht eingeübt werden, indem z.B. der Realitätsgehalt seiner depressiven Bewertungsmuster sehr genau mit ihm überprüft wird, indem er sich vorstellt, was andere Bewertungen für Konsequenzen hätten usw. © Dr. Götz Fabry, Abteilung für Medizinische Psychologie, Freiburg. www.medizinische-psychologie.de 9 / 10 Folie 16 negatives Denken empirische Belege • depressive Patienten erinnern sich besser an unangenehme Erfahrungen als an positive • depressive Probanden schätzten sich und ihre Leistung schlechter ein als nicht-depressive (auch bei objektiv gleicher Leistung) • depressive Probandinnen wählten bei Fragen zu einem Text (Frauen in schwierigen Situationen), signifikant häufiger Antworten, die depressive Denkfehler enthielten • nicht-depressive Probanden, die negative Aussagen (i.S. „automatischer Gedanken“) über sich selbst lesen mussten wurden zunehmend depressiv • Bei depressiven Patienten mit Grübelneigung hielt die depressive Verstimmung länger an. nach Comer 22001 Außer diesem kognitiv orientierten Vorgehen gibt es natürlich noch eine Reihe anderer psychotherapeutischer Strategien, die z.B. auf die Beziehungsprobleme des Patienten gerichtet sind oder die auf den direkten Aufbau von angenehm erlebten Aktivitäten zielen. Insgesamt gilt das psychotherapeutische Vorgehen bei der Depression als der wichtigste Therapiebaustein überhaupt. Bei schweren depressiven Störungen ist allerdings zusätzlich (!) eine langfristige medikamentöse Therapie meist unvermeidbar, auch um das Risiko weiterer depressiver Episoden zu verringern. Folie 17 Depression take-home-message • ist eine häufige und sehr ernste Erkrankung • hat vielfältige Ursachen auf genetischer, neurobiologischer und psychischer Ebene • erfordert psychotherapeutische und je nach Schweregrad auch psychopharmakologische Maßnahmen Literatur: • Belmaker RH, Agam G (2008): Major depressive disorder. New England Journal of Medicine, 358(1): 55-68. • Comer RJ (2008): Klinische Psychologie. 8. Aufl. Heidelberg (Spektrum Akademischer Verlag). • Dawson G, Frey K, Panagiotides H, Yamada E, Hessl D, Osterling J (1999): Infants of depressed mothers exhibit atypical frontal electrical brain activity during interactions with mother and with a familiar nondepressed adult. Child Development, 70 (5): 1058-1066. • Margraf J, Schneider S (Hrsg) (2008): Lehrbuch der Verhaltenstherapie. 3. Aufl. Bd. 2: Störungen des Erwachsenenalters. Heidelberg (Springer Verlag). • Silk JS, Shaw DS, Skuban EM, Oland AA, Kovacs M (2006): Emotion regulation strategies in offspring of childhood-onset depressed mothers. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(1): 69-78. • Spießl H, Hübner-Liebermann B, Hajak G (2006): Volkskrankheit Depression. Deutsche Medizinische Wochenschrift, 131: 35-40. • Weissmann MM, Wickramaratne P, Nomura Y, Warner V, Pilowsky D, Verdeli H (2006): Offspring of depressed parents: 20 years later. American Journal of Psychiatry, 163: 1001-1008. • Wolfersdorf M (2008): Depression und Suizid. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 51: 443-450. © Dr. Götz Fabry, Abteilung für Medizinische Psychologie, Freiburg. www.medizinische-psychologie.de 10 / 10