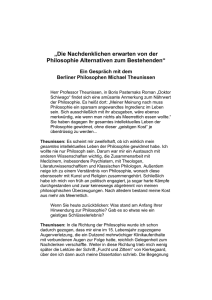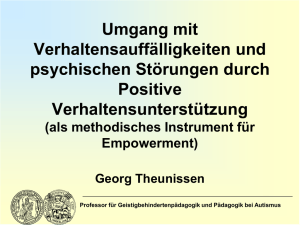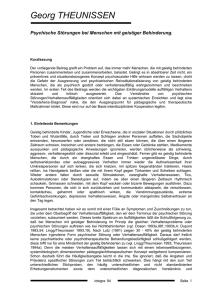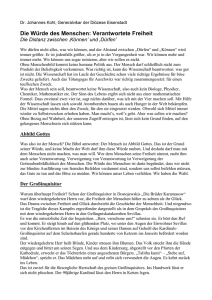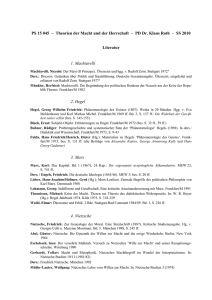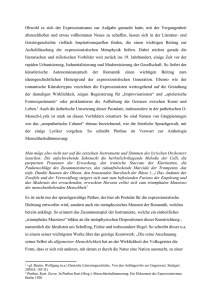Kommunikative Freiheit und negative Theologie
Werbung

Kommunikative Freiheit und negative Theologie Fragen an Michael Theunissen Kof!Imunikative Freiheit und negative Theologie Fragen an Michael Theunissen Michael Theunissen verdankt die verhaltene Radikalität sei­ nes Denkens dem Umstand, daß er sich gleichzeitig für Kierkegaard und für Marx geöffnet hat - für jene beiden Geister also, die sich ihrerseits dem spekulativen Gedanken Hegels radikaler als alle anderen ausgesetzt hatten. So zie­ hen die beiden Philosophen, die in unserem Jahrhundert Kierkegaard und Marx erst wieder zu philosophischem Le­ ben erweckt haben, Theunissens besonderes Interesse auf sich: die Existentialontologie und der Hegelmarxismus. Mit beiden Traditionen setzt sich Theunissen im Rückgriff auf deren ursprüngliche Motive auseinander: Aus seiner Sicht behalten der authentische Kierkegaard und der kritisch an­ geeignete Marx recht sowohl gegen Heidegger und Sartre wie gegen Horkheimer und Adorno.1 Dabei kann sich Theunissen auf Ergebnisse einer schon früh vollzogenen kommunikationstheoretischen Wende stützen, die gegen­ über der durch Einstellungen der ersten und der dritten Per­ son bestimmten Subjekt-Objekt-Beziehung die Relevanz der zweiten Person - des Anderen in der Rolle des Du - zur Geltung bringt. Die dialogische Begegnung mit dem angesprochenen Ande­ ren, dessen Antwort sich der eigenen Verfügung entzieht, eröffnet dem Einzelnen erst den intersubjektiven Raum für sein eigentliches Selbstsein. Theunissen hat seine Dialogphi­ losophie in der Auseinandersetzung mit der transzendenta­ len Intersubjektivitätstheorie von Husserl bis Sartre entwik­ kelt. Sie läßt sich nicht nur durch Bubers »Theologie des Zwischen« anregen, sondern lebt selbst aus theologischen II2 Motiven. Theunissen versteht nämlich jene »Mitte« des in­ tersubjektiven Raums, den die dialogische Begegnung er­ schließt und der seinerseits die dialogische Selbstwerdung von Ich und Anderem ermöglicht, als »Reich Gottes«, das der Sphäre der jeweiligen Subjektivität vorausgeht und zu­ grunde liegt. Mit Bezugnahme auf Lukas 17,21 - »das Reich Gottes ist mitten unter euch« - erklärt Theunissen: »Es ist zwischen den Menschen, die zu ihm berufen sind, als gegen­ wärtige Zukunft.« Theunissen hat zeitlebens versucht, den Gehalt dieser einen zentralen Aussage philosophierend ein­ zuholen. Denn »vermutlich ist die Wirklichkeit, als die sich der Dialogik das Zwischen in theologischer Sicht zeigt, die Seite am Reich Gottes, deren Philosophie überhaupt ansich­ tig werden kann: die Seite nicht der >Gnade<, sondern des >Willens<. Der Wille zum dialogischen Selbstwerden gehört so zum >Trachten< nach dem Reich Gottes, das in der gegen­ wärtigen Liebe der Menschen zueinander seine Zukunft verheißt.«2 Später hat Theunissen versucht, dieses theologische Motiv mit Hilfe des Begriffs der »kommunikativen Freiheit« in die kritische Gesellschaftstheorie einzubeziehen, um so Kierke­ gaard mit Marx kompatibel zu machen. Der Alternative, die sich letztlich doch stellte, ist er freilich nicht ausgewichen der Wahl zwischen der theologischen und der materialisti­ schen Lesart von Versöhnung..Einer rational ermutigten Transzendenz von innen hat er stets den proleptischen Vor­ schein eines Eschaton vorgezogen, das in der Gegenwart Zuversicht einflößen kann. Auch diese Option soll noch philosophisch begründet werden können. Das ist der An­ spruch, den ich im folgenden prüfen möchte. Gründe sieht Theunissen vor allem bei Kierkegaard, und er scheint sie insbesondere in einer durch Kierkegaard erneuerten Fichte113 sehen Denkfigur zu finden. Natürlich will sich Theunissen nicht hinter dem Autor der »Krankheit zum Tode« und des­ sen Autorität verstecken. Seine Argumente geben aber den Anstoß für Theunissens negativistische Begründung eines authentischen Selbstseins. Zunächst möchte ich den Anspruch charakterisieren, we­ sentliche Gehalte der christlichen Heilserwartung unter Be­ dingungen nachmetaphysischen Denkens zu rechtfertigen. Anschließend erörtere ich die Argumente, mit denen Theu­ nissen auf den heute »noch gangbaren Wegen philoso­ phischen Denkens« diesen starken Anspruch einzulösen versucht. Meine kritischen Anfragen berühren nicht die So­ lidarität mit einem bewundernswerten Unternehmen, dem ich mich in seinen praktischen Antrieben und Intentionen verbunden weiß. Das Christentum ist in der Geschichte des abendländischen Denkens seit Augustin mit den metaphysischen Überliefe­ rungen platonischer Herkunft auf vielfache Art Symbiosen eingegangen. In Übereinstimmung mit Theologen wie Jür­ gen Moltmann und Johann Baptist Metz3 bemüht sich Theunissen darum, den ursprünglichen eschatologischen Gehalt eines aus seinen hellenistischen Hüllen befreiten Christentums wiederherzustellen. Dessen Kern ist ein mit Wesensbegriffen unvereinbares, radikal geschichtliches Denken: »Die Herrschaft des Vergangenen über das Zu­ künftige macht überhaupt erst den Zwangscharakter der er­ lösungsbedürftigen Realität aus. Die erlösungsbedürftige Realität bildet einen universalen Zwangszusammenhang, weil in ihr die Zukunft ständig von der Vergangenheit über114 wältigt wird.«4 Dieser Satz hat bei Theunissen einen ge­ nauen, über Adornos »Negative Dialektik« hinausreichen­ den theologischen Sinn: »Wenn es die Herrschaft des Ver­ gangenen ist, durch die der Mensch in die Ohnmacht des Nicht-Handeln-Könnens versinkt, so erwacht er aus dieser Ohnmacht durch das befreiende Handeln Gottes. Sein Da­ sein in der Zeit, das die von Platon auf den Weg gebrachte Metaphysik unter dem negativen Gesichtspunkt des Ver­ änderlichen betrachtet, nimmt die positive Gestalt des Ver­ änderbaren an.«5 Was Theunissens Position auch von den benachbarten Theologen trennt, ist nun der Anspruch, die gemeinsame Intention mit nicht-theologischen Mitteln ein­ zulösen. Diese entlehnt Theunissen der metaphysischen Grundbegrifflichkeit des gleichzeitig zu überwindenden Platonismus. Dabei läßt er jene vorsichtige Unterscheidung zwischen Aspekten der »Gnade« und des »Willens«, unter denen sich das Reich Gottes nur dem Theologen oder auch dem Philosophen erschließen sollte, fallen. Inzwischen scheint er sich zuzutrauen, die Kluft, die zwischen dem Ap­ pell an die im Glauben erfahrene Realität einerseits, der Überzeugungskraft philosophischer Gründe andererseits besteht, ihrerseits mit Argumenten zu schließen. Die Benjaminsche Intuition, daß das schlechte Kontinuum aller bisherigen Geschichte aufgebrochen werden muß - der Schrei der gequälten Kreatur, daß alles »anders werden müsse« - hat nach den Katastrophen unseres Jahrhunderts gewiß eine mehr als nur suggestive Kraft. Heute bedrängen uns die Regressionen, die der Zerfall des Sowjetimperiums ausgelöst hat. Auch angesichts dieser Phänomene bedarf der Impuls, sich gegen die Herrschaft der Vergangenheit über die Zukunft aufzulehnen6, bedarf sogar der Imperativ, die Kette der fatalen Wiederkehr des Gleichen zu sprengen, kei1I 5 ner weitläufigen Rechtfertigung: »Benjamin hat die unsägli­ che Traurigkeit beschrieben, die der Anblick der zur Natur erstarrten Geschichte hervorruft. Wirkliche Geschichte gäbe es erst, wenn die Zeit eine andere würde.«7 Allein, in welchem Sinne läßt sich eine solche Erwartung verstehen als Aussicht auf ein bevorstehendes Ereignis, als Zuversicht in eine verheißene Wende, als Hoffnung auf das Gelingen ei­ nes begünstigten, gar begnadeten Unternehmens? Oder soll das semantische Potential der Heilserwartung nur eine Di­ mension offenhalten, aus der wir auch in profanen Zeiten ei­ nen Maßstab für die Orientierung am jeweils Besseren ge­ winnen und aus der wir Mut schöpfen können? Die Hoffnung, daß das eigene Zutun nicht a fortiori sinnlos ist, kann dem Pessimismus, ja der Verzweiflung durch mehr oder weniger gute Gründe abgerungen werden. Eine derart rational motivierte Ermutigung darf jedoch nicht verwech­ selt werden mit existentieller Zuversicht, die aus dem voll­ brachten Skeptizismus einer gegen sich selbst gewendeten Verzweiflung hervorgeht. Die Hoffnung, daß doch noch »alles anders wird in der Zeit«, unterscheidet sich eben von dem Glauben, »daß die Zeit selbst anders wird.« Die zwei­ deutige Formulierung vom »Anderswerden der Zeit« ver­ deckt die Differenz zwischen dem Vertrauen auf eine escha­ tologische Wende der Welt und der profanen Erwartung, daß unsere Praxis in der Welt eine Wendung zum Besseren trotz allem befördern könnte. Diesseits einer spes fidei, die sich aus einer Kierkegaardschen Dialektik der Verzweifl�ng nährt, bleibt Raum für eine fallible, von einer skeptischen, aber nicht-defaitistischen Vernunft belehrte Hoffnung. Diese docta spes ist unverächtlich, wenn auch nicht unver­ wüstlich. Theunissen würde wohl diese Differenz kaum leugnen, aber an der Aufgabe festhalten, daß die profane II6 Hoffnung mit philosophischen Gründen in der eschatologi­ schen zu verankern sei. In seiner jüngsten Publikation nennt Theunissen drei Wege des philosophischen Denkens, die ihm heute noch gangbar erscheinen. Die Philosophie soll sich die kritische Aneig­ nung der Geschichte der Metaphysik im ganzen zumuten; sie kann Beiträge zur Reflexion der Fachwissenschaften lei­ sten und sogar metaphysische Gehalte der Tradition, die sich wissenschaftlicher Objektivierung entziehen, aus ihrer nachmetaphysischen Stellung heraus retten. Nach diesem Programm versichert sich die Philosophie auf dem Weg der historischen Selbstreflexion zunächst der Gedanken, die sie sodann im Durchgang durch die Wissenschaften wie auch über diese hinaus systematisch entfaltet.8 So verraten schon die beiden Themen, die Theunissen historisch beschäftigen, die systematische Absicht. Unter dem Stichwort kommuni­ kative Freiheit analysiert er das Verhältnis von Subjektivität und lntersubjektivität im Durchgang durch die »Logik« Hegels. Und mit dem Blick auf die proleptische Zukunft der in die Gegenwart hereinragenden christlichen Verheißung analysiert er die zeitvergessenen Begriffe der Metaphysik von Parmenides bis Hegel. Unter beiden Aspekten verfolgt Theunissen die Ontologisierung der Theologie, also eine Hellenisierung des Christentums, die den soteriologischen Gehalt des radikal geschichtlichen Denkens verschüttet. Wie Heidegger bemüht sich Theunissen um eine Dekon­ struktion der Geschichte der Metaphysik. Dabei hat er aber nicht das »archäologische« Ziel vor Augen, mit einem Sprung aus der Modeme hinter Jesus und Sokrates zurück­ zukehren. Theunissen zielt vielmehr auf eine philosophisch begründete negative Theologie ab, die eine mit sich zerfal­ lende Modeme aus ihrer Zerstreuung zurückrufen und für I17 die unverständlich gewordene Heilsbotschaft doch noch sensibel machen soll. II Theunissen trägt an Hegels »Logik«, die die Geschichte der abendländischen Metaphysik auf ihre Weise resümiert, eine aus der nachhegelschen Dialogphilosophie gewonnene Hy­ pothese heran: »Die gesamte Logik gründet Hegel auf die Hypothese, daß alles, was ist, nur in der Beziehung und letztlich als die Beziehung auf >sein Anderes< es selbst sein könne.«9 Diese in der intersubjektiven Beziehung zum An­ deren sich realisierende Selbstbeziehung setzt Theunissen dem Für-sich-Sein der Subjektivität entgegen. Das wahre Selbstsein äußert sich als kommunikative Freiheit - als lm­ Anderen-bei-sich-se/bst-sein; dazu verhält sich die Liebe das Bei-sich-selbst-sein-im Anderen - komplementär. Der Zusammenhang - oder gar die Koinzidenz - von Freiheit und Liebe charakterisiert die unversehrte lntersubjektivität eines Verhältnisses symmetrischer wechselseitiger Anerken­ nung. Darin ist einer für den anderen nicht die Schranke sei­ ner Freiheit, sondern eine Bedingung gelingenden Selbst­ seins. Und die kommunikative Freiheit des einen kann nicht ohne die realisierte Freiheit aller anderen vollkommen sein. Mit diesen Begriffen einer solidarischen und zwanglos in­ dividuierenden Vergesellschaftung gibt Theunissen dem konkret Allgemeinen eine dialogische Fassung, die kritisch gegen Hegel selbst gewendet werden kann. »Abstraktion« bedeutet dann eine »Gleichgültigkeit gegen anderes«, die die »Beziehung zum Anderen« neutralisiert. Diese Indifferenz wiederum bedeutet, weil sie kommunikative Freiheit ver­ hindert, Herrschaft. In ihrer kommunikationstheoretischen II8 Lesart erhält deshalb Hegels Dialektik einen herrschaftskri­ tischen Sinn. Theunissen argumentiert mit Hegel gegen Hegel. Er mar­ kiert die Stellen, an denen Hegel vom Pfad einer dialekti­ schen Untersuchung der »Praxis des Miteinanderspre­ chens« abweicht und die zum Greifen nahe Dimension der Sprachpragmatik zugunsten der logischen Analyse von »bloßem Urteil oder Satz« vernachlässigt.10 Hegels logisch­ semantische Engführung kommt der Aufspreizung des Re­ flexionsmodells entgegen, welches das Bei-sich-Sein der epistemischen Selbstbeziehung gegenüber der Beziehung zum Anderen privilegiert. Wo die kommunikative Freiheit die wechselseitige Anerkennung von Differenz und Anders­ heit fordern würde, erzwingt das Reflexionsmodell Einheit und Totalisierung. 11 Theunissen sträubt sich auch gegen den affirmativen Zug ei­ ner in der dialektischen Logik versteckten Theodizee, wo­ nach das Wirkliche das Vernünftige sei. In Hegels Begriff des Unwahren verschwindet die Differenz zwischen dem Inhaltslosen und dem erst Unentwickelten. Diese Differenz will Theunissen mit Hilfe der von Marx entlehnten Unter­ scheidung zwischen Darstellung und Kritik wiederherstel­ len. Die Auflösung eines objektiven Scheins bringt nicht im­ mer die Wahrheit einer neuen Positivität zum Vorschein; oft genug behält sie den destruktiven Sinn einer Enthüllung der Wahrheit über etwas.12 Interessanterweise zeigt sich schon an dieser Stelle, was Theunissen bei aller Kritik an Hegel gleichwohl von Kritik verschont - den Begriff des Absolu­ ten. Wohl präjudiziert Hegel mit seinem Begriff der bestimmten Negation eine Einheit von Kritik und Darstellung, die der Darstellung den kritischen Stachel zieht. Aber Theunissen 119 spielt das zu einer bloß methodischen Frage herunter, ob­ wohl Hegel die Einheit von Kritik und Darstellung auf die substantielle Annahme einer logischen Verfassung des Welt­ prozesses im ganzen stützt. An diesen metaphysischen Kern des Problems - daß aus der Orthogenese der Natur keine Pathogenese der Geschichte entspringen kann, wenn sich das Prozessieren der Geschichte in denselben logischen Formen wie der Naturprozeß vollzieht - rührt Theunissen nicht. Seine Kritik macht halt vor der Totalisierung des Bei­ sich-Seins-im-Anderen zur kommunikativen Verfassung der Welt im ganzen. Die Idee der Einheit von Selbstbezie­ hung und Beziehung zum Anderen regiert die Bewegung der gesamten Logik und erstreckt sich auf eine im ganzen intersubjektivistisch begriffene Wirklichkeit. Sie beschränkt sich keineswegs auf die Sphäre zwischenmenschlicher Be­ ziehungen. Dem stimmt Theunissen zu, auch wenn die als universale Kommunikationstheorie begriffene »Logik« er­ kennen lassen soll, »daß sie eine Struktur freilegt, die ihre einzig angemessene Realität in den Verhältnissen menschli­ cher Subjekte zueinander hat«.13 Der metaphysischen An­ nahme, daß die an der dialogischen Verständigung abgele­ sene Grundstruktur des Bei-sich-seins-im-Anderen über den Horizont der Lebenswelt hinaus auf die Welt im ganzen übergreift, widerspricht Theunissen nicht. Er ist nämlic-h davon überzeugt, daß jede interpersonale Beziehung in die Beziehung zu einem ganz Anderen einge­ bettet ist, die dem Verhältnis zum konkreten Anderen zu­ vorkommt. Dieser ganz Andere verkörpert eine absolute Freiheit, die wir voraussetzen müssen, um zu erklären, wie unsere kommunikative Freiheit überhaupt möglich ist: »denn absolut könnte nur sein, was das Andere so aus sich entläßt, daß dessen Freiheit zugleich seine eigene Freiheit 120 von und zu ihm ist«.14 Diese Denkfigur geht auf die jüdische und protestantische, durch den schwäbischen Pietismus vermittelte Mystik zurück: Gott bestätigt sich in seiner Frei­ heit dadurch, daß er ein ebenso freies Alter ego aus sich her­ aussetzt. Indem er die Menschen in die Freiheit, ihr Selbst­ sein verfehlen und aus eigener Kraft erringen zu können, entläßt, zieht er sich aus der Welt in sich zurück. In der Kommunikationsgeschichte der Menschen ist Gott nur noch als ermöglichende und zugleich richtungsweisende Struktur der Versöhnung präsent - und zwar im Modus der Verheißung, eben der »vorfallenden« Gegenwärtigkeit einer erfüllten Zukunft.15 Wie man sieht, kann eine systematische Aneignung der Ge­ schichte der Metaphysik vielleicht unüberholte Problem­ stellungen vergegenwärtigen. Aber kann sie unsere Distanz zu Lösungsvorschlägen, die in der Sprache der Metaphysik vorgetragen werden, tilgen? Auch die kommunikations­ theoretische Lesart der Begriffslogik macht uns bestenfalls vertraut mit der Idee, daß die kommunikative Freiheit des Bei-sich-seins-im-Anderen die absolute Freiheit der ganz Anderen voraussetzt. Es bleibt am Ende unentschieden, wie dieses in die Struktur unverzerrter Intersubjektivität einge­ lassene Potential zu verstehen sei: als ein idealisierender Überschuß, der den kommunikativ Handelnden ein von ih­ nen selbst zu vollziehendes Transzendieren zumutet - oder als der Einbruch eines vorgängigen Geschehens kommuni­ kativer Befreiung, das von den in die Freiheit Entlassenen Hingabe verlangt. Wenn Gott, der sich einst in die über­ schießende Struktur sprachlicher Verständigung zurückge­ zogen haben soll, den zur kommunikativen Freiheit verur­ teilten Geschöpfen den Prozeß der Geschichte überlassen hätte, müßte ihrer profanisierenden Arbeit auch dieser My121 thos vom sich selbst begrenzenden Gott am Ende selber an­ heimfallen. Wenn Gott jedoch in der Geschichte einziger Garant für die offengehaltene Möglichkeit bleibt, aus der Kontinuität des naturwüchsigen Kreislaufs einer vergan­ genheitsbeherrschten Geschichte auszubrechen, dann harrt der Begriff des Absoluten, der mit jedem Akt gelingender Verständigung schon präsupponiert ist, einer angemessenen philosophischen Erklärung. Diese Aufgabe ist auf dem Wege einer Destruktion der Geschichte der Metaphysik nicht zu lösen. III Deshalb bemüht sich T heunissen um eme nachmetaphy­ sisch ansetzende Begründung des metaphysischen Gehalts kommunikativer Freiheit. Er entfaltet sein Argument im Anschluß an den Text »Krankheit zum Tode«. a) Zunächst grenzt Theunissen sein »negativistisches« von einem »normativistischen« Vorgehen ab. Nach der Verab­ schiedung der Substanz- und Wesensbegriffe der Metaphy­ sik, mit denen das Seinsollende in der Ordnung der Dinge selber verankert worden war, ist in der Neuzeit die Archi­ tektonik der Vernunft an die Stelle der objektiven Teleologie getreten. Seitdem lassen sich normative Gehalte nicht mehr ontologisch aus dem Seienden selbst, sondern nur noch re­ konstruktiv aus notwendigen subjektiven Bedingungen für die objektive Gültigkeit unserer Erfahrungen und Urteile gewinnen. Die sprachpragmatische Wende vom Bewußt­ seins- zum Verständigungsparadigma hat freilich dieser Un­ tersuchung normativ gehaltvoller transzendentaler Bedin­ gungen nochmals eine neue Richtung gegeben. Nun soll das Faktum gelingender intersubjektiver Verständigung aufge!22 klärt werden. In den allgemeinen und unvermeidlichen pragmatischen Voraussetzungen kommunikativen Han­ delns stoßen wir auf den kontrafaktischen Gehalt von ldealisierungen, die alle Subjekte, sofern sie ihr Handeln überhaupt an Geltungsansprüchen orientieren, vornehmen müssen. Die Nicht-Beliebigkeit dieses im weiteren Sinne normativen Gehalts unausweichlicher Kommunikations­ voraussetzungen ist weder ontologisch durch die zweckmä­ ßige Verfassung des Seienden noch epistemologisch durch die vernünftige Ausstattung der Subjektivität gesichert; sie wird allein durch die Alternativlosigkeit einer Praxis be­ glaubigt, in der sich kommunikativ vergesellschaftete Sub­ jekte immer schon vorfinden. Auf diesem formalpragmati­ schen Wege habe ich selbst versucht, in der Geltungsbasis verständigungsorientierten Handelns ein Vernunftpotential ausfindig zu machen, auf das sich die kritische Gesell­ schaftstheorie als normative Grundlage berufen kann.16 Diesen »Normativismus« lehnt T heunissen ab, aber nicht etwa deshalb, weil er darin die metaphysischen Spuren von Wesensbestimmungen und objektiver Teleologie argwöhn­ te.17 Vielmehr führt der »Negativismus«, der sein eigenes Vorgehen leiten soll, den normativen Gehalt wiederum ins Ontische ein, allerdings auf dem Wege einer Inversion des dem Seienden inhärierenden Seinsollens. W ährend sich die logische Operation der Verneinung auf den affirmativ erho­ benen Geltungsanspruch bezieht, den eine zweite Person für ihre Aussage erhebt, soll die »ontische Negativität« dem von uns negativ Bewerteten selber zukommen: »Unter dem >Negativen< verstehen wir hier das, womit wir nicht einver­ standen sind, oder das, wovon wir nicht wollen (können), daß es ist. In diesem (ontologischen) Sinne soll es nicht sein.« 18 Freilich bezieht sich die Negativität des Nichtsein123 sollenden oder objektiv Unwahren nicht mehr wie die ob­ jektiveTeleologie auf das in der Welt Seiende oder den Kos­ mos des Seienden im ganzen. Im Sinne einer invertierten Geschichtsphilosophie ist die Verfassung der historischen Welt, in der die Menschen leben und leiden, negativ. Die Ne­ gativität der Seinsverfassung ist die von uns oder von mir er­ fahrene Negativität von Lebenswelt und Lebensgeschichte. Deshalb soll die Untersuchung beim »Negativen der beste­ henden Welt« ansetzen und aus ihm den Maßstab der Kritik erst gewinnen. Theunissen rechtfertigt dieses »negativisti­ sche« Verfahren damit, daß die lückenlose Pathologie des herrschenden Weltzustandes die Kriterien für eine unver­ dächtige Unterscheidung zwischen Gesundheit und Krank­ heit, Wahrheit und Unwahrheit, Idee und Erscheinung längst verdorben hat. Ist erst einmal die Krankheit der Ge­ sunden entlarvt, verfällt jede Diagnose, die im Lichte einer unbefragt vorausgesetzten Normalität vorgenommen wird, der Hermeneutik des Verdachts. b) Im Anschluß an Marx und an Kierkegaard bieten sich zwei Ausgangspunkte an für den Versuch, das in kommuni­ kativer Freiheit angelegte Potential von Versöhnung und Verbesserung negativistisch zu rechtfertigen: die soziale Entfremdung in kapitalistisch rationalisierten Gesellschaf­ ten und die existentielle Verzweiflung des in der säkulari­ sierten Moderne vereinzelten Individuums. Den ersten Weg hatTheunissen weitgehend seinen Schülern überlassen19; er selbst konzentriert sich auf die Ausarbeitung eines Argu­ mentes, das Kierkegaard für die Identität von Gottesglau­ ben und Selbstsein anführt. 20 Die Rekonstruktion dieses Gedankengangs kennzeichnet zunächst das Phänomen der Verzweiflung als ontische Negativität. Die Verzweiflung ra­ dikalisiert das in Langeweile, Sorge, Angst und Schwermut 124 erfahrene Negative eines mißlichen oder bedrückenden Zu­ standes zu einem defizienten Modus des Daseins selber. In der Verzweiflung manifestiert sich das Mißglücken des menschlichen Lebens im ganzen. Als dieses schlechthin Nichtseinsollende verrät die Verzweiflung auch etwas über ihr verfehltes Gegenteil: das gelingende »Selbstsein«. Des­ halb kann die Fülle der Verzweiflungsphänomene als Aus­ gangsmaterial dienen, an dem Kierkegaard seine Analyse unter dem Gesichtspunkt einer Erkrankung des Selbst auf­ nimmt, noch bevor er über einen normativen Begriff des Selbst verfügt. Nach dieser methodischen Klärung trägt Theunissen eine transzendentale Fragestellung an das Phänomen der Ver­ zweiflung heran: »Wie muß der Mensch beschaffen sein und auf welche Weise ist sein Selbst zu denken, wenn die Ver­ zweiflung möglich sein soll, die er als seine Wirklichkeit er­ fährt ?«21 Diese Frage impliziert sogleich die weitere Frage: wie das Selbstsein möglich ist, das im Prozeß der Befreiung aus dem stets gegenwärtigen Sog der Verzweiflung voraus­ gesetzt werden muß. Was macht das Selbstsein als Prozeß des »ständigen Vernichtens der Möglichkeit von Verzweif­ lung« möglich? Dem Selbst kann, so lautet Kierkegaards Antwort, sein Selbstsein nur dadurch gelingen, daß es sich im Sich-selbst-Setzen zu einem Anderen verhält, durch das es selber gesetzt worden ist. Der Mensch entgeht seiner Ver­ zweiflung nur, indem er sein Selbst »durchsichtig in der Macht, die es gesetzt hat«, gründet. Diese These wird mit Bezugnahme auf zwei Grundmodi der Verzweiflung exi­ stenzdialektisch begründet. Im verzweifelten Nicht-man­ selbst-sein-Wollen erfahren wir, daß wir uns nicht loswer­ den können, daß wir zur Freiheit verurteilt sind und uns selbst setzen müssen. Aber im nächsten Stadium des ver125 zweifelten Man-selbst-sein-Wollens erfahren wir die Ver­ geblichkeit der eigenwilligen Anstrengung, uns aus eigener Kraft als Selbst zu setzen. Dieser Verzweiflung trotziger Selbstbegründung können wir uns schließlich nur dadurch entwinden, daß wir uns der Endlichkeit unserer Freiheit inne werden und dabei unsere Abhängigkeit von einer un­ endlichen Macht erkennen: »Die Bedingungen des Nicht­ verzweifeltseins sind zugleich die des gelingenden Selbst­ seins. Daß der Mensch im Sich-Setzen das Andere sich voraussetzen muß, das ihn ins Sich-Setzen eingesetzt hat, definiert also sein Selbstsein.«22 c) Theunissen hält diesen existenzdialektischen Nachweis einer Fundierung des Selbstseins im Glauben für »ein schwer widerlegbares Argument«. Auch aus seiner Sicht be­ darf das Argument im Hinblick auf die kommunikative Ver­ fassung des Selbstseinkönnens freilich einer Ergänzung. Für die Explikation der grundlegenden Struktur des Bei-sich­ seins-im-Anderen besagt nämlich die Erklärung bisher nur so viel: der Mensch könne in seiner endlichen Freiheit er selbst sein, wenn er sich, indem er die absolute Freiheit Got­ tes anerkennt, von einem narzißtisch in sich geschlossenen Selbstsein befreit und aus der unendlichen Entfernung einer gläubigen Kommunikation mit dem schlechthin Anderen auf sein eigenes Selbstsein zurückkommt. Unvollständig bleibt die Erklärung im Hinblick auf jenen trivialen inner­ weltlichen Aspekt des Bei-sich-seins-im-Anderen, unter dem uns doch kommunikative Freiheit zunächst und zu­ meist begegnet. Theunissen kritisiert die eigentümliche Weltlosigkeit des Selbstseins, das Kierkegaard im Nega­ tionsverfahren gegen die Verzweiflung abgehoben hat: »Wohl begreift auch Kierkegaard, wie Hegel, das Selbstsein oder die Freiheit als Bei-sich-sein-im-Anderen, aber das 126 Andere ist in seinem Verständnis ausschließlich Gott, nicht mehr die Welt.«23 Die bloße Reflexivität eines Sich-Verhal­ tens zum Selbstverhältnis muß in die Intersubjektivität ei­ nes Sich-Einlassens-auf-den-Anderen erst noch eingeholt werden: »In der Liebe eröffnet sich demnach die Ur­ sprungsdimension jener Freiheit des Menschen von sich selbst, als die sich uns auch der Glaube dargestellt hat.«24 So kehrt Theunissen mit einem rekonstruierten Kierkegaard zu einem zuvor kommunikationstheoretisch gelesenen He­ gel zurück, um das komplementäre Verhältnis von kommu­ nikativer Freiheit und Liebe in der absoluten Freiheit und Liebe Gottes zu begründen. Denn »alle wirkliche Liebe zu anderen Menschen (ist) Liebe zu Gott«. IV Auch wenn man dieser kommunikationstheoretischen Er­ weiterung des existenzdialektischen Gedankenganges folgt, bleibt die Frage, ob das von Theunissen umsichtig rekon­ struierte Kierkegaardsche Argument, das die eigentliche Be­ weislast tragen muß, leistet, was es leisten soll - eben den Nachweis, daß der Mensch, um ganz er selbst sein zu kön­ nen, seiner eigenen kommunikativen Freiheit eine Ermächti­ gung durch die absolute Freiheit Gottes voraussetzen muß. Meine Bedenken richten sich sowohl gegen das negativisti­ sche Verfahren wie gegen eine Übertragung transzendentaler Fragestellungen auf anthro'pologische Tatsachen.25 Wir ziehen es gewiß vor, nicht verzweifelt zu sein. Aber aus der Ablehnung des negativ bewerteten Phänomens der Ver­ zweiflung ergibt sich noch keine positive Auszeichnung der bloßen Abwesenheit des Phänomens - also des Nichtver­ zweifeltseins. Dieser Zustand mag eine notwendige Bedin127 gung für eigentliches Selbstsein darstellen, aber nicht ohne weiteres eine hinreichende. Nur wenn wir von vornherein mit klinischen Begriffen wie seelischer Gesundheit einen starken internen Zusammenhang zwischen dem Phänomen der Verzweiflung und dem Modus des Selbst-sein-Wollens in Anschlag bringen, kann die überwundene Verzweiflung von sich aus gelingendes Selbstsein indizieren. Dann er­ schließt aber erst das normativ gehaltvolle hermeneutische Vorverständnis die Verzweiflung als Symptom einer Krank­ heit; und die derart ansetzende Interpretation kann nicht mehr als durchgängig negativistisch gekennzeichnet wer­ den. Des weiteren läßt sich die transzendentale Frage nach den Bedingungen des Selbstseinkönnens auf eine existentielle Stimmung wie das verzweifelte Man-selbst-sein-Wollen nur anwenden, wenn wir die Universalität und Nicht-Substi­ tuierbarkeit dieser »Grundbefindlichkeit« unterstellen dür­ fen. Die transzendentale Bedingungsanalyse ist allein im Hinblick auf Leistungen sinnvoll, die allgemeiner Natur sind, für die es also keine funktionalen Äquivalente gibt. Die Transzendentalisierung von Tatsachen oder existentiellen Selbsterfahrungen hat die mißliche Konsequenz, daß wir für etwas, das in der Welt vorkommt, einen für die Welt selbst konstitutiven Rang nachweisen müssen. Wenn die transzen­ dentale Begründung des Selbstseins als Nicht-Verzweifelt­ seins funktionieren soll, muß das verzweifelte Man-selbst­ sein-Wollen zur condition humaine gehören und so etwas wie eine allgemeine anthropologische Tatsache darstellen. Wir müssen zudem ausschließen können, daß sich andere Phänomene eines nicht-verzweifelten Man-selbst-sein­ Wollens als Kandidaten für eine analoge Begründung des Selbstseins namhaft machen lassen. 128 Damit nicht genug. Die eigentliche Schwierigkeit ergibt sich aus dem Umstand, daß das aufklärungsbedürftige Faktum, an dem die Frage nach Ermöglichungsbedingungen nur an­ setzen kann, ein irgendwie schon bewährtes Resultat sein muß. Die transzendentale Frage stellt sich im Hinblick auf validierte Erzeugnisse, die entsprechende Gültigkeitsbedin­ gungen erfüllen: wahre Aussagen, grammatische Sätze, gül­ tige Sprechakte, richtige Normen, einleuchtende Theorien, gelungene Werke der Literatur und Kunst usw. Aus der re­ konstruktiven Sicht Theunissens fragt auch Kierkegaard nach den Bedingungen der Möglichkeit wenn nicht eines ge­ lungenen Produktes, so doch eines Prozesses gelingenden Selbstseins: Wie ist Selbstsein als Prozeß der Bewältigung einer immer wieder aufsteigenden Verzweiflung möglich? Aber bei der Kantischen Frage, wie objektive Erfahrung möglich ist, geht es um das Durchsichtigmachen der Genese einer bereits als gültig akzeptierten Leistung, deren Ergeb­ nis wir als aufklärungsbedürftiges Faktum antreffen und in beliebig vielen Beispielen reproduzieren können. Kierke­ gaard geht aber von einem Faktum ganz anderer Art aus vom verzweifelten Man-selbst-sein-Wollen, wobei das Ge­ lingen dahingestellt bleibt. Für das, was Kierkegaard in sei­ ner Genese durchsichtig machen will, steht die Validierung noch aus. Denn das Normale ist die Krankheit, auf deren Kontrastfolie sich eine Art von »gesunder« menschlicher Existenz erst abzeichnet. Der Modus eines gelingenden Selbstseins kann für den Zweck der transzendentalen Auf­ klärung seiner Ermöglichungsbedingungen nur hypothe­ tisch in Anschlag gebracht werden. Unter dieser Prämisse könnte man den Glauben allenfalls funktional, als geeigne­ tes Mittel zur Erreichung des vom Man-selbst-sein-Wollen implizierten Zieles rechtfertigen. Eine funktionale Begrün129 dung reicht aber nicht hin für das, was Theunissen mit Kier­ kegaards Argument begründen möchte, nämlich die These: »Das Werden der Freiheit zu sich aus der Freiheit von sich geschieht im Grunde des Glaubens selbst als kommunika­ tive Genese des Selbstseins.«26 Der Glaube, der sich funk­ tional begründet, destruiert sich selbst. Theunissen überschätzt die Tragweite des von ihm rekon­ struierten Kierkegaardschen Argumentes. Auch die dialog­ philosophische Ergänzung der vertikalen Kommunikation mit Gott durch die horizontale Achse der interpersonalen Beziehung bringt nicht den erhofften Gewinn. Aus der Sicht einer formalpragmatischen Analyse sind gewiß die kommu­ nikativ Handelnden, die sich an transzendierenden Gel­ tungsansprüchen orientieren, mit jedem gelingenden Akt der Verständigung zu einer Transzendenz von innen heraus­ gefordert. Mit dieser spröden Wahrheit will sich aber Theu­ nissen nicht zufriedengeben. Er möchte in gelingenden Ak­ ten der Verständigung eine in die Geschichte einbrechende Transzendenz, die verheißungsvolle Gegenwart einer abso­ luten, unsere endliche Freiheit erst ermöglichenden Macht erkennen. So bietet er immer neue Argumente auf, um den Kierkegaardschen »Sprung« in einen rational nachvollzieh­ baren Übergang zu verwandeln.27 Denn Theunissen ist zu sehr Philosoph, als daß er den Satz Dostojewskis (in einem Brief an Natalja Vonwisin vom 20. Februar 1854) akzeptie­ ren könnte: »Würde mir jemand beweisen, daß sich Chri­ stus außerhalb der Wahrheit befände, und wäre es wirklich so, daß die Wahrheit außerhalb Christi läge, so würde ich lieber mit Christus bleiben als bei der Wahrheit.« Theunis­ sen glaubt, philosophische Gründe zu haben, die ihn berech­ tigen und darin bestärken, an einem enthellinisierten Begriff des Eschaton festzuhalten. Ich vermag diese Gründe nicht 130 zu erkennen, allenfalls rationale Motive für die Überzeu­ gung, solche Gründe zu haben. V Ein Motiv für diese Gewißheit entnehme ich der harschen Polemik, die T heunissen in den Spuren der Hegelschen Kri­ tik an Kant gegen den Formalismus der Sollensethiken aus­ trägt.28 Freiheit im moralischen Sinn der Selbstbestimmung manifestiert sich im freien Willen; und frei nennt Kant den Willen, der sich an moralische Einsichten bindet und das tut, was im gleichmäßigen Interesse aller liegt. Die Aufgabe der Moraltheorie besteht in einer Erklärung, wie richtige mora­ lische Urteile möglich sind. Grundsätzlich trauen wir uns die rationale Entscheidung praktischer Fragen immer schon zu. Da nun die Ideen von Gerechtigkeit und Solidarität mit der Form kommunikativer Vergesellschaftung überhaupt verwoben sind, versucht die Diskursethik diese Tatsache aus allgemeinen pragmatischen Voraussetzungen des kommu­ nikativen Handelns und der Argumentation zu erklären. Gegen dieses schwache Moralkonzept erneuert T heunissen Hegels Kritik an der Ohnmacht des abstrakten Sollens. In der Tat müssen sich moralische Einsichten, wenn sie prakti­ sche Wirksamkeit erlangen sollen, des Entgegenkommens konkreter Lebensformen vergewissern.29 Sie appellieren nämlich allein an die ermutigungsbedürftigen Kräfte autono­ mer Menschen, die wissen können, daß sie, obgleich abhän­ gig von der Gunst der Umstände, auf sich gestellt sind. Anders verhält es sich mit Freiheit im ethischen Sinne der Selbstverwirklichung. Sie manifestiert sich in einer bewuß­ ten Lebensführung, deren Gelingen nicht ausschließlich der Autonomie endlicher Wesen zugemutet werden kann. 131 Theunissen scheint davon auszugehen, daß die Ethik die Aufgabe hat, das gelingende Selbstsein in analoger Weise zu erklären wie die Moraltheorie die Tatsache, daß wir uns richtige moralische Urteile immer schon zutrauen. Dann muß sie aber eine Instanz benennen, die für jeden die gleiche Möglichkeit eines nicht-verfehlten Lebens garantiert, damit wir das Selbstseinkönnen in ähnlicher Weise als ein tran­ szendentales Faktum unterstellen dürfen wie die Fähigkeit, richtige moralische Urteile zu fällen. Nun steht ein nicht­ verfehltes Leben nicht in gleicher Weise wie das richtige mo­ ralische Urteilen und Handeln in unserer Macht. Wenn es aber in gleicher Weise der transzendentalen Frage nach den Bedingungen seiner Möglichkeit unterzogen wird, erklärt der Umstand seiner Unverfügbarkeit, warum das gelin­ gende Selbstsein durch eine andere Macht garantiert wer­ den müßte. Diese Problemlage macht verständlich, warum Theunissen auf den Bezug zur absoluten Freiheit schon aus argumentationsstrategischen Gründen nicht verzichten kann. Aber Kant hat gesehen, daß sich aus der Logik dieser Art von Fragestellung Gott bestenfalls als ein praktisches Postulat rechtfertigen läßt. Unser Bedürfnis, nicht verzwei­ felt zu sein und uns auch unter der Herrschaft der Zeit die Aussicht auf Glück zu erhalten, ist kein ausreichender Grund dafür, daß die Philosophie eine zuversichtliche Aus­ kunft erteilt. Diese Überlegung macht wenigstens den Streitpunkt klar: Können wir unter Bedingungen nachmetaphysischen Den­ kens die klassische Frage nach dem guten Leben - in ihrer modernen Lesart als Frage nach dem gelingenden Selbst­ sein - nicht nur formal, sondern beispielsweise so beantwor­ ten, daß wir einen philosophischen Schattenriß der evangeli­ schen Botschaft zeichnen? 132 Ein weiteres Motiv für Theunissens affirmative Antwort auf diese Frage vermute ich in der selektiven Beschreibung von Kommunikation. Die Dialogphilosophie tauscht nämlich die Subjekt-Objekt-Beziehung, also das in der Bewußt­ seinsphilosophie ausgezeichnete Verhältnis zwischen dritter und erster Person, lediglich aus gegen das Verhältnis zwi­ schen erster und zweiter Person, statt den vollen Sinn des Systems der Personalpronomina auszuschöpfen. Die episte­ mische Selbstbeziehung war zunächst nach dem Modell der Selbstbeobachtung gedacht worden; an die Stelle dieses Re­ flexionsmodells tritt nun eine kommunikativ vermittelte Selbstbeziehung, die nach dem Vorbild der dialogischen Ich-Du-Beziehung strukturiert ist. Sie wird als praktisches Selbstverhältnis konzipiert, und zwar je nach Akzentuie­ rung der zweiten oder der ersten Person als Liebe oder als kommunikativ vermittelte Freiheit, d. h. als Bei-sich-selbst­ sein-im-Anderen oder als Im-Anderen-bei-sich-selbst-sein. Damit wird freilich ein Spezialfall, nämlich die wechselsei­ tige ethische Selbstverständigung darüber, wer man ist und sein möchte, zum Prototyp von Verständigungsprozessen überhaupt erhoben. Die Dialogphilosophie zieht sogar die Aufmerksamkeit von der Struktur der Verständigung selbst ab und verlagert sie auf die existentielle Selbsterfahrung der Beteiligten, die sich in der Folge einer gelingenden Kom­ munikation einstellt. Sie vernachlässigt an der Struktur des Sich-miteinander-über-etwas-Verständigens vor lauter In­ tersubjektivität den Bezug zur objektiven Welt, zu dem, worüber kommuniziert wird. Damit schließt sich die Di­ mension der Wahrheitsgeltung zugunsten von Authentizi­ tät. Und selbst diese Dimension kann gegen den narzißti­ schen Sog eines weltlosen Selbstverständigungsdiskurses nur noch durch ein gleichsam hinterrücks eingeführtes All133 gemeines offengehalten werden, das die Kommunikation als solche erst ermöglichen soll. Aus diesem Grund hatte Theunissen bereits 1969 eine »ab­ solute Objektivität« eingeklagt, »die über lntersubjektivität hinausreicht und das Subjekt schlechthin begründet«.30 In einer späteren Studie, die dem »dunklen« Verhältnis von Allgemeinheit und lntersubjektivität gewidmet ist, wieder­ holt er die These, »daß wir in unserer Selbstverwirklichung Allgemeinheit zu realisieren haben«.31 Den fundamentali­ stischen Bezug zu einer Objektivität und Wahrheit verbür­ genden Instanz glaubt Theunissen nicht aufgeben zu dürfen, weil sonst »die lntersubjektivität ... nur erweiterte Subjek­ tivität ist«.32 Die Notwendigkeit eines solchen Korrek­ tivs entfällt aber, sobald wir die Struktur des Sich-miteinan­ der-über-etwas-Verständigens aus der dialogphilosophi­ schen Engführung auf »den Anderen« befreien. Wenn wir die Dritte-Person-Einstellung zu etwas in der objektiven Welt mit den performativen Einstellungen der teilnehmen­ den ersten und zweiten Person zueinander integrieren, zer­ fällt auch die Komplementarität, die Theunissen für das Ver­ hältnis von kommunikativer Freiheit und Liebe behauptet. Die kommunikative Freiheit nimmt dann nämlich die pro­ fane, aber unverächtliche Gestalt der Zurechnungsfähigkeit kommunikativ handelnder Subjekte an. Sie besteht darin, daß die Beteiligten ihr Handeln an Geltungsansprüchen ori­ entieren können, indem sie Geltungsansprüche erheben, zu anderen Geltungsansprüchen mit»Ja« oder»Nein« Stellung nehmen und illokutionäre Verpflichtungen eingehen. Im Wechselspiel der kommunikativen Freiheit endlicher Subjekte eröffnet sich der Horizont, in dem wir auch die Herrschaft der Vergangenheit über die Zukunft als Wund­ mal sowohl der gesellschaftlichen wie der lebensgeschicht1 34 liehen Realität erfahren. Ob wir uns ihr zynisch anpassen oder melancholisch unterwerfen, ob wir an ihr und uns ver­ zweifeln, darüber geben jene Phänomene Aufschluß, an de­ nen Theunissen zu Recht ein brennendes Interesse nimmt. Der Philosoph wird aber von diesen Phänomenen wenn auch keineswegs eine entmutigende, so doch eine andere Beschreibung geben müssen als der Theologe. Reflexionen aus dem beschädigten Leben sind Sache des einen so gut wie des anderen; aber sie unterscheiden sich nach Status und Anspruch, wenn die theologisch-philosophischen Diskurse erst einmal entmischt sind.33 Die philosophischen erkennt man daran, ob sie diesseits der Rhetorik von Verhängnis und Verheißung verharren. Wenn freilich, was Theunissen für gegeben hält, die Anoma­ lien selber zur Norm geworden sind, beginnen die Phäno­ mene zu verschwimmen. Um die relevanten Phänomene überhaupt noch zu Gesicht zu bekommen, mag es dann an­ gebracht sein, Philosophie in der Art, aber doch nur in der Art einer negativen Theologie zu betreiben. 13 5