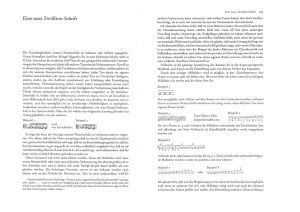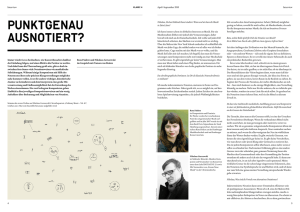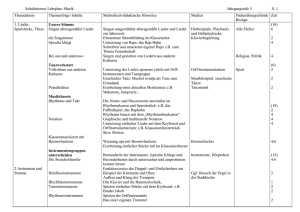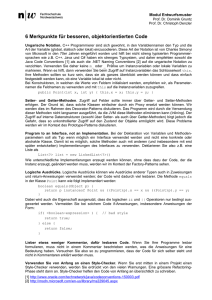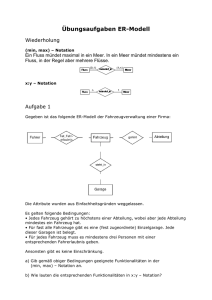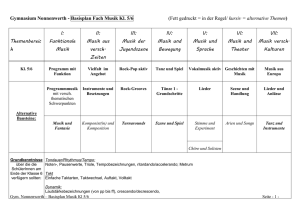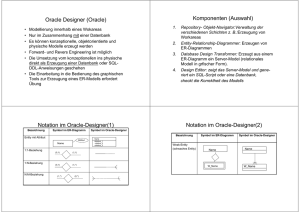Notieren von Musik im Unterricht - didaktische und
Werbung
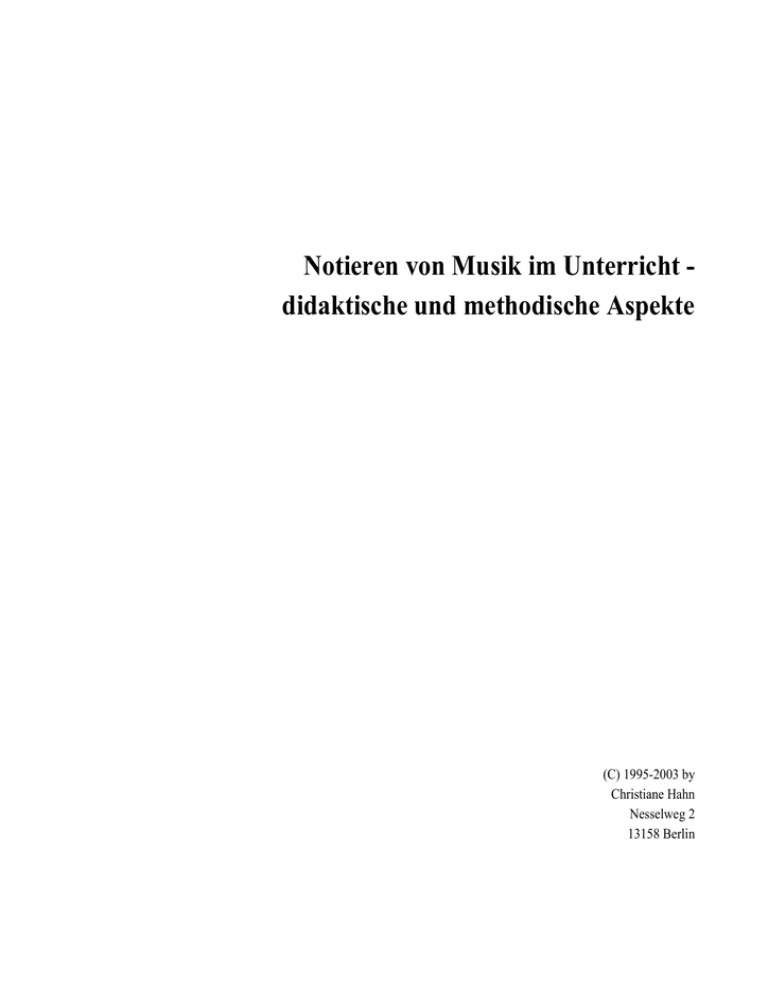
Notieren von Musik im Unterricht didaktische und methodische Aspekte (C) 1995-2003 by Christiane Hahn Nesselweg 2 13158 Berlin Inhalt 1. Einleitung 4 2. Das Notieren von Musik in der musikpädagogischen Diskussion seit den sechziger Jahren 6 2.1. Die Notation im Musikunterricht der frühen sechziger Jahre 6 Beispiel Nordrhein-Westfalen 2.2. Ansätze zu einer Neubestimmung des Stellenwerts der traditionellen Notenschrift 8 Günther 1965 - Venus 1969 2.3. Kritik und Verteidigung der traditionellen Notenschrift 11 Vogelsänger 1969 - Giebeler 1969 2.4. Produktions- und Rezeptionsnotation? 15 Frisius 1973 - Koch 1973 2.5. Graphische Notationsformen im Musikunterricht 19 Finkel / Wünnenberg 1975 - Kühlenthal 1976 2.6. Zum Verhältnis von graphischer und traditioneller Notation im Musikunterricht 22 Koch 1975 - Wiechell 1976 - Fischer 1976 - Große-Jäger 1977 2.7. Neuere Stellungnahmen zur Notation in der allgemeinbildenden Schule 28 Rectanus 1994 /1990 - Günther 1991 - Kaiser 1995 3. Allgemeine Überlegungen zur Notation 33 3.1. Notationsformen als Zeichensysteme 33 3.2. Notation, Klang und Bedeutung 35 3.3. Prä- und deskriptive Notation 37 3.4. Notation und musikbezogenes Handeln 38 3.5. Werk, Notentext und Aufführung 39 4. Didaktische Aspekte zum Notieren von Musik im Unterricht aus heutiger Sicht 41 4.1. Die Bedeutung verschiedener Notationsformen für Musik und Musikleben der Gegenwart 43 4.2. Die (zukünftige) Bedeutung verschiedener Notationsformen für die Schüler 44 4.3. Verschiedene Notationsformen als Mittel zu einem abgestuften Musikverständnis 46 Tonhöhendarstellung / Harmonik 46 - Zeitliche Struktur /Rhythmik 48 - Klangfarbe / Artikulation / Dynamik 50 Struktur / Form 51 5. Methodische Aspekte zum Notieren von Musik im Unterricht 56 5.1. Notationsbezogene Arbeitsformen im Musikunterricht 57 A. Erlernen (57) Information - Übung - Wiederholung B. Lesen (59) Notate untersuchen - Hörvorstellungen entwickeln - Hören mit Noten - Notate zuordnen - Notiertes ausführen C. Schreiben (60): Schreibübungen - Gehörtes notieren - Komponieren - Übersetzen D. Reflektieren (62) 5.2. Notationsbezogene Medien im Musikunterricht 63 Lehrbuch / Arbeitsbogen - Tafel / Overhead-Projektor - Legetafeln / Lernkarten - Keyboard / Klaviertastatur Gedrucktes Material: Studienpartituren und Klavierauszüge - Computer 5.3. Zur Methodik des Erlernens der traditionellen Notation 68 Methodenkonzeptionen - Anthropogene Voraussetzungen - Merksätze 6. Literaturverzeichnis 76 1. Einleitung Die vorliegende Arbeit ist dem "Notieren von Musik im Unterricht" gewidmet. Eine solche Formulierung läßt verschiedene Lesarten zu: zum einen kann es darum gehen, daß Musik während des Unterrichts (oder, weiter gefaßt, im Zusammenhang mit dem Unterricht) von Schülern oder vom Lehrer (oder, stellvertretend, von anderen Produzenten von Unterrichtsmaterial) notiert wird; zum anderen kann das Notieren von Musik Gegenstand des Unterrichts sein, indem verschiedene Notationsformen erlernt, angewendet und diskutiert werden, um so eine Grundlage für eine weitergehende Auseinandersetzung mit Musik zu schaffen. Die zweite Lesart ist umfassender als die erste: daß Musik im Unterricht notiert wird, ist nur ein Teilaspekt einer unterrichtlichen Beschäftigung mit dem Notieren von Musik. - In jedem Fall aber steht die Tätigkeit im Vordergrund: es geht um den Vorgang des Aufschreibens von Musik, die als bereits existent in der Vorstellung oder real - gedacht wird. Ein solcher Blickwinkel, der modern scheint, weil der Klang als das Primäre gesehen wird und der Aspekt äußerer Aktivität betont wird, verführt jedoch zur Einseitigkeit. Etwas aufzuschreiben hat nur dann Sinn, wenn es jemanden gibt, der das Geschriebene zu lesen versteht, und es erscheint fragwürdig, ob man überhaupt schreiben lernen kann, ohne - vorher oder zugleich auch lesen zu lernen.1 - Umgekehrt geht es: man kann zumindest brauchbar lesen lernen, ohne schreiben zu können (wenngleich sich mit dem Lesenkönnen wohl meist auch das Schreibenwollen entwickelt). Dies aber - das bloße Lesen vorgegebener Notationen - wäre eine einseitige Beschäftigung mit dem Schriftbild der Musik, die durch die Formulierung "Notieren von Musik" ausgeschlossen wird. Im folgenden wird allerdings um der sprachlichen Flüssigkeit willen ebensogut von "Notation" oder "Notationsformen im Unterricht" gesprochen. Der Stellenwert der Notation im Musikunterricht der allgemeinbildenden Schule ist Gegenstand einer kontroversen Auseinandersetzung, die seit Ende der sechziger Jahre in der musikpädagogischen Literatur geführt wird und keinesfalls beendet scheint. Wenn Peter Koch 1975 die Situation so beschreibt: Die Standpunkte innerhalb der Musikerziehung sind heute weit auseinandergezogen: Extremisten wollen auf eine Notation im normalen Klassenunterricht überhaupt verzichten; Progressive suchen eine dem kindlichen oder jugendlichen Hörer (nicht dem Komponisten oder Interpreten!) entsprechende Fixierung in Wort, Zeichen oder Graphik zu erreichen; andere wiederum gehen die alte Notenschrift großzügiger an, indem sie den Tonhöhenverlauf, das rhythmische Geschehen, die Klangfarbe usw. gewissermaßen aus der Vogelperspektive betrachten, wohingegen Traditionalisten z.B. Tonikado mit all seiner tonalen Gebundenheit weiterhin bevorzugen, sei es, weil sie es so gelernt haben, sei es aus Mißtrauen gegenüber noch Unklarem, Unbewährtem, sei es aus Überzeugung. (8) so kann man wohl sagen, daß sich in den vergangenen fünfundzwanzig Jahren daran kaum etwas geändert hat, außer daß der Anteil der "Traditionalisten" gegenüber dem der "Progressiven" stark zurückgegangen sein dürfte. Befragt man nämlich z.B. Musiklehrer an Gymnasien nach ihren Erfahrungen, so wird übereinstimmend berichtet, daß die Notationskenntnisse von Schülern, die von verschiedenen Grundschulen kommen, völlig unterschiedlich sind. Um eine gemeinsame Basis für den weiteren Unterricht zu schaffen, sei man daher oft gezwungen, in der 7. Klasse noch einmal von vorn anzufangen. Dies langweilt die Schüler mit Vorkenntnissen und überfordert oft diejenigen, die zum ersten Mal mit Notation in Berührung kommen. - Hieraus wird deutlich, daß die Frage, in welchem Umfang das Notieren von Musik überhaupt 1 Beim Lesen notierter Musik kommt noch etwas hinzu: im Gegensatz zur Sprachschrift genügt es nicht, den Inhalt bloß sachlich zu verstehen, sondern das Aufgeschriebene soll in künstlerisch überzeugender Weise zum Klingen gebracht werden. Diese zu erwartende Eigenleistung muß aber muß bereits beim Schreiben berücksichtigt werden und ist insofern bereits ein Moment des Schreibens. Gegenstand des Musikunterrichts an der Grundschule sein soll, bisher offenbar nicht verbindlich geklärt ist, auch wenn sich hier mittlerweile eine Tendenz abzeichnet, die traditionelle Notation ausgehend von einer graphischen "Vornotation" einzuführen. Es besteht aber keineswegs Einigkeit darüber, welcher Beherrschungsgrad hier anzustreben ist und welches Gewicht den verschiedenen Notationsformen zukommt. Dabei ist die Frage, ob die Schüler im Schulunterricht die Notenschrift erlernen sollen oder ob diese Aufgabe den Musikschulen oder dem privaten Instrumentalunterricht vorbehalten bleiben soll, keineswegs nur von peripherer Bedeutung. Ein wichtiger Gesichtspunkt ist hierbei die Glaubwürdigkeit des Schulfaches Musik. Solange Leistungskurse in Musik angeboten werden, in denen ein flüssiger Umgang mit der Notenschrift vorausgesetzt wird, muß dieser Umgang in der Schule erlernbar sein. Sicherlich kann es keinem Schüler verwehrt werden, durch tägliches Üben eines Instruments den im Schulunterricht abgesteckten Horizont zu erweitern: dies wäre auch in anderen Fächern der Fall, wo Schüler das Fach zum privaten Hobby machen. Es ist auch nicht vermeidbar, daß die privaten Erfahrungen den Unterricht bereichern und womöglich sein Niveau anheben. Es muß aber von den Schülern mit Recht als schikanös empfunden werden, wenn während des Pflichtunterrichts bis zur 10. Klasse so getan wird, als sei der Umgang mit graphischen Partituren oder elementaren Notenbildern hinreichend, dann aber im Basis- oder Profilkurs der 11.Klasse plötzlich eine Beethoven-Sinfonie anhand des Partiturbildes analysiert werden soll. Diese Überlegungen führen auf die folgende Alternative: entweder der Musikunterricht verzichtet im Ganzen auf die Notenschrift, dann aber auch im Abitur; oder die Notenschrift wird ernsthaft in der Schule gelehrt, und zwar möglichst früh beginnend, bis hin zu einer Stufe, die den Anforderungen im Abitur entspricht. Um die Grundlage für eine fundierte Stellungnahme zu schaffen, werden im dritten Kapitel einige wichtige Aspekte des Phänomens Notation zunächst unabhängig von pädagogischen Fragestellungen beleuchtet. Das vierte Kapitel wendet sich der Frage zu, in welchem Maße und mit welchen Schwerpunkten die Vermittlung von Notationskenntnissen im Schulunterricht überhaupt notwendig, sinnvoll und realistisch erscheint. Das fünfte Kapitel schließlich soll Hilfen bei der konkreten Unterrichtsplanung bieten: hier wird zum einen ein Repertoire von notationsbezogenen Arbeitsformen und Medien bereitgestellt und kommentiert; zum anderen wird ausführlich auf die Methodik der Einführung der traditionellen Notenschrift eingegangen. Zuvor soll jedoch folgenden Kapitel die Diskussion um die Notation im Musikunterricht vom Ende der sechziger Jahre an nachvollzogen werden, um die Argumente aus heutiger Sicht auf ihre Stichhaltigkeit zu überprüfen. Die Betrachtung dieser Debatte zeigt, daß eine sachliche Auseinandersetzung oft dadurch erschwert wurde, daß die traditionelle Notenschrift, um die besonders erbittert gestritten wurde, anscheinend seit jeher stark emotional besetzt war - sowohl positiv als auch negativ. Zu vermuten ist, daß es auch heute noch überall versteckte Ressentiments gibt. Es wäre schön, wenn diese Arbeit dazu beitragen könnte, die Argumente von solchem emotionalen und oft auch ideologischen Ballast zu befreien und dadurch zu einer so differenzierten Sicht zu gelangen, wie sie der Sache angemessen wäre. 2. Das Notieren von Musik in der musikpädagogischen Diskussion seit den sechziger Jahren Ende der sechziger Jahre begann in der musikpädagogischen Literatur eine kontroverse Debatte über die Behandlung der Notation im Musikunterricht in der allgemeinbildenden Schule. Sie stand im Zusammenhang mit der Diskussion um eine Neuorientierung des Schulfaches Musik, für deren Notwendigkeit eine ganze Reihe von Gründen sprach: - Die Präsenz der Massenmedien - damals noch als "technische Mittler" bezeichnet - hatte zu einer signifikanten Änderung des musikbezogenen Verhaltens aller gesellschaftlichen Gruppen, besonders aber der Jugendlichen, geführt. - Der Deutsche Bildungsrat hatte in seinem Strukturplan für das Bildungswesen grundsätzliche Forderungen für die Bildungsinhalte aller Fächer aufgestellt (u.a. die nach Wissenschaftlichkeit aller Lerninhalte und nach dem Lernen des Lernens), die auch im Fach Musik große Änderungen notwendig machte. - Die Neugliederung des Schulwesens in Elementar-, Primar- und Sekundarbereich und das damit in Zusammenhang stehende Gesamtschulmodell (seit 1968) bedeutete eine Akzentverschiebung gegenüber der traditionellen Dreigliedrigkeit (Haupt- und Realschule sowie Gymnasium). - Lerntheorie und Erziehungswissenschaften lieferten neue Konzepte, wie z.B. Handlungsorientierung, mit denen man sich auch für den Bereich Musik auseinandersetzen mußte. - Die mehr als ein Jahrzehnt zurückliegende Kritik Th.W.Adornos an der Musikpädagogik trug Früchte, u.a. in der Forderung nach stärkerer Berücksichtigung auch der neuesten avantgardistischen Musikproduktion im Musikunterricht in der Schule. Viele dieser Gründe erhalten aus heutiger Sicht ein anderes Gewicht; die aus ihnen resultierenden Konsequenzen müssen dementsprechend überprüft werden. So müssen immense Veränderungen im Bereich der Massenmedien, aber auch in der Musikelektronik sowie in der Computertechnologie berücksichtigt werden. Auch wurden bestimmte schulorganisatorische oder allgemeindidaktische Vorgaben, von denen damals ausgegangen wurde, nicht realisiert, wie z.B. die Revision des Curriculums2. - Andererseits sind die Argumente der siebziger Jahre heute keineswegs überwunden. Als Indiz dafür mag gelten, daß sich noch neueste Veröffentlichungen auf Zitate stützen, denen schon vor zwanzig Jahren kritisch begegnet wurde3. Wenn daher im folgenden der Versuch unternommen wird, jene Argumente auf "ideologieverdächtige Partialtöne" (Wiechell 1976, 15/2 ) zu untersuchen, dann bereichert dies auch die aktuelle musikpädagogische Diskussion. 2.1. Die Notation im Musikunterricht der frühen sechziger Jahre Um die Ausgangssituation zu skizzieren, auf deren Hintergrund die Diskussion um den didaktischen Stellenwert der Notenschrift im Musikunterricht der allgemeinbildenden Schule begann, soll im folgenden auf den Lehr- und Arbeitsplan für den Musikunterricht in den Volksschulen eingegangen werden, der die Richtlinien für die Musikerziehung in der Volksschule des Landes Nordrhein-Westfalen (Erlaß des Kultus- 2 So berücksichtigen die derzeit gültigen Berliner Rahmenpläne für das Fach Musik nicht einmal die 1988 beschlossenen Stundentafelkürzungen! 3 Kaiser zitiert 1995 Frisius und Moles so unkritisch, daß ihm Fischers Aufsatz von 1976 entgangen sein muß. ministers vom 19. Juli 1951) konkretisiert4. Zwar darf ein solcher Lehrplan nicht mit der durchschnittlichen Unterrichtswirklichkeit verwechselt werden - abgesehen davon, daß seine Gültigkeit auf ein Bundesland beschränkt ist - , aber er erlaubt doch Rückschlüsse darauf, welche Rolle das Notieren von Musik im Musikunterricht der fünfziger und sechziger Jahre gespielt haben dürfte. Während Sätze wie dieser - Zitat aus den erwähnten Richtlinien - fast modern klingen: 1. Ausgangspunkt für jede musikalische Erziehung und Bildung ist die Tätigkeit des Kindes in Spiel, Bewegung und körperlicher Darstellung, wobei der Improvisation besondere Bedeutung zukommt. (9), wird der entscheidende Unterschied zur heutigen Auffassung schnell deutlich: 2. Im Mittelpunkt alles [sic] Singens und Musizierens in der Schule steht das alte und das neue Lied. Vom Kinderlied, Spiellied und landschaftlich gebundenen Lied geht der Weg zum deutschen Volkslied und, in gegebener Begrenzung auch zum einfacheren Kunstlied und zum Lied anderer Völker. (...) Unserer Jugend einen reichen, mit Lust ersungenen Liederschatz zu vermitteln, ist Hauptaufgabe der Musikerziehung. (9) 7. Alle Kenntnisse musiktheoretischer Art, vor allem auch das Verständnis der gebräuchlichen Notenschrift, sind in enger Verbindung mit dem Liedgut zu behandeln und dürfen nicht Selbstzweck werden. (...) Auf streng systematischen Aufbau kann in diesem Arbeitsbereich verzichtet werden. (10) Der Unterrichtsweg ist in siebzig Abschnitte aufgeteilt, die gleichmäßig auf die zweite bis achte Klasse verteilt werden sollen, so daß auf jede Klassenstufe zehn Unterrichtseinheiten entfallen. Ausgangspunkt ist die Eintonweise, gefolgt von der Zweiton- ("Rufterz" mit "Kuckucks-Schlüssel" nach Fritz Jöde), Dreiton("Leiermelodik"), Vierton- und Fünftonweise (Pentatonik), mit der das zweite Schuljahr beschlossen wird. In der Rhythmik sollen am Ende der zweiten Klasse Einschlag-, Zweischlag- und "Laufnoten" (Achtel), Einschlag(Viertel)-Pause sowie Zwei-, Drei- und Vierertakt [sic], Taktstrich und Bindebogen bekannt sein. Gegen Ende der dritten Klasse wird dann, nachdem bereits kleine Hördiktate geschrieben (UE 16) und Rhythmen und Melodien ergänzt wurden (UE 18), das "Fa" eingeführt und damit der Weg zum Hexachord geöffnet, mit dem das Schuljahr beschlossen wird. Während dieses Schuljahr rhythmisch wenig Neues brachte, folgen im vierten Schuljahr der Auftakt, ja sogar der Achtelauftakt (in Kirchenliedern), die punktierte Note, der Dreiachteltakt und die halbe Pause. Vom Ende der vierten Klasse an (UE 30) werden die Buchstaben-Notennamen benutzt - allerdings nicht konsequent. Die Stammhalbtonschritte werden erst in der zweiten Hälfte der sechsten (UE 48) und die Vorzeichen (UE 51-53) erst in der siebten Klasse behandelt. Bei der Behandlung der Notenlehre im Lehr- und Arbeitsplan fällt vor allem eine ungleichgewichtige Verteilung der Unterrichtsinhalte auf: während man sich in den ersten fünf Schuljahren ausführlich mit modulationsloser diatonischer Melodik beschäftigt und somit den Unterschied zwischen Halb- und Ganztonschritt nur unreflektiert ausgeführt, aber nicht zum Gegenstand des Begreifens gemacht hat, werden im letzten - achten - Schuljahr die Themen Dur-Moll-Dreiklang (UE 60-61), Kadenzen (UE 62), Kirchentonarten (UE 63-65), Melodisches und Harmonisches Moll (UE 66), Modulation (UE 67) und Transposition (UE 68) zusammengedrängt. Man ahnt, daß diese Unterrichtsinhalte bei einer zeitlichen Vorgabe von etwa vier Wochen pro Unterrichtseinheit (in denen noch etliche andere Themen zu behandeln sind) lediglich angerissen werden können und ein tieferes Verständnis somit von vornherein ausgeschlossen ist. Unter den Themen, die "in die Oberstufenarbeit nach Belieben eingebaut werden" (61) sollen, findet sich 4 Scheitler, Wenzel und Wilhelm Börger. Lehr- und Arbeitsplan für den Musikunterricht in den Volksschulen.Ratingen: Henn, 1960. "Das große Tongebäude: Von Kreuzen und Been. - Der Quintenzirkel." (61) - wahrscheinlich als Krönung der musiktheoretischen Grundlagenarbeit gedacht. Wenn ein anderes dieser Themen lautet: "Von guter und schlechter Musik. - Jazz, Schlager, Unterhaltungsmusik." (ebd.), so darf wohl angemerkt werden, daß ein Musikunterricht, der diesem Arbeitsplan folgt, nicht einmal dem Anspruch nach das Rüstzeug liefert, Schlager, Unterhaltungsmusik oder gar Jazz auch nur zu erklären, geschweige denn zu beurteilen. 2.2. Ansätze zu einer Neubestimmung des Stellenwerts der traditionellen Notenschrift Es ist daher nicht verwunderlich, wenn sich Mitte der sechziger Jahre Kritik an der oben dargestellten Behandlung der Notenschrift im Musikunterricht regt. Ulrich Günther geht es in seinem 1965 auf der Bundesschulmusikwoche in Bonn gehaltenen Vortrag Die Notation als Beispiel zu einer Didaktik der Musik nicht um das Erlernen der Notenschrift, sondern um vielfältigen Umgang mit dem komplexen musikalischen Phänomen Notation, der zu einer komplexen Erziehung in der Musik führen soll (660). Er führt eine phänomenologische Analyse der Notation durch, die zunächst ergibt, daß es außer der von uns verwendeten noch viele andere Notationsformen gibt: Die Fülle anderer Möglichkeiten der Notation reicht etwa von der chinesischen Wärternotation über die Neumen und die Mensuralnotation bis zur freien musikalischen Graphik oder dem Programm für Computermusik. (660) Die Aufgabe der Notation sieht Günther in ihrem bewahrenden Charakter: (...) sie ermöglicht Vergegenwärtigung und ständige Wiederholung und löst damit Musik aus ihrer Einmaligkeit. Musik als notierte Musik wird allen zugänglich, die Notation zu lesen verstehen. (660) Sie leistet dies, indem sie die in der Zeit ablaufenden Ereignisse in ein räumliches Nebeneinander überträgt. Neben symbolischen Zeichen mit exakter Bedeutung enthält die Notation nach Günther auch ikonische Zeichen, die nur ein ungefähres Abbild musikalischer Ereignisse geben und daher der Deutung bedürfen: Das Moment der Deutung aber ist es, das Notation autonom macht, das sie von den Intentionen ihres Urhebers löst und somit darauf hinweist, daß sie mehr ist als ein Mittel zum Zweck oder gar Schein von Musik. Sie ist vielmehr Musik in der spezifischen Weise der geschriebenen Musik; sie ist musikalische Wirklichkeit in ihrem 'schriftlich geronnenen Aggregatzustand' (Adorno) - jedoch nur für den, der Musik auch in 'flüssigem' Zustand kennt. (660) Als mögliche Arten des Umgangs nennt Günther neben dem Notieren des Komponisten, der daran arbeitet, und dem Realisieren des Interpreten, das das Deuten und Üben voraussetzt, auch das Lesen des Hörers (Kritikers, Theoretikers), das das Analysieren, das innere Hören sowie das Mitlesen umfaßt. Günther bezeichnet Notation als "genuin pädagogisch präformiertes Phänomen" (661) und sagt zu ihrer erziehenden Wirkung, daß alle, die sich mit ihr befassen, durch die ungemein komplizierte, wechselseitige Abstraktionsleistung, Zeit in Raum zu verwandeln, Klang ins Bild zu bringen und umgekehrt, zu einer Bewußtheit in der Musik, zu einem Bewußtsein musikalischer Vorgänge erzogen werden, die alles diffus Schwärmerische und damit alles bewußter Erziehungsarbeit Unzugängliche ausklammert. (660f.) Dies gilt nicht nur für den Komponisten, von dem die Notation die geistige Durchdringung dessen, was er aufschreiben will, fordert, oder den Interpreten, dem sie verbindliche Aufgaben stellt, deren Lösung seine Disziplin schult, sondern auch für den Hörer, dem sie Begriffswerkzeuge an die Hand gibt, die das Hören bereichern. Die Objekthaftigkeit, Greifbarkeit der Notation ermöglicht es, daß Erziehungsformen wie Unterricht und Lehre in einem Bereich zur Wirkung kommen, der sonst nicht greifbar, immateriell ist. Anhand von zwei Beispielen aus der Praxis konkretisiert Günther, worum es ihm geht: indem die Schüler für bestimmte Aufgaben eigene Notationssysteme erfinden, gewinnen sie nicht nur Einsichten in Probleme der Notation, sondern darüberhinaus ein tiefergehendes Verständnis für vielfältige musikalische Sachverhalte. Auf diese Weise ist Notation nicht länger ein isolierter Unterrichtsgegenstand, der nur mit einer einzigen (noch dazu fragwürdigen) musikalischen Verhaltensweise in Verbindung gebracht wird - dem Blattsingen - , sondern Notation ist das Zentrum, von dem aus der Vorstoß zu verschiedenen Fragestellungen erfolgen kann. Auch Dankmar Venus nimmt 1969 in seiner Unterweisung im Musikhören eine grundsätzliche Neubestimmung des didaktischen Stellenwerts der Notenschrift vor. Venus stellt zunächst fest, daß aufgrund der veränderten Situation des Musiklebens, die gekennzeichnet ist durch die "Perfektionierung und Verbreitung von Rundfunk, Schallplatte und Magnettonband" (12), die über 150 Jahre gültige didaktische Zentralstellung des Singens (der "Primat des Singens") nicht länger haltbar ist: Zum Zwecke einer umfassenden musikalischen Unterweisung erscheint es daher notwendig, die fünf vorrangigen Verhaltensweisen gegenüber der Musik nicht in Abhängigkeit von einer einzigen Tätigkeit zu sehen, sondern sie als gleichgewichtige, eigenständige Unterrichtsinhalte in der schulmusikalischen Arbeit zu berücksichtigen. Diese fünf Verhaltenweisen sind die Produktion, die Reproduktion, die Rezeption und die Transposition von Musik, sowie die Reflexion über musikalische Sachverhalte. (21) Venus betont, daß es sich hierbei um "grundständige Unterichtsinhalte" handele, "die alle vom ersten Schuljahr an beachtet werden müssen"(22), wobei "Hören als das Grundverhalten zur Musik angesehen wird" und "als die Voraussetzung erscheint, die für jede musikalische Betätigung, für Komposition, Gesang oder Instrumentalspiel unabdingbar ist. (...) In diesem Sinne ist jeder Musikunterricht Hörerziehung." (24) Venus diskutiert nun verschiedene hypothetische Hör- bzw. Hörertypologien von Wellek über Adorno bis Rauhe und formuliert schließlich in Anlehnung an Helmuth Plessner: Mitgenommenwerden durch die Töne und doch zugleich nie die Herrschaft über dieses Mitgenommensein zu verlieren, erscheint demnach als eine sicher nicht einfach, aber dafür um so lohnendere Höreinstellung, der die unterrichtlichen Bemühungen gelten sollten. (47) Dieses Ziel scheint erreichbar nur mit Hilfe von Notation: Ein solches Hören, das Ergriffensein und Begreifen in sich vereint, wird man lehrgangsmäßig im Klassenunterricht nur üben können, wenn die Notenschrift, oder vorsichter gesagt, wenn Notation dabei zu Hilfe genommen wird. (47) Venus mißt hierbei der traditionellen Notenschrift das größte Gewicht bei und begründet dies - bezugnehmend auf Erna Woll - mit ihrer Bedeutung für die abendländische Musikkultur: Angesichts der Korrelation, die zwischen der abendländischen Musik und der Notation besteht, macht jeder ernsthafte Versuch, in die Musik dieses Kulturbereiches einzuführen, die Vermittlung von Notenschrift unumgänglich. (48) Damit bleibt jedoch die Frage noch offen, mit welchen Schwerpunkten diese Behandlung erfolgen soll: Da die Notenschrift heute (...) vielfältige Funktionen haben kann, je nachdem man sich ihrer als Komponist, Interpret oder Hörer bedient, wirft die Frage nach der Art ihrer Einführung nicht nur methodische, sondern auch didaktische Probleme auf. Erst wenn von der historischen Situation her entschieden worden ist, wozu die Notenschrift eigentlich vorrangig benötigt wird, läßt sich über den Weg der Vermittlung befinden. (48) Da erst aufgrund einer solchen Entscheidung eine konkrete Zuteilung von Unterrichtszeit möglich ist, ... ist die Beantwortung der didaktischen Frage zugleich eine unterrichtsökonomische Notwendigkeit. (49) Venus kritisiert unter diesem Blickwinkel den Notenlehrgang nach den bisherigen Richtlinien, der an der vokalen Reproduktion orientiert ist und als Fernziel das Vomblattsingen hat: Gemessen am Zeitaufwand ist das Ergebnis in der Regel minimal, denn was erreicht wird, ist allenfalls, daß die Schüler solche Melodien vom Blatt zu singen lernen, deren Aneignung auch in kürzester Zeit durch ein Vor- und Nachsingen hätte erfolgen können. (50) Hinzu kommt, daß das Vomblattsingen als Unterrichtsinhalt der allgemeinbildenden Schule problematisch ist, weil es die Fähigkeit zum inneren Voraushören der Melodie voraussetzt, die möglicherweise nicht jeder Schüler ausbilden kann: Die Fähigkeit, eine dem Notenbild adäquate exakte innere Klangvorstellung zu entwickeln, ist möglicherweise, wie Wellek annimmt, typologischen Dispositionen unterworfen (...) Die Tatsache, daß es zu allen Zeiten Komponisten gegeben hat, die, obwohl sie sozusagen stets in Übung waren, immer nur mit Hilfe des Instruments komponieren konnten, also des äußeren Klangreizes bedurften, wie es beispielsweise von Wagner überliefert wird und wie es Strawinsky von sich selbst berichtet, erscheint in diesem Zusammenhang beachtenswert. (51) Dagegen erscheint das Spielen nach Noten schon eher erreichbar: Für die Einführung der Notenschrift aber dürfte die Verwendung der relativ leicht spielbaren Stabspiele und auch der oft geschmähten Blockflöte weit mehr Erfolg versprechen als jede primär auf dem Gesang basierende Methode. (52) Die bisher gültige "Alternative einer vokalen oder instrumentalen Einführung" (52) der Notenschrift muß jedoch in der beschriebenen historischen Situation nun um die "Überlegung, welche Bedeutung die Notenschrift für das Musikhören haben kann", bereichert werden. - Venus unterscheidet dabei das Hören mit Noten, vom Hören nach Noten: Während das komplizierte Nach-Noten-Hören auf exakte Klangvorstellungen zielt, die die äußere klangliche Realisierung eines Musikstückes nahezu überflüssig machen, genügen für das Mit-Noten-Hören, das mit der Darbietung eines Werkes rechnet, Annäherungsvorstellungen, einzelne Vermutungen, also diffuse Klangerwartungen.(...) Durch die optische Analyse und den [sic] dabei entwickelten diffusen Klangerwartungen läßt sich eine Hörsituation anbahnen, bei der der Schüler nicht mehr der Fülle klanglicher Erscheinungen ausgeliefert ist, sondern einige Punkte der Orientierung besitzt, die das vorübereilende Musikstück zumindest grob strukturieren. (...) Die Klangerwartungen sollen (...) so genau wie möglich und mit zunehmender Übung immer exakter entwickelt werden, die Schüler sind also stets in echten Arbeitssituationen, nur wird dabei nicht allein (...) synthetisch vorgegangen, sondern zugleich eine analytische Methode gewählt, die von der groben Strukturierung musikalischer Zusammenhänge zu immer feineren fortschreitet, ohne allerdings dabei sich der Illusion hinzugeben, das Hochziel Adornos ["das adäquate, aber stumme Lesen von Musik" Zur Musikpädagogik, 104] je zu erreichen. (55f.) In Verbindung mit dem Singen und Spielen nach Noten stellt das Hören mit Noten nicht nur eine methodische, sondern auch eine didaktische Bereicherung dar, da die Beschränkung auf die "kleinen Werke großer Meister" nicht länger notwendig ist. Venus führt eine Reihe von Argumenten dafür an, daß es im Gegenteil sinnvoller sein kann, Ausschnitte aus anspruchsvolleren Werken zu hören, denn Einstimmige Weisen oder ein Menuett, des 6jährigen Mozart (...) stellen an den Hörer häufig höhere Anforderungen als ein farbig instrumentiertes Werke wie Händels 'Wassermusik' oder Strawinskys 'Petruschka', da die sparsameVerwendung der Kunstmittel die Aufmerklsamkeit weniger erregt und daher ein größerer Wille zum Zuhören aufgebracht werden muß. (59) Die Kritik von Günther und Venus am traditionellen Notenlehrgang stimmt in zwei wesentlichen Punkten überein: 1. Das Ziel des Notenlehrgangs - die Fähigkeit zum Vomblattsingen - wird als fragwürdig angesehen: zum einen sei es unrealistisch bzw. das relativ dürftige Ergebnis stehe in keinem Verhältnis zum Aufwand; zum anderen stelle es einen zu einseitigen Zugang zur Musik dar, der Musikunterricht müsse aber eine Vielzahl von musikalischen Verhaltensweisen fördern und ausbilden. Wenn Venus dabei eine neue zentrale Verhaltensweise - das Hören - angibt, so ist dies nicht mit dem Primat des Singens vergleichbar, da das Musikhören von vornherein als sehr vielschichtige Verhaltensweise gesehen wird. 2. Beide Autoren geben anderen, insbesondere von Schülern selbst erfundenen, Notenschriften Raum. Eines der Ziele ist dabei das Begreifen des Phänomens Notation: die Erkenntnis, daß eine zeitliche Abfolge von Klängen, die unser Gemüt erregt, sich als Anordnung von Zeichen in der Fläche darstellen läßt, und daß aus dieser Darstellung wiederum Musik gelesen werden kann. - Während Venus jedoch keinen Zweifel daran läßt, daß es letztlich um die traditionelle Notenschrift geht, um Partituren klassischer Werke, fordert Günther: Die Konsequenz wäre deshalb eine Revision des Notenlehrgangs zugunsten eines pädagogisch relevanten und didaktisch bewußten Umgangs mit dem musikalischen Phänomen Notation. Dieser Umgang kann dann freilich auch zur herkömmlichen Notation als einer Sonderform führen (...) (663) Aus dieser letzten Formulierung wird deutlich, wie sehr Günther bereits 1965 bereit scheint, auf die traditionelle Notenschrift möglicherweise ganz zu verzichten. 2.3. Kritik und Verteidigung der traditionellen Notenschrift Ging es Günther und Venus vorrangig um die Frage, inwieweit und unter welchen Gesichtspunkten eine Behandlung der Notenschrift im Schulunterricht sinnvoll sei, so wird die Kritik in der Folge auf die traditionelle Notenschrift selbst und ihre Eignung zur Darstellung von Musik ausgeweitet. Bereits 1964 hatte Carl Dahlhaus - allerdings ohne jedes musikdidaktische Interesse - vor einem vorwiegend an Neuer Musik interessierten Publikum, die traditionelle Notenschrift mitsamt ihren in neuester Zeit geschaffenen Erweiterungen und Ergänzungen auf innere Unstimmigkeiten, Unvollkommenheiten und Widersprüche untersucht5. Ebenfalls aus dem praktischen Interesse an der Notation neuester Musik heraus hatte zwei Jahre später Erhard Karkoschka den Versuch einer Bestandsaufnahme neuer Notationssymbole unternommen6. Auf diese beiden Arbeiten wird weiter unten noch eingegangen werden. Siegfried Vogelsänger veröffentlicht 1969 einen Aufsatz mit dem provokanten Titel Das Erlernen der Notenschrift: Eine pädagogisch fragwürdige Aufgabenstellung. Im Verlauf seiner Argumentation führt er eine Reihe von "Mängeln" der Notenschrift auf, die jedoch aus anderem Blickwinkel als Vorzüge gelten müssen, so das Ökonomieprinzip: 1. Ein grundsätzlicher Mangel besteht darin, daß mit Hilfe relativ weniger Zeichen eine Fülle musikalischer Ausdrucksmöglichkeiten wiedergegeben werden soll, so daß man jedes Zeichen in einem neuen Zusammenhang jeweils neu deuten muß. (182) oder die Leistung, Musik der Vergänglichkeit zu entheben: 5 Dahlhaus 1965 6 Karkoschka 1966 2. Ein weiterer wesentlicher Mangel besteht darin, daß mit der schriftlichen Fixierung die Musik aus einem dynamischn in einen statischen Zustand versetzt und die 'Musikzeit' damit aufgehoben wird. (...) (182) Zutreffend ist allerdings die Warnung, 3. (...) die zeitlich-räumlicheVorstellung, welche die Notenschrift von der Musik vermittelt, nicht als deren reales Abbild (182) zu verstehen. In dem folgenden Punkt wird kritisiert, daß - man verzeihe die Ironie - ein falscher oder unvollständiger Gebrauch der Notenschrift zu falschen oder unvollständigen Ergebnissen führt: 4. Die Tonhöhe ist (...) nur ungenau angegeben; (...) so daß ein gleiches Notenbild durch Verwendung verschiedener Schlüssel und Vorzeichen völlig verschiedene Klangbilder ergibt. (182) Dazu ist zu bemerken, daß erstens die Klangbilder, die sich ergeben würden, denn doch nicht so völlig verschieden wären, und daß es zweitens eben nicht mehr das gleiche Notenbild ist, wenn ein anderer Schlüssel verwendet wird. - Dagegen ist der folgende Einwand zutreffend: 5. Auch von der Tondauer geben die Noten kein genaues Bild, sondern diese verändern ihren Wert je nach dem Zusammenhang, in dem sie stehen, sind abhängig von Grundtempo, Phrasierung, Artikulation (...) (182) Auch die in den nächsten Punkten geäußerte Kritik, daß Tonhöhen und -dauern durch die Notenschrift gegenüber anderen Klangeigenschaften, die wiederum selbst teilweise nicht genau fixierbar sind, zu sehr in den Vordergrund gerückt werden, muß ernstgenommen werden. - Insgesamt muß aber gesagt werden, daß diese "Kritik" an der Notenschrift, besonders im Vergleich mit den Überlegungen Dahlhaus', weitgehend undifferenziert und undurchdacht erscheint. Die folgenden Zitate (Hervorhebungen von mir): So kann also auch die differenzierteste Partitur keinem Interpreten die Arbeit abnehmen, zu entdecken, was der Komponist mit seiner Aufzeichnung hat aussagen wollen. (182/2) Neben der Aufführung eines Werkes ist es einzig deren Aufzeichnung mit Hilfe der technischen Mittler, die ein reales Abbild von ihm vermittelt; (182/3) zeigen eine stark vereinfachende, geradezu naive Gleichsetzung von Intentionen des Komponisten, Werk und Aufführung, wobei Notentext und Interpret lediglich der Vermittlung dienen. Erinnert sei hier an die Ausführungen Ulrich Günthers: Das Moment der Deutung aber ist es, das Notation autonom macht, das sie von den Intentionen ihres Urhebers löst und somit darauf hinweist, daß sie mehr ist als ein Mittel zum Zweck oder gar Schein von Musik. (s.o.) Auch die folgenden Aussagen müssen mit Blick auf Venus kritisch gesehen werden: Die 'Vor-Stellung' von der in einem Notentext fixierten Musik kann also durch bloßes Lesen, Benennen und Registrieren der einzelnen Daten weder gewonnen noch geschult werden. 'Lesenkönnen' der Notenschrift ist darum keine Voraussetzung oder Vorstufe zum Verstehenkönnen von Musik; denn dieses Lesen ist nur musikalisches Lesen, sofern und soweit der Leser dabei in der Lage ist, die notierte Musik auch klingend zu erleben. (182/2) Man wird diesen Feststellungen voll zustimmen können, wenn mit dem "klingend erleben" auf ein "Hören mit Noten" abgezielt wird, das sich ja ohne weiteres methodisch realisieren läßt, wie Venus gezeigt hat. Wenn jedoch damit ein "Hören nach Noten" gemeint ist, so käme man zu der absurden Konsequenz, daß selbst viele Berufsmusiker - ja selbst Komponisten - nicht zum "musikalischen Notenlesen" fähig wären (vgl. Venus 1969, 51). Zustimmen können würde man auch der folgenden Warnung, wäre sie etwas vorsichtiger formuliert, nämlich mit "können" statt "müssen": Daraus ergibt sich, daß alle Aussagen über musikalische Vorgänge, welche mit Hilfe der Notenschrift (...) gewonnen und zur Grundlage der Musiklehre und Musikbetrachtung gemacht werden, dort zu Fehlschlüssen und -interpretationen führen müssen, wo man sie für musikalische Tatsachen hält; (182/3) Vogelsänger zieht dann die Konsequenzen für den Musikunterricht: wenn man nicht alle Schüler zu "Ausführenden" ausbilden wolle, sei es die Frage, ob man den Schüler so weit in die Notenschrift einführen kann, daß er daraus Erfahrungen und Erkenntnisse für das Hören- und Verstehenlernen der Musik gewinnt. (182/3) Dies sei jedoch über eine rein vokale Hör- und Denkweise kaum zu erreichen; die für diesen Zweck einzig sinnvolle instrumentale Ausbildung aber, die am Tasteninstrument nämlich, sei dagegen unrealistisch. Beim Lesenlernen der Notenschrift kommt man also in der Schule (...) über das Buchstabieren nicht hinaus. Der Sinn solcher Übungen kann es dann nur sein, dem Schüler die Augen zu öffnen für das Phänomen Notenschrift und das Spezifische musikalischer Notation; darin liegt einzig ihr Bildungsgehalt. (...) So ergibt sich die Frage, was dem Schüler die Notenschrift beim Hören und Hörenlernen helfen kann: Da er seinerseits nicht in der Lage ist, sie adäquat zu lesen und lesen zu lernen (...) kann es lediglich eine allgemeine Konzentrationshilfe und Gedächtnisstütze für ihn sein. Damit kann er sich 'an der Musik entlangtasten' - falls das Notenbild dabei nicht gerade das bewirkt, was es verhindern soll, ihn also irritiert und auf Unwesentliches ablenkt (...). (183/1-2) Hier spricht Vogelsänger eine Gefahr an, die bei der methodischen Vorbereitung des "Hörens mit Noten" unbedingt beachtet werden muß. - Abschließend betont er nochmals, daß das Beherrschen der traditionellen Notenschrift nicht den Gradmesser für die Ergebnisse des Musikunterrichts darstellen darf: Der Grad musikalischer Bildung, den jeder in seinem Leben erlangen sollte (...) entscheidet sich nicht am Lesen- oder Schreibenkönnen der Notenschrift, sondern einzig und allein daran, ob seine Fähigkeiten ausgebildet worden sind, Musik hören, erleben und verstehen und gegebenenfalls auch über das Gehörte sprechen zu können. (...) (183/1-2) Auf der einen Seite ist Vogelsänger der erste, der unmißverständlich ausspricht, was bei Günther nur angedeutet ist: daß der Musikunterricht vielleicht ganz ohne die traditionelle Notenschrift auskommen könnte und damit mehr erreichen würde als mit ihr. Darin besteht sein Verdienst. Auf der anderen Seite erscheinen viele seiner Aussagen über die Notenschrift - besonders im Vergleich zu den Überlegungen Dahlhaus' - zum Teil undifferenziert, zum Teil sogar unhaltbar und dürfen keinesfalls die Basis für didaktische Entscheidungen bilden. (Dies gilt übrigens auch für das 1970 erschienene Buch Vogelsängers, in dem er seine Argumente kaum verändert wiederholt.) Es erscheint daher nicht verwunderlich, wenn bereits im selben Jahrgang (1969) von Musik und Bildung eine Erwiderung auf diesen Aufsatz erscheint, verfaßt von Konrad Giebeler, den Vogelsänger am Anfang seines Aufsatzes kritisch zitiert hatte. - Giebeler hält unter den Hemmnissen, die den Erfolg des Musikkunde-Unterrichts einschränken, die Tatsache, daß mit der Einführung der Notenschrift nicht im 2. Schuljahr oder früher, sondern - wenn überhaupt - erst im 5. Schuljahr begonnen werde, für das schlimmste. Er weist dann hin auf den unseligen Rückkopplungsmechanismus zwischen den unbefriedigenden Erfolgen, die der Musikunterricht erzielt, der Geringschätzung, mit der er von Schulpolitikern und Schulleitern behandelt wird, und den unzureichenden Bedingungen, die ihm daher eingeräumt werden. Aus diesem Dilemma jedoch durch eine Radikallösung herauszukommen, indem man nämlich auf die Einführung der Notenschrift ganz verzichtet, hält Giebeler für gefährlich: Indem man nämlich dem Singeunterricht weitgehend den Abschied gegeben hat, auf der anderen Seite aber ein Werkbetrachtungsunterricht auf der Grundlage musikwissenschaftlicher Methoden mangels einer durch die Musiklehre vermittelten adäquaten Sprache ausgeschlossen ist, kommt es zur Wiederentdeckung eines auf dem naiven Erlebnis sich gründenden Unterrichts, in dem Einhören und Einfühlen stattfindet. (545/2) Im folgenden setzt er sich mit verschiedenen Argumentationsmustern auseinander, die auf Forderungen nach dem Verzicht auf die Notenschrift führen. Zum einen werde argumentiert, es seien weder Noten noch Fachbegriffe nötig, um ein Musikstück sinnvoll hören zu können. Das reine Musikerlebnis vollzieht sich in einer außerbegrifflichen Schicht. (...) Die Folgerung daraus, es seien also Notenkenntnis und Beherrschung musikalischer Fachbegriffe im Musikunterricht nicht erforderlich, ist nicht schlüssig, denn die Gleichsetzung von Hörerlebnis und Musikunterricht ist nicht ohne weiteres möglich. (545/2) Eine zweite Überlegung gehe dahin, daß es nicht sinnvoll sei, das Notenlesen zu vermitteln, da die Schüler durch den Musikunterricht ohnehin nicht zu einer perfekten Beherrschung der Notenschrift geführt werden könnten. Giebeler bemerkt darauf, dies gelte für viele andere Unterrichtsinhalte auch: Würde man die Forderung, ein Unterrichtsgegenstand dürfe nur unterrichtet werden, wenn die Gewähr besteht, daß ihn der Schüler schließlich in voller Perfektion beherrscht, in den allgemeinbildenden Schulen zum Grundsatz erhoben, so lernte man dort allenfalls noch Lesen und Schreiben. (546/1) Giebeler nimmt dann direkt auf den Aufsatz Vogelsängers Bezug und unterstellt diesem, er habe behauptet, Musikunterricht sei ohne die wichtigsten elementaren Begriffe der Musiklehre möglich. Daß in anderen Fachrichtungen die Frage überhaupt diskutiert werden könnte, es sei ein Unterricht ohne Begriffsapparat und ohne kontrollierbare Wissensvermittlung möglich, ist undenkbar. (...) Es muß daran festgehalten werden, daß das Ziel auch des Musikunterrichts Erkenntnis ist, nicht nur Erkenntnis, gewiß, aber auch Erkenntnis. Gibt die Musikerziehung dieses Ziel auf, so hätte das in Hinsicht auf den oben beschriebenen Rückkopplungskreis schlimme Folgen. (546/1) Deutlich wird daran, daß Giebeler Notationskenntnisse als unabdingbare Voraussetzung für musikalische Begriffsbildung sieht. - Er geht dann, um die Bedeutung der Notenschrift für den Musikkunde-Unterricht näher zu begründen, auf das Verhältnis von Partitur und Werk ein, wobei er sich auf Roman Ingardens Untersuchungen zur Ontologie der Kunst bezieht: da das Musikwerk kein realer Gegenstand sei, sondern nur die jeweilige Aufführung, müsse man sich an die Partitur halten, die zwar auch nicht das Werk sei, sondern "ein System imperativistischer Symbole", das aber unter anderem auch als "Text" das Studium des Werkes gestatte, ohne daß eine Aufführung notwendig wäre (546/2). Die Notenschrift biete somit dem, der sie beherrscht, drei Möglichkeiten: Er kann seine musikalischen Ideen zu Papier bringen (der Komponist), er kann danach ein Musikstück aufführen (der Musikant [sic!]), er kann danach Erkenntnisse über ein Werk erwerben (der Student). (547/1) Dies gelte im ähnlicher Weise auch für die Buchstabenschrift, wobei keineswegs ausgemacht sei, daß diese "genauer" als die Notenschrift sei. Giebeler weist auf die methodischen Möglichkeiten der Partiturarbeit hin: Das Musikwerk als ein Vorgang in der Zeit erscheint in der Partitur als ein simultanes Gebilde, als ein Abbild. Gegenüber der Schallplatte, als der anderen Form der Musik-"schrift", die aber das Vorganghafte der Musik nicht ins Simultane umsetzt, hat die Partitur den Vorteil, daß man sie in Ruhe betrachten kann. Sie läßt sich hin und herwenden, analysieren, durchforschen. Schwer durchschaubare Stellen, die bei der musikalischen Aufführung genauso schnell vorübereilen wie die "leichten" Stellen, lassen sich so lange festhalten, bis man sie begriffen hat: Die Vorteile für die Unterrichtspraxis sind einleuchtend. (547/1) Eine solche Partiturarbeit sei keineswegs an eine "innere Hörvorstellung" gebunden: Im übrigen setzt das sinnvolle Betrachten einer Partiturseite keineswegs voraus, daß dem Betrachter aus dem Notenbild stets etwas entgegenklingt. (...) Das Gestalthafte des Musikwerks mit seinen Teilganzen und Elementen schlägt sich in graphischen Figurationen nieder, die an sich selbst eine graphische Gestaltsqualität besitzen. (547/1-2) Giebeler hält durchaus andere Darstellungsformen als die traditionelle Notation für sinnvoll: Eine Abstraktion zweiten Grade findet statt, wenn - aus methodischen Gründen - von dem Werk durch Zeichen und Figuren ein Schema seines formalen Verlaufs hergestellt wird. (547/2) Er wendet sich keinesfalls gegen Hörerziehung allgemein, sondern nur gegen eine Hörerziehung, die keine begrifflich faßbare Erkenntnis anstrebt: Die naive Klangfreude des kleinen Kindes, das einer Mozartsymphonie lauschet und dabei vielleicht sogar deren musikalische Qualitäten erahnt, können wir dem Heranwachsenden und Erwachsenen nicht mehr zubilligen. Er besitzt auch dessen Unschuld nicht mehr (547/2) In den Tendenzen, die unter anderem in Vogelsängers Aufsatz deutlich werden, sieht er eine Rückwärtsentwicklung: Ist vielleicht überhaupt die Abkehr einmal von der heiteren Strenge des Musizierens und zum anderen von der wissenschaftlich begründeten Musiklehre und der gleichzeitige Rückzug auf eine vorbegriffliche Anleitung zum Hören von Musik ein Symptom einer neuen Lehre von bloß "musischer", der Theorie abgeneigter Musikerziehung? (...) Es ist notwendig, einer Art Geistigkeit, die sich der Begriffe und damit des Denkens entledigt, mit dem größten Mißtrauen zu begegnen. ( 548/1) Daß Giebeler hier versucht, Vogelsänger in die Nähe der gerade erst überwundenen "musischen Erziehung" zu rücken, zeigt eine polemische Absicht, die noch an einem anderen Beispiel verdeutlicht werden soll. Bezugnehmend auf eine von Vogelsänger selbst beschriebene Unterrichtsstunde stellt Giebeler fest, bei dem, "was den Schülern als Ertrag der Stunde sprachlich faßbar geblieben" sei, handele es sich "ausschließlich um Aussagen über die Subjektseite des Hörvorgangs. Um über das Stück selbst etwas aussagen zu können, fehlt den Kindern die Sprache: Die Formulierung der bemerkten Tatsachen wird ihnen durch eine Sprachbarriere verwehrt" (546/1). Daß Giebeler als "der Konservative" hier Vogelsänger den Vorwurf macht, er lasse "Sprachbarrieren" bestehen, ist eine polemische Vertauschung der Seiten. In einer Anmerkung gibt Giebeler übrigens zu, daß Vogelsänger in der zitierten Unterrichtsstunde "immerhin" noch die Kenntnis der Notenschrift voraussetzte (Anm. 3, 548/1). Hieraus läßt sich schließen, daß das Erlernen der Notenschrift offenbar kein Mittel ist, um "Sprachbarrieren" abzubauen; und genau dies will ja Vogelsänger zum Ausdruck bringen. Insofern kann gesagt werden, daß zwischen beiden Parteien keine wirkliche Auseinandersetzung stattfindet, sondern beide aneinander vorbeilaufen und dabei über das Ziel hinausschießen. - Dennoch muß gesagt werden, daß Giebelers Aufsatz eine wesentlich differenziertere Sicht des Phänomens Notation zeigt, hinter der eine musikpädagogische Diskussion nicht zurückbleiben sollte. 2.4. Produktions- und Rezeptionsnotation? Die verhärteten Fronten von Gegnern und Befürwortern der traditionellen Notation werden nachhaltig in Bewegung gebracht durch einen 1973 erschienenen Aufsatz, in dem Rudolf Frisius die Antwort auf die musikdidaktische Frage nach der Bedeutung des Themas Notation im Musikunterricht erneut durch Aussagen über die Notenschrift selbst zu fundieren sucht. Im Zusammenhang mit der "fachwissenschaftlichen Grundfrage" nach den Gründen, Musik aufzuschreiben, entwickelt er die Unterscheidung zwischen Produktions- und Rezeptionsnotation, wobei letztere dokumentiert, wie bestimmte Musik in einer bestimmten Ausführung klang. Sie ist sozusagen ein musikalisches Protokoll, vergleichbar dem stenographischen Protokoll einer Rede oder eines Gespräches. (19/1) Er gibt dazu das Beispiel eines Musikethnologen, der ein ihm bisher unbekanntes Volkslied nach dem Höreindruck aufzeichnet: Wesentlich ist, daß im Falle des Volkslieds das tatsächliche Erklingen so notierter Musik in der Regel keine Notation voraussetzt. Das klangliche Resultat (...) folgt der mündlichen Überlieferung (...) oder allgemeinen ungeschriebenen musikalischen Konventionen (...). Eine Notation derartiger Musik kann darum die Musik nicht so darstellen, wie sie "tatsächlich" gemeint ist, wondern nur so, wie der Notierende sie hören und aufschreiben konnte. Die Notation ist in diesem Falle mit einer Interpretation verbunden (...) (19/1), indem nämlich der Aufzeichnende ein Notationssystem wählt und darüber entscheidet, welche klanglichen Aspekte er als wesentlich betrachtet und festhält und welche er nicht notiert. Für die Produktions-Notation gibt er das Beispiel eines Komponisten, der eine Komposition aufzeichnet: Ausgangspunkt ist die Hörvorstellung, ein vorgestellter Höreindruck. Hieraus ergibt sich eine Notation. Die Notation ermöglicht eine Aufführung und damit einen realen Höreindruck. (...) Die Notation bezieht sich hier auf die Fixierung erfundener Musik, auf Musik, die in der Vorstellung des Komponisten, aber noch nicht im realen Klang existiert. Die Notation geht aus von der musikalischen Produktion. Sie ist weniger musikalisches Protokoll als Aufführungsanweisung, vergleichbar dem aufgeschriebenen Text eines Theaterstückes. (19/1-2) Insgesamt stellt Frisius fest, daß die Bedeutung der Notation in neuerer Zeit geringer ist als früher: Im Bereich der Rezeption hat die Notation an Bedeutung verloren, seit sich Musik über Tonband und Schallplatte auch ohne das Hilfsmittel der Notation verbreiten und überliefern läßt. Im Bereich der Produktion hat die Notation an Bedeutung verloren, seit elektronische und konkrete Musik neue Möglichkeiten erschlossen haben, kompositorische Vorstellungen ohne Vermittlung von Notation direkt in realen Klang umzusetzen. In beiden Bereichen (...) hat sich überdies im Laufe dieser Entwicklung immer deutlicher herausgestellt, daß die Vielfalt des Hörbaren und insbesondere die Vielfalt der heute allgemein zugänglichen Musik sich nur in sehr beschränktem Ausmaße und mit allenfalls annähernder Genauigkeit schriftlich fixieren lassen. (19/2) Die zweite "fachwissenschaftliche Grundfrage" nach den Möglichkeiten, wie sich Musik aufschreiben läßt, führt zur Unterscheidung von verbaler und grafischer Notation, die aber im weiteren Verlauf von Frisius' Argumentation keine nennenswerte Rolle spielt, auf die daher auch hier nicht näher eingegangen wird. Frisius behauptet nun, daß die Beschaffenheit der traditionellen Notenschrift erklärt, daß sie in erster Linie den Bedingungen der Produktion und nicht denen der Rezeption entspricht. (...) Eine Partitur von Wagner läßt sich nach dem Notentext aufführen, aber ihr Notentext läßt sich nicht ohne weiteres nach Abhören einer Aufführung rekonstruieren. (20/2) Ausgehend von seiner Unterscheidung von Rezeptions- und Produktionsnotation geht Frisius nun der Frage nach, welche Rolle der Notation im Musikunterricht zukommt. Er kritisiert zunächst Venus' "Hören mit Noten" mit dem Argument, die dabei verwendeten Partituren seien Produktions-, keine Rezeptionsnotationen, aus denen der Hörer das von ihm Gehörte entnehmen könne. Er zitiert dazu Moles7: "Die Partitur ist ein Operationsschema und als solches nur für den Ausübenden, aber durchaus nicht für den Hörer bestimmt. Wenn der Hörer ein Musikstück anhand der Partitur verfolgt, macht er einen ästhetisch widersinnigen Gebrauch von ihr; er will nur wissen, wie man das ästhetische Objekt herstellt, das er wahrnimmt" (21/1) 7 Moles 1971, 158 Auf dieses für eindimensionales Denken plausible Moles-Zitat, das in der musikpädagogischen Literatur von nun an immer wieder auftaucht, wird im nächsten Kapitel näher eingegangen werden. Zu dem von Venus als Argument für die Vermittlung der Notenschrift angeführten engen Zusammenhang zwischen abendländischer Musik und Notation zitiert er zunächst Georgiades8: "Es decken sich Notenschrift und derjenige Bestandteil der Musik, der als 'Komposition', als Leistung des Komponisten gemeint ist; jedoch nicht Notenschrift und Erklingen, das, was wir eben als Musik bezeichnen. (...) Das Wesentliche der musikgeschichtlichen Interpretation sollte im Musik-Machen bestehen. Man sollte zeigen, wie man Klang hinstellen kann." (21/2) - ohne übrigens deutlich zu machen, daß Georgiades dies über die Musik des 12. Jhds. sagt, als die Notation gerade begann, unerläßliche Voraussetzung für das Komponieren zu werden - um dann anzuschließen: Eine unterrichtliche Vermittlung, die sich an musikgeschichtlichen Gegebenheiten orientiert, müßte dementsprechend die Produktionsnotation in den Mittelpunkt stellen: Sie müßte deutlich machen, wie vorgestellte Klänge, die in abstrakte Notentexte übersetzt und uns in dieser Form überliefert wurden, sich in ein konkretes, real hörbares Klangbild umsetzen lassen. (21/2) Ein sich daraus ergebendes Problem ist, daß die Schüler selbst nur einen kleinen Ausschnitt des musikalischen Spektrums, das ihnen heute zugänglich ist, auszuführen in der Lage sind. In einem Musikunterricht, der diesem Spektrum und den ihm adäquaten musikalischen Verhaltensweisen gerecht werden will, müßte man daher erwägen, den Problemkreis 'Notation' entweder von der starken Fixierung auf die Musikausübung weitgehend zu lösen oder ihn nur noch als speziellen Teilaspekt zu berücksichtigen. (21/2) Die Kritik an der von Venus vertretenen ersten Variante bleibt aber bestehen: Wenn Schüler also vorgegebene Musik hören und in Verbindung damit vorgegebene Notationen dieser Musik lesen, so lernen sie dabei nicht unbedingt den Aspekt der Produktionsnotation und seine grundlegende Bedeutung kennen. Aber auch der Aspekt der Rezeptionsnotation erschließt sich dabei in der Regel nicht: Was ein Schüler hört, kann er nicht aus einer vorgegebenen Notation entnehmen; er muß vielmehr von seinen eigenen Höreindrücken ausgehen, um diese dann gegebenenfalls schriftlich zu fixieren. (22/1) Bleibt also die Berücksichtigung der Notation als eines speziellen Teilaspekts der Auseinandersetzung mit Musik: Wenn Schüler selbsterfundene Musik aufschreiben (Produktionsnotation) oder gehörte Musik schriftlich fixieren (Rezeptionsnotation), sind sie nicht auf die speziellen Modalitäten der traditionellen Notenschrift festgelegt; sie setzen sich dabei aber mit grundlegenden Notationsprinzipien auseinander, deren Bedeutung über den Bereich spezieller Notationssysteme hinausreicht. (22/1) Frisius faßt zusammen: Aus der Unterscheidung zwischen Produktionsnotation und Rezeptionsnotation ergeben sich also spezifisch verschiedene Ansatzmöglichkeiten, Notation im größeren Zusammenhang (ohne ausschließliche Fixierung auf die traditionelle Notation) in den Musikunterricht einzubeziehen. Dies bedeutet aber keineswegs, daß Produktionsnotation und Rezeptionsnotation im Unterricht voneinander isoliert werden müßten; im Gegenteil: die deutliche Unterscheidung beider Aspekte erleichtert es, sie im Unterricht angemessen aufeinander zu beziehen und miteinander zu verbinden (...) (22/1) Einen wesentlichen Aspekt versteckt Frisius übrigens im Anmerkungsteil: einige bedeutende Musikwissenschaftler und -pädagogen9 gestehen Musik den Status eines Kunstwerks nur dann zu, wenn 8 Georgiades 1954, 28f. 9 z.B. Carl Dahlhaus und Karl-Heinrich Ehrenforth ihr ein Notentext zugrundeliegt; sie schließen somit außereuropäische Kunstmusik ebenso aus wie JazzImprovisationen. Nun ist es zwar zutreffend, daß die spezifische Existenzweise, in der die heute aufgeführte sogenannte "E-Musik" der vergangenen Jahrhunderte lebt, ohne "Notentext" nicht möglich wäre (hierauf wird im nächsten Kapitel eingegangen werden). Das heißt aber nicht, daß Musikwissenschaft oder -pädagogik den Blick verschließen können vor den Leistungen anderer Musikkulturen oder -subkulturen, in denen die Notation eine untergeordnete Rolle spielt. Das entscheidende Anliegen des Aufsatzes ist aber die Etablierung der Begriffe Produktions- und Rezeptionsnotation und ihre Anwendung auf musikdidaktische Fragestellungen. Auch wenn dieser Unterscheidung später von Dörte Wiechell attestiert wird, "hilfreich" zu sein, sind die Schwierigkeiten solcher Begrifflichkeit nicht zu übersehen, auf die Peter Koch in einer kritischen Stellungnahme ausführlich eingeht10. Zum einen ist, wie Peter Koch zeigt, jede der Notationen gleichzeitig auch Reproduktionsnotation, die von einem (vorgestellten oder realen) Klang ausgeht und auf einen (vorgestellten oder realen) Klang abzielt, so daß die Unterscheidung überhaupt fragwürdig erscheint. Ein anderes Problem ist, daß Produktionsnotate allgemeinverbindlich, Rezeptionsnotate dagegen streng subjektiv und beide daher im Grunde nicht vergleichbar sind. Der von Frisius verwendete Begriff des "tatsächlichen Höreindrucks" ist erkenntnistheoretisch nicht haltbar (Koch formuliert milder: "irreführend", 332/2). Man kann das tatsächlich Erklingende aufzeichnen - das Ergebnis wäre z.B. die digitale Information, die auf einer CD gespeichert ist - oder ein bestimmter Hörer kann das aufzuzeichnen versuchen, was er persönlich wahrgenommen hat - ein im Detail oft mühseliges und unbefriedigendes Unterfangen. Schließlich - und darauf läuft es wohl oft hinaus - kann ein Lehrer dafür sorgen, daß an der Tafel das aufgezeichnet wird, was seiner Ansicht nach die Schüler hätten hören sollen (und was er selbst anhand der Taschenpartitur überprüft hat). Hier stellt sich die Frage, ob es nicht besser wäre, mit offenen Karten zu spielen und die Partitur für die Schüler erkennbar heranzuziehen als Aufzeichnung dessen, was nach Ansicht des Komponisten hätte hörbar sein sollen - eine Information, die zwar Kriterien an die Hand gibt, eine Aufführung zu beurteilen, die aber dem Hörer keineswegs vorschreibt, was er hören soll. Daß es wenig Sinn macht, die Begriffe Produktions- und Rezeptionsnotation vom einzelnen Notat ohne weiteres auf ganze Notationssysteme zu übertragen, wie Frisius es tut, wird im nächsten Kapitel gezeigt werden. Was bleibt von dem Aufsatz, wenn doch die begriffliche Unterscheidung, auf der Frisius seine gesamte Argumentation aufbaut, so anfechtbar ist? Die Idee, um die es wohl bereits Günther und Vogelsänger ging, und um die auch Frisius' Überlegungen kreisen, die aber hier von einem fragwürdigen musikwissenschaftlichen Begründungsgebäude erdrückt wird, ist folgende: Schüler, also ungeübte Hörer, können ihre Hörfähigkeit trainieren, indem sie das (subjektiv) Gehörte aufzeichnen und in mehreren Durchgängen ihre Aufzeichnungen mit dem Gehörten vergleichen. Die Erfahrung zeigt, daß durch solches Vorgehen die Hörwahrnehmung ungeheuer intensiviert wird. Das eigentliche Ziel ist also ein subjektives: der Schüler soll seine Hörfähigkeit verbessern. Insofern handelt es sich um eine wichtige methodische Möglichkeit, die sich aus dem Notieren von Musik ergibt, auf die im letzten Kapitel noch einzugehen sein wird. Dies hat jedoch wenig zu tun mit dem Transkri- 10 Koch 1974 bieren des Musikethnologen, oder dem Platten-Abhören des Jazzmusikers, denn deren Ziel ist ein objektives - es geht darum, daß die Aufzeichnung die Musik möglichst getreu wiedergibt. 2.5. Graphische Notationsformen im Musikunterricht Im Verlauf der siebziger Jahre erscheinen immer wieder Aufsätze, die die Möglichkeiten des Einsatzes graphischer Notation im Unterricht zeigen sollen. Auf zwei von ihnen soll hier näher eingegangen werden. Klaus Finkel und Ulrike Wünnenberg beschreiben 1975 ein Unterrichtsmodell zur Hörerziehung für musikalisch nicht vorgebildete Kinder der Sekundarstufe I, das an 6. bis 10. Klassen verschiedener Schulformen in Rheinland-Pfalz erprobt wurde. Gegenstand des Unterrichts waren je vier Stücke aus den Bereichen der musikalischen Avantgarde und der traditionellen Musik11. Ausgehend vom Strukturplan des Deutschen Bildungsrates werden die Unterrichtsziele quasi systematisch abgeleitet - ein Verfahren, das nach heutigen musikpädagogischen Erkenntnissen zweifelhaft ist12. Die folgende Darstellung wird sich daher auf die Abschnitte beschränken, in denen auf die Rolle der Notation eingegangen wird. Das Erstellen eigener Notationen wird neben dem experimentellen Umgang mit Klängen als vorrangiges methodisches Mittel gesehen, um Musikdenken zu vermitteln. Die traditionelle Notenschrift scheint den Autoren hierfür ungeeignet: Die Schüler werden mit einer Fülle von Regeln überschüttet, die sie erfahrungsgemäß nur sehr widerwillig lernen, weil ihnen dazu die Motivation (in Form von Musik) fehlt. (...) Überdies lassen sich 'Sachverhalte, die gerade nicht in den Noten stehen: harmonische, metrische und formale Funktionen oder melodische und rhythmische Beziehungen und Zusammenhänge' [Carl Dahlhaus, Über das Analysieren Neuer Musik, Musik im Unterricht 9/1965, S. 277] kaum feststellen, was aber zum Verständnis von Musik unbedingt nötig ist. Graphische Symbole dagegen vermitteln dem Schüler 'Einblick in die Ordnungen des Werkes und läßt [lassen, C.H.] ihn die Zuordnung der Elemente erkennen, die er auditiv schon wegen seiner geringen Übung nie vor sich aufbauen könnte' [Helga Ettl, Petruschka - Ein Modell zur Werkbetrachtung, Stuttgart 1968, S. 146] (34) Problematisch hieran ist zweierlei: zum einen müßte auch graphische Notation einer "Fülle von Regeln" gehorchen, um komplexe Sachverhalte darstellen zu können, die anhand des traditionellen Notenbildes nicht oder nur mühevoll erschlossen werden können. Zum anderen muß eine Hörpartitur, die dem Schüler Einblicke vermitteln soll, die er auditiv nicht gewinnen könnte, vorgefertigt sein. Dies steht im Widerspruch mit der folgenden Überlegung: Jede 'vorgefertigte' Notation engt den Erfahrungsspielraum ein, verhindert Denken und Kreativität. Genauso wie man dem Schüler erlaubt, seine Gedanken aufzuschreiben, muß man ihm erlauben, ihn die seinem Hören gemäßen Zeichen selber finden zu lassen [sic]. Damit würde er mehr als sonst zum Zuhören motiviert. Er braucht kein kompliziertes Regelsystem zu lernen, um auch komplexere Strukturen darstellen zu können (...) so daß seine Aufmerksamkeit von vornherein auf musikalische Zusammenhänge und Entwicklungen gerichtet wird, anstatt sie [die Musik, C.H.] in kleinste Einheiten zu zerlegen (Intervall, Motiv etc.). (35) 11 Im einzelnen waren dies: Karlheinz Stockhausen, Zyklus für einen Schlagzeuger (1959) und Studie II (1954), Krzysztof Penderecki, Utrenja (Grablegung Christi, 1970), Michael Vetter, Felder II (1968) einerseits und Johann Sebastian Bach, "Sicut locutus est" aus dem Magnificat, Joseph Haydn, "Die Himmel erzählen" aus der Schöpfung und das Andante aus der Paukenschlagsinfonie sowie der 4. Satz aus der Kleinen Kammermusik für Bläser op.22,2 von Paul Hindemith andererseits. 12 vgl. Kaiser / Nolte 1989, 95f. Ein weiterer Vorteil einer Notation, die sich am Klangeindruck orientiert, ist die Möglichkeit, in der Klasse eine Gespächsgrundlage zu schaffen, die jedem zugänglich ist, so daß im ständigen Vergleich von Zeichen und Klang das Gehörte kontrolliert wird. Die Gespräche über Musik bleiben sachlich, sind am Gegenstand orientiert und laufen nicht Gefahr, sich ins Irrationale zu verflüchtigen. (35) Es werden dann in enger Anlehnung an Vogelsänger (1972) Grundsätze für die Fixierung neuer graphischer Zeichen aufgestellt: - Die Zeichen müssen praktisch sein, denn sie verlieren dann ihren Sinn, wenn die Ökonomie des "neuen" Systems nicht mehr in rechter Relation zum Zeitaufwand des Erlernens steht. - Die graphischen Zeichen sind immer nur Hilfsmittel. (...) Bleistift und Papier oder Kreide und Tafel genügen völlig, sie allein lassen das didaktische Hilfsmittel nicht erstarren, sie allein engen auch den Denkapparat des Schülers nicht weiter als nötig ein. - Werden Zeichen aus der traditionellen Notenschrift übernommen, dann mit der üblichen und gewohnten Bedeutung (...) - Grundprinzipien der traditionellen Notenschrift sollten - soweit es sinnvoll erscheint - beibehalten werden. (Tonhöhe wird in der Vertikalen notiert, Tondauer in der Horizontalen, Zusammenklänge stehen untereinander, Linien als Achsen oder Begrenzung oder eine Zeitleiste am Fuß der Notierung bieten sich ebenfalls an.) - Die Zeichen sollten sich gut voneinander abheben. (...) (36), gefolgt von einer Tabelle von Grundzeichen einer "graphischen Nomenklatur", die sich ebenfalls eng an Vogelsänger (1972, S. 59ff.) anlehnt. - Kritisch muß an dieser Stelle bemerkt werden, daß eine Nomenklatur natürlich den Schüler bereits wieder einengt und somit auch einige der gegen die traditionelle Notenschrift vorgebrachten Argumente wieder gelten. An anderer Stelle werden nochmals die Gründe zusammengefaßt, die für den Einsatz einer freien graphischen Notation, die vom Schüler allein oder im Klassenverband entwickelt werden kann, sprechen: - Sie fixiert das Hören nicht wie die traditionelle Notation auf temperierte Tonsysteme und periodische Rhythmik. Dem Schüler wird die Welt der Klänge nicht durch ein kompliziertes Regelsystem verbaut. Der Schüler kann selber früh komplexe musikalische Zusammenhänge notieren. Die optische Vorlage hilft dem Schüler, sein Hören zu kontrollieren, korrigieren und differenzieren. Die graphische Vorlage motivert gegenstandsbezogene Gespräche über Musik. Die graphischen Zeichen lösen musikalische Vorstellungen aus und initiieren Musikdenken, indem sie die Relationierung der musikalischen Elemente visuell erleichtern. - Die visuelle Vorlage bietet dem Auge musikalische Abläufe simultan dar, während das Ohr sie nur nacheinander aufnehmen kann. Musikalische Sinnzusammenhänge zu erkennen, fällt dem Schüler dadurch leichter. Es fällt auf, daß einige dieser Aussagen ebensogut auch auf die traditionelle Notation zutreffen könnten. Die Autoren betonen denn auch, es gehe ihnen keineswegs darum, die traditionelle Notation durch eine neugeschaffene zu ersetzen, sondern vielmehr um "eine Art Form- oder Struktur-Skizze, die eine Übersicht über das musikalische (...) Geschehen verschaffen soll, 'die verloren ginge, wären alle Ereignisse in der gewohnten Weise notiert' [Karkoschka 1966, S.55]" (S. 52). Daß auch ohne die traditionelle Notenschrift Begriffe gebildet und Einsichten in den Bau auch klassischer Werke gewonnen werden können, zeigen die Ergebnisse der Unterrichtssequenzen, z.B. über Bachs Chorfuge "Sicut locutus est" aus dem Magnificat: - Es gibt Linienmusik und Blockmusik. Linienmusik ist polyphone Musik. Blockmusik ist homophone Musik. Eine Musik, bei der eine musikalische Linie nacheinander in allen Ebenen erscheint, heißt Fuge. In der Fuge heißt die musikalische Linie Thema. Das Thema hat ein Gegenthema. - Das Gegenthema heißt Kontrapunkt. - Der Kontrapunkt erscheint in der Fuge immer nach dem Thema und zwar dann, wenn das Thema in eine andere Ebene (=Stimme) wechselt. (...) (83) Wenn hier die Abgrenzung gegenüber dem Kanon einerseits und der Fuge mit wechselnden Kontrapunkten andererseits nicht deutlich genug scheint, so ist dabei zu berücksichtigen, daß es sich bei den Schülern um solche ohne musikalische Vorbildung handelte. Bei solchen Schülern etwa in der 8. Klasse mit einer Einführung in die traditionelle Notenschrift zu beginnen, wäre sicherlich völlig verfehlt. Andererseits bedeutet dies nicht, daß nicht bei besseren Rahmenbedingungen - durchgehender qualifizierter Unterricht vom ersten oder zweiten Schuljahr an - mehr erreichbar wäre, und daß nicht dann auch die traditionelle Notenschrift möglicherweise das geeignetere Medium wäre. Michael Kühlenthal (1976) sieht die musikalische Graphik vor allem als methodisches Mittel, um die Schüler in die ungewohnte Klangwelt der Neuen Musik einzuführen. Voraussetzung hierfür sei lediglich ein brauchbar sortiertes Orff-Instrumentarium. Die achte Klassenstufe scheint ihm für ein solches Vorhaben besonders geeignet, da auch die Schüler, die sich bereits im Stimmbruch befinden, voll einbezogen werden können, und andererseits noch die nötige Spielfreude vorhanden sei. Als Einstieg empfiehlt er die Kritik der traditionellen Notenschrift, die an ihre Grenzen stößt, wo es um unbestimmbare Tonhöhen und nicht eindeutig definierbare Klangqualitäten geht. Er entwickelt daraufhin ein Repertoire graphischer Formen, die sich zur Aufzeichnung von Klängen eignen. Die Brauchbarkeit der Zeichen sei dadurch nachprüfbar, daß Schüler, die zuvor aus dem Raum geschickt wurden, die an der Tafel stehenden Zeichen realisieren müssen. Kühlenthal skizziert nun zwei Wege, mit den erarbeiteten Zeichen zu arbeiten: zum einen könne man mit Hilfe des Formenrepertoires eine musikalische Graphik entwerfen. Der angestrebte Zweck ist schon erreicht, wenn die Schüler bei der Komposition der Graphik, animiert durch die optischen Signale, manche Partien bereits klingen hören oder Vorschläge sowohl auf Grund optischer als auch akustischer Überlegeungen machen (...). (21/2 - 22/1) Bei der Ausführung sollen alle Schüler beteiligt sein. Das Zeitmaß des Ablaufs kann durch langsames Vorrücken der Hand angedeutet werden. - Es ist auch die Komposition aleatorischer Musik möglich, indem die Tafel in Bereiche eingeteilt wird, die mit Nummern versehen werden können. Der andere Weg besteht darin, zunächst Klangabläufe festzulegen - wobei der Lehrer eine gewisse Hilfestellung leisten muß -, diese zu notieren und dann zu spielen. Hierbei können auch verschiedene Versionen derselben Komposition realisiert werden. Die von den Schülern erarbeiteten Realisationen können auf Tonband aufgezeichnet und beurteilt und verglichen werden. "Sie werden mit Anteilnahme und Aufmerksamkeit verfolgt, weil die eigenen Produkte zur Diskussion stehen." (22/1) Will man am Ende dieser Unterrichtseinheit ein Fazit in bezug auf den Lernstoff ziehen, kann darin zum Ausdruck kommen, - daß man Musik durch Graphik tatsächlich so festlegen kann, daß das Resultat der Ausführung dem Charakter der Intenion entspricht; - daß man mit der neuen Methode auch Geräusche darstellen kann, was bisher nicht notwendig war, weil sie in der Regel in der traditionellen Kompositionstechnik nicht verwendet wurden; - daß die Musik nicht in jedem einzelnen ihrer Elemente genau fixiert, aber in der ihr gemäßen Bewegung und ihrem Klangchcharakter entsprechend festgehalten ist; - daß die Ausführenden stark in den Kompositionsakt einbezogen sind, weil die Notationsform eine Aktion erfordert, die verschieden realisiert werden kann; - und daß, wie wir gesehen haben, der Umgang mit musikalischer Graphik durch ein ausgesprochen spielerisches Element gekennzeichten ist. "(22/2) Als übergeordnete Lernziele nennt Kühlenthal die Schulung der Imagination und die Entwicklung der Phantasie. 2.6. Zum Verhältnis von traditioneller und graphischer Notation im Musikunterricht Während der siebziger Jahre wurde die graphische Notation nicht nur zu einem festen Bestandteil des Musikunterrichts - sie drohte anscheinend sogar die traditionelle Notation aus dem Schulunterricht völlig zu verdrängen. Dies ist zwar nicht anhand von Aufsätzen belegbar - Vogelsänger scheint der einzige zu sein, der eine entsprechende Forderung formuliert - , kann aber daraus geschlossen werden, daß verschiedene Autoren es immer wieder für nötig halten, die traditionelle Notation als Unterrichtsgegenstand zu verteidigen. Peter Koch unternimmt mit seiner Nü-Methode (1975) sogar noch einmal den Versuch, das Ziel des Blattsingens in der Schule zu erreichen. Auch er betont zunächst die bleibende Wichtigkeit der traditionellen Notation: Bis auf einen kleinen, wenn auch gewichtigen Teil an Schallkunst der letzten 15 - 20 Jahre ist die aufgeschriebene Musik der letzten Jahrhunderte in traditioneller Notenschrift dargestellt. (...) Wenn nicht alle Erfahrungen trügen, wird die gesamte Musiktradition auch weiterhin in traditioneller Schrift vermittelt und nicht graphisch umschrieben werden. Zudem gibt es (...) noch keine neue Schrift, die nur annähernd so symbolkräftig und genau traditionelle Musik bis zu Webern (und darüber hinaus!) zu erfassen imstande ist. (5) Er geht auf die Argumentation der Gegner der traditionellen Notation ein: Noch eine schwere Einwandkette: Der minutiöse Umgang mit den Noten ist unverhältnismäßig zeitraubend; dazu stellt das traditionelle Notensystem nur eine Möglichkeit der Notation dar. Zur Zeit gibt es daneben zahlreiche andere von der exakten graphischen Partitur bis zur verbalen Anweisung für Improvisationen. Außerdem hören Erwachsene normalerweise Musik ohne jegliches Schriftbild. Der Musikunterricht sollte sich diesen Tatsachen beugen und auf Notation im Klassenunterricht verzichten. Wer Noten lesen will, kann dies im Instrumentalunterricht oder Chor tun. (20) Koch nennt diesen Vorschlag "verlockend" und wischt ihn keinesfalls einfach vom Tisch. Er gibt nur zu bedenken: Musik macht man mit Tönen (bis hin zu Geräuschen) und nicht mit Gedanken. Alles Reden über Musik bleibt peripher, wenn nicht das beziehungsreiche"Spiel der Töne" in seiner eigenen Gesetzlichkeit erkannt wird. Dazu aber bedarf es einer Begrifflichkeit, die so nahe wie möglich an der Sache ist, bedarf es scharfen Hörens, wobei es geradezu unumgänglich sein kann, angelesene Vorurteile beiseitezuschieben und n u r zu hören, immer genau zu hören, was im einzelnen vorsich geht. Was aber fördert besser dieses genaue Hören als der bewußte Umgang mit Noten? Mit Hilfe der Notation erst läßt sich die Struktur eines Werkes durchschauen. Wer Wert darauf legt, Musik nicht nur emotionell und kulturkundlich zu behandeln, kann des Schriftbildes schwerlich entraten. (19f.) Auch Koch hält somit fest an dem engen Zusammenhang genaues Hören - musiknahe Begrifflichkeit Notation, welche ohne weiteres mit der traditionellen Notation gleichgesetzt wird, zu der es keine ernsthafte Alternative gebe. Auch Dörte Wiechell findet starke Argumente für eine frühzeitige Einführung in die traditionelle Notation. Sie weist zunächst darauf hin, daß das Unbehagen an der Notenschrift von verschiedenen Seiten her im Gefolge einer Diskussion um den musikalischen Werkbegriff geäußert wurde, und kritisiert dann "ideologieverdächtige Partialtöne": mancher geriet in Gefahr, sich aus dem nicht bestreitbaren bedauerlichen Tatbestand, daß über den aktiven Umgang mit der traditionellen Notation wirklich nur vermehrt 'privilegierte' Kinder verfügen, den Zugang zur sachlogischen Auseinandersetzung mit dem Phänomen verlegen zu lassen. (15/2) Sie möchte zwar die Tatsache, daß Schüler die Notation nur widerwillig und unvollkommen lernen, vor allem den folgenden vier Gründen zuschreiben: dem zu späten Zeitpunkt des Erlernens, den falschen Methoden der Darbringung, der Trägheit in der regelmäßigen Anwendung und dem mangelnden Eingebettetsein des Notenlesens in einen förderlichen Kontext (...)"(15/2), gesteht aber der Kontroverse um die Notenschrift zu, zu einem Aufbrechen der Gleichsetzung des Musikunterrichts mit einem Notenlehrgang beigetragen zu haben sowie die Befürworter und Gegner der Notenschrift dazu zu bringen, sich über die Leistungen bzw. Nicht-Leistungen von Notationen im Unterricht Rechenschaft zu geben. - Sie faßt dann die in der Debatte gefallenen Argumente knapp zusammen. Außer den bereits im Zusammenhang mit den anderen Aufsätzen erwähnten wäre hier zu nennen: die Hörbarkeits-Debatte ... den Streit darum, ob das nicht mehr Durchhörbare ästhetische Berechtigung habe. (16/2), wobei Carl Dahlhaus als Kronzeuge gegen die These vom Ausschließlichkeitsanspruch des Hörbaren in der Musik referiert wird. - Der zentrale Begriff ihrer Argumentation aber ist der der musikalischen Mündigkeit. Da schwer zu operationalisieren sei, was alles dazugehöre, geht sie von der anderen Seite heran und betrachtet, was unvereinbar mit Mündigkeit ist. Unvereinbar sei zum Beispiel, wenn der Heranwachsende unter den möglichen Funktionen, die Musik vom Mittel zur Betäubung bis hin zum Objekt geistiger Auseinandersetzung für sein Leben einnehmen könnte, nicht informiert und frei wählen kann. Wenn es aber stimmt (...), daß ein vertiefter reflektierender Zugang zu konstituierenden Elementen der Musik bis etwa 1950 (...) ohne Noten nicht möglich ist, dann verwehrt man dem heranwachsenden Kind diesen Zugang zur Musik durch die Beschneidung um die Lernchance Notation. (17/2) Unvereinbar mit musikalischer Mündigkeit sei ebenfalls, wenn jemand für seine Freizeit nicht frei entscheiden könne, ob und welche Musik er spielen oder singen möchte, wenn ihm das Spielen gänzlich unmöglich sei (weil er keine Noten lesen kann) und beim Singen auf das Vorsingen anderer angewiesen sei. Mithin muß man sich darüber im klaren sein, daß man mit der Entscheidung gegen das Einführen der musikalische Standard-Notation in der allgemeinbildenden Schule folgende Möglichkeiten autonomer Freizeitgestaltung in späterer Zeit für den jungen Menschen empfindlich stört, wo nicht unmöglich macht: - Musizieren im konventionellen Bereich bei selbstgesteuerter inhaltlicher Auswahl; - sachverständiges Verfolgen kompositorischer Absichten beim Hören; - visuell gestütztes Memorieren und Imaginieren musikalischer Vorgänge im traditionellen Bereich; (...) - Lustgewinn und Stolz beim Erkennen kompositorischer Absichten und Beurteilen ihrer aktuellen Realisation." (18/1) Eine Sache nicht perfekt zu beherrschen und sie nicht in früher Zeit zumindest kennengelernt zu haben, so daß man die Scheu vor ihr verlieren konnte, ist aber gewißlich zweierlei. (18/1) Sie verweist darauf, daß häusliche Sozialisation, Milieudruck und emotionale Stabilität wesentlich wichtiger für die musikalische Zukunft des Heranwachsenden sind als die Qualität des Musikunterrichts. Aber nachdem erwiesen zu sein scheint, daß die Familie das Hinführen zu den genannten Möglichkeiten autonomer Freizeitgestaltung nicht mehr oder nur mehr für wenige leistet, ist die Schule die einzige Institution, in der Bekanntschaft mit solchen Kulturtechniken (...) gemacht werden könnte. Man muß das Argument vom bevorzugten Verfügen einiger weni- ger Privilegierter sogar umdrehen und sagen, hier müsse kompensatorisch dafür gesorgt werden, daß der Zugang zur vertieften Auseinandersetzung mit Musik in Reproduktion, Rezeption, Reflexion und Transposition grundsätzlich allen zur Verfügung steht und nicht länger ein Schichten voneinander scheidendes Merkmal bleibt. Daß die Schule im anderen Fall auch das Absterben ganzer Reihen von musikbezogenen Berufsmöglichkeiten - vom Orchestermusiker bis zu Tonmeister und Musikalienhändler - mitzuverantworten hätte, sei nur am Rande miterwähnt. (18/1-2) Schließlich kommt Wiechell auf den pragmatischen Aspekt des Notenlernens zu sprechen, der wesentlich von der Frage nach Alter und Vorerfahrung der jeweiligen Lerngruppe bestimmt werde. Während das Erlernen der Notenschrift in der Vor- oder Grundschule auf großes Interesse stoßen dürfte - vergleichbar dem an Geheimschriften und -sprachen - stelle das Erlernen der Notenschrift für Dreizehnjährige eine kognitive und affektive Unterforderung dar. In der siebten Klasse erstmals mit Notenlernen zu beginnen, ist oft höchst gefährlich, weil es die letzte Motivation gründlich verjagt (...) (18/2). Anders sei es mit dem notwendigen Üben vorhandener Fähigkeiten, das auch oft lästig erscheine, und das einer Kulturtechnik gelte, die sich nicht eines besonders hohen gesellschaftlichen Stellenwertes erfreue. Aber genau, wie der Alltagsmensch in anderen Bereichen gern auf Techniken verzichten würde, die Mündigkeit herbeiführen könnten (...), und doch von der verantwortungsbewußt agierenden Schule möglichst an diesem kurzsichtigen Verzicht gehindert wird, genauso darf sich ein Fach in dieser Schule, das für den Sektor verantwortlich ist, der vielleicht von allen Schulfächern am tiefsten in die Persönlichkeitsstruktur des Heranwachsenden eingreift, nicht eines technischen Hilfsmittels voreilig entschlagen, dessen Leistungen bei aller Relativierung noch durch kein besseres übernommen worden sind - selbst dann nicht, wenn's unbequem ist. (19/1) Auch Wilfried Fischer (1976) hält die traditionelle Notation für unverzichtbar. Er äußert weitgehende Kritik an Frisius und bezweifelt, daß man aus der Tatsache, daß die meisten Partituren Realisationspartituren seien, didaktische Konsequenzen für den Umgang mit traditioneller Notation im Musikunterricht ableiten sollte. Im Hinblick auf andere Notationsformen sieht er jedoch keinen Gegensatz zu Frisius: Zunächst sei jedoch betont, daß die von Frisius zitierte und bekräftigte Forderung Ulrich Günthers, Notation im Musikunterricht nicht ausschließlich als traditionellen Notenlehrgang zu verstehen, sondern andere Notationsformen einzubeziehen (verbale Partitur, grafische Partitur etc.), volle Unterstützung verdient: gegenteilige Vorstellungen würden in der Praxis fast zwangsläufig darauf hinauslaufen, daß mit den Notationsformen auch das Hörangebot eingeschränkt und damit der Verfestigung und Kanalisierung von Hörerwartungen und -einstellungen Vorschub geleistet würde. (11/1) Es gehe also nur darum, in welchem Umfang und in welcher Form die traditionelle Notation eingeführt werden sollte. Nach Aebli13 bestehe ein "wesentliches Ziel aller Bildungsprozesse darin, den Schüler die Sprachen erwerben zu lassen, welche den verschiedenen Bereichen des kognitiven Verhaltens zu geordnet sind (Wortsprachen, technische Sprachen, Schriften der Mathematik und der Naturwissenshaften, Musiknoten, phonetische Schriften usw.)" Daher werde man "auf eine detaillierte Behandlung der überlieferten Notationsformen schon deshalb nicht verzichten können, weil sich wesentliche, für ein adäquates Hören von Musik unabdingbare Begriffe erst im Zusammenhang mit ihrem visuellen Korrelat erschließen, so z.B. Bitonalität, Cantus firmus, Diatonik und Chromatik, modale Skalen, Engführung, Forstspinnung, Kontrapunkt, komplementäre Rhythmik, Instrumentation, Modulation usw. "(11/2) 13 Aebli, Hans, Die geistige Entwicklung als Funktion von Anlage, Reifung, Umwelt- und Erziehungbedingungen, in: Deutscher Bildungsrat, Gutachten und Studien der Bildungskommission Band 4: Begabung und Lernen, hrsg. v. Heinrich Roth, 5.Aufl. Stuttgart 1970, S. 157, zit. nach Fischer 1976 Für einen Notenlehrgang in der Grundschule gebe es daher folgende Argumente: - Komplexe, also auch klassische Werke müßten als Gegengewicht gegen die Reizüberflutung den Schülern angeboten werden; dazu sei die Fähigkeit zum adäquaten Hören nötig, welches nicht ohne affektive Bindung möglich sei; diese aber hänge vom Bekanntheitsgrad und damit von der Häufigkeit des Hörens ab. Ein solches mehrfaches konzentriertes Hören sei nur in Verbindung mit Partituren möglich. - Außerdem sei durch die Einbeziehung von Notenbildern ein häufiger Methodenwechsel möglich, der besonders in der Grundschule erforderlich sei. - Außerdem erleichtere die traditionelle Notation das Verständnis der Fachsprache und rege zur Verbalisierung musikalischer Phänomene an. Schließlich stehe die verwendete Notationsform in engem Zusammenhang mit der Musik, die in ihr aufgeschrieben sei und erleichtere so den Zugang zu ihr. Nach einer Entscheidung für einen traditionellen Notenlehrgang in der Grundschule müssen curriculare bzw. didaktisch-methodische Entscheidungen getroffen werden: Soll die traditionelle Notation am Anfang des Musikunterrichts stehen oder soll sie durch Vornotationen (Luftschrift, relative Zeichen o.ä.) vorbereitet werden? Soll sie auf synthetischem Wege eingeführt werden, d.h. beginnend mit Einzelton, Zwei- und Dreitongruppen, oder auf analytischem Wege, d.h. anhand von vollständigen Notenbildern, deren Tonvorrat gesammelt und nach bestimmten Kriterien geordnet wird (...)? Soll der Notenlehrgang im Sinne kontinuierlicher Progression oder spiralförmig (Wiederholung des Gleichen auf einem jeweils höheren Abstraktionsniveau) angelegt werden? (12/2) Fischer plädiert für ein Modell, das von der schleswig-holsteinischen Projektgruppe Grundschule, Fachbereich Musik14, erarbeitet wurde. Danach soll, nachdem im 1. und 2. Schuljahr Vorerfahrungen im Bereich musikalischen Zeichen gesammelt wurden, im 3. und 4. Schuljahr - neben anderen Lerninhalten in zwei Lernsequenzen ein traditioneller Notenlehrgang durchgeführt werden. Hierbei soll nicht vom Einzelton, sondern von der Ganzheit der chromatischen Tonleiter ausgegangen werden. Wichtigstes Medium sei dabei eine Papp-Klaviertastatur über zwei Oktaven, die zur Veranschaulichung der Verhältnisse der chromatischen Skala diene. Fischer bewertet also traditionelle und graphische Notation unterschiedlich: graphische Notationsformen haben vor allem propädeutische Funktion, ihnen wird zum Beispiel keine begriffsbildende Funktion zugeschrieben. Auf der anderen Seite hält er sie für geeigneter, um erste Erfahrungen mit dem Notieren von Musik zu sammeln. - Soweit übrigens an den Beispielen erkennbar ist, scheint Fischer das Hauptaugenmerk auf den Aspekt der Tonhöhennotation zu richten; von der Vermittlung der Rhythmusnotation ist jedenfalls nirgendwo die Rede. Auch Hermann Große-Jäger stellt 1977 ein integrierendes Konzept vor, in dem traditionelle und graphische Notation gleichermaßen ihren Stellenwert haben. Er geht von der Frage aus, wie das Erlernen der Notenschrift in der allgemeinbildenden Schule zu legitimieren sei, und nennt drei Argumentationsebenen: - Kulturhistorisch läßt sich argumentieren, daß das Begreifen der europäischen Musikkultur ohne deren wichtigste Errungenschaft, die Notenschrift, nicht möglich sei. Hieraus läßt sich aber nicht ableiten, wie umfangreich und welcher Art die Kenntnisse und der Gebrauch der Notenschrift sein müssen. - Notation kann eine bewußte Auseinandersetzung mit Musik veranlassen und vertiefen. - Notation hat neben der Sprache und Gebärden eine wichtige Funktion für die Kommunikation über Musik, die beim Klassenunterricht zwingend erforderlich ist. Sie dient außerdem als Gedächtnisstütze. 14 Mitglieder: Wilfried Fischer, Erich Hansen, Jens Jacobsen, Martin Schulz Die angeführten Argumente begründen allerdings den Einsatz von Notation im Unterricht nur allgemein; sie erlauben weder die Auswahl einer bestimmten Notationsform noch eine Entscheidung der Frage, ob eine lehrgangsmäßige Einübung der Notenschrift sinnvoll erscheint. Denn das Erlernen der Notenschrift ist kein Selbstzweck und kein absolut zu setzender Faktor von Musikunterricht. Vielmahr kannn man ihn nur im Zusammenhang mit und in Bezug auf die jeweils angestrebten Ziele und die gewählten Inhalte eines Musikunterrichts legitimieren. (...) Es mag daher zu einer differenzierten Sicht dienlich sein, Funktionsfelder zu unterscheiden, in denen das schriftlich fixierte Bild von Musik einen jeweils anderen pädagogisch-didaktischen Stellenwert hat. (41/2) Hierzu ist ein erweiterter Notationsbegriff erforderlich, der zum einen die Notationsbedürfnisse zeitgenössischer und außereuropäischer Musik berücksichtigt, zum anderen aber aus didaktischen Gründen graphische Notation, Hörpartituren etc. einbezieht. Es hat sich gezeigt, daß die Befähigung zum Hören von Musik nicht unbedingt verlangt, daß der Schüler dieselbe Musikschrift verstehen können müsse, mit deren Hilfe der ausführende Musiker ein Musikstück realisiert. Zumindest zur anfanghaften Verständigung kann das Aufschreiben von Musik mittels verabredeter Symbole, ikonischer Zeichen und mittels Farbe eine angemessene Hörhilfe sein. (42/1) Große-Jäger nennt sechs Funktionsfelder, in denen Notation als Unterrichtsfaktor eine Rolle spielt; drei davon stehen in Verbindung mit dem Musikmachen, die anderen drei mit dem Musikhören. 1. Notation von Klangexperimenten Das Experimentieren mit Klängen zielt neben der Entfaltung schöpferischer Kräfte auf das entdeckende Lernen an musikalischen Abläufen. (42/1) Auf diese Weise wird gelernt: Musik kann aufgeschrieben werden mittels verabredeter Zeichen; nur wer die Verabredung kennt, kann nach den Zeichen Musik machen; jene Zeichen sind die besten, die die Musikart am genauesten wiedergeben; ein Symbol kann mehrere musikalische Charakteristika bezeichnen (z.B. Klangfarbe und Lautstärke); wenn man Musik aufschreibt, ist sie besser wiederholbar. Es scheint, daß solche Lernziele durch das Mittel des Aufschreibens eigener Klangexperimente am besten erreicht werden können. (42/2) Einsichtig ist, daß Notationsversuche eigener Klangexperimente Verständnis und Gebrauch von Notationsarten moderner (42/2) Musik vorbereiten und erleichtern. (43/1) 2. Instrumentalspiel nach Noten Auch hier wird wieder deutlich, daß der Stellenwert der Notation nur zu bestimmen ist, wenn Klarheit über die Ziele besteht, die das Instrumentalspiel anstreben soll. Heißt das Ziel: Instrumentalspiel als Mittel zur Förderung musikalischer Äußerung und Kreativität, dann hat eine bestimmte Art von Notation eine untergeordnete Rolle. Heißt das Ziel: Der Instrumentalist soll befähigt werden, tradierte Musikwerke zu musizieren, dann steht das Spiel nach Noten im Mittelpunkt der Bemühungen. (43/1-2) Große-Jäger weist im Anschluß an diese Überlegungen auf die unterschiedliche Schwerpunktsetzung in allgemeinbildender Schule und Musikschule hin: Für den Musikunterricht an Grundschulen kann nicht der gleiche Stellenwert der Notenschrift gelten wie für Musikschulen. Für die allgemeinbildende Schule wird ein exaktes vokales und instrumentales Musikzieren nach Noten als Fernziel schwerlich zu begründen sein. ( 43/2) 3. Singen nach Noten Hier sind zunächst zwei Verfahren zu unterscheiden: das analytisch-synthetische, das mit kleinen melodischen Bausteinen wie Rufterz, Tritonik etc. beginnt und dann zu Dur, Moll und Kirchentonarten gelangt, die im Notenbild erkannt werden und dann gesungen werden sollen, und das "ganzheitliche", das auf Heinrich Pape [Der ganzheitliche Weg im musikalischen Anfangsunterricht, 1959] zurückgeht und vom Liedganzen ausgeht, das zunächst gesummt, in eine Luftschrift übersetzt und dann im Notenbild wiedergefunden wird. Große-Jäger diskutiert dann ausführlich die Frage des Vom-Blatt-Singens in der Schule, wo der Lehrer es mit einer im Hinblick auf gegenwärtige und zukünftige musikalische Interessen und Schwerpunkte heterogenen Lerngruppe zu tun hat: In dieser Situation dürfte Singen nach Noten soweit begründbar sein, als es die Fähigkeit zur Bildung annähernder Tonvorstellung fördert, die auf verschiedene Arten des Musikmachens und -hörens transferiert werden kann. Damit verlagert sich die unterrichtliche Funktion des Notationsgebrauchs beim Singen: Nicht die Heranbildung zukünftiger Chorsänger ist das Ziel - wenngleich das nicht gänzlich ausgeschlossen bleibt - , sondern die Fähigkeit, auch auf diesem Wege inneres Hören durch Tonvorstellungen zu fördern, die bei jedweder Art des Umgangs mit Musik hilfreich sind. (45/1) 4. Notation von Umweltklängen Große-Jäger nennt einen wichtigen Grund, der dafür spricht, erste Notationsversuche anhand von Umweltklängen zu unternehmen: Diese akustischen Ereignisse sind allen Kindern zugänglich: das Lernen geschieht situationsorientiert. Da es zum Hören dieser Geräusche und Klänge keiner Vorbildung bedarf, befinden sich alle Schüler in einer gleichen Ausgangssituation. (45/1-2) Er warnt jedoch davor, eine Hörerziehung anhand von Umweltklängen in ihrer Wirksamkeit zu überschätzen: es sei "noch nicht erwiesen, daß Hörerfahrungen, die an Geräuschen etc. gewonnen wurden, auf das Hören komponierter Musik übertragbar sind" (45/2). Dazu komme, daß Alltagsgeräusche nicht sehr motivierend wirken. Er referiert Heinz Meyer, der eine intensive Beschäftigung mit Umweltklängen, wie sie die auditive Wahrnehmungserziehung kennzeichnen, für inhuman hält; erstrebenswert sei eher die Fähigkeit, sich von der Hörwelt, die uns täglich umgibt, bewußt abzuwenden. 5. Hören mit Noten Große-Jäger bezieht sich hier ausführlich auf Venus, dessen Ansatz er auf andere Notationsformen erweitert. Er referiert auch die Frisiusschen Einwände, läßt sich aber auf eine Ausschließlichkeit einer Notationsform nicht ein: Wenn man aber grundsätzlich zustimmt, daß optische Hörhilfen ihren unterrichtlichen Sinn haben, dann dürfte gerade die gegenseitige Ergänzung beider Schreibarten von Musik beim fortschreitende, differenzierenden Hören hilfreich und notwendig sein. (46/2) 6. Hören mit Hörpartituren In einer Hörpartitur halten wir jene musikalischen Strukturelemente fest, die einer Lerngruppe beim Hören besonders auffallen oder solche, die zu erarbeiten Aufgabe des Unterrichts ist. (46/2) Die Hörpartitur ermöglicht auch dem einen Zugang zu Kompositionen, der keine speziellen Kenntnisse des vom Komponisten gebrauchten Notationssystems besitzt. Die Vorteile der Hörpartitur sind zugleich ihre Nachteile. Wenn es darum geht, über Details sich Klarheit zu verschaffen, muß sie versagen. Hier wird sie auch im Unterricht ergänzt durch die Originalpartitur. Zumindest sollte der Lehrer dann zu erkennen geben, daß auch er musikalische Einzelheiten nicht allein und nicht immer sicher aufgrund seines Hörens erkennt, sondern weil er die Original-Partitur zu lesen versteht. (46f.) Ein typischer Unterrichtsverlauf könnte nach Große-Jäger etwa so aussehen: (a) Nach dem ersten Hören werden Eindrücke verbaliter geäußert und festgehalten. (b) Die Aufmerksamkeit richtet sich auf Möglichkeiten, das musikalische Geschehen zu gliedern. Hier entsteht bereits eine erste, sehr einfache und noch lückenhafte Graphik. (c) Einzelheiten, die bei mehrfachem Hören erkannt werden, können nun in diese erste Graphik eingetragen werden. Dabei kann das Notationsschema verbessert werden. Dies kann auch in Gruppen geschehen, die die Ergebnisse später zusammentragen. (d) In einem letzten Schritt kann das Stück mit der vollständigen Hörpartitur, die nun Mitlesepartitur wird, verfolgt werden. (47) 2.7. Neuere Stellungnahmen zur Notation in der allgemeinbildenden Schule In einem - übrigens sehr lesenswerten und differenzierten - Handbuchartikel hat Hans Rectanus 1994 versucht, den Stellenwert verschiedener Notationsformen im Musikunterricht aus heutiger Sicht zu bestimmen: Unbestritten ist heute die Forderung nach einem Umgang mit dem Schriftbild der Musik im Musikunterricht (...). Allerdings besteht zwischen den jeweiligen Zielvorstellungen des Musikunterrichts und dem Stellenwert und der Funktion der N[otation] ein Wechselverhältnis: in einem Musikunterricht, in dem Lied und Singen fast einzige Inhalte sind, spielt das Lernfeld Notation eine andere Rolle als in einem Musikunterricht, der auch das Musikhören und Improvisieren als wichtige Inhalte einschließt. (...) Einige Notationsformen eignen sich als Vorlage für eine präzise Reproduktion und als Grundlage für eine genaue Analyse. Die sogenannte grafische N[otation] mit ihrem hohen Anteil an ikonischen Zeichen erschließt sich dem Verständnis unmittelbar und wird insbes[ondere] als Hörhilfe (...), zur Fixierung von Höreindrücken in Verlaufsskizzen und als Anregung zum Improvisieren eingesetzt. Die Verbalnotation hält Eindrücke, Assoziationen, Einsatzfolgen von Instrumenten u.a. protokollartig (Hörprotokoll) fest. Der Forderung nach einem flexiblen Umgang mit N[otation] werden die auf Ergänzung und Weiterentwicklung angelegten Arbeits- und Rahmenpartituren gerecht, mit denen die Schüler operativ umgehen können (...) Uneinigkeit herrscht jedoch darüber, bis zu welchem Intensitätsgrad Kenntnisse und Fähigkeiten in der herkömmlichen Notation zu fordern sind. (208) In seinem Artikel Nicht eine, viele Notationen für die Schule (1990) fragt er, welche Erwartungen hinter dem schon fast alltäglichen Gebrauch der sog. graphischen Notation im schulischen Alltag stehen. Und weiter: Hält der Einsatz dieses didaktischen Mittels den Ansprüchen stand, die an es herangetragen werden, nämlich insbesondere - für alle Schüler mögliche Zugansgswege zu einer Musik anzubieten? - eigenständige und kreative Annäherung an Musik zu ermöglichen? - Basisunterlagen schriftlicher Art zu schaffen, die Grundlage für die weitere Beschäftigung mit der nun auch schriftlich vorhandenen Musik sein können? (18/1) Die positiven Erfahrungen mit dieser Art Notation sollten Anlaß zum Nachdenken über mögliche Verbesserungen sein: Insbesondere ist immer wieder das Verhältnis von traditioneller Notation zu diesen sog. graphischen Notationen (...) neu zu bestimmen, und dies nicht im Sinne eines Entweder-Oder, sondern vielmehr eines funktional geregelten Nebeneinanders. (18/2) Hier scheint sich für die musikdidaktische Forschung der nächsten Zeit ein Gebiet aufzutun, nämlich den Pluralismus der Notationen in ihrer Wechselseitigkeit und Bezogenheit zu bestimmen und ihr je eigenständiges Leistungsvermögen bezüglich einer Veranschaulichung von Musik zu beschreiben und diese präzisierend voneinander abzugrenzen. (18/2) Rectanus nennt drei Begründungszusammenhänge, "die für die unabdingbare Präsenz der Schriftlichkeit in ihren verschiedenen Ausprägungen im Musikunterricht sprechen und sie kategorisch fordern" (18/3): - lernpsychologisch (Hören in Verbindung mit Sehen ist effektiver) - wahrnehmungstheoretisch (Notation überwindet die Vergänglichkeit des Schallreizes) - kulturhistorisch (unsere Musikkultur ist auch eine Schriftkultur; Notation ermöglicht z.B. das Arbeiten an Musik, wie etwa an Beethovens Arbeitsweise [Skizzenbücher] deutlich wird) Er besteht aber auf einem Pluralismus der in der Schule verwendeten Notationsformen: Wenn es dem hörenden Schüler erlaubt sein soll, seinen Eindruck von Musik (und nicht alles Hörbare) in eigenständiger schriftlicher Form aufzuzeichnen, dann kann es in diesem Zusammenhang auch nicht mehr nur eine Notationsart geben, sondern ein breites Repertoire von Notierungsweisen, von denen jede das hörbare Ereignis in charakteristischer Weise perspektiviert und die zudem wegen ihrer verschiedenen Funktionen nicht beliebig austauschbar sind. (19/3) Daß solch offenes Denken dem Musikunterricht guttut, zeigen die erfrischende Vielfalt der drei Hörpartituren, die Schüler einer Vorschulgruppe und einer 3.Klasse von demselben Stück (J.S.Bach, Weihnachtsoratorium, 1.Kantate, Schlußchoral Nr. 9) angefertigt haben. Gefordert ist hier vor allem vom Lehrer, der in der Lage sein muß, die jeweilige Perspektive der Schüler zu erkennen, damit es einerseits nicht zu entmutigenden negativen Beurteilungen von unkonventionellen Notationsweisen kommt, andererseits aber auch nicht zu dem genauso ungünstigen Anschein, daß jedes irgendwie geartete Bild schon eine Hörpartitur sein kann. Enttäuschend ist dagegen Ulrich Günthers Handbuchartikel von 1991, in dem wohl - wie ein Blick in den Anmerkungsteil befürchten läßt - die musikpädagogische Diskussion zur Rolle der Notation im Unterricht der allgemeinbildenden Schule nur bis 1973 berücksichtigt wird. - Günther beginnt mit einer historischen Skizze, die die Anfänge der Notenschrift relativ ausführlich, den Übergang von der Mensuralnotation zur modernen Notation dagegen sehr knapp und überdies z.T. unrichtig darstellt: Die wenigen Linien mit wechselndem Schlüssel reichten nun nicht mehr aus und wurden auf elf Linien erweitert (...) (47) Es handelt sich nicht um einen Druckfehler, denn später resümiert Günther: Soweit heute zu erkennen ist, wurde jedoch das Ziel, im Schulmusikunterricht die Schüler zum Beherrschen, zumindest zum Verstehen der Elfliniennotation zu führen, nicht erreicht; und ich bezweifle, daß es sich - im Rahmen und unter den Bedingungen des schulischen Musikunterrichts, der im übrigen viele Aufgaben zu erfüllen hat - je erreichen läßt. (50), Hier ist zu fragen, ob nicht die Pädagogisierung der Sache zumindest zum Teil an solchem Mißerfolg schuld ist. Denn was verbirgt sich hinter der "Elfliniennotation"? - Gemeint ist ein Doppelsystem mit Violin- und Baßschlüssel, wobei oberes und unteres System so nah aneinandergerückt werden, daß die Hilfslinie für das c' für beide Systeme zusammenfallen. Welches aber sind die pädagogischen Auswirkungen solcher Begrifflichkeit? - Für einen kritischen Schüler, der sich auf seine eigenen Augen verläßt, nachzählt und auf zehn Linien kommt, bestätigt sich wahrscheinlich der Verdacht, daß die Musiker eben doch einen eigenen Zirkel bilden, in den sie die anderen ungern hineinlassen. Ein Blick in ein einschlägiges Musiklexikon, das keine Klärung bereithält, bestätigt dies. Der musikalisch gebildete Schüler dagegen weiß, daß diese Art der Notation außerhalb der Schule nicht verwendet wird - nicht einmal zur Notation von Klaviermusik, auch hier wechselt der Systemabstand je nach Bedarf - und schweigt weise. - So verliert der Musikunterricht zwei wichtige Schülergruppen. Andere Stellen deuten darauf hin, daß die Differenzierungsfähigkeit des Autors gegenüber 1965 nachgelassen hat: Vereinfacht ausgedrückt dient die Notation einem Komponisten dazu, den Reproduzenten (...) Anweisungen (...) zu geben, damit die Musik entstehen kann, die der Komponist sich vorgestellt hat. (50) Notation [allgemein, nicht etwa beschränkt auf traditionelle Notation, C.H.] dient dem Musikmachen (...). (51) Autonomie des Notats, Deutung, Analysieren, inneres Hören, Mitlesen - all das scheint vergessen. - Die von Günther dargestellten didaktischen Folgerungen aus dem "grundlegenden und auch theoretisch weiterführenden Ansatz" (49) von Frisius gehen über dessen Darstellung nicht hinaus; auf sie wird daher an dieser Stelle nicht nochmals eingegangen. Dagegen erfordert der umfangreiche zweiteilige Aufsatz, in dem Hermann J. Kaiser sich kürzlich dem Thema Notation zugewandt hat, eine ausführlichere Darstellung. Ihm geht es vorrangig um ein Problem, das weit über das Thema Notation, ja sogar weit über das Fach Musik hinausgeht: Didaktische und curriculare Vorstellungen mit universalistischem Anspruch übersehen, daß Kinder und Jugendliche (...) eine je eigene Lernbiographie haben. (...) Der Differenzierungsgrad unserer gegenwärtigen Welt ist derartig hoch, daß universalistische Ansprüche von Bildungsinstitutionen und den dazu gehörigen Bildungstheorien nicht eingelöst werden können. (...) Diese Überlegungen führen zu der Überzeugung, daß eine musikdidaktische Theorie mit universellem Anspruch sich heute nur noch als Meta-Theorie formulieren läßt, nämlich als Theorie darüber, wie musikdidaktische Theorien im engeren Sinne zu entwickeln sind. (...) Eine solche Meta-Theorie hat den theoretichen Status einer "regulativen Idee" (...) Daraus folgt, daß musikdidaktische Theorien im herkömmlichen Sinne nur noch differentiell denkbar sind. Man muß in Rechnung stellen, daß sie miteinander in Konflikt geraten können, höchstens noch partiell miteinander verträglich sind oder auch völlig unabhängig voneinander gedacht und gebildet werden. (I,78/1-2) Diese Überlegungen konkretisiert Kaiser am Beispiel der "schriftlichen (Re)Präsentation von Musik". Zentral ist dabei der Begriff der "musikbezogenen Erfahrung": Der Erfahrungshorizont von Schülerinnen und Schülern wird zu jenem Punkt, an dem musikdidaktische Theorien ansetzen; er wird aber auch zum Ort der Begründung für die weitere Ausformung musikdidaktischer Vorstellungne und Konzeptionen. (80/1) Nachdem Kaiser verschiedene Modelle zum Erfahrungsbegriff dargestellt und kommentiert hat - u.a. Ehrenforth/Richter, Jank/Meyer/Ott und Nykrin - unternimmt er den Versuch, wesentliche Elemente musikbezogener Erfahrung zu benennen und zu einer strukturell-relationalen Vorstellung musikbezogener Erfahrung zusammenzuführen. Er geht dabei von dem aristotelischen Erfahrungsbegriff aus und erweitert diesen. Danach ist Erfahrung Wissen um Einzelnes, Besonderes, das eingebettet ist in ein Kontinuum von Erfahrungen und mit anderen Erfahrungen einen "Erfahrungsschatz" bildet. Erfahrungen sind einem steten Wandel unterworfen, beziehen sich auf Erinnerungen an Vergangenes ebenso wie auf zukünftiges Handeln und sind stets mit konkreten Orten und sozialen Räumen verbunden. Für musikbezogene Erfahrung gilt darüber hinaus die Reflexivität ästhetischer Erfahrung: die Aussage, ein Musikstück sei schön, sagt nicht über das Musikstück etwas aus, sondern über mein Verhältnis zu ihm. Weiterhin bewahrt nur die axiologische Dignität, also die Wertigkeit, die ich einer Erfahrung beimesse, diese vor dem Vergessen. Schließlich hat auch musikbezogene Erfahrung einen pragmatischen Kern: sie ist verantwortlich dafür, wie wir später mit Musik umgehen. Ein solcher Erfahrungsbegriff eignet sich nicht für generalisierende didaktische Aussagen. Dieses hat zur Folge, daß die normalerweise auf Unterrichts-, Lern-, Erziehungs- oder Bildungsziele zielende didaktische Fragestellung reformuliert werden muß: "Wie muß der Erfahrungsraum von Kindern und Jugendlichen einer bestimmten Altersgruppe, in einem bestimmten sozialen Milieu, an einer bestimmten Schule usw. strukturiert sein, daß [wohl eher: "damit", C.H.] die Beschäftigung mit bestimmten Sachverhalten, hier der schriftlichen (Re)Präsentation von Musik, subjektiv als gegenwärtig wichtig, für zukünftiges Handeln hilfreich und subjektiv befriedigend empfunden wird, so daß sie (die Kinder und Jugendlichen) in einer durch ihren Institutionencharakter häufig so belasteten Institution wie jener der allgemeinbildenden Schule sich auf ihn [wohl eher: "sie" (die Sachverhalte), C.H.] einzulassen bereit sind?" (83/1) Im zweiten Teil seines Aufsatzes geht Kaiser auf die Wertigkeit ein, die einem Gegenstand, der im schulischen Musikunterricht behandelt wird, objektiv beigemessen wird, unabhängig davon, ob er durch Vorschlag der Schüler oder des Lehrers oder durch Vorgabe der Rahmenpläne dort behandelt wird; diese orientiert sich an der gesellschaftlichen Vordefinition des Gegenstandes. - Bei der Beantwortung der Frage: "was ist und welche Funktion hat schriftliche (Re)Präsentation von Musik? "lehnt er sich im wesentlichen an Frisius, Moles und Günther an. Darüberhinaus nennt er vier Kategorien, unter denen sich das Ver- hältnis von Schriftbild und Musik erfassen lasse: das zeitliche Verhältnis führt auf die Unterscheidung von prä- und deskriptiver Notation; die Beziehung zu musikalischem Verhalten führe zu den Begriffen Rezeptions-, Produktions- und Reproduktionsnotation; weiterhin lasse sich Notation als Instrument zur Vermittlung, zur Deutung und zur Dokumentation begreifen; schließlich werde - vor allem durch bestimmte Formen der Graphik - die innere Konstruktion bzw. Konstitution der Musik abgebildet. Nach diesen umfangreichen Präliminarien kommt Kaiser nun zu der Leitfrage seines Aufsatzes: Welche jugendlichen Subjekte können und wollen überhaupt einen derartig komplexen Sachverhalt erfahrungsbildend und damit bildungsbedeutsam nutzen?(...) Wie lassen sich die konstitutiven Elemente (der Bildung) von musikbezogener Erfahrung von Kindern und Jugendlichen auf den historisch-gesellschaftlich definierten Gegenstand 'Notation' in einer Weise beziehen, daß daran neue musikbezogene Erfahrungen entstehen (können)? (144-145) Bei der Beantwortung dieser Frage wird jedoch ein Problem deutlich: Wenn musikbezogene Erfahrung das Kriterium für die inhaltliche und formale Organisation von musikbezogenen Lernprozessen, aber auch von deren Kritik bildet, dann müßten wir bei musididaktischen Aussagen und Planungen immer nur von ganz konkreten Kindern und Jugendlichen ausgehen, keinesfalls von dem Kind oder dem Jugendlichen. Hier geraten wir nun in eine Schwierigkeit: Wir können an dieser Stelle nicht bei einer konkreten Klasse, bei konkreten Individuen ansetzen; wir könnten diese für unseren gedanklichen Zusammenhang höschstens simulieren. Der damit verbundenen Gefahr des 'Sandkastenspiels' wäre dann aber kaum noch zu begegnen. Folglich sind wir zu besonderer Vorsicht und Bescheidenheit verpflichtet. Wir können hinsichtlich des Zusammenhangs von schriftlicher (Re)Präsentation von Musik und Erfahrungsbildung hier eigentlich nur Fragen formulieren und Hinweise grundsätzlicher Art über diesen Zusammenhang geben. Noch genauer, wir können nur formulieren, wie man als Organisator/-in von musikbezogenen Lern- und Erfahrugnsbildungsprozessen zu fragen hat, wenn man schülerorientiert, und d.h. durch das Kriterium der musikbezogenen Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen geleitet, Unterricht inszenieren will. (145/2) Für den Lehrer als Organisator von Lernprozessen stellt sich zusätzlich das Problem, daß in der Institution Schule die Lerngegenstände in der Regel nicht durch die Lernenden in den Lernprozeß hereingetragen werden oder zumindest von ihren Voraussetzungen aus geplant werden, sondern - z.B. durch Rahmenpläne - von außen vorgegeben werden. Damit nun überhaupt Erfahrungen gebildet werden, muß zunächst dafür gesorgt werden, daß das zu erwerbende Wissen nicht neutral und damit für die Erfahrungsbildung irrelevant bleibt, sondern für den Schüler selbst relevant und damit "interessiertes Wissen" wird. Dies bedeutet für schriftliche (Re)Präsentationen von Musik, daß ein Bezug sowohl zu voraufgegangenen wie auch zu antizipierten Handlungsmöglichkeiten der Schüler hergestellt werden muß: Als jemand, der mit Formen der schriftlichen (Re)Präsentation von Musik unzugehen vermag, schaffe ich mir neue und vertiefte Zugriffsöglichkeiten auf Musiken. (Ich kann sie u.U. intensiver hören, instrumental reproduzieren, mich mit anderen Menschen besser verständigen usf.) Diese mir zuwachsenden Möglichkeiten machen aus mir jemanden, der ich zuvor nicht war. (146/2) Erfahrungsbildende Lernprozesse greifen also in das Leben anderer Menschen ein. Das zwingt zu zweierlei: Respekt auch vor denjenigen, die 'nicht das lernen wollen, was wir vielleicht für sinnvoll und notwendig erachten' und Abweisung von falschen Anspruchen, die u.U. sogar auch in Lehrplänen und Richtlinien formuliert werden. (146/2) Die Beurteilung der Bedeutsamkeit von Erfahrungen erfolgt zum einen auf dem Hintergrund eines "mitlaufenden Weltmodells", in das sie eingefügt oder von dem aus sie verworfen werden können, zum zweiten auf der Basis eines "Bildes der eigenen Zukunft", das die Subjekte in sich tragen, und das sie zuvor erworben haben müssen, und schließlich aufgrund von Prozessen, die hirnphysiologisch im limbischen System zu lokalisieren wären, die Sinneseindrücke als befriedigend oder Unlust erzeugend bewerten. Nur wenn Musikunterricht in seiner je spezifischen und das heißt, an bestimmte, ganz konkrete Schülerinnen und Schüler gebundenen Vergangenheit dafür gesorgt hat, daß die für die Bildung musikbezogener Erfahrung existentiellen 'mitlaufenden Weltmodelle' eine antizipierte musikbezogene Praxis enthalten, die dann von Antizipation in Wirklichkeit übergeht und der 'Erfahrung gemäß' sinnvoll, u.U. auch beglückend gemeistert wird, dann hat erfahrungsbezogener und Erfahrungen bildender - das aber heißt: schülerorientierter Musikunterricht - sehr viel erreicht. Das heißt aber andererseits auch, daß die visuelle (Re)Präsentation von Musik 'kein Thema sein darf', wenn diese in der Vergangenheit für junge Subjekte keine handlungsrelevante Rolle gespiellt hat und - aus der Sicht der Subjekte - dieses auch zukünftig für sie nicht spielen wird. Dieses als Lehrer/-in ohne Angst und Resignation, ohne schlechtes Gewissen gegenüber Lehrplanvorgaben usf. anzunehmen, zeigt allerdings in derselben Weise, daß schülerorientierter Unterricht viel erreicht hat. (147/1-2) Kaiser will nach eigener Aussage mit diesem Aufsatz vor allem Mut machen: zum einen zur Gelassenheit gegenüber institutionellen Regelungen und deren teilweise falschen Ansprüchen sowie zur Mißachtung kulturpessimistischer Optionen, zum anderen zum wirklich schülerorientierten Arbeiten, das - richtig verstanden - zugleich auch lehrer- und sachorientiert sei. Sicherlich kann dieser Aufsatz auch als Freibrief für ein curriculares laissez-faire mißverstanden werden. Dies wäre schade, denn die wichtigste Konsequenz aus den Überlegungen Kaisers ist eine andere: es kommt darauf an, bereits in der Grundschule die Möglichkeit eines selbstverständlichen Umgangs mit traditioneller Notation im Selbstbild der Kinder zu verankern. Die Voraussetzungen dazu sind heute besser denn je: nahezu jedes Kind, das heute die Schule besucht, wird später einen Computer besitzen; auch der Besitz eines Keyboards und eines notationsfähigen Sequencerprogramms sind zumindest finanziell in jedermanns Reichweite. Was liegt näher, als sich mit solchen Hilfen ausgerüstet auch kreativ mit einer Sache zu beschäftigen, die im Leben der meisten Menschen heute einen hohen Stellenwert besitzt? - Es kommt nicht darauf an, daß es später möglicherweise nur bei wenigen tatsächlich zu einer solchen schöpferischen Auseinandersetzung kommt. Wichtig ist, daß das sechs- bis zehnjährige Kind nicht mit dem heute immer noch üblichen Vorurteil geimpft wird, der Umgang mit traditioneller Notation sei eine Frage der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht. 3. Allgemeine Überlegungen zur Notation Im vorigen Kapitel wurde wiederholt deutlich, wie wichtig es ist, sich genau über die zeichentheoretischen und pragmatischen Implikationen des Verhältnisses von Notation und Musik Klarheit zu verschaffen, bevor auf einer solchen Basis didaktische Entscheidungen gefällt werden. Da dies ein umfangreiches Gebiet ist, können im folgenden lediglich einige wesentliche Aspekte dieses Verhältnisses angedeutet werden. Vorrangiges Ziel dabei ist es, Differenzierungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die eine eindimensionale und verkürzte Betrachtungsweise verhindern helfen sollen. Geht man - einer Tendenz in der neueren musikpädagogischen Literatur folgend - zunächst von einem möglichst weit gefaßten Begriff von (statischen, flächigen) "visuellen (Re)präsentationen von Musik" (Kaiser 1995, II 144) aus, so lassen sich zunächst Darstellungen, die die zeitliche Struktur der Musik in räumliche Beziehungen "übersetzen", von solchen unterscheiden, die die Musik als einheitliches Ganzes wiedergeben. Hieraus läßt sich eine Minimalbedingung für musikalische Notationsformen ableiten: die Umsetzung des zeitlichen Nacheinanders in das räumliche Nebeneinander muß nach einer erkennbaren Regel erfolgen. Insofern wäre Earle Browns musikalische Grafik December 1952 ein Grenzfall, denn nach Angaben des Komponisten kann das Blatt "in jeder denkbaren Richtung" gelesen werden (vgl. Danuser 1984, 336). Ebenso wären aleatorische Spielanweisungen Grenzfälle, denn die "Regel", nach der aus dem Notat der zeitliche Ablauf "abgelesen" wird, ist die des Zufalls. Daß andererseits die übliche Leserichtung von links nach rechts keineswegs notwendig und oft nicht einmal die musikalisch sinnvollste ist, zeigt die nebenstehende Darstellung einer Rondoform. 3.1. Notationsformen als Zeichensysteme Etablierte universelle musikalische Notationsformen sind Zeichensysteme, d.h. die Umsetzung der musikalischen Ereignisse in die entsprechende graphische Darstellung erfolgt mit Hilfe von Zeichen nach gleichbleibenden Transformationsregeln, die auch die Syntax - also das Verhältnis der verschiedenen Zeichen zueinander - betreffen. An ein solches Regelsystem sind gewisse Anforderungen zu stellen: es muß z.B. widerspruchsfrei und konsistent sein, d.h. gleiche Zeichen müssen Gleiches, verschiedene Zeichen Verschiedenes bezeichnen. Die traditionelle Notenschrift und viele andere Notationsformen erfüllen diese Anforderungen. Wenn jedoch ein Schüler versucht, Musik in seiner eigenen Weise aufzuzeichnen, geht es oft um etwas anderes: daß nämlich überhaupt das im Inneren Gehörte oder Empfundene nach außen gebracht wird. Solche graphischen Äußerungsformen müssen kritiklos akzeptiert werden; es wäre unangebracht, eine fehlende innere Logik zu bemängeln. Gleiches gilt für musikalische Graphiken, die lediglich als "Provokation zu assoziativem 'Musikmachen'" (Dahlhaus 1965, 32) aufgefaßt werden sollen. Auch wenn es sich dabei nicht um universelle Notationsformen handelt, können sie zur Übung des Musikdenkens dennoch von unschätzbarem Wert sein. - Die folgenden Ausführungen beziehen sich aber nur auf Zeichensysteme. Klang- und Aktionszeichen Die Bedeutung der Zeichen - oder Texte - kann sich auf den resultierenden Klang beziehen oder auf eine Aktion, die den Klang bewirkt15. Die klangliche Bedeutung der Aktionszeichen erschließt sich daher erst durch Spezialkenntnisse über das ausführende Instrument. Als Beispiel kann die Griffnotation für Streicherflageoletts gelten: wird eine Quint über der leeren Saite gegriffen, klingt der Ton eine Duodezime höher als die leere Saite; bei einer Quart dagegen zwei Oktaven. Eine Abwärtsbewegung der Noten um eine Sekund bedeutet hier also ein Ansteigen der Töne um eine Quart. Aktionszeichen sind also bei der Bildung einer Klangvorstellung meist hinderlich, kommen aber oft den Ausübenden entgegen. - In diesem Zusammenhang kann gesagt werden, daß die traditionelle Notenschrift im wesentlichen eine Klangschrift ist: obwohl die Ausführung einer Melodie auf unterschiedlichen Instrumenten wie Horn oder Gitarre völlig unterschiedliche Spieltechniken/Aktionen erfordert, wird sie jeweils gleich notiert, weil sie ja gleich klingt. Analoge Darstellungsformen und ikonische und symbolische Zeichen Die analoge graphische Umsetzung von Klangparametern ist meist sinnfällig; die Transformationsregel ist nach dem Modell des "je - desto" gebildet. Beispiel: die Lautstärke wird als Dicke der Linien/Punkte dargestellt. Dabei gilt: je lauter der Klang, desto dicker der Punkt/die Linie. Sie eignet sich aber nur für solche Parameter, die kontinuierlich veränderbar sind, also z.B. nicht für die Klangfarbe. - Besteht zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten eine Ähnlichkeit, so sprechen wir von ikonischen, sonst aber von symbolischen Zeichen16. So werden etwa die zu verwendenden Instrumente in neueren Schulbüchern oft durch Ikonen gekennzeichnet. Dagegen werden die Notenwerte in der traditionellen Notenschrift durch symbolische Zeichen dargestellt. Ein "ikonisches Mißverständnis" wäre: die halbe Note als "hohl klingend" im Vergleich zur "voll klingenden" Viertelnote zu interpretieren. Kontextabhängigkeit, Relationalität und Exaktheit von Zeichen Dankmar Venus erweitert die Günthersche Klassifizierung der in der Notenschrift verwendeten Zeichen (in symbolische, ikonische und emotive Zeichen17) in folgender Weise: 1. Zeichen, die für sich alleinstehend unmißverständlich sind. 2. Zeichen, mit denen Relationen exakt wiederzugeben sind und die in der Notierungspraxis durch Ergänzungszeichen stets eindeutig werden. 15 vgl. hierzu Dahlhaus' Unterscheidung von Aktions- und Resultatschrift (Dahlhaus 1965, 24f.). - Anders als bei Dahlhaus wird hier der Terminus "Aktionsschrift" durchaus wertneutral gebraucht. 16 vgl. Eco 1977, 60; die Begriffe gehen auf Peirce zurück. Nach Peirce wären auch analoge Darstellungen den ikonischen Zeichen zuzurechnen. Die hier vorgenommene Unterscheidung ermöglicht die Mehrfachbesetzung von Zeichen: der Punkt stellt einen kurzen Klang ikonisch dar, seine Dicke ist eine Analogie zur Lautstärke. 17 Ulrich Günther, "Sprache in der Musikerziehung" (bei Venus fehlt eine genauere Angabe) 3. Zeichen, mit denen Relationen exakt wiederzugeben sind und die in der Notierungspraxis nur gelegentlich eindeutig, häufiger jedoch durch Zusatzangaben nur annähernd präzisiert werden. 4. Zeichen, mit denen Relationen nur angedeutet werden. 5. Zeichen, die nur allgemein, oft in Form einer Analogie charakterisieren." (103) Aus den Formulierungen wird deutlich, daß fast alle Zeichen - bis auf die erste und letzte Gruppe - kontextabhängig sind und zudem nur Relationen, keine absoluten Werte angeben. Die Tondauer z.B. (Gruppe 3) wird relational exakt festgelegt: eine halbe Note dauert doppelt so lange wie zwei Viertelnoten; ihre absolute Dauer aber hängt vom Tempo ab, das - wenn nicht eine Metronomangabe hinzugefügt ist - meist nur ungefähr aus der Charakterbezeichnung (Gruppe 5) zu erschließen ist. Die Tonhöhe dagegen (Gruppe 2 - sie wird aber genaugenommen nicht durch Zeichen, sondern durch Transformationsregeln dargestellt) ist aus der Position einer Note im Liniensystem im Zusammenhang mit dem Schlüssel und den Vorzeichen exakt zu erschließen, wenn man von der schwankenden Frequenz des Kammertons und Intonationsfeinheiten absieht. Zu den Transformationsregeln gehört auch, wie exakt die Bedeutung von Zeichen zu nehmen ist: dynamische, agogische oder Artikulationszeichen (Gruppe 4) sind freizügiger zu interpretieren als Tonhöhenangaben, und in barocker Musik ist auch ein punktierter Rhythmus im triolischen Zusammenhang keineswegs "wörtlich" zu nehmen. In der Neuen Musik tritt die Frage, wie exakt eine Notation zu verstehen ist, weiter in den Vordergrund, so daß sich Karkoschka (1966) zu folgender Unterscheidung entschließt: - Präzise Notation: Der Interpret soll die Anweisungen möglichst genau realisieren. - Rahmennotation: Der Interpret kann frei entscheiden, jedoch innerhalb eines präzise abgesteckten Rahmens. (Beispiel: Spielen einer beliebigen Tonhöhe zwischen cis' und e'). - Hinweisende Notation: Der Interpret soll durch ungefähres Abschätzen das Gemeinte realisieren. (Beispiel: Tondauern sind durch Streckenlängen gegeben, jedoch ohne Raster, das ein präzises Ablesen ermöglicht.) - Musikalische Graphik: Sie soll den Interpreten anregen, ohne ihn festzulegen. Karkoschka weist selbst darauf hin, daß eine solche Systematik immer unzulänglich bleiben muß, weil die Grenzen z.T. fließend sind. Er gibt aber ein relativ präzises Kriterium dafür an, wann ein Schriftbild überhaupt als Notation gelten kann: In die drei Bereiche der präzisen Notation, der Rahmennotation und der hinweisenden Notation fällt ein Werk dann, wenn es das übliche Koordinatensystem von Zeit und Raum zur Basis hat, wenn es mehr Zeichen als Zeichnung enthält und von einer zeilenhaften Darstellung ausgeht. Das gilt auch dort, wo relativ frei über diese Basen verfügt wird, wenn sie nur als solche evident werden. (80) 3.2. Notation, Klang und Bedeutung Nachdem im vorigen Abschnitt davon ausgegangen wurde, daß die Notationszeichen sich entweder auf den Klang der Musik beziehen oder auf die Aktionen, die den Klang hervorbringen, muß nun der Frage, was es ist, das die Notation aufzeichnet, genauer nachgegangen werden. - Carl Dahlhaus stellt an den Anfang seiner Überlegungen zur Notation18 die Frage, ob "geschriebene Musik" tatsächlich "nichts als eine Anweisung zum Produzieren von Tönen" sei oder nicht vielmehr doch "ein Text, vergleichbar dem 18 Dahlhaus 1965 der geschriebenen Sprache" (9). Er kommt zu dem Ergebnis, daß zu dem Unterschied zwischen dem "Wortlaut" als "intentionalem" und dem "Lautmaterial" als "realem Gegenstand" auch in der Musik analoge Sachverhalte auszumachen sind. Als Beispiel führt er den Taktstrich an, dessen (intentionale) Bedeutung darin besteht, ein Schwerpunktzeichen zu sein, dessen (reale) klangliche Ausführung aber auf verschiedene Weise - als Marcato oder Tenuto z.B. - möglich ist (10). Zeichentheoretisch ergibt sich daher die Notwendigkeit, zumindest zwei Formen von Notation zu unterscheiden. Die eine bezieht sich nur auf den Klang, die andere zugleich auf eine gewissermaßen hinter dem Klang stehende intentionale Bedeutungsebene. Bei dieser zweiten Form wird der Klang selbst zum Zeichen, das auf ein anderes verweist. Die folgenden beiden Schemata sollen dies verdeutlichen: Notation als Zeichen Bezeichnetes Klangzeichen Notation Klang Text Klang Notation Bedeutung Die Bedeutung muß dabei keineswegs auf einer zweifelhaften Ebene der "Aussage" von Kunstwerken gesucht werden, sondern findet sich bereits auf der Ebene des "Faktischen". Schon beim bloßen Hören eines Musikstücks - ohne daß die Notation ins Spiel kommt - muß der Hörer fortwährend interpretieren, was er hört: handelt es sich wirklich um einen Dreivierteltonschritt oder um unsaubere Intonation? Ist es ein großer Notenwert oder eine Fermate? Ist es eine selbständige Melodiewendung oder eine Verzierung? Ist das Stück zu Ende oder wurde nur ausgeblendet? - Diese Beispiele machen deutlich, daß es bei aufmerksamem Umgang mit Musik immer um eine intentionale Ebene geht und der reale Klang dabei keinesfalls die letzte, nicht mehr hinterfragbare Instanz darstellt. Auch Kinder hören bereits so, wenn sie z.B. über eine unbekannte Aufnahme eines unbekannten Stückes urteilen, es sei "schief". - Notation, als Text verstanden, kann helfen, den Zugang zur intentionalen Ebene zu intensivieren, weil sie gegenüber dem realen Klang selbständig bleibt. Notation und Musiktheorie Die Basis der intentionalen Ebene, auf die sich Notation und Klang gleichermaßen beziehen, bilden das Tonsystem und das System der zeitlichen Ordnung, das für die jeweilige Musikkultur Gültigkeit hat. Diese sind Gegenstand der Musiktheorie. Daher besteht ein enger Zusammenhang zwischen Musiktheorie, intentionaler Klangbedeutung und Notationsweise. Die Terz des-f, auf dem Klavier gespielt im tonalen Zusammenhang von Des-Dur, ist eine Konsonanz und wird als solche gehört. Dieselben Tasten, angeschlagen im tonalen Zusammenhang von d-Moll, werden als verminderte Quart und somit als Dissonanz gehört, obwohl "real-klanglich" kein Unterschied besteht. Der Unterschied besteht auf der "intentionalklanglichen" Ebene. Die Schwierigkeit, daß derselbe Ton - und auf dem Klavier ist es derselbe! -in einem Fall als des, im anderen Fall als cis notiert wird, wird nicht durch die Notation erzeugt, sondern durch das Tonsystem, das die Voraussetzung für das Verstehen der Bedeutung des Zusammenklangs bildet. Notation und Klangvorstellung Eine wichtige Frage ist, ob und inwieweit zum Beherrschen einer Notationsform die Fähigkeit zur Bildung von inneren Klangvorstellungen gehört19. Wenn Theodor W. Adorno, der als Verfechter eines solchen Zusammenhangs gilt, schreibt20, Musikpädagogik müsse die Fähigkeit der musikalischen Imagination fördern, die Schüler lehren, mit dem inneren Ohr Musik so konkret und genau sich vorzustellen, als erklänge sie leibhaft. (103), so ist dies insofern mißverständlich, als es auf einen Primat des Klangs abzuzielen scheint. An anderer Stelle heißt es jedoch: Zweck musikalischer Pädagogik ist es, ... [die Schüler] dahin zu bringen, ... kraft der Genauigkeit der sinnlichen Anschauung, das Geistige wahrzunehmen, das den Gehalt eines jeden Kunstwerks ausmacht. (102) Auch die Klangvorstellung ist also nicht Endzweck des Notenlesens, sondern nur Mittel zur Erkenntnis des geistigen Gehalts. - Adorno wendet sich in dem zitierten Aufsatz ja vor allem gegen die Tendenz der damaligen Musikpädagogik zum gedankenlosen "Drauflosspielen", also gerade gegen den Primat des Klangs. Deutlich wird das an der folgenden Stelle: Gar nichts schadet es im Unterricht, 'zu schwierige' Stücke zu behandeln, wofern es dem Lehrer gelingt, sie zur Erfahrung zu bringen; wenn die Finger es nicht schaffen, so ist das gleichgültig, wofern die reproduzierende Phantasie es geschafft hat (118) Wenn Adorno also "das adäquate, aber stumme Lesen von Musik" (104) als Ideal der Musikpädagogik propagiert, so geht es ihm also offenbar darum, ein Gegengewicht zu schaffen gegen die Unmittelbarkeit des realen Klangs und somit durch Klang und Notation hindurch zur intentionalen Ebene vorzustoßen. Hilfreicher als dieses Ideal einfach als utopisch abzutun (und damit den Gegenstand Notation gleich mit zu erledigen) ist es wohl, zu differenzieren und darauf zu verweisen, daß innere Klangvorstellungen ihrer Deutlichkeit nach gestaffelt werden können von der "diffusen Klangerwartung" bis zum lebendigen Klangbild21. Darüberhinaus wäre zu überlegen, welcher Art die inneren Klangvorstellungen sind, die auf das "Geistige" der Musik abzielen. Viel wichtiger als die genaue Tonhöhenvorstellung dürfte hier oft die Prägnanz der rhythmisch-gestischen Vorstellung sein: im fast gesprochenen "jat-tat-tat-taaaaa!" ist mehr Beethoven als in "no-no-no-nooo" auf eine glasklare große Terz. 3.3. Prä- und deskriptive Notation Ein Notat kann vor (präskriptiv) oder nach dem Erklingen des Notierten (deskriptiv) entstehen. Der erste Fall ist bei komponierter Musik der übliche; Beispiele für den zweiten Fall sind Transkriptionen von außereuropäischer Musik oder von Improvisationen, aber auch Hörpartituren. - Rudolf Frisius, der diese Unterscheidung unter den Begriffen Produktions- und Rezeptionsnotation 1973 in die musikpädagogische Diskussion einbrachte, wendet sie aber nicht nur auf einzelne Notate, sondern auch auf Notationsweisen an und behauptet, die traditionelle Notenschrift sei auf Produktionsnotation hin konzipiert. Daher soll im 19 Dankmar Venus z.B. weist darauf hin, daß selbst Komponisten wie Strawinsky oder Wagner nicht über diese Fähigkeit verfügten. 20 Adorno 1972 [1957]. 21 vgl. Venus, a.a.O., 55f. folgenden untersucht werden, ob eine vorwiegend prä- oder deskriptive Anwendung eines Notationssystems Auswirkungen auf die Definition der Zeichen und Transformationsregeln hat. Das von Frisius gegebene Beispiel einer Wagner-Partitur, die sich nach dem Hören einer Aufführung nicht rekonstruieren lasse, ist irreführend, denn das Problem ist hierbei zunächst nicht die verwendete Notationsform, sondern die Komplexität des Klangbildes (also nicht das Schreiben, sondern das Hören). Demgegenüber sollte zu denken geben, daß es - wie Gehörbildungsübungen immer wieder beweisen - sehr wohl möglich ist, etwa ein einfaches Bach-Präludium nach dem Gehör exakt so zu notieren, wie Bach es notiert hat, inclusive der Entscheidung, ob es jeweils fis oder ges heißen muß. Man kann noch weiter gehen: in notationslosen Musikkulturen oder solchen, in denen die Notation bei der Weitergabe von Musik gegenüber dem unmittelbaren Nachspielen eine untergeordnete Rolle spielt - hierzu gehört auch die Jazz- und mehr noch die Rock-Subkultur -, wird ein erfahrener Instrumentalist einen Höreindruck zunächst dadurch wiedergeben, daß er ihn nachspielt. Die bestmögliche Rezeptionsnotation - zur Archivierung oder zur Weitergabe an andere, die nicht so gut hören können - wäre dann die, die möglichst genau fixiert, durch welche Spielweise der Klang zu erzeugen ist, also eine möglichst genaue Produktionsnotation. Bei der Transkription von außereuropäischer Musik geht es jedoch nicht um die bloße Reproduzierbarkeit, sondern vor allem um ein Verständnis der Musik, d.h. um die Intentionalität des Klangs. Je weiter die Kenntnis über die entsprechende Musikkultur fortschreitet, je genauer also Tonsystem, Rhythmen, Spielund Verzierungstechniken bekannt sind, umso eher ist die Entwicklung einer Notation möglich, die der intentionalen Ebene angemessen ist. Aber auch dies wäre keine spezielle Rezeptionsnotation, sondern eine allgemeine Notationsform, die ebensogut zur Produktion der Musik verwendet werden könnte. Aus musikwissenschaftlicher Sicht hat also eine begriffliche Unterscheidung, wie Frisius sie vorschlägt, wenig Sinn. Eher geht es wohl um ein psychologisches Problem: wie nämlich ein Hörer einen zunächst ungenauen und unbestimmten Höreindruck festhalten kann, um dann - bei wiederholtem Hören - die Aufzeichnung mit den Höreindrücken immer wieder zu vergleichen und so einerseits die Aufzeichnung zu vervollkommnen und andererseits - und darauf kommt es vor allem an - sein Hören zu schulen. Die Rezeptionsnotation wäre also lediglich ein methodisches Mittel des Musikunterrichts. 3.4. Notation und musikbezogenes Handeln Jedes Notat kann auf unterschiedliche Weise Gegenstand von musikbezogenen Handlungen werden, und zwar unabhängig davon, ob diese intendiert sind. Der intendierte Gebrauch der Stimmenausgabe eines Streichquartetts z.B. wäre die Ausführung der Musik (Reproduktion ). Denkbar ist aber ebensosehr, daß die Musiker in Sektlaune beginnen, improvisierend mit dem vorgegebenen Material umzugehen. Dies z.B. wäre wiederum der intendierte Gebrauch von Jazz-Noten: Gebundene Improvisation. Vielfältiger noch sind die Möglichkeiten, mit Partituren oder Klavierauszügen umzugehen, also Notaten, die jeweils ein ganzes Werk repräsentieren: sie dienen dem Dirigenten eines Orchesters zur Leitung der Probenarbeit und der Aufführung, dem Korrepetitor zum Einstudieren eines Gesangsparts, dem Liebhaber zur Unterstützung des Musikhörens, dem Komponisten zum Analysieren, Zitieren oder Bearbeiten und dem Archivar zum Aufbewahren. - Es ist unsinnig, irgendeine dieser Handlungsweisen ausschließen zu wollen. Genau dies tut Moles in der folgenden, in der musikpädagogischen Literatur wiederholt zitierten Textstelle22: 22 Moles 1971, 158, zit. n. Frisius 1973. Die Partitur ist ein Operationsschema und als solches nur für den Ausübenden, aber durchaus nicht für den Hörer bestimmt. Wenn der Hörer ein Musikstück anhand der Partitur verfolgt, macht er einen ästhetisch widersinnigen Gebrauch von ihr; er will nur wissen, wie man das ästhetische Objekt herstellt, das er wahrnimmt. (21/1) Hieran ist bereits der erste Satz unzutreffend: wenn ein Orchester ein Stück spielt, hat nur der Dirigent eine Partitur, die Spieler dagegen Einzelstimmen. Die Aufgabe des Dirigenten während der Probenarbeit besteht unter anderem darin, darauf zu achten, ob die in der Partitur festgelegte klangliche Intention - hier kommt natürlich das Moment der Deutung ins Spiel - realisiert wird. Insofern fällt dem Dirigenten vor allem die Rolle eines kritischen Hörers zu. - Ähnlich verhält es sich bei einem gebildeten Zuhörer, der während des Hörens die Partitur verfolgt: ihm kommt es viel weniger darauf an, wie man herstellt, was er ohnehin wahrnimmt, sondern vielmehr darauf, ob er alles wahrnimmt, was - dem Partiturbild nach zu urteilen - von Bedeutung für das ästhetische Erlebnis ist. Insofern kann das Mitlesen der Schulung der eigenen Wahrnehmung dienen, aber auch der Beurteilung einer Aufführung. 3.5. Werk, Notentext und Aufführung Häufig findet man in der musikpädagogischen Literatur, aber auch in Texten von Musikern aus dem nichtklassischen Bereich eine Darstellung des Verhältnisses von Komponist und Interpret, wonach der Interpret im wesentlichen die Klangvorstellung des Komponisten realisiert und daher diesem künstlerisch nachgeordnet sei. Der Notentext ist hiernach das Medium, durch welches der Komponist dem Interpreten seine Anweisungen gibt. Diese Darstellung mag zwar für zeitgenössische Kompositionen zutreffen, deren Realisation vom Komponisten selbst geleitet oder überwacht wird, ist aber für jene Aufführungen schriftlich fixierter Werke der letzten fünfhundert Jahre23, die für das abendländisch geprägte Musikleben in der ganzen Welt so charakteristisch sind, zu stark vereinfachend. Es soll daher noch einmal zurückgekehrt werden zu der Frage, was es ist, das die Notation aufzeichnet. Thrasybulos Georgiades schreibt über die Anfänge der Notation im 12. Jhd.24: Wir sehen: Notiert wird, was man als Gegenstand des Komponierens im engeren Sinne betrachtet. Was der Ebene der Ausführung angehört, wird nicht schriftlich fixiert. Es decken sich Notenschrift und derjenige Bestandteil der Musik, der als 'Komposition', als Leistung des Komponisten gemeint ist; jedoch nicht Notenschrift und Erklingen, das, was wir eben als Musik bezeichnen. Umspielungsmöglichkeiten, Verdopplungen, Besetzung (ob vokal oder auch instrumental, ob solistisch oder chorisch, ob Männerstimmen oder auch Knabenstimmen), Tempo, Tonstärke-Abstufungen, Klanggebung, kurz: alles, was die Musik erst zur Musik, nämlich zum Erklingenden macht, ist aus der Notenschrift nicht zu entnehmen. Selbst die Beschaffenheit der Intervalle vermag uns keine Notenschrift zu verraten. Wie eine Sekund, wie eine Terz akustisch beschaffen sind, ihre wirklichen Schwingungsverhältnisse, erfahren wir erst durch die Kenntnis des Tonsystems. Obwohl seitdem immer mehr Zeichen entwickelt wurden, um den Klang präziser zu bestimmen, so bleibt doch immer ein klanglicher Rest, der sich der Notation entzieht. Auch in der im übrigen sehr genauen traditionellen Notenschrift werden selbst für den Charakter eines Musikstücks wichtige Details (z.B. die genaue Tondauer bei portato-Achteln, die Veränderung der Tonhöhe beim Vibrato einer Geige, die Feindynamik von Melodien etc.) überhaupt nicht oder nur höchst ungenau wiedergegeben. Der Musiker, der solche Musikstücke ästhetisch befriedigend wiedergeben will, muß daher über eine ganze Reihe von 23 Der Zeitraum zeigt eine Tendenz zur Ausweitung; das Interesse schwächt sich zu den Rändern hin ab. 24 Georgiades, Thrasybulos G.. Musik und Sprache. Das Werden der abendländischen Musik dargestellt an der Vertonung der Messe. Berlin - Heidelberg - New York: Springer, 1954. S. 28 Fähigkeiten verfügen, um diese "Informationslücken" auszugleichen. Hierzu gehören Stilkenntnis und Sinn für musikalische Logik. Für die Leistung eines ausübenden Musikers wird von Theoretikern gern der Begriff "Reproduktion" gebraucht, der suggeriert, es handele sich dabei um die möglichst getreue Wiederherstellung des Originalklanges. Aufführungen mit historischen Instrumenten scheinen dies zu belegen. Der Blick auf Konzertund Schallplattenkritiken zeigt aber, daß auch hier die Einzigartigkeit der Aufführung im Vordergrund steht, ebenso wie dies von aller improvisierten Musik beansprucht wird. Goutiert werden "die knisternde Spannung beim Übergang zum Finale" oder "die noch nie so kristallklar gehörten Bläserakkorde". Zwar gibt es sicher auch Hörer, die nach einem Konzert befriedigt feststellen, daß es genauso klingt wie auf der Platte25, aber diese Einstellung dürfte unter gebildeten klassischen Musikliebhabern selten sein. Denn die Arbeit der Interpreten besteht darin, auf die Werke der Vergangenheit immer wieder den Blick der Gegenwart zu richten, ihnen neue Seiten abzugewinnen und zu beweisen, daß sie lebendig sind, daß sie uns auch heute etwas mitzuteilen haben. Da dieser Beweis nicht in Worten erbracht wird, sondern in klingender Musik, erweist sich seine Stichhaltigkeit unmittelbar: zu oft darf uns ein Stück nicht langweilen, sonst hat es seine zeitgenössiche Existenz verwirkt. Die Verantwortung für das Überleben der Werke liegt also zum großen Teil bei den Interpreten, die über große künstlerische Gestaltungskräfte verfügen müssen: sie erschaffen den Klang der Musik. Es ist daher nicht verwunderlich, daß auch Interpretationen klassischer Werke den Stempel ihrer Zeit tragen, wie im Vergleich verschiedener Schallplattenaufnahmen deutlich wird26. In diesem Zusammenhang muß auch die Funktion des Notentextes gesehen werden: würde er einfach nur die Klangvorstellung des Komponisten festhalten, so bliebe dem Interpreten tatsächlich nur, diese zu realisieren. Andererseits geht die Freiheit des Interpreten in der Regel nicht so weit, daß er "Verbesserungen" am Werk vornehmen darf, obwohl auch dies immer wieder geschieht: Beispiele dafür sind Striche in Opern und Uminstrumentierungen. - Der Notentext garantiert so die Identität des Werks bei der Verschiedenheit der Aufführungen, und der ästhetische Genuß besteht nicht nur im Wahrnehmen der klanglichen Realisation, sondern ebensosehr im Vergleich mit der eigenen Erinnerung von anderen Aufführungen. Die Opernrezeption ist hierfür ein gutes Beispiel: ein großer Teil des Publikums kennt die Oper mehr oder weniger gut; die Spannung richtet sich daher nicht - wie bei einem Action-Film - auf den Ausgang der Handlung, sondern darauf, wie bestimmte Szenen gespielt und gesungen werden. 25 Eine Feststellung, die man ironischerweise z.B. über das "improvisierte" Gitarrensolo im live dargebotenen "Samba pa ti" von Carlos Santana treffen konnte. Aber auch die Rolling-Stones-Anhänger wunderten sich ja in diesem Jahr über allzugroße Präzision... 26 Man vergleiche etwa die Aufnahmen des Amadeus-Quartetts mit denen des LaSalle- oder des Alban-Berg-Quartetts: hier sind drei Generationen des Streichquartettklangs zu erkennen. 4. Didaktische Aspekte zum Notieren von Musik im Unterricht aus heutiger Sicht In diesem Kapitel sollen verschiedene Notationsformen daraufhin untersucht werden, in welchem Maße sie als eigenständige Lerninhalte oder methodische Mittel des Musikunterrichts von Interesse sind. Für die Auswahl musikalischer Lerninhalte nennen Hermann J. Kaiser und Eckhard Nolte vier Aspekte27: - die Lernziele - den Gegenstandsbereich Musik - den Lernenden und seine Bedingungen - methodische Möglichkeiten des Lerninhalts. Was die Lernziele betrifft, so nennen dieselben Autoren vor allem vier Argumentationsansätze, die für das Lernzielrepertoire der neueren Lehrbücher und Rahmenpläne von prägender Bedeutung waren (101ff.): - die Veränderung der musikalischen Umwelt durch die elektroakustischen Medien - die Gefahr der Hörnormierung - das allgemeinpädagogische Leitbild des mündigen Verhaltens - Wissenschaftspropädeutik Dabei zitieren Nolte und Kaiser Autoren bis 1976 und Rahmenpläne bis 1981. Es darf daher angenommen werden, daß diese Argumentationsansätze aus heutiger Sicht zumindest zu vervollständigen wären. Dies soll hier zunächst in sehr knapper Form geschehen, bevor gefragt wird, welchen Beitrag Notation zum Erreichen dieser Ziele leisten kann. Während es in den sechziger und siebziger Jahren vor allem die Verbreitung von Rundfunk und Schallplatte waren, die das Musikhören in den Mittelpunkt didaktischer Überlegungen rückte, ist es heute vor allem die Computertechnologie, die Anlaß gibt, über neue musikalische Verhaltensweisen nachzudenken. Sequencerprogramme in Verbindung mit computergesteuerten Samplern oder Synthesizern und Musikstücke, die als Computerdateien im Handel erhältlich sind28, ermöglichen nämlich ein Eingreifen in den musikalischen Ablauf: die Stücke können bis in Details hinein verändert und in veränderter Form automatisch abgespielt werden. Daß viele dieser Programme auch ein Arbeiten mit dem Notenbild ermöglichen, macht die Sache besonders interessant29. - Solche Ausrüstungen wie auch programmierbare Keyboards, die das schrittweise Eingeben von Harmoniefolgen und Begleitmustern ermöglichen, machen das Produzieren oder Verändern von Musik auch für diejenigen möglich, die kein Instrument erlernt haben; in diesem Zusammenhang gewinnt auch die Musiktheorie einen anderen Stellenwert. Zwar werden zunächst nur wenige von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, und der Anspruch wird sich eher auf Spielniveau bewegen. Dennoch wird eine Akzentverschiebung deutlich, die auch didaktisch ihren Niederschlag finden muß. Der Vorrangstellung, die das Musikhören im musikpädagogischen Denken der siebziger Jahre einnahm, entspricht die Vorstellung, der reale Klang sei an der Musik das Wesentliche. Wenn dies schon in der seit langem säkularisierten Musik der westlichen Welt eine verkürzte und letztlich nicht haltbare Vorstellung ist, wie im vorigen Kapitel gezeigt wurde, dann gilt dies umso mehr für außereuropäische Musik, die oft 27 28 29 Kaiser / Nolte 1989, 109ff. Die Berliner Firma Geerdes bietet z.Zt. in ihrer Midi-Music-Collection über 3000 Titel an, darunter sowohl aktuelle Hits als auch klassische Musikstücke. Ein Überblick über die Leistungen derzeit verfügbarer Sequencerprogramme findet sich z.B. in Jörn Loviscach, "Taktgeber. MIDI-Sequencer für Windows und Mac OS". c't. Magazin für Computertechnik. Heft 1/1996. Hannover, 1996. 172 - 176. noch heute mit religiösen Handlungen oder zumindest Vorstellungen verbunden ist. Wenn wir also ein Buch über buddhistischen Ritualgesang in Japan lesen, dann ist auch dies eine musikbezogene Verhaltensweise, und es kann sein, daß hierdurch unser Verständnis und unser musikalisches Denken mehr gefördert werden, als wenn wir von solcher Musik mit Hilfe einer Stoppuhr eine Hörpartitur anfertigen. Dies führt auf eine weitere Veränderung gegenüber den siebziger Jahren, die damals zwar bereits vorausgesehen wurde, die man sich aber konkret wohl noch nicht vorstellen konnte30: das Entstehen einer WeltMusikkultur, das einhergeht mit der Verflachung und dem Sterben hochentwickelter eigenständiger Musikkulturen, letztlich wohl auch der europäischen Musikkultur vergangener Jahrhunderte. Zur Zeit sind zwei gegenläufige Prozesse zu beobachten: einerseits sorgen weltweit operierende Fernsehsender wie MTV dafür, daß kulturelle Unterschiede, zumindest was die Massenkultur betrifft, nivelliert werden. Auf der anderen Seite finden Bruchstücke verschiedener Musikkulturen - gregorianischer Gesang ebenso wie mohammedanische Gebetsrufe - Eingang in die alles verschlingende Hip-Hop-Kultur und werden dadurch immerhin verbreitet. Aber auch ernsthafte Zusammenstellungen außereuropäischer Musik sind auf CD in weitaus größerem Maße erhältlich, als dies vor zwanzig Jahren der Fall war. Das Leitziel der Offenheit gegenüber allen Erscheinungsformen der Musik muß in einer solchen Situation ergänzt werden durch das Ziel, den Schülern Orientierungen zu bieten, die sie in die Lage versetzen, die Kulturfragmente in größere Zusammenhänge einzuordnen und - zumindest ansatzweise - zu verstehen. Dazu aber ist vielfach die Kenntnis kultureller Hintergründe erforderlich, die der Musikunterricht - wenn es anderswo nicht geschieht - vermitteln müßte. Dies gilt im übrigen ebenso für die eigene Musikkultur, die ja von Schülern z.T. bereits nicht mehr als "die eigene" erlebt wird. Es genügt also nicht mehr, das "richtige Hören" zu lehren, was ohnehin schon immer einen bevormundenden Beigeschmack hatte31. Zwar ist auch weiterhin eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit wichtig; vor allem aber kommt es darauf an, daß die Schüler auch nach dem Ende ihrer Schulzeit weiterhin neugierig auf Erfahrungen mit Musik sind, daß sie also bereit und fähig sind, sich vielschichtig mit Musik auseinandersetzen. Dazu aber ist es erforderlich, daß der Musikunterricht sie auf den kreativen Umgang mit den neuen Medien ebenso vorbereitet, wie er sie lehren muß, sich fundierte Hintergrundinformationen über Musik zu verschaffen. Um also die eingangs gestellte Frage beantworten zu können, in welchem Maße Notationsformen als eigenständige Lerninhalte oder methodische Mittel des Musikunterrichts von Interesse sind, müssen u.a. folgende Gesichtspunkte geprüft werden: - Welche Bedeutung hat die Notationsform für die Musik bzw. für das gegenwärtige Musikleben? - Welche Bedeutung kann sie jetzt oder später im Leben des Schülers haben? - Kann die Notationsform helfen, Musik bzw. Aspekte der Musik zu verstehen? Bis zu welchem Grad muß sie dazu beherrscht werden? - Mit welchen Schwierigkeiten muß beim Erlernen der Notationsform gerechnet werden, wenn ein bestimmter Grad der Beherrschung angestrebt werden soll? Die letzte Frage ist wichtig, weil bei der Auswahl von Lernzielen und Lerninhalten natürlich immer eine Aufwand-Nutzen-Abwägung vorgenommen werden muß. Ein mäßig wichtiger Lerninhalt, der nur mit 30 31 vgl. jedoch hierzu den erstaunlich weitsichtigen Artikel von Karlheinz Stockhausen: Weltmusik. Musik international: Informationen über Jazz, Pop, außereuropäische Musik. Die Garbe Bd. 5, hg. Eduard Pütz und Hugo Wolfram Schmidt. Köln: Gerig, 1975. 13 - 22. vgl. Karbusicky 1986, S. 5ff. großem Zeitaufwand vermittelbar wäre, müßte entfallen, wogegen weniger wichtige Lerninhalte, die auf dem Weg liegen und eine interessante Bereicherung des Unterrichts darstellen, vertretbar wären. 4.1. Die Bedeutung verschiedener Notationsformen für Musik und Musikleben der Gegenwart Betrachtet man die Gesamtheit aller heute erhältlichen schriftlichen Aufzeichnungen von Musik - dazu gehören Musical-Klavierauszüge, Studienpartituren, Orchestermaterial, Pop-Noten, Transkriptionen außereuropäischer Musik, Bibliotheksbestände an Handschriften alter Musik, Liederbücher, musikalische Grafiken, Hörpartituren, Computerausdrucke von MIDI-Files, aber auch Konzert- und Opernführer mit eingestreuten kleinen Notenbeispielen, und nicht zuletzt auch Schulbücher - so wird schnell deutlich, daß gegenüber der sogenannten traditonellen Notation alle anderen Notationsformen nur ein marginales Schattendasein führen. Selbst in Bereichen, wo sie der Struktur der Musik nicht optimal angepaßt ist - hierzu gehören nicht-tonale und metrisch nicht gebundene Musik, außereuropäische Musik mit abweichenden Tonsystemen, Jazz und Pop mit speziellen Techniken der Tongebung und freierer Rhythmik - wird vorwiegend die traditionelle Notenschrift verwendet32 - ggf. erweitert um einige Zusatzzeichen. Die Konsequenz daraus dürfte zugleich der wichtigste Grund für diese Situation sein: die traditionelle Notenschrift ist zu einem mächtigen gesellschaftlichen Standard geworden, den jeder anerkennen muß, der keine Nachteile in Kauf nehmen will. Ein Komponist, der seine Werke heute anders notiert als üblich, muß zunächst die Musiker davon überzeugen, daß es sich lohnt, sich durch die "Gebrauchsanleitung" für das Notenmaterial zu arbeiten. Verwendet er dagegen die traditionelle Notenschrift, ggf. in Verbindung mit einigen verbalen Anweisungen, so kann die eingesparte Lesezeit zum Proben verwendet werden. Dies dürfte auch das Argument gewesen sein, das Arnold Schönberg abhielt, seine zwölftönigen Werke in einer 1924 konzipierten "Zwölftonschrift" herauszugeben33. Andererseits hat es besonders in den fünfziger und sechziger Jahren eine wahre Flut an neuen Notationsformen und -zeichen gegeben, die Erhard Karkoschka 1966 dokumentiert hat. Jedoch blieb ihre Bedeutung - bis auf wenige Ausnahmen - auf den Bereich avantgardistischer Musik beschränkt. Von Karkoschka aufgeführte alternative Notenschriften wie Klavarscribo oder Equiton werden z.B. selbst in Danusers Handbuch über Die Musik des 20. Jahrhunderts (1984) nicht erwähnt. Eine mehr technische als musikalische Notationsform, deren gesellschaftliche Bedeutung auf amtlicher Verfügung beruht, ist das Sonagramm, das zur standardisierten Klangbeschreibung bei Hörmarken verwendet werden kann34: 32 33 34 z. B. Keith Jarrett, The Köln Concert, von Jarrett authorisierte Transkription der Aufnahme des Konzerts in der Kölner Oper am 24. Januar 1975 von Yukiko Kishinami und Kunihiko Yamashita. Mainz: Schott, 1991. Bemerkenswert ist, daß in der Transkription auf zusätzliche Zeichen und sogar auf Artikulationsangaben fast vollständig verzichtet wird. Außerdem Pink Floyd, The Wall. Transkribiert von Jesse Gress. London: Pink Floyd Music Publishers Ltd. o.J. (1986?). Hier wird eine Gitarrentabulatur mit Zusatzzeichen für Glissandi verwendet; die parallel dazu laufende traditioneller Notation ist erforderlich, weil die Tabulatur keine rhythmischen Informationen enthält. vgl. Danuser 1984 (NHdM 7), 131. Mitteilung Nr. 16/94 des Präsidenten des Deutschen Patentamts über die Form der Darstellung von Hörmarken durch Sonagramm ... vom 16. Dezember 1994 Hierbei handelt es sich um ein zeitabhängiges Frequenz-Amplitudenspektrum. In einem Koordinatensystem werden die jeweiligen Amplituden von sinusförmigen Schallschwingungen mit ihren Frequenzen wiedergegeben. Auf der horizontalen Achse wird die Zeit und auf der vertikalen Achse die Frequenz der Hörmarke aufgetragen. Die in Dezibel (dB) gemessene Höhe der Amplitude der jeweiligen Schallschwingung bestimmt den Schwärzungsgrad im Sonagramm. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß die Obertöne eines "einfachen" Tones im Sonagramm gesondert aufzuzeichnen wären. Theoretisch gesehen wäre dies die naturwissenschaftlich genauestmögliche Darstellung, die von einem Klangverlauf gegeben werden kann, sieht man von der Möglichkeit ab, den Inhalt eines CD-Tracks als Zahlenkolonnen auszudrucken. - Man kann die Balkendiagramme, mit denen auch viele Sequencerprogramme arbeiten, als vereinfachte Sonagramme ansehen, wobei die Obertöne weggelassen werden und die Tonhöhen nur gerastert angegeben werden können; außerdem wird die Dynamik (z.Zt. noch) nicht als Schwärzungsgrad dargestellt. Ziffernnotationen, wie sie 1742 von Rameau erfunden und noch heute in China gebräuchlich sind35, sind aus unseren Liederbüchern weitgehend verschwunden; sie werden allerdings in einigen Keyboard-Schulen verwendet, meist in Verbindung mit der traditionellen Notenschrift. Aus der Vorgeschichte der traditionellen Notation stammt die Choralnotation, in der noch heute die gregorianischen Gesänge aufgezeichnet sind. Diese Weiterentwicklung der Neumenschrift kennt Ligaturen, also Zeichen für ganze Notengruppen, die in der Modal- und Mensuralnotation noch bis ins 16. Jhd. hinein verwendet wurden. - Hier besteht übrigens ein Bezug zu graphischen Vornotationen, wie sie für den Gebrauch an Schulen empfohlen werden: bei den Ligaturen handelt es sich im Grunde auch um Melodiekurven, und ihr Vorkommen in frühesten europäischer Notationsformen deutet darauf hin, daß es sich hierbei um eine naheliegende Notationsweise handelt. Ein Sonderproblem ist die Notation von Harmonien. In fast allen Liederbüchern und Songbooks findet man Akkordbezeichnungen, wobei viele unterschiedliche Systeme verwendet werden: ein Molldreiklang etwa kann durch nachgestelltes "m" oder durch Kleinbuchstaben kenntlich gemacht werden. Die Grundtöne werden deutsch oder englisch benannt, so daß "B" entweder B oder H bedeuten kann. - In diesem Zusammenhang ist auch die Generalbaßnotation zu nennen, die heute zumindest im Notenmaterial meist mitgeführt wird und von Musikern, die an Aufführungen alter Musik beteiligt sind, auch zumeist gelesen werden kann. 4.2. Die (zukünftige) Bedeutung verschiedener Notationsformen für die Schüler Welche Anlässe kann es nun für Schüler - jetzt oder später - geben, sich dieser Notationsformen zu bedienen? Nach den Überlegungen Kaisers (1995) ist dies die Frage, die letztlich darüber entscheidet, ob eine unterrichtliche Beschäftigung mit Notationsformen bleibende Früchte trägt oder nicht. Zumindest müssen die Schüler selbst eine Perspektive haben, die ihnen das Erlernen oder Anwenden dieser Notationsformen sinnvoll erscheinen läßt. Zunächst läßt sich sagen, daß das, was im Musikleben nur marginale Bedeutung hat, wahrscheinlich für die meisten Schüler nicht zentrale Wichtigkeit erlangen wird. Es wird also zunächst vor allem um die traditionelle Notenschrift gehen. - Nun ist deren Beherrschung selbst für viele derjenigen verzichtbar, die ein Instrument erlernen. Aber sie ermöglicht Entscheidungsfreiheit, Zugang zu einem immensen Angebot an Musik, die es zu erschließen gilt. An dieser Stelle muß auf eine Veränderung der gesellschaftlichen Rah35 vgl. Böhle 1994, S. 21. menbedingungen hingewiesen werden. Heute werden bereits Bach-Urtextausgaben in Kaufhäusern angeboten, und bei einer neuen Vertriebsform erwirbt der Kunde mit der CD zugleich die Noten36. Die Hemmschwelle, eine Musikalienhandlung zu betreten und unter dem kritischen Blick des Verkäufers Noten auf Spielbarkeit hin zu überprüfen, entfällt damit. Dies mögen gegenwärtig Einzelfälle sein; andererseits ist die überkommene Musikalienhandlung, in der Geigenetuis, Schallplatten, Mundorgeln und Noten feilgeboten werden, wahrscheinlich nicht die Vertriebsform der Zukunft. Auf das Angebot an Musiksoftware, die auch die traditionelle Notation beherrscht, wurde bereits hingewiesen. Hier ist auch in Zukunft mit Erweiterungen und Verbesserungen zu rechnen. Da zu erwarten ist, daß bald in jedem Haushalt mindestens ein Computer steht, mit dem besonders die Kinder und Jugendlichen umgehen können, und da oft die Software - auch die Musiksoftware - bereits beim Kauf mitgeliefert wird, wäre es nicht einmal verwunderlich, wenn in wenigen Jahren von Schülern der Wunsch geäußert würde, sich doch einmal im Musikunterricht mit Notation und Musiktheorie zu befassen. Um diese Überlegungen zu veranschaulichen, sollen zunächst drei hypothetische Fallbeispiele dargestellt werden, die sich mit Situationen beschäftigen, in denen Menschen, die die Schule bereits verlassen haben, sich ihre in der Schule erworbenen Notationskenntnisse nutzbar machen. Beispiel 1: Jemand hört, während er den Abwasch macht, im Radio bereits zum zweiten Mal einen neuen Titel, der es ihm schon beim ersten Mal besonders angetan hatte. Er startet sofort den Cassettenrecorder, in dem zu diesem Zweck immer eine überspielbare Cassette steckt. Da ist sie wieder, diese melodisch-harmonische Wendung, die ihn sofort elektrisiert hatte! Er will unbedingt wissen, was da passiert. Nach dem Abwasch spult er die Cassette zurück und hört sich die Stelle mehrmals an. Dabei notiert er sich einen ungefähren Melodieverlauf. Nun holt er sein Keyboard. Nach mehrfachem Vor- und Zurückspulen und Ausprobieren ist es soweit: die Melodie zumindest hat er herausgefunden. Weil er jetzt zur Arbeit muß, notiert er die herausgefundene Melodie; die Akkorde wird er nach Feierabend herausfinden. Lange bevor die Noten in irgendeiner Musikalienhandlung zu finden sind, kann er das Stück in sein programmierbares Keyboard eingeben und seine Freunde mit Karaoke-Vorführungen beeindrucken. Beispiel 2: Weil MIDI-Files von Originalhits oft vergleichsweise teuer sind, hat sich jemand von einer Versandfirma eine Zusammenstellung GEMA-freier Musik schicken lassen. Hier gibt es häufig Titel, die in Melodie und Arrangement verblüffende Ähnlichkeit mit Originalhits aufweisen; stets aber ist die Ähnlichkeit zu gering, als daß ein Konflikt mit dem Urheberrecht zu befürchten wäre. Auch sein Lieblingshit ist in einer stark veränderten Fassung vertreten. Er läßt sich zunächst einen Computerausdruck vom Notenbild machen, das er mitliest, während er die Original-CD hört. Er markiert sich die Stellen, an denen es anders klingt. An einigen Stellen bemerkt er bereits beim Mitlesen, worin die Abweichungen bestehen. Danach setzt er sich an den Computer und korrigiert die Melodiestimme. Wieder einmal ist er überrascht, an wie wenigen Stellen etwas ändern mußte, um das Original zu rekonstruieren! Beispiel 3: Jemand stellt zufällig fest, daß er zwei Aufnahmen desselben barocken Concerto grosso besitzt, die aber völlig unterschiedlich klingen. Da ihn die Sache interessiert, entleiht er bei einem seiner nächsten Besuche in einer Musikbibliothek, die auch CDs verleiht (deshalb ist er dort), auch eine Partitur des fraglichen Stücks. Zuhause angekommen, muß er feststellen, daß merkwürdigerweise gerade in der 36 J. S. Bach, Französische Suiten. Urtext, hg. Tamas Zaszkaliczky. Budapest: Könemann Music, 1995, gekauft September 1995 bei Karstadt für ca. 10 DM. - SONY und Peters: CD und Noten von Klaviermusik für zusammen ca. 20 DM. Aufnahme, die er besser findet, teilweise Noten gespielt werden, die gar nicht in der Partitur stehen. Er nimmt dies zum Anlaß, wieder Kontakt aufzunehmen zu einem seiner früheren Mitschüler, der später Musik studiert hat, und erfährt von diesem einiges über barocke Aufführungspraxis, das seine Beobachtungen erklärt und ihm ein neues spannendes Kapitel seiner Musikliebhaberei eröffnet. Es handelt sich in allen drei Beispielen um Musikliebhaber, die jedoch kein Instrument spielen und ihre Notationskenntnisse in der Schule erworben haben. Im ersten Fall geht es um "Gehörbildung mit Hilfe eines Instruments": die Notation ist nur ein Zwischenstadium, das zwischen dem ersten Hören und dem Memorieren bzw. Einprogrammieren vermittelt. Sie ist nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe gedacht. Es käme daher z.B. eine Buchstabennotation in Frage; auf die Rhythmusnotation kann u.U. ganz verzichtet werden. - Im zweiten Beispiel geht es um ein "Hören mit Noten", das durch aktives Eingreifen in den Notentext ergänzt wird. Die Auswahl der möglichen Notationsformen hängt davon ab, was der Computer beherrscht. Allerdings empfiehlt sich wegen der Übersichtlichkeit des Ausdrucks die traditionelle Notenschrift. Das "Korrigieren" des Musikstücks wird dadurch vereinfacht, daß der Computer auf Veränderungen des Notenbildes mit klanglicher Rückmeldung reagieren kann. - Im dritten Beispiel schließlich geht es wiederum um ein "Hören mit Noten", diesmal in Verbindung mit einem Interpretationsvergleich; vor allem geht es aber um die Nutzung des durch öffentliche Bibliotheken bereitgehaltenen Informationsbestandes, wodurch sich eine Festlegung auf die traditionelle Notenschrift ergibt. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß ein Erlernen der traditionellen Notenschrift in der Schule durchaus sinnvoll erscheint. Um das Informationsangebot, das Partituren oder Songbooks bieten, nutzen zu können, sollte jeder Schüler zumindest lernen, sich in einer Partitur zu orientieren und die Töne eines Liedes auf einem Keyboard zu finden. 4.3. Verschiedene Notationsformen als Mittel zu einem abgestuften Musikverständnis In diesem Abschnitt soll untersucht werden, in welcher Weise verschiedene Notationsformen dem Musikverständnis dienen können. Dabei wird von verschiedenen Stufen des Musikverständnisses ausgegangen, denen verschiedene Grade der "Beherrschung" der Notationsform entsprechen; zugleich wird auf die Schwierigkeiten beim Erreichen der entsprechenden Beherrschungsgrade eingegangen. Hierbei muß aber beachtet werden, daß solche Schwierigkeiten oft nicht eigentlich die Schrift betreffen, sondern das, was durch die Schrift dargestellt werden soll. Das Problem z.B., daß derselbe Ton einmal als fis, das andere Mal als ges geschrieben werden muß, reflektiert ja nur, daß dieser Ton eben nicht derselbe ist - jedenfalls nicht in musiktheoretischem Sinn. Wenn die Schüler das Notationsproblem begriffen haben, haben sie zugleich das musiktheoretische Problem begriffen; sie sind zu einem erweiterten Musikverständnis gelangt. Da viele Notationsweisen vor allem zwei musikalische Dimensionen in Beziehung setzen - die Tonhöhe und die Zeit - und die anderen Dimensionen - Dynamik, Artikulation, Form - zumeist in qualitativ anderer Form darstellen, werden diese einzelnen Dimensionen im folgenden getrennt untersucht. Tonhöhendarstellung / Harmonik Zunächst muß daran erinnert werden, daß die absolute Tonhöhe für das Musikverständnis eine weitaus geringere Rolle spielt als die Tonhöhenrelationen. - Bezogen auf Tonhöhen und Tonhöhenrelationen, gilt es mehrere Stufen des Musikverständnisses zu unterscheiden. Auf der untersten Stufe geht es um hohe und tiefe Töne, die Bewegungsrichtung einer Melodie und die Unterscheidung von großen und kleinen Inter- vallen. Auf einer höheren Stufe wird genauer differenziert; hier geht es um eine präzise Bestimmung der Tonhöhe und um die Anzahl der Halbtonschritte in jedem Intervall bzw. um die Erkenntnis, daß in anderen Tonsystemen kein Halbtonraster existiert. Parallel dazu wird sich - mit Bezug auf tonale Musik - die Einsicht entwickeln, daß Tonhöhenverhältnisse auch eine harmonische Dimension besitzen: es werden konsonante und dissonante Intervalle unterschieden. Auf einer sehr hohen Ebene des Musikverständnisses wird man vielleicht dahin gelangen, daß jedes Intervall und jeder Akkord eine eigene Klangqualität besitzen, die beim Hören erkannt wird, und daß eine verminderte Quart ein dissonantes, eine große Terz dagegen ein konsonantes Intervall ist, obwohl beide auf dem Klavier identisch klingen. Außerdem wird man erkennen, daß Akkorde verwandt oder fremd sein, und daß Akkordfolgen den Erwartungen entsprechen oder überraschend sein können. Die traditionelle Notenschrift bietet gute Voraussetzungen, diesen Weg zu begleiten. Die Vorteile der Tonhöhendarstellung liegen in der Kombination aus einer analogen Grob- und einer symbolischen Feindarstellung. Was unmittelbar analog in vertikale Positionen im Notensystem umgesetzt wird, sind nicht die Tonhöhen, sondern die Tonstufen. Die genaue Tonhöhe ist - außer bei den sogenannten Stammtönen erst im Zusammenhang mit einem Versetzungszeichen bestimmbar. Dies Verfahren scheint verwirrend, entspricht aber genau der Hörerfahrung bei tonaler Musik: die Abstände zwischen den Stufen einer Tonleiter werden zunächst nicht als unterschiedlich empfunden. Erst eine Demonstration an einem Saiteninstrument o.ä. belehrt uns eines besseren. - Solange man sich daher auf dieser Stufe des Musikverständnisses bewegt, kann man die absolute Tonhöhen und Intervallgrößen mit hinreichender Genauigkeit aus dem Notenbild ablesen. Das Feststellen der genauen Tonhöhe ist zwar unproblematisch, wenn man die Vorzeichenbedeutungen kennt; eine präzise Intervallbestimmung ist dagegen schon wesentlich mühseliger, selbst wenn nur die Anzahl der Halbtonschritte festgestellt werden soll und man eine Klaviertastatur zu Hilfe nimmt. Sie dürfte aber das Musikverständnis in den meisten Fällen kaum weiterbringen. Erst wenn Intervallqualitäten - vollkommene / unvollkommene Konsonanz und Dissonanz - begriffen sind, kann eine genaue Intervallbestimmung von Interesse sein. - Es ist aber auch der umgekehrte Weg denkbar: das Notationsproblem kann als Einstieg in die Diskussion musiktheoretischer Fragestellungen dienen. Als Beispiel sei auf die bereits oben erwähnte verminderte Quarte cis-f verwiesen. Sinnvoller erscheint auf der mittleren Stufe des Musikverständnisses ein "heuristischer" Umgang mit Vorzeichen: eine Häufung von gleichartigen Vorzeichen zeigt oft - nicht immer - eine Modulation oder Rückung an, die auch beim Hören erlebt wird, die aber vom Höreindruck her nur schwer beschrieben werden kann. Betrachtet man andere Notationsformen, die eine präzise Tonhöhennotation erlauben - alle anderen können ohnehin nur der untersten Stufe des Musikverständnisses gerecht werden - , so erscheint neben dem System von Obuchov37 von 1915, das die Vorzeichen gewissermaßen in die Notenform einbezieht, sonst aber keine Vorzüge gegenüber der Standardnotation bringt, vor allem das System interessant, in dem Hauer 1925 seine "Tropen" notierte und das durch Walter Steffens weiterentwickelt wurde38: es kommt ohne Vorzeichen aus, behandelt daher alle zwölf Töne wirklich gleichberechtigt, und ist gleichzeitig durch die Anlehnung an die Klaviertastatur zugleich übersichtlich und unmittelbar verständlich. Oktavverwandtschaften sind unmittel37 38 Zu Obuchov und Hauer vgl. Danuser 1984, 131-135. Walter Steffens, Entwurf einer abstrakt-temperierten Notenschrift. Neue Zeitschrift für Musik 7/1961.Zitiert nach Karkoschka 1966, 11. bar ablesbar, gleich große Intervalle werden durch gleich weit entfernte Noten repräsentiert. Karkoschka favorisiert dagegen das System "Equiton": durch Verwendung unterschiedlicher NotenkopfFormen könnten hier bis zu 32 Tonstufen je Oktave unterschieden werden39. - Dagegen fehlt bei der Balkennotation, wie sie Computerprogramme verwenden, trotz der seitlich angebrachten Klaviertastatur, die die Rolle des "Schlüssels" spielt, die Orientierung. Intervallqualitäten können nur mit Mühe oder überhaupt nicht unterschieden werden: Tritonus und Quint sehen (fast) gleich aus. Die Unterscheidung von verminderter Quart und großer Terz dagegen ist auch bei Hauer nicht möglich. Zum Herausarbeiten tonal-harmonischer Zusammenhänge eignet sich daher keines der alternativen Systeme. An dieser Stelle soll kurz auf die verschiedenen Formen eingegangen werden, die die Harmonik in unmittelbarer Form sichtbar machen, also Akkordschriften aller Art. Neben dem ärgerlichen Nebeneinander verschiedener Nomenklaturen liegt die hauptsächliche Schwäche solcher Schriften darin, daß sie absolut und nicht relativ notieren, so daß die Entsprechungen funktional gleicher Akkordfolgen in verschiedenen Tonarten nicht deutlich wird. Die Generalbaßschrift, für die das nicht gilt, hat dafür den anderen Nachteil, daß der Grundton der Akkorde erst errechnet werden muß. Vorzuziehen wären also Stufen- oder Funktionsbezeichnungen, die dann allerdings, um für die Musikpraxis nutzbar zu sein, erst umgerechnet werden müßten. Eine interessante Variante der Balkennotation wäre die, die die Lage eines Dreiklangs im Quintenzirkel darstellen und damit harmonische Beziehungen wirklich veranschaulichen würde. Zeitliche Struktur / Rhythmik Ebenso wie bei der Tonhöhe sollen zunächst verschiedene Stufen des Musikverständnisses unterschieden werden. - Auf der untersten Stufe wird es um gleichmäßige und ungleichmäßige rhythmische Bewegung, Metrum, Taktart und Tempo, lange und kurze Töne und das ungefähre Lokalisieren von musikalischen Ereignissen gehen. Auf einer mittleren Stufe geht es um rhythmische Grundmuster, die ein Musikstück prägen, verschiedene rhythmische Schichten, Beschleunigung und Verlangsamung, Differenzierung zwischen schnellem Tempo und schnellen Notenwerten. Auf der höchsten Stufe schließlich werden rhythmische Charaktere erkannt (wobei bereits die Artikulation einbezogen werden müßte, denn es ist ein Unterschied, ob ein punktierter Rhythmus staccato oder legato ausgeführt wird). Die traditionelle Notenschrift stellt die zeitliche Struktur der Musik mit Hilfe der Notenwerte dar. Die dafür verwendeten Symbole - verschieden aussehende Noten - bedeuten zunächst nur Relationen 1 : 2 : 4 : 8 etc., die erst im Zusammenhang mit Metrum und Tempo eine klare Bedeutung erhalten. - Dem üblichen Verständnis nach geben die Notenwerte Auskunft über die Dauer der Töne. Dies gilt jedoch genaugenom39 vgl. Karkoschka 1966, 13. men nur für legato ausgeführte Streicher- oder Bläsermelodien. Bei allen anderen Instrumenten und Artikulationsweisen weichen die Tondauern von den Notenwerten ab. Bei Stabspielen z.B. können im Grunde keine Töne verschiedener Dauer erzeugt werden; dennoch wird man zur Notation von Melodien unterschiedliche Notenwerte verwenden. Das musikalische Substrat der Notenwerte ist also nicht die Tondauer, sondern der zeitliche Abstand zum Anfang des nächsten Tons. Hierin stimmt die Notation mit der Hörwahrnehmung überein, denn auch für diese ist die zeitliche Ordnung der Toneinsätze wichtiger als die Tondauern. In einfachen Situationen hält sich die Notenschrift an sinnvolle Grundprinzipien: für jeden Ton wird eine Note aufgeschrieben, Gleichzeitiges steht untereinander, nacheinander Erklingendes wird von links nach rechts gelesen. - Der Bezug zum Metrum aber, das für die Wahrnehmung der zeitlichen Ordnung unverzichtbar ist, wird durch Taktstriche nur unvollkommen dargestellt; innerhalb eines Taktes kann man die zeitliche Position einer Note nur ermitteln, indem man die Notenwerte der vorangehenden Noten addiert. Diese Gegebenheit macht Pausensymbole notwendig. Sie dienen gewissermaßen als Abstandhalter: wenn ein Ton in der Taktmitte einsetzen soll, so muß die zeitliche Distanz vom Taktanfang bis zur Taktmitte durch ein Pausensymbol dargestellt werden. Zum einen wird hierdurch das Prinzip "je Ton eine Note" durchbrochen - es wird etwas notiert, wo klanglich nichts ist. Zum anderen sind die Pausensymbole unglücklich gewählt; sie scheinen weder untereinander noch mit den Notenwert-Symbolen in Zusammenhang zu stehen. Nur bei Achtelnoten und -pausen und kleineren Werten ist das Bildungsprinzip dasselbe. Das Prinzip "je Ton eine Note" muß auch dort durchbrochen werden, wo die Dauer (bzw. Einsatzdistanz) sich nicht durch einfache Notenwerte darstellen läßt. Die allgemeine Lösung für diesen Fall besteht darin, daß man zwei oder mehrere aufeinanderfolgende Noten gleicher Tonhöhe durch einen Haltebogen zu einem Zeichen für einen Ton verbindet. Unseligerweise ist der Haltebogen kaum von einem Legatobogen zu unterscheiden, der z.B. die Töne c und cis verbindet. Hier gibt es, lernpsychologisch gesehen, Interferenzprobleme. Im Zusammenhang mit der Regel, daß für übergebundene Noten im neuen Takt das Versetzungszeichen nicht wiederholt wird, ergibt sich für den Lernenden die schwierige Situation, das folgende Notenbeispiel interpretieren zu müssen: Hinzu kommt, daß hier die Grundregel, wonach jedem erklingenden Ton eine Note entspricht, durchbrochen wird. So werden Schüler, die nach Noten spielen, dazu tendieren, übergebundene Noten neu anzuschlagen. Als Sonderfall der Überbindung wird die Punktierung gehandhabt. Sie ist gewissermaßen eine Abkürzung für den besonderen Fall, daß die Dauer der letzten durch Haltebogen verbundenen Note zur Dauer der vorigen im Verhältnis 1:2 steht. Auch hier gibt es Interferenzprobleme, wenn der Punkt hinter der Note mit dem Staccatopunkt über oder unter der Note verwechselt wird. Weil die Position einer Note im Takt sich nur sehr umständlich über die Addition aller vorigen Notenwerte ermitteln läßt, haben sich in der Notationspraxis Konventionen zur Gliederung des Notenbildes ent- wickelt. So werden Achtelnoten und kleinere Notenwerte durch Balken zusammengefaßt, größere Notenwerte werden je nach ihrer Position im Takt u.U. geteilt: Einerseits ist es damit leichter, die zeitliche Position der Note im Takt zu erkennen, andererseits aber bekommen damit selbst eingängige Pop-Rhythmen, die mit vorgezogenen Noten arbeiten, oft ein sehr kompliziert es Aussehen. Hilfreich ist allerdings die Möglichkeit, mehrere kleinere Notenwerte durch entsprechende Verbindungsbalken zu Gruppen zusammenzufassen. Dies erleichtert das Erkennen von rhythmischen Grundmustern wie z.B. punktierten Rhythmen erheblich, und durch das unterschiedliche Aussehen der Notenwerte läßt sich mit einem Überfliegen einer Partiturseite z.B. schnell der häufigste Notenwert ermitteln, was - in Verbindung mit der Tempoangabe - bereits auf einer der unteren Stufen des Musikverständnisses eine Vorstellung von dem rhythmischen Fluß eines Musikstücks vermitteln kann. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die innerhalb der traditionellen Notation die Rhythmusnotation mit weitaus größeren Schwierigkeiten behaftet ist als die Tonhöhennotation. Die Vorteile der symbolischen Darstellung der Tondauern liegen in einer Straffung des Notenbildes, in der Möglichkeit zur exakten Darstellung der rhythmischen Proportionen und in der schnellen Erkennbarkeit rhythmischer Muster. - Die Nachteile werden überall dort offenbar, wo von dem sinnvollen Grundprinzip - eine Note pro Ton - abgewichen werden muß, also zum einen bei Pausen und zum anderen bei der Verwendung von Haltebögen. Außerdem wird das für die musikalische Wahrnehmung Entscheidende - die Position eines Ereignisses innerhalb des Taktes - nur mittelbar dargestellt. Im Hinblick auf die zeitliche Organisation bietet daher z.B. die Balkennotation einige Vorteile gegenüber der traditionellen Notenschrift: das Grundprinzip - ein Balken pro Ton - wird streng durchgehalten; wo nichts klingt, wird auch nichts notiert. Auch die Position eines Ereignisses innerhalb des Taktes, ja sogar relativ zu den Zählzeiten kann durch Hilfslinien gut sichtbar gemacht werden. Diese Vorteile werden erkauft entweder mit einer größeren horizontalen Ausdehnung (bei großem Maßstab) oder mit kaum noch erkennbaren rhythmischen Proportionen bei kleinen Notenwerten (bei kleinem Maßstab). - Das Erkennen von rhythmischen Grundmustern wird allerdings weniger unterstützt, da die entstehenden Notenbilder weniger charakteristisch sind. Klangfarbe / Artikulation / Dynamik Diese drei Parameter werden hier gemeinsam behandelt, da unter ihnen ein sehr enger Zusammenhang besteht: ein Akzent z.B. kann vom Musiker durch einen Wechsel der Klangfarbe oder auch durch einen Wechsel der Dynamik realisiert werden. - Auch hier können unterschiedliche Stufen des Musikverständnisses unterschieden werden. Auf der untersten Stufe nämlich geht es um das Erkennen verschiedener Instrumente und ihrer Gruppenzugehörigkeit, um piano und forte, um staccato und legato. Auf einer höheren Stufe können Spielweisen oder Register von Instrumenten sowie solistischer und chorischer Klang unterschieden werden. Auch das Verständnis der Dynamik kann vertieft werden: nicht nur pianissimo und piano sind zu unterscheiden, sondern ebenso verschiedene Arten des pianissimo. Es ist klar, daß auf dem Gebiet der Artikulation erst recht unerschöpfliche Differenzierungsmöglichkeiten bestehen. Man sieht an diesen Überlegungen, daß man auch auf diesem Weg ins Zentrum des Musikalischen gelangen kann. In der traditionellen Notenschrift wird dieser Bereich vorwiegend verbal notiert. Was die Klangfarbe betrifft, so wird sie genaugenommen überhaupt nicht notiert: wenn z.B. eine Melodie von Horn und Cello zu spielen ist, dann steht sie eben in der Partitur zweimal, nämlich in der Horn- und in der Cellostimme. Einzig Schönbergs Particell (s.u.) notiert das Ereignis nur einmal und gibt dazu die (kombinierte) Klangfarbe an. - Klangfarbendifferenzierungen (Dämpfer, besondere Spielweisen) sind meist verbal angegeben; um sie zu dechiffrieren, empfiehlt sich die Verwendung eines Instrumentenhandbuchs, da hierzu eine Fülle von Detailkenntnissen erforderlich ist. Artikulationszeichen - Staccatopunkt, Tenutostrich, Akzentzeichen etc. - haben meist keine präzise festgelegte Bedeutung: nach einem staccato gespielten Ton sollte auf jeden Fall eine erkennbare Lücke zum nächsten Ton bleiben; ihre genaue Länge hängt jedoch vom musikalischen Zusammenhang und von der Interpretation ab. Auch bei Angaben der Dynamik ist zu fragen, ob sie absolut oder auf das jeweilige Instrument bezogen sind: Ein c' der Flöte im forte ist sicherlich weniger durchdringend als ein piano in der bequemen Mittellage der Posaune. - Zusammenfassend läßt sich sagen, daß dieser ganze Bereich ein Stiefkind der traditionellen Notenschrift ist, sofern man sie als Mittel zum Musikverständnis sieht. Wie aber steht es mit anderen Notationsformen? - In der Balkennotation könnte man durch unterschiedliche Schwärzung oder Dicke der Balken die Dynamik deutlich machen, durch unterschiedliche Färbung eventuell sogar die Klangfarbe; allerdings wäre eine Legende erforderlich, da unmöglich allen denkbaren Instrumentenkombinationen eine fixierte Farbe zugeordnet werden könnte. Die Artikulation dagegen würde in den anderen musikalischen Parametern aufgehen: zwischen einer Zweiunddreißigstel und einer staccato gespielten Sechzehntelnote bestünde in der Notation kein Unterschied. Dies ist u.U. im Hinblick auf die "hinter dem Klang stehende Bedeutung" (vgl. 3.2.) problematisch, und es gibt auch nicht das wieder, was der Musiker macht. Die einzige Notation, die Klangfarben mit wissenschaftlicher Genauigkeit wiedergeben könnte, wäre das Sonagramm: wenn die Klangfarbe physikalisch bestimmt ist durch das mikrozeitlichen Veränderungen unterworfene Obertonspektrum eines Tones40, so wäre entweder ein dreidimensionales Diagramm erforderlich, in der die Amplitude der Obertöne abhängig von Frequenz und Zeit dargestellt wird, oder eben ein Sonagramm. Nur mit einer solchen Darstellung ließen sich z.B. kontinuierliche Klangfarbenveränderungen, wie sie auf elektronischem Wege möglich sind, sichtbar machen. Bei akustischen Instrumenten sind ebenfalls feine Klangfarbenverschiebungen möglich, die durch spezielle Spieltechniken hervorgerufen werden. Auch das, was man gemeinhin unter "Artikulation" versteht, findet seine physikalische Entsprechung in solchen Klangfarbenveränderungen, wie sie im Millisekundenbereich beim Ein- und Ausschwingen von Tönen geschehen. - Diese Überlegungen machen deutlich, daß die Notation der Klangfarbe zwar technisch aufwendig, aber möglich wäre. Es erscheint jedoch fragwürdig, ob das Ergebnis anschaulich wäre, und ob es als Mittel zum Musikverständnis in der Schule einsetzbar wäre. Struktur / Form Was die Strukturen der Musik betrifft, so muß zunächst zwischen Grob- und Feinstrukturen unterschieden werden. Dabei gilt für die Notation von Musik wie wohl für jede graphische Darstellung, daß die Aufmerksamkeit umso mehr der Grobstruktur zugewandt werden kann, je mehr Details weggelassen werden. Insofern ist fragwürdig, ob eine Notationsform, die jeden Ton notiert, sich überhaupt für Untersuchungen 40 vgl. E. Donell Blackham, Klaviere. Die Physik der Musikinstrumente.Verständliche Forschung. Heidelberg: Spektrum-Verlag, 1988. 100 - 109. Bes. S. 105ff. der Form - also der groben zeitlichen Struktur - eignet. Andererseits sind - z.B. bei Exposition und Reprise eines Sonatensatzes - teilweise gerade die Abweichungen im Detail bei im wesentlichen übereinstimmenden Formteilen interessant, so daß man gewissermaßen beides braucht: das Weitwinkel- und das Teleobjektiv. Auch hier sollen nun zunächst verschiedene Stufen des Musikverständnisses unterschieden werden. Auf der untersten Stufe ist ein Musikstück nur grob nach den Gesichtspunkten Gleichheit, Ähnlichkeit und Kontrast gegliedert: es gibt identische oder leicht abgewandelte Wiederholungen oder auffällige Wechsel des Charakters oder der Instrumentation. Auf einer höheren Stufe geht es zum einen um verschiedene Klangschichten und deren Beziehungen zueinander und zum anderen um eine differenziertere Wahrnehmung von Ähnlichkeit und Verschiedenheit im Nacheinander. Ob eine sogenannte Studienpartitur das optimale Mittel ist, ein so beschriebenes strukturelles Musikverständnis zu fördern, muß bezweifelt werden. Arnold Schönberg schreibt 1917 im Vorwort zu der Partitur seiner Orchesterlieder op. 2241: [Die bisher übliche Partiturform] besitzt den Vorzug, daß in ihr jedes einzelne Instrument genau so geschrieben ist, wie die Stimmen für die Musiker, wodurch der Kapellmeister verhältnismäßig mühelos die Richtigkeit der Abschrift der Stimmen prüfen kann. Das ... erschwert aber die Lesbarkeit der Partitur. Denn die vielen transponierenden Instrumente machen es dem besten Partiturspieler fast unmöglich, komplizierte Notenbilder zu lesen. Und der Umstand, daß Stimmen, die ja nur einmal klingen, zwei- drei- und noch vielmal öfter dastehen (ich meine die Verdopplungen), bedingt, daß Gebilde, die auf zwei bis sechs Zeilen Platz fänden, 15 - 30 und mehr Zeilen beanspruchen. (2/1) Über die Grundsätze der von ihm entwickelten "vereinfachten Studier- und Dirigier-Partitur" schreibt er: IV. Jedes Ereignis soll auf die einfachste Art notiert werden; d.h. 1. Stimmen, die von mehreren Instrumenten gespielt werden, sind nur einmal zu notieren. (...) 2. Stimmen, die in gleichem Rhythmus gehen, sollen womöglich gemeinsam "abgestrichen" werden. 3. Die Harmonien sind womöglich so zusammenzuziehen, wie dies im Klavierauszug geschieht, so daß man so oft es geht, den ganzen Akkord beisammen hat. 4. Es werden stets nur so viel Systeme verwendet, als zur Darstellung unbedingt nötig sind. 5. Auf ein System können stets zwei, eventuell sogar drei selbständige Stimmen, oder eine selbständige Stimme und eine mehrstimmige Harmonie oder eine Begleitungsfigur gesetzt werden (...) 6. Systeme, die nicht mehr verwendet werden, können (unbeschadet des dadurch entstehenden leeren Raumes) auch mitten in der Zeile weggelassen werden. 7. Die Bezeichnung des mitwirkenden Instruments am Rande entfällt; an deren Stelle geschieht Folgendes: (2/2) a) In jedem System wird zu jeder Stimme unterVerwendung der üblichen Abkürzungen in großer, hervortretender Schrift der Name des oder der einsetzenden Instrumente notiert. (...) (3/1) Leider hat sich dieser Partiturtypus - im folgenden als Particell bezeichnet - als Editionsform nicht einmal bei Schönbergs eigenen Werken durchsetzen können. Andererseits zeigen moderne Klavierauszüge die Tendenz zum Particell, indem sie Instrumentationsangaben einbeziehen und an einzelnen Stellen auch mehr als zwei Systeme verwenden. Als gedrucktes Material stehen also weiterhin nur Partituren und Klavierauszüge zur Verfügung, was unter pädagogischen Aspekten zu bedauern ist. Denn im Particell lassen sich einerseits Detailinformationen ablesen, andererseits sind die Klangschichten der Musik auf einen Blick erfaßbar. Das liegt daran, das das Particell am musikalischen Ereignis und nicht an der Einzelstimme orientiert ist. - Zur Verdeutlichung soll der Anfang des Largos aus der 9. Sinfonie von Antonin Dvorak zunächst im Particell gezeigt werden: 41 Arnold Schönberg. Vier Lieder op. 22 für Gesang und Orchester. Vereinfachte Studier- und Dirigier-Partitur. Wien: Universal Edition, o.J. (UE 6060) Der Vorzug des Particells gegenüber der Studienpartitur42 wird deutlich, sobald man versucht, die Bläserakkorde zu lesen: 42 Antonin Dvorak. Symphonie Nr. 9. London - Zürich - Mainz - New York: Eulenburg, o.J. 55 f. Daß in der Balkennotation harmonische Sachverhalte schwieriger zu erkennen sind als in der traditionellen Notation, wurde bereits gesagt. Die Instrumentation kann durch unterschiedliche Schraffur deutlich gemacht werden. Es fällt aber auf, daß die langgezogenen und weniger wichtigen Töne in der Streicherbegleitung übermäßig stark in den Vordergrund treten, der Durchgang in der zweittiefsten Bläserstimme im dritten Takt dagegen kaum auffällt. Der immer gleichbleibende Rhythmus im Englischhorn kann ebenfalls kaum erkannt werden, da wegen der großen vertikalen Entfernung der Melodietöne die Gruppenbildung erschwert wird. Freilich bietet die Balkennotation wegen der Freiheit in der Wahl des Maßstabs die Möglichkeit, ein längeres Stück auf wenige Zentimeter zusammenzuziehen. Eine solche Darstellung eines Ausschnitts aus Chales Ives' Unanswered Question ist in dem von Rudolf Frisius herausgegebenen Materialheft Notation und Komposition enthalten (Frisius 1980, 32). Zusammenfassend kann gesagt werden, daß zur Bildung eines differenzierten Musikverständnisses jedenfalls präzise Notationsformen notwendig sind, die eine detaillierte Musikaufzeichnung ermöglichen. Eine solche Darstellung ist zwar nicht für alle Zwecke optimal, es können aber Techniken entwickelt werden, die es erlauben, aus detaillierten Notaten auch größere Zusammenhänge herauszulesen. Darauf wird näher im letzten Abschnitt des nächsten Kapitels eingegangen werden. Dagegen können graphische Notationsformen, die die musikalischen Ereignisse nur ungefähr festhalten, zwar zur Aufzeichnung von Höreindrücken dienlich sein; sie ermöglichen aber keinen Zugang zu Begriffen wie Tonsystem, Harmonik, Stil etc., die für ein vertieftes Musikverständnis wichtig sind. Will man beispielsweise darstellen, daß die indische Musik für eine Tonstufe bis zu drei Srutis kennt, die sich in der Tonhöhe nur um einen minimalen Betrag unterscheiden, dann muß man entweder Zusatzzeichen verwenden, die eine präzise Notationsform noch weiter präzisieren, oder man muß eine ganz andere, auf das indische Tonsystem zugeschnittene Notation verwenden; eine ungefähre Notation aber vermag den Sachverhalt nicht darzustellen. Bezieht man die Überlegungen der vorigen beiden Abschnitte mit ein, so kommt man zu dem Ergebnis, daß die traditionelle Notenschrift auch weiterhin von zentraler Bedeutung für den Musikunterricht sein sollte. Dabei ist es sinnvoll, ihre Einführung durch die Arbeit mit graphischen Notationsformen vorzubereiten und ihren Gebrauch immer wieder durch die Einbeziehung anderer Notationsmöglichkeiten zu ergänzen. - Daß es übrigens auch bei stark reduzierenden Block- bzw. Hörpartituren sinnvoll sein kann, neben verbalen Beschreibungen Zeichen aus der traditionellen Notation einzubeziehen, soll abschließend das folgende Beispiel zeigen (es handelt sich wiederum um den Anfang des Largos aus der 9. Sinfonie von Antonin Dvorak): 5. Methodische Aspekte zum Notieren von Musik im Unterricht Nach Eckhard Nolte besteht "die grundlegende Aufgabe methodischen Handelns in der Planung und Gestaltung von Lernsituationen, die durch bestimmte Aufgabenstellungen charakterisiert sind" (Nolte 1982, 72). - Auf der Suche nach charakteristischen Lernsituationen im Musikunterricht stößt man immer wieder auf die in der folgenden Tabelle dargestellten musikalischen Umgangsweisen: Venus 1969 Lemmermann 1977 Fischer 1982, 133 Nolte/Kaiser 1989, 31 I. Produktion (Komposition / Improvisation) 1. Gestalten 1. Singen / Spielen / Improvisieren 4. Erfinden II. Reproduktion (vokal / instrumental; solistisch / chorisch) 2. Nachgestalten III. Rezeption 4. Akzipieren 2. Hören IV. Transposition in Bewegung, Sprache, Bild 3. Umgestalten 3. Mit Notation umgehen 5. Abbilden in ein 4. Umsetzen in anderes Medium Bewegung, Szene, Bild V. Reflexion (incl. Aneignung von Kenntnissen) 5. Informieren 5. Erfinden / Experimentieren / Instrumente basteln 6. Nachdenken 6. Reflektieren 3. Darstellen 1. Hören / Wahrnehmen 2. Nachdenken Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, herrscht zwischen verschiedenen Autoren über einen Zeitraum von zwanzig Jahren im wesentlichen Einigkeit über die schulisch relevanten musikbezogenen Verhaltensweisen; lediglich in der Reihenfolge der Nennung (hier durch Ordnungszahlen wiedergegeben) und in einigen Details gibt es Unterschiede. So weicht Wilfried Fischer in drei Punkten von den anderen Autoren ab: er verzichtet auf die in der Schulpraxis weniger bedeutende Unterscheidung zwischen Produktion und Reproduktion, räumt dafür dem Umgang mit Notation einen eigenen Punkt ein und bezieht außerdem Experimentieren und Basteln ein (zur Begründung vgl. Fischer 1982, 132). Auf die zentrale Bedeutung dieser Umgangsweisen mit Musik für die konkrete Planung des Musikunterrichts ist verschiedentlich hingewiesen worden, u.a. durch Fischer: Die bewußte Konzentration auf die Tatsache der weitgehenden Analogie von Methoden und musikalischen Verhaltensweisen hat nichts mit einer Abwertung oder Unterbewertung anderer methodischer "Entscheidungsfelder" (Artikulationsschemata, Sozialformen, Unterrichtsformen, Medieneinsatz) zu tun, sondern beruht auf der schulpraktischen Erfahrung, daß Entscheidungen über die in bestimmten inhaltlichen Zusammenhängen sinnvollen musikalischen Aktivitäten allen anderen Entscheidungen vorgeordnet sind. (Fischer 1982, 143) Dabei ist es besonders für den Unterricht in der Grundschule wichtig, über ein möglichst großes und vielfältiges Repertoire an verschiedenen Arbeitsformen zu verfügen: Gerade in einer Entwicklungsphase des Schulkindes, in der die Aufmerksamkeitsspanne noch vergleichsweise gering ist, d.h. die Fähigkeit, sich längere Zeit einer Sache oder Tätigkeit konzentriert zuwenden zu können, erst allmählich wachsen muß, hängen Lehr- und Lernerfolg wesentlich von einer methodisch variablen Lernorganisation ab. Dies muß nicht etwa einen Wechsel in der Sache (des Lerngegenstandes) innerhalb einer Unterrichtsstunde bedeuten, wie vielfach irrtümlich geglaubt wird, sondern es meint einen Wechsel der methodischen Vermittlungsform. Da im musikdidaktischen Sprachgebrauch der Begriff Methode sehr eng an den Begriff musikalische Verhaltensweise gekoppelt ist, kann Methodenwechsel (cum grano salis) fast immer als Wechsel der Verhaltensweise verstanden werden. (Fischer 1982, 131) In diesem Sinne soll im folgenden Abschnitt zunächst ein Raster für notationsbezogene Arbeitsformen im Musikunterricht erstellt werden, das vor allem dazu dienen soll, die Vielfalt der möglichen Umgangsformen mit Notation aufzuzeigen, um bei der konkreten Unterrichtsplanung auf ein möglichst reichhaltiges methodisches Repertoire zurückgreifen zu können und so einen häufigen Methodenwechsel realisieren zu können. - Im zweiten Abschnitt sollen Medien, die im Zusammenhang mit notationsbezogenen Arbeitsformen eingesetzt werden, u.a. daraufhin untersucht werden, für welche Aufgabenstellungen sie besonders geeignet erscheinen und welche Sozialformen sie ermöglichen. Im dritten und letzten Abschnitt schließlich werden einige methodische Prinzipien und Elemente bei der Einführung der traditionellen Notenschrift kritisch erörtert. 5.1. Notationsbezogene Arbeitsformen im Musikunterricht Das folgende Raster ist nach sachlogischen Gesichtspunkten gegliedert:eine Notationsform muß erst erlernt werden, bevor sie gelesen und geschrieben, und bevor über sie nachgedacht werden kann. Dies ist jedoch nicht so zu verstehen, daß hiermit eine für den konkreten Unterricht verbindliche Schrittfolge vorgegeben wäre. Vielmehr kann z.B. das Untersuchen (-> Lesen) einer Partitur der Information (-> Erlernen) über die Bedeutung der in ihr vorkommenden Zeichen vorausgehen. A. Erlernen In dem Maße, in dem die verwendete Notationsform ein verbindliches Zeichensystem darstellt, müssen die Zeichen, ihre Bedeutung und die Transformationsregeln erlernt werden. Dies Erlernen umfaßt im wesentlichen zwei Teilprozesse: die Information und die Übung, die vor der eigentlichen Anwendung einen sicheren und flüssigen Umgang mit dem Gelernten zum Ziel hat. Darüberhinaus muß geklärt werden, wie bereits bekannte Sachverhalte nach einer Phase des Vergessens wieder aktiviert werden können, ohne daß man den Stoff von neuem durcharbeitet; dies führt auf das Wiederholen als selbständige methodische Arbeitsform. - All diese methodischen Arbeitsweisen sind nicht musikspezifisch: sie sind charakteristisch für alle Lerninhalte, die verbindlich vorgegeben sind, wie Grammatik oder Rechenregeln. Daher wird man sicherlich auch in der fachdidaktischen Literatur anderer Fächer wertvolle Anregungen finden. Information Die Information über Zeichenvorrat, Bedeutung und Transformationsregeln einer Notationsform kann in der Regel nicht auf einmal erfolgen, sondern muß in kleine Lernschritte aufgeteilt werden, zwischen denen Übephasen stattfinden. Dabei gilt: "Der Lerninhalt konstituiert sich beim Lernenden entsprechend dem Weg der Vermittlung" (Kaiser/Nolte 144) Es ist also äußerst wichtig für den weiteren Unterrichtsverlauf, in welcher Weise die Information methodisch aufbereitet ist, die den Schülern gegeben wird, d.h. in welcher Reihenfolge die Lernschritte stattfinden, wie groß sie sind, und in welcher Richtung fortgeschritten wird (z.B vom Ganzen zum Detail oder umgekehrt). Außerdem sind hier neben verschiedenen Möglichkeiten, wie die Informationen an die Schü- ler herangetragen werden können - etwa durch Erklärungen des Lehrers oder durch schriftliche Anleitungen - auch die Rolle von Medien zu bedenken. Im dritten Abschnitt dieses Kapitels werden diese Fragen am Beispiel der traditionellen Notenschrift ausführlich erörtert werden. Übung In anderen Fächern wie Mathematik oder Latein ist diese methodische Arbeitsweise ein Hauptbestandteil des Unterrichts. In Musik dagegen scheint sie verpönt zu sein, obwohl jeder Lehrer in seinem Studium die Wichtigkeit des Übens für das Instrumentalspiel am eigenen Leib erfahren hat. Vielleicht ist aber gerade deshalb ein Üben anderer Fertigkeiten im Klassenverband für einen Musiker schwer vorstellbar. Anders als beim Allein-Üben muß z.B. auf unterschiedliche Interessen und Lernniveaus Rücksicht genommen werden; daher sind abwechslungsreiche Übemethoden gefragt. Das Bewältigen der - angemessen schwierigen - Übungsaufgaben kann die Schüler motivieren: am steigenden Schwierigkeitsgrad der Aufgaben können sie ihren eigenen Lernerfolg ablesen. Auch im Hinblick auf spätere Anwendungen des Geübten kann vorgearbeitet werden, indem bereits hier - sozusagen auf der Spielwiese - voraussehbare Stolpersteine ausgeräumt werden können. Insofern hat die Qualität des Übens einen nachhaltigen und langfristigen Einfluß auf die Motivation der Klasse. Rudolf-Dieter Kraemer hat hierzu eine umfangreiche Sammlung von Arbeitsblättern herausgegeben, die den Übeprozeß immer wieder interessant zu gestalten ermöglicht43. Wiederholung Gerade im Fach Musik, und gerade im Zusammenhang mit der Notenschrift gibt es viele Gründe, sich genau zu überlegen, wie man Sachverhalte, deren Behandlung im Unterricht längere Zeit zurückliegt, wieder ins Gedächtnis der Schüler zurückruft. Bei maximal zwei Wochenstunden, in denen sich der Musikunterricht mit sehr vielfältigen Fragestellungen beschäftigen muß, wird es häufig vorkommen, daß ein großer Teil der Schüler sich an wichtige, bereits besprochene Dinge nicht mehr erinnern kann - zumindest nicht mehr hinreichend genau. Wie falsch es nun wäre, wenn alles noch einmal von vorn besprochen würde, wie demotivierend dies auf die Schüler mit besserem Gedächtnis wirken muß, weiß jeder, der solche Situationen schon einmal erlebt hat. Auf der anderen Seite wäre es sinnlos, nun mit einem Drittel der Klasse einfach weiter voranzuschreiten. Es muß den Schülern Gelegenheit gegeben werden, sich je nach Notwendigkeit die für den Fortgang wichtigen Details wieder anzueignen, ohne daß der gesamte Unterricht darunter leidet. Hier bieten sich vor allem Medien an, also z.B. Tafeln, die die wichtigsten Informationen enthalten und während der gesamten Unterrichtsstunde für alle sichtbar sind. Außerdem kann eine Wiederholungsphase dazu genutzt werden, das Wissen von Ballast zu befreien. Hat man zum Beispiel die Vorzeichen einer Tonart bisher ermittelt, indem man vom Grundton aus die entsprechende Folge von Ganz- und Halbtonschritten bildete, so kann eine Wiederholung z. B. im Zusammenhang mit der Einführung des Quintenzirkels erfolgen; das Ergebnis wäre so neben der Reaktivierung des Wissens eine Straffung, da ab jetzt eine schnellere Methode zur Vorzeichenbestimmung benutzt werden könnte. Die Schüler, die sich an die alte Methode noch erinnern, hätten den Vorteil eines tiefergehenden Verständnisses der QuintenzirkelMethode, und die anderen hätten dennoch keinen Nachteil. 43 Kraemer 1993 B. Lesen Notate untersuchen Der These, von einem sinnvollen Notenlesen könne erst dann gesprochen werden, wenn dabei eine Hörvorstellung gebildet wird, ist bereits weiter oben widersprochen worden. So kann das Arbeiten mit Notaten selbst dann eine sinnvolle Arbeitsmethode im Musikunterricht sein, wenn die Bildung einer Klangvorstellung nicht einmal intendiert ist. - Es können z.B. alle auf einer Partiturseite vorkommenden Zeichen zusammengestellt werden; dies kann zur Einführung einer Notationsform dienen. Es können aber auch durch graphischen Vergleich - Ähnlichkeiten bei den Stimmeinsätzen in einer Fuge oder Veränderungen in der Textur eines Notenbildes festgestellt werden, d.h. es können bereits Zusammenhänge hergestellt werden. Insofern handelt es sich schon um ein Lesen und nicht mehr um ein Buchstabieren, bei dem nur die Zeichenbedeutungen wiedergegeben werden. Natürlich lassen sich hieraus auch "diffuse Klangerwartungen" ableiten, aber eben auf der alleruntersten Stufe. Hörvorstellungen entwickeln - Hören mit Noten Zur Methodik dieser Aktionsform sei zunächst auf Dankmar Venus (1969) verwiesen, der das Thema ausführlich behandelt. Darüberhinaus soll auf eine Variante des Hörens mit Noten besonders hingewiesen werden: den Interpretations- bzw. Versionsvergleich. Im Bereich der klassischen Musik eignet sich diese Aktionsform besonders dazu, das Verhältnis von Intention des Komponisten, Deutung des Interpreten und Verständnis des Hörers zu thematisieren. Aber auch im Bereich der Popmusik gibt es immer wieder sogenannte CoverVersionen, d.h. Wiederaufnahmen alter Songs in neuem Gewand, und auch hier kann man fruchtbar die Frage diskutieren, welchen Sinn solche Veränderungen haben und wie schwerwiegend die Veränderungen sein dürfen, ohne daß ein anderes Stück entsteht. Notate zuordnen Diese Methode wird ebenfalls bereits bei Venus beschrieben. Auch hier müssen Klangvorstellungen gebildet werden, jedoch wird nach Art des multiple-choice-Tests verfahren, d.h. es werden verschiedene Möglichkeiten angeboten. Dabei kann ein Notat mehreren Klangbeispielen gegenüberstehen oder umgekehrt ein Klangbeispiel mehreren Notaten. - Durch diese Methode kann insbesondere das schnelle und grobe Erfassen von hervorstechenden Charakterzügen trainiert werden. - Eine weitere Variante findet sich in dem Schulbuch Hauptsache Musik: hier sollen Schlüsse (graphisch notiert) von Musikstücken ihren Anfängen (traditionell notiert) zugeordnet werden44. Dies ist möglich, wenn man aufgrund der jeweiligen Notate zunächst diffuse Hörerwartungen bildet und dann vergleicht; denkbar ist aber auch, daß man lediglich einen strukturellen Vergleich der Notate durchführt. Notiertes ausführen Wenn auch dies - musikwissenschaftlich gesehen - die zentrale Umgangsweise mit Notation sein dürfte, so ist doch ihre Bedeutung für die Schulpraxis deutlich geringer. Das liegt vor allem daran, daß neben der Fähigkeit, Notiertes zu lesen, eine Reihe weiterer, vor allem psychomotorischer Fähigkeiten nötig sind, um das Gelesene auch auszuführen. Dazu kommt, daß selbst Musiker mit jahrelanger Ausbildung vor der Aufführung im Regelfall umfangreich üben (allein) und proben (gemeinsam); dies muß beim Musizieren 44 Hauptsache Musik 7/8. Hg. Pütz, Werner und Rainer Schmitt. Stuttgart: Klett, 1995. 40f. in der Klasse, wo es doch noch viel nötiger wäre, im Regelfall aus organisatorischen Gründen fast völlig unterbleiben. Somit sind dem Ausführen von Musik ohnehin recht enge Qualitätsgrenzen gesetzt. Bei der Ausführung von Notiertem kommt es also darauf an, eine Häufung von Schwierigkeiten zu vermeiden. Das bedeutet: solange das Lesen der Notate noch Schwierigkeiten bereitet, müssen die Anforderungen im psychomotorischen Bereich möglichst gering gehalten werden. Hier bietet sich zunächst das Sprechen an, da dies seit frühester Kindheit trainiert worden ist. Die Aufmerksamkeit kann sich also voll dem Lesen und Umsetzen des Notierten zuwenden, wobei auch hier zu Anfang die Anforderungen relativ niedrig sind, solange es nur um den Rhythmus geht. Später können Betonungen, angedeutete Tonhöhenbeziehungen und erhöhtes Tempo hinzukommen. Das Sprechen von Notiertem ist für die Lesefähigkeit von großer Bedeutung, da hier Assoziationen von rhythmisierten Wörtern und Notenbildern verankert werden können, die später - im Zusammenhang mit der Tonhöhennotation - gewissermaßen als "musikalische Morpheme" abgerufen werden können. Wenn eine gewisse Sicherheit im Lesen von Rhythmusnotaten gewonnen ist, kann die Ausführung von Notiertem auch durch Spielen auf einem Instrument erfolgen. Um die Schwierigkeiten der Tonhöhennotation zunächst auszusparen, können vom Sprechen her bekannte Rhythmen auf Schlaginstrumenten gespielt werden. Auch eine gewisse Differenzierung hinsichtlich der Tonhöhe bzw. Spielweise ist hier möglich. Erst wenn dies sicher beherrscht wird, sollte der Parameter Tonhöhe mit einbezogen werden; dabei sind unter dem Aspekt des Erlernens der Notenschrift den Stabspielen oder Keyboards der Vorzug gegenüber der Blockflöte zu geben. Die psychomotorischen Schwierigkeiten, die hier hinzukommen, sind zum einen spieltechnischer Art; zum anderen ist z.B. bei Stabspielen ein Wechsel der Blickrichtung zwischen Notat und Instrument notwendig. - All dies findet hier Erwähnung, um deutlich zu machen, daß der weitaus größere Teil der Schwierigkeiten, die beim Spielen nach Notiertem auftreten können, nichts mit dem Beherrschen der Notationsform zu tun hat. Auch wenn man damit vorrangig die Lesefähigkeit entwickeln will, so muß man doch immer auch an der Beseitigung dieser anderen Schwierigkeiten arbeiten, also z.B. auf die ergonomisch günstigste Körperhaltung beim Spielen eingehen und Techniken des Vorauslesens gezielt trainieren. Das Singen nach Notiertem erfordert vor allem die Fähigkeit zur Bildung einer präzisen Tonvorstellung aufgrund des Notats - es sei denn, präzise Tonhöhen sind nicht notiert und gemeint. Im Bereich der traditionellen Notation wird daher Notiertes für die meisten Schüler lediglich als Gedächtnisstütze dienen können, die nur in Verbindung mit dem Vorsingen durch den Lehrer o.ä. sinnvoll ist. Erwägenswert ist die Kombination mit dem Instrumentalspiel: wenn die Schüler in der Lage sind, sich den Tonhöhenverlauf mit Hilfe eines Tasteninstruments selbst zu erarbeiten und das Gehörte dann nachzusingen, dann können sie damit einen Teil des im Musikalienhandel erhältlichen Angebots an Notiertem - Songbooks z.B. - sinnvoll nutzen. Dies wäre ein Ziel, das einen großen Aufwand lohnen würde. C. Schreiben Schreibübungen Bei allen Notationsformen kommt es darauf an, den Zeichenvorrat sicher zu beherrschen und zügig und lesbar zu Papier zu bringen. Gerade im Bereich der traditionellen Notation dauert es oft unverhältnismäßig lange, bis die Schüler wenige Noten aufgeschrieben haben. Sie versuchen dabei, die gedruckte Typographie nachzuahmen, was unzweckmäßig ist (im Bereich der Verbalschrift tut man dies ja auch nicht). In diesem Zusammenhang muß überlegt werden, ob nicht - analog zur Schulausgangsschrift - eine Notenschrift bzw. -schreibtechnik entwickelt werden kann, die es ermöglicht, gute Lesbarkeit mit flüssigem Schreibtempo zu verbinden. Dabei könnten neue Schlüssel- und Pausensymbole die Rationalität der Gesamtkonzeption verdeutlichen, ohne daß die Fähigkeit, traditionelle Partituren lesen zu können, darunter leiden müßte (vgl. Abb.) Um mit einer Notationsform vertraut zu werden, ist sicherlich das Abschreiben von Notaten sinnvoll. Dabei können zwei Ziele zugleich verfolgt werden: die Differenzierung der visuellen Wahrnehmung, die beim Lesen der Vorlage unterschiedliche Zeichenpositionen und Positionen unterscheiden muß, und die Klangvorstellung, die beim Lesen entsteht. Diese kann besonders unterstützt werden, wenn die Aufmerksamkeit von vornherein nicht auf die absolute Position im Notensystem, sondern auf die Intervalle gelenkt wird. Dies kann z.B. bei Transpositionsübungen geschehen. Überhaupt sollte dem Abschreiben sinnvoller Notentexte - z.B. solcher, die man später selbst realisiert - der Vorzug vor dem stupiden Füllen von Zeilen mit Violinschlüsseln oder Achtelnoten gegeben werden. Darüberhinaus kann das Abschreiben bereits mit einfachen Umgestaltungsaufgaben (z.B. zwei getrennte Stimmen richtig übereinanderstehend in eine Partitur übertragen oder zwei in einem System stehende Stimmen in zwei Systeme schreiben) verbunden werden. Gehörtes notieren Hier gilt es zu unterscheiden zwischen einer möglichst detaillierten Notation von sehr kurzen Beispielen (von höchstens fünf Sekunden Dauer) und einer gröberen Notation längerer Beispiele. Während es bei den letzteren vorwiegend um formale Aspekte geht (Wiederholungen, Entsprechungen, Gegensätze), kommt es bei den ersteren auf die größtmögliche Genauigkeit an. Beide Methoden tragen dazu bei, das Gehör zu schärfen, indem sie zum wiederholten konzentrierten Hören von Musikbeispielen zwingen. - Als kurze Hörbeispiele eignen sich hierbei neben kurzen Ausschnitten aus Werken Neuer Musik auch interessante Umweltklänge. Bei den längeren Hörbeispielen kann davon ausgegangen werden, daß eine Minute das Maximum der Aufnahmefähigkeit darstellt. Hörbeispiele von mehr als einer Minute Dauer sind nur dann sinnvoll, wenn die Aufgabe nicht in der Notation des Höreindrucks besteht, sondern von vornherein eingeschränkt wird auf bestimmte Parameter wie z.B. Instrumentation. Reizvoll dürfte in diesem Zusammenhang die Notation der Tonspur von Filmsequenzen sein, deren Geschehen die Schüler aufgrund des Gehörten erraten müssen. Hier bieten sich z.B. die Filme von Jacques Tati an, in denen die Geräusche oft eine entscheidende Rolle spielen und in gewissem Sinn "komponiert" sind45. Die Wahl der Notationsform hängt dabei von der Zielsetzung ab. Geht es um die Intensivierung des Hörens und damit der musikalischen Erfahrung, so ist unbedingt einer möglichst freien Notationsform der Vorzug zu geben, die den Schülern ermöglicht, ihre je individuellen Höreindrücke festzuhalten und zum genauen Hören ihren individuellen Weg zu finden. Eine Vorgabe einer Notationsform wirkt sich hier hin45 z.B. Tati's Playtime, Szene im Wartezimmer; zu hören sind eine Lüftung mit zwei wechselnden Tonhöhen, ein Luftkissensessel, der beim Hinsetzen die Luft herausbläst und beim Aufstehen hereinsaugt, schnalzende Lackschuhe, ein Reißverschluß etc. derlich aus, egal, ob es sich dabei um eine grobe graphische Notationsform oder irgendeine andere handelt. - Anders ist es, wenn eine möglichst genaue graphische Darstellung des objektiven Klangs angestrebt wird. Hier können präzise Höraufträge, die Einigung auf eine Notationsform und weitere "objektivierende" Hilfsmittel wie eine weithin sichtbare mitlaufende Uhr, mit deren Hilfe musikalische Ereignisse präzise lokalisiert werden können, deutlich machen, daß es hierbei nicht um individuelle Erfahrung, sondern um objektive Beschreibung geht. Komponieren Komponieren kann zum einen bedeuten, daß die Schüler eine konkrete, durch Ausprobieren entwickelte Klanggestalt durch eine Notation festhalten; es kann aber auch bedeuten, daß sie zunächst ohne konkrete Klangvorstellung Ausführungsanweisungen zusammenstellen, deren klangliches Resultat sie dann erst durch die Realisation erfahren (vgl. hierzu Kühlenthal 1976). Man sollte solch experimentierenden Umgang mit Notation nicht gering schätzen: er eröffnet zum einen den Zugang zu ganz neuartigen Klangerfahrungen, zum anderen kann durch die kritische Auseinandersetzung mit den resultierenden Klängen unter Umständen ein äußerst fruchtbarer Prozeß eingeleitet werden, in dessen Verlauf die Schüler viel darüber lernen können, wie komplexe Klänge entstehen. - Im weiteren Sinn gehört auch das Anfertigen musikalischer Grafiken unter Verwendung des Zeichenvorrats der traditionellen Notenschrift hierher. Solche "Kompositionen", bei denen nicht klar ist, ob sie überhaupt mit konkreten klanglichen Vorstellungen verbunden werden, entstehen vielfach spontan, wenn Kinder anfangen, die Notenschrift zu erlernen. Sie zeugen von der großen Faszination, die vom Schriftbild der Musik ausgeht (vgl. hierzu Möwensee, Komposition einer 8-jährigen Klavierschülerin, im Anschluß an dieses Kapitel). Übersetzen Gemeint ist hier das Übersetzen von einer Notationsform in eine andere. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn in einer gegebenen Notationsform eine bestimmte Eigenschaft der Musik nicht in der gewünschten Deutlichkeit erscheint. So könnte man z.B. anhand einer traditionellen Partitur ein Instrumentations- oder Dynamikdiagramm anfertigen lassen. Dies wäre eine Reduktion, da der umgekehrte Weg nicht möglich wäre. Denkbar ist auch eine Vereinfachung des Notenbildes, indem Oktavverdopplungen weggelassen werden, Spielfiguren (Dreiklangsbrechungen etc.) nur angedeutet werden und im übrigen nur Hauptstimmen und Begleitakkorde (in Akkordschrift) übrigbleiben (vgl. hierzu auch das Particell im Sinne Schönbergs). Die Balkennotation kann zur Veranschaulichung der Notenwerte in der traditionellen Notenschrift dienen, wie ein Blick in das Schulbuch Musik im Leben zeigt: dort werdenüber viele Seiten hin traditionelle Notation und Balkennotation parallel geführt46. Insofern könnten Übersetzungsübungen von der traditionellen Notenschrift in die Balkennotation und umgekehrt das Verständnis der traditionellen Rhythmusnotation fördern. D. Reflektieren Es kann über verschiedene Aspekte von Notationsformen nachgedacht werden, z.B. über ihre Funktionalität, ihre Angemessenheit (im Hinblick auf die dargestellte Musik), ihre Ästhetik. Ein solches Nachdenken macht jedoch wenig Sinn, wenn nicht Alternativen zu der jeweiligen Notationsform bekannt sind oder 46 Musik im Leben. Schulwerk für die Musikerziehung. Hg. Prof. Dr. Josef Heer und Prof. Edgar Rabsch. Neu durchgesehen von Prof. Dr. Richard Jakoby. Bd. II: Ein Buch zur Musiklehre und Werkbetrachtung. Frankfurt/M. - Berlin - Bonn - München: Diesterweg, 111968. S. 14 - 40. wenigstens ansatzweise entwickelt werden. Insofern gehört auch das Erfinden von Notationsformen hierher. Die Reflexion über die Funktionalität einer Notationsform könnte z.B. die Fragen ansprechen, wieviele Zeichen verwendet werden (Ökonomieprinzip), wie deutlich sie sind, wie leicht sie zu lernen sind; hier kann auch darauf eingegangen werden, daß es u.U. sinnvoller ist, eine weniger angemessene Notenschrift zu akzeptieren, die aber bereits weltweit geläufig ist, als eine neue zu erfinden, die mühevoll gelernt werden muß und dann nur für eine Komposition anwendbar ist. - Die Frage nach der Angemessenheit führt direkt auf musiktheoretische Fragestellungen und damit in ein Gebiet, das im Musikunterricht hochinteressante Perspektiven eröffnet. Mit der Erkenntnis nämlich, daß die traditionelle Notenschrift einerseits für die Notation tonaler, metrisch gebundener Musik geradezu maßgeschneidert ist, andererseits aber ohne wesentliche Ergänzungen zur Notation z.B. indischer Musik nahezu ungeeignet ist, kann vielleicht die Verschiedenartigkeit beider Musikkulturen besonders eindrucksvoll deutlich gemacht werden. - Auch der Aspekt der Ästhetik einer Notationsform kann zum Gegenstand des Reflektierens gemacht werden. Immerhin hat sich bei der traditionellen Notenschrift in den vergangenen Jahrhunderten ein typographischer Standard herausgebildet, der heute nahezu allgemeinverbindlich ist, und gegen den es der computergesteuerte Notendruck immer noch schwer hat47. An diesen Überlegungen wird deutlich, daß das Erfinden von Notationsformen, wenn es nicht in schlechtem Sinn dilettantisch bleiben soll, keine einfache Angelegenheit ist, schon gar nicht in der Schule. In den meisten Fällen wird man sich daher darauf beschränken, dies entweder ganz am Anfang einer Auseinandersetzung mit Notation zu tun, um den Prozeß des Notierens überhaupt begreifbar zu machen, oder aber nur denkbare Alternativen zu bekannten Notationsformen zu entwickeln, um deren Vor- und Nachteile deutlich zu machen. 5.2. Notationsbezogene Medien im Musikunterricht Wenn sich die Schüler in verschiedenen Arbeitsformen mit dem Notieren von Musik beschäftigen, dann ist dieser Prozeß undenkbar ohne Medien. Hierunter werden alle Hilfsmittel verstanden, die eine Auseinandersetzung des Schülers mit der Sache überhaupt erst möglich machen, indem sie sie gewissermaßen an ihn herantragen. Es macht einen Unterschied, ob der Schüler eine Partitur selbst in den Händen hält, in der er blättern kann, oder ob die Partiturseiten nacheinander an die Wand projiziert werden. Die Fragen, um die es im folgenden geht, sind: Welche Funktionen können verschiedene Medien im Zusammenhang mit notationsbezogenen Arbeitsweisen erfüllen? Welche Sozialformen ermöglichen sie? Lehrbuch / Arbeitsbogen Das Lehrbuch kann sehr vielfältige Funktionen erfüllen. Dotzauer (1982) unterscheidet Lieder-, Musizierund Arbeitsbuch, wobei der letztgenannte Typ den Hauptanteil ausmache (190). Mögliche notationsbezogene Aufgabenstellungen, die im Zusammenhang mit einem Arbeitsbuch gelöst werden können, sind u.a. Zuordnungsaufgaben, Komposition von Bildergeschichten oder Texten, Realisierung von Notationen, Mitlesen und Ergänzen von Hörpartituren, Übersetzungen von einer Notationsform in eine andere, Untersuchung von Notaten. 47 vgl. hierzu Justus Noll, "Notenschreiber". c't. Magazin für Computertechnik. Heft 1/1996. Hannover, 1996. 199 - 202. Für alle genannten Aufgabenstellungen lassen sich ebensogut Arbeitsbögen einsetzen. Der wichtigste Unterschied des Lehrbuchs gegenüber Arbeitsbögen ist, daß es durchgeblättert werden kann. Wenn Dotzauer als didaktische Funktionen des Lehrbuchs u.a. Strukturierung der Lernfelder und Präsentation der Lerninhalte nennt (193), dann ist damit angedeutet, daß der Schüler sich durch Betrachten des Lehrbuchs unabhängig vom Unterricht ein individuelles Bild des Faches Musik macht, so daß "das Lehrbuch als Leitmedium eine starke Steuerung des Unterrichtsablaufs bewirken kann" (193). Der Vorzug des Lehrbuchs besteht in der Möglichkeit zum selbständigen und selbstbestimmten Arbeiten. Der Schüler kann sich intensiv auch mit solchen Bereichen auseinandersetzen, die im Unterricht aus Zeitgründen nur knapp behandelt wurden. Er kann Unterrichtsstoff wiederholen oder Informationen nachschlagen, die ihm entfallen sind oder die ein weiterführendes Interesse befriedigen. Dies ist gerade im Zusammenhang mit Notation von Interesse: viele Lehrbücher enthalten eine große Anzahl von Notenbildern, die im Unterricht aus Zeitgründen in der Regel nicht alle ausführlich behandelt werden können. Viele dieser Notenbilder besonders die avantgardistischen - reizen zur Betrachtung und zur Auseinandersetzung; sie provozieren Schülerfragen und halten das Interesse an der Materie wach. Arbeitsbögen haben gegenüber dem Lehrbuch den Vorteil, daß sie zerschnitten oder bemalt werden können. Ihnen ist also bei der Ergänzung von lückenhaften Hörpartituren (vgl. Weisbrod 1982, 225f.), Markieren von Motivbeziehungen etc. der Vorzug zu geben. Eine andere Aufgabenstellung wäre, daß einzelne Teile einer Partitur, die auf einem Blatt abgedruckt sind, ausgeschnitten und richtig zusammengefügt werden müssen (vgl. Weisbrod 1982, 231f.). Solche Aufgaben eignen sich hervorragend für die Arbeit in kleinen Gruppen. Der Vorzug von vorbereiteten Arbeitsbögen gegenüber dem selbständigen Erstellen einer Hörpartitur besteht dabei in der Möglichkeit einer gezielten Beschränkung der Schwierigkeiten. Tafel / Overhead-Projektor Tafel und Overhead-Projektor sind zentrale Medien in dem Sinn, daß sie eine Orientierung der Aufmerksamkeit aller Schüler auf denselben Punkt bedingen. Sie eignen sich z.B., um gemeinsam mit der ganzen Klasse eine Hörpartitur zu erstellen oder um Schüleräußerungen zu protokollieren. Dabei hat die Tafel gegenüber dem Overhead-Projektor zunächst den Vorzug besserer Lesbarkeit: das Projektorbild ist in der Regel zu den Rändern hin schlecht ausgeleuchtet und verzerrt; außerdem ist es kleiner als die Tafel. - Andererseits ermöglicht der OH-Projektor typische Arbeitstechniken, die nur zum kleinen Teil auch an der Tafel realisierbar sind (Dotzauer 1982 , 201f.): - Hervorheben: Einkreisen, Zeigen, Unterstreichen. Hierbei ist besonders interessant, daß durch Verwendung von wasserfesten und wasserlöslichen Stiften bestimmte Eintragungen wieder rückgängig gemacht werden können, ohne das gesamte Bild zu zerstören. Ebensogut kann man Eintragungen auf einer darübergelegten zweiten Folie vornehmen. - Es können z.B. in einer Partitur Motive eingekreist und mit Pfeilen versehen werden, um Beziehungen zu verdeutlichen. - Ergänzen: Ebenso wie an der Tafel kann ein Bild während des Unterrichts vervollständigt werden. Im Gegensatz zur Tafel kann jedoch das Anfangsbild bereits vorgefertigt sein. - So kann z.B. der Vergleich der Ergänzungen in lückenhaften Hörpartituren erfolgen, indem eine Folienkopie des Schülerarbeitsblatts auf dem OH-Projektor vervollständigt wird. - Abdecken: Ein vollständig vorgefertigtes Bild kann zunächst teilweise abgedeckt und im Verlauf des Unterrichts nach und nach freigegeben werden. - Der Aufbau eines Klaviersatzes aus Melodie, Baß und Mittelstimmen kann z.B. verdeutlicht werden, indem die einzelnen Schichten in verschiedenen Kombinationen sichtbar gemacht und vom Lehrer am Klavier realisiert werden. - Aufbauen: Aufwendiger gestaltet sich die Möglichkeit, mehrere OH-Folien zu erstellen, die erst übereinandergelegt das vollständige Bild ergeben (Overlay-Technik). Dies empfiehlt sich überall dort, wo wegen der Kompliziertheit des Bildaufbaus nicht abgedeckt werden kann. - Denkbar wäre z.B. der sukzessive Aufbau einer Partiturseite aus Noten, Legatobögen und Vortragsbezeichnungen. Ein Problem ist, daß die Schüler die Bilder, die an der Tafel oder am OH-Projektor entstehen, nicht mit nach Hause nehmen können. Eine Übertragung ins Heft ist oft zeitaufwendig und birgt die Gefahr von Abschreibfehlern. Insofern sind vor allem Abdecken und Aufbauen vor allem Mittel des Lehrervortrags. Legetafeln / Lernkarten Die unten abgebildeten Tafeln eignen sich für handlungsorientierte Methoden im Bereich der Rhythmik. Durch ihre Breite veranschaulichen sie die Dauer der abgebildeten Rhythmen, so daß auch das Übereinanderlegen ein korrektes Notenbild ergibt. - Es sind unterschiedliche Arbeitsweisen denkbar. So kann eine feste Verbindung von Notenbild und Rhythmusvorstellung angestrebt werden, die später beim Spielen längerer Rhythmen abrufbar ist. Dies kann z.B. durch Merkwörter unterstützt werden, die den Rhythmen unterlegt werden: Solche Tafeln können aber auch zu Zwecken der Gehörbildung genutzt werden, indem man die Aufgabe stellt, eine vorgegebene Auswahl von Rhythmustafeln in die richtige Reihenfolge zu bringen oder eine Lücke in einem vorgegebenen Notenbild durch die passende Rhythmustafel auszufüllen (vgl. Weisbrod 1982, 240 ff.). Das Arbeiten mit solchen Tafeln hat gegenüber der rein schriftlichen Form den Vorteil, daß - besonders bei kleineren Kindern - keine schreibtechnischen Probleme auftauchen und eine Vorgehensweise nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum begünstigt wird. In Verbindung mit einem Taktraster können Kinder z.B. spielerisch lernen, welche Notenkombinationen etwa in einen Dreivierteltakt passen. Das Prinzip der Legetafeln kann natürlich auch auf andere Bereiche der Notation ausgeweitet werden. So könnte z.B. eine Instrumentationspartitur aus vorgefertigten Bausteinen gelegt werden, auf denen die Instrumente abgebildet sind. Sigrid Abel-Struth schlägt eine Verwendung von Lernkarten zur Ausbildung der Tonvorstellung vor (1982 [b], 115 ff.). Legetafeln können sowohl als Magnettafeln für die Arbeit an der Tafel als auch für die Einzel- oder Gruppenarbeit verwendet werden. Auch eine Ausführung als Bauklötzchen für kleinere Kinder ist denkbar. Keyboard / Klaviertastatur Wilfried Fischer nennt 1976 eine über zwei Oktaven reichende Papptastatur das wichtigste Hilfsmittel, um die Verhältnisse der chromatischen Skala zu veranschaulichen (13). Tatsächlich eignet sich die Klaviertastatur wie kaum ein anderes Hilfsmittel zur handlungsbezogenen Auseinandersetzung mit den musiktheoretischen Grundlagen der traditionellen Notenschrift (vgl. die folgende Abbildung einer "äquidistanten" Klaviertastatur mit "Dur-Tonleiter-Kamm"). Nur sollte man angesichts der heutigen Preise für Keyboards zwei Schritte weiter gehen. Zum einen ist die Anschaffung eines Keyboard-Klassensatzes für jede Schule erschwinglich (wenn nicht auf einmal, dann über mehrere Jahre verteilt). Zum anderen kann man den Eltern sicherlich ebenfalls die Anschaffung eines Keyboards empfehlen, das heute für wenig mehr als den Preis eines Schultaschenrechners erhältlich ist. Wenn jeder Schüler ein solches Keyboard besäße, sollte nach wenigen Wochen das Auffinden notierter Töne und das Spielen einfacher Tonfolgen kein Problem mehr sein. Dies würde dem Musikunterricht unvorstellbare Perspektiven eröffnen, und die Aussage Vogelsängers, es sei "ein völlig unrealistische Ziel", jeden Schüler am Tasteninstrument auszubilden (1969, 183 / 1), müßte immerhin relativiert werden. - Natürlich kann für einen geringen Preis keine überragende Klangqualität erwartet werden. Dem Vorwurf des "Plastiksounds" können aber mehrere Gegenargumente entgegengesetzt werden. Erstens sollten anders als bei Blockflöten - Intonationsprobleme ausgeschlossen und somit auch ein Zusammenspiel möglich sein. Zweitens bieten Keyboards die Möglichkeit zur selbständigen musikalischen Einzel- oder Partnerarbeit im Klassenzimmer ohne gegenseitige akustische Behinderung. Voraussetzung ist allerdings, daß die Geräte über eine oder besser zwei Kopfhörerbuchsen verfügen, deren Benutzung eine Stummschaltung des Lautsprechers bewirkt. Nachteil dabei ist, daß kaum mehr als zwei Schüler gleichzeitig auf einem Keyboard spielen können. Vielleicht bringt hier die Zukunft die Möglichkeit einer "Ensembleschaltung", mit der sich mehrere Keyboards verbinden lassen. Gedrucktes Material: Studienpartituren und Klavierauszüge Wilfried Dotzauer berichtet 1982 von Versuchen aus den fünfziger bis Ende der sechziger Jahre, ein Hören mit Noten zu ermöglichen, indem das Notenbild zur laufenden Musik mit dem Diaprojektor vorgeführt wurde (Dotzauer 1982, 187). Zu diesem Zweck waren bis 1969 ca. 150 komplette Partituren bzw. Klavierauszüge auf Kleinbildfilm aufgenommen worden. Aus heutiger Sicht muß ein solches Unterfangen fragwürdig erscheinen, besonders wenn man den damit verbundenen Aufwand in Betracht zieht. Zwar bietet die Beschäftigung mit einem zentralen Notenbild Vorzüge gegenüber einem dezentralen Arbeiten. So ist es z.B. möglich, mit einem Lichtzeiger auf einzelne Stellen hinzuweisen. Andererseits besteht der Vorzug der Partitur doch gerade darin, "daß man sie in Ruhe betrachten kann. Sie läßt sich hin und herwenden, analysieren, durchforschen" (Giebeler 1969, 547/1). Auch beim Mitlesen machen wir davon Gebrauch, indem wir voraus- oder nachlesen, jedenfalls aber den Zeitpunkt des Umwendens selbst bestimmen. Und wenn die Schüler beim Mitlesen den Anschluß verlieren, ist dies ein willkommener Anlaß, Techniken des Partiturerfassens zu üben. Insofern ist eine aufgezwungene Synchronisation des Lesevorgangs kontraproduktiv. Hinzu kommt, daß der unüberlegte Einsatz käuflichen, also nicht pädagogisch aufbereiteten Notenmaterials als Hörhilfe problematisch ist, worauf bereits verschiedentlich hingewiesen wurde48. Auch für andere Einsatzzwecke gilt dieser Vorbehalt: die meisten dieser Notentexte enthalten eine Fülle von Zeichen und - in der Regel fremdsprachigen - verbalen Anweisungen, die die Schüler verwirren. Hier bieten sich zwei Lösungsmöglichkeiten an: zum einen können Kopien verwendet werden, in denen unverständliche Zeichen getilgt und fremdsprachige Ausführungsanweisungen mit entsprechenden Übersetzungen überklebt wurden (z.B. bei Graßmann 1994, 26/27). Dieses Verfahren ist - in Eigenregie durchgeführt urheberrechtlich problematisch und andererseits nicht für ganze Partituren durchführbar. Daher bietet sich eine andere Möglichkeit an, die auch im Hinblick auf das Ziel, den Schülern das vorhandene Notenmaterial als Informationsquelle zu erschließen, vorteilhafter erscheint: die Erstellung eines Lexikons, in dem 48 Vogelsänger 1969, aber auch Rectanus 1990, 19 / 3. alle verbalen und grafischen Anweisungen nachgeschlagen werden können, die in gängigen Notentexten auftauchen, und das den Schülern während des Partiturstudiums zur Verfügung steht. Computer Meißner und Rundfeldt beschreiben 1994 die Möglichkeiten, die der Computereinsatz im Musikunterricht bietet. Dabei könnte eine sinnvolle Gerätekombination aus einem Computer mit einem speziellen LCDDisplay für Overhead-Projektoren und einem MIDI-fähigen Keyboard bestehen. Als Programme wären interessant: Sequencer mit Notationsfähigkeiten und Begleitautomatik, Gehörbildungs- und Musiklehreprogramme, Programme zur Analyse von Klangspektren und Music-Painter-Software. Die Autoren nennen folgende Möglichkeiten der Veranschaulichung von Musik (34 ff.): - Verfolgen des Stimmenverlaufs: Der Computer zeigt die Notendarstellung des Musikstücks während des Abspielens an, wobei in einer Stimme der Cursor auf der gerade erklingenden Note steht. So können die Schüler die Stimme mitverfolgen. Hier wäre zu ergänzen, daß man bei Sequencerprogrammen in der Regel einzelne Stimmen ausblenden kann ("Mute"-Funktion). - Protokoll der eigenen Einspielung: Zum erklingenden Metronom kann ein Schüler auf dem Keyboard eine Stimme einspielen. Das Programm zeigt ein Notenbild von dem an, was gespielt wurde und ermöglicht so einerseits die Kontrolle der Einspielung, andererseits aber können Einfälle, die während des Spielens entstehen, vor dem Vergessen bewahrt werden. - Direkte Kopplung von Klang und Schriftbild: Jede Veränderung im Notenbild kann unmittelbar hörbar gemacht werden. Während also die Position einer Note mit der Maus verändert wird, erklingen auf dem Keyboard die zugehörigen Töne. Dadurch können Tonfolgen nach Gehör notiert werden. - Verdeutlichung von Tondauerverhältnissen / Manipulation von Tonhöhen und Tondauern: Die genannten Programme beherrschen neben der Notendarstellung meist auch die Balkennotation, und die Autoren weisen darauf hin, daß die Veränderung der Parameter Tonhöhe und Tondauer mit Hilfe der Computermaus innerhalb dieser Notationsform besonders anschaulich ist. - Auch für Übungen zur Gehörbildung wäre der Computer selbstverständlich nutzbar. - Verdeutlichung der Struktur mehrstimmiger Musik: Die Autoren beziehen sich hier auf die Fähigkeit eines Sequencerprogramms, ein komplexes Stimmengeflecht auf Knopfdruck in Einzelstimmen zu "zerlegen". Das hierzu abgebildete Beispiel kann aber nicht recht überzeugen, da eine Fuge in Themen, Kontrapunkte und "den Rest" zerlegt wurde, also eben nicht in Einzelstimmen. Eigene Erfahrungen mit Computerprogrammen zeigen auch, daß dieser Vorgang in der Regel nicht zum erwünschten Ergebnis führt. - Instrumentation: Sind Einzelstimmen eingegeben, bereitet es keine Schwierigkeit, sie mit unterschiedlichen Klangfarben zu belegen. Auch wenn die Klangfarben der erschwinglichen Synthesizer an ein lebendiges Orchester nicht heranreichen, so kann man doch recht gut die Auswirkungen der Instrumentation auf die Wirkung von Musik demonstrieren. - Hilfe bei kompositorischen Aufgaben: Es ist einleuchtend, daß ein Orchester, das stets bereit ist, eine Komposition in ihrer aktuellen Fassung unmittelbar zu realisieren, eine große Hilfe für jeden Komponisten wäre. Diese Rolle kann der Computer mit einem Sequencerprogramm und einem Synthesizer übernehmen. Darüberhinaus erlauben Sequencerprogramme das Ausschneiden, Kopieren und Transponieren von Blöcken ebenso wie dies bei Textverarbeitungsprogrammen möglich ist und erleichtern damit das kompositorische Arbeiten. - Darstellung physikalisch-musikalischer Phänomene: Spezielle Programme erlauben die Darstellung von Frequenzspektren und Schwingungsverläufen und können daher physikalische Grundlagen der Musik veranschaulichen. - Kombination von Grafik und Klang: Wieder andere Programme erlauben die Umsetzung einer beliebigen (!) Graphik in Musik und umgekehrt. - Die gegenwärtig verfügbaren Programme seien zwar noch nicht ausgereift, die zu erwartenden Entwicklungen seien aber vielversprechend. Zu ergänzen wäre noch, daß einige Programme einen Wechsel der Darstellungsebenen ermöglichen, d.h. auf einer höheren Ebene erscheint nur ein Block, den man geeignet benennen kann, z.B. "Introduktion". Erst wenn man mit der Maus in einen solchen Block hineinklickt, öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem der Inhalt des Blocks detailliert angezeigt wird. Die Funktion des "Weitwinkel- und Teleobjektivs", wie es weiter oben genannt wurde, wird hier also kombiniert. Ein anderer Aspekt des Computers erscheint bedeutsam: er eignet sich auch zur Tonaufzeichnung in digitaler Qualität (Harddisk-Recording) und bietet unvorstellbare Nachbearbeitungsmöglichkeiten, angefangen von weitreichenden Manipulationen des Klangmaterials selbst (Hall, Echo, Filter, Transposition etc.) bis hin zum Verschieben, Kopieren und Mischen von Blöcken; aus einem Klangmaterial von wenigen Sekunden Dauer kann so ein Musiktitel üblicher Länge zusammengestllt werden. So könnten also tatsächlich auch komplexe elektronische Partituren realisiert werden, ohne daß Bänder geschnitten und geklebt werden müssen; ebenso könnten Umweltklänge einbezogen werden. Wenn auch solche Überlegungen zeigen, daß die Bedeutung des Computers für den Musikunterricht der Zukunft nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, so darf er keineswegs als methodisches Allheilmittel gesehen werden. Hier sollen nur einige problematische Punkte angesprochen werden: - Da es in der Regel nur einen Computerarbeitsplatz geben wird und die Bedienung der Programme entgegen allen Werbesprüchen eben doch nicht ganz unproblematisch ist, besteht die Gefahr einer "Expertokratie" im Unterricht. - Hinzu kommt, daß die gegenwärtig verfügbaren Programme für den Markt der Musikelektronik-Liebhaber, nicht aber für den Einsatz in der Schule entwickelt wurden. Die Folge ist, daß die "Bedienungslogik" nicht auf Schüler, sondern auf den "MIDI-Insider" zugeschnitten ist. - Die üblichen Computer-Displays sind viel zu klein für die Darstellung von Notenbildern. (Die Darstellung einer Partiturseite eines Orchesterstücks mit 20 Systemen in lesbarer Qualität müßte etwa 1200 Bildpunkte hoch sein, wobei auch die graphischen Bedienelemente Platz beanspruchen. Eine solche Auflösung ist aber derzeit nur bei Verwendung spezieller Grafikkarten und teurer Großbildschirme erreichbar.) - Auch ist die Verwendung eines Overhead-Projektors nicht gerade die Garantie dafür, daß ein solches Notenbild überall im Raum gut lesbar ist. Aus diesen Gründen eignet sich der Computer gegenwärtig wohl doch nur zu gelegentlichen Demonstrationen, nicht aber als Dauer-Arbeitsmittel. - Dies kann sich allerdings schon sehr bald ändern, wenn lichtstarke Großdisplays existieren und wirklich pädagogisch orientierte Software vorhanden ist. 5.3. Überlegungen zur Methodik des Erlernens der traditionellen Notenschrift Es wurde bereits darauf hingewiesen, wie wichtig es für den weiteren Unterrichtsverlauf ist, in welcher Weise den Schülern der Zeichenvorrat und das Regelsystem einer Notationsweise vermittelt werden. In diesem Abschnitt soll daher noch einmal detailliert auf einige Aspekte der Methodik einer Einführung der traditionellen Notenschrift eingegangen werden, deren Ziel allerdings nicht die Fähigkeit zum Vom-BlattSingen oder -Spielen sein soll, sondern die Fähigkeit, das ungeheure Informationsangebot, das in Gestalt von Studienpartituren, Klavierauszügen, Songbooks etc. allen Menschen zugänglich ist, nutzen zu können. Methodenkonzeptionen Notate von Musikstücken sind - unabhängig von der verwendeten Notationsform - umso komplexer, je genauer sie das musikalische Geschehen wiedergeben. Sollen sie als Informationsquellen optimal genutzt werden, so muß ein vielschichtiger Umgang mit ihnen angestrebt werden, der im Idealfall sowohl die Kenntnis der Bedeutungen der einzelnen vorkommenden Zeichen umfaßt, als auch die Fähigkeit, Strukturen zu erkennen und Bezüge zwischen diesen herzustellen. - Es stellt sich daher zunächst die Frage, welche Methodenkonzeptionen49 geeignet sind, diese Ziele zu erreichen. Methodenkonzeptionen werden hier Verfahrensweisen genannt, die von einem Gesamtentwurf des Unterrichtsverlaufs hier die einzelnen Lernschritte determinieren. (31) Für den Musikunterricht von Bedeutung sind die ersten drei (vgl. auch Kaiser/Nolte 1989, 148): a) Ganzheitlich-analytische Verfahren gehen von einem (oft diffusen) Gesamteindruck aus (...), um ihn in seinen Aspekten zu klären und so zu einem präzisierten und differenzierten Gesamtbild zu verhelfen. b) Elementhaft-synthetische Verfahren bauen aus Wissenselementen Wissenszusammenhänge auf, wie eine umstrittene Leselernmethode aus Buchstaben Worte und schließlich Sätze zusammenfügen läßt. c) Projektverfahren gehen ... von Zielsetzungen aus, die auf Schülerinitiative zurückgehen oder jedenfalls nicht allein auf Lehrerinitiative, und suchen sie in gemeinsamer Arbeit zu planen, arbeitsteilig zu lösen und dann der Kritik zu unterwerfen. Als Projektziel wird in der Regel nur ein "Werk" anerkannt (...) ( 31) Die Vor- und Nachteile des elementhaft-synthetischen Verfahrens beschreibt Ernst Klaus Schneider 1980: Dieses Vorgehen entspricht einem Lernen in Lehrgängen (Kursen) oder lehrgangsähnlichen Formen. Es ist eine primär fachimmanent gegliederte Schrittfolge und ist überall dort verwendbar, wo eine Systematisierung von der Sache her möglich und kontinuierliches Fortschreiten schulisch sinnvoll erscheint ... Es hat aber den Nachteil, daß es jeweils nur begrenzte Anwendungsbereiche erschließt (in diesen allerdings zur Grundlagenbildung unerläßlich ist), vornehmlich auf kognitive und psychomotorische Verhaltensbereiche ausgerichtet ist, die Geschlossenheit der Lernprozesse und die Lehrerzentrierung betont sowie Eigeninitiativen der Schüler nur bedingt zuläßt. (223) Allem Anschein nach wird in der Praxis zum Erlernen der traditionellen Notenschrift vor allem das elementhaft-synthetische Verfahren verwendet. Dies scheint zunächst von der Sache her gerechtfertigt zu sein, da die Notenschrift mit relativ wenigen Zeichen auskommt und auf klaren Regeln basiert, die im Grunde schnell erklärt sind. In extremer Form wird das elementhaft-synthetische Form im Arbeitsplan von 1960 praktiziert: hier wird tatsächlich zunächst nur eine Note gelernt, dann eine zweite, dann eine dritte! Demgegenüber bedeutet es schon einen Fortschritt, wenn Fischer 1976 empfiehlt, in der dritten Klasse die chromatische Tonleiter im Ganzen zu lernen. Entsprechendes gilt natürlich für die Notenwerte. - Aber auch Fischers Methode ist im Grunde elementhaft-synthetisch. Dies wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, welche kognitiven Leistungen nötig sind, um aus der Bedeutung der Einzelzeichen den Informationsgehalt einer Partitur zu erschließen. Die folgende Tabelle stellt, von oben nach unten gelesen, diesen Vorgang des synthetischen Notenlesens dar: 49 Wolfgang Schulz. Unterricht - Analyse und Planung. Heiman, Paul, Gunter Otto und Wolfgang Schulz: Unterricht. Analyse und Planung.Hg. Dr. Alfred Blumenthal und Dr. Wilhelm Ostermann. Hannover (Berlin, Darmstadt, Dortmund): Schroedel 1965. S. 13 - 47. Kenntnis der Einzelzeichen Schlüssel / Vorzeichen Notenwerte / Pausenwerte Tempo- / Taktangaben Dynamische Angaben Spielweisen / Verzierungen Abbreviaturen ` D F H : 3 = . / > |: :| C9 <> A8B #$ % & ' ? F 0 @ = 80 + Position Dauer (bzw. (+ Transposition) Abstand zur folgenden Note) Taktschema Erkennen von Aspekten des Einzeltons Tonhöhe rhythmische Position im Takt und (ungefähre) Dauer Erkennen von musikalischen Gestalten rhythmisch-melodische Motive als kleinste musikalische Bedeutungsträger Dynamik Artikulation Erkennen von Beziehungen und zeitlicher Struktur Nach einer weitverbreiteten Auffassung kommt es lediglich darauf an, die Zeichenbedeutungen so schnell und sicher zu beherrschen, daß die Synthese komplexer Strukturen in einem annehmbaren Zeitraum gelingt. Das Aufsteigen von einfachen zu immer komplizierteren Notenbildern scheint daher nur eine Frage des ausreichenden Übens zu sein. Wenn daher in der Schule das Ziel, aus dem Umgang mit Notenbildern Vorteile ziehen zu können, nur von wenigen Schülern erreicht wird, so liegt das an der zu geringen Übemöglichkeit. - Es zeigt sich jedoch, daß ein solcher Schluß vorschnell ist. In diesem Zusammenhang sind neuere Überlegungen von Bernd Graßmann (1995) von Interesse, die vom Begriff der Progression ausgehen. Hierunter versteht Graßmann "die fortschreitende Verdichtung des Wissens, die wachsende Fähigkeit, immer komplexere Fragen zu beantworten, schließlich auch Problembewußtsein zu entwickeln, und die allmähliche Steigerung von Fertigkeiten." Sie werde üblicherweise abgelesen "an einer zunehmenden Flüssigkeit, einer wachsenden Breite und einer steigenden Komplexität" (23/1). Einer solchen Vorstellung steht Graßmann kritisch gegenüber: Einerseits ist es fragwürdig, ob Fertigkeiten und Wissensstände wirklich die flüssigeren, breiteren, komplexeren Stufen vorgedachter Grundstufen oder nicht vielmehr Ergebnisse ganz anderer kognitiver Verflechtungen sind. (...) Extrem flüssiges Lesen aller Einzelstimmen einer Partitur hilft selbst dem Partiturspieler nur sehr bedingt. Er muß Harmonien und charakteristische Spielfiguren erkennen. Ist er jedoch dazu in der Lage, muß er noch lange nicht eine Wendung als Zitat oder als tonmalerisch durchschauen. Beides - das souveräne Partiturspiel oder die musikwissenschaftliche Kennerschaft - stellen unterschiedliche Leistungen dar, die auf sehr verschiedenen "Notenerschließungen" basieren. Näher besehen scheint das, was wir nach der vertrauten Metapher als Progression ansehen, eher ein Paradigmenwechsel zu sein" (23/1-2) Um diese Überlegungen - die im übrigen keineswegs für das Notenlesen allein, sondern für das Erlernen komplexer hierarchischer Systeme allgemein gelten dürften - zu verifizieren, wären Ausflüge in die kognitive Psychologie nötig, die diese Arbeit nicht leisten kann. Sie scheinen aber plausibel und werden durch eigene Lernerfahrungen bestätigt. Es ergeben sich aus ihnen einige für die Methodik des Notenlernens wichtige Konsequenzen. Zum einen ist die Fähigkeit "fortgeschrittenes Notenlesen" keineswegs eindeutig bestimmbar; der zukünftige Musikkritiker muß in anderer Richtung fortschreiten als der zukünftige Partiturspieler. Die Schüler sollten dagegen vor allem lernen, Notentexte als Informationsquelle nutzen zu können. Zum zweiten verläuft der Weg vom Lesen einzelner Noten zum sinnvollen Erfassen ganzer Partituren nicht geradlinig, sondern ist durch Sprünge ("Paradigmenwechsel") gekennzeichnet. Der Musikunterricht muß diese Sprünge gezielt unterstützen. - Jede erreichte Stufe muß durch Üben gefestigt werden, bevor zum nächsten Sprung angesetzt werden kann. Auf jeder Stufe muß natürlich anders geübt werden. Ein solches Üben ist unter schulischen Bedingungen nur durch ökonomische Planung zu haben: Die Unterbrechungen im Musikunterricht - oft nur eine Stunde pro Woche, Wochen- und Wahlunterricht, Unterrichtsausfall, aus motivationalen Gründen rasch wechselnde Themen - können nur durch mittel- und langfristig geplante "Trainingsprogramme" aufgewogen werden, die als Aneinanderreihung einzelner Etappen zu denken wären. Nur durch Wiederholung und zunehmende Vernetzung bilden sich neue kognitive Schemata heraus.(23/2) Graßmann stellt zunächst zwei verschiedene Dimensionen der Progression dar. Die Progression im Partiturbild wird durch die Stationen Klaviernoten, Vielstimmige Notationen (Klavierauszug, Chor- Kammermusikpartitur), Particell (womit er offenbar etwas anderes meint als z.B. Schönberg) und Studienpartitur markiert. - Unabhängig davon gibt es die Progression des Komplexitätsgrades - man muß hinzufügen: weniger des Notenbildes als vielmehr der Art, es wahrzunehmen. Auch hier nennt Graßmann vier Stationen: Synopse (ganzheitliche Wahrnehmung einer Partitur), Hierarchie (Fähigkeit, Klangschichten zu unterscheiden), Struktur (Fähigkeit, wiederkehrende Muster - z.B. Motive - zu erkennen) und Relation (Fähigkeit, Beziehungen zwischen Einzeltönen zu erkennen). Korrespondierend zu diesen je vier Stationen der Progression entwickelt Graßmann vier Übungsmodelle, die die vier bisher als interne Operationen zur Bewältigung der verschiedenen Komplexitätsgrade beschriebenen Handlungen der synoptischen Zusammenfassung, der Hierarchiebildung, der Strukturierung und des Herstellens von Relationen nunmehr als äußerlich sichtbar am Notenbild durchzuführende Unterrichtshandlungen (25/1) katalogisieren. Diese nennt er Montage (Zusammenkleben von Teilen einer Partitur), Konturierung (farbliche Hervorhebung von Klangschichten), Layout (Umrahmen von Motiven) und Dechiffrierung (korrektes Lesen der einzelnen Noten). Graßmann gibt dann eine knappe Übersicht über eine mögliche Unterrichtsplanung für die Klassenstufen 5 - 10, in denen die verschiedenen Umgangsweisen mit Partituren immer wieder in anderem Zusammenhang vorkommen und so einen gewissermaßen im Hintergrund ablaufenden Notenlehrgang darstellen, der dennoch zu einer Progression im Umgang mit Partituren führen soll. Interessant ist an der Darstellung von Graßmann, daß die Progression in der Fähigkeit zum Partiturlesen vom Ganzen zum Detail führt: am Anfang steht demzufolge nicht die Einzelnote, sondern das ganzheitlich wahrgenommene Partiturbild. Hier können bereits verschiedenartige Partiturbilder - als Ganze - miteinander verglichen werden: homophone Partien einer Motette können z.B. von polyphonen Satz unterschieden werden. - Auch Klangschichten und Texturen von Begleitmustern können auf einer ganzheitlichen Ebene erkannt werden. Sogar das Aufsuchen von Motiven, die in einem imitatorischen Satz die Stimmen durchwandern, kann im Sinne eines rein graphischen Vergleichs erfolgen. Dazu muß der Lernende - wie übrigens bei allen vorstehenden Techniken auch - keineswegs einzelne Noten lesen können. Vielmehr verfährt er so, als fische er gleiche Wörter aus einem Meer von unbekannten Schriftzeichen. (24/3) Man kann also dem oben dargestellten Modell der synthetischen Notenlesens ein analytisches Modell gegenüberstellen: 1. Überblick gewinnen. Zunächst werden der ersten Partiturseite folgende Informationen entnommen: beteiligte Instrumente, Tempo, Taktart. Anschließend wird die Partitur durchgeblättert und aufmerksam auf Takt- und Tonartwechsel (zunächst nur am Zeilenanfang), Wiederholungszeichen, Tempoangaben etc. durchgesehen. Mit diesen Informationen ist es bereits möglich, ein grobes Formschema zu erstellen. 2. Klangschichten unterscheiden. In vertikaler Richtung wird eine bestimmte Stelle bzw. ein bestimmter Takt daraufhin untersucht, ob in mehreren Systemen "im Prinzip dasselbe" steht. Hier geht es um einen graphischen Vergleich, bei dem das charakteristische Aussehen der Notenwerte hilfreich ist. Je nach Stand des Musikverständnisses wird hierbei eine Einteilung in wirklich hörbare Klangschichten herauskommen. Ziel sollte in jedem Fall sein, Haupt- und Nebenstimmen zu identifizieren. Oft ist es auch möglich, die im ersten Schritt gefundenen Blöcke aufgrund wechselnder Satzweisen weiter zu untergliedern. 3. Zusammenhänge erkennen. Nun werden wiederum in horizontaler Richtung die Hauptstimmen - ggf. auch die Nebenstimmen - im Hinblick auf musikalische Charaktere miteinander verglichen. Auch hier geht es vor allem um eine Suche nach graphischen Ähnlichkeiten. 4. Noten dechiffrieren. In einem letzten Schritt können einzelne interessierende Stellen aufgesucht werden und detailliert untersucht werden. Aber auch in diesem Schritt müssen keineswegs alle Detailinformationen ausgewertet werden, die das Notenbild enthält. Man sieht, daß in diesem Modell die Fähigkeit, Einzelnoten dechiffrieren zu können, ihnen also präzise Informationen über einzelne Töne entnehmen zu können, einen weitaus geringeren Stellenwert hat als bei einer synthetischen Methode. Dies bedeutet, daß auch diejenigen Schüler, bei denen das Entziffern der Einzelnoten verhältnismäßig lange dauert, weil sie weniger Gelegenheit hatten, es zu üben, bei der Arbeit mit ganzen Partituren nicht über Gebühr benachteiligt sind. Zum anderen hat die Methode, gewissermaßen mit dem Dach anzufangen und das Fundament später zu schaffen, den motivationsbezogenen Vorteil, daß das Haus, daß da gebaut werden soll, schon erkennbar wird und vielleicht eine gewisse Attraktion ausstrahlt. Die synthetische Methode dagegen bleibt nur zu oft bei der Kellerdecke stecken und hinterläßt so manchen enttäuschten Schüler, der einst begeistert angefangen hat. Im Unterricht sollten daher beide Methoden kombiniert werden, d.h. von Anfang an sollten vollständige Notenbilder von ganzen Stücken ins Spiel kommen; wie dies geschehen kann, hat Graßmann für die Sekundarstufe beschrieben. Dies kann sicherlich mit geeigneten Beispielen auf die Grundschule erweitert werden. Andererseits muß natürlich die Notenschrift gründlich erklärt werden, und dies kann letztlich nur synthetisch geschehen. Anthropogene Voraussetzungen Ein weiterer Gesichtspunkt, der bei der Einführung der Notenschrift zu bedenken ist, betrifft die wahrnehmungs- und entwicklungspsychologischen Voraussetzungen der Kinder. Hieraus kann ein Prinzip der psychischen Nähe abgeleitet werden. Dies soll zunächst am Beispiel der Rhythmuswahrnehmung erläutert werden. Nach C. Hildebrandt (1985)50 und R. Upitis (1987) entwickelt sich die Übersetzung von Rhythmen in zeichnerische Symbole regelhaft; die folgenden Stadien der Darstellung können unterschieden werden: - ikonisch: es werden die Instrumente, die Hände oder die Bewegungen gezeichnet - prä-figural: für jeden Schlag wird ein Strich gezeichnet (5 - 6 Jahre) - figural: längere und kürzere Schläge werden differenziert gekennzeichnet, Pausen oder lange Abschlußnoten von Phrasen werden jedoch nicht dargestellt (7 - 8 Jahre) - metrisch: der Rhythmus wird metrisch genau dargestellt, wobei u.U. sogar die metrischen Einheiten auch graphisch zusammengefaßt werden. Figurale und metrische Darstellungsweisen entwickeln sich vermutlich lange parallel; die Bevorzugung der metrischen Repräsentation scheint interessanterweise nicht mit der musikalischen Vorbildung (Instrumentalunterricht) in Zusammenhang zu stehen, sondern mit der Entwicklung der Hörfähigkeit und der motorischen Fähigkeiten. Man kann hieraus verschiedene Schlüsse ziehen: 1. Für die meisten Grundschulkinder der dritten oder vierten Klasse stellt die Erwartung, einen Rhythmus metrisch korrekt zu notieren (egal in welcher Notationsform), eine Überforderung dar. - Um zu dieser Fähigkeit zu gelangen, ist es erforderlich, die allgemeine Hörfähigkeit, aber auch die allgemeinen motorischen Fähigkeiten zu trainieren. 2. Es fördert die Entwicklung nicht, wenn man die Notenwerte mit der Klangdauer der Töne in Verbindung bringt. Vielmehr ist, wie bereits oben dargestellt, der Abstand zur nächsten Note das Entscheidende. Will man also den Schritt von der figuralen zur metrischen Darstellung fördern, so muß die Aufmerksamkeit der Schüler auf die Zeit bis zum nächsten Ton gelenkt werden - wenn diese nicht durch den Klang ausgefüllt wird (dies wird bei Schlaginstrumenten selten der Fall sein), dann müssen die Schüler sie durch eine Bewegung ausfüllen51. Auch Köneke und Langner berücksichtigen in ihrem zehnteiligen Notationslehrgang52 das Prinzip der psychischen Nähe. Sie beginnen daher mit ikonischen Zeichen für Klänge und schreiten dann über einfache Symbole fort zur traditionellen Notenschrift. Dabei kommen die Schüler sehr frühzeitig, nämlich unmittelbar nachdem sie die Darstellung der Tonhöhe im Liniensystem - noch ohne Schlüssel - kennengelernt haben, in Kontakt mit einer traditionellen Partitur, die fast ausschließlich aus Elementen besteht, die die Schüler zu diesem Zeitpunkt noch nicht dechiffrieren können: Notenwerte, Vorzeichen (Doppelkreuz!), Vorschlagsnoten, Pausen. Dennoch wird der Versuch gewagt, aufgrund des Notenbildes Hörerwartungen formulieren zu lassen. Dabei ist der programmatische Aspekt des Stücks ("Vater und Sohn" von Paul Haletzki für Piccolo-Flöte und Fagott, nach einer im Arbeitsblatt abgebildeten Karikatur von E.O.Plauen) sicherlich hilfreich. - Hier hängt der Unterrichtserfolg wahrscheinlich entscheidend davon ab, wie der Lehrer im Detail auf Schülerfragen oder -unsicherheiten reagiert. Zuzustimmen ist den Autoren jedenfalls, wenn sie feststellen, daß die Begegnung mit komplexen Erscheinungsformen aus dem Umfeld des Musizierens und Musikhörens besser zu motivieren vermag als die Darbietung von Elementen, die aus ihrem Zusammenhang herausgelöst worden sind, oder von 50 51 52 s. Bruhn 1993, 296f. - Vgl. auch Gruhn 1993. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß arabische Musiker, wenn sie einen Rhythmus lernen, diesen zunächst auf die Trommelsilben "dum" und "tak" sprechen. Die Pausen werden auch gesprochen, und zwar auf einen zischenden "s"-Laut. erschienen in MuB 11/82 bis 10/83. schlichten Primitivismen, die speziell für Kinder der Grundstufe zugeschnitten werden. (Köneke / Langner, Folge 6, MuB 5/83, 39) Merksätze Abschließend soll hier noch kritisch auf einige methodische "Hilfestellungen" eingegangen werden, die im Bestreben, die Sache für die Schüler zu vereinfachen, oft in Wahrheit das Gegenteil erreichen. So wurde bereits weiter oben auf die Problematik des Begriffs "Elfliniennotation" hingewiesen. - Ein weiteres Beispiel solcher Pädagogisierung sind die Merksätze, die zu den unausrottbaren Eigenheiten des Musikunterrichts gehören. Unzweifelhaft hatte das "Ut queant laxis" des Guido von Arezzo seinen guten Sinn und vor allem durchschlagenden Erfolg. Wenn aber Wilfried Fischer, der 1980 die Einführung der traditionellen Notation in der Grundschule als Methodenproblem bezeichnet, zum Memorieren der Notenpositionen im Violinschlüssel jene Merksätze empfiehlt, die er selbst als "alt-schulmeisterlich" charakterisiert - "Es geht hurtig durch Fleiß" bzw. "Der Fritz aß Citronen-Eis" (S. 247) -, so muß gefragt werden, ob hier nicht der Schaden größer ist als der Nutzen. Erstens verbinden sich im Gehirn des Schülers von Anfang an Musik und altväterische Pädagogik zu einer unauflöslichen Einheit. Zweitens belasten am Ende der Schulzeit eine Reihe von Merksätzen das Schülergedächtnis, die fortwährend verwechselt werden. Drittens aber und das ist hier der entscheidende Fehler - wird vom Wesentlichen abgelenkt. Denn wichtig für das Musikverständnis sind in den meisten Fällen nicht die absoluten Tonhöhen, sondern die Intervalle. Und wenn wirklich einmal die absolute Tonhöhe dechiffriert werden muß, dann sollte man sich die Zeit nehmen und das Verfahren benutzen, das für alle Schlüssel funktioniert, nämlich von der Bezugslinie aus abzuzählen. Soll dieser Vorgang beschleunigt werden, so sollte eher das sichere und schnelle Erkennen von Intervallgrößen trainiert werden. Die zweite Gruppe von Merksätzen - "Geh, du alter Esel, hol Fisch!" bzw. "Feine Braten essen Assessoren des Geset-Ces" - betrifft den Quintenzirkel, der im Zusammenhang mit der traditionellen Notenschrift gern als Hilfsmittel zur Dechiffrierung der Vorzeichen am Zeilenanfang benutzt wird. Hier sind mehrere Einwände zu erheben. - Die Sätze werden häufig verwechselt. Es kommt sogar zu schlimmen Mißverständnissen wie der Auffassung, der eine Satz sei für die Dur- und der andere für die Molltonarten. - Die Bedeutung der Merkwörter innerhalb der Sätze kann falsch interpretiert werden ("Fisch" für F-Dur, "Esel" für Es-Dur, "Assessor" für A-Dur usw.) - Der Quintenzirkel in der üblichen Form leistet wenig. Aus ihm kann nur die Anzahl der Vorzeichen abgelesen werden, nicht aber, welche Stufen erhöht oder erniedrigt sind. Die Vorzeichen von Molltonarten können nur auf dem Umweg über die Paralleltonarten ermittelt werden. Dazu kommt, daß der Quintenzirkel, wenn er die Struktur unseres Tonsystems veranschaulichen soll, bekanntlich in Wahrheit eher als Spirale darzustellen wäre. Die kreisförmige Anordnung der Tonarten ist eigentlich nur für den seltenen Fall einer enharmonischen Modulation wichtig. Für die meisten Anwendungen ist eine geradlinige Anordnung sehr viel sinnvoller, da sie erlauben würde, mit Hilfe eines "Tonleiterkamms" die Vorzeichen von Dur- und Molltonleitern sogleich in der Reihenfolge abzulesen, in der sie am Zeilenanfang aufgeführt werden. Zweifel, ob es "gis" oder "as" heißen muß, wären ausgeschlossen, wie die folgende Darstellung zeigt: Die vorangegangenen Überlegungen zeigen, daß die Methodik der Einführung der traditionellen Notenschrift keineswegs soweit fortgeschritten ist, daß man aus dem Scheitern des Versuchs, Schüler aller Schularten in ihren Gebrauch einzuführen, auf die prinzipielle Aussichtslosigkeit eines solchen Unterfangens schließen darf. Im Gegenteil: über die psychologischen Vorgänge beim erfolgreichen Notenlesen ist noch so wenig bekannt, daß hier ein wichtiger Bereich musikpädagogischer Forschung liegen sollte. Auf die in der Schule praktizierte Methodik hätten solche Anstrengungen allerdings nur dann einen Einfluß, wenn der Unterricht ausschließlich durch fachlich ausgebildete Musiklehrer erteilt würde, die sich während ihres Studiums bewußt mit der Problematik auseinandergesetzt haben. Lehrerinnen und Lehrer dagegen, deren Qualifikation vor allem in ihrer Neigung zur Musik und vielleicht noch in der Beherrschung eines Instruments besteht, werden im Zweifelsfall auf die Methoden zurückgreifen, nach denen sie selbst mehr oder weniger erfolgreich gelernt haben. Es ist daher zu hoffen, daß sich an den Rahmenbedingungen, unter denen Musikunterricht stattfindet, recht bald etwas ändert. 6. Literaturverzeichnis Die Literaturangaben folgen weitgehend den Empfehlungen der Schrift: "Wie verfasse ich wissenschaftliche Arbeiten?" aus dem DUDEN-Verlag. Im Literaturverzeichnis wird auf größtmögliche Genauigkeit und Vollständigkeit Wert gelegt. Dagegen erfolgen Quellenangaben im Text möglichst knapp: durch den Nachnamen des Verfassers, das Erscheinungsjahr der Quelle und die Seitenzahl; Verfasser und Erscheinungsjahr werden nur dann angegeben, wenn sie aus dem Textzusammenhang nicht bereits eindeutig hervorgehen. Bei mehrspaltigem Layout der Quelle wird zusätzlich nach einem Schrägstrich die Spalte angegeben: "Fischer 1976, 10/2" heißt also: zitiert wird der Aufsatz von [Wilfried] Fischer aus dem Jahr 1976, Seite 10, 2. Spalte. Bei mehreren Aufsätzen desselben Verfassers aus demselben Jahr werden Kleinbuchstaben hinzugefügt, die sich auch im Literaturverzeichnis befinden. - Bei mehreren aufeinanderfolgenden Zitaten aus derselben Quelle wird nur die Seitenzahl vermerkt, sofern es dadurch nicht zu Uneindeutigkeiten kommen kann. Die vollständige Quellenangabe erfolgt nur dann unmittelbar in der Fußnote, - wenn die Literaturliste nicht durch eine Quelle belastet werden soll, die nur einmal zitiert wird und zum Thema keinen direkten Bezug hat - wenn es sich nur um die Weitergabe eines Belegs aus zitierter Literatur handelt, die Quelle selbst mir aber nicht vorlag. Im Literaturverzeichnis vorkommende Schriften, die in bibliographischer Absicht aufgenommen wurden, auf die aber in der Arbeit nicht eingegangen wurde, sind mit Stern gekennzeichnet. Abkürzungen für Zeitschriften und Handbücher: NHdM Neues Handbuch der Musikwissenschaft.Hg. Carl Dahlhaus. Laaber: Laaber-Verlag. 1980 ff. MuB Musik und Bildung. Zeitschrift des Verbandes der deutschen Schulmusikerzieher etc. Mainz: Schott, 1969 ff. MuU Musik und Unterricht. Zeitschrift für Musikpädagogik. Velber: Friedrich-Verlag, 1990 ff. ZfMP Zeitschrift für Musikpädagogik. Hg. Klaus-Ernst Behne u.a.. Regensburg: Bosse, 1976 ff. Aufsätze und Bücher zum Thema: Abel-Struth, Sigrid. "Methodik des Musikunterrichts. Geschichte, Begriffsfeld und Theorie". Methoden des Musikunterrichts. Eine Bestandsaufnahme.Hg. Wolfgang Schmidt-Brunner. Mainz: Schott, 1982 [a]. 30 - 47. Abel-Struth, Sigrid. "Musik im Elementar-Bereich. Zur methodischen Planung des Musikalischen Beginns". Methoden des Musikunterrichts. Eine Bestandsaufnahme.Hg. Wolfgang Schmidt-Brunner. Mainz: Schott, 1982 [b]. 112 - 124. Adorno, Theodor W[iesengrund]. "Zur Musikpädagogik". Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt. [Erstmals erschienen in der "Jungen Musik", Dezember 1957.] 5. Aufl. Göttingen, 1972. Beckmann, Arvid. "Erfahrungen mit einem 'traditionellen Notenlehrgang' in zwei 3. Klassen und einer 4. Klasse an der Waldschule in Flensburg". Musikerziehung als Herausforderung der Gegenwart. Kongreßbericht der 13. Bundesschulmusikwoche Braunschweig 1980. Mainz: Schott, 1981. 252-261. Böhle, Reinhard C.. "Wer knackt den Zahlencode? Neugestaltung einer nicht mehr jungen Zahlen-Tonschrift für die Grundschule". MuU 24/1994. 21 - 22. Bruhn, Herbert. "Rhythmus in Wahrnehmung und musikbezogener Handlung". Musikpsychologie. Ein Handbuch. Hg. Herbert Bruhn, Rolf Oerter und Helmut Rösing. Reinbek: Rowohlt, 1993. 291 - 299. Dahlhaus, Carl. "Notenschrift heute". Notation Neuer Musik.Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik IX. Mainz: Schott, 1965. 9-34. Danuser, Hermann. Die Musik des 20. Jahrhunderts. NHdM Bd. 7. Laaber: Laaber-Verlag, 1984. Dotzauer, Wilfried. "Medien im Musikunterricht". Methoden des Musikunterrichts. Eine Bestandsaufnahme.Hg. Wolfgang Schmidt-Brunner. Mainz: Schott, 1982. 185 - 205. Eco, Umberto. Zeichen. Einführung in einen Begriff und seine Geschichte. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1977. Finkel, Klaus, und Ulrike Wünnenberg. Musikalische Struktur und graphische Notierung. Hörerziehung bei musikalisch nicht vorgebildeten Schülern der Sekundarstufe. Materialien zur Musikpädagogik Bd. 1. München, Salzburg: Musikverlag Emil Katzbichler, 1975. Fischer, Wilfried. "Traditionelle Notation im Musikunterricht der Primarstufe. Neue didaktisch-methodische Überlegungen zu einer alten Streitfrage". MuB 1/1976. 9 - 15. Fischer, Wilfried. "Die Einführung der traditionellen Notation in der GS als Methodenproblem". Musikerziehung als Herausforderung der Gegenwart. Kongreßbericht der 13. Bundesschulmusikwoche Braunschweig 1980. Mainz: Schott, 1981. 237-251 Fischer, Wilfried. "Methoden im Musikunterricht der Primarstufe". Methoden des Musikunterrichts. Eine Bestandsaufnahme.Hg. Wolfgang Schmidt-Brunner. Mainz: Schott, 1982. 125 - 144. *Flechsig, Hartmut. "Gestalten und Umgestalten. Überlegungen zur musikalischen Notation". MuU 24/1994. 10 - 13. Frisius, Rudolf. "Die Notation im Musikunterricht". Forschung in der Musikerziehung, Heft 9/10-1973. *Frisius, Rudolf.. Notation und Komposition. Unterrichtsmaterialien für die Sekundarstufe I. Stuttgart: Klett, 1980. Georgiades, Thrasybulos G.. Musik und Sprache. Das Werden der abendländischen Musik dargestellt an der Vertonung der Messe. Berlin - Heidelberg - New York: Springer, 1954. Giebeler, Konrad. "Musikkunde-Unterricht ohne Noten? Ein Plädoyer für die Notenschrift". MuB12/1969. 545 - 548. Graßmann, Bernd. "Progressive Vermittlung des Partiturgebrauchs im allgemeinbildenden Musikunterricht". MuU 24/1994. 23 - 33. Große-Jäger, Hermann: "Notation von Musik als Unterrichtsfaktor". ZfMP 3/1977. 40-49. Gruhn, Wilfried, "Wie Kinder einfache Rhythmen hören". Vom pädagogischen Umgang mit Musik. Hg. Hermann J. Kaiser, Eckhard Nolte und Michael Roske. Mainz: Schott, 1993. S. 156 - 160. Günther, Ulrich. "Die Notation als Beispiel zu einer Didaktik der Musik". Fortschritt und Rückbildung in der deutschen Musikerziehung, hg. Egon Kraus. Mainz: Schott, 1965. Wieder abgedruckt in MuB 9/88. 660 - 663. Günther, Ulrich. "Über Notation und Notenlehrgänge". Aspekte gegenwärtiger Musikpädagogik: Ein Fach im Umbruch,hg. W.-D. Lugert, und V. Schütz. Stuttgart 1991. 47 - 53. Helms, Siegmund. "Schrift und Klang". MuU 24/1994. 4 - 9. *Jacobsen, Jens. Keine Not mit Noten. Ein neuer Weg zum Notenlernen in der Schule. Mit einer Toncassette. Mainz: Schott, 1987. Kaiser, Hermann J.. "Notation(en) im Musikunterricht oder Was hat schülerorientierter Musikunterricht mit der schriftlichen (Re)präsentation von Musik zu tun?" Musik in der Schule, Teil I: Heft 2/1995. 78 84. Teil II: Heft 3/1995. 143 - 148. Kaiser, Hermann J. und Eckhard Nolte. Musikdidaktik. Sachverhalte - Argumente - Begründungen. Ein Lese- und Arbeitsbuch. Mainz - London - New York - Tokyo: Schott, 1989. Karbusicky, Vladimir. Grundriß der musikalischen Semantik. Grundrisse Bd. 7. Darmstadt, 1986. Karkoschka, Erhard. Das Schriftbild der Neuen Musik. Bestandsaufnahme neuer Notationssymbole. Anleitung zu deren Deutung, Realisation und Kritik. Celle: Moeck, 1966. Klusen, Ernst. Gefahr und Elend einer neuen Musikdidaktik. Köln: Gerig, 1973. *Klusen, Ernst. Musikverständnis ohne Notenkenntnis. Voraussetzungslose Hinführung zur Musik in höheren Schuljahren und in der Erwachsenenbildung. 3 Lehrgänge und einige Vorüberlegungen. Berlin: Lienau, 1975. Koch, Peter. Blattlesen in der Schule. Die Nü-Methode. Sonderausgabe der Roten Reihe. Wien: Universal Edition, 1972. Koch, Peter: "Traditionelle Notenschrift - in der Schule überflüssig?" MuB 5/74 Köneke, Hans W. Langner, Annelies: "Musik aufzeichnen" (Folgen 1 - 10). MuB 11/82, 732-735; 12/82, 812-813; 1/83, 37-38; 3/83, 37-39; 4/83, 41-43; 5/83, 39-40; 6/83, 39-42; 7-8/83, 47-48; 9/83, 45-46; 10/83, 37-40. Kraemer, Rudolf-Dieter. Notation: Übungen - Spiele. Arbeitsblätter für Schule und Musikschule. Musikunterricht: Materialien - Methoden - Modelle. ?: Wißner, 1993. *Küntzel, Gottfried. "Kleine Archäologie der Tonleiter. Anmerkungen zur Didaktik der Allgemeinen Musiklehre". MuB 11/1984. 733-740, 749. Küntzel-Hansen, Margit. "Einführung und Anwendung graphischer Notation im Musikunterricht der Grundschule". MuU 24/1994. 14 - 20. Kühlenthal, Michael. "Musikalische Graphik im Unterricht". MuB 1/1976. 20 - 24. *Langner, Annelies. "Vom Umgang mit freier graphischer Notation im Unterricht der Grundschule". MuB 6/80. 386-389. *Maschke, Helmut. "Möglichkeiten der Liedeinführung in der Grundschule unter weitgehendem Verzicht auf Vor- und Nachsingen". Musik in der Schule, Teil IV: Heft 3/1995. 139 - 143. Meißner, Ralf und Frank Rundfeldt. "Schrift und Klang - digital. Über den Einsatz des Computers für die Visualisierung von Musik". MuU 24/1994. 34 - 42. *Meyer, Heinz. Musik als Lehrfach. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1978. Moles, A[braham] A.. Informationstheorie und ästhetische Wahrnehmung. Köln 1971. Zit. nach Frisius 1973. Nolte, Eckhard. "Methoden des Musikunterrichts als Problem der Musikpädagogik. Überlegungen zu seiner theoretischen Durchdringung". Methoden des Musikunterrichts. Eine Bestandsaufnahme.Hg. Wolfgang Schmidt-Brunner. Mainz: Schott, 1982. 68 - 82. *Reckziegel, Walter. "Notation". Kritische Stichwörter zum Musikunterricht.Hg. Walter Gieseler. München: Fink, 1978. 269-275. *Rectanus, H. "Das Aufschreiben von Musik als Form der musikalischen Analyse. Erfahrungen mit Vorund Grundschulkindern beim Musikhören und Notieren". Musik - Kunst - Puppenspiel.Kontakt 4 Materialien zur Lehrerbildung und Lehrerfortbildung. 1975 Rectanus, H. "Nicht eine, viele Notationen für die Schule". MuU 2/1990. Rectanus, H. "Notation - Notenlehre". Neues Lexikon der Musikpädagogik. Sachteil.Hg. Siegmund Helms, Reinhard Schneider und Rudolf Weber. Kassel: Bosse, 1994. Scheitler, Wenzel und Wilhelm Börger. Lehr- und Arbeitsplan für den Musikunterricht in den Volksschulen.Ratingen: Henn, 1960. Schneider, Ernst Klaus. "Unterrichtsmethoden im Fach Musik". MuB 1980/4. 221 - 225. *Schwarz, Rudolf. "Kontakte zum Notenbild". Musikerziehung. Feb. 1981. 97-102. *Suppan, Wolfgang. "Musik und Schrift: Was kann und soll Musiknotenschrift leisten?" MuB 3/1987. 196-203. *Torkel, Wilhelm. "Einführung der Notenlehre durch gebundenes Musizieren in der Hauptschule". Jahrbuch für Musiklehrer. Bd. 4 Eres Lilienthal, 1984. 86-104. Venus, Dankmar. Unterweisung im Musikhören. Beiträge zur Fachdidaktik. Wuppertal: Henn, 1969. Vogelsänger, Siegfried. "Das Erlernen der Notenschrift: Eine pädagogisch fragwürdige Aufgabenstellung". MuB 4/1969. 181 - 184 Vogelsänger, Siegfried. Musik als Unterrichtsgegenstand der Allgemeinbildenden Schule: Didaktische Analysen - Methodische Anleitungen. Bausteine für Musikerziehung und Musikpflege Bd. 18. Mainz: Schott, 1970. *Vogelsänger, Siegfried. "Graphische Darstellung als Hilfsmittel der Werkinterpretation". Neue Ansätze im Musikunterricht, hg. Rectanus, H.. Stuttgart 1972 *Vogelsänger, Siegfried. "Musiktheorie in der Grundschule". Handbuch Musikunterricht Grundschule. Hg. Willi Gundlach. Düsseldorf: Schwann-Bagel, 1984. Weisbrod, Fried. "Methoden der Hörerziehung und der Gehörbildung". Methoden des Musikunterrichts. Eine Bestandsaufnahme.Hg. Wolfgang Schmidt-Brunner. Mainz: Schott, 1982. 221 - 247. *Weyer, Reinhold. "Grundschüler lernen Hören und Sehen". Zum Stellenwert graphischer Notation im Grundschul-Musikunterricht. Neue Musikzeitung 2/83. 18. Wiechell, Dörte. "Der Stellenwert der traditionellen Notation im Musikunterricht der allgemeinbildenden Schule". MuB 1976. 15 - 19.