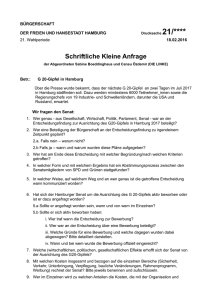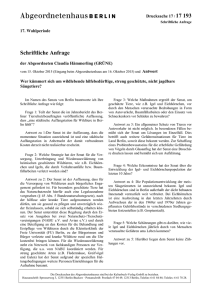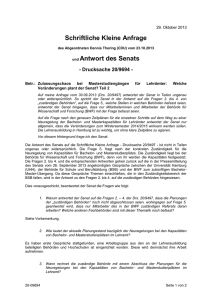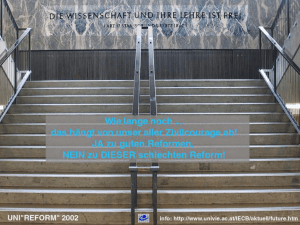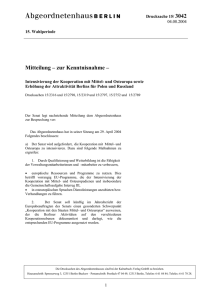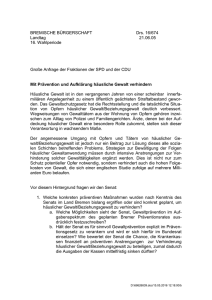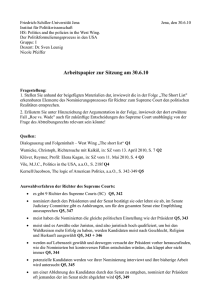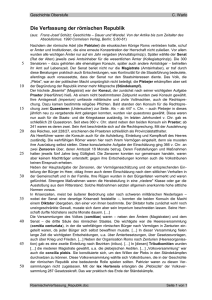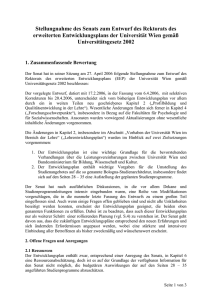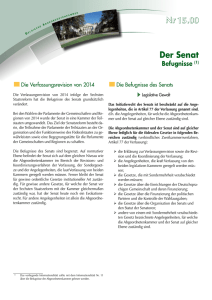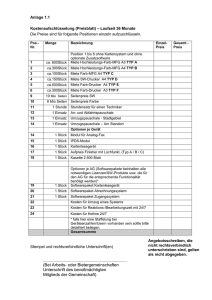Sinn und Unsinn einzelner Instrumente der Wohnungspolitik
Werbung

Johannes Mosmann www.dreigliederung.de Sinn und Unsinn einzelner Instrumente der Wohnungspolitik Ergänzung zu dem Papier „Wie kann die Berliner Landespolitik weitere Mietsteigerungen verhindern?“ vom Verein Bewegung für soziale Dreigliederung, das auf dem Mietenkongress 2010 des Berliner Landesverbandes der Partei Bündnis 90/Die Grünen diskutiert wurde. 1. Ist eine Anpassung der Hartz IV Sätze an die Mieten sinnvoll? Die Frage, ob eine Anpassung der Hartz IV Sätze an die Mieten sinnvoll ist oder nicht, hängt davon ab, ob bei der betreffenden Miete die Bezahlung des Wohnrechts als solchem ausgeschlossen ist oder nicht. Solange mit der Miete nicht nur Leistung gegen Leistung getauscht wird, sondern auch Leistung gegen Recht, kann man überhaupt nichts sinnvolles tun. Als vor einigen Jahren die Hartz IV Sätze angehoben wurden, haben die Vermieter einfach die Miete an die Hartz IV Sätze angepasst. Solange der Vermieter die Möglichkeit hat, die Miete unabhängig von realwirtschaftlichen Leistungen zu erhöhen, kommt eine Erhöhung der Hartz IV Sätze deshalb einer Subventionierung der unbegründeten Verteuerung des Wohnraums gleich. Unter den gegebenen Bedingungen ist eine Anpassung der Hartz IV Sätze also keine Lösung. 2. Ist es sinnvoll, die maximal mögliche Mieterhöhung bei Neuvermietung auf 15 % zu begrenzen? Nein, das ist nicht sinnvoll. Die Gerechtigkeit ist keine Prozentfrage. Die Frage ist vielmehr, von was die 15% eigentlich genommen werden. In der Miete sind ja die Kosten für die realwirtschaftlichen Leistungen der Eigentümer, zu denen ich auch ihr Einkommen zähle, mit den Renditen zusammengeworfen, die in keinem Zusammenhang mit einer Leistung stehen, sondern auf einer Kapitalisierung des Rechts beruhen. Man kann deshalb gar nichts über Sinn oder Unsinn der 15% aussagen. Was ist, wenn die Kosten für die Modernisierung nicht mit den 15% gedeckt werden können? Sollen wir das dann über die Steuer bezahlen? Und was ist, wenn die Kosten unter 15% liegen – wollen wir trotzdem 15% bezahlen? Wenn eine Leistung dahinter steht, muss der Eigentümer auch 20% verlangen können, wenn keine dahinter steht, darf er keinen einzigen Prozent verlangen. Man muss also wieder Leistung und Kapitalisierung des Rechts unterscheiden können alles andere ist Hokus-Pokus. 3. Ist es sinnvoll, die Obergrenze der Mieterhöhungen generell von 20% auf 15% des Mietspiegels abzusenken? Nein, das ist nicht sinnvoll. Was ist nämlich der Mietspiegel? Der Mietspiegel ist der Durchschnitt der spekulationsbedingten Mietpreise. Da hilft es wenig, wenn man 20% oder 15% mehr für die Spekulation bezahlen soll. An den spekulativen Preisen kann man sich gar nicht orientieren, man muss vielmehr herausbekommen, was der reale, gewinnbereinigte Kostenanteil der Miete ist. Wenn man einen gerechten Preis bekommen will, muss man sich an der Realwirtschaft orientieren. Sinnvoll wäre einfach der Nachweis, was gemacht wurde und was es gekostet hat. 4. Ist es sinnvoll, eine generelle Mietobergrenze festzulegen? Nein, das ist nicht sinnvoll. Wenn es den Betrag X kostet, den Dachstuhl zu machen, dann kostet es 1 eben den Betrag X. Irgendjemand bezahlt das, wenn nicht die Mieter, dann eben die Steuerzahler. Es hat keinen Sinn, gegen das zu agitieren, was ein Mensch für seine Leistungen an Einkommen bekommen muss. Insofern mit der Miete nichts anderes bezahlt wird als echte Leistungen, kann es deshalb keinen staatlich festgesetzten Preis geben. Was aber zusätzlich zur Leistung bezahlt wird, das muss man aus der Miete herausbekommen. Und das kann man nicht durch eine Obergrenze herausbekommen, sondern nur dadurch, dass man eine Eigentümerstruktur schafft, in der das Wohnrecht als solches nicht vergütet werden kann. 5. Was ist von dem Programm „soziale Stadt“ zu halten? „Sozial“ ist an diesem Programm gar nichts. Zunächst soll es durch Spielereien wie Grillparties zu einer Identifizierung der Anwohner mit ihrem Kiez führen. Die Menschen sollen sich verantwortlich fühlen. Das Problem liegt aber gar nicht auf der Gefühlsebene, sondern darin, dass die Menschen mit ihrem Kiez eben nicht identisch sind. Die Frage ist nicht, wie sorgt man dafür, dass die Menschen sich verantwortlich fühlen, sondern die Frage ist, wie sorgt man dafür, dass sie tatsächlich verantwortlich sind. Und solange die Menschen bloß die Rendite der Eigentümer ihres Kiezes zu erwirtschaften haben, sind sie faktisch nicht verantwortlich. Das Programm fördert außerdem kulturelle Projekte. Das bedeutet aber, dass die Kultur über den Förderkatalog vom Staat definiert wird. Durch Quartiersmanagement und ähnliches strebt in Wahrheit der Staat in die Lücke, die die Kultur wegen der Spekulation verlassen musste. Der Staat wird zum Unterhalter. Und das merkt man sofort, wenn man eines der geförderten Projekte betritt – es ist schlicht dilettantisch, was da getrieben wird. Es kann aber auch nicht anders sein: echte Kultur beruht immer auf der Initiative und Fähigkeit freier Geister, und niemals auf dem, was aus politischen Erwägungen heraus bestimmt wird. „Förderung“ hieße also, wenn man es ernst meinte: Lasst den Menschen den Raum, den sie brauchen, um selbst die Initiative zu ergreifen. Der Staat kann den Menschen dabei helfen, sich von den Eigentümern ihres Lebensraumes frei zu machen, indem er Grundstücke günstig an alternative Wohnprojekte abgibt. Dann braucht allerdings auch niemand mehr eine Schein-Identifizierung durch ein Quartiersmanagement, weil „Identität“ dann etwas reales ist. In Wahrheit strebt das Programm „soziale Stadt“ das genaue Gegenteil an. Das erkennt man z.B. an dem Angebot der „Zwischennutzung“ von leerstehenden Gebäuden. Kulturelle Initiativen dürfen leerstehende Räume so lange nutzen, bis es sich lohnt, diese zu verkaufen. Die Nutzung durch die Kulturinitiativen, die man dann vor die Türe setzt, ist gleichzeitig das Mittel, um den Wohnraum zu verteuern. Gegenüber den Eigentümern der Gebäude wirbt die Stadt nämlich damit, dass durch die geförderte Zwischennutzung der Wert der Immobilie steige, was höhere Mieten und einen höheren Verkaufspreis ermögliche. Die Förderung der Spekulation ist also das eigentliche Motiv für das Programm „soziale Stadt“. 6. Soll Berlin zum sozialen Wohnungsbau zurückkehren? Auf keinen Fall! Beim „sozialen Wohnungsbau“ erstattete der Senat den Immobilienfonds die „Kapitalkosten“, die den Fonds angeblich dadurch entstanden, dass sie Wohnraum günstiger zur Verfügung stellten. Die Kapitalkosten wiederum bestanden aus den Zinsen für Fremdkapital und den Renditeerwartungen der Anleger. Der Steuerzahler bezahlte den Spekulanten die Opportunitätskosten, sprich, die Gewinne, die sie theoretisch hätten machen können, und verteuerte durch diese traumhafte Subventionierung der Spekulation den eigenen Lebensraum. Die Verpflichtung, die Mieten für ausgesuchte Wohnungen auf dem Niveau der Sozialmiete zu halten, bestand nur für den Zeitraum der Förderung der „Kapitalzinsen“ durch den Senat. 430.000 2 Wohnungen in Berlin wurden auf diese Weise „sozialisiert“, keine von ihnen ist heute noch vorhanden. Der soziale Wohnungsbau ist somit selbst einer der Gründe, warum Berlin jetzt das Problem der steigenden Mieten hat. 7. Kann Berlin durch Förderungen steuernd in den Wohnungsmarkt eingreifen? Ja, wenn Rücksicht auf die Organisationsform der zu fördernden Eigentümer-Gesellschaft genommen wird. Eine Förderung ohne Rücksicht auf die Organisationsform ist immer eine Subventionierung der Verteuerung des Wohnraumes. Das heisst, der Senat kann dem Steigen der Mieten nur dann durch Förderung entgegenwirken, wenn er nicht Eigentümer fördert, sondern Mieter, die sich zur Bildung einer neuen Eigentumsform zusammengeschlossen haben. „Förderung“ heisst in diesem Zusammenhang dann allerdings etwas ganz anderes als bislang: Der Senat fördert, wenn er die Mieter über die Möglichkeiten der Selbstverwaltung aufklärt, er fördert, wenn er aus dem Staatsbesitz zu verkaufendes Land nicht mehr an den meistbietenden Private-Equity-Fonds versteigert, sondern zu einem realistischen Preis an Genossenschaften, Stiftungen oder Syndikate verkauft, er fördert, wenn er bei der Bereitstellung günstiger Kredite hilft - kurz gesagt: er fördert nicht, wenn er Geld gegen Einhaltung eines Förderkataloges verteilt, sondern er fördert, indem er Menschen erlaubt, selbstbestimmt zu handeln, sofern sie die Kapitalisierung des Bodens ausschliessen. 8. Kann der Senat über die städtischen Wohnungsbaugesellschaften regulierend in den Wohnungsmarkt eingreifen? Ja, wenn er aus seinen Wohnungsbaugesellschaften das genaue Gegenteil dessen macht, was sie gegenwärtig sind. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften sind derzeit stinknormale Kapitalgesellschaften, und taugen daher nicht mehr und nicht weniger als jede andere Kapitalgesellschaft zur Verbilligung des Wohnraumes, also so erstmal gar nicht. Vielmehr sind sie selbst die Urheber der Verteuerung. Ich erinnere an die degewo, die nach Wegfall der Anschlussförderung im sozialen Wohnungsbau, sprich, als die Renditeerwartungen der Anleger nicht mehr vom Staat bezahlt wurden, die Mieten verdreifacht und die Sozialhilfeempfänger auf die Straße gesetzt hat. Oder an die GSW, Berlins größte „gemeinnützige“ Wohnungsbaugesellschaft, ebenfalls eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die eben vom Senat an einen Private-EquityFonds verkauft wurde, also einem Fonds, der bis zu 90% der Kosten für den Kauf von den Mietern und den nächsten Eigentümern bezahlen lässt. Beides muss ausgeschlossen werden, wenn eine Wohnungsbaugesellschaft als Instrument für die Stadtentwicklung dienen soll. Die Baugesellschaft darf erstens nicht in die Lage kommen, in den Mietpreis einen Teil einzurechnen, der nicht durch realwirtschaftliche Leistungen gedeckt ist. Die „Kostenmiete“ ist dabei keine Orientierungshilfe, denn dieses Wort ist ein trickreicher Täuschungsversuch: Zu den Kosten zählt man dabei auch die Renditeerwartungen der Anleger, und die können bis zu 70% der Miete ausmachen. Zweitens darf die Wohnungsbaugesellschaft auch nicht die Möglichkeit haben, ihr Eigentum zu verkaufen. Wenn sie das Interesse an der Verwaltung der Immobilien verliert und diese abgeben will, kann sie sich zwar die Entschädigung ihrer noch unbezahlten Aufwendungen oder Herausgabe ihrer Einlagen verlangen. Irgendein Preis für das Recht als solches darf nicht in diese Entschädigung einfließen. Es muss also dafür gesorgt werden, dass sie das Recht an der Verwaltung der Immobilien nicht verkaufen, sondern nur kostenlos an denjenigen übergeben kann, der dann in der Lage ist, die Immobilien zu verwalten. Möglichkeiten, die Unverkäuflichkeit des Rechts herzustellen, bietet das Stiftungsrecht, ein Syndikatsmäßiger Verbund aus GmbHs, und vielleicht auch die Genossenschaft. Sicher lassen sich 3 auch andere Formen finden, aber die Trennung von Bewertung von Leistungen und Bewertung von Rechten muss eben auf irgendeine Weise vollzogen werden, anders geht’s nicht. Falls das Eigentumsrecht der Wohnungsbaugesellschaften nicht neutralisiert werden kann, dann sollte einerseits vom Gesetzgeber geregelt werden, dass die Wohnungsbaugesellschaften im Fall eines Verkaufes Initiativen vorziehen müssen, die dazu in der Lage sind. Das Wichtigste in dieser Beziehung geht aber nur ohne gesetzlichen Zwang: Dass überhaupt erkannt wird, was die Stadt einerseits durch einen teuren Verkauf an Immobilienfonds verliert, und was sie durch einen günstigeren Verkauf an soziale Initiativen gewinnt. Der Begriff der „Stadtrendite“ muss richtig gefasst werden können. Denn wenn auch ein Private-Equity-Fonds erstmal mehr bezahlen kann als das selbstverwaltete Wohnprojekt, bringt langfristig gesehen das selbstverwaltete Wohnprojekt wesentlich mehr Geld in die Staatskassen. Ein Grund dafür ist, dass das Geld, das ein Immobilienfonds über Miete und Verkauf einnimmt, aus Berlin verschwindet, dem Wirtschaftskreislauf entzogen wird, während das Geld, das die Berliner in ihren Taschen behalten bzw. für Leistungen ausgeben, eben im Wirtschaftskreislauf bleibt. Ein weiterer Grund ist, dass der Staat die durch den Fonds erzeugte Verteuerung des Wohnraumes letztendlich selbst bezahlt, wenigstens solange er Sozialstaat ist. Es gibt viele andere Gründe für die höhere Wirtschaftlichkeit der alternativen Wohnprojekte, der bedeutsamste Grund ist für das gewohnte Denken jedoch am schwersten zu fassen: der ökonomische Wert des Kulturlebens, das aber seinerseits von günstigen Mieten und der Möglichkeit der Selbstverwaltung abhängt. 9. Wie kann der Senat die alternativen Wohnprojekte unterstützen? Das Wichtigste ist, dass der Senat überhaupt versteht, was „Stadtrendite“ bedeutet, und welchen Gewinn die Stadt und der Senat selbst dadurch haben, dass sie selbstverwaltete, nicht gewinnorientierte Wohn- oder Bauprojekte unterstützen. Diese Einsicht fehlt im Augenblick. Alles weitere hängt aber davon ab, ob es den alternativen Wohnprojekten gelingt, eben diese Einsicht herbeizuführen oder nicht. Wenn diese Einsicht vorhanden ist, dann wäre der nächste Schritt die Einrichtung einer Stelle beim Senat speziell für den Kontakt zu den Wohnprojekten, so wie das etwa in Hamburg erfolgreich gemacht wird. Ist aber erst einmal die Möglichkeit eines gegenseitigen Wahrnehmens gegeben, so ist es auch möglich, dass der Senat die Berliner Bürger bei den Verhandlungen um ihren Boden wenigstens als gleichwertige Gesprächspartner zu den Private-Equity-Fonds betrachtet. Unabhängig von ideologischen Vorurteilen könnte dann im konkreten Fall geprüft werden, ob der Fonds, oder die soziale Initiative faktisch der größere Gewinn für Berlin ist. Fördern sollte der Senat nicht über Steuergelder, weil diese erstens immer einen Förderkatalog im Schlepptau haben, und zweitens die Wirtschaftlichkeit des Projekts verzerren. Die Projekte streben das auch gar nicht an, sie wollen nicht, dass die Miete letztendlich von Steuergeldern bezahlt wird, sondern sie wollen die Miete selbst in den Griff kriegen. Die Förderung könnte daher so aussehen, dass man den Projekten dabei hilft, günstigen Kredit zu bekommen. Damit würde man dem Selbstverwaltungsimpuls Rechnung tragen: Kredit appelliert im Unterschied zur Steuerfinanzierung an die Initiativkraft und Verantwortlichkeit der Menschen, und bringt die Sicherheit, dass das betreffende Grundstück nicht vernachlässigt wird. Fördergelder sorgen außerdem dafür, dass die Sozialbindung zeitlich befristet bleibt. Bei einer 4 echten Förderung der alternativen Eigentumsformen dagegen ist die Sozialbindung dauerhaft. Wie diese dauerhafte Sozialbindung gesichert wird, habe ich in dem Papier „Wie kann die Berliner Landespolitik weitere Mietsteigerungen verhindern?“ dargelegt. Wenn der Senat etwas verschenken will, dann soll er an anderer Stelle verschenken. Der Genossenschaft Bremer Höhe hat der Senat ein Grundstück für 14 Millionen Euro verkauft, dann hat er ihr 8 Millionen Fördergelder gegeben, plus Förderkatalog, versteht sich. Der Geschäftsführer der Bremer Höhe, Ulf Heitmann, stellt fest: 'Hätte der Senat uns das Grundstück günstiger gegeben, hätten wir auch keine Förderung durch Geldmittel gebraucht'. Dann hätte aber der Staat auch nicht mitsprechen können. Dieser Umweg der Förderung über das Geld dient also wohl dem Zweck, die Eigenverantwortung der Projektbetreiber zu untergraben. Wieso soll der Senat aber überhaupt an der Stelle, da er ein soziales Projekt ermöglichen will, Steuern einnehmen? Das ist widersinnig. Er gibt ja das Grundstück in die Verwaltung der sozialen Initiativen, um günstigen Wohnraum zu fördern. Sofern das Grundstück den Senat überhaupt eine entsprechende Summe gekostet hat, ist das eine Ausgabe, so wie die Förderung der Eigentümer beim sozialen Wohnungsbau eine Ausgabe gewesen ist - nur dass diese Ausgabe tatsächlich günstigen Wohnraum schafft, während jene den Wohnraum verteuert hat. Bei einer Ausgabe etwas einnehmen zu wollen, ist schlicht Unfug. Und noch größerer Unfug ist es, an dieser Stelle Gewinne machen zu wollen. Das ist gar nicht anders, als wenn man glaubt, man könne etwas einnehmen oder gar Gewinne machen, indem man einem Menschen Sozialhilfe gibt. Das geht eben nicht. Man kann nur indirekt etwas einnehmen, insofern der Mensch nämlich durch die Sozialhilfe in die Lage kommt, seine Kräfte zu entfalten. Und so ist es auch hier: In dem Maße, in dem der Senat bei Grund und Boden auf Einnahmen verzichtet, in dem Maße werden seine Steuereinnahmen an anderer Stelle steigen, weil dann eben die Mieteinnahmen nicht an der New Yorker Börse verschwinden - und weil dann eben nicht der Staat, sondern das wirtschaftliche Leben die Menschen versorgt. Und von diesem wirtschaftlichen Leben ist der Staat wiederum selbst abhängig, denn der Staat ist gegenüber dem Wirtschaftsleben ein reiner Konsument. Konstruktiv wäre die Förderung, wenn die regierende Partei beim Verkauf des Staatsbesitzes nicht primär an das Gewinne-Machen denkt, sondern daran, was die Initiativen mit dem Grundstück zu tun imstande sind. Alle zu veräußernden Grundstücke des Senates werden jedoch gegenwärtig vom Berliner Liegenschaftsfonds an den Meistbietenden versteigert. Auf der Webseite des Liegenschaftsfonds heisst es: Mit unserer Datenbank und den rund 5.000 Immobilien im Angebot haben Sie die Möglichkeit, genau die Immobilie zu finden, die Sie suchen. Egal, was Sie möchten: Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser, Lauben, Landhäuser, Gutshöfe und Villen, Geschäftsund Bürohäuser, denkmalgeschützte Objekte, See- und Gartengrundstücke, Kliniken und Krankenhäuser, Grundstücke für Bauherrengemeinschaften, bebaute und unbebaute Grundstücke, Immobilien für Sondernutzungen, Innerstädtische Gewerbeflächen oder Logistikgroßflächen mit Autobahnanschluss. Diese Mentalität wäre zu hinterfragen. Es gibt auf dem freien Markt genug Auswahl an Spekulationsobjekten, der Senat muss das Staatseigentum nicht erst wie eine Prostituierte herumreichen. Er könnte durchaus auch einen Gedanken daran verschwenden, in wessen Hände der Berliner Boden eigentlich geraten soll. Wenn er also das Staatseigentum unbedingt verkaufen will, dann sollte er dem Meistbieter-Prinzip wenigstens einen anderen Aspekt vorziehen: Die Frage, was der Käufer mit dem Grundstück vor hat, und welche gesamtwirtschaftlichen Folgen aus der geplanten Nutzung des Grundstückes resultieren, ob also, auf längere Sicht gesehen, der scheinbare Meistbieter tatsächlich der Meistbieter ist. 5 Es gibt laut Ulf Heitmann nur einen einzigen Fall, da es einer sozialen Initiative in Berlin gelungen ist, ein Grundstück aus dem Berliner Staatsbesitz zu ersteigern. Der Grund für das Nachsehen der nicht-gewinnorientierten Bauherren ist nicht immer der Preis, sondern oft die Tatsache, dass die meisten sozialen Akteure vom Liegenschaftsfonds einfach ignoriert werden. Ein stärkeres zugehen des Liegenschaftsfonds auf Gemeinschaften, die die Kapitalisierung des Rechts und damit das Steigen der Mieten verhindern können, wäre also das Mindeste, was der Senat zur Senkung der Mieten tun müsste. 10. Privatisierung - ja oder nein? Der Kapitalismus enthält eine Wahrheit: die Wirtschaft muss mit der Initiativkraft des Einzelnen rechnen. Die Wirtschaft verkümmert, wo die Initiativkraft durch eine Staatsverwaltung ersetzt werden soll. Die Antwort auf die Bodenfrage kann deshalb nicht sein, dass ein sozialistisch gedachter Staat Eigentümer des Bodens wird. Der beste Beweis dafür ist der Zustand Ost-Berlins nach der Wende. Der Kapitalismus enthält jedoch auch eine Lüge: dass die Initiativkraft des Einzelnen auf einer Kapitalisierung des Rechts beruht. Das Gegenteil ist der Fall: sofern der Kapitalismus auch die Möglichkeit einschliesst, das Recht zu kapitalisieren, hebelt er die Initiativkraft wieder aus. Denn was hat der Aktionär, der die Rendite kassiert und vielleicht nicht einmal in dem selben Land lebt, mit der Gestaltung des Lebensraumes in einem Berliner Kiez zu tun? Nichts. Initiativkraft können nur die Menschen entfalten, die tatsächlich mit der betreffenden Sache verbunden sind, und sie wird dadurch verhindert, dass die Menschen für das Recht, Initiativkraft zu entfalten, viel Geld an einen Aktionär bezahlen müssen, der nichts mit der Sache zu tun hat. Die alternativen Wohnprojekte haben nun eindrucksvoll bewiesen, dass die private Initiative der Menschen nicht davon abhängt, dass sie das Grundstück verkaufen oder in anderer Weise kapitalisieren können. Die Initiativkraft braucht lediglich das Recht, einen Ort ohne jede Einmischung zu nutzen, sie braucht nicht die Möglichkeit, dieses Recht selber wieder zu verkaufen. Im Gegenteil: kann das Nutzungsrecht weiterverkauft werden, dann verliert der Mensch das Interesse an der konkreten Nutzungsart. Für den, der in das Nutzungsrecht als solches investiert, ist es nämlich völlig irrelevant, ob das Grundstück von einem Theater oder von McDonalds oder von wem auch immer bewirtschaftet wird, entscheidend ist für ihn, was die Menschen für das Nutzungsrecht bezahlen. Er kann sich, wenn er nach der Logik seines Geschäftes „richtig“ denkt, gerade nicht für den konkreten Wert, und nicht für den gesamtwirtschaftlichen Gewinn interessieren, sondern nur für den abstrakten Zahlenwert seines persönlichen Einkommens. Also: Privatisierung ja, wenn damit die Verantwortung von Individuen für die Gestaltung ihres Lebensraumes gemeint ist an Stelle einer Zentralverwaltung, Privatisierung nein, wenn damit gemeint ist, dass mit dem Recht auf Entfaltung der Initiativkraft selber gehandelt werden soll. Wenn man nicht ausschliesst, dass das Recht selber zur Ware gemacht werden, dann beruht die Dialektik zwischen „privat“ und „öffentlich“ ohnehin auf einer Illusion: Die öffentliche Hand spekuliert mit dem Recht genau so wie jeder private Investor, siehe GSW. 10. Was können die Grünen tun? Die Grünen werden sich von anderen Parteien darin unterscheiden müssen, dass sie den Mut haben, wissenschaftlich zu denken anstatt populistisch. Faktisch ist es so, dass die bestehenden Initiativen die Mieten dadurch niedrig halten können, dass sie Gemeinschaften bilden, in denen zwar die 6 Leistungen, nicht aber das Wohnrecht als solches vergolten werden kann. Durch die Arbeit von Initiativen wie Stiftung Edith Maryon, Stiftung trias oder Mietshäuser Syndikat ist die Frage, wie man Mieten senken kann und was gegen Gentrifizierung getan werden kann, eigentlich schon beantwortet. Die praktische Erfahrung ist da, und die Grünen brauchen das nur aufzugreifen, indem sie selber ähnliche Strukturen entwickeln, oder die vorhandenen unterstützen. Falls die Grünen dagegen trotz dieser Erfahrungen anfangen sollten, von einer „Mietobergrenze“ und ähnlichem bloß Ausgedachtem zu reden, weil sich eine solche „Mietobergrenze“ für denjenigen, der sich mit dem Thema nicht beschäftigt hat, irgendwie nach Gerechtigkeit anhört, wenn also die Grünen den Sachverstand gegen Populismus tauschen, dann können sie nicht zur Stadtentwicklung beitragen. Fazit Sinn oder Unsinn jeder Maßnahme hängt letztendlich davon ab, ob man den Unterschied zwischen Wirtschaftsfrage und Rechtsfrage erkennen und berücksichtigen kann. Die Wirtschaft beruht auf Leistung und Gegenleistung. Die Tatsache, dass ich an einer bestimmten Stelle stehen darf und nicht ein anderer, beruht dagegen nicht auf einer Leistung, sondern auf dem Schutz der demokratischen Mehrheit. Wenn ich dieses Recht verkaufe, dann tausche ich Leistung gegen Recht. Die Möglichkeit, durch Kapitalisierung des Rechts ein leistungsloses Einkommen zu beziehen, ist aber der Ursprung der Mietsteigerung. Dieser Text kann unter den von Creative Commons als ByNcNd definierten Bedingungen kostenlos verbreitet werden, d.h., Autor und Quelle müssen genannt, der Text darf nicht verändert, und nur für nichtkommerzielle Zwecke verwendet werden. 7