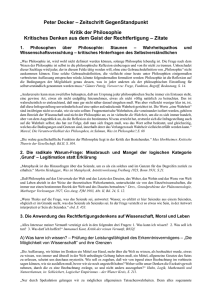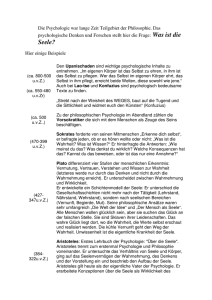Zu Max Horkheimers Satz: »Einen unbedingten Sinn zu retten ohne
Werbung
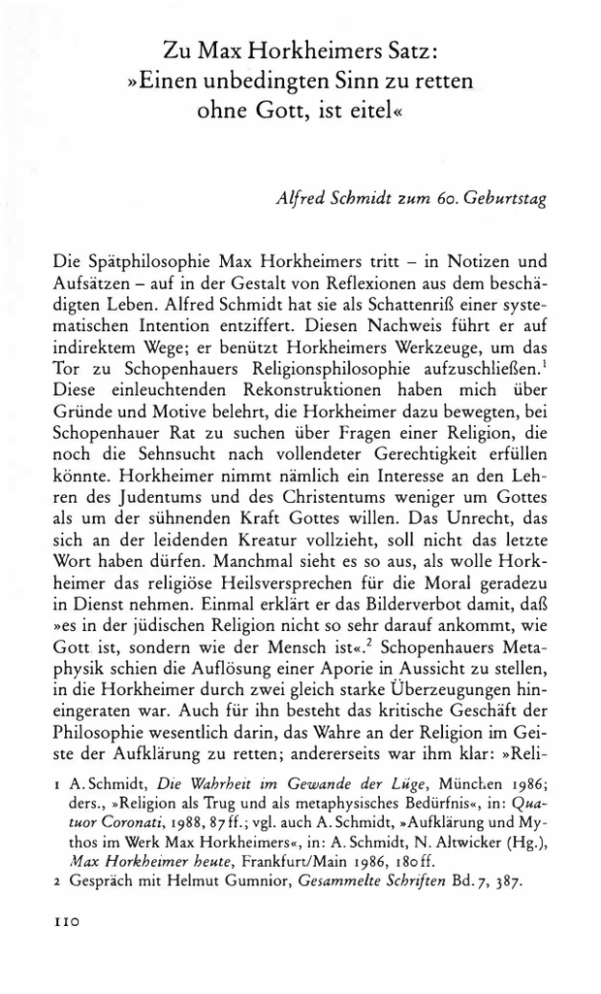
Zu Max Horkheimers Satz: »Einen unbedingten Sinn zu retten ohne Gott, ist eitel« Alfred Schmidt zum 60. Geburtstag Die Spätphilosophie Max Horkheimers tritt - in Notizen und Aufsätzen - auf in der Gestalt von Reflexionen aus dem beschä­ digten Leben. Alfred Schmidt hat sie als Schattenriß einer syste­ matischen Intention entziffert. Diesen Nachweis führt er auf indirektem Wege; er benützt Horkheimers Werkzeuge, um das Tor zu Schopenhauers Religionsphilosophie aufzuschließen.1 Diese einleuchtenden Rekonstruktionen haben mich über Gründe und Motive belehrt, die Horkheimer dazu bewegten, bei Schopenhauer Rat zu suchen über Fragen einer Religion, die noch die Sehnsucht nach vollendeter Gerechtigkeit erfüllen könnte. Horkheimer nimmt nämlich ein Interesse an den Leh­ ren des Judentums und des Christentums weniger um Gottes als um der sühnenden Kraft Gottes willen. Das Unrecht, das sich an der leidenden Kreatur vollzieht, soll nicht das letzte Wort haben dürfen. Manchmal sieht es so aus, als wolle Hork­ heimer das religiöse Heilsversprechen für die Moral geradezu in Dienst nehmen. Einmal erklärt er das Bilderverbot damit, daß »es in der jüdischen Religion nicht so sehr darauf ankommt, wie Gott ist, sondern wie der Mensch ist«.2 Schopenhauers Meta­ physik schien die Auflösung einer Aporie in Aussicht zu stellen, in die Horkheimer durch zwei gleich starke Überzeugungen hin­ eingeraten war. Auch für ihn besteht das kritische Geschäft der Philosophie wesentlich darin, das Wahre an der Religion im Gei­ ste der Aufklärung zu retten; andererseits war ihm klar: »Reli1 A. Schmidt, Die Wahrheit im Gewande der Lüge, München 1986; ders., »Religion als Trug und als metaphysisches Bedürfnis«, in: Qua­ tuor Coronati, 1988, 87 ff.; vgl. auch A. Schmidt, »Aufklärung und My­ thos im Werk Max Horkheimers«, in: A. Schmidt, N. Altwicker (Hg.), Max Horkheimer heute, Frankfurt/Main 1986, 18off. 2 Gespräch mit Helmut Gumnior, Gesammelte Schriften Bd. 7, 387. I IO gion kann man nicht säkularisieren, wenn man sie nicht aufgeben will.«3 Diese Aporie hat die griechische Philosophie seit den Tagen ihrer ersten Begegnung mit der jüdischen und der christlichen Überlie­ ferung wie ein Schatten begleitet. Bei Horkheimer verschärft sie sich noch durch eine tiefe Vernunftskepsis. Was für ihn den we­ sentlichen Gehalt der Religion ausmacht, eben Moral, ist nicht länger mit Vernunft verschwistert. Horkheimer rühmt die dunk­ len Schriftsteller des Bürgertums dafür, daß sie »die Unmöglich­ keit, aus der Vernunft ein grundsätzliches Argument gegen den Mord vozubringen, nicht vertuscht, sondern in alle Welt ge­ schrieen ... haben.«4 Ich gestehe, daß mich dieser Satz heute nicht weniger irritiert als vor fast vier Jahrzehnten, als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe. So habe ich mich auch von der Konse­ quenz dieser Vernunftskepsis, die Horkheimers zwiespältiges Verhältnis zur Religion begründet, nie recht überzeugen können. Daß es eitel sei, einen unbedingten Sinn retten zu wollen ohne Gott, verrät nicht nur ein metaphysisches Bedürfnis. Der Satz selbst ist ein Stück jener Metaphysik, ohne die heute nicht nur die Philosophen, sondern selbst die T heologen auskommen müs­ sen. Bevor ich versuche, diesen Einspruch zu begründen, will ich mich der moralischen Grundintuition vergewissern, die Horkheimer zeit seines Lebens geleitet hat; sodann möchte ich die Verwandt­ schaft von Religion und Philosophie, die Horkheimer nie aus den Augen verloren hat, erörtern und schließlich die Prämissen kenntlich machen, unter denen er Schopenhauers negative Meta­ physik aufnimmt. Dabei stütze ich mich auf die Notizen und Aufsätze, die Alfred Schmidt der Öffentlichkeit zugänglich ge­ macht5 und auf deren systematische Bedeutung er als erster hin­ gewiesen hat.6 3 Gesammelte Schriften Bd. 7, 393. 4 M. Horkheimer, Th. W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Amster­ dam 1947, 142. 5 M. Horkheimer, Notizen 1950 bis 1969, Frankfurt/Main 1974. 6 Das gilt vor allem für jene philosophischen Abhandlungen, die Schmidt bereits in den Anhang zur deutschen Ausgabe von Zur Kritik der in­ strumentellen Vernunft (Frankfurt/Main 1967, 177ff.) aufgenommen hatte. III I. Nachdem in der säkularisierten Welt die religiös instruierte Ge­ wissensregung der Reue nicht mehr als vernünftig gilt, nimmt das moralische Gefühl des Mitleids deren Platz ein. Wenn Horkhei­ mer das Gute absichtsvoll tautologisch als den Versuch definiert, das Schlechte abzuschaffen, dann hat er eine Solidarität mit dem Leiden verletzbarer und verlassener Kreaturen im Sinn, die durch Empörung gegen konkretes Unrecht angestachelt wird. Die ver­ söhnende Kraft des Mitleids steht nicht im Gegensatz zur antrei­ benden Kraft der Auflehnung gegen eine Welt ohne Sühne und Wiedergutmachung für erlittenes Unrecht. Solidarität und Ge­ rechtigkeit sind zwei Seiten derselben Medaille; deshalb streitet die Ethik des Mitleids der Gerechtigkeitsmoral nicht den Rang ab, sie nimmt dieser nur die gesinnungsethische Starrheit. Anders wäre das Kantische Pathos nicht zu verstehen, das sich in Hork­ heimers Forderung ausspricht, »trotz allem in der Wüste fortzu­ ziehen, selbst wenn die Hoffnung verloren wäre.«7 Und unter dem Stichwort »Notwendige Eitelkeit« scheut sich Horkheimer nicht vor der beinahe protestantischen Konsequenz: »Es ist wahr, ein Einzelner kann den Weltlauf nicht ändern. Aber wenn sein ganzes Leben nicht die wilde Verzweifelung ist, die dagegen sich aufbäumt, wird er auch nicht das unendlich kleine, bedeutungs­ lose, eitle, nichtige bißchen Gute zustande bringen, zu dem er als Einzelner fähig ist.«8 Das gemeinsame Schicksal, der Unendlich­ keit eines fühllosen Universums ausgesetzt zu sein, mag in den Menschen ein Gefühl der Solidarität wecken; aber in der Gemein­ schaft der Verlassenen darf Hoffnung auf Solidarität, darf das Mitleid mit dem Nächsten die gleiche Achtung für jedermann nicht beeinträchtigen. Moralische Gefühle, denen der Sinn für Gerechtigkeit innewohnt, sind nicht bloß spontane Regungen; sie sind Intuitionen mehr als Impulse; in ihnen äußert sich eine im emphatischen Sinne richtige Einsicht. Die Positivisten »wissen nichts davon, daß der Haß gegen einen anständigen und die Ehr­ furcht vor einem niederträchtigen Menschen nicht bloß vor der Sitte, sondern vor der Wahrheit verkehrte Regungen, nicht bloß 7 Notizen (1974), 93· 8 Notizen (1974), 184. II2 ideologisch tadelnswerte, sondern sachlich verkehrte Erfahrun­ gen und Reaktionen sind.«9 Horkheimer ist sich seiner moralischen Grundintuition so gewiß, daß er sie nicht anders denn als »richtige Einsicht« qualifizieren kann. Dieser moralische Kognitivismus scheint ihn vollends an die Seite Kants zu rücken. Dennoch läßt er sich von der Dialektik der Aufklärung so weit beeindrucken, daß er immer wieder de­ mentiert, was Kant der praktischen Vernunft noch zutraute. Zu­ rückgeblieben sei nur noch eine »formalistische Vernunft«, die keineswegs »in einem engeren Zusammenhang mit der Moral als mit der Unmoral« stehe.10 Nur materiale Untersuchungen kön­ nen den kraftlosen Formalismus überwinden, freilich auf para­ doxe Weise. Ohne das Gute benennen zu können, soll eine kriti­ sche Gesellschaftstheorie das jeweils bestimmte Unrecht bezeich­ nen. Weil diese Theorie, vernunftskeptisch wie sie ist, kein affir­ matives Verhältnis mehr unterhält zu den normativen Gehalten, die sie in der Kritik ungerechter Verhältnisse gleichwohl Schritt für Schritt entfaltet, muß sie alles Normative einer inzwischen überholten Gestalt des Geistes entlehnen: - der mit Metaphysik verschmolzenen Theologie. Diese hütet das Erbe einer inzwi­ schen entmachteten substantiellen Vernunft. Über den Charakter dieser schwindelerregenden Aufgabe macht sich Horkheimer keine Illusionen. Die Gesellschaftstheorie »hat die Theologie abgelöst, aber keinen neuen Himmel gefunden, auf den sie weisen kann, nicht einmal einen irdischen Himmel. Aus dem Sinn schlagen kann sie ihn freilich nicht, und darum wird sie immer nach dem Weg gefragt, der hinführt. Als ob es nicht gerade ihre Entdeckung wäre, daß der Himmel, zu dem man den Weg weisen kann, keiner ist.«11 Keine Theorie könnte, bevor sie sich zum Ästhetischwerden entschließt und in Literatur übergeht, mit dieser kafkaesken Denkfigur gut leben. Die Gedanken des alten Horkheimer kreisen deshalb um jene Theologie, die durch das kritische und selbstkritische Geschäft der Vernunft »abgelöst« werden muß, ohne doch in ihren Begründungsleistungen für den Unbedingtheitsanspruch der Moral durch Vernunft ersetzt wer­ den zu können. Horkheimers Spätphilosophie läßt sich verstehen 9 Notizen (1974), 102. 10 Horkheimer, Adorno (1947), 141. 11 Notizen (1974), 61. ll3 als die Bearbeitung dieses Problems, die Deutung der Schopen­ hauerschen Metaphysik als ein Vorschlag zu seiner Lösung. In seinem Aufsatz über »Theismus-Atheismus« verfolgt Hork­ heimer die hellenistische Verschwisterung von Theologie und Metaphysik bis zu den großen Systemen, in denen göttliche und irdische W issenschaft konvergieren. Vor allem interessiert ihn der kämpferische Atheismus des 18.Jahrhunderts, der »das Interesse an Religion eher zu vertiefen als auszulöschen imstande war.«12 Auch die materialistische Antithese zum Christentum, die »Gott« durch »Natur« substituiert und nur eine Umbesetzung in den Grundbegriffen vornimmt, bleibt der metaphysischen Architek­ tonik der Weltbilder noch verhaftet. Kants Metaphysikkritik öff­ net dann das Tor für mystische und messianische Gehalte, die von Baader und Schelling bis zu Hegel und Marx in die Philosophie eindringen. Über den theologischen Gehalt der Marxschen Theo­ rie war sich Horkheimer immer im klaren: die Aufklärung hatte mit der Idee einer gerechten Gesellschaft die Perspektive auf ein neues Jenseits im Diesseits eröffnet; nun sollte der Geist des Evangeliums im Geschichtsprozeß einen Weg der irdischen Er­ füllung finden. Die säkularisierende Aufhebung der Ontotheologie in Ge­ schichtsphilosophie hat ein zutiefst zweideutiges Ergebnis. Auf der einen Seite wird die Philosophie zur verkappten Theologie und rettet deren wesentliche Gehalte. Es ist der Sinn des Atheis­ mus selber, der die Aktualität des Theismus bewahrt: »Nur die ihn damals als Schmähwort gebrauchten, verstanden darunter das bloße Gegenteil der Religion. Die Betroffenen, die zu ihm (dem Atheismus) sich bekannten, als die Religion noch Macht besaß, pflegten mit dem theistischen Gebot der Hingabe an den Näch­ sten und die Kreatur schlechthin inniger sich zu identifizieren als die meisten Anhänger und Mitläufer der Konfessionen.«13 Auf der anderen Seite kann die Philosophie den Gedanken an das Unbedingte nur im Medium einer Vernunft retten, die inzwi­ schen das Ewige an die geschichtlichen Kontingenzen ausgeliefert und das Unbedingte verraten hatte. Denn die Vernunft, die keine andere Autorität als die der Wissenschaft mehr beanspruchen kann, ist ein naturalistisches Vermögen, ist zu Intelligenz im 12 Gesammelte Schriften Bd. 7, 178. l3 l »Theismus-Atheismus«, Gesammelte Schriften Bd. 7, 14 l 85 f. Dienste schierer Selbstbehauptung regrediert; sie bemißt sich an funktionalen Beiträgen, an technischen Erfolgen, aber nicht an einer Räume und Zeiten transzendierenden Geltung: »Zugleich mit Gott stirbt auch die ewige Wahrheit.«14 Nach der Aufklärung kann das Wahre an der Religion nur mit Mitteln gerettet werden, die die Wahrheit liquidieren. In dieser unbequemen Lage befindet sich eine Kritische Theorie, die die Theologie »ablösen« soll, weil nach Horkheimers Auffassung letztlich alles, was mit Moral zu­ sammenhängt, auf Theologie zurückgeht. II. Die vernünftige Aufhebung der Theologie und ihrer wesentlichen Gehalte - wie soll das heute, unter Bedingungen einer nicht mehr rückgängig zu machenden Metaphysikkritik, noch zu leisten sein, ohne entweder den Sinn der religiösen Gehalte oder die Vernunft selbst zu zerstören? Mit dieser Frage wendet sich der pessimisti­ sche Materialist Horkheimer an den pessimistischen Idealisten Schopenhauer. Nach Horkheimers überraschender Interpretation besteht die Aktualität Schopenhauers darin, daß dessen konse­ quenter Negativismus »den Geist des Evangeliums« rette. Scho­ penhauer soll das Kunststück gelungen sein, die in der Theologie gründende Moral atheistisch zu begründen - also unter Abzug Gottes die Religion zurückzubehalten. In der Welt als »Wille und Vorstellung« erkennt Horkheimer einerseits das wüste darwinistische Werk einer zum Organ der Selbsterhaltung herabgesetzten instrumentellen Vernunft, die bis in den ringsum alles objektivierenden wissenschaftlichen Intellekt hinein von einem blinden, unstillbaren, die eine Subjektivität ge­ gen die andere aufstachelnden Lebensdrang beherrscht ist. Auf der anderen Seite soll genau diese Reflexion auf den abgründig negativen Wesensgrund in den einander erbarmungslos überwäl­ tigenden Subjekten eine Ahnung von ihrem gemeinsamen Schick­ sal und das innehaltende Bewußtsein wecken, daß alle Lebensäu­ ßerungen von einem identischen W illen durchherrscht sind: »Ist das Reich der Erscheinung, die erfahrbare W irklichkeit, nicht das Werk positiver göttlicher Macht, Ausdruck des an sich selber 14 Ebd., 184. guten, ewigen Seins, sondern des in jedem Endlichen sich beja­ henden, in der Vielheit verzerrt sich spiegelnden, jedoch zutiefst identischen Willens, dann hat ein jeder Grund, mit jedem anderen sich eins zu wissen, nicht mit seinen spezifischen Motiven, son­ dern mit seiner Verstrickung in Wahn und Schuld, dem Getrie­ bensein, der Freude und dem Untergang. Leben und Schicksal des Stifters des Christentums werden zum Vorbild, nicht mehr aufgrund von Geboten, sondern von Einsicht in das Innerste der Welt.«15 Was Horkheimer an Schopenhauer fasziniert, ist die Aussicht auf eine metaphysische Begründung der Moral aus Einsicht in die Verfassung der Welt im ganzen - jedoch so, daß sich diese Ein­ sicht zugleich gegen zentrale Annahmen der Metaphysik richtet und der nachmetaphysischen Vernunftskepsis genügt. Die nega­ tive Metaphysik hält nur unter Verkehrung der Vorzeichen an der Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung fest - umge­ kehrter Platonismus. Darauf gründet sich dann die Erwartung, daß die Einsicht in die »unbarmherzige Struktur der Ewigkeit die Gemeinschaft der Verlassenen« erzeugen könne. Horkheimer be­ merkt allerdings den Schatten jenes performativen Selbstwider­ spruchs, der alle negative Metaphysik seit Schopenhauer und Nietzsche begleitet. Selbst wenn man erkenntniskritische Beden­ ken gegen den intuitiven, leibvermittelten Zugang zum Ding an sich zurückstellt, bleibt ja unerfindlich, wie es zu jener Umkehr der Antriebsrichtung kommt, die den irrationalen Weltwillen ge­ gen sich selber kehrt und die instrumentelle Vernunft zur inne­ haltenden Reflexion verhält: »Die Metaphysik des unvernünfti­ gen Willens als des Wesens der Welt muß zum Gedanken der Problematik der Wahrheit führen.«16 Alfred Schmidt hat die Aporie herausgearbeitet: »Ist das Wesen der Welt irrational, so bleibt das dem Wahrheitsanspruch eben dieser These nicht äußer­ lich.«17 Im Lichte dieser Konsequenz kann man den Satz, daß es eitel sei, einen unbedingten Sinn zu retten ohne Gott, auch als Kritik an Schopenhauer verstehen, als Kritik an dem »letzten · großen philosophischen Versuch, den Kern des Christentums zu retten.«18 15 »Religion und Philosophie«, in: Gesammelte Schriften Bd. 7, 193. Gesammelte Schriften Bd. 7, 136. 16 »Die Aktualität Schopenhauers«, in: 17 Schmidt (1986), 121. 18 ·Religion und Philosophie«, II6 Gesammelte Schriften Bd. 7, 191. Am Ende pendeln Horkheimers zweideutige Formulierungen unschlüssig zwischen Schopenhauers negativ-metaphysischer Be­ gründung der Moral und einer Rückkehr zum Glauben der V äter. Diese ungeklärte Argumentationslage veranlaßt mich, zu jener Prämisse zurückzukehren, von der Horkheimers Spätphilosophie ausgeht: daß die »formalistische« Vernunft oder die unter Bedin­ gungen nachmetaphysischen Denkens gleichsam übriggebliebene prozedurale Vernunft gleich weit entfernt sei von der Moral wie von der Unmoral. Soweit ich sehe, stützt sich Horkheimers skep­ tische Behauptung vor allem auf die zeitgenössische Erfahrung des Stalinismus und auf ein konzeptuelles Argument, das den ontologischen Wahrheitsbegriff voraussetzt. III. Horkheimers Denken ist mehr noch als das Adornos bestimmt durch die erschütternde historische Erfahrung, daß jene aus prak­ tischer Vernunft hergeleiteten, die Französische Revolution be­ flügelnden, von Marx gesellschaftskritisch eingeholten Ideen von Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit nicht zum Sozialismus, sondern, im Namen des Sozialismus, zur Barbarei geführt haben: »Die Vision der Einrichtung der Erde in Gerechtigkeit und Frei­ heit, die dem Kantischen Denken zugrunde lag, hat sich in die Mobilisation der Nationen verwandelt. Mit jedem Aufstand, der der großen Revolution in Frankreich folgte, so will es scheinen, nahm die Substanz des humanistischen Inhalts ab und der Natio­ nalismus zu. Das größte Schauspiel der Perversion des Bekennt­ nisses zur Menschheit in einen intransigenten Staatskult bot in diesem Jahrhundert der Sozialismus selbst ... Was Lenin und die meisten seiner Genossen vor der Machtergreifung erstrebten, war eine freie und gerechte Gesellschaft. In der Realität bahnten sie den Weg für eine totalitäre Bürokratie, unter deren Herrschaft es nicht mehr Freiheit gab als einst im Reich der Zaren. Daß das neue China in eine Phase der Barbarei übergeht, ist offenkun­ dig.«19 Aus dieser Erfahrung hat Horkheimer Konsequenzen für einen Umbau in der Architektonik der Vernunft gezogen, der 19 »Die Aktualität Schopenhauers«, in: Gesammelte Schriften Bd. 7, 138 f. I 17 sich im Begriff der »instrumentellen Vernunft« anzeigt. Es gibt keine Differenz mehr zwischen einer im Dienst subjektiver Selbstbehauptung stehenden Verstandestätigkeit, die allem ihre Kategorien überstülpt und alles zum Objekt macht, einerseits und andererseits der Vernunft als dem Vermögen von Ideen, de­ ren Platz der Verstand usurpiert hat. Ja, die Ideen selbst geraten in den Sog der Verdinglichung; sie haben, zu absoluten Zwecken hypostasiert, nur noch eine funktionale Bedeutung für andere Zwecke. Indem aber der Vorrat an Ideen derart aufgebraucht wird, verliert jeder über Zweckrationalität hinausweisende An­ spruch seine transzendierende Kraft; Wahrheit und Moralität bü­ ßen ihren unbedingten Sinn ein. Ein Denken, das bis in seine Grundbegriffe hinein auf geschicht­ liche Veränderungen reagiert, unterwirft sich der Instanz neuer Erfahrungen. Es ist also nicht unbillig zu fragen, ob der inzwi­ schen manifest gewordene Bankrott des Staatssozialismus nicht andere Lehren bereithält. Denn dieser Bankrott geht auch auf das Konto von Ideen, die das Regime, während es sich immer weiter von ihnen entfernte, zur eigenen Legitimation mißbraucht hat, weil es sie, was wichtiger ist, in Anspruch nehmen mußte. Ein System, das trotz seines brutal-Orwellschen Unterdrückungs­ apparats einstürzt, weil der gesellschaftliche Zustand alles, was die legitimierenden Ideen vorspiegeln, lauthals dementiert, kann über den Eigensinn dieser Ideen offensichtlich doch nicht beliebig verfügen. In den wie immer auch geschundenen Ideen einer ver­ fassungsrechtlich verkörperten republikanischen Tradition ver­ rät sich jenes Stück existierender Vernunft, das die »Dialektik der Aufklärung« nicht zu Wort kommen ließ, weil es sich dem nivellierenden Blick der negativen Geschichtsphilosophie ent­ zog. Der Streit um diese T hese könnte nur auf dem Felde materialer Analysen ausgetragen werden. Ich beschränke mich deshalb auf das konzeptuelle Argument, das Horkheimer aus der Kritik der instrumentellen Vernunft entwickelt. Horkheimers Behauptung, daß die Differenz zwischen Vernunft und Verstand im Lauf des weltgeschichtlichen Prozesses eingezogen worden ist, setzte ja, anders als im Poststrukturalismus heute, noch voraus, daß wir uns an den emphatischen Begriff der Vernunft erinnern können. Der kritische Sinn von »instrumenteller Vernunft« hebt sich erst vor der Folie dieser Erinnerung ab. Und allein durch den anaII8 mnetischen Rückgriff auf die substantielle Vernunft religiöser und metaphysischer Weltbilder versichern wir uns des Sinnes von Unbedingtheit, den Begriffe wie Wahrheit und Moralität einst mit sich führten, solange sie noch nicht positivistisch oder funk­ tionalistisch zerfallen sind. Ein Absolutes oder Unbedingtes er­ schließt sich der Philosophie nur in eins mit der Rechtfertigung der Welt im ganzen, also durch Metaphysik. Ihren metaphysi­ schen Anfängen bleibt aber die Philosophie nur solange treu, wie sie versucht, »es der positiven Theologie nachzutun«, und davon ausgeht, daß sich die erkennende Vernunft in der vernünftig strukturierten Welt wiederfindet oder selber Natur und Ge­ schichte eine vernünftige Struktur verleiht. Sobald die Welt »ih­ rem Wesen nach mit dem Geist dagegen nicht notwendig zusam­ menhängt, schwindet das philosophische Vertrauen in das Sein von Wahrheit überhaupt. Wahrheit ist dann nirgends mehr aufge­ hoben als in den vergänglichen Menschen selbst und so vergäng­ lich wie sie.«20 Horkheimer hat nie in Erwägung gezogen, daß es zwischen der »instrumentellen« Vernunft und der „formalen« einen Unter­ schied geben könnte. Er hat auch eine prozedurale Vernunft, die die Gültigkeit ihrer Resualtate nicht mehr von den vernünftig organisierten Weltinhalten abhängig macht, sondern von der Ra­ tionalität der Verfahren, nach denen sie ihre Probleme löst, ohne Zögern der instrumentellen zugeschlagen. Horkheimer geht da­ von aus, daß es Wahrheit ohne Absolutes nicht geben kann nicht ohne eine die Welt im ganzen transzendierende Macht, »bei der die Wahrheit aufgehoben ist«. Ohne ontologische Veranke­ rung, so meint er, müsse der Wahrheitsbegriff den innerwelt!i­ chen Kontingenzen der sterblichen Menschen und ihren wech­ selnden Kontexten anheim fallen; ohne sie ist Wahrheit keine Idee mehr, sondern Waffe im Lebenskampf. Die menschliche Erkenntnis, die moralische Einsicht einschließt, könne mit dem Anspruch auf Wahrheit nur auftreten, wenn sie sich an Relatio-­ nen zwischen ihr und dem Seienden orientiert, wie sie sich allein dem göttlichen Auge darbieten. Gegenüber dieser eigenartig tra­ ditionellen Auffassung werde ich (im letzten Abschnitt) eine mo­ derne Alternative zur Geltung bringen - einen Begriff kommuni­ kativer Vernunft, der es gestattet, den Sinn des Unbedingten ohne 20 Ebd., 135f. I 19 Metaphysik zu retten. Zuvor müssen wir uns aber des eigentli­ chen Motivs vergewissern, das Horkheimer am klassischen Be­ griff der Wahrheit als adaequatio intellectus ad rem festhalten läßt. Den Ausschlag für ein Festhalten an einer ontologischen Veran­ kerung der Wahrheit gibt nämlich jene ethische Überlegung, die Horkheimer Schopenhauer entlehnt. Allein die Einsicht in die Identität allen Lebens, in die Einheit eines sei's auch irrationalen Wesensgrundes, worin alle einzelnen Erscheinungen zusammen­ hängen, »vermag lang vor dem Sterben Solidarität mit aller Krea­ tur zu begründen.«21 Das metaphysische Einheitsdenken macht plausibel, warum die Überwindung des Egoismus in der Verfas­ sung der Welt ein Echo findet. Nur aus diesem Grunde hat für die Philosophen Einheit Vorrang vor V ielheit, tritt das Unbedingte im Singular auf, gilt für Juden und Christen der Eine Gott mehr als die vielen Gottheiten der Antike. Daß sich die Einzelnen in ihrer Besonderung verschanzen und dadurch den Individualis­ mus zur Lüge machen, ist insbesondere das Schicksal der bürger­ lichen Kultur. Diesen gesellschaftlichen Naturzustand der Kon­ kurrenzgesellschaft hält Horkheimer so sehr für das moralische Grundproblem, daß für ihn Gerechtigkeit und Solidarität gleich­ bedeutend werden mit »der Abkehr von der Bejahung des abge­ schlossenen eigenen Ichs«. Der Egoismus hat sich derart zu einem verkehrten Weltzustand verfestigt, daß ein Übergang von der Selbstliebe zur Hingabe an den Anderen gar nicht denkbar ist ohne die metaphysische Vorsorge für die vorgängige Einheit eines abgründigen Weltwillens, der uns zur Einsicht in die Solidarität der Verlassenen provoziert: »Schopenhauer zog die Konsequenz: richtig ist die Einsicht in die Schlechtigkeit des eigenen Lebens, das vom Leiden anderer Kreaturen sich nicht trennen läßt, richtig ist die Einheit mit den Leidenden, mit Mensch und T ier, die Abkehr von der Eigenliebe, vom Drang zum individuellen Wohl­ ergehen als letztem Ziel, wünschenswert das Eingehen nach dem Tod ins Allgemeine, nicht Persönliche, ins Nichts.«22 Schlecht ist nur der individuierte W ille, der sich gegen andere wendet, gut ist er, wenn er im Mitleiden seine wahre Identität mit allen anderen Wesen realisiert. 21 »Schopenhauers Denken«, in: Gesammelte Schriften Bd. 7, 252. 22 »Pessimismus heute«, Gesammelte Schriften Bd. 7, 227f. 120 IV. Schon in der »Dialektik der Aufklärung« schreibt Horkheimer de Sade und Nietzsche die Erkenntnis zu, »daß nach der Formalisie­ rung der Vernunft (nur) das Mitleid gleichsam als das sinnliche Bewußtsein der Identität von Allgemeinem und Besonderem, als die naturalisierte Vermittlung noch übrig war.«23 In der Schopen­ hauerschen Lesart kann freilich das Mitleid die Rolle einer dialek­ tischen Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft, zwi­ schen dem gleichen Respekt für jeden und der Solidarität eines jeden mit allen, nicht übernehmen. Hier geht es nur noch um die abstrakte Selbstaufhebung der Individualität, um das Aufgehen des Individuums im All-Einen. Damit wird genau die Idee aufge­ kündigt, die den moralischen Gehalt des Christentums ausmacht. Die, die am Jüngsten Tage, in Erwartung eines gerechten Urteils, einer nach dem anderen, einzeln, unvertretbar, ohne den Mantel weltlicher Güter und Würden, also als Gleiche, vor das Angesicht Gottes treten, erfahren sich als vollständig individuierte Wesen, die Rechenschaft geben über ihre verantwortlich übernommene Lebensgeschichte. Gleichzeitig mit dieser Idee müßte die tiefe Intuition verloren gehen, daß das Band zwischen Solidarität und Gerechtigkeit nicht reißen darf. Darin folgt Horkheimer Schopenhauer gewiß nicht ohne Zögern. Seine Interpretation des 9 r. Psalms verrät die Anstrengung, über eine Dissonanz hinwegzukommen. Die Lehre von der Einzel­ seele, heißt es, habe im Judentum noch eine andere, von Jenseits­ erwartungen unverfälschte Bedeutung gehabt: »Die Idee des Fortlebens meint zuvörderst nicht das Jenseits, sondern das vom neuzeitlichen Nationalismus kraß verzerrte Verbundensein mit der Nation, das in der Bibel seine Vorgeschichte hat. Indem der Einzelne gemäß der T hora sein Leben einrichtet, im Gehorsam gegen das Gesetz Tage, Monate und Jahre verbringt, wird er, trotz individueller Differenzen, mit dem Anderen so sehr eins, daß nach dem eigenen Tod er in den Seinen weiterexistiert, in ihrer Ausübung der Tradition, der Liebe zur Familie und zum Stamm, in der Erwartung, daß es einmal in der Welt noch gut wird ... Der Gestalt Jesu im Christentum nicht unähnlich, stand 23 Horkheimer, Adorno (1947), 123. I2I das Judentum als Ganzes für die Erlösung ein.«24 Horkheimer versucht, das Problem der Aufhebung des Individuums, der Leugnung der unveräußerlichen Individualität zu umgehen, in­ dem er das Thema verschiebt. Die Frage ist ja nicht, ob das Reich des Messias von dieser Welt ist, sondern ob jene moralische, aus Judentum und Christentum hervorgehende Grundintuition, der Horkheimer unbeirrt folgt, überhaupt angemessen expliziert werden kann ohne Bezugnahme auf die in universeller Bundesge­ nossenschaft mögliche, vorbehaltlose Individuierung. Der moralische Impuls, sich nicht abfinden zu wollen mit der Gewalt von Verhältnissen, die den Einzelnen vereinzeln und den einen Glück und Macht nur um den Preis des Unglücks und der Ohnmacht der anderen gewähren, dieser Impuls veranlaßt Hork­ heimer zu der Auffassung, daß die versöhnende Kraft der Solida­ rität mit dem Leiden nur eine Chance hat, wenn sich die Einzel­ nen als Individuen selber aufgeben. Er sieht nicht, daß die Gefahr der nationalistischen Verzerrung des Verbundenseins mit der Na­ tion gerade in dem Augenblick entsteht, wenn eine falsche Solida­ rität den Einzelnen im Kollektiv aufgehen läßt. Ein - wie immer auch negativ gewendetes - metaphysisches Einheitsdenken ver­ schiebt nämlich die Solidarität, die ihren genuinen Ort in der sprachlichen Intersubjektivität, in Verständigung und individu­ ierender Vergesellschaftung hat, in die Identität eines zugrunde­ liegenden Wesens, in die differenzlose Negativität des Weltwil­ lens. Eine ganz andere, eine dialektische Einheit stellt sich in der Kommunikation her, der die sprachliche Struktur den Abstand zwischen Ich und Du einschreibt. Mit der Struktur sprachlicher Intersubjektivität wird uns die Verschränkung von Autonomie und Hingabe zugemutet, eine Versöhnung, die die Differenzen nicht auslöscht. Gegenüber dem in der Sprache selbst angelegten Versprechen ist Horkheimer keineswegs taub. Einmal heißt es lapidar: »Sprache, ob sie will oder nicht, muß den Anspruch erheben, wahr zu sein.«25 Er erkennt auch, daß wir auf die pragmatische Dimension der Sprachverwendung rekurrieren müssen; denn aus der be­ schränkten Sicht der Semantik, die die Äußerungen auf Sätze reduziert, läßt sich der transzendierende Wahrheitsanspruch der 24 »Psalm 91«, in: Gesammelte Schriften Bd. 7, 25 Notizen (1974), 12J. 122 210. Rede nicht erklären: »Wahrheit in der Rede kommt ja nicht dem losgelösten nackten Urteil zu, gleichsam als wäre es auf einen Zettel gedruckt, sondern dem im Urteil sich ausdrückenden, an dieser Stelle sich konzentrierenden ... Verhalten des Redenden zur Welt.«26 Horkheimer steht offensichtlich die theologische Tradition vor Augen, die von Augustin über die Logosmystik bis zum radikalen Protestantismus anknüpft an die Anfänglichkeit des göttlichen Wortes und an die Sprache als Medium der göttli­ chen Botschaft: »Die theologische Metaphysik aber ist gegen den Positivismus im Recht, weil jeder Satz nicht anders kann, als den unmöglichen Anspruch nicht bloß auf eine erwartete W irkung, auf Erfolg zu erheben, wie der Positivismus meint, sondern auf Wahrheit im eigentlichen Sinne, gleichviel ob der Sprechende dar­ auf reflektiert.«27 Das Gebet, in dem der Gläubige Kontakt sucht mit Gott, würde sich von Beschwörung nicht kategorial unter­ scheiden, müßte auf die Stufe der Magie zurückfallen, wenn wir den illokutionären Sinn unserer Äußerungen mit deren perloku­ tionären Effekt so verwechselten, wie es das undurchführbare Programm des Sprachnominalismus tatsächlich tut. Aber diese Einsichten bleiben okkasionell. Horkheimer benutzt sie nicht als Spuren zu einer sprachpragmatischen Erklärung des mit unvermeidlichen Wahrheitsansprüchen verbundenen unbe­ dingten Sinns. Seine Vernunftskepsis reicht so tief, daß er im gegenwärtigen Weltzustand einen Platz für kommunikatives Handeln nicht mehr entdecken kann: »Heute ist die Rede schal, und die, welche nicht zuhören wollen, haben gar nicht so unrecht ... Das Sprechen ist überholt. Freilich auch das Tun, soweit es auf das Sprechen einmal bezogen war.«28 V. Die pessimistische Zeitdiagnose ist nicht der einzige Grund, der Horkheimer davon abhält, sich ernsthaft die Frage zu stellen, wie das, was wir täglich praktizieren, möglich ist: unser Handeln an transzendierenden Geltungsansprüchen zu orientieren. Eher ver26 Ebd., 172. 27 »Die Aktualität Schopenhauers«, in: Gesammelte Schriften Bd: 7, 138. 28 Notizen (1974), 26. 123 hält es sich so, daß eine profane Antwort auf diese Frage, wie sie beispielsweise Peirce vorgeschlagen hat, Horkheimers metaphysi­ sches Bedürfnis nach Religion nicht hinreichend hätte befriedigen können. Horkheimer hat die formalistische Vernunft Kants mit der instru­ mentellen gleichgesetzt. Ch. S. Peirce aber gibt dem Kantischen Formalismus eine sprachpragmatische Wendung und begreift die Vernunft prozeduralistisch. Der Prozeß der Zeicheninterpreta­ tion gelangt auf der Stufe der Argumentation zum Bewußtsein seiner selbst. Peirce zeigt nun, wie diese gleichsam außeralltägli­ che Kommunikationsform dem »unbedingten Sinn« von Wahr­ heit, von transzendierenden Geltungsansprüchen überhaupt, ge­ wachsen ist. Er begreift Wahrheit als die Einlösbarkeit eines Wahrheitsanspruchs unter den Kommunikationsbedingungen ei­ ner idealen, d. h. im sozialen Raum und in der historischen Zeit ideal erweiterten Gemeinschaft von Interpreten. Die kontrafakti­ sche Bezugnahme auf eine solche unbegrenzte Kommunikations­ gemeinschaft ersetzt das Ewigkeitsmoment oder den überzeitli­ chen Charakter von »Unbedingtheit« durch die Idee eines of­ fenen, aber zielgerichteten Interpretationsprozesses, der die Grenzen des sozialen Raums und der historischen Zeit von innen, aus der Perspektive einer in der Welt verorteten Existenz heraus transzendiert. In der Zeit sollen die Lernprozesse einen Bogen bilden, der alle zeitlichen Distanzen überbrückt; in der Welt sol­ len sich jene Bedingungen realisieren lassen, die wir in jeder Ar­ gumentation als hinreichend erfüllt wenigstens voraussetzen. In­ tuitiv wissen wir nämlich, daß wir niemanden, nicht einmal uns selbst von etwas überzeugen können, wenn wir nicht gemeinsam davon ausgehen, daß alle irgend relevanten Stimmen Gehör fin­ den, die besten beim gegenwärtigen W issensstand verfügbaren Argumente zur Sprache kommen und nur der zwanglose Zwang des besseren Arguments die Ja-/Nein-Stellungnahmen der Teil­ nehmer bestimmt. Damit verlagert sich die Spannung zwischen dem Intelligiblen und dem Reich der Phänomene in allgemeine Kommtlilikations­ voraussetzungen, die, obgleich sie einen idealen und nur annähe­ rungsweise erfüllbaren Gehalt haben, alle Beteiligten faktisch je­ desmal dann vornehmen müssen, wenn sie einen strittigen Wahr­ heitsanspruch zum Thema machen wollen. Die idealisierende Kraft dieser transzendierenden Vorgriffe dringt sogar ins Herz 124 der kommunikativen Alltagspraxis ein. Denn noch das flüchtigste Sprechaktangebot, das konventionellste >Ja< und >Nein< verweisen auf potentielle Gründe - und damit auf das ideal erweiterte Audi­ torium, dem sie einleuchten müssen, wenn sie gültig sein sollen. Das ideale Moment der Unbedingtheit ist tief in die faktischen Verständigungsprozesse eingelassen, weil Geltungsansprüche ein Janusgesicht zeigen: als universale schießen sie über jeden gegebe­ nen Kontext hinaus; zugleich müssen sie hier und jetzt erhoben und aktzeptiert werden, um ein handlungskoordinierendes Ein­ verständnis tragen zu können. Im kommunikativen Handeln ori­ entieren wir uns an Geltungsansprüchen, die wir nur im Kontext unserer Sprache, unserer Lebensform faktisch erheben können, während die implizit mitgesetzte Einlösbarkeit zugleich über die Provinzialität des jeweiligen historischen Kontextes hinausweist. Wer sich einer Sprache verständigungsorientiert bedient, ist einer Transzendenz von innen ausgesetzt. Darüber kann er sowenig verfügen, wie er sich durch die Intentionalität des gesprochenen Wortes zum Herrn der Struktur der Sprache macht. Die sprachli­ che Intersubjektivität überschreitet die Subjekte, aber ohne sie hörig zu machen. Nachmetaphysisches Denken unterscheidet sich von Religion da­ durch, daß es den Sinn des Unbedingten rettet ohne Rekurs auf Gott oder ein Absolutes. Horkheimer behielte mit seinem Dik­ tum nur dann recht, wenn er mit dem »unbedingten Sinn« etwas anderes gemeint hätte als jenen Sinn von Unbedingtheit, der als ein Moment auch in die Bedeutung von Wahrheit eingeht. Der Sinn von Unbedingtheit ist nicht dasselbe wie ein unbedingter Sinn, der Trost spendet. Unter Bedingungen nachmetaphysischen Denkens kann die Philosophie den Trost nicht ersetzen, mit dem die Religion das unvermeidliche Leid und das nicht-gesühnte Un­ recht, die Kontingenzen von Not, Einsamkeit, Krankheit und Tod in anderes Licht rückt und ertragen lehrt. Wohl kann die Philosophie auch heute noch den moralischen Gesichtspunkt er­ klären, unter dem wir etwas unparteilich als recht und unrecht beurteilen; insoweit ist die kommunikative Vernunft keineswegs gleich weit von der Moral wie von der Unmoral entfernt. Ein anderes ist es aber, eine motivierende Antwort auf die Frage zu geben, warum wir unseren moralischen Einsichten folgen, über­ haupt moralisch sein sollen. In dieser Hinsicht ließe sich vielleicht sagen: einen unbedingten Sinn zu retten ohne Gott, ist eitel. 125 Denn es gehört zur Würde der Philosophie, unnachgiebig darauf zu beharren, daß kein Geltungsanspruch kognitiv Bestand haben kann, der nicht vor dem Forum der begründenden Rede gerecht­ fertigt ist. 126