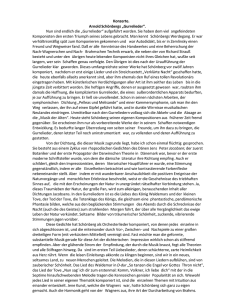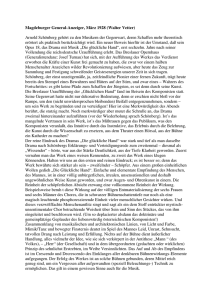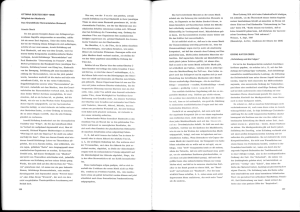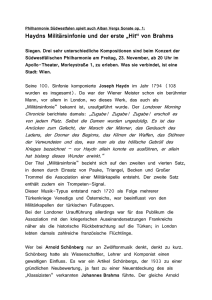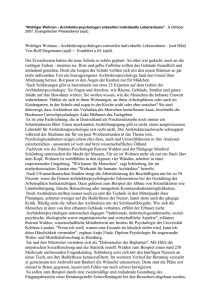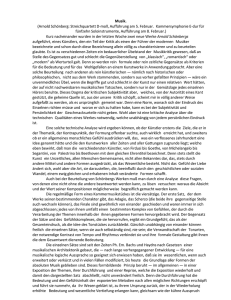SCHÖNBERGS MUSIKALISCHE POETIK Der Gegensatz zwischen
Werbung

• .# SCHÖNBERGS MUSIKALISCHE POETIK I Der Gegensatz zwischen Ästhetik und Handwerkslehre, den Schönberg nicht ohne Ironie - 1911 im ersten Kapitel der "Harmonielehre" pointierte, ist streng genommen von durchaus sekundärer Bedeutung. Denn die Ästhetik, deren Ansprüche Schönberg abzuwehren versuchte, war eine klassizistisch verengte; und die Harmonielehre wurde, um die Ästhetiker zu verdrießen, zwar gelobt, aber weniger, weil sie eine entscheidende Instanz wäre, als vielmehr wegen der Redlichkeit, mit der sie sich in ihren Grenzen hielt. (Eine Apologie des Handwerks, wie sie später von Strawinsky und Hindemith formuliert wurde, war Schönbergs Sache nicht. ) Wenn vom Komponieren im emphatischen Sinne die Rede ist, beruft sich Schönberg auf sein Formgefühl; und eine Begründung der Funde des. Formgefühls durch Theorie gilt zwar als prinzipiell möglich, aber emst,·· weilen nicht als dringlich. Schönberg begreift die Musikgeschichte als einen Prozeß, der das hervortreibt und manifest macht, was in der Na,~ tur der Musik als Möglichkeit, die zur Verwirklichung drängt, angelegt und vorgezeichnet ist - als Prozeß, dessen Träger das kompositorische Genie ist, das nicht irren kann. Theorie ist, da das Genie entscheidet, eine cura posterior. Andererseits ist jedoch - sofern es sich um die Entfaltung von Momenten handelt, die in der Natur besehlossen Li.egen, und ni.cht um Phänomene, die durch und durch gesehichtlich sind .. eine Theorie denkbar, die umfassende Prinzipien formuliert, statt sich auf die bloße Kodifizierung oder RatIonalisierung von Epochen." oder Pers nalstilen zu beschränken. Die Natur als Ursprung der Musik" die schichte als Entfaltu~lg, das Genie als Vollstrecker des von Natur gezeichneten und das Meisterwerk als Resultat bilden in Denken einen Komplex, dessen Teilmomente untrennbar miteinander verquickt erscheinen. Gibt man aber Schönbergs metaphysischen Naturbegriff .. und nichts anderes läßt sich in einer Darstellung, die sich als empirisch versteht, rechtfertigen -, so erscheint Theorie nicht mehr als Rekonstruktion musikalischer Naturgrundlagen, von denen das kompositori-, sehe Genie, eher ahnend als wissend, getragen wird, sondern als Inbe·~ griff geschichtlich geprägter Prinzipien und Kategorien, die das musi,,, kalis ehe Denken eines Komponisten fundieren. Und die Theorie eines individuellen oeuvres kann man, in Anlehnung an den Wortgebrauch der Literaturwissenschaft, Poetik nennen. Mit dem Begriff der musikalischen Poetik o. einem Begriff, der die Erinnerung an seinen griechischen Ursprung durchaus festhält - ist demnach eine von Reflexion durchdrungene Vorstellung vom Machen und Her,· stellen musikalischer Ge bilde gemeint. Die Denkstruktur , die aufgedeckt werden soll, ist ebenso in kompositorischen Verfahrensweisen enthalten, wie sie sich andererseits in begründenden oder rechtferti118 genden Theoremen ausdrücken kann. Das besagt jedoch nicht, daß theoretische .Äußerungen eines Komponisten umstandslos als letztes Wort über den Sinn der musikalischen Werke hingenommen werden dürfen. Sie sind vielmehr Gegenstand der Untersuchung, nicht deren Voraussetzung: Sie gehören zu dem Material, aus dem - in Wechselwirkung mit der Interpretation der Werke selbst - die musikalische Poetik rekonstruiert werden soll. Versuche, im Hinblick auf Werke des 19. und 20. Jahrhunderts musikalische Poetiken zu entwerfen, sind im Gegensatz zur älteren PoetikTradition zu der Selbstbeschränkung gezwungen, deskriptiv und individualisierend, nicht norxnativ und generalisierend zu verfahren. Von den Regelsystemen" die bis zum 18. Jahrhundert Poetik genannt wurden, unterscheiden sie sich dadurch, daß sie nicht Normen formulieren, die ein Werk erfüllen muß, wenn es dem Anspruch einer Gattungsüberlieferung und einer Stilhöhe genügen soll" sondern lediglich in einer Gruppe von Prinzipien und Kategorien, die einem individuellen oeuvre zugrundeliegen, Zusammenhänge oder Fundierungsverhältnisse sichtbar ma,. ehen. Eine musikalische Poetik zu skizzieren, in der die technischen Momente in ästhetische übergehen und umgekehrt, wäre unmöglich, wenn Schön~. bergs schroffe Unterscheidung zwischen dem, was ein Werk "ist 1t , und der Art, wie es "gemacht ist ft , beim Wort genommen werden müßte. Man darf jedoch ,- ähnlich wie bei. der umgekehrt akzentuierten Entge .. gensetzung von .Ästhetik und Handwerkslehre - die apologetischen Funktionen nicht außer acht lassen, die Schönbergs Theoreme erfüllen soll,. ten, Fühlte sich Schönberg 1911, nach dem Übergang zur AtonalItät, von Kritikern bedrängt, die ihm Verletzungen ästhetischer Normen zum Vorwurf machten, so geriet er später, in der Periode der Dode,~ kaphonie, als musikalischer :Mathematiker oder Ingenieur in Verruf. In der ersten Situation spielte er die Handwerkslehre gegen die Asthe~. tik aus, auf die sich seine Gegner beriefen, in der zweiten dafür den Sachverhalt, daß seine Werke im selben Sinne Musik sind wie die von Beethovön oder Brahms, gegen die Tendenz der Kritiker - der wohlge". sonnenen ebenso wie der feindseligen,", sich an die Machart zu klam .." mern, Da[J die Theoreme demnach von praktischen Zwecken abhängen oder mitbestimmt sind" besagt zwar nicht, daß sie haltlos seien, denn eine Wahrheit hört dadurch, daß sie einem Interesse dient" keineswegs eine Wahrheit zu sehL Doch läfJt die Tatsache, daß die Helation zwi,. , s chen den technischen und den ästhetischen Momenten der Musik von Schönberg extrem verschieden akzentuiert werden konnte, immerhin den Schluß zu, daf3 es sich bei den oft zitierten Aphorismen urn einsei,~ tige Pointierungen handelt, die Schönbergs eigentliche Überzeugung, daß Machart und Bedeutung zwei Seiten derselben Sache seien - eine Überzeugung, als deren theoretische Ausarbeitung eine musikalische Poetik zu verstehen ist.. zwar halb verdecken, aber nicht gänzlIch unkenntlich machen. II Die Kategorien, als deren Zusammenhang sich Schönbergs musikaJj,~ sche Poetik konstituierte: Kategorien wie Gedanke und Entwicklung, 119 Konsequenz und Logik, sind Ausdruck der Tendenz, ein musikalisches Werk in einem nahezu unmetaphorischen Sinne als Diskurs, als tönenden Denkvorgang aufzufassen. Nicht, daß der Begriff des musikalischen Denkens um 1910, als Schönbergs Poetik feste Gestalt annahm, neu gewesen wäre. Die Emphase aber, mit der Schönberg eine Terminologie, die von Forkel, Hansliek und Riemann eher analogisierend als mit theo~ retischem Anspruch gehandhabt worden war, beim Wort nahm, war durchaus ungewöhnlich. Andererseits hat Schönbergs Denkweise Epoche gemacht und in den Jahrzehnten, die seither vergangen sind, die Art des Verstehens von Musik und des Redens über sie - sogar bei Schönbergs Gegnern - tiefgreifend verändert. So deutlich sich aber die Tendenzen abzeichnen, die Schönbergs musikalischer Poetik zugrundeliegen, so schwierig ist es andererseits, unmißverständlich zu sagen, was Schönberg unter ein(lm musikalischen Gedanken überhaupt versteht. Am ehesten greifbar ist das ästhetische Moment: die Unterscheidung zwischen musikalischen Gedanken, die den Namen verdienen, und bloßen Topoi, Floskeln oder Formeln. Schönbergs Begriff des musikalischen Gedankens ist von einem Pathos erfüllt, das an den Affekt erinnert, mit dem Adolf Loos das Ornament bekämpfte und Karl Kraus die Phrase. Den Begriff des musikalischen Gedankens technisch-formal zu bestimmen, scheint kaum möglich zu sein. Eine Gleichsetzung mit den Kategorien Motiv oder Thema wäre eine Verengung, durch die man sich den Zugang zu Schönbergs Poetik verstellen würde. Auch Zusammenklänge sind von Schönberg, sofern sie Einfälle und nicht Topoi waren, als Gedanken aufgefaßt worden; und es ist zweifellos kein Verstoß gegen Schönbergs Denkweise, wenn man sogar abstrakte Intervallstrukturen wie die von Jan Maegaard entdeckten, die einen gemeinsamen Nenner ganzer pen von Motiven und Akkorden bilden, zu den musikalischen GBdanken zählt. Andererseits ist es in manchen Zusammenhängen gerade nicht eine be,~ stimmte Intervallstruktur , sondern ein expressiver Gestus, der die Sub,~ stanz eines musikalischen Gedankens ausmacht: ein Gestus, dessen stalt wechseln kann, wenn nur der Umriß kenntlich bleibt. Wenn sowohl ein Motiv oder ein Thema als auch ein GBStuS, dessen gestalt veränderlich ist, und sogar eine abstrakte Intervallstruktur , die in wechselnden Rhythmisierungen und entweder in melodischer oder in harmonischer Form erscheint, als musikalischer Gedanke gelten kann, so zerfließt offenbar die Kategorie ins UngreIfbare. l<:s gibt kein festes, immer wiederkehrendes Merkmal, das sämtlichen Erscheinungsformen dessen, was bei Schönberg musikalischer Gedanke heißen kann, gemein" sam wäre. Dennoch ist der Terminus kein leeres Wort. Schönbergs musikalische Poetik kann als Versuch aufgefaf3t werden, zwischen Postulaten zu vermitteln, die der unglückliche musikästhetische Parteienstreit zwischen Formalismus und Affektenlehre als Gegensätze erscheinen läßt: zwischen der Forderung nach zwingender Expressivität in jedem Augenblick einerseits und nach lückenlosem Zusammenhang der musikalischen Ereignisse andererseits Es macht in Schönbergs Vorste1lung das Wesen eines musikalischen Gedankens aus, daß er sowohl aus einem Ausdrucksbedürfnis hervorgeht, das geradezu den Charakter eines Diktats annehmen kann, als auch formale Konsequenzen hat und weitreichende Zusammenhänge begründet, statt sich in einem Momen0 taneffekt zu erschöpfen. Mit anderen Worten: Ein musikalischer Gedanke konstituiert sich als das, was er ist, durch die Relationen, in denen er steht; auch Expressivität ist, entgegen einem populären Vorurteil, zu einem nicht geringen Teil eine Funktion des Kontextes. Die Einheit des Expressiven und des Strukturellen, wie sie in der traditionellen Musik durch Themen und Motive verbürgt wurde, die sowohl den "Ton" und Charakter eines Satzes bestimmten als auch den Ausgangspunkt und die Substanz entwickelnder Variation bildeten, war jedoch gerade bei Schönberg gefährdet, und zwar durch die Trennbarkeit des gestischen Moments vom intervallischen: Daß ein Gestus sich in wechselnden Intervallgestalten ausprägt und entfaltet, ist ein anderer musikalischer Prozeß als die Deduktion verschiedener Melodiephrasen und Akkorde aus einer Intervallstruktur ; und die Vorgänge lassen sich nicht nur im analytischen Denken voneinander unterscheiden, sondern auch in der kompositorischen Praxis trennen, während sie in der tra,ditionellen thematisch-motivischen Arbeit enger miteinander verquickt waren. Gestus und Intervallstruktur erscheinen gleichsam als entgegen,gesetzte Abstraktionen vom überlieferten Motivbegriff, und zwar als verselbständigte Abstraktionen. Andererseits trachtete Schönberg die ästhetische Funktion des klassi-, schen Motivs, die der Verklammerung des Expressiven und des StruktUr'ellen, auch dann noch zu bewahren, als er die kompositionstechnischen Voraussetzungen tiefgreifend verändert hatte. Man kann geradezu behaupten, daß der Begriff des musikalischen Gedankens die Idee bezeichne, daß es möglich sein müsse, unter problematischen Bedingungen eine Einheit der Momente zu restituieren, wie sie im traditionellen Motiv und in dessen Entwicklung unproblematisch gegeben war. Paradox ausgedrückt: Schönberg d ach te IImotivisch" , auch wenn er nicht "motivisch lf kom p 0 nIe I' t e . Erst durch detaillierte Analysen könnte gezeigt werden, wie sich im einzeJnen Werk oder Satz das Herausspinnen formaler Zusammenhän,~ ge aus Intervallstrukturen zu dem Ablauf verhält, den die gestischen Charaktere beschreiben. Ob aber die Vermittlung durchschaubar gera, ten mag oder nicht: Immer ist es Schönbergs tragende Absicht, strul\>, turelle Momente zugleich als expressive fühlbar zu machen und ulYl.ge,·· kehrt. III Die Überzeugung, daß ein musIkalischer Gedanke erst durch den Zusammenhang, in dem er steht, überhaupt zu einem Gedanken wird, bedeute,· te, daß Schönberg,kaum anders als Wagner, Isoliertes, in sich Ver,schlossenes als unverständlich ansah und nicht ertrug. :Die Faßlichkeit des Einzelnen hängt von der Logik des Ganzen ab. Die Vorstellung von der Unbegreiflichkeit des Isolierten brachte Schönberg allerdings in Schwierigkeiten, als er die Emanzipation der Disso-nanz zu rechtfertigen versuchte. Die kompositorische Entscheidung, daß eine 'Dissonanz, statt aufgelöst werden zu müssen, für sich stehen könne, stützte sich auf die theoretische Annahme, daß sie unabhängig von einer Konsonanz, an die sie sich anlehnt, musikalisch verständlIch sei, ohne daß jedoch eindeutig feststünde, was der Ausdruck Verständ,,, 121 120 lichkeit bei einer emanzipierten Dissonanz eigentlich besagt, denn die bloße Durchschaubarkeit der Intervallstruktur kann schwerlich gemeint sein. Zusammen mi~ dem Auflösungszwang wurde auch die Fortschreitungstendenz der Dissonanz, also ein zusammenhangbildendes Moment durch die Emanzipation aufgehoben. Statt musikalischen Fortgang hervo'rzutreiben, verharrt die Dissonanz als emanzipiertes Gebilde - so scheint es jedenfalls - konsequenzlos in sich selbst. Isolierung erweist sich als Kehrseite der Emanzipation. Ein erster Ausweg aus dem Dilemma war das - allerdings nur begrenzt praktizierbare - Prinzip der komplementären Harmonik, ein zweiter die Behandlung eines Akkords als Motiv. Die Ergänzung des Tonbestandes konnte ebenso wie die Transformation einer harmonischen 1ntervallstruktur in eine melodische als musikalische Konsequenz als Logik aufgefaßt werden. ' Die Lösungsversuche aber, zu denen sich Schönberg durch den Konflikt zwischen der Emanzipation der Dissonanz und der Überzeugung von der Unverständlichkeit isolierter musikalischer Ereignisse herausgefordert fühlte, hängen wiederum mit anderen Teilmomenten des Systems, als das sich Schönbergs musikalische Poetik dem Betrachter präsentiert, eng ,~usammen. Komplementäre Harmonik tendiert zur Zwölftönigkeit, zu luckenloser Chromatik. Und die Auffassung eines Akkords als Motiv ist Ausdruck eines "strukturellen" Denkens, aus dem schließlich das Reihenprinzip resultierte: eines Denkens, das Tonzusamrnenhänge als abst,rakte 1nterva,llstrukturen begreift, deren vertikale Darstellung eine VarIante der horIzontalen und nicht ein prinzipie~ll anderes Phänomen i~t.?ie Problen:e, die unter den Voraussetzungen von Schönbergs muslkahscher PoetIk - unter der Herrschaft der These von der Unfaßlichkeit des Isolierten - aus der Emanzipation der Dissonanz erwuchsen, gehören also als treibende Momente der Vorgeschichte der nie an. Und umgekehrt bleibt die Entstehung der Zwölftontechnik par,~ tiell unverständlich, wenn man nicht die kompositionstechnischen ~'Tat,~ sachen, wie sie sich bei einer Analyse der Notentexte zu der musikalischen Poetik in Beziehung setzt, in deren die ,einzelnen Phänomene und Verfahrensweisen überhaupt erst den Sinn erlnelten, von dem die Konsequenzen abhingen, die sie in Entwicklung hatten. IV Das Herausspinnen eines Netzes von Zusammenhängen aus einem musi,," kaUschen Gedanken ist von Schönberg entwickelnde Variation genannt worden. Von dem gewohnten Begriff der thematisch-motivischen Arbeit unterscheidet sich die Schönbergsehe Kategori.e dadurch, da[j die Ver"" quickung des diastematischen und des rhythmiHchen Moments wie sie für die traditionelle Vorstellung von einem Thema oder eine~ Motiv charakteristisch ist, aufgelöst werden kann: Schönberg subsumiert aueh diastematische Anknüpfungen unabhängig vom Rhythmus und rhythmisehe unabhängig vom Tonhöhenverlauf unter den Begriff der entwickelnden Variation. 122 Beschreibungen von Methoden der entwickelnden Variation oder der theArbeit kranken fast immer an einer Einseitigkeit, dle swh um so storender auswirkt, als man sich ihrer kaum bewußt zu sein scheint: Wer ein Stück Musik analysiert, betont unwillkürlich - um den inneren Zusammenhalt des Satzes kenntlich zu machen - die wiederkehrenden, verklammernden Momente und vernachlässigt die nicht geringere Aufgabe, die verschiedenen Arten der Abweichung vom Modell und der Begründung für sie zu untersuchen. Über den Sinn einer Variante entscheidet jedoch nicht nur die Abhängigkeit vom Modell, sondern auch die Ursache dafür, daß an einer bestimmten Stelle im Formverlauf gerade diese Variante und nicht eine andere erscheint. In der traditionellen Musik - von deren Substanz Schönberg nichts preisgeben mochte, deren Grundbestimmungen er vielmehr zu bewahren, unter veränderten Bedingungen zu restituieren oder durch Äquivalente zu ersetzen trachtete - beruhte der Eindruck von Konsequenz, der von einer Variantenreihe ausging, erstens auf der harmonischen Logik der Akkordprogressionen, von denen die Variantenbildung getragen wurde, zweitens auf einer gewissen Folgerichtigkeit der rhythmischen oder diastematischen Ausdehnungen oder Zusammenziehungen, denen das Mo,· deH,unterworfen wurde, und drittens auf dem Konnex zwischen den syntaktIsch-formalen Funktionen, die durch die verschiedenen Varianten erfüllt wurden. Von den Mitteln, um Konsequenz zu erzielen, wurde einzig die tonale Fundierung der Variantenreihung - die Konstituierung von musikalischer Logik in einer Variantenkette durch harmonische Funktionalität von Schönberg aufgehoben. Andererseits bildet gerade die Relation zwi,~ sehen Harmonik und Motivik in der thematisch-motivischen Arbeit ein Anschauungsmodell, an dem sich Schönberg orientierte, um zu Reflexio," nen zu gelangen, deren extreme Konsequenz die Atonalität war. Zu der gewohnten Vorstellung, daß die Harmonik "" die harmonische 1,0" gik eines Tonzusammenhangs - zur Substanz eines musikalischen Gedankens gehöre oder geradezu dessen zentrale Eigenschaft steht eine 'I'atsache quer, die zwar trivial aber offenbar niemals in ihre Kon·, sequenzen verfolgt wurde: die Tatsache, daß in thematisch-motivischen Durchführungen ein melodisches olme dadurch unkenntlich zu immer wieder anders harmonisiert wird. Die IdentItät eineH Motivs beruht in solchen Zusammenhängen eher auf dem me,~, lodischen Umriß und dessen Charakter als auf der genauen diastematischen Formulierung und deren harmonischem Süm Umgekehrt ausgedrückt: Der tonale Funktionszusan:lmenhang we,·~ niger den ll'msikalischen Gedanken selbst, als daß er eines der Mittel darstellt, um Varianten des Gedankens so zu verkn'Lipfen, daß der Eindruck von Konsequenz entsteht. Die thematisch-motivische Arbeit aber - und nicht der gewöhnliche lVIe,~ lodiebegriff, dessen Merkmal diastematisch-harmonischeEindeutigkeit ist. - bildete die Voraussetzung oder den Hü1tergrund für Schönbergs Vor,~ stellungen davon, was ein musikalischer Gedanke seL Denn zu den ImpHkationen der Schönbergschen Kategorie - Implikationen, die sie nlit dem melodischen Substrat rnotivisch,"themat:Lscher Durchführungen gemeinsam hat - gehört es, daß erstens der vage melodische Umr:lf3 als expressiver GeHtus ." das Wesen eines musikalischen GedankenH n:ati~ch-motivisc,~en o 123 ;p primär ausmacht, daß sich zweitens ein Gedanke überhaupt erst in einer Entwicklung, die von ihm ausgeht, als Gedanke bewährt und daß drittens die harmonische Tonali.tät nicht als Substanz eines musikalischen Gedankens, sondern als Mittel zu dessen faßlicher Darstellung unter Darstellung versteht Schönberg die Ausarbeitung zu einem in sich zusammenhängenden tönenden Diskurs - erscheint. Die Preisgabe der Tonalität bewirkte, wie erwähnt, den Verlust eines der Mittel, die einer Variantenreihe eine Richtungstendenz gaben. Nicht eine diastematische oder rhythmische Anknüpfung als solche, sondern erst eine funktional begründete Anknüpfung kann als musikalische Logik, als entwickelnde Variation im unverkürzten Sinne des Wortes gelten. Die Aufhebung der Tonalität war also eine Emanzipation, die zugleich eine Einbuße bedeutete. Und es scheint, als s,ei die Erfindung der Dodekaphonie - die ihm als Entdeckung erschien - von Schönberg als Ausweg aus Schwierigkeiten empfunden worden, die durch den ,Verzicht auf Rückhalt an der Tonalität entstanden waren. Nicht, daß die Dodekaphonie in einem handgreiflichen Sinne ein Äquivalent der Tonalität wäre. Die Vorstellung, daß eine Konfiguration von zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen als "pantonalität", also gleichsam als Erweiterung und Differenzierung der traditionellen Tonalität, in der sich die Töne um ein einziges Zentrum versammelten, zu erklären sei, ist im schlechten Sinne abstrakt. Die Dodekaphonie ist nicht substanziell, sondern - wenn überhaupt - funktional mit der Tonalität vergleichbar: Si.e knüpft nicht an das Prinzip der Tonalität an, sondern erfüllt partiell - bei der Durchführung oder entwickelnden Variation von Motiven - eine analoge Funktion. Bildete in tonalen Werken die harmonische Logik - neben den formalen Funktionen und den Richtungstendenzen des melodischen und rhythmischen Verlaufs ,- eines der Mittel, um zu begründen, warum an einem bestimmten Punkt einer Entwicklung ge rade diese Variante und keine andere am Platze ist, so dient unter den Bedingungen der Atonalität die Dodekaphonie einem ähnlichen Zweck. Denn von der Zwölftonstruktur ist es partien abhängig (nur dar·~ um, weil sie manipulierbar ist), in welchen diastematischen Formulie" rungen ein expressiver Gestus .~ der die Substanz eines musikalischen Gedankens darstellt - exponiert und entwickelt wird. Die ist, wie die Tonalität, die sie ablöst, ein Vehikel der Folgerichtigkeit in der Darstellung eines musikalischen Gedankens. Historiker, die der Vorgeschichte der Dodekaphonie nachgehen, sollten also nicht alleill nach substanziellen Voraussetzungen ,~ nach Zwölftonkom.plexen oder nach Perumtationen von Intervallstrukturen ,~ suchen, sondern auch die Probleme rekonstruieren, als deren :Lösung innerhalb des Bezugssystems von Schönbergs musikalischer Poetik die Dodekaphonie eine Bedeutung erhielt, die ihr als bloßer Technik - als einer Verfahrensweise, die in wenigen Sätzen beschreibbar ist ,. schwerlich zukam. w .!J\JU'C,,"O. • SCHÖNBERG UND DIE PROGRAMMUSIK tl Was Programmusik ist, steht nicht fest. Die Idee einer "reinen Instrumentalmusik, die sich im Funktionszusammenhang der Töne erschöpft, ist ebenso eine Abstraktion wie der Gedanke einer Programmusik, die als musikalischer Roman eine Geschichte detailliert erzählt und ausmalt. Die musikalische Wirklichkeit besteht aus Übergängen zwischen den Extremen, über die sich die Ästhetiker streiten. Außerdem verwirrt es die Diskussion, daß Meinungen darüber, was Programmusik überhaupt ist, fast immer mit Urteilen über den ästhetischen Nutzen oder Nachteil der Gattung verquickt sind: Wer sie verteidigt, neigt dazu, Schumanns Charakterstücke, an deren Rang niemand zweifelt, zur Programmusik zu zählen; wer sie dagegen ablehnt, zieht die Grenzen des Genres enger. Nur zwei frühe Werke von Schönberg, das Streichsextett tlVerklärte Nacht" opus 4 und die symphonische Dichtung "Pelleas und Melisande" opus 5, gehören unzweifelhaft zur Programmusik. Und daß außerdem noch von anderen Werken die Rede sein wird, besagt keineswegs, daß sie einem weit gefaßten - oder überdehnten ,- Begriff von Programmusik unterworfen werden sollen, sondern geschieht lediglich, weil die opera 16, 34 und 45 zur Erörterung von Problemen herausfordern, die mit Schönbergs Verhältnis zur Programmusik unmittelbar zusammenhängen. Schönbergs Ästhetik, deren Grundzüge man verstanden haben muß, um die programmusikalischen Werke nicht zu mif~deuten, beruht auf zwei Voraussetzungen, die sich bei flüchtiger Betrachtung zu widersprechen scheinen. Erstens bekannte sich Schönberg zu der bis ins 18. Jahrhun,· dert zurückreIchenden Maxime, daß in einem Stück Musik, sofern es "poetisch" und nicht Itmechanisch lt sei, der Komponist sich selbst aus··, drücke. Und zweitens machte er sich die These Schopenhauers und ners zu eigen, daß Musik unmittelbar das Wesen der Welt in Töne fasse, während die Wortsprache eine vermittelte, sekundäre Ausdrucksfonn sei. In der Verbindung von Musik mit einem Text .. sei es einer gesun,~ genen Dichtung oder einem Programm .. illustriert also nicht die Musik den Text,. sondern der Text erscheint, gerade umgekehrt, als Metapher :für das, was die Musik in "eigentlicher Sprache" sagt, Soll die erste Maxime mit der zweiten zusammenstimmen, so ist es un,~ umgänglich, unter der Person des Komponisten, der durch Musik sich selbst ausdrückt, nicht das "empirische", biographisch grei.fbare,. son,~ dern das "intelligible lch lt zu verstehen, das ein Sprachrohr jener ":ln,~ nersten Natur" der Dinge darstellt, unter deren Diktat Schönberg zu komponieren glaubte Schönbergs Ausdrucksästhetik darf nicht mit der ebenso populären wie fragwürdigen Vorstellung, daß ein musikalisches Werk ein Stück tönende Biographie des Komponisten sei .. gleichgesetzt werden, Manche Ästhetiker des 19. und noch des 20, Jahrhunderts - zuletzt Ar,~ nold Schering - waren von der Idee besessen, daß es möglich sein müs "" 0 Aus: Archiv für Musikwissenschaft XXXIII, 1976" Mit frdL Genehmigung des Verlags Franz Steiner GmbH, Wi.esbaden. 124 12 ~)