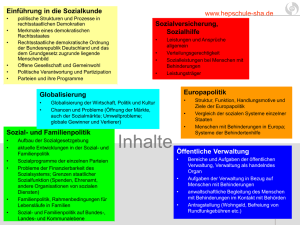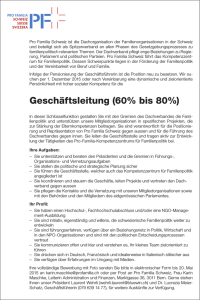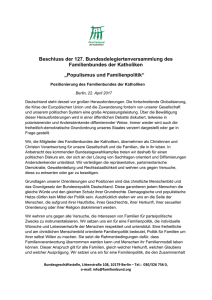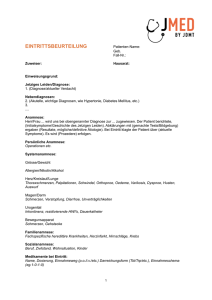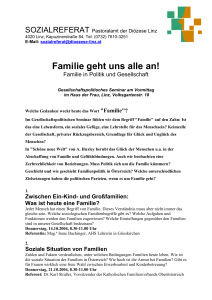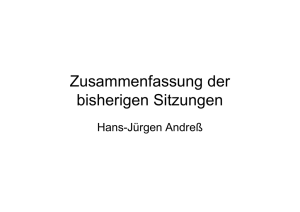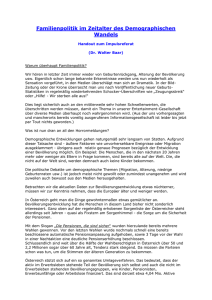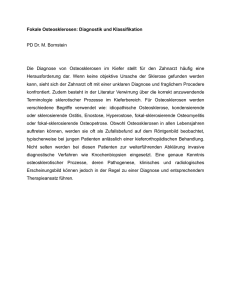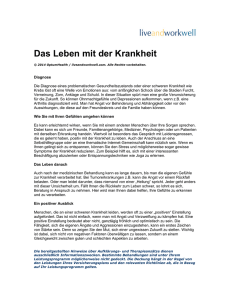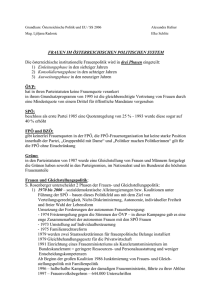"Policy Frames and Implementation Problems: The Case of Gender
Werbung
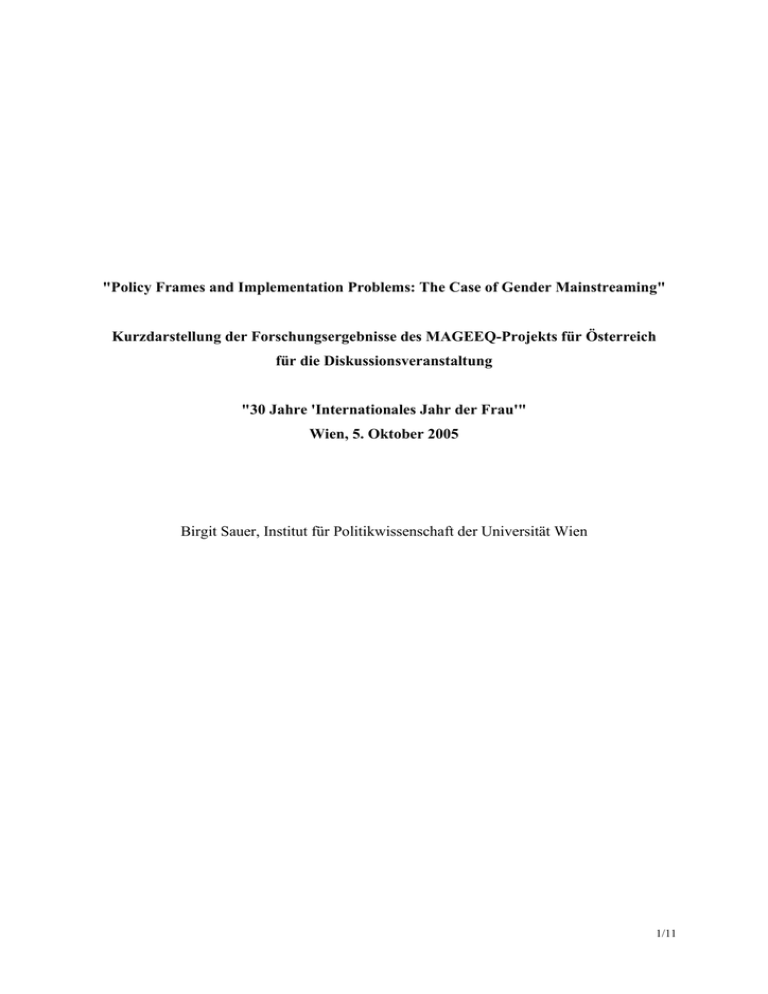
"Policy Frames and Implementation Problems: The Case of Gender Mainstreaming" Kurzdarstellung der Forschungsergebnisse des MAGEEQ-Projekts für Österreich für die Diskussionsveranstaltung "30 Jahre 'Internationales Jahr der Frau'" Wien, 5. Oktober 2005 Birgit Sauer, Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien 1/11 1. Forschungsgegenstand und Fragestellung MAGEEQ 1 untersucht Vorstellungen und Präsentationen von Geschlecht, von Männern und Frauen sowie von Geschlechtergerechtigkeit in österreichischen Politikdokumenten. Der theoretisch-methodische Hintergrund einer solchen "frame analysis" (Rahmenanalyse) geht davon aus, dass die Präsentation eines Politikproblems (seine Diagnose wie auch seine Lösungsvorschläge) die tatsächlichen politischen Lösungsvorschläge prägen bzw. konstitutieren. Das Ziel einer "frame analysis" ist es deshalb, die Vorstellungen – man könnte auch sagen: das implizite und explizite Wissen – von politischen AkteurInnen herauszuarbeiten, um deutlich zu machen, wie ein Problem durch politische AkteurInnen gesehen und präsentiert – sprich "geframt" wird und welche möglichen politischen Konzepte, Lösungsvorschläge und Strategien erwartbar sind. Die Strategie des Gender Mainstreaming basiert auf der Explizierung von implizitem, unbewusstem oder vorbewusstem Geschlechterwissen, von Vorstellungen über Geschlechter und Geschlechtergleichstellung in der Politik. Nur durch eine solche Bewusstmachung von "frames" kann es gelingen, eine Sensibilisierung politischer AkteurInnen in Bezug auf Geschlecht (wie im Gender Mainstreaming-Ansatz gefordert) in die Wege zu leiten. Im Projekt wurden die folgenden Politikdokumente analysiert: Familienpolitik: Für die Analyse dieses Feldes wurden 16 Dokumente aus dem Zeitraum 1995-2003 herangezogen. Die Dokumente setzen sich zusammen aus Ausschnitten aus dem Familienbericht 1999, dem Bericht Österreichs über den Stand der Umsetzung der CEDAWKonvention 1999, der Debatte im Bundesrat über das Kinderbetreuungsgeld 1999, den Debatten der Parteien SPÖ, ÖVP, FPÖ und Grüne im Nationalrat über das Kinderbetreuungsgeld 2001, Stellungnahmen des Instituts für Ehe und Familie sowie der Österreichischen Kinderfreunde zum Kinderbetreuungsgeldgesetz 2001, dem Regierungsprogramm 2003 sowie aus Zeitungsartikeln der Tageszeitungen Kurier, Die Presse und Der Standard. 1 Mageeq ist ein EU-finanziertes Projekt. Die Ergebnisse wurden von Birgit Sauer und Karin Tertinegg (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) gemeinsam erarbeitet. 2/11 Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich: Für die Analyse dieses Feldes wurden 20 Dokumente aus dem Zeitraum 1995-2002 herangezogen: Die Dokumente setzen sich zusammen aus dem Gewaltschutzgesetz 1996 sowie dem Justizausschussbericht zum Gewaltschutzgesetz 1996, Debatten im Nationalrat zum Gewaltschutzgesetz 1996, zu Gewalt in der Familie und innerer Sicherheit 1997, der Nationalratsdebatte im Jahr 2000 zu Maßnahmen für Frauen und Familien, dem Bericht Österreichs über den Stand der Umsetzung der CEDAW-Konvention 1999. Die Programme der Parteien Grüne, ÖVP und SPÖ sowie der Plattform Initiative freiheitlicher Frauen wurden ebenso analysiert wie das Regierungsprogramm 2003 und Zeitungsartikel der Tageszeitungen Kurier und Der Standard. Geschlechterungleichheit in der Politik: Für die Analyse dieses Feldes wurden 22 Dokumente aus dem Zeitraum 1995-2003 herangezogen. Die Dokumente setzen sich zusammen aus Zeitungsartikeln der Tageszeitungen Die Presse und Der Standard, den Programmen der Parteien Grüne, ÖVP und SPÖ sowie der Plattform Initiative freiheitlicher Frauen, sowie dem Regierungsprogramm 2003. Weiters wurden analysiert eine abweichende Stellungnahme zum Kommentar zum Bundesgleichbehandlungsgesetz 1996, Nationalratsdebatten zur Novelle des Bundesgleichbehandlungsgesetzes 1999 sowie Wortmeldungen im Nationalrat im Juli 2003, dem Bericht Österreichs über den Stand der Umsetzung der CEDAW-Konvention 1999 sowie der Stellungnahme des Büros für Gleichstellung und Gender Studies der Universität Innsbruck zum neuen Gleichbehandlungsgesetz für den öffentlichen Dienst 2003. 3/11 2. Familienpolitik Die Diagnose von Familienpolitik In den österreichischen Dokumenten werden Probleme in der Familienpolitik und Lösungsvorschläge mit absteigender Häufigkeit folgendermaßen umrissen: An erster Stelle steht die Vorstellung, dass Probleme in der Familienpolitik durch "Versagen bisheriger Familienpolitik" entstanden sind, d.h. dass ungenügende Maßnahmen, falsche Maßnahmen bisher ergriffen wurden und korrigiert werden sollten. Fast gleich stark ausgeprägt ist die Ansicht, "Vereinbarkeit von Beruf und Familie" stelle ein Problem dar und solle gelöst werden. Beide Argumentationen sind über den gesamten Zeitraum stark artikuliert. Als dritte, ebenfalls häufig vorkommende Vorstellung ist die "Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt" zu nennen: diese Vorstellung geht davon aus, dass Frauen am Arbeitsmarkt Probleme haben und dass es nötig ist, vermehrt Frauen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Diese drei Argumentationen sind im untersuchten Zeitraum dominant. Weitere Argumentationen in der Diagnose des Problems sind "Armut", "demographische Entwicklung", "Veränderung von Familien" (Familien unterliegen einem Wandel) und "Geschlechtergleichheit", wobei die beiden letzten sehr schwach ausgeprägt sind. Die Seltenheit der Präsentation des Problems als eines der "Geschlechtergleichheit" bedeutet, dass Familienpolitik wird im untersuchten Zeitraum kaum als Feld wahrgenommen wird, in dem es um Gleichheit und Ungleichheit der Geschlechter geht. Die Präsentation "Geschlechtergleichheit" ist in den analysierten österreichischen Dokumenten, im Gegensatz etwa zu den EU-Dokumenten sowie den spanischen Dokumenten, sehr schwach artikuliert und wird ausschließlich von der SPÖ und den Grünen angewandt. "Demographische Entwicklung" als Problem für Familienpolitik scheint erstmals im Jahr 2001 in der Nationalratsdebatte über das Kindergeld von ÖVP- und FPÖ- Abgeordneten auf. Ebenso scheint die Argumentation "Armut" als Problem für Familienpolitik erstmals im Jahr 2001 auf. Vor diesem Zeitpunkt wurden diese Argumentationen nicht in den analysierten Dokumenten gefunden. Für Probleme, die als familienpolitische dargestellt werden, werden selten strukturelle Ursachen genannt; stattdessen wird das Problem meist in falschem individuellem Verhalten 4/11 oder falschen individuellen Werten lokalisiert. Dieser Individualisierung fehlt meist jegliche Geschlechterperspektive. Die individuelle Entscheidung, Kinder zu zeugen oder nicht und diese selbst zu betreuen oder nicht, wird politisiert. Bevölkerungspolitische Relevanz wird betont, geschlechterpolitische Relevanz wird meist nicht artikuliert. Die Geschlechterfrage wird somit entpolitisiert, während eine Generationenfrage politisiert wird. Generell wurde in den analysierten Dokumenten wenig bis kein Bezug zu Gender Mainstreaming gefunden. Die Thematik Gender Mainstreaming scheint jedenfalls nicht im direkten Zusammenhang mit Familienpolitik auf. Die Prognose von Familienpolitik Logisch kohärente Vorstellungen über die Existenz eines Problems und Vorschläge zur Lösung dieses Problems wurden hauptsächlich bei den Präsentationen "Versagen bisheriger Familienpolitik" und "Vereinbarkeit von Beruf und Familie" sowie bei "Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt" gefunden, weniger bei den anderen Präsentationen. Die Argumentation "Demographische Entwicklung" ist hauptsächlich als Problemdefinition ausgeprägt und weniger als Lösungsansatz ausgeprägt – demographische Entwicklung wird als zwar als Problem definiert, aber selten werden damit Lösungsvorschläge verbunden. Die ungleiche Verteilung von Arbeit zwischen Frauen und Männern wird meist reproduziert; Frauen werden, sowohl in der Diagnose als auch in den unterschiedlichen Lösungsansätzen, als Hauptverantwortliche für Betreuungs- und Familienarbeit dargestellt. Männer werden selten als Zielgruppe für Lösungsvorschläge dargestellt. Ungleiche Verteilung von Familienarbeit wird nur im Zusammenhang mit CEDAW als Problem für die Demokratie und damit für den Staat wahrgenommen. In der Präsentation "Vereinbarkeit von Beruf und Familie" gibt es eine Verschiebung vom Modell der vollen Erwerbstätigkeit für Frauen und Männer hin zu einem modifizierten Modell der vollen Erwerbstätigkeit des Mannes plus einer zusätzlichen Teilzeit-Erwerbstätigkeit der Frau. Ab 2000 wird eine neue Dichotomie eröffnet: Erwerbstätigkeit von Frauen mit Kindern wird als (durch wirtschaftliche Notwendigkeit) erzwungen und unfreiwillig dargestellt. Dieser Präsentation wird die Vorstellung der freien Wahl der Kinderbetreuung andererseits gegenübergestellt. Selbstbetreuung von Kindern durch Frauen in der Familie wird als beste Form der Betreuung dargestellt und naturalisiert. Familie wird als notwendige Basiseinheit 5/11 der Gesellschaft dargestellt, als ein Refugium, an dem alle Bedürfnisse von Kindern am Besten gestillt werden können. Damit verbunden ist eine Infragestellung der Qualität öffentlicher Kinderbetreuung. Geschlechterdimensionen von Familie werden selten expliziert: heterosexuelle Paare mit Kindern scheinen als Normfamilie auf, Alleinerziehende werden ebenfalls genannt. Ab 2000 kann eine zunehmende De-Artikulierung oder Re-Traditionalisierung von Geschlechterrollen, sowohl in Diagnose als auch in Prognose festgestellt werden. Vorstellungen über "Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt" werden zunehmend durch Vorstellungen ersetzt, die auf traditionelle Geschlechterrollen zurückgreifen oder den Fokus auf Familie, Kinder und Generationen lenken, ohne Geschlechterdimensionen zu artikulieren. 3. Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich Die Diagnose von Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich Gewalt gegen Frauen wird in den untersuchten Dokumenten selten als öffentliches Problem diskutiert. Als öffentliches Problem wird es vor allem als Ausdruck von mangelnder öffentlicher Sicherheit und im Zusammenhang mit Kriminalität und Verbrechensprävention gesehen; die Geschlechterdimension gerät bei dieser Präsentation in den Hintergrund. Häufiger wird Gewalt gegen Frauen als etwas diskutiert, bei dem Privates und Öffentliches aufeinander stoßen, wobei die Schutzwürdigkeit des Privaten bei dieser Vorstellung stets betont wird. So zeigt die Präsentation des Problems bei allen Parteien mit Ausnahme der Grünen, dass das Problem "Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich" in der Beziehung zwischen zwei Individuen, also im Privaten, liegt. Als Problem für die Demokratie wird Gewalt gegen Frauen explizit nur von den Grünen genannt. Im Allgemeinen wird Gewalt gegen Frauen in den untersuchten Dokumenten in geschlechtsneutraler Sprache diskutiert: Entgeschlechtlichte „Opfer“ werden einem „Aggressor“ oder „Täter“ gegenübergestellt. Wenn trotz der häufigen entgeschlechtlichenden Darstellung Geschlecht benannt wird, dann indem Frauen mit Opfern gleichgesetzt werden, oft im Zusammenhang mit Kindern. Frauen werden als schwach und abhängig dargestellt, manchmal auch als unfähig, sich aus Gewaltbeziehungen zu lösen und somit auch als Mitverantwortliche für die gegen sie gerichtete Gewalt. Täter oder Aggressoren jedoch bleiben meist geschlechtslos. Dies gilt auch dann, wenn im selben Text Opfer in 6/11 geschlechtlicher Weise als Frauen dargestellt werden. Wenn Gewalttäter jedoch geschlechtlich benannt werden, dann als männlich, aber das Bild des Täters ist im Allgemeinen verschwommener als das des weiblichen Opfers. Wenn männliche Gewalttäter näher beschrieben werden, dann insofern, als gewalttätiges Verhalten individualisierend wie etwa durch Gewalterfahrungen in der Kindheit erklärt wird. Gewalt gegen Frauen wird in den untersuchten Dokumenten äußerst selten (von einigen weiblichen Abgeordneten der Parteien SPÖ und des LIF sowie im Parteilprogramm der Grünen) als strukturell bedingt dargestellt: meist wird es als Ergebnis falschen individuellen Verhaltens dargestellt, das unter anderem durch Drogen, Arbeitslosigkeit oder Alkohol hervorgerufen wird. Ungleiche Geschlechterverhältnisse werden wiederum explizit nur von den Grünen als Ursache für Gewalt gegen Frauen genannt. In keinem der untersuchten Dokumente wird eine Verbindung hergestellt zwischen Gewalt gegen Frauen und Gender Mainstreaming-Politik. Die Prognose von Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich Alle Parteien verwenden die Argumentation, dass Gewalt gegen Frauen grundsätzlich etwas zu Bestrafendes sei. Grosse Unterschiede gibt es jedoch in der konkreten Ausgestaltung von Maßnahmen, die Gewalt gegen Frauen verhindern sollen. Die Vorstellung, dass staatliche Intervention bei Gewalt in der Familie nur in sehr limitierter Weise stattfinden sollte, findet sich in der Argumentation des Schutzes der Privatsphäre des Täters oder Wohnungseigentümers. Das zu schützende Gut ist hier die Privatsphäre des Gewalttäters, die körperliche Unversehrtheit von Frauen muss mit diesem Gut abgewogen werden. Diese Vorstellung findet sich bei Abgeordneten der FPÖ, während alle anderen Parteien den Eingriff in die Privatsphäre als legitim erachten, um Frauen vor Gewalt zu schützen. Einige FPÖ-Abgeordnete lokalisieren die zu schützende Person auch im männlichen Gewalttäter, der durch staatliche Maßnahmen wie der Wegweisung nicht nur in seiner Privatsphäre beeinträchtigt wird, sondern der Gefahr ausgesetzt ist, obdachlos und arbeitslos zu werden. Staatliche Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt in der Familie sollen daher so täterfreundlich wie möglich gestaltet werden und die Interessen des Täters wahren. Diese Präsentation ist in Österreich im Vergleich mit den anderen untersuchten Staaten relativ häufig anzutreffen, in den analysierten EU-Dokumenten jedoch nicht vorhanden. 7/11 Seit 2000 kann eine Veränderung von Präsentationen festgestellt werden: die Familie als zu schützendes Refugium wird in den Mittelpunkt gestellt. Gewalt in der Familie ist nun Teil eines größeren Diskurses um die Wichtigkeit von Familie und die Gefahr von deren Erosion durch verschiedene Einflüsse. Gewalt wird als einer dieser negativen Einflüsse auf Familien betrachtet. Diese Präsentation enthält keinerlei Bezug zu Geschlechterdimensionen und ungleichen gesellschaftlichen Machtverhältnissen. In den parlamentarischen Debatten ist eine Verschiebung von der Präsentation „Gewalt gegen Frauen“ hin zur entgeschlechtlichten Präsentation „Gewalt in der Familie“ festzustellen. Gewalt gegen Frauen rückt zunehmend in den Hintergrund. Die Vorstellung, dass die Integrität und der Schutz der Familie im Zentrum der Politik stehen sollten, gewinnt an Bedeutung. Weiters gibt es seit 2000 eine Vermischung von zwei Argumentationen: Gewalt in der Familie und Kindesmissbrauch. Diese Vermischung verstärkt das Abrücken von Geschlechterdimensionen sowohl bei Problemdefinition als auch bei Lösungsvorschlägen für Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahbereich. 4. Geschlechterungleichheit in der Politik Mageeq spricht nicht von "politischer Unterrepräsentation von Frauen in der Politik, sondern von "Geschlechterungleichheit in der Politik", da der Begriff der Repräsentation bereits spezifische Interpretationen der Position und Rolle von Frauen in der Politik enthält, die aber in den analysierten österreichischen Debatten nur unzureichend differenziert werden und deshalb selbst Gegenstand der Untersuchung sind. In der (politik-)wissenschaftlichen Literatur wird zwischen "quantitativer Repräsentation" (Anzahl von Frauen) und "qualitativer Repräsentation" (die Anerkennung des Geschlechterunterschieds in allen Politikbereichen mit dem Ziel einer frauenfreundlichen Politik) unterschieden. Während die quantitative Repräsentation als ein Gebot der Realisierung gleicher politischer Rechte für Männer und Frauen gilt, ist die Frage nach qualitativer Repräsentation mehr auf positive Aktionen zum Ausgleich benachteiligender Geschlechterdifferenz gerichtet. Beide Formen der Repräsentation gilt es zu trennen. 8/11 In den untersuchten österreichischen Politikdokumenten wird diese Unterscheidung nicht gemacht. Diese Blindstelle führt zu drei Verkürzungen in der Problem- und Lösungsrepräsentation: erstens zu der Vorstellung, dass die Erhöhung des quantitativen Anteils von Frauen in politischen Gremien gleichsam automatisch zu einer frauenfreundlicheren Politik führe. Besondere frauenpolitische Anstrengungen erscheinen dann über die Erhöhung des quantitativen Frauenanteils hinaus nicht mehr notwendig. Zweitens wird daraus gefolgert, dass die im politischen Bereich präsenten Frauen automatisch für Frauenpolitik zuständig sind (Männer also entlastet sind). Drittens wird die Frage nach politischer Repräsentation von Frauen vielfach auf die Frage machtpolitischer Interessen von individuellen Frauen reduziert und selten als ein demokratiepolitisches Problem verstanden. Die untersuchten Dokumente weisen – mit Ausnahme der FPÖ – einen "Allparteienkonsens" in Bezug auf die Diagnose von Geschlechterungleichheit in der Politik auf: Frauen sollten in der Politik bzw. in politischen Führungspositionen besser repräsentiert sein – freilich mit der Ungenauigkeit des Repräsentationsbegriffs. Die Debatten um Geschlechterungleichheit in der Politik werden in Österreich fast ausschließlich von Frauen der politischen Parteien geführt: Diese Exklusivität der Rede verdeutlicht, dass das Problem der Geschlechterungleichheit als ein "Frauenproblem" wahrgenommen und präsentiert wird. Ein Bezug auf die Gender Mainstreaming-Politik der EU ist in der gesamten Debatte nur schwach vorhanden. Die Diagnose von Geschlechterungleichheit in der Politik Die Diagnosen der Geschlechterungleichheit in der Politik sind in den analysierten Dokumenten vergleichsweise schwach. Ganz allgemein sind es die Strukturen der Politik oder die Gesellschaft, die die Präsenz von Frauen behindern. Lediglich Johanna Dohnal kritisiert die Männer in ihrer Partei, der SPÖ, die Frauen abblocken. Politik wird als "Männerbund" bzw. als "Männerwelt" beschrieben. Die Bezeichnung von der Politik als "Männerwelt" findet am Beginn des neuen Jahrhunderts Eingang in die Dokumente aller drei Parteien – ÖVP, SPÖ und Grüne. Allerdings fehlen in der Diagnose des Problems weiblicher Unterrepräsentation Bezüge auf die Organisation und Struktur von Parteien, auf die Interessen von Männer(-gruppen) innerhalb der Parteien oder auf die Bedeutung der Sozialpartnerschaft für den Ausschluss von Frauen aus der Politik. Anders ausgedrückt: In der Problemdiagnose werden die Ursachen für Geschlechterungleichheit in der Politik in andere gesellschaftliche Bereiche verschoben und 9/11 die Strukturen der Welt der Politik werden nicht in den Blick genommen. Das Feld der Politik wird nicht als durch Geschlechterherrschaft gekennzeichnetes wahrgenommen. Vielmehr geraten in der Diagnose vornehmlich Frauen ins Visier der Darstellung: Sie werden – wohlwollend – als Problem konstruiert, sie haben ein Problem mit der Politik, weil sie unterrepräsentiert sind. Anders ausgerückt: Die Debatten um Beseitigung von Geschlechterungleichheit in der Politik konstruieren Frauen als "das Andere" der Politik. In den österreichischen Dokumenten fehlen – im Unterschied zu anderen europäischen Ländern – zwei Argumentationen in der Diagnose: Erstens wird die Unterrepräsentation von Frauen nicht als ein Problem für die österreichische Demokratie geframt; die Unterrepräsentation ist ein Problem für Frauen, nicht aber für die Legitimität der österreichischen Demokratie (wie dies in den jungen Demokratien debattiert wird). Zweitens fehlt in den österreichischen Dokumenten weitgehend ein "Differenzansatz" in der Debatte. SPÖ und Grüne Dokumente vertreten einen strikten Egalitätsansatz (gleiche Rechte), nur in ÖVP-Dokumenten findet sich ein nicht sehr ausgeprägter Bezug darauf, dass Frauen "als Frauen" einen Unterschied machen sollten, indem betont wird, dass Frauen sich nicht wie Männer verhalten sollten. Nur in FPÖ-Dokumenten ist ein starke Differenzansatz enthalten: Die Erhöhung des Frauenanteils in der Politik werde zu einem anderen Politikstil führen, zu mehr Verantwortung und Konsens. Die Prognosen zur Beseitigung von Geschlechterungleichheit in der Politik Die Prognosen und Problemlösungen sind entsprechend der schwachen Problemdiagnosen auch eher phantasielos. Individualistische Lösungen gelten als das probateste Mittel, nämlich die Hebung der politischen Qualifikation von Frauen durch Schulungen und Mentoring. Dies ist das am ehesten akzeptierte Mittel, obgleich in der Diagnose selten von geringer Qualifikation von Frauen die Rede ist. Freilich reflektiert dieser individualistische Zugang die fehlende Strukturanalyse von Frauen und die Konstruktion von Frauen als "die Andere" – und eben geringer Qualifizierte. Umgekehrt wird nahegelegt, dass wenn Frauen besser qualifiziert sind für die Politik, sie auch besser repräsentiert sind. In den Lösungsvorschlägen wird auf außerpolitische Strukturen Bezug genommen, aber tendenziell in einem Regulierung abwehrenden Gestus: Damit sich das Geschlechterverhältnis 10/11 in der Politik ändere, müssen sich erst gesellschaftliche Geschlechterverhältnisse und die politische Kultur ändern. Die Forderung einer Quotierung zur Realisierung gleicher quantitativer Repräsentation wird von den Parteien – mit Ausnahme der Grünen – sehr schwach vertreten. Während die FPÖ von einer eher naturwüchsigen Steigerung des Frauenanteils bei Veränderung der Gesellschaft ausgeht, wird in ÖVP-Dokumenten bis zum Jahre 2003 eine Regulierung durch Quoten gegen die Qualifikation von Frauen in Anschlag gebracht. Auch die SPÖ-Frauen sind mit Kritik an der mangelhaften Realisierung ihrer Quotierungsvorgabe durch die männlichen Parteikollegen eher zurückhaltend. Erst im Jahr 2003 gibt es einen Stimmungsumschwung, an dem auch Vertreterinnen der ÖVP beteiligt sind. Nach wie vor abgelehnt wird – wie in EU-Dokumenten vorgeschlagen – eine gesetzliche Regulierung und Sanktionierung von weiblicher Unterrepräsentation – mit Ausnahme der Grünen, die einen solchen Vorschlag in die Diskussion brachten. In der Lösungsperspektive fehlt völlig die Frage nach qualitativer Repräsentation von Frauen, also Wege und Möglichkeiten einer geschlechtergerechteren Politik. 11/11