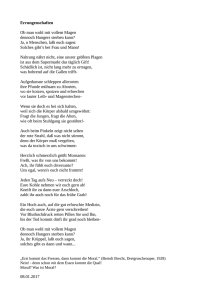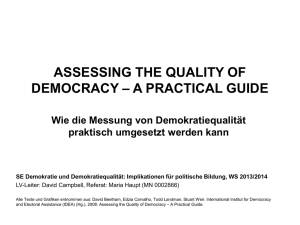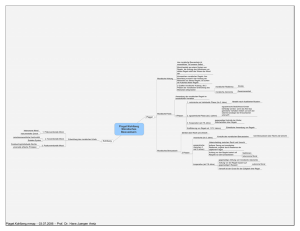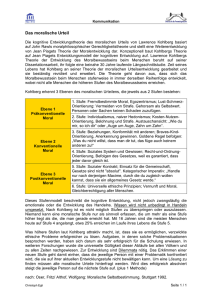Moralische oder politische Demokratie
Werbung

1 Moralische oder politische Demokratie Worauf kann die globale Umweltvorsorge bauen? Anton Leist Nicht wenige halten die globale Umweltpolitik für eine zukünftige Antriebskraft für Demokratie, auszugehend insbesondere vom Westen. Diese Erwartung beruht auf der Basis eines kosmopolitisch-moralischen Begriffs der Demokratie. In diesem Artikel wird dafür plädiert, dass ein solches Verständnis in Sackgassen führt und durch eine genuin politische Konzeption ersetzt werden sollte. Aufgrund der überwiegend nur abstrakt zu beurteilenden Gefahren benötigt die Umweltvorsorge eine politische Demokratie sogar noch eher als viele andere Politikziele. Schlüsselwörter: moralischer Kosmopolitismus, Bedingungen von Gerechtigkeit, deliberative Demokratie, agonistische Demokratie, internationale Umweltpolitik Abstract Englisch Quite a few think of global environmental politics as a future driving force for democracy, meant especially to spring from the West. Basic to this expectation is a cosmopolitic and „moral“ concept of democracy. This article claims that the moral concept of democracy leads to dead ends of policy and that it should be substituted by a genuinely „political“ idea of democracy. Due to its inherent abstractness environmental policy is even more than other political fields in need of a political democracy. Keywords: moral cosmopolitism, conditions of justice, deliberative democracy, agonistic democracy, international environmental politics. 2 Viele Philosophen sind der Meinung, dass die Moral letztgültige Gründe für Rechte und Pflichten unter allen Menschen liefere. Die Moral bildet für siedas Fundament der Politik, idealerweise würde die Politik das realisieren, was die Moral fordere. Nach Ansicht vieler Politiker hingegen spielt die Moral im Rahmen der Politik eine untergeordnete Rolle. Bestärkt werden sie dadurch, dass unter den meisten Bürgern kein hinreichend starker moralischer Konsens herrscht, und zudem durch die Erfahrung, dass die moralischen Überzeugungen, selbst wo sie vorherrschen, nicht sonderlich wirksam sind. Nicht zuletzt die Umweltgüter benötigen als öffentliche Güter die Koordination mit je anderen Akteuren anhand von nichtmoralischen, nämlich sozialen Normen und Institutionen. Mit moralischen Überzeugungen lassen sich diese Normen nicht ersetzen, und allein durch Moral kämen sie erst gar nicht zustande. Der Gegensatz zwischen moralisch argumentierenden Philosophen und politischen Demokraten schien früher schon einmal überwunden, weil im demokratischen Denken Moral und demokratische Prozeduren kaum voneinander zu trennen waren. Inzwischen heben aber viele Herausforderungen an die Politik, vor allem diejenigen der Umwelt, einen Kontrast von Moral und Politik immer deutlicher hervor. Umweltherausforderungen wie der Klimawandel haben im 21. Jahrhundert ein transnationales, globales Ausmaß angenommen, und ohne eine entsprechend transnationale Kooperation sind ihre Auswirkungen nicht zu kontrollieren. Die Visionen von Moral und Politik, wie diese Aufgabe zu lösen sein wird, fallen aber auseinander. Unklar ist vor allem, ob der normative Maßstab unter den Völkern direkt in einer räumlich unbegrenzten Moral bestehen kann, oder ob die transnationale Politik anderen – insbesondere eigenständig politischen – Gesichtspunkten folgen muss. Moralischer Kosmopolitismus. Zu den fatalen Wirkungen des Klimawandels gehört, dass er dabei ist, die bereits bestehende globale Ungleichheit zu verschärfen. 1 Ausgedrückt in blanken Zahlen: 1,37 Milliarden Menschen, etwa 25 Prozent der Weltbevölkerung vor allem in südlichen Ländern, kommen täglich mit weniger als 1,25 Dollar aus. 2,56 Milliarden, etwa 50 Prozent, mit weniger als zwei Dollar. Die 15 Prozent Bewohner der einkommensstarken westlichen Länder verfügen dagegen über ein Durchschnittseinkommen pro Tag von 75 Dollar. 2 Unstrittig drücken diese Zahlen eine extreme soziale Ungleichheit aus, die von den zu erwartenden Folgen des Klimawandels voraussichtlich noch verstärkt werden wird. Diese Umstände fordern eine moralische Reaktion geradezu heraus, nicht nur von den Philosophen, sondern auch spontan von vielen Bürger im Alltag. Die sozialliberalen, Freiheit und Wohlfahrt verteidigenden Philosophen sind in ihrer Reaktion jedoch gespalten. Eine Teilgruppe unter ihnen hat eine Doktrin des „moralischen Kosmopolitismus“ zu entwickeln begonnen, die sie auf internationalen Foren vertritt. Der amerikanische Philosoph Henry Shue ist ähnlich wie der deutsche Philosoph Thomas Pogge der Meinung, dass alle Menschen weltweit ein Recht auf ein soziales Minimum haben, das von den im globalen Maßstab besser Gestellten ungeachtet nationaler Grenzen realisiert werden sollte. 3 Viele angelsächsische und deutschsprachige Philosophen schließen sich dieser oder einer ähnlichen Forderung an. Einer 3 anderen Gruppe sozialliberaler Philosophen fällt es gerade in moralischer Hinsicht schwer, diesen Forderungen zu folgen. Die Moral scheint ihnen keine hinreichende Grundlage für transnationale Beziehungen zu sein. 4 Aus historischer Perspektive sind die Forderungen der ersten Gruppe „westlicher“ Philosophen nachvollziehbar, verteidigen sie doch nichts anderes als die in Europa geborene Idee eines moralischen Vorrangs des Weltbürgertums vor lokalen politischen Pflichten, wie sie Diogenes von Sinope bereits im 4. Jahrhundert vor Christus entwickelt hat. 5 Andererseits ist auch Philosophen klar, dass sie in der gegenwärtigen Welt unterschiedlicher Glaubenssysteme und kontroverser Ideologien international nicht einfach an das Faktum des Menschseins erinnern können, um damit Staaten in Bewegung zu setzen. Auf der Suche nach einer möglichst schlanken „moralischen Strategie“ war Pogge vermutlich am erfindungsreichsten. Seiner Meinung nach reicht es aus, an das weithin geteilte „negative Prinzip“ des Schadenvermeidens zu appellieren. So verhinderten die westlichen Länder durch ihre protektionistische Wirtschaftspolitik gleiche Chancen der Entwicklungsländer auf dem Weltmarkt und beteiligen sich an der Ausbeutung ressourcenstarker Entwicklungsländer, indem sie mit deren korrupten, nicht-demokratischen Eliten kooperierten. Pogge ist der Meinung, dass allein aufgrund dieser Verstöße gegen die negativen Rechte der global Armen positive Gerechtigkeitsforderungen entstehen, die von den reichen westlichen Ländern beglichen werden müssen. Das von Pogge angesprochene Ausmaß des Schädigens zwischen den Staaten ist begrifflich und empirisch jedoch nicht überzeugend. Inwiefern die Starken die Schwachen schädigen, indem sie ihre Chancen verringern, ist ohne eine bereits unterstellte moralische Gleichheit nicht klar. Außerdem sind die Starken nicht durchweg die historische Ursache für den Zustand der Schwachen, etwa wenn deren Religion Demokratie verhindert und Diktaturen Vorschub leistet. Und inwiefern die Kooperation mit korrupten Eliten mehr Übel als Gutes verursacht, wirft historische Fragen auf, die vermutlich umstritten bleiben. Um diesen empirischen Meinungsstreit möglichst zu umgehen, versucht Pogge in seiner Argumentation vorrangig normativ zu überzeugen. Dabei stößt er jedoch auf eine Reihe von Bedingungen, die es erschweren, die Moral unter Individuen einfach auf Gesellschaften im internationalen politischen Raum auszudehnen. 6 Gerechtigkeit nicht ohne Voraussetzungen. Die moralischen Kosmopoliten übersehen nämlich leicht, dass ethische Forderungen an die Politik ein Resultat bereits errungener institutioneller Voraussetzungen sind und ihren Sinn nur innerhalb dieser Voraussetzungen gewinnen. Zu ihnen gehören Institutionen der ökonomischen Kooperation, des rechtlichen Zwangs und eine einigende Kultur. Sehen wir zu, wie diese drei Bedingungen ineinander greifen. 7 Regelmäßige Pflichten gegenüber Unbekannten wird man nicht auf sich nehmen, wenn dies nicht zum gegenseitigen Nutzen in einer mehr oder weniger abgeschlossenen Gesellschaft 4 geschieht. Von Pflichten ohne eigenen Nutzen sind die meisten Menschen überfordert, sodass regelmäßige Pflichten nur in einem System der Kooperation realistisch sind (erstens). Weil selbst dann der individuelle Nutzen nicht proportional oder auch nur klar taxierbar sein wird, müssen die Regeln des Kooperierens rechtlich geordnet und gesichert werden. Auch sich politisch aneinander zu binden, erfordert bereits Zwang (man könnte sich immer auch anders binden), der als legitim begründet werden muss. Gerechtigkeit und Zwang gehen dabei eine enge Bindung ein (zweitens). Rechtlicher Zwang und Gerechtigkeit wären aber nicht effektiv, könnten sie sich nicht auf ein gemeinsames kulturelles Vorverständnis stützen. Kooperation setzt legitimen Zwang, und legitimer Zwang setzt geteilte Kultur voraus (drittens). Deliberative versus agonistische Demokratie. Als empirisches Beiwerk der Politik werden diese drei institutionellen Bedingungen von den moralischen Kosmopoliten durchaus wahrgenommen. Weil sie jedoch an die allgemeine menschliche Vernünftigkeit glauben, halten sie die inner- wie auch die international einigende Wirkung der Moral für stark genug, die unterschiedlichen Meinungen und Interessen der Bürger zu harmonisieren. Im internationalen Raum herrscht allerdings nur eingeschränkt Kooperation, nur für schwerste Verstöße gegen „Menschenrechte“ gibt es juristische Strafen, während die rechtlichen Grundlagen für eine anspruchsvollere gemeinsame Politik fehlen. Schließlich fehlt offensichtlich auch die kulturelle Homogenität. Wenn manche „deliberativen Demokraten“ dennoch der Meinung sind, es könnte eine internationale Demokratie geben, so beruht das auf einem tiefen Glauben an eine allgemeine menschliche Vernünftigkeit. Ein Demokrat, der diesen stoisch-kosmopolitischen Glauben nicht teilen kann, neigt eher zu der von der belgischen Philosophin Chantal Mouffe „agonistische Demokratie“ genannten Position. 8 Wenn wir den Glauben an wesentliche Vernünftigkeit aufgeben, tritt das reale Phänomen des moralischen Pluralismus unverstellter in den Vordergrund, und es scheint nicht mehr plausibel, dass die in ihren Interessen uneinigen Bürger gerade durch eine universelle Moral geeint werden sollten. Geeint werden sie vielmehr immer nur durch den Nutzenvorteil der Kooperation, den legitimen rechtlichen Zwang und die Gewohnheiten der gemeinsamen Kultur – vorzugsweise innerhalb einer Gesellschaft. Innerhalb dieser Trias muss die jeweils am schwächsten wirkende Bedingung durch die Stärke der jeweils anderen ausgeglichen werden, die Moral dürfte – sofern überhaupt – am Ende nur bespiegelnd hinzutreten. Die Demokratie kommt nicht ohne einen abgrenzbaren demos aus, ein Volk ist nicht beliebig konstruierbar und bildet die Voraussetzung der Politik. Wenn wir öffentlich moralisch argumentieren, so unter der kulturellen Voraussetzung eines politischen Gemeinwesens. Mit moralischen Argumenten können wir die Details innerhalb des Gemeinwesens zu ordnen versuchen, tendenziell bedrohen wir dabei aber diese Voraussetzungen selbst. Da zu moralischen Argumenten ihre Universalität hinzugehört, lassen sie kaum zu, zwischen Bürgern und Nicht-Bürgern zu unterscheiden. Wenn moralische Argumente die drei Bedingungen der gemeinsamen Kooperation, des rechtlichen Zwangs und der kulturellen Homogenität nicht beachten, müssen sie Ausländern denselben Status einräumen wie den 5 Bürgern, und lösen damit die Grenzen des Demos auf. In diesem Sinn bedrohen sie die demokratische Politik. Diese Bemerkungen lassen sich auch so zusammenfassen, dass sich eine Gesellschaft die Moral nur deshalb leisten kann, weil sie durch einen gemeinsamen Nutzen, durch Zwang und gemeinsame Kultur ermöglicht wird. Die Kosmopoliten pflegen die Illusion, das Gegenteil anzunehmen – dass Nutzen, Zwang und Kultur die Moral nur behinderten. Deshalb haben sie auch keinen Sinn dafür, dass Gesellschaften untereinander eher zu Gegnerschaften als zu Konsensen tendieren, und dass kontrollierte Gegnerschaften in der Realität vorteilhafter sind als konsensuelle Gemeinschaften, die nur auf dem moralischen Reißbrett existieren. Ob es innernational mehr als eine kompromissfähige Demokratie geben kann – einen, mit Rawls gesprochen, „übergreifenden Konsens“ –, ist empirisch gesehen weitgehend unklar; für mehr als Kompromisse, also kontrollierte Gegnerschaften, im internationalen Raum spricht hingegen wenig. Konflikt zwischen innen und außen. Im Allgemeinen stoßen moralisch motivierte Erweiterungen der nationalen Demokratie immer auf zwei Probleme: auf das Problem der mangelnden politischen Legitimation bloß moralisch motivierter Aktionen und auf das Problem des Nullsummen-Verhältnisses zwischen nationaler und transnationaler Legitimation. Beides sei näher erläutert. 9 Kosmopoliten sehen internationale Foren, NGOs, Menschenrechtsgruppen und andere Aktivisten der globalen Zivilgesellschaft gern als demokratische Repräsentanten der (national) Betroffenen. Was aber verleiht diesen Gruppen einen demokratischen Status? Einige von ihnen vertreten schlicht partikulare Interessen, andere sind ethisch motiviert. Keine der Gruppen ist demokratisch gewählt und allen fehlt die zentrale politische Eigenschaft, bindende Entscheidungen innerhalb stabiler Institutionen herbeiführen und längerfristig verantworten zu müssen. Ohne solche Entscheidungen müssen Konflikte, wie sie international sicher nicht geringer sind als innernational, nicht politisch ausgetragen werden. Die Kosmopoliten müssen ihre Ideale nicht in die agonistische Politik umsetzen und können sie deshalb nur parteilich äußern. Das Nullsummen-Problem würde sichtbar, wenn tatsächlich international entscheidungsfähige Institutionen geschaffen wären, die Nationalbürgern Rechte unabhängig von deren Verfassungsrechten zusprächen. Kosmopoliten verteidigen oft eine Idee von universellen Menschenrechten, um auf diese Weise nationale Rechtsverstöße anzuprangern. Globale Rechte, gäbe es für sie Institutionen, müssten jedoch die nationalen Institutionen (Parlamente, Gerichte) außer Kraft setzen. Ein grundsätzliches Problem eines solchen Prozesses wäre, dass sie weniger demokratisch legitimiert sein könnten wie die national geschaffenen Rechte. Denn wie immer man sich eine global-demokratische Legitimation vorstellt, sie könnte nur erheblich indirekter sein wie die nationale. Hält man die Kooperations- und die Gemeinschaftsbedingung als relevant für den Demos, so sind transnational-demokratische 6 Abstimmungen, sofern es sie in bestimmtem Ausmaß (etwa in der EU) bereits gibt, weniger demokratisch legitime Abstimmungen wie die nationalen. Die stark ökonomisch motivierte und schwach moralisch verklärte Einigung Europas ist für einen solchen Vorgang ein anschauliches Beispiel. 10 Eine demokratische globale Politik ist deshalb nicht denkbar, wenn unter „globaler Demokratie“ die Legitimation durch transnationale Versammlungen und Kollektive gemeint ist. Die Aktivitäten der globalen Zivilgesellschaft sind entweder interessengesteuerte oder moralische, nicht aber politische. Sofern es eine globale Umweltdemokratie geben kann, so bestenfalls eine zwischen nationalen Demokratien, nicht jenseits von ihnen. Von der globalen zur lokalen Umweltdemokratie. Wer die soweit entwickelte Skepsis gegenüber der Wirksamkeit einer globalen Zivilgesellschaft teilt, wird in den kosmopolitischen Entwürfen eher ein Problem sehen als die gedankliche Arbeit an einer Hoffnung. Allerdings ist gerade im Kontext der globalen Umweltpolitik nicht nur verständlich, warum vielen der Appell an Gerechtigkeit als unausweichlicher Bestandteil jedes künftigen Klimaregimes gilt, sondern auch, warum beim aktuell vollständigen Versagen der internationalen Politik moralische Argumente als die einzig mögliche Rückzugsposition erscheinen. 11 Aber so verständlich der Trost durch die Moral auch ist, die ökonomiediktierte Verweigerung der Großen, sich auch nur auf schwache CO2-Auflagen festzulegen, erweist moralisch motivierte Appelle als einen müßigen Zeitvertreib. Die intellektuelle Koalition zwischen Europäern und amerikanischen Ostküstenbewohnern reicht selbst unter einer USdemokratischen Regierung nicht aus, um die amerikanische Position auch nur wenig zu ändern. Aus der Sicht des geschilderten politischen Standpunkts entwickelt die Umweltpolitik innerhalb des gesamten Politikszenarios deshalb eine so geringe Eigendynamik, weil die Umweltvorsorge in der Regel nur rationale und kaum emotionale Identifikationsziele zulässt. Zukünftige Generationen jenseits von Kindern und Enkeln, quantifizierte Risikograde und globale Folgen sind nur rational, nicht emotional zugängliche Konstrukte. Da die Politik eine Identifikation mit einem Gemeinwesen benötigt, können solche unausweichlich rationalen Umweltziele bestenfalls sekundärer Bestandteil bereits gelingender Politik und nicht originäre Quellen der Politik sein. Sichtbar wird dieses Defizit am stärksten, wenn die globale Politik vorrangig von ökonomischen Interessen geleitet wird, eine Konstellation, in die sich die CO2bedrohten kleinen Länder zu fügen scheinen. Global wird eine demokratische Klimapolitik deshalb nicht die Sprengkraft entwickeln, die sich die Kosmopoliten – und generell viele Europäer – überwiegend wünschen. Demokratische Hoffnungen gelten häufig auch der lokalen Politik, soweit sie von lokalen NGOs getragen wird. NGOs, nichtstaatliche Interessengruppierungen, lassen sich nicht pauschal als demokratisch förderlich einstufen, und das nicht nur, weil sie teilweise eher ökonomische Effektivität als politische Ziele verfolgen (Worldbank, WTO). Ein großer Teil 7 der kleinen NGOs, vor allem in Drittweltländern, versteht sich als Vertreter moralischer und nicht politischer Ziele. Das ist für diejenigen NGOs plausibel, die in demokratisch unterentwickelten Staaten in Opposition zur gewählten Regierung stehen und ihre Ziele den staatlichen Zielen entgegensetzen oder mindestens nicht unterordnen können. Dennoch tragen Staaten und deren Repräsentanten häufig (selbst im undemokratischen Fall) deutlich politischere Züge als NGOs. NGOs sind keiner Gesamtbevölkerung rechenschaftspflichtig und nicht prozedural legitimiert. Es verwundert deshalb nicht, dass die politische Funktion von NGOs in der Realität stark korreliert mit den politischen Verhältnissen, in denen sich ein Land befindet. 12 Während sie in oligarchischen Staaten Kontrollfunktionen gegenüber Regierungen übernehmen können oder in ungefestigt demokratischen Staaten eine die Demokratie unterstützende Funktion, sind sie in neoliberal ausgerichteten Entwicklungen auch als Sekundanten Demokratie blockierender Kräfte wirksam. NGOs sind immer Teil der Kultur, in der sie entstehen, ethnische Konflikte finden sich in ihnen ebenso wieder wie in der Gesellschaft. Manche ihrer charismatischen Führer fordern Gefolgschaft und keineswegs demokratische Partizipation. Freilich: Wären nicht sozialliberale NGOs, getragen von einem Ethos der Menschenrechte, von diesen Tendenzen gefeit? In der Theorie ja, in der Praxis erklärt hingegen ihre mangelnde politische Konstitution ihre Tendenz, entweder in einer kosmopolitischen Protesthaltung zu gerinnen oder sich der neoliberalen Dienstbarkeit zu unterwerfen. Moral und Ökonomie sind die externen Alternativen zur Politik, und wenn sich lokale Bewegungen nicht klar mit einem politischen Programm verbinden, bleiben sie auf die eine oder andere Weise in einer der Demokratie hinderlichen moralischen oder ökonomischen Sackgasse stecken. Positiv gewendet heißt das auch, dass im Fall des Konflikts zwischen einer entstehenden Demokratie und Menschenrechten die Demokratie wichtiger ist als die Menschenrechte. Blickt man auf die nicht-westlichen Staaten nicht unter dem speziellen Ideal der europäischen Synthese von Demokratie und Menschenrechten, kann man sich in einem solchen Konflikt (etwa angesichts Chinas) zwischen Demokratie und Menschenrechten entscheiden, und es ist klar, dass dann die politische Perspektive vor den unrealistischen Mahnungen der Menschenrechte den Vorzug haben sollte. Autor Anton Leist, Jg. 1947, Studium der Philosophie, Soziologie und Germanistik in München und Frankfurt. Professor für Ethik an der Universität Zürich und Leiter der Arbeits- und Forschungsstelle für Ethik. Schwerpunkte ökologische Ethik, ökologische Demokratie. EMail: [email protected] Anmerkungen 8 1 Ebenso gilt das für viele andere globale Umweltprobleme, wie den Verlust an Biodiversität, die Folgen des internationalen Giftmülltransports, die Verschmutzung der Meere und die Überfischung. Der Klimawandel hat bereits jetzt zahlreiche lokale Probleme zur Folge, wie Wasserknappheit und Bodenerosion. Manche lokalen Probleme sind die Folge des global wirksamen Drucks auf nationale Ökonomien, insbesondere auf die Landwirtschaft in Drittweltländern. 2 Die Zahlen gelten für 2005. Sie sind kaufkraftbereinigt, berücksichtigen aber nicht die bestehenden Vermögen, wodurch sich die Asymmetrie noch erhöht. 3 Shue, Henry (1999): Global Environment and International Inequality, in: International Affairs 75, pp. 531–545; Pogge, Thomas (2002): World Poverty and Human Rights, Cambridge. – Ein „Recht“ auf ein soziales Minimum geht über das übliche Verständnis der freiwilligen Welthungerhilfe hinaus, insofern es eine längerfristige und einklagbare Verbindlichkeit darstellt und nicht mehr freiwillig ist. 4 Zur ersten Gruppe gehören Joshua Cohen, Ulrich Beck, Charles Beitz, Sheila Benhabib, Nancy Fraser, Jürgen Habermas, David Held, Martha Nussbaum und Peter Singer. Zur zweiten Gruppe gehören eine Reihe weiterer angelsächsischer Philosophen wie John Rawls, Samuel Freedman, David Miller, Thomas Nagel, Leif Wenar und Michael Walzer. 5 Zur Bedeutung der antiken Stoiker für Kants Konzeption der Menschenwürde und für sein Ideal des Weltbürgertums – beides bis heute wirkungsmächtige Visionen – vgl.: Nussbaum, Martha (1997): Kant and Stoic Cosmopolitanism. In: Journal of Political Philosophy 5, pp. 1–25 6 Für eine detailliertere Kritik an Pogge siehe auch Hayward, Tim (2005): Thomas Pogge’s Global Resources Dividend: A Critique and an Alternative. In: Journal of Moral Philosophy 2, pp. 299–314; (2008): On the Nature of Our Debt to the Global Poor. In: Journal of Social Philosophy 39, pp. 1–19 7 Dabei folge ich: Miller, David (2009): Justice and Boundaries. In: Politics, Philosophy & Economics 8, pp. 291–309 8 Mouffe, Chantal (2000): The Democratic Paradox, London (Kap. 4); (2007): Über das Politische. Wider die kosmopolitische Illusion, Frankfurt (Kap. 2); (2005): Eine kosmopolitische oder eine multipolare Weltordnung? In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 53, S. 69–82 9 Siehe auch die ausführlichere Diskussion bei Chandler, David (2003): New Rights for Old? Cosmopolitan Citizenship and the Critique of State Souvereignity. In: Political Studies 51, pp. 332–349 10 Der erhebliche Widerstand, den die EU-Bürger der Verlagerung von nationalen Kompetenzen auf die EU-Bürokratie entgegensetzen, wird in der geringen Wahlbeteiligung zu EU-Wahlen wie in der einzelstaatlichen Ablehnung der EU-Verfassung deutlich. Ohne eine Top-down-Politik wäre die europäische Einigung nicht durchführbar, so, wie sie realisiert wird, ist sie nicht ausreichend demokratisch. Siehe auch Dahl, Ronald (1999): Can International Organizations be Democratic? A Skeptic’s View. In: I. Shapiro/C. HackerCordon (eds.): Democracy’s Edges. Cambridge. 11 Das aktuelle Versagen hat der Kopenhagen-Gipfel 2009 demonstriert. Siehe Dimitrov, Radoslav (2010): Inside Copenhagen: The State of Climate Governance. In: Global Environmental Politics 10, pp. 18–24. – Aufgrund der Nichtbeteiligung der USA, Chinas, Indiens und Brasiliens wurde nicht einmal der minimalistische Vertrag über die 2-GradGrenze realisiert. Bereits die Erwärmung von weniger als 2 Grad wird eine Vielzahl von 9 Staaten in der nahen Zukunft schlechter stellen als andere, umso mehr die erwartbare Erwärmung von 4 bis 7 Grad. Siehe zu Kopenhagen auch die Beiträge in der Zeitschrift Capitalism, Nature, Socialism 21, Heft 1, 2010. 12 Für einen Überblick: Mercer, Claire (2002): NGOs, Civil Society and Democratization: a Critical Review of the Literature. Ín: Development Studies 2, pp. 5–22.