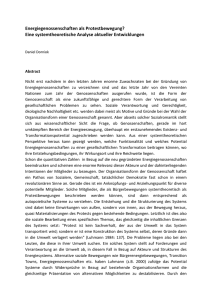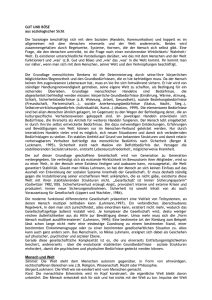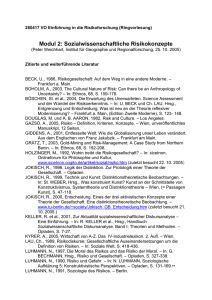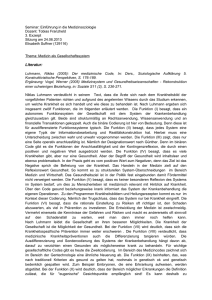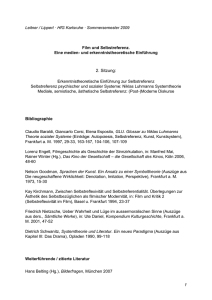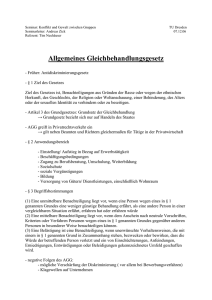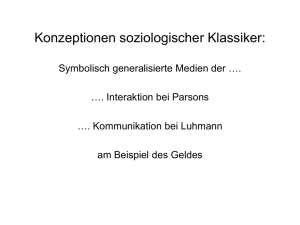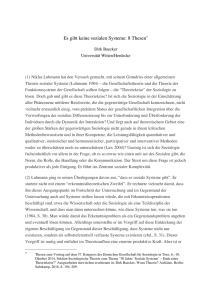Heiner Sameisky Soziale Arbeit als Funktionssystem!? Über die
Werbung
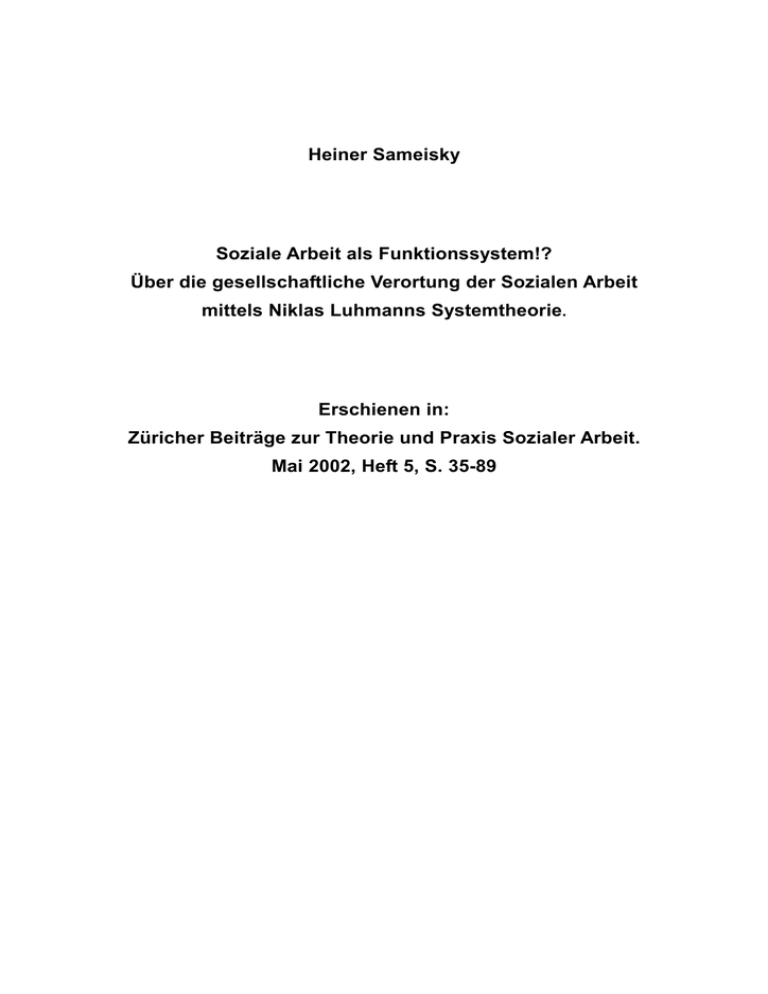
Heiner Sameisky Soziale Arbeit als Funktionssystem!? Über die gesellschaftliche Verortung der Sozialen Arbeit mittels Niklas Luhmanns Systemtheorie. Erschienen in: Züricher Beiträge zur Theorie und Praxis Sozialer Arbeit. Mai 2002, Heft 5, S. 35-89 1. Prolog In den letzten Jahrzehnten konnte Soziale Arbeit ein enormes Wachstum in quantitativer und qualitativer Hinsicht verzeichnen. Doch ungeachtet ihrer gewachsenen gesellschaftlichen Bedeutung steht eine einheitliche theoretische Bestimmung der disziplinären bzw. professionellen Identität der Sozialen Arbeit bislang aus. Von Zeit zu Zeit tritt jemand auf den Plan, diesem – zuvor als Missstand deklarierten – Umstand abzuhelfen. Immer häufiger werden hierzu auch systemtheoretische Konzepte herangezogen.1 Auch die Systemtheorie Luhmannscher Provenienz wurde in den letzten Jahren mit wachsender Aufmerksamkeit bedacht. Dies ist nicht zuletzt auf die These zurückzuführen, Soziale Arbeit habe sich als gesellschaftliches Funktionssystem ausdifferenziert (vgl. Baecker 1994). Danach kommt Sozialer Arbeit die gesellschaftsweite Aufgabe zu, die wachsenden Exklusionsfolgen der modernen Gesellschaft zu bearbeiten. Die vorliegende Arbeit zeichnet die Argumentation dieser These nach und überprüft im Anschluss die Tragfähigkeit des zugrundeliegenden systemtheoretischen Unterbaus. Parallel zur Expansion der Beschäftigtenzahlen im sozialen Sektor hat sich die Bandbreite der Angebots- und Interventionsformen, die von SozialarbeiterInnen durchgeführt werden, erhöht (vgl. Rauschenbach 1999). Zu den klassischen Arbeitsfeldern Armut, Obdachlosigkeit, Abweichung und gesellschaftliche Integration sind andere Bereiche hinzugetreten, die das Spektrum der sozialarbeiterischen Tätigkeiten erweitern. Heutzutage befassen sich SozialarbeiterInnen auch mit „Formen der Scheidungsmoderation, Gewaltprävention, feministischer Mädchenbildung oder Beratung von Migranten“ (Bommes & Scherr 1996; S. 107) Ein Großteil dieser Tätigkeiten überschneidet sich mit den Kompetenzbereichen anderer – wesentlich spezialisierterer – Berufsgruppen wie PsychologInnen, LehrerInnen, etc. Im Gegensatz zu diesen können SozialarbeiterInnen gegenüber Außenstehenden nicht hinreichend deutlich machen, was ihre spezifische Kompetenz darstellt, so dass der Eindruck entsteht, eigentlich könne jedeR andere deren Aufgaben ebenso gut oder besser erfüllen. Eine Befragung unter StudentInnen der Sozialen Arbeit zur Besonderheit ihres Berufsstandes führte zum Ergebnis, dass es im Grunde keine für Soziale Arbeit spezifischen Eigenschaften gibt, die nicht auch andere Professionen für sich geltend machen würden (vgl. Kunstreich 1997; S. 7). Die Soziale Arbeit lässt sich also weder im Hinblick auf ein abgeschlossenes Tätigkeitsfeld noch auf spezifische Tätigkeitsmerkmale verorten. Charakteristisch für die Soziale Arbeit, so könnte man die Not zur Tugend wenden, scheint allein ihre „diffuse Allzuständigkeit für »soziale Probleme« zu sein“ (Bommes & Scherr 1996; S. 107) sowie das Fehlen eines einheitlichen Bezugsrahmens, was sich auch im Fehlen einer allgemeinen Theorie der Sozialen Arbeit – zugunsten eines eher eklektizistischen Gebrauchs unterschiedlicher theoreti- 1 Für eine Übersicht über systemische und systemtheoretische Konzepte in der Sozialen Arbeit vgl. Staub-Bernasconi 1995; S. 117-140 & 1998 S. 516-523 scher Versatzstücke – niederschlägt. Das muss kein Nachteil sein. Den wechselnden Anforderungen der sozialarbeiterischen Praxis werden eine Vielzahl von Theorien kleiner bis mittlerer Reichweite eher gerecht als eine einzige umfassende Theorie. Im Hinblick auf das Problem der professionellen Identität erscheint diese Schlußfolgerung allerdings halbherzig und unbefriedigend. Einen anderen Zugang zur Frage nach dem Gegenstandsbereich der Sozialen Arbeit schlägt Timm Kunstreich vor: Es sei „nicht die ‚Eigenschaft‘“, die das Besondere ist, „sondern der Kontext, in dem die ‚Eigenschaft‘ eine Rolle spielt“ (Kunstreich 1997; S. 8). Dementsprechend wäre „die Besonderheit Sozialer Arbeit in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung (Funktion) zu suchen“ (ebd.) Aus dieser Perspektive geraten weniger „die einzelnen Tätigkeiten (oder deren Merkmale)“ (ebd.) in den Blickpunkt, sondern „die Professionellen der Sozialen Arbeit als eine gesellschaftliche Gruppe und deren Einbindung in das gesellschaftliche System.“ (ebd.) Sieht man einmal von dem Umstand ab, dass Luhmann soziale Systeme nicht einfach als „Gruppe von Individuen“ fasst (vgl. Kap. 2), scheint dessen Systemtheorie prädestiniert dafür zu sein, Soziale Arbeit im o.g. Sinne zu bestimmen. Luhmann hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine universelle Theorie der Gesellschaft zu konzipieren, die den gesamten Bereich des Sozialen, also auch die Soziale Arbeit, innerhalb eines einheitlichen Begriffssystems zu beschreiben imstande ist (vgl. Luhmann 1987; S. 163). Soziale Arbeit könnte demnach, vorausgesetzt die eingangs genannte These trifft zu, mit den gleichen begrifflichen Werkzeugen beschrieben werden, wie jedes andere Funktionssystem. Dieser Umstand hat sicherlich dazu beigetragen, dass die ursprünglich von Dirk Baecker (1994) eingebrachte These, Soziale Arbeit habe sich als gesellschaftliches Funktionssystem ausdifferenziert, zunehmende Akzeptanz erfährt (vgl. Fuchs & Schneider 1995; Kleve 1997, 1999a & b) – bis hin zur Empfehlung, der Sozialen Arbeit „das systemtheoretische Denken Luhmannscher Provenienz als sozialwissenschaftliches Theoriewerkzeug zur Seite“ (Kleve 1999b; S. 380) zu stellen. Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist die Frage, inwieweit eine systemtheoretische Bestimmung der Sozialen Arbeit auf der Basis Luhmannscher Konzepte tragfähig ist. Um dies zu beantworten, fasst sie zunächst die Grundannahmen der Luhmannschen Theorie sozialer Systeme und deren gesellschaftstheoretische Implikationen zusammen. Das darauffolgende Kapitel stellt die These, Soziale Arbeit sei ein gesellschaftliches Funktionssystem, vor. Dabei liegt der Schwerpunkt zunächst darin, die Schlussfolgerungen nachvollziehbar darzustellen und sich möglichst dicht entlang der Argumentationslinien Luhmannscher Theorie zu bewegen. Die Komplexität dieser Theoriegrundlage zwingt zu einer weitgehend immanenten Herangehensweise, will man nicht grundsätzliche Fragestellungen aufwerfen, die den Rahmen dieser Textes sprengen würden. Erst das vierten Kapitel wagt den Schritt aus dem geschlossenen Theoriegebäude heraus, und versucht exemplarisch einige Widersprüche und Erklärungslücken der Luhmannschen Theorie aufzuzeigen.. 2. Systemtheorie – ein neues gesellschaftstheoretisches Paradigma Unzufrieden mit dem gegenwärtigen Zustand der soziologischen Disziplin, war es Luhmanns Anliegen, eine fachuniversale Theorie der Soziologie zu entwerfen, die auf alle gesellschaftlichen Phänomene anwendbar ist. Dreißig Jahre hatte er für deren Realisierung veranschlagt (vgl. Luhmann 1997; S. 11). Im Laufe dieser Zeit hat Luhmann seine Theorie in mehr als 40 Büchern und unzähligen Aufsätzen veröffentlicht. Luhmanns Œuvre gilt, wie die Menge der angebotenen Einführungsliteratur eindrucksvoll belegt,2 als schwer zugänglich. Leider entspricht es meiner Erfahrung, dass der Umfang der Theorie, deren redundante Präsentation und nicht zuletzt deren stilistische Extravaganzen sich effektiv jedem Versuch widersetzen, Außenstehenden gewisse Anlaufschwierigkeiten zu ersparen. Luhmann hat ein in sich geschlossenes Denk- und Begriffssystem aufgestellt, das in vielfacher Hinsicht traditionelle soziologische Sichtweisen des Sozialen auf den Kopf stellt, und auch mit dem Alltagsverständnis vom Sozialen alles andere als kompatibel ist. Neulinge stehen deshalb vor dem Paradoxon, dass man eigentlich bereits das Ganze nachvollzogen haben muss, um einzelne Teile verstehen zu können. Eine nicht unübliche Empfehlung an Außenstehende lautet deshalb, zunächst 300 – 500 Seiten (vgl. Reese-Schäfer 1992; S. 13) zu lesen, bis sich nach und nach – bei der weiteren Lektüre – ein Verständnis der Theorie einstellt. Diese Arbeit muss – allein aufgrund ihres vergleichsweise geringen Umfangs – mit dem Umstand leben, nicht alles sagen zu können, was gesagt werden müsste. Sie reißt an, und beschäftigt sich schon mit etwas anderem. Damit setzt auch sie voraus, was eigentlich ihr Gegenstand sein sollte. Sie führt nicht in die Grundlagen der Luhmannschen Theorie ein, sondern wirft lediglich einige Schlaglichter auf Schlüsselbegriffe, die den Paradigmenwechsel verdeutlichen sollen, den Luhmann beansprucht. Das Ziel ist weniger Klarheit, als vielmehr ausreichend Irritationen zu erzeugen, um den/die LeserIn davor zu bewahren, Luhmanns Terminologie zu assimilieren, ohne die Brüche mit traditionellen Denkgewohnheiten zu bemerken, die diese Theorie fordert. 2.1. Die Theorie sozialer Systeme Von Anfang an beschäftigte Luhmann sich mit systemtheoretischen Konzepten, um soziale Phänomene beschreiben zu können. Dabei sind Systeme allgemein das, „worauf die Unterscheidung von innen (System) und außen (Umwelt) anwendbar ist“ (Krause 1996; S. 161). Im Gegensatz zur Auffassung der allgemeinen Systemtheorie betrachtet Luhmann Systeme jedoch nicht als lediglich beobachterabhängige Erfindungen, sondern als ‚soziale Fakten‘. Luhmann geht „davon aus, daß es [die HS] Systeme gibt“ (Luhmann 1996b; S. 30), die mit dem Systembegriff bezeichnet werden, und „läßt sich damit auf eine Verantwortung für Bewährung seiner Aussagen an der Wirklichkeit ein.“ (ebd.) 2 Mir liegen allein 6 Werke dieser Gattung vor (Baraldi & Corsi & Esposito 1998; Fuchs 1993; Gripp-Hagelstange 1995; Kneer & Nassehi1997; Krause 1996; Reese-Schäfer 1992) Der von Luhmann verwendete Systembegriff hat eine Reihe von konzeptuellen Veränderungen erfahren, bevor seine Systemtheorie in ihrer bis heute aktuellen Ausprägung Gestalt annehmen konnte. Als Wendepunkt gilt die Übertragung des Konzeptes der Autopoiesis auf die Theorie sozialer Systeme. Diese wurde im Jahre 1984 mit der Veröffentlichung des Werkes „Soziale Systeme“ der Fachöffentlichkeit vorgestellt, und legte den Grundstein für seine später ausgearbeitete Gesellschaftstheorie, auf die sich auch die vorliegende Arbeit bezieht. Für Luhmann stellten alle vorherigen Veröffentlichungen lediglich „Null-Serie der Theorieproduktion“ (Luhmann 1985a; S. 142) dar. Um den Paradigmenwechsel zu verdeutlichen, der von Luhmann reklamiert wird, werde ich zunächst das Autopoiesiskonzept und seine Anwendung in der Theorie sozialer Systeme vorstellen. Flankierend werden die Begriffe Kommunikation und Sinn eingeführt, die durch Luhmann eine eigenwillige, kontraintuitive Interpretation erfahren haben und deshalb häufig Missverständnisse provozieren. Weder das Autopoiesiskonzept noch die späteren Ausführungen zur Theorie der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Verortung der Sozialen Arbeit sind ohne ein Verständnis der Luhmannschen Konzeption dieser Begriffe nachvollziehbar. 2.1.1. Autopoiesis Der Begriff Autopoiesis wurde ursprünglich von Humberto Maturana und Francisco Varela, zwei chilenischen Neurobiologen, als Antwort auf das Problem der eindeutigen Unterscheidung lebender von nicht-lebenden Systeme eingeführt. Demnach sind lebende Systeme gekennzeichnet durch ein spezifisches Organisationsprinzip: Autopoiesis (griech. autos = selbst; poiesis = Schöpfung, Dichtung). Dieses bedeutet zweierlei: (a) Lebende Systeme erzeugen und erhalten sich selbst, indem sie unter Beibehaltung ihrer autopoietischen Organisation rekursiv ihre Elemente produzieren und reproduzieren.3 (b) Indem lebende Systeme dieses tun, konstituieren sie sich selbst als eine Einheit mit einer spezifischen Grenze zur Umwelt (bspw. Zellmembran), die selbst ein Element des Systems ist (vgl. Maturana & Varela 1987). Während die autopoietische Organisation allen Lebewesen gemein ist, unterscheiden sich die konkreten Relationen der Elemente, durch die die Einheit des Systems und deren Autopoiesis realisiert werden. Diese spezifischen Relationen der Elemente bezeichnen Maturana und Varela als Struktur. Die Autopoiesis kann sich, analog zur Vielzahl unterschiedlicher Lebewesen, in unzähligen Strukturen realisieren. Im Gegensatz zur Organisation, deren Auflösung mit dem Tod eines Lebewesens koinzidiert, kann sich die Struktur eines Lebewesens auch ändern. Lebende Systeme sind „organisationsinvariante und zugleich strukturveränderbare Systeme.“ (Kneer & Nassehi 1997; S. 50) 3 Sie erzeugen sich selbst, im Gegensatz zu bspw. Kaffeemaschinen, die Kaffee produzieren, und sie erhalten sich selbst, im Gegensatz zu bspw. Autos, die sich nicht selbst warten und reparieren können. Nach Maturana und Varela sind lebende Systeme geschlossene Systeme, weil sie ausschließlich selbstreferenziell operieren. Die jeweilige Struktur legt fest, welche Systemoperationen zu einem gegebenen Zeitpunkt möglich sind. Systemoperationen schließen immer an vorhergehende Systemoperationen an. Lebende Systeme sind strukturgekoppelt in dem Sinne, dass Veränderungen stets auf die gegebene Struktur aufsetzen müssen. So gesehen gibt es keine Umweltdetermination, sondern nur Strukturdetermination. Die Geschlossenheit bezieht sich auf diesen Umstand der Autonomie (griech. autos = selbst; nomos = Gesetz) lebender Systeme hinsichtlich ihrer Operationen. Gleichzeitig sind Lebewesen darauf angewiesen, Nahrung, Sauerstoff etc. aus ihrer Umwelt aufzunehmen. Geschlossenheit meint also nicht Autarkie (griech. autos = selbst; arkein = ausreichen, genügen). Luhmann hat das Konzept der Autopoiesis generalisiert und in direkter Weise auf psychische Systeme (Luhmanns Umschreibung dessen, was gemeinhin als Bewusstsein bezeichnet wird) und soziale Systeme (Interaktionen, Organisationen und Gesellschaft) übertragen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Soziale oder das Bewusstsein als biologischer Organismus (miss-)zuverstehen sind, sondern bezieht sich ausschließlich auf deren gemeinsame Organisationsform: lebende, psychische und soziale Systeme bringen ihre Autopoiesis auf eine jeweils eigene Weise zustande und bestehen aus unterschiedlichen Elementen. Psychische Systeme konstituieren sich durch Gedanken und soziale Systeme durch Kommunikationen. Genau wie lebende Systeme sind auch psychische und soziale Systeme autonom in ihren Operationen, also ausschließlich strukturell aneinander gekoppelt. Dies wird allein schon daraus deutlich, dass ihre Letztelemente – Gedanken bzw. Kommunikationen – jeweils exklusiv in diesen Systemen vorkommen. Gedanken können nicht zum Gegenstand von Operationen sozialer Systeme werden und Kommunikationen können nicht als Operationen psychischer Systeme betrachtet werden (vgl. Kap. 2.1.3). Umweltereignisse werden ausschließlich gemäß der Struktur des Systems beobachtet und können Veränderungen in dessen Struktur anregen, nicht aber verursachen. Dies ist besonders schwierig nachzuvollziehen, da wir gewohnt sind, die Welt kausal zu beschreiben.4 Für einen Außenstehenden mag es so aussehen, als ob ein System auf ein anderes reagiert. Es besteht jedoch ein grundlegender Unterschied zwischen der Beschreibung von aufeinander bezogenen Umweltereignissen durch einen Beobachter und der Art und Weise, wie diese Ereignisse autonom von den beteiligten Systemen bearbeitet werden. Durch die Generalisierung des Autopoiesiskonzeptes ist es Luhmann gelungen, eine Theorie zu formulieren, die soziale Phänomene als autonom von individuellem Handeln beschreibt. Er beobachtet das Soziale nicht als Summe handelnder oder kommunizierender Menschen, sondern als operativ geschlossenes System von Kommunikationen. Individuen sind demnach nicht die konstituierenden Elemente sozialer Systeme, sondern in deren Umwelt verortet. 4 Diese Weltsicht bezeichnet Luhmann als ‚alteuropäisches Denken‘ Um dies zu plausibilisieren, sollen im folgenden die Begriffe Sinn und Kommunikation komplementär zu den vorangegangenen Ausführungen erläutert werden. Beide Begriffe korrespondieren mit bislang offenen Erklärungslücken. Im Falle von Sinn geht es um die Frage, auf welche Weise sich psychische und soziale Systeme – analog zu lebenden Organismen – durch eigene Operationen gegenüber ihrer Umwelt abgrenzen. Anhand von Kommunikation soll dargestellt werden, inwieweit psychische und soziale Systeme, trotz ihrer Autonomie, wechselseitig füreinander Bestandsvoraussetzung sind. Nebenbei illustrieren beide Begriffe eindrucksvoll, wie die Luhmannsche Theorie alltäglichen Begriffen neue Bedeutungen zuweist und damit selbst das vollzieht, was ihr Gegenstand ist: Sie schränkt die Möglichkeit dessen ein, was innerhalb der Grenzen der Theorie kommuniziert werden kann und wird sich so selbst zum Beispiel.5 2.1.2. Sinn Soziale Systeme sind etwas anderes als der Raum, in dem kommuniziert wird, und psychische Systeme sind nicht identisch mit dem Gehirn, welches lediglich Umwelt für Gedanken ist. Während lebende Systeme als Organismen eine materielle Grenze im Raum ziehen, die sie deutlich von ihrer Umwelt unterscheidet, müssen psychische und soziale Systeme sich in Form einer Unterscheidung von der Umwelt selbst beobachten können (vgl. Luhmann 1997; S. 45). Hier setzt Luhmanns Sinnbegriff an: „die Grenzen des Systems zur Umwelt werden im Medium des Sinns gezogen. [...] Im Fall sozialer und psychischer Systeme spricht man deswegen von Sinngrenzen.“ (Baraldi & Corsi & Esposito 1998; S. 172) Gewöhnlich bezeichnet man mit Sinn zwei unterschiedliche Sachverhalte: erstens einen bestimmten Zweck oder ein Ziel (etwas sinnvolles tun) bzw. eine Wertkategorie (Sinn des Lebens). Zweitens kann Sinn auch als Äquivalent für Bedeutung angebracht werden (etwas hat einen Sinn). Im allgemeinen wird angenommen, dass Sinn jeweils subjektgebunden ist. Sinn wird als eine Operation des Bewusstseins verstanden. Es überrascht nicht, dass Luhmann eine andere Auffassung vertritt: Sowohl psychische Systeme als auch soziale Systeme operieren über das Medium Sinn und es besteht keine Kopplung von Sinn an Bewusstseinssysteme als deren ‚Träger‘ (vgl. Luhmann 1996b; S. 141). Luhmanns Sinnkategorie entspricht am ehesten der zweiten Verwendung im Sinne von Bedeutung. Abstrakt formuliert ist Sinn „die Einheit der Differenz von Aktualität und Possibilität des in Sinnsystemen möglichen sinnhaften Erlebens und Handelns.“ (Krause 1996; S. 154) Possibilität bezeichnet die Tatsache, dass es „keine von der Realität des faktischen Erlebens und Kommunizierens abgehobene“ (Luhmann 1997; S. 44) Weltqualität gibt. Luhmann begreift „die Welt nicht mehr als Gesamtheit der Dinge und ihrer Beziehungen [...], sondern als das Unbeobachtbare schlechthin“ (ebd.; S. 57), dessen Komplexität die Möglichkeit bewussten Erlebens weit übersteigt. „Die Welt ist ein unermeßliches Potential für Überra- 5 Eine Theorie der Gesellschaft muss, nach Luhmann, immer auch sich selbst als Teil der Gesellschaft berücksichtigen (vgl. Luhmann 1997; S. 17). schungen, ist virtuelle Information, die aber Systeme benötigt, um Informationen zu erzeugen, oder genauer: um ausgewählten Irritationen den Sinn von Informationen zu geben.“ (ebd.; S. 46) Aktualität meint demnach die systeminterne Erzeugung von Information im Rahmen selektiv prozessierter Weltkomplexität. Sinn ist nicht mehr und nicht weniger als eine Selektionshilfe, die festlegt, was innerhalb der Grenzen eines Systems möglich ist und was nicht. „Ein sinnkonstituierendes System ist eine Ordnung, die selektiv gegenüber anderen Möglichkeiten offen ist.“ (Baraldi & Corsi & Esposito 1998; S. 171) Dabei kommt Sinn ausschließlich systemintern als Korrelat der Sinn benutzenden Operationen vor (vgl. Luhmann 1997; S. 44). Psychische und soziale Systeme sind aufgrund der nicht simultan zu bewältigenden Weltkomplexität darauf angewiesen, selektiv und damit sinnhaft zu operieren. Sie konstituieren die Grenze zwischen sich und der Umwelt autonom, indem sie ihre Operationen an der Unterscheidung von Aktualität und Possibilität orientieren oder – um den Kreis zu schließen – indem sie ihre Autopoiesis realisieren. Insofern ist Sinn eine differenzlose Kategorie: Es kann nicht Nicht-Sinn geben. 2.1.3. Kommunikation Üblicherweise wird unter Kommunikation die Übertragung einer Nachricht (Information) zwischen einem (Ab-)Sender und einem Empfänger verstanden (vgl. Luhmann 1996b; S. 193). Der Gebrauch der Übertragungsmetapher für Kommunikation ist jedoch im Hinblick auf die Geschlossenheit psychischer Systeme problematisch, weil sie Information vergegenständlicht und deshalb außer acht lässt, dass eine Information „für Absender und Empfänger“, entsprechend ihres Selektionshorizontes, „sehr verschiedenes bedeutet.“ (ebd.; S. 194) Die „Identität dessen, was »übertragen« wird“ (ebd.), ist nach Luhmann weder durch die „inhaltliche Qualität der Information“ (ebd.), noch durch reziproke Verhaltensabstimmung gewährleistet, sondern ist das Resultat eines eigenständigen Kommunikationsgeschehens. Die Überwindung der doppelten Kontingenz durch Koordination der Selektionshorizonte von Bewusstseinssystemen setzt Kommunikation immer schon voraus, und ist zugleich Bedingung für Kommunikation. Luhmann versteht Kommunikation als die Synthese (Einheit) von drei kontingenten Selektionen: Im einfachsten Fall (zwei psychische Systeme) wählt A eine im Rahmen seines Selektionshorizontes denkbare Information aus und entschließt sich, diese tatsächlich durch ein spezifisches Verhalten mitzuteilen. Kommunikation kommt jedoch erst dadurch zustande, dass B entsprechend der Form der Mitteilung und innerhalb seiner eigenen Sinngrenzen versteht6, dass A ihm eine Information mitgeteilt hat. Nimmt B die Selektionsofferte des A an, und vollzieht die Unterscheidung, die notwendig ist, um aus der Mitteilung wiederum eine Information zu generieren, wird aus der bloßen Beobachtung eines Verhaltens eine 6 Verstehen meint in diesem Zusammenhang nicht die Befürwortung einer Äußerung, sondern lediglich den Vollzug der Unter- scheidung von Information und Mitteilung. inhaltliche Äußerung. Damit hat B die Mitteilung verstanden und kann seinerseits eine weitere Mitteilung (Selektionsofferte) daran anschließen oder dies unterlassen. Kommunikation ist ein eigenständiges Geschehen, weil erst die Einheit von Information, Mitteilung und Verstehen einen Kommunikationsakt abschließt, an den dann weitere Kommunikationen angeschlossen werden können – solange, bis der Kommunikationsprozess unterbrochen wird. Insofern kann Kommunikation nicht auf die Bewusstseinsoperationen und Handlungen eines einzelnen Individuums reduziert werden. „Das Kommunikationssystem ist [...] zwangsläufig auf sich selbst gestellt, es kann sich nur selbst dirigieren; und es kann dies, sofern es ihm nur gelingt, in seiner Umwelt das dafür notwendige Bewußtseinsmaterial zu aktivieren.“ (Luhmann 1997; S. 115) Dazu muss das Zustandekommen von Kommunikation in einer Weise erwartbar sein, die psychische Systeme motiviert, Kommunikation zu wagen und sich damit auf vorangegangene Kommunikation zu beziehen. Im Gegensatz zu dem auf Austausch von Informationen beruhenden zweistufigen Kommunikationsmodell macht Luhmanns dreistufiges Modell deutlich, welche komplexen Entwicklungen stattgefunden haben müssen, damit Kommunikation überhaupt zustande kommen konnte. Denn die für Kommunikation erforderliche Koordination von Selektivität erscheint unter der Bedingung der operativen Geschlossenheit psychischer Systeme „extrem unwahrscheinlich.“ (ebd.; S. 190) Dies entspricht nicht unserer Erfahrung. Wenn wir schon nicht kommunizieren können, so nehmen wir doch ständig an Kommunikation teil und gewöhnlich verläuft diese so reibungslos, dass man meinen könnte, es handele sich lediglich um Austausch von Informationen. Angesichts der hier skizzierten Problematik stellt sich jedoch die Frage, „wie dieses Normalfunktionieren überhaupt möglich ist.“ (Luhmann 1996b; S. 217) Luhmann weist drei Ebenen der Unwahrscheinlichkeit aus, denen jeweils unterschiedliche Kommunikationsmedien begegnen, die sich im Laufe der gemeinsamen Evolution (vgl. Kap. 1.2.2) von psychischen und sozialen Systemen entwickelt haben. Kommunikationsmedien sind selbst evolutionäre Errungenschaften, die das Normalfunktionieren von Kommunikation ermöglichen, indem sie „Unwahrscheinliches in Wahrscheinliches [...] transformieren.“ (Luhmann 1996b; S. 220) Zunächst einmal ist es auf der Ebene von Interaktionen unwahrscheinlich, dass B überhaupt versteht, was A meint, denn Kommunikation setzt koordinierte Selektivität immer schon voraus, und zwar, wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt wurde, „im Hinblick auf Weltsachverhalte, die kontingent, also auch anders möglich sind.“ (ebd.; S. 217) Wie ist es dann möglich, sich kommunikativ auf Sachverhalte zu beziehen, die außerhalb der unmittelbar geteilten Wahrnehmung liegen? Hier setzt das Medium Sprache an, indem es erlaubt, auch zukünftige oder vergangene sowie räumlich getrennte Ereignisse zu thematisieren. „Die zweite Unwahrscheinlichkeit bezieht sich auf das Erreichen von Adressaten“ (ebd.; S. 218) für Kommunikation über den raum-zeitlichen Zusammenhang eines spezifischen Interaktionssystems hinaus. Es geht darum, wie Kommunikation, die jeweils in einer sozialen Situation stattfindet, gegenüber Nichtanwesenden zu einem späteren Zeitpunkt und/oder an einem anderen Ort reproduziert werden kann. Diese „Befreiung [der Kommunikation HS] von sachlichen, zeitlichen und räumlichen sowie sozialen Beschränkungen“ (Krause 1996; S. 152) ist erst durch die Entstehung von Schrift und – darauf aufbauend – Verbreitungsmedien wie Buchdruck und Massenmedien möglich geworden. Selbst wenn die ersten beiden Hürden genommen sind, bedeutet dies nicht, „daß sie [die Kommunikation HS] auch angenommen und befolgt wird.“ (Luhmann 1996b; S. 218) Im Gegenteil: Die Chancen für die Annahme von Kommunikation nehmen ab, je mehr Sprache ein differenziertes Verstehen von Kommunikation ermöglicht und je weniger Kommunikation auf einen Kontext, „die Deutungshilfe“ und den „Annahmedruck der konkreten Interaktion“ (ebd.; S. 219) zurückgreifen kann. Kommunikation annehmen bedeutet, „den selektiven Inhalt der Kommunikation (die Information) als Prämisse eigenen Verhaltens“ (ebd.; S. 218) zu übernehmen und die entsprechende Information als weiteren Ausgangspunkt von Handlungen, Informationsverarbeitungen und Denken zu übernehmen. Nur so kann Kommunikation sich fortlaufend selbst reproduzieren. Damit trotz dieser Unsicherheit „Kommunikation gewagt werden kann und nicht von vornherein als hoffnungslos unterlassen wird“ (Luhmann 1996a; S. 21) muss die „Annahmebereitschaft für Kommunikation“ (ebd.) erhöht werden. Andernfalls kämen soziale Systeme nicht zustande. Diese Funktion übernehmen die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien, beispielsweise „Wahrheit, Liebe, Eigentum/Geld, Macht/Recht“ (Luhmann 1996b; S. 222). Ihre Aufgabe ist es, „die Selektion der Kommunikation so zu konditionieren, dass sie zugleich als Motivationsmittel wirken, also die Befolgung des Selektionsvorschlages hinreichend sicherstellen kann.“ (ebd.) Entsprechend ist Kommunikation, die auf diese Medien aufsetzt, vergleichsweise erfolgsversprechend. 2.2. Die Theorie der Gesellschaft Gesellschaft ist nach dem hier dargestellten Verständnis das umfassende soziale System, das alle anderen sozialen Systeme in sich einschließt. Wie alle sozialen Systeme besteht auch das Gesellschaftssystem nicht aus Individuen, sondern aus Kommunikation. Auch sind die Grenzen der Gesellschaft nicht etwa räumliche Grenzen (Staaten oder Kontinente), sondern ausschließlich Grenzen der Kommunikation (Sinngrenzen). Die Gesellschaft zieht die Grenzen der Kommunikation, indem sie die Möglichkeiten einschränkt, die in der Kommunikation erfasst werden können. Außerhalb der Gesellschaft kann es keine Kommunikation geben. Dadurch reduziert das Gesellschaftssystem – stellvertretend und bindend für alle sozialen Systeme – die zu bewältigende Komplexität. 2.2.1. Gesellschaftliche Differenzierung Nach dem im Kapitel 2.1.1 dargestellten Verständnis sind autopoietische Systeme durch eine unveränderbare Organisation (Autopoiesis) bei gleichzeitig variabler Struktur gekennzeichnet. Es geht im folgenden um die Struktur der Gesellschaft bzw. um das Verhältnis der konstituierenden Elemente (hier: Kommunikationen) zueinander. Für das Gesellschaftssys- tem wird dieses Verhältnis durch die interne Differenzierung bestimmt. Damit ist nicht die Tatsache bezeichnet, dass das Gesellschaftssystem alle anderen sozialen Systeme einschließt, sondern die Fähigkeit des Gesellschaftssystems, Subsysteme zu bilden. Systemdifferenzierung bedeutet also nicht die Zerlegung einer Einheit in mehrere Teile, sondern (innere) Differenzierung von System/Umwelt-Differenzen: „jedes Teilsystem [rekonstruiert] das umfassende System, dem es angehört und das es mitvollzieht, durch eine eigene (teilsystemspezifische) Differenz von System und Umwelt.“ (Luhmann 1997; S. 598) Die innere Differenzierung ergibt sich nicht willkürlich, sondern richtet sich entlang einer spezifischen Differenzierungsform aus (vgl. ebd.; S. 609f). Im Laufe der gesellschaftlichen Evolution haben verschiedene primäre Differenzierungsformen die gesellschaftliche Struktur geprägt, indem sie gesellschaftsweit die Art und Weise bestimmten, wie die Beziehungen zwischen den Teilsystemen realisiert werden konnten oder anders gesagt, „welche strukturellen Kopplungen im Verhältnis der Teilsysteme zueinander möglich“ (ebd.; S. 601) waren. Durch innere Differenzierung erhöht sich die Fähigkeit der Gesellschaft, Weltkomplexität kommunikativ zu bewältigen. Das Bezugsproblem ist die Frage, wie die Bandbreite kommunizierbarer Sachverhalte wachsen kann, ohne die Wahrscheinlichkeit für das Zustandekommen von Kommunikation durch Unterbestimmtheit der Selektivität zu gefährden. Aufgrund der Differenzierung der Gesellschaft in Teilsysteme kann ein und derselbe Sachverhalt mehrfach, unterschiedlich und autonom beobachtet werden. „jede Veränderung [ist] eine doppelte, ja eine vielfache Veränderung.“ (ebd.; S. 599) Dadurch erhöhen sich die Möglichkeiten von Kommunikation. Gleichzeitig steigern die Subsysteme ihre Selektivität gegenüber Umweltereignissen; sie mauern ihre Schwelle der Indifferenz gegenüber für sie unrelevanten Umweltereignisse hoch, indem sie eine enge (Sinn-) Grenze ziehen. Sie sind jeweils nur für einen kleinen Ausschnitt der in der Gesellschaft möglichen Kommunikationen zuständig und bleiben so anschlussfähig. Übersteigt das Ausmaß der kommunikativ zu erfassenden Komplexität eine bestimmte Grenze, reproduziert sich die Gesellschaft nur dann weiter, wenn sie die Form ihrer Differenzierung ändert. Eine Zunahme der Differenzierung ist dann nicht mehr möglich, sondern nur noch der Wechsel zu einem qualitativ anderen Differenzierungsprinzip. 2.2.2. Evolution der Gesellschaft Um diese Änderungen der Gesellschaftsstruktur zu erklären, hat Luhmann das Konzept der Evolution aus der Biologie entlehnt: „Gesellschaft ist das Resultat von Evolution. [...] es gibt heute keine andere Theorie, die den Aufbau und die Reproduktion der Strukturen des Sozialsystems Gesellschaft erklären könnte.“ (ebd.; S. 413) Wie bereits im Zusammenhang mit der Einführung des Autopoiesiskonzeptes erwähnt wurde, meint die begriffliche Koinzidenz nicht die Gleichsetzung biologischer und psychischer/sozialer Systeme, sondern lediglich die Adaption eines Erklärungsprinzips für die Theorie der Gesellschaft. Das Bezugsproblem der Evolutionstheorie ist hier wie dort die Frage, wie trotz des Entropiesatzes die Entstehung komplexer und voraussetzungsreicher (unwahrscheinlicher) Strukturen verstanden werden kann, ohne auf teleologische Erklärungsmuster zurückzugreifen. Anders gesagt: wie Strukturänderungen ohne die Möglichkeit, instruktiv auf die Struktur (eines autopoietischen Systems) einzuwirken, erklärt werden können? „Es geht [...] allein um die Frage, wie zu erklären ist, daß in einer Welt, die immer auch anderes bietet und beibehält, komplexere Systeme entstehen, und eventuell: woran sie dann scheitern. Es geht, sehr vereinfacht gesagt, um die Erklärung von Strukturänderungen.“ (ebd.; S. 429f) Im Laufe der Evolution der Gesellschaft haben nach Luhmann vier Differenzierungsformen die Gesellschaftsstruktur geprägt: Differenzierung in gleiche Teilsysteme (Segmentation); Differenzierung in Zentrum und Peripherie; hierarchische Differenzierung in Schichten (Stratifikation) und die funktionale Differenzierung der modernen Gesellschaft. 2.2.2.1. Segmentation Im Anschluss an eine Zeit der Differenzierung nach „den natürlichen Unterschieden des Alters und des Geschlechts,“ (ebd.; S. 634) markiert in den archaischen Gesellschaften die segmentäre Differenzierungsform die erste Stufe in der Evolution der gesellschaftlichen Differenzierung nach „künstliche[n] Einheit[en]“ (ebd.) Die Teilsysteme der segmentären Gesellschaft sind - hinsichtlich des jeweiligen Differenzierungsprinzips - gleich. Dieses Prinzip ist die Verwandtschaft (Stämme oder Clans oder Familien) oder die Territorialität (Häuser oder Dörfer). Die Segmentierung kann sich außerdem rekursiv wiederholen und so größere Einheiten bilden: Eine Gruppe von Familien bildet einen Stamm, aus einer Ansammlung von Häusern wird ein Dorf. Segmentär differenzierte Gesellschaften lassen aufgrund ihrer Form nur eine geringe Komplexität zu: „Diese Limitation resultiert daher, daß segmentär differenzierte Gesellschaften sich in Teilsysteme ausdifferenzieren, die ihre Grenzen in Lokalitäten und konkreten Handlungssituationen finden; es sind also Gesellschaften, in denen die Differenz von Interaktion und Gesellschaft noch nicht erlebbar ist, da als wesentliches Kriterium für die Zugehörigkeit zum (Teil-)System die Anwesenheit von Personen fungiert“ (Kneer & Nassehi 1997; S. 123). Die universelle Verbreitung der Norm der Reziprozität ist die Bestandsvoraussetzung für die segmentäre Differenzierungsform, weil sie die Funktion hat, die Gleichheit zwischen den Teilsystemen (Stämmen, Familien, Dörfer etc.) zu erhalten, die die Form der Differenzierung ausmacht. Die auf segmentäre Differenzierung folgenden Differenzierungsformen können zum einen an das Prinzip der Verwandtschaft anschließen und eine hierarchische Differenzierung in Schichten bilden (Stratifikation) oder an das Territorialitätsprinzip (Zentrum-Peripherie). Diese neuen Differenzierungsformen teilen die Eigenschaft, dass die Teilsysteme, im Gegensatz zur segmentären Differenzierungsform, ungleich in Bezug auf das Bildungsprinzip (Territorium oder Verwandtschaft) sind. 2.2.2.2. Zentrum/Peripherie Im Vergleich zu segmentären Gesellschaften kommt es zu einer räumlichen Ausdehnung der Kommunikationsmöglichkeiten und damit auch zur Bildung von wesentlich größeren kommunikativen Einheiten, die das Prinzip der Segmentierung überlagern, indem sie auf beiden Seiten der Unterscheidung mehrere segmentäre Einheiten zulassen. Zentren können eine Vielzahl von Städten sein, die jeweils eine eigene ländliche Peripherie haben. Seltener kann es dagegen zur Bildung von Großreichen kommen, die sich als Zentrum der Welt betrachten und alles andere als Peripherie wahrnehmen. Nur in den neu entstandenen Zentren macht die Unterscheidung Zentrum/Peripherie einen Unterschied. „Die Zentrum/Peripherie-Differenzierung [...] ist gleichsam im Zentrum zu Hause.“ (Luhmann 1997; S. 663) Demgegenüber behält die Peripherie, also das Umland, ihre primär segmentäre Differenzierung in Familien und Dörfer bei „und könnte daher auch ohne Zentrum überleben.“ (ebd.; S. 663) Das Problem dieser Form sind die knappen Kontakte, die zwischen Zentrum und Peripherie möglich sind. Das Zentrum ist eine Art Insel in der Gesellschaft. 2.2.2.3. Stratifikation Mit der Schließung der Oberschicht (die Adligen) durch das Gebot schichtinterner Ehen (Endogamie) (vgl. ebd.; S. 686) kommt es zu einer Differenzierung der Differenzierungsformen: Im Zentrum bildet sich eine stratifikatorische Differenzierung, die sich auf den Adel stützt, während in der Peripherie weiterhin Segmentierung besteht. Stratifikation bedeutet ungleiche Verteilung der Ressourcen und der Kommunikationsgelegenheiten. Stratifikation sieht zunächst eine Rangdifferenz zwischen Adligen und Volk vor; innerhalb dieser beiden Schichten entwickeln sich dann weitere Differenzierungen. Die innere Ordnung der Gesellschaft ist durch das Prinzip der Ungleichheit geprägt. Dagegen wird die Kommunikation innerhalb der Schichten durch das Prinzip der Gleichheit bestimmt. Stratifikation bedeutet also Gleichheit im Rahmen von Ungleichheit. Mit der Entstehung eines spezifischen Systems ‚Oberschicht‘ - mit entsprechend größerer Selektivität gegenüber Umweltereignissen erlaubt die Stratifikation die Ausbildung höherer Komplexität, verglichen mit den früheren Strukturen. 2.2.2.4. Funktionale Differenzierung Funktionale Differenzierung bezeichnet den vorläufigen Endpunkt der gesellschaftlichen Evolution. Im Gegensatz zu vormodernen Gesellschaftssystemen, die multifunktional angelegt waren, sind die Teilsysteme in der modernen (funktional differenzierten) Gesellschaft hochspezialisiert. Jedes Teilsystem richtet sich nach einer spezifischen Funktion in der gesamten Gesellschaft aus, die nicht von anderen Funktionssystemen wahrgenommen werden kann. Deshalb sind die Teilsysteme unter dem Gesichtspunkt der von jedem einzelnen erfüllten Funktion ungleichartig. Die wichtigsten Teilsysteme sind nach Luhmann das politische System, das Wirtschaftssystem, das Erziehungssystem, das Rechtssystem, die Familien, die Religion, das Medizinsystem und das Kunstsystem. Im Gegensatz zur stratifikatorischen Form der gesellschaftlichen Differenzierung sind die Beziehungen zwischen den Teil- systemen nicht-hierarchisch geregelt; die Ungleichheit zwischen den Systemen stützt sich nicht mehr auf Hierarchie und auch nicht auf räumliche Zuordnung. Denn jedes Funktionssystem operiert auf der Ebene der ganzen (Welt-)Gesellschaft. Die funktional differenzierte Gesellschaft hat keine Spitze und kein Zentrum, weil alle Funktionen für die Gesellschaft grundlegend sind, und keine das Primat besitzen kann. Tabelle 1 fasst die Merkmale der unterschiedlichen Differenzierungsformen zusammen: vormoderne Gesellschaften moderne Gesellschaft Differenzierungs- segmentär form Zent- stratifikatorisch funktional rum/Peripherie Gesellschaftstyp archaische Gesellschaften Hochkulturen moderne Gesellschaft Differenzierungs- Verwandtschaft oder Territorialität Verwandtschaft Funktion prinzip Territorialität Teilsysteme Familien, Clans, Städte, Großreiche Klasse, Kaste, Politik, Wirtschaft, Stämme, Stammes- etc. Schicht etc. Recht, Religion, verbände, Häuser, Erziehung etc. Dörfer etc. ungleich im Hinblick ungleich im Hinblick ungleichartig im Teilsysteme auf räumliche Zuord- auf Hierarchie Hinblick auf Funktion zueinander nung (unten/oben) (gleich im Hinblick auf Verhältnis der gleich (symmetrisch) Ungleichartigkeit) Tabelle 1: Formen der gesellschaftlichen Differenzierung nach Luhmann 2.3. Inklusion und Exklusion Eine soziologische Theorie kommt nicht umhin, das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft zu spezifizieren. Im allgemeinen wird heute davon ausgegangen, dass Gesellschaft und Individuen zueinander komplementär sind: Nur innerhalb gesellschaftlicher Beziehungen lässt sich ‚Menschsein’ realisieren. Die Geschlossenheit von sozialen und psychischen Systemen steht hierzu nicht im Widerspruch. Wie bereits gezeigt wurde, kann keines der beiden ohne das andere überleben. Allerdings darf gesellschaftliche Eingebundenheit nicht mehr mit Rückgriff auf Integrationstermini bezeichnet werden. An deren Stelle ist bei Luhmann die Unterscheidung von Inklusion und Exklusion getreten. Da Menschen als Umwelt des Gesellschaftssystems konzipiert sind, befinden sie sich nicht in der Gesellschaft, sondern werden in die Gesellschaft inkludiert, indem sie an Kommunikation teilnehmen, und werden durch Ausschluss von Kommunikation exkludiert. Dabei sind die Bedingungen der Inklusion und Exklusion an den jeweiligen Typus gesellschaftlicher Differenzierung geknüpft. In segmentären Gesellschaften werden Menschen einem Segment zugeordnet, womit feststeht, dass sie nicht gleichzeitig einem anderen Segment angehören können. Sie werden quasi durch (Total-)Inklusion einem Stamm, Clan, Dorf zugeordnet und aus allen anderen Segmenten exkludiert. In Einzelfällen kann es zu Übersiedlungen in ein anderes Dorf oder in einen anderen Stamm kommen. Es ist jedoch praktisch ausgeschlossen, ohne Zugehörigkeit zu einem Segment zu überleben. Exklusion aus einem Segment bedeutet deshalb fast immer Inklusion in ein anderes Segment. In stratifizierten Gesellschaften erfolgt die Inklusion über die Zuordnung von Menschen zu einer Kaste, einem Stand, einer bestimmten Schicht, die ihnen ebenfalls „Komplettidentität“ (Fuchs & Schneider 1995; S. 205) garantieren. „Man findet seinen sozialen Status in der Schicht, der man angehört.“ (Luhmann 1997; S. 622) Menschen sind entweder Bürgerliche, Adelige, Bauern etc. und gehören demnach zum Bürgertum, Adel usw. „Die Regelung von Inklusion/Exklusion findet dagegen nach wie vor auf segmentärer Ebene statt. Sie obliegt den Familien bzw. (für Abhängige) den Familienhaushalten. Irgendwo war man danach durch Geburt oder Aufnahme zu Hause“ (ebd.), wobei die jeweils schichtspezifische Heiratsordnung (Endogamie) festlegt, wer würdig ist, an der schichtspezifischen Kommunikation teilzunehmen. Exklusion war aber auch „aus Gründen der Not oder mangelnder Heiratschancen möglich.“ (ebd.) Im Gegensatz zur segmentären Gesellschaft gab es jedoch Überlebensmöglichkeiten außerhalb der Stände: zum Beispiel als Bettler, Mönch, Berufssoldat oder auch Pirat (vgl. ebd.) Die Inklusion in segmentären und stratifizierten Gesellschaften ließe sich noch problemlos mit der Unterscheidung Integration/Desintegration bezeichnen: Weil in beiden Differenzierungsformen die Inklusion dem Differenzierungsprinzip folgt: „In beiden Fällen ist der ‚Schied‘ des Unterschieds identisch mit der Systemgrenze.“ (Fuchs & Schneider 1995; S. 205) Die Grenzziehungen zwischen Teilsystemen sind immer auch Grenzen zwischen Menschen und zwischen weitestgehend festgelegten Lebensformen. Die Inklusion in die funktional differenzierte Gesellschaft folgt dagegen einer völlig anderen Logik. Die funktionale Differenzierung der Gesellschaft hat zur Folge, dass die gesellschaftliche Struktur und Individualität quer zueinander stehen: Da funktionale Differenzierung die Gesellschaft nicht entlang der Grenzlinien konkreter Gruppen aufteilt (die jeweils multifunktional angelegt sind), sondern in kommunikative Systeme, die exklusiv je eine gesellschaftlichen Funktion erfüllen, verlangt die moderne Gesellschaft von Personen, dass sie „an allen Funktionssystemen teilnehmen können, je nachdem, in welchen Funktionsbereich und unter welchem Code ihre Kommunikation eingebracht wird.“ (Luhmann 1997; S. 625) In der funktional differenzierten Gesellschaft gehen die Teilsystemgrenzen durch Individuen und Gruppen hindurch. Deshalb können auch nicht ganze Menschen, nicht Individuen in die gesellschaftlichen Teilsysteme inkludiert, sondern lediglich Dividuen, also rollen- bzw. inklusionsspezifische Teilaspekte der Person. Nach dieser Logik bedeutet Inklusion (der Person) gleichzeitig Exklusion (des Individuums). Andere Funktionssysteme inkludieren jeweils andere Teilaspekte der Person, aber das Individuum bleibt immer ausgeschlossen. Nicht die Zugehörigkeit des Individuums zu einem gesellschaftlichen Teilsystem macht daher seine Individualität aus, sondern gerade seine Nicht-Zugehörigkeit. Anders als in der segmentären oder stratifizierten Gesellschaft, „ist das Gesellschaftssystem und sind dessen Funktionssysteme auf Inklusion der Gesamtbevölkerung angelegt. [...] Bei prinzipieller Vollinklusion entscheiden die Funktionssysteme selbst, wie weit es jemand bringt“ (Luhmann 1999; S. 142). Inklusion und Exklusion erfolgen ausschließlich nach funktionsspezifischen Kriterien: Personen müssen für die jeweiligen Funktionssysteme relevant sein, indem sie innerhalb eines festgelegten Rahmens erwartungskomplementär handeln. Der Modus der Vergesellschaftung „ist von Herkunft [...] auf Karriere umgestellt worden.“ (ebd.; S. 149) 3. Beobachtung Sozialer Arbeit Schon früh geriet Soziale Arbeit in das Blickfeld Luhmannscher Beobachtung. In dem 1973 erschienen Artikel „Formen des Helfens im Wandel gesellschaftlicher Bedingungen“ (Luhmann 1975) beschreibt Luhmann die Entwicklung von Hilfe hin zur professionellen Sozialarbeit als Korrelat der funktionalen Ausdifferenzierung der modernen Gesellschaft. Während soziale Hilfe in segmentären Gesellschaften auf Dankespflichten bzw. zwischen unterschiedlichen Straten auf gesellschaftlicher Moralsemantik beruhende Formen privater Hilfe darstellte, hat sich Hilfe in der modernen Gesellschaft in den formal organisierten öffentlichen Bereich verlagert. Unter Helfen versteht Luhmann allgemein „einen Beitrag zur Befriedigung der Bedürfnisse eines anderen Menschen.“ (ebd.; S. 21) Luhmann stellt Soziale Arbeit in eine lineare Abfolge mit nichtorganisierten Formen des Helfens, die funktional äquivalente und demzufolge austauschbare Leistungen bereitstellen. Die reziproke Hilfe unter Gleichen ist, ebenso wie moralisch inspirierte Hilfe, in der modernen Gesellschaft durch organisierte Hilfe weitgehend abgelöst worden, ohne jedoch gänzlich zu verschwinden. Organisierte Hilfe in Form von Sozialer Arbeit „gräbt andersartigen Hilfsmotivationen das Wasser ab, weil sie ihnen in der Effektivität und durch eine diffuse Streuung der Belastungen überlegen ist.“ (ebd.; S. 36) 3.1. Kumulative Exklusion / Exklusionsdrift Das gemeinsame Grundproblem allen Helfens ist die Differenz in der personellen Verfügbarkeit von materiellen und symbolischen Ressourcen (vgl. ebd.; S. 22). Darüber hinaus haben sich, analog zu den Hilfeformen, die jeweils spezifischen Umstände der Hilfebedürftigkeit mit der Gesellschaftsstruktur verändert. Typische Notlagen in segmentären Gesellschaften aufgrund von Missernten, Krankheiten oder intersegmentären Konflikten betrafen häufig alle Mitglieder gleichermaßen. In stratifizierten Gesellschaften konnte die Zugehörigkeit zu einem niedrigen Stand bereits eine Notlage darstellen. War in vormodernen Gesellschaften die Inklusion in ein Segment oder eine Schicht zugleich die ‚Ursache‘ der Notlage und – in der segmentären Gesellschaft – Voraussetzung der Hilfe, ist es in der modernen Gesellschaft Luhmannscher Provenienz gerade der fehlende Zugang zu den gesellschaftlichen Teilsystemen, der Hilfebedürftigkeit kennzeichnet. Während in vormodernen Gesellschaften die Inklusion in nur ein multifunktionales Teilsystem die Regel war, sind Individuen in der modernen Gesellschaft als Personen in mehrere Funktionssysteme inkludiert. Inklusion in ein spezifisches Funktionssystem kann nicht oder nur bedingt durch Inklusion in andere Funktionssysteme aufgefangen werden, weil jedes Funktionssystem ausschließlich für eine Funktion zuständig ist. Die „Wirtschaft, die Politik oder selbst Intimbeziehungen [können] nicht Helfen [stellvertretend für andere Funktionssysteme inkludieren HS], ohne ihre Selbstreproduktion, ihre Autopoiesis zu gefährden“ (Kleve 1997; S. 420). Das Gegenteil ist der Fall: Exklusion aus einem System zieht meistens weitere Exklusionen nach sich, löst eine Exklusionsdrift aus, an deren Ende die gesellschaftliche Irrelevanz von Menschen steht. „Keine Arbeit, kein Geldeinkommen, kein Ausweis, keine stabilen Intimbeziehungen, kein Zugang zu Verträgen und zu gerichtlichem Rechtsschutz, keine Möglichkeit, politische Wahlkampagnen von Karnevalsveranstaltungen zu unterscheiden, Analphabetentum und medizinische wie auch ernährungsmäßige Unterversorgung [...] definiert mehr oder weniger große Teile der Bevölkerung“ (Luhmann 1997; S. 630f). Fuchs & Schneider (1995) haben für diesen Prozess der wechselseitigen Exklusionsverstärkung den Begriff „Hauptmann-von-Köpenick-Syndrom“ geprägt. Hierbei handelt es sich offensichtlich um eine späte Entdeckung Luhmanns, welche in der Theorie funktionaler Differenzierung eigentlich nicht vorgesehen war. Denn im Gegensatz zu den Straten und Segmenten vormoderner Gesellschaften „ist das Gesellschaftssystem und sind dessen Funktionssysteme [so wie Luhmann sie sieht] auf Inklusion der Gesamtbevölkerung angelegt.“ (Luhmann 1999; S. 142) Wenngleich Luhmann bereits recht früh „den Totallausschluß [...] von der Teilhabe an den Funktionsbereichen.“ (1980; S. 6) erwähnt und auch schon von einer „wechselseitigen Verstärkung einer Mehrzahl von Ungleichheiten“ (1985b; S. 119) spricht, bleiben diese Tatsachen theoretisch zunächst weitgehend unberücksichtigt. Erst um das Jahr 1995 wird das Thema – jetzt unter dem Begriff „Exklusion“ – auch im Rahmen der Theorie sozialer Systeme umfassender – wenngleich nicht erschöpfend – problematisiert (vgl. Luhmann 1999; S. 138ff). Es waren wohl weniger theoretische Überlegungen als vielmehr unmittelbare Erfahrungen, die den Sozialen Ausschluss von Menschen nachhaltig in das Aufmerksamkeitsfeld der Systemtheorie gerückt haben. Luhmann hatte eine Reise unternommen und wandte sich nach seiner Rückkehr an seine LeserInnen: „Zur Überraschung aller Wohlgesinnten muß man feststellen, daß es doch Exklusionen gibt, und zwar massenhaft und in einer Art von Elend, das sich der Beschreibung entzieht. Jeder der einen Besuch in den Favelas südamerikanischer Großstädte wagt und lebend wieder herauskommt, kann davon berichten. Aber schon ein Besuch in den Siedlungen, die die Stillegung des Kohlenbergbaus in Wales hinterlassen hat, kann davon überzeugen. Es bedarf dazu keiner empirischen Untersuchungen. Wer seinen Augen traut, kann es sehen, und zwar in einer Eindrücklichkeit, an der die verfügbaren Erklärungen scheitern.“ (ebd.; S. 147) 3.2. Soziale Arbeit als gesellschaftliches Funktionssystem! Aufgrund der Eigenlogik funktionaler Differenzierung liegt die Bearbeitung des Problems der Exklusion außerhalb der Zuständigkeit der ‚verursachenden‘ Gesellschaftssysteme: „Man kann nicht erwarten, daß dies Problem innerhalb der einzelnen Funktionssysteme gelöst werden kann; denn [...] Inklusion [ist] nur vor dem Hintergrund möglicher Exklusionen denkbar“ (ebd.; S. 633) ‚Blinde‘ Inklusion bedeutet ein Aufweichen der Systemgrenzen und letztendlich die Gefährdung ihrer Autopoiesis. Luhmann geht davon aus, dass vor allem das Wirtschaftssystem und das Erziehungssystem Exklusionsdriften auslösen (vgl. ebd.; S. 774). Dies ändert aber nichts an der Feststellung, dass „das Problem der wechselseitigen Verstärkung von Exklusionen [sich] keinem einzelnen Funktionssystem zuordnen [läßt].“ (ebd.; S. 633) Die Lösung des Problems kann daher nur in weiterer funktionaler Differenzierung liegen: Es „wäre eher damit zu rechnen, daß sich ein neues, sekundäres Funktionssystem bildet, das sich mit den Exklusionsfolgen funktionaler Differenzierung befaßt – sei es auf der Ebene der Sozialhilfe, sei es auf der Ebene der Entwicklungshilfe.“ (ebd.) Im Gegensatz zu den primären Funktionssystemen wäre Soziale Arbeit ein sekundäres Funktionssystem, weil es sich erst im Anschluß an die funktionale Differenzierung gebildet hat. Luhmann zweifelt jedoch noch, „ob sich ein gesellschaftliches Subsystem schon gebildet hat oder ob es sich um weit verstreute Bemühungen auf der Ebene von Interaktionen und Kommunikationen handelt“ (ebd.), merkt aber an, dass die institutionell verfasste Hilfe bereits auf einer anderen Ebene operiere, auf der es „nicht mehr um Armenpflege im Sinne der Tradition geht, sondern um strukturelle Veränderungen.“ (ebd.; S. 634) Deshalb wäre es vielleicht möglich, dass „wir hier ein Funktionssystem im Entstehen beobachten“ (ebd.) können. Luhmann hatte nicht mehr die Zeit, diese Entwicklung zu beobachten: Er verstarb am 6.November 1998. Noch zu Lebzeiten haben andere (Baecker 1994; Fuchs & Schneider 1995; Bommes & Scherr 1996 & 2000; Kleve 1997 & 1999) seinen Gedanken aufgegriffen und weiterentwickelt. Während Bommes & Scherr mit Luhmann die Auffassung vertreten, Soziale Arbeit sei bislang nur auf der Ebene von Organisationen beobachtbar, versuchen Baecker, Fuchs & Schneider und Kleve die mittlerweile prominente These zu validieren, Soziale Arbeit habe sich bereits zu einem gesellschaftlichen Funktionssystem ausdifferenziert. Die letztgenannte Position soll im folgenden anhand der Ausführungen von Kleve (1999a) ausführlich dargestellt werden. Im Anschluss werde ich kurz die Argumente wiedergeben, die Bommes & Scherr gegen die Funktionssystemthese angeführt haben. Wie lässt sich die These der funktionssystemischen Ausdifferenzierung Sozialer Arbeit plausibilisieren? Kleve schlägt im Anschluss an Baecker vor, die Anwendbarkeit eines allgemeinen Kriterienkataloges zur Identifikation von Funktionssystemen zu überprüfen. Soziale Arbeit müsse sich, wie die anderen Funktionssysteme auch, „mit Hilfe der Kriterien [...] Funktion, Leistung, operative Geschlossenheit (Autopoiesis), Medium und binäre Codierung“ (ebd.; S. 193) beschreiben lassen.7 Es geht konkret um fünf Fragestellungen: „Erstens: Welche Funktion erfüllt die Soziale Arbeit für die Gesellschaft? Zweitens: Welche Leis- 7 Die Anwendung dieses, für die Identifikation primärer Funktionssysteme entwickelten Kataloges setzt in Ermangelung eines besseren Werkzeuges voraus, dass er sich auch für die Beschreibung von sekundären Funktionssystemen wie das der Sozialen Arbeit eignet (vgl. Fuchs 1995; S. 210). tungen erfüllt sie für andere Funktionssysteme? Drittens: Welche Kommunikation realisiert ihre operationale Schließung, ihre Autopoiesis? Viertens: Hat sie einen binären Code?, wenn ja: welchen? und fünftens: Hat sie ein Medium?, wenn ja: welches?“ (ebd.; S. 181) Die folgenden Unterabschnitte stellen jeweils ein Kriterium in den Kontext der Theorie sozialer Systeme und markieren deren Auslegung für das System der Sozialen Arbeit. 3.2.1. Funktion der Sozialarbeit für die Gesellschaft Luhmann unterscheidet zwischen Funktion und Leistung von Systemen. Wie oben gezeigt wurde, übernimmt jedes gesellschaftliche Teilsystem für die gesamte Gesellschaft exklusiv eine Funktion. Bei der Frage nach der Funktion der Sozialen Arbeit geht es also um eine gesellschaftliche Aufgabe, die ausschließlich durch die Ausdifferenzierung des Funktionssystems Soziale Arbeit gelöst wird. Dementsprechend wäre es falsch, Soziale Arbeit als Hilfesystem zu beschreiben, denn Hilfe findet nach wie vor „in Familien, in Freundeskreisen, Nachbarschaften etc.“ (ebd.; S. 182) statt. Die Funktion Sozialer Arbeit wird demgegenüber als „Exklusionsbegrenzung, Exklusionsverwaltung und/oder Inklusionsvermittlung“ (ebd.; S. 194) beschrieben. Sie hilft nur dort, wo keine private Hilfe erwartbar wäre. Soziale Arbeit kann also allgemein als ein sekundäres Funktionssystem bezeichnet werden, das sich mit den Exklusionsfolgen funktionaler Differenzierung befasst. 3.2.2. Leistung der Sozialen Arbeit für andere Funktionssysteme Demgegenüber verweist Leistung auf „interfunktionssystemische Beziehungen [und setzt] Soziale Arbeit ins Verhältnis [...] zu gesellschaftlichen Teilsystemen wie Politik, Wirtschaft, Familie, Erziehung, Wissenschaft, Kunst oder Religion.“ (ebd.; S. 196) Es gibt Leistungen, die Soziale Arbeit anderen Funktionssystemen anbietet und Leistungen, die Soziale Arbeit von anderen Funktionssystemen nutzt. Die unterschiedlichen Angebots- und Interventionsformen der Sozialen Arbeit reagieren in jeweils spezifischer Weise auf politische, wirtschaftliche, familiale, erzieherische oder religiöse Exklusionen. Entsprechend „bezieht sie sich auch in jeweils spezifischer Weise auf die Funktionssysteme [...] und offeriert diesen Leistungen“ (ebd.; S. 196). Stellvertretend für Politik, Wirtschaft, Familie usw. offeriert Soziale Arbeit Partizipationsmöglichkeiten, Sozialhilfe, Beratung etc. Andere Funktionssysteme beziehen sich auf diese Leistungen: Die Wirtschaft rechnet damit, dass die psychosozialen Folgen von Erwerbslosigkeit aufgefangen werden, die Politik vertraut auf die Aufrechterhaltung des sozialen Friedens, das Recht gewährt ‚Therapie vor Strafe‘ (vgl. Baecker 1994; S. 108f & Kleve 1999a; S. 196f). Indirekt ermöglicht Soziale Arbeit anderen Funktionssystemen die Rekrutierung ihres Personals auch dann, wenn allzu sichtbare Exklusion über den Exklusionsbereich hinaus mobilitätshemmend wirkt, indem sie „die von dauerhaften sozialen Integrationsformen losgelösten Individuen von sozial helfenden Zumutungen [befreit].“ (Kleve 1999a; S. 180) Sie tritt an die Stelle von Solidarität unter Gleichen, ist institutionalisierte Bearbeitung von Ungerechtigkeit und entbindet von moralischen Verpflichtungen zu Helfen.8 „Dadurch arbeitet professionelle Soziale Hilfe den [primären HS] Funktionssystemen [...] zu; denn sie flexibilisiert und mobilisiert individuelle, familiär-‚lebensweltliche‘ oder gruppenspezifische Möglichkeiten, an gesellschaftlicher, an funktionssystemischer Kommunikation teilzunehmen.“ (ebd.) Im Gegenzug bezieht Soziale Arbeit jeweils spezifische Leistungen des Wirtschaftssystems (Geld), des Rechtssystems (Rechtsansprüche) und der Massenmedien (Thematisierung von sozialen Problemen) (vgl. ebd.; S. 197). 3.2.3. Autopoiesis der Sozialen Arbeit Wie alle sozialen Systeme muss auch das sekundäre Funktionssystem Soziale Arbeit seine eigenen Sinngrenzen konstituieren, indem es festlegt, welche Kommunikation innerhalb des Systems möglich ist. Das Prinzip der Ungleichartigkeit von Funktionssystemen legt fest, dass die spezifische Kommunikation eines Funktionssystems ausschließlich in diesem vorkommt. „Die operationale Schließung der Sozialen Arbeit realisiert sich durch die Kommunikation von Hilfe.“ (ebd.; S. 197) Hilfe kann in keinem anderen Funktionssystem kommuniziert werden: „Wer nur noch helfen will, ruiniert damit seine ökonomischen und politischen Kalküle ebenso wie eine Aussicht auf Liebe, die auf beiden Seiten Passion für den anderen und nicht für dessen Probleme voraussetzt.“ (Baecker 1994; S. 99) 3.2.4. Medium der Sozialen Arbeit Während Sprache und Verbreitungsmedien für alle gesellschaftliche Kommunikation gleichermaßen relevant sind, koevoluieren Funktionssysteme zusätzlich mit einem jeweils spezifischen symbolisch generalisierten Kommunikationsmedium. Für die primären Funktionssysteme stellen Geld (Wirtschaft), Macht (Politik), Liebe (Familie/Intimität), das Kind (Erziehung), Glaube (Religion) und Wahrheit (Wissenschaft) derartige Medien dar (vgl. Luhmann 1996b; S. 222). Ihre Aufgabe ist es, „die Selektion der Kommunikation so zu konditionieren, daß sie zugleich als Motivationsmittel wirken, also die Befolgung des Selektionsvorschlages hinreichend sicherstellen kann.“ (ebd.) Entsprechend ist Kommunikation, die auf diese Medien aufsetzt, vergleichsweise erfolgsversprechend. In diesem Zusammenhang ist von Interesse, welches symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium die Unwahrscheinlichkeit des Zustandekommens von spezifisch helfender Kommunikation in Form von Sozialer Arbeit in Wahrscheinlichkeit transferiert. Dieses Medium der Sozialarbeit ist der/die KlientIn. Die Konstruktion von KlientInnen (Personen in besonderen Ungleichheitslagen) macht den Zusammenhang der Gewährung und Nichtgewäh- 8 So wurde in einer Kampagne der Hamburger Verkehrsbetriebe unter dem Titel: „Niemand muss in Hamburg betteln“ auf die allen zugänglichen sozialen Sicherungssysteme verwiesen. rung von Hilfe gewissermaßen selbstevident. „Erst wenn eine Person zum Klienten geworden ist, helfen Sozialarbeiter, die anstreben, dass der Klient wieder zum Nicht-Klient wird.“ (Kleve 1999a; S. 198) 3.2.5. Binäre Codierung der Sozialen Arbeit Durch seine Funktion grenzt sich ein Gesellschaftssystem gegenüber anderen Gesellschaftssystemen ab, indem es „die Überlegenheit seiner eigenen Operationen verteidigt“ (Luhmann 1997; S. 749). Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle Operationen des Systems teleologisch auf die Erfüllung dieser Funktion ausgerichtet sind. Damit ein Funktionssystem sich gegenüber seiner Umwelt abgrenzen kann, muss es gewissermaßen durch eine innere Struktur seine funktionale Autonomie sicherstellen. Es muss deutlich machen können, ob und unter welchen Bedingungen eine funktionssystemspezifische Kommunikation stattfinden bzw. nicht stattfinden kann. Diese Rolle übernimmt der jeweilige binäre Code eines Systems, indem er eine beobachtungsleitende Differenz bereitstellt, die festlegt, wie Umweltereignisse in einem System, und nur in diesem, beobachtet werden (vgl. Luhmann 1997; S. 748ff). Ein binärer Code besteht, anders als die (eindimensionale) Funktion, aus zwei entgegengesetzten Werten und schließt dritte Werte prinzipiell aus. Codes transformieren eine analoge Situation in eine digitale und limitieren dadurch den Entscheidungspielraum von Funktionssystemen auf ein hartes Entweder/Oder (vgl. ebd.; S. 359f). Beispiele für binäre Codes in den primären Funktionssystemen sind wahr/unwahr (Wissenschaft), Zahlung/Nicht-Zahlung (Wirtschaft), Recht/Unrecht (Recht), Immanenz/Transzendenz (Religion), Macht/keine Macht (Politik), besser lernen/schlechter lernen (Erziehung). Anders als die Funktion regelt der Code eines Systems die Kontingenz der Bewertungen, anhand derer das System seine eigenen Operationen orientiert. Über den negativen Wert seines Codes „reflektiert es [...] die Kriterienbedürftigkeit aller eigenen Operationen“ und verhindert dadurch, „dass das System im Erreichen eines Zieles [...] festläuft und dann aufhört zu operieren. [...] Nicht die Orientierung an der eigenen Einheit [Funktion HS], sondern erst die Orientierung an der eigenen Differenz sichert, daß im Zeitlauf eigene Operationen an eigene Operationen angeschlossen werden können.“ (ebd.; S. 749) Mit Bezug auf das Funktionssystem Soziale Arbeit geht es also darum, diesen binären Schalter zu identifizieren, der im Hinblick auf die Funktion, der Entgeneralisierung von übergreifenden Exklusionsfolgen, kontingent festlegt, welche spezifischen Lebens- und Soziallagen vom System bearbeitet werden und welche nicht. Weder das „problemgenerierende Schema“ (Fuchs & Schneider 1995; S. 211) Inklusion/Exklusion noch die Unterscheidung von gleich/ungleich sind dazu geeignet, diese Funktion trennscharf zu erfüllen, da mit ihnen auch Lebenslagen bezeichnet werden können, die nicht in das Ressort der Sozialen Arbeit fallen. Exklusion bedeutet nicht zwangsläufig Exklusionsdrift, und Ungleichheit kennzeichnet gerade auch Lebenslagen im Inklusionsbereich der Gesellschaft. Nicht jeder kann studieren oder Politiker werden, und nicht jeder kann in gleichem Maße auf die funktionssystemischen Leistungen zurückgreifen. Aber bezogen auf das Inklusionsgebot sind alle gleich inkludiert. In Abgrenzung zu diesen gewöhnlichen Ungleichheitslagen gilt es, diejenigen besonderen Ungleichheitslagen herauszufiltern, die erst durch die Kumulierung von Exklusionen entstehen. Kommunikation im Funktionssystem Soziale Arbeit kommt nur dann zustande, wenn Lebenslagen von Personen als generalisierte Ungleichheitslagen beobachtet werden können. Systemintern wird diese Unterscheidung durch die „Transformation von sozialen Ungleichheitslagen (diesen besonderen Lagen) in soziale Problemlagen und als Transformation von sozialen Problemlagen in Fälle, die programmförmig abgearbeitet werden können“ (ebd.; S. 213f) prozessiert. Analog zu den primären Funktionssystemen, die sich bspw. nur reproduzieren wenn gezahlt wird oder wenn ‚wahre‘ Erkenntnisse publiziert und rezipiert werden, muss sich die Sozialarbeit über den kommunikativen Anschluss von Falldeklarationen an weitere Falldeklarationen reproduzieren. Der zentrale Code des Funktionssystems Soziale Arbeit ist dementsprechend die Unterscheidung Fall/Nichtfall, wobei der ursprünglich negative Präferenzwert (Ungleichheit) positiv (invers) als Fall markiert wird. Möglicherweise wird die Unterscheidung Fall/Nichtfall aufgrund des externen wie internen Plausibilisierungsdrucks, dem die Soziale Arbeit unterliegt – und nicht zuletzt um die Annahmewahrscheinlichkeit von ansonsten unwahrscheinlicher Kommunikation zu steigern – in einem dritten Schritt in die Unterscheidung Hilfe/Nichthilfe transformiert, die dann als „offiziöses Banner der Systemoperationen“ (ebd.; S. 215) an die erste Stelle aufrückt. 3.3. Soziale Arbeit als organisierte Hilfe im Wohlfahrtsstaat Die von Kleve et al. vorgenommene Fassung der Sozialen Arbeit als Funktionssystem ist selbst im Lager der Systemtheoretiker nicht unumstritten. Es wurde bereits erwähnt, dass Luhmann selbst der Auffassung war, dass es sich bei Sozialer Arbeit um „verstreue Bemühungen auf der Ebene von Interaktionen und Organisationen“ (Luhmann 1997; S. 633) handelt und noch nicht um ein eigenständiges Funktionssystem. Bommes & Scherr (1996 & 2000) haben diese These ausführlich begründet und davon ausgehend eine umfassende Beschreibung der Sozialen Arbeit als einem „Komplex von wohlfahrtsstaatlich ermöglichten Organisationen der Hilfe“ (Bommes & Scherr 2000; S. 108) ausgearbeitet. Deren ausführliche Darstellung würde mit Rücksicht auf die Ausgangsfrage dieses Textes aus dem Rahmen fallen. Ich möchte jedoch einige der Argumente wiedergeben, die von den Autoren gegen die „Funktionssystem-These“ anführen: Die Autonomie der Sozialen Arbeit ist im Vergleich zu den primären Funktionssystemen eingeschränkt, insofern sie „in einem hohen Maße von sozialpolitischen Ressourcenzuteilungen abhängig“ (ebd.; S. 110) ist. Dies gilt zwar auch für andere Funktionssysteme, beispielsweise das Erziehungssystem oder das Gesundheitssystem; anders als es für diese der Fall ist, wird jedoch die Sinnhaftigkeit der Sozialen Arbeit immer wieder in Frage gestellt. „Das Ausmaß, in dem Leistungen der Sozialen Arbeit [...] als notwendig und sinnvoll erachtet werden“ variiert daher „in weitgehender Abhängigkeit von politischen Pro- grammen – die die Annahme keineswegs ausschließen, dass ein Verzicht auf solche Leistungen als eine bessere Form der Hilfe betrachtet wird, da Soziale Arbeit im Verdacht der Unterminierung der Selbsthilfefähigkeit steht.“ (Bommes & Scherr 2000; S. 110) Die verbreitete Annahme, dass professionelle Hilfe uneffektiv und ersetzbar ist (beispielsweise durch nachbarschaftliche Hilfe anstelle von Renovierungskostenbeihilfe oder durch Haftstrafen anstelle von erlebnispädagogischen Maßnahmen), sowie oftmals auch „die Erwartung der Eigenverantwortlichkeit“ (ebd.) unterhöhlt, deutet darauf hin, dass Soziale Arbeit nicht in der Lage ist, die Nicht-Substituierbarkeit und Alternativlosigkeit der ihr zugrunde liegenden Problemstellung erfolgreich zu kommunizieren. Soziale Arbeit kann, anders als es für ein gesellschaftliches Funktionssystem erforderlich wäre, nicht für sich reklamieren, exklusiv für die Erfüllung einer gesellschaftlichen Funktion zuständig zu sein. Soziale Arbeit kann zudem nicht grundsätzlich eigenständig darüber entscheiden, „wann Hilfsbedürftigkeit vorliegt oder nicht und wie angemessen zu helfen sei“ (ebd.; S. 109). Sie ist also – systemtheoretisch gesprochen – nicht in der Lage, ihre Grenzen ausschließlich selbstreferentiell zu erzeugen. Empirisch lässt sich der Anspruch, Soziale Arbeit sei exklusiv für Formen der Hilfebedürftigkeit zuständig (und entscheidungsbefugt) am Beispiel der Kindesherausnahme widerlegen, denn bei Fragen des Sorgerechtsentzugs ist Soziale Arbeit auf Entscheidungen des Rechtssystems angewiesen (vgl. ebd.; S. 110), das zudem oftmals auf psychologische Gutachten zurückgreift. Sozialer Arbeit fehlt zur Sicherung ihrer funktionalen Autonomie ein eindeutiger Code, anhand dessen entschieden werden kann, ob und unter welchen Bedingungen Hilfe stattfinden bzw. nicht stattfindet. „Die Unterscheidung Hilfe/Nicht-Hilfe schränkt die Kommunikation nicht in der Weise ein“, dass „alles unter dem Gesichtspunkt, ob es für Hilfe in Frage kommt oder nicht“ (ebd.; S. 111) dupliziert wird. Die Grenze eines Funktionssystems Soziale Arbeit wäre durch diesen Code nicht hinreichend bestimmt. Vielmehr hängt das Zustandekommen von Hilfe oftmals davon ab, in wie weit es gelingt, soziale Problemlagen in Programme zu transformieren, deren Notwendigkeit auch in anderen Funktionskontexten kommunizierbar ist. „Helfen wird zum Beispiel der Politik als Programm angeraten, indem Hilfe, wie etwa im Fall der Sozialen Arbeit mit so genannten rechtsradikalen Jugendlichen, als politischer Beitrag zu ihrer ‚Integration in die Gesellschaft’ aufgelegt wird.“ (ebd.) Für Soziale Arbeit gilt nicht, „dass sie irgendwann im Leben für alle in Frage kommt.“ Zwar hat jedeR prinzipiell Zugang zum System der Sozialen Arbeit, in Frage zu stellen ist jedoch „der Universalismus der Problemstellung in dem Sinne, dass Hilfe alle angeht.“ (ebd.; S. 112f) 3.4. Praxistheoretische Dimensionen Zu der Frage, ob die Luhmannsche Systemtheorie über eine Beschreibung der Sozialen Arbeit als Teilsystem der Gesellschaft hinaus auch zur Reflexion sozialarbeiterischer Praxis taugt, gibt es unterschiedliche Meinungen. Während Bommes & Scherr (2000) ihre soziologische Beschreibung der Sozialen Arbeit bewusst in Distanz zur Praxis setzen,9 versucht Kleve über eine Reihe „praxistheoretischer Dimensionen“ (Kleve 1999a; S. 237), die allgemein an Luhmanns Gesellschaftstheorie und speziell an die These der funktionalen Ausdifferenzierung der Sozialen Arbeit anknüpfen, systemtheoretisches Wissen auch als Reflexionswissen für die Soziale Arbeit nutzbar zu machen. 3.4.1. Dabeisein war alles! Soziale Arbeit jenseits der Bearbeitung von Desintegration Ein in der Sozialen Arbeit verbreitetes Paradigma führt individuelle Problemlagen auf gesellschaftliche Desintegration zurück. Desintegration wird als Prozess des Auseinanderfallens sozialer Zusammenhänge verstanden und als Ursache für soziale Problemlagen verantwortlich gemacht. Danach führt die verlorengegangene Kohäsion der funktional differenzierten Gesellschaft zum Verlust sinnstiftender Bindungen und damit zu einer Zunahme abweichenden Verhaltens (vgl. Heitmeyer 1997). Im Hinblick auf die These der funktionalen Differenzierung ist diese Sichtweise problematisch. In der modernen Gesellschaft gehen die Grenzen der Funktionssysteme durch Individuen (Lebensformen, Lebenswelten) hindurch. Inkludiert werden nur noch Personen bei gleichzeitiger Exklusion der Individuen. Konsequenterweise hat sich damit auch das gesellschaftsstrukturelle Fundament traditioneller Identitätsformen aufgelöst: Die Aufgabe der Identitätsbildung obliegt den Individuen persönlich, denn sie können sich nicht mehr an allgemeinverbindlichen Normen und Werten weitestgehend homogener Segmente bzw. Straten orientieren. Ein normativer Integrationsbegriff, der dazu benutzt wird, „Einheitsperspektiven oder sogar Solidaritätserwartungen zu formulieren und entsprechende Einstellungen anzumahnen“, wird diesem Tatbestand nicht gerecht und „muss [...] in Gesellschaften, die komplexer werden, auf zunehmenden Widerstand stoßen.“ (Luhmann 1997; S. 603) Luhmann schlägt stattdessen vor, „unter Integration nichts anderes [zu] verstehen, als die [wechselseitige HS] Reduktion von Freiheitsgraden“ (ebd.; S. 603). Dabei geht es auch um Verständigung über „Ziele und Werte innerhalb sozialer Gemeinschaften“ oder Bindungen „auf einer Ebene von subjektiven Moralvorstellungen, Werten und Lebensmaßstäben“ sowie die „Koordination von Handlungen“ (Kleve 1999a; S. 216). Derartige Bindungen sind allerdings nicht als Voraussetzung für gesellschaftliche Partizipation zu verstehen, sondern im Gegenteil als Demobilisierung im Hinblick auf die Anforderungen wechselnder Inklusionen, 9 Sie unterscheiden zwischen einer „Soziologie der Sozialen Arbeit“ im Sinne einer soziologischen Beschreibung der Sozialen Arbeit als Teil der Gesellschaft und einer „Soziologie für die Soziale Arbeit, die sich um die Aufbereitung soziologischen Wissens für die Zwecke der Sozialen Arbeit bemüht.“ (Bommes & Scherr 2000; S. 14f) die ein Individuum zu bewältigen hat. „Die Gesellschaft ist folglich - genau umgekehrt wie unter dem Regime der Stratifikation - in ihrer untersten Schicht stärker integriert als in ihren oberen Schichten. Sie kann nur »unten« auf Freiheitsgrade verzichten. Ihre Ordnung beruht hingegen auf Desintegration, auf Entkopplung der Funktionssysteme.“ (Luhmann 1997; S. 631f) Wenn man dieser Logik folgt, kann Soziale Arbeit nicht als Integrationsarbeit verstanden werden. Die problematisierten Desintegrationsprozesse dürfen nicht als Abweichung missverstanden werden, sondern sind, in der funktional differenzierten Gesellschaft, die Norm. Soziale Arbeit muss folglich, wenn sie wirksam aus besonderen Ungleichheitslagen befreien will, die Handlungsmöglichkeiten ihrer AdressatInnen erweitern und damit desintegrieren. Kleve stellt zudem fest, dass Soziale Arbeit „auch nicht bewirken kann, wozu die primären Funktionssysteme nicht in der Lage sind.“ (Kleve 1997; 418) Als Funktionssystem kann auch sie nur Personen, nur KlientInnen, AdressatInnen oder auch Fälle inkludieren, aber niemals Individuen. Auch Soziale Arbeit inkludiert, indem sie exkludiert. Folglich kann sie kaum für sich beanspruchen, Integration – die sich immer auf den ganzen Menschen bezieht – zu betreiben. Das Gegenteil ist der Fall: Soziale Arbeit reißt Menschen aus ihren lebensweltlichen Zusammenhängen heraus, weil sie „ihre Probleme nicht in einer [...] auf Alltagswissen beruhenden Interaktion mit Verwandten und Freunden, sondern mit Expertenwissen verwaltenden Professionellen“ (ebd.) zu lösen versucht. 3.4.2. Nichts ist unmöglich! Soziale Arbeit jenseits der Unterscheidung von Norm und Abweichung Die These der Desintegration im Inklusionsbereich rückt ein weiteres Merkmal der funktional differenzierten Gesellschaft ins Blickfeld: Die Normalität von Desintegration als Resultat der nur noch nachrangigen Bedeutung von homogenen gesellschaftlichen Einheiten korrespondiert mit der (zwangsweisen) Freisetzung der Individuen von normativen Erwartungen und sozialen Bindungen. „Die moderne Gesellschaft untergräbt“ aufgrund ihres Differenzierungsprinzips „unwiderruflich diejenigen sinnstiftenden sozialen Strukturen und kulturellen Gehalte, die in vormodernen Gesellschaften existiert hatten.“ (Schimank 1998; S. 69) Auf der anderen Seite schafft erst der selektive Zugriff der Gesellschaft auf Menschen die Voraussetzungen für die Pluralität moderner Lebensformen jenseits von kultureller, normativer, weltanschaulicher oder moralischer Vorgaben. Dies ist jedoch nicht nur eine Nebenwirkung funktionaler Differenzierung, „sondern ein unhintergehbares funktionales Erfordernis“ (ebd.) dieser Gesellschaftsform, weil nur solche Bewusstseinssysteme den komplexen Anforderungen wechselnder Inklusionen gewachsen sind, „die sich jeweils als einzigartig und selbstbestimmt auffassen.“ (ebd.) Die Konstituierung der eigenen Identität stellt heute die Voraussetzung dafür dar, an Kommunikation anschließen zu können. Die weitestgehend auf fremdreferentiellen Operationen basierende Individualität vormoderner Gesellschaften stellte die Anschlussfähigkeit an Kommunikation noch über die Orientierung an „tradiertem, gruppenspezifischen Regelwis- sen“ (Nassehi 1997; S. 123) her. In der modernen Gesellschaft hingegen „müssen sich Individuen gewissermaßen außerhalb bzw. neben dem Inklusionsbereich der funktionalen Teilsysteme Formen der Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung erschließen.“ (ebd.; S. 129) Sie müssen „sich selbst zum Maß aller Dinge machen.“ (Kneer & Nassehi 1997; S. 162) Weil individuelle Identität sich nicht mehr an gesamtgesellschaftlich geteilte Normen anlehnt, kann auch Soziale Arbeit nicht mehr anhand der Unterscheidung Abweichung/Norm entscheiden, ob geholfen werden soll oder nicht. Insofern ist es ein Irrtum, anzunehmen, Soziale Arbeit orientiere sich entlang des binären Codes Konformität/Devianz, wonach sich ein spezifischer Hilfebedarf anhand einer konkreten Abweichung von allgemeingültigen Merkmalen bestimmen ließe. Die neue Leitdifferenz Helfen/Nichthelfen ist hinsichtlich der Art und Weise, wie geholfen wird, völlig indifferent. Sie „markiert nur ein funktionales Prinzip, ein Prinzip, das den Erfolg der Hilfe erst dann sichtbar werden läßt, wenn aus Hilfe Nicht-Hilfe wird, wenn stellvertretende Inklusion durch die Soziale Arbeit in sozialarbeiterische Exklusion übergeht und Inklusionen in die primären Funktionssysteme personell wieder möglich werden.“ (Kleve 1999a; S. 238) Dies hat nach Kleve zu einer Erosion der klassischen Leitdifferenz der Sozialarbeit geführt. Es kann „nicht mehr klar gesagt werden [...], von welcher Norm Personen abweichen und hinsichtlich welcher Norm sie als KlientInnen angepaßt, re-integriert werden sollen.“ (ebd.) Dadurch habe Soziale Arbeit ihre klare, eindeutige Orientierung verloren. Im Hinblick auf den modernen Modus der Vergesellschaftung komme der Sozialen Arbeit stattdessen die Aufgabe zu, gemeinsam mit den Adressaten „Formen zu finden und auszubilden, in denen Pluralität vollziehbar und in Übergängen mit neuen Identitätsfindungen lebbar wird.“ (ebd.; S. 240) 3.4.3. Hilfe und sonst nichts! Soziale Arbeit jenseits ihres doppelten Mandats Das doppelte Mandat der Sozialen Arbeit bezeichnet nach Böhnisch & Lösch (1975) die Konfliktlinie, die sich daraus ergibt, dass Soziale Arbeit sich immer „zwischen der Orientierung an den Interessen seiner Klienten und den (in den Tätigkeitserwartungen der Sozialadministration vermittelten) gesellschaftlichen Ordnungs- und Kontrollinteressen“ (ebd.; S. 37) bewegt. Dieses auch mit der Unterscheidung von Hilfe und Kontrolle gekennzeichnete „zentrale Strukturmerkmal [der] spezifischen sozialen Dienstleistungsfunktion“ (ebd.; S. 28) des/der SozialarbeiterIn „kann jedoch nicht allein auf Loyalitätskonflikte innerhalb von Institutionen zurückgeführt werden“ (ebd.), wie sie von SozialarbeiterInnen erfahren werden. Forderungen nach größerer Autonomie des/der SozialarbeiterIn gegenüber institutionellorganisatorischen Zwängen treffen deshalb nicht den Kern des Problems. Vielmehr muss „der politisch-soziale Horizont, vor dem Sozialarbeit sich vollzieht“ (ebd. S. 27), berücksichtigt werden. Es geht um die „sozioökonomischen Bedingungen, unter denen die Masse der Klienten zum Gegenstand der Sozialarbeit wird“ (ebd.; S. 29), und die zugleich die Bedin- gungen darstellen, unter denen Beteiligungsmöglichkeiten für KlientInnen erreicht werden können. Verlagert man die Beobachtung Sozialer Arbeit auf die Ebene autopoietischer Gesellschaftssysteme, dann spielen derartige Überlegungen keine Rolle mehr. Kleve stellt die These auf, dass die Unterscheidung von Abweichung/Norm als vermeintliche Leitdifferenz der Sozialen Arbeit verschleiere, „dass es ihre eigenen Interaktionen, Organisationen bzw. funktionssystemischen Kommunikationen sind, die in struktureller Kopplung mit deren sozialer Umwelt bestimmen, wem unter welchen Bedingungen wann und wie geholfen werden kann.“ (Kleve 1999a; S. 244) Mit Bezug auf die im vorhergehenden Kapitel erörterte Auflösung normativer Zusammenhänge geht es „es im Fall der Sozialarbeit wie im Fall der Sozialpädagogik um »Hilfe« und nicht etwa um die Kontrolle von »Abweichung«.“ (Bommes & Scherr 1996; S. 117) „Soziale Arbeit ist ein eigenständiges Berufssystem, das Hilfe anbietet und sonst nichts.“ (Wolf o.J. in: Kleve 1999a; S. 205) 4. Kritik Der Grundlagenteil dieser Arbeit ist abgeschlossen und es ist an der Zeit, aus dem Schatten der Luhmannschen Theorie herauszutreten, auch wenn – oder gerade weil – das Vorhaben, die Ausgangsthese, Soziale Arbeit habe sich als sekundäres Funktionssystem ausdifferenziert, so plausibel und zugleich präzise wie möglich nachzuzeichnen, im Ergebnis nicht befriedigt. Vielmehr reflektieren die vorangegangenen Kapitel die Erfahrungen, die ich auch bei der Lektüre der Originaltexte gemacht habe: Vieles von dem, was Luhmann und seine geistigen Erben (neu-)entdecken, hätte auch ohne den Aufwand einer allgemeinen Theorie der Gesellschaft gesagt werden können. Andererseits leidet die Theorie als Ganzes an einer Reihe von Erklärungslücken, auf deren Auflösung man vergeblich wartet. Die Theorie Sozialer Systeme erwartet von Ihrem Leser die Abkehr von gewohnten (alteuropäischen) Denkmustern, ohne in ihrer jetzigen Form soziale Wirklichkeit widerspruchsfrei beschreiben – geschweige denn erklären – zu können. An dieser Stelle muss mit einem Mythos gebrochen werden, den auch die vorliegende Arbeit bis dato gepflegt hat: dass das Luhmannsche Werk bereits in Form einer ausgereiften Theorie vorliegt. Der beeindruckende Umfang der Luhmannschen Veröffentlichungen, der Luhmann den Ruf eines Polyscriptors einbrachte, der elaborierte Habitus seiner Ausführungen, die zahlreichen Einführungen, ja sogar Lexika, die ausschließlich den Luhmannschen Begriffen gewidmet sind, täuschen darüber hinweg, dass ihr Gegenstand sich allenfalls im Entwurfsstadium befindet (vgl. auch Kastl 1999; S. 240). Man kann Luhmann bei einem Projekt von diesem Ausmaß den Stand der Theorieentwicklung nicht zum Vorwurf machen, zumal Luhmann aus der Tatsache kein Geheimnis gemacht hat, dass Veröffentlichungen für ihn nicht mit einer „Perfektions-Vorstellung“ verbunden waren, sondern eher vorläufige Schnappschüsse ohne Anspruch auf Endgültigkeit darstellten (vgl. Luhmann 1985; S. 142). Die Vorbehaltlosigkeit, mit der die Luhmannschen Begriffe neuerdings in den verschiedens- ten sozialwissenschaftlichen Disziplinen Einzug erhalten, ist angesichts dieser Selbsteinschätzung allerdings überraschend. Die nachfolgenden Ausführungen reklamieren für sich ebenfalls den Status der Vorläufigkeit. Sie beanspruchen keinesfalls, das letzte Wort in Sachen Luhmann-Kritik zu sprechen und werden nach Möglichkeit in der Zukunft weitere Revisionen erfahren. Mit Rücksicht auf die Tatsache, dass es sich bei dem Luhmannschen Œuvre um ein „zweifellos sperrige[s] Konvolut“ (Scherr 2001; S. 64) handelt, beschränke ich mich notwendigerweise auf einige Kernaussagen der Theorie. Nicht eine vollständige, alle Aspekte umfassende Kritik ist das Ziel, sondern eine Übersicht über die nach meiner Einschätzung zentralen Stellen, an denen eine sachbezogene, kritische Auseinandersetzung mit der Luhmannschen Theorie ansetzen kann. Es geht dabei weniger um Detailfragen, sondern um tragende Bauteile innerhalb der Theorie sozialer Systeme und der Theorie der Gesellschaft. Dies sind der Begriff der Autopoiesis als Grundlage der kommunikativen Verfasstheit des Gesellschaftssystems, die systemtheoretische Neufassung des Machtbegriffs, die These vom Primat der funktionalen Differenzierung für die moderne Gesellschaft, der Luhmannschen Gesellschaftsbegriff im allgemeinen sowie der Begriff der Exklusion zur Bezeichnung von gesellschaftlichem Ausschluss. Die Frage, inwiefern Soziale Arbeit als gesellschaftliches Funktionssystem im Luhmannschen Sinne gefasst werden kann, tritt zugunsten einer Kritik des theoretischen Unterbaus weitgehend zurück. Die im Folgenden noch zu zeigenden theorieimmanenten Problematiken geben ausreichend Anlass zur Annahme, dass die Systemtheorie, wie sie in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt wurde, als Grundlage einer Theorie der bzw. für die Sozialen Arbeit wenig tragfähig ist. Auf eine eingehende Prüfung der Auslegung der Luhmannschen Konzepte für die Soziale Arbeit kann daher verzichtet werden. 4.1. Autopoiesis Die Theorie der Autopoiesis weist bereits in ihrer ursprünglichen Fassung durch Maturana und Varela einige Schwächen auf, die ihre Generalisierung im Rahmen der Theorie sozialer Systeme zumindest unglücklich erscheinen lassen. Maturana und Varela beanspruchen, Leben mit dem Konzept der Autopoiesis zu erklären. Sie geben jedoch nicht das, was gemeinhin unter einer Erklärung verstanden wird, sondern nur eine tautologische Beschreibung der Bestandsvoraussetzungen von Zellen (die Aufrechterhaltung einer Grenze zu ihrer Umwelt, die Bewahrung einer gewissen organisatorischen Identität etc.) ohne konkret benennen zu können, wie bzw. mit welchen Mechanismen lebende Systeme ihre Struktur aufrechterhalten.10 10 „Erklärungen bleiben nicht bei der Deskription von Sachverhalten stehen und wollen diese auch nicht in einem phänomeno- logischen Sinne verstehen, sondern sie fragen nach dem Warum, nach den Ursachen, nach den Wirkzusammenhängen.“ (Reinhold 1997; S. 150) Vieles spricht zudem dafür, dass ideologische Erwägungen die Autoren verleitet haben, Teilphänomene des Lebens zugunsten der universalen Geltung individueller Autonomie auszuklammern11. So verstoßen beispielsweise Viren in grundlegender Weise gegen Maturanas und Varelas Definition von Leben, weil sie instruktiv auf die Organisation von Zellen einwirken, indem sie Teile ihrer DNA ‚verpflanzen‘. Ungeachtet dieser Veränderung der Organisation setzen die Zellen ihre Autopoiesis (wenn man noch von Autopoiesis sprechen kann) fort (vgl. ausführlich: Viskovatoff 1999). Insofern verwundert es nicht, dass die Theorie im Fachbereich Biologie allenfalls ein Inseldasein fristet: Es handelt sich eher um eine biophilosophische, denn um eine biologische Theorie. Die Theorie sozialer Systeme kann sich also kaum auf vermeintlich abgesicherte Ergebnisse aus anderen Wissenschaftsbereichen berufen, denn diese sind bereits innerhalb ihrer eigenen Fachdisziplin umstritten. Weder in der Biologie, noch im Bereich der Neurophysiologie repräsentiert die Theorie der Autopoiesis den Mainstream. Daraus ergibt sich nicht zwangsläufig, dass die Luhmannsche Adaption der Autopoiesis falsch ist. Denn psychische Systeme und soziale Systeme sind jeweils emergent, d.h. sie können und dürfen nicht auf die „Eigenschaften ihrer Komponenten [...] zurückgeführt werden“ (Luhmann 1997, S. 134). Das bedeutet aber im Gegenzug, dass die Gültigkeit des Konzeptes der Autopoiesis sich an diesen Phänomenbereichen in je eigener Weise zu bewähren hat (vgl. Kastl 1999; S. 205). Luhmann gelingt es meines Erachtens nicht, die Autopoiesis des Bewusstseins und des Sozialen plausibel darzulegen. Trotz dessen zentraler Stellung innerhalb der Theorie bleibt er einen tragfähigen Beweis für die Anwendbarkeit des Autopoiesiskonzeptes schuldig. Seine Argumentation lässt sich im Grunde auf den folgenden Satz verdichten: Reduziert man Individuen auf Bewusstseinssysteme und Gesellschaft auf Kommunikation, dann ergibt sich deren Schließung schon allein daraus, dass deren Letztelemente – Gedanken bzw. Kommunikationen – jeweils nicht im anderen Phänomenbereich vorkommen können. Dies klingt auf den ersten Blick einleuchtend; man darf jedoch nicht übersehen, dass Luhmann hier auf einer äußerst abstrakten Ebene mit selbsterzeugten Plausibilitäten argumentiert: Die Autopoiesis von sozialen und psychischen Systemen ist sowohl Resultat der kommunikativen Fassung der Gesellschaft, als auch deren Voraussetzung. Sie ist Explanans und Explanandum zugleich. Auf einer konkreteren Kommunikation und Ebene äußert Bewusstsein sich in die der wechselseitige Unmöglichkeit, Geschlossenheit von den Ablauf eines Kommunikationsgeschehens einseitig zu determinieren. Diese Unbestimmbarkeit „wird unausweichlich zur Erfahrung, sobald es überhaupt dazu kommt, dass zwei Menschen einander beobachten.“ (Kieserling 1999; S. 87) Die Autopoiesen werden also über Diskontinuitätserfahrungen des Bewusstseins erlebbar: „Man kann das [die Geschlossenheit von Kommunikation und Bewusstsein HS] an Erfahrungen festmachen wie, dass sich Kommunikationen schlecht vorausplanen lassen, dass das, was in einer Kommunikation 11 Maturana und Varela haben auf der Basis des Autopoiesiskonzeptes eine Ethik abgeleitet, welche die Freiheit und Eigenver- antwortlichkeit des Individuums in den Vordergrund stellt (vgl. Maturana 1994). zustande kommt, nicht einfach eine Funktion eines zuvor gedachten ist, an Schwierigkeiten, einer psychischen Erfahrung Ausdruck in der Kommunikation zu verleihen.“ (Kastl 1999; S. 219) Die Existenz derartiger Erfahrungen kann nicht ernsthaft bestritten werden. Einen Beleg für die Getrenntheit von Kommunikation und Bewusstsein stellen sie aber nicht dar. Denn auch ohne die Prämisse der Geschlossenheit der beteiligten Systeme lassen sich solche Phänomene beschreiben ohne zwangsläufig in einen einseitigen Determinismus zu verfallen. Die Verortung der Individuen in der Umwelt der Kommunikation ist also weder eine notwendige Konsequenz, noch ist sie in diesem Zusammenhang sonderlich plausibel: Es leuchtet bis zu einem gewissen Punkt noch ein, dass Kommunikation nicht auf des Handeln eines einzelnen Akteurs reduziert werden kann, aber entspricht es nicht ebenfalls der Erfahrung (und um die geht es hier), dass Individuen zumindest „ein strukturierendes Moment dessen“ sind, „was in der Kommunikation zustande kommt?“ (Kastl 1999; S. 220) Andererseits sind auch die Luhmannschen Systeme mit ihrer Umwelt in hohem Maße koordiniert und damit in gewisser Weise vorhersagbar und determinierbar. Wie sonst, wenn nicht auf Basis wiederholt erlebbarer Korrelation von Systemen können Bewusstseinssysteme erfolgreich „unter der Illusion eines Umweltkontaktes“ (Luhmann 1997, S. 93) operieren? Erst auf der Ebene von Beobachtungen zweiter Ordnung, also jenseits der Alltagserfahrung, wird die wechselseitige Geschlossenheit der autopoietischen Systeme sichtbar. „Solange sie [die Systeme] nur beobachten, was sie beobachten, und nicht beobachten, wie sie beobachten“ (ebd.) ist der Illusionscharakter der Wahrnehmung nicht durchschaubar. Gänzlich überwinden lässt sich diese Illusion ohnehin nicht, denn auf die Beobachtung erster Ordnung kann nicht verzichtet werden, insofern „auch die Beobachtung zweiter Ordnung noch einen Beobachter muß beobachten können.“ (ebd.) Daher können die Bewusstseinssysteme gar nicht anders, als „Erfahrungen von Widerstand und Nichtbeliebigkeit der Operationsresultate“ (ebd.) extern zu verbuchen und von einer Welt auszugehen, „der man sich zu fügen hat. Phänomenologie wird als Ontologie praktiziert.“12 (ebd.) Diese einander widersprechenden Erfahrungen der Diskontinuität innerhalb von Kommunikation einerseits und der Erfahrung von „Widerstand und Nichtbeliebigkeit der Operationsresultate“ (ebd.) andererseits können im Rahmen der Theorie der Autopoiesis nicht konsistent integriert werden. Das Dilemma lässt sich jedenfalls nicht einfach dadurch lösen, dass den Diskontinuitätserfahrungen ein höherer Wirklichkeitsstatus eingeräumt wird, während die mit der Theorie unvereinbaren Kontinuitätserfahrungen als „Illusionen“ gebrandmarkt werden. Das Autopoiesiskonzept wird durch diesen willkürlichen Umgang mit unterschiedlichen Wahrnehmungen letztendlich jeglichem Zugriff auf der Ebene von unmittelbaren Er- 12 Luhmann unterstellt hier, wie Kastl feststellt, „einen äußerst simplen Begriff von ‚Ontologie’. Er ist gleichbedeutend mit der Annahme einer unabhängigen, absoluten Realität. Die Möglichkeit einer Ontologie, deren Seinsbegriff sich gerade an einer Relationalität von System und Umwelt orientieren könnte, lässt er schlichtweg unter den Tisch fallen.“ (Kastl 1999, S. 227) fahrungen entzogen, unabhängig davon, ob diese für oder gegen die operationale Geschlossenheit von Bewusstsein und Kommunikation sprechen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch Luhmann Verständnis von „Illusion“, wie er es selbst an nachfolgendem Beispiel illustriert: „Man sieht, dass die Sonne »aufgeht«, und kann es nicht anders sehen, obwohl man weiß, dass man sich täuscht. Anders gesagt: Auf der Ebene der Beobachtung erster Ordnung, die nie ganz aufgegeben werden kann, kann zwischen Realität und Realitätsillusion nicht unterschieden werden.“ (Luhmann 1997; S. 93) Natürlich ist die Aussage, dass die Sonne die Erde umkreist, strenggenommen falsch. Aber kann allein deshalb auf den trügerischen Charakter der Wahrnehmung geschlossen werden? Allenfalls könnte von einer falschen Schlussfolgerung auf Basis einer zutreffenden Wahrnehmung gesprochen werden. Die Unmöglichkeit, sich wider besseren Wissens dieser vermeintlichen Täuschung zu entziehen „deutet gerade nicht auf den Illusionscharakter der Wahrnehmung hin“, sondern „dokumentiert geradezu die Verlässlichkeit dieser Ebene ‚erster Beobachtung’ gegenüber jedem davon abgeleiteten Wissen.“ (Kastl 1999; S. 228) Denn die auf der übergeordneten Beobachtungsebene zweiter Ordnung gewonnene Erkenntnis steht nicht im Widerspruch zu der ursprünglichen Beobachtung erster Ordnung, sondern leistet sogar eine Erklärung dafür, warum diese so ist, wie sie ist. Mit Erklärungen tut sich die Theorie der Autopoiesis ohnehin schwer. Ihr Erklärungsvermögens tendiert, wie es bereits in der biologischen Fassung durch Maturana zutage tritt, gegen null. Auch Luhmann deklariert schlicht, dass Systeme sich selbst produzieren, aber er kann nicht erklären, warum und wie spezifische gesellschaftliche Verhältnisse sich etablieren. „Es sind mehr deskriptive Schilderungen von Differenzierungsprozessen, ohne eine Erkenntnis jener Faktoren, die für das Vorantreiben des Differenzierungsprozesses verantwortlich zu machen sind.“ (Schwinn 2001, S. 23) Eine Tatsache, die Luhmann zwar einräumt, wenngleich er sie theoretisch nicht weiter problematisiert: „Er [der Begriff der Autopoiesis HS] sagt [...] nichts darüber, welche spezifischen Strukturen sich in solchen Systemen auf Grund von strukturellen Kopplungen zwischen System und Umwelt entwickelt haben. Er erklärt also nicht die historischen Systemzustände, von denen die weitere Autopoiesis ausgeht. [...] Die autopoietische Operation der Kommunikation voraussetzende Kommunikation erzeugt Gesellschaft, aber daraus ergibt sich noch nicht: was für eine Gesellschaft.“ (Luhmann 1997, S. 66) Insbesondere diese Tatsache des fehlenden Blicks auf die konstitutiven Bedingungen des Sozialen hat der Luhmannschen Systemtheorie den Vorwurf eingetragen, als Grundlage einer auf Kritik und Veränderung der gesellschaftlichen Bedingungen ausgerichtete Rezeption nicht zu taugen. Zwar hat u.a. Scherr (2000) darauf hingewiesen, dass eine kritische Gesellschaftsbeschreibung auf systemtheoretischer Basis möglich sei, beispielsweise durch „die Aufdeckung latenter Funktionen, das Aufzeigen problematischer Folgen der Gesellschaftsstruktur, das Bestreiten der Alternativlosigkeit von Organisationsformen und Entscheidungen, die Infragestellung einer fortschrittsoptimistischen Deutung des Modernisierungsprozesses...“ (Scherr 2000; S. 63) Aber auch jenseits von normativen Handlungsanweisungen lässt die Theorie gänzlich offen, welche Folgerungen aus der so gewonnenen Kritik abzuleiten wären. Denn in der Luhmannschen Gesellschaftskonzeption gibt es weder Personen noch Sozialitäten, die auf die gesellschaftlichen Verhältnisse (sei es mit guten oder schlechten Absichten) direkten Einfluss nehmen könnten. Gesellschaft evoluiert nach Luhmann plan- und ziellos entlang der eigenen Struktur. In dieser als grundsätzlich eigensinnig verstanden Gesellschaft „sind alle intentionalen, am Bewußtsein der Akteure ansetzenden Zugänge zum dezentrierten, Konstitutionsprozess in des Teilsystemperspektiven Sozialen verschlossen. zerfallenden In Gesellschaft einer bleibt vollständig für die Selbstthematisierung der Gesamtgesellschaft kein Ort und keine Instanz mehr übrig. [...] Damit ist jede Kritik- und Reformfähigkeit von Gesellschaft ausgeschlossen. Für alle, die aber gerade daran interessiert sind, ist die neuere Systemtheorie eine Sackgasse.“ (Schwinn 2000, S. 25) 4.2. Macht Ein gegenüber der Luhmannschen Theorie der Autopoiesis häufig geäußerter Vorwurf besagt, dass die auf Basis dieser Theorie formulierte Gesellschaftsbeschreibung blind für macht- und herrschaftsbedingte soziale Strukturen sei (vgl. Staub Bernasconi 1995 & 2000). Diese Kritik erscheint oberflächlich betrachtet unbegründet, da Luhmann bereits im Jahre 1975 ein Buch veröffentlicht hat, dass einzig dem Thema Macht gewidmet ist. Nach der „autopoietischen Wende“ wurde das Thema insbesondere in Zusammenhang mit dem Politiksystem wieder aufgenommen (vgl. Luhmann 2000). Machtblindheit kann also nicht völlige Ignoranz gegenüber dem Phänomen Macht bedeuten. Vielmehr geht es um die Frage, ob im Gesamt-Kontext der Luhmannschen Theorie wesentliche Aspekte von Macht – insbesondere in Bezug auf das Verhältnis der Wirtschaft zu den anderen Systemen – unberücksichtigt bleiben. Nach Luhmann ist Macht ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium und dient äquivalent zu anderen Medien dieser Art der Erhöhung der Annahmebereitschaft für ansonsten unwahrscheinliche Kommunikation. Als Code des Politiksystems wird Macht primär dem Bereich des Politischen zugerechnet, aber auch in Organisationen wird mittels des Mediums Macht kommuniziert. Luhmann grenzt seinen Machtbegriff explizit von der Weberschen Fassung von „Macht als ein[em] Handlungsvermögen, das sich gegen erwarteten Widerstand kausal durchsetzt“ (Luhmann 2000, S. 21) ab. Als problematisch an diesem traditionellen Machtbegriff sieht Luhmann einerseits die Vorannahme eines kausalen Wirkzusammenhangs, also die Unterscheidung von Ursache und Wirkung sowie – damit eng verknüpft – die Annahme einer identifizierbaren Wirkungsabsicht auf Seiten des Machthabers.13 13 Luhmanns Kritik des handlungstheoretischen Machtbegriffs verschließt sich zum Teil meinem Verständnis – zumindest soweit er sich dabei explizit auf Max Weber bezieht. Auch angesichts einer zugegebenermaßen äußerst selektiven WeberLektüre, dränget sich mir der Eindruck auf, dass Luhmanns am Kern der Weberschen Machttheorie vorbei argumentiert: Müsste nicht im Rahmen einer Kritik am Determinismus der alten Machttheorien das von Weber durch den Begriff der Chance eingeführte Wahrscheinlichkeitsmoment Berücksichtigung finden? Und belegen nicht die Weberschen Typen der Herrschaft, die die Motivlagen unterscheiden, aufgrund derer die Machtunterworfenen an die Rechtmäßigkeit der bestehenden Ordnung glauben, dass Weber Macht keineswegs so einseitig beim Machthaber verortet sieht, wie Luhmann unterstellt? Wie alle Kommunikation ist auch die mittels des Mediums Macht geführte Kommunikation ein eigenständiger Prozess, der nicht einseitig determiniert werden kann. Gemäß der Logik der Theorie autopoietischer Systeme können Macht und Herrschaft daher nicht als Ursache verstanden werden: „der Machthaber [ist] für das Zustandekommen von Macht [nicht] wichtiger oder in irgend einem Sinne ‚ursächlicher’ als der Machtunterworfene.“ (Luhmann 1988, S. 16) Kausalität stellt keine Eigenschaft der Systeme dar. Sie ist vielmehr das Resultat einer Beobachtung mittels der Unterscheidung Ursache/Wirkung. Ebenso sind Motive oder Absichten keine psychischen Tatsachen sondern Konstruktionen in Form von Selbst- oder Fremdzuschreibungen (vgl. Luhmann 2000, S. 25). Luhmanns Machttheorie verweist damit nicht mehr auf konkrete Akteure und deren Motive, sondern geht „von den Funktionen der Macht für das System der Gesamtgesellschaft“ (Luhmann 1988; S. 98) aus. Dementsprechend wird Macht in erster Linie im Hinblick auf ihre gesellschaftliche Funktion, „die Wahrscheinlichkeit des Zustandekommens unwahrscheinlicher Selektionszusammenhänge zu steigern“ (ebd., S. 12), problematisiert: Zu wenig Macht bedeutet eine unverträgliche Kompexitätssteigerung, während ein zuviel an Macht langfristig zu einem „Problem für die Realitätsangepaßtheit des Systems“ (Luhmann 2000, S. 20) – und damit zu einer Gefährdung von dessen Autopoiesis – werden kann. Dieses Verständnis vom „Risiko der Macht“ (Luhmann 1988; S. 82) setzt Luhmann „an die Stelle des alten, gut greifbaren, moralisierten, ‚rechtsfähigen’ Mißbrauchs-Konzepts“ (ebd.), welches zwar angesichts des nach wie vor alltäglichen – und heutzutage „in durch Technik gesteigerten Dimensionen“ (ebd.) auftretenden – Machtmissbrauchs durchaus seine Berechtigung habe, andererseits aber durch die „Hilflosigkeit der alten Mittel gegen Machtmissbrauch“ (ebd.) gekennzeichnet sei. Kritisch wendet sich Luhmann gegen „eine bloße Generalisierung alter Missbrauchs- und Unterdrückungsthemen – etwa im Konzept der ‚strukturellen Gewalt’, der ‚herrschenden Klasse’ oder ganz naiv in der Vorstellung des Mehrwert abschöpfenden Kapitalisten oder Plutokraten.“ (ebd.) Diese Auffassung sei realitätsfremd und fördere bloß die Stimulierung von Aggressionen. Unklar bleibt dabei jedoch, wo nach Luhmann die Grenze zwischen berechtigter und naiver, unzulässig generalisierter Kritik verläuft. Sein Vorwurf kommt daher einem Pauschalurteil gleich, wie es im übrigen auch an anderer Stelle durchklingt: „Allzu offensichtlich steckt hinter solchen [auf der überholten Moralsemantik basierenden HS] Vorwurfsbegriffen die Erfahrung, daß andere mehr von Macht profitieren, als man selbst.“ (Luhmann 2000; S. 20) Erstaunlich, wie unbedarft Luhmann ausgerechnet in diesem Kontext ein persönliches Motiv unterstellt. Eine gerechtigkeitsorientierte Machtkritik, die am Wohlergehen und der Partizipation aller interessiert ist, kann er sich offensichtlich nicht vorstellen. Notwendige Bedingung für diese rein funktionsbezogene Thematisierung von Macht ist die kommunikative Fassung aller Phänomene die traditionell unter diesen Begriff fallen. Voraussetzung hierfür ist nach Luhmann das Vorhandensein einer für beide Seiten verbindlichen Vermeidungsalternative. Machtbezogene Kommunikation „setzt voraus, dass beide Partner Alternativen sehen, deren Realisierung sie vermeiden möchten.“ (Luhmann 1988; S. 22) Diese Vermeidungsalternative muss dergestalt sein, dass der/die Machtunterworfene diese vergleichsweise „eher vermeiden möchte, als der Machthaber“ (ebd.) Trotz dieses notwendigen Ungleichgewichts ist von zentraler Bedeutung, dass sowohl der/die MachthaberIn, als auch der/die Machtunterworfene kein Interesse am Zustandekommen der Vermeidungsalternative haben. Denn die Macht bricht in dem Moment „zusammen, wenn es zur Verwirklichung der Vermeidungsalternativen kommt.“ (ebd.; S. 23) Aus diesem Grund ist „das Vermeiden von (möglichen und möglich bleibenden) Sanktionen [...] für die Funktion von Macht unabdingbar.“ (ebd.) Eine derartige, für beide Seiten bindende, Vermeidungsalternative ist allerdings nur unter der Voraussetzung denkbar, dass der/die MachthaberIn grundsätzlich auf die Kooperation benennbarer Entitäten angewiesen ist. In dem Moment, in dem Personen, Organisationen oder Systeme mehr oder weniger austauschbar sind, wie es beispielsweise im Verhältnis von Organisationen der Wirtschaft zu ArbeitnehmerInnen ebenso der Fall ist, wie im Verhältnis von global operierenden Konzernen zu lokal begrenzten Staaten, ist die Annahme der Kommunikation im Einzelfall keine notwendig Voraussetzung, weil es stets alternative Handlungsoptionen zur Erreichung der Organisationsziele gibt. Die Wahrnehmung der Vermeidungsalternative ist dann nicht der „worst case“, sondern gehört gewissermaßen zum Kalkül dieser Form von Organisationen, die sich im Hinblick auf Produktionsstandorte, Absatzmärkte und Personal immer für die jeweils günstigsten Angebote entscheiden können. Bricht dadurch deren Macht zusammen, wie Luhmann es prophezeit? Im Gegenteil: Die Organisationen haben nicht nur ihr Ziel erreicht, sondern können sich auch weiterhin auf dem Markt der Arbeitssuchenden Individuen bzw. um Investitionen werbenden Staaten frei bedienen. Im Konkurrenzkampf um Arbeitsplätze/Investitionen haben weder Individuen, noch Staaten eine andere Wahl, als sich im Umfang der gewährten Zugeständnisse gegenseitig zu überbieten. Das zunehmende Machtgefälle zwischen global operierenden Organisationen des Wirtschaftssystems und den aufgrund ihrer nationalstaatlichen Begrenztheit vergleichsweise zahnlosen Politik- und Rechtssystemen wirft zudem die Frage auf, wie angesichts dieses Ungleichgewichts noch von der Gleichheit und Autonomie aller gesellschaftlichen Teilsysteme ausgegangen werden kann. Wie Staub-Bernasconi (2000; S. 232ff) am Beispiel des WTO-MAI-Abkommens14 deutlich macht, erweisen sich das Politik- und Rechtssystem gegenüber dem Zugriff des Wirtschaftssytems weitgehend ungeschützt. Sie sind gewissermaßen grenzenlos, insofern es ihnen nicht mehr gelingt, ihre exklusive Zuständigkeit für ihr jeweiliges Bezugsproblem zu behaupten und sie wesentliche Kompetenzbereiche an das Wirtschaftssystem abtreten. Indem Luhmann Macht ausschließlich in der Form eines gesellschaftlichen Kommunikationsmediums fasst, verstellt er die Sicht auf Machtstrukturen, die einzelne Machthaber in die 14 Multilateral Agreement on Investment: Ein „Produkt geheimer Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik“, mit dem Ziel der „Mobilisierung höherer ausländischer Direktinvestitionen und [dem] Transfer von Technologien durch eine investitionsfördernde nationale Politik sowie die Schaffung von Rechtssicherheit für ein Investitionsvolumen“ von mehr als 3 Billiarden USDollar (Staub-Bernasconi 2000; S. 232). Lage versetzen, durch schlichtes Handeln gesellschaftliche Realität herzustellen, ohne Rücksicht auf die Interessen der von diesem Handeln betroffenen Menschen, Organisationen oder Staaten nehmen zu müssen. Luhmann blendet dieses Möglichkeit grundsätzlich aus, indem er Macht als reinem Handlungsvermögen nur einen ans Lächerliche grenzenden Stellenwert einräumt: „In einem extrem weiten Sinne könnte man jede Fähigkeit zu effektivem Handeln als Macht bezeichnen. Danach hätte man Macht, wenn man den Zustand der Welt [...] nach eigenen Absichten verändern kann. [...] Diese Machtfreiheit alleine ließe sich aber nicht als ein soziales System ausdifferenzieren. Sie wäre im übrigen geringe Macht – sich die Zähne putzen, seinen Wagen zu parken, ein Buch in den Abfalleimer zu werfen, oder einfach: etwas zu sagen.“ (Luhmann 2000; S. 39) 4.3. Funktionale Differenzierung Am Beispiel der Luhmannschen Machttheorie ist bereits deutlich geworden, dass die Systemtheorie den konstitutiven Bedingung für die Etablierung und Aufrechterhaltung von sozialen Ungleichheitsstrukturen nur wenig Aufmerksamkeit schenkt. In der primär funktional differenzierten Gesellschaft spielt soziale Ungleichheit streng genommen keine Rolle mehr, denn ihr kommt keine funktionale Bedeutung zu. Schichtung ist nicht mehr das entscheidende Strukturmerkmal für die Regelung von Kommunikation oder für die soziale Positionierung von Individuen und wird daher als nur noch nachrangige, nicht mehr gesellschaftsprägende Differenzierungsform ohne eigenständiges Strukturierungspotenzial gefasst. Luhmann stimmt zwar mit Bourdieu überein, dass innerhalb der gesellschaftlichen Schichten einen „verbissenen Kampf gegen Nivellierung“ und ein „Bemühen, kleinsten, »feinsten« Unterschieden soziale Bedeutung abzugewinnen“ (Luhmann 1997; S. 774f) zu beobachten sei. Das Bemühen der Akteure um die Bourdieuschen „feinen Unterschiede“ stellt für Luhmann vor dem Hintergrund der Theorie funktionaler Differenzierung aber lediglich eine Kuriosität am Rande dar, die angesichts eines fehlenden „gesellschaftsstrukturellen Hintergrundes“ in erster Linie durch ihre „Vergeblichkeit“ beeindruckt (ebd.) Die Luhmannsche Systemtheorie trägt damit ihrerseits eine spezifische Erklärungslast: Sie müsste plausibilisieren können, wie „vertikale Differenzierung aus einem horizontalen [...] Differenzierungsprinzip“ (Schwinn 1998; S. 11) abgeleitet werden kann. „Eine konsistente Fassung des Verhältnisses von Schichtung und funktionaler Differenzierung kann“ sie jedoch „nicht anbieten“ (ebd.; S. 4). Schichtung stellt in der modernen Gesellschaft lediglich ein funktionsloses Nebenprodukt der gesellschaftlichen Operationen dar, dass damit letztendlich nur als ein „zufallsgesteuertes Ereignis“ (ebd.; S. 11) verstanden werden kann, welches sich in Form von individuellen Karrieren verdichtet. Zufall stellt in diesem Zusammenhang jedoch ein denkbar ungünstiges Erklärungsprinzip dar. Es lässt sich – angesichts der selektiven Verteilung von Armut und Exklusion auf soziale Cluster – nicht halten: „Rasse (nicht-weiß), Klasse (Arbeiter, insbesondere die un- und angelernten) und Geschlecht (weiblich) sind die entscheidenden sozialen Merkmale, an denen sich ein höheres Risiko, sozial ausgeschlossen zu werden, festmacht.“ (Kronauer 1998) Dass „sich der Zugriff von Schichtung auf das Interaktionsgeschehen gegenüber der vormodernen Ordnung gelockert“ (Schwinn 1998; S. 5) hat, kann nicht bestritten werden. Schichten sind in der modernen Gesellschaft nach oben wie nach unten durchlässiger geworden sein. Der Professorensohn, der eine Ausbildung zum Automechaniker macht ist aus heutiger Sicht ebenso vorstellbar, wie die Tochter des Sozialhilfeempfängers, die bereits im Alter von 30 Jahren ein Vermögen an der Börse gewinnt. Derartige Karrieren sind sicherlich keine Einzelfälle und daher im Rahmen einer Soziologie der Gesellschaft erklärungsbedürftig. Sie stellen andererseits aber auch nicht die gesellschaftliche Normalität dar. Die Chancen für einen Platz in den oberen Schichten stehen für den Professorensohn immer noch besser, als für die Tochter des Sozialhilfeempfängers. Vor diesem Hintergrund erscheint die Feststellung, „Die Integration von Individuum und Gesellschaft“ habe sich von Herkunft [...] auf Karriere umgestellt“ (Luhmann 1999; S. 149) ebenso unplausibel, wie eine ausschließlich am Begriff der Klasse orientierte Ungleichheitstheorie. Luhmann verschiebt das Problem, wie soziale Ungleichheitslagen in der modernen Gesellschaft zustande kommen, lediglich von der Makro- auf die Mikroperspektive und entzieht sich damit der Verantwortung für eine theoretische Klärung. „Was Luhmann in der Makroperspektive auf die funktionale Differenzierungsform nicht zu erklären vermag, wie Stratifikation entsteht, soll in der Mikroperspektive auf individuelle Karrieren zugerechnet werden. Das ist aber nur eine Verschiebung des Problems auf eine andere Aggregatebene, nicht seine Lösung.“ (Schwinn 1998; S. 4) Unberücksichtigt bleibt damit die Tatsache, dass soziale Mobilität nur zu einem geringen Teil als individuelle Mobilität gefasst werden kann. In der überwiegenden Zahl der Fälle sind es strukturelle Veränderungen der Gesellschaft insgesamt sowie eine damit einhergehende „Änderung in der Verteilung der Klassen zwischen zwei Zeitpunkten bzw. Generationen“ (Esser 2000; S. 180), die einen Wechsel der jeweiligen sozialen Position erzwingen. „Sehr viel, was zunächst wie das Ergebnis rein individueller Bemühungen aussieht, [ist] nichts weiter [...] als die Folge von gesellschaftlichen Veränderungen, denen sich die Akteure fügen müssen“ (ebd.; S. 182). So hat sich beispielsweise im Zuge der „‚Unterschichtung’ der westlichen Gesellschaften durch Arbeitsimmigranten“ (ebd.; S: 185) der soziale Status der vormals untersten Schichten verbessert. An diesem Beispiel wird noch ein weiterer Aspekt sozialer Mobilität deutlich, der sich einer Zurechnung auf individuelle Karrieren widersetzt: Vertikale Mobilität findet in hohem Maße im Rahmen kollektiver Prozesse statt, die ganze Schichten oder Berufsgruppen auf- oder abwerten (vgl. ebd.; S. 183). 4.4. Gesellschaft Ausgehend von einer primär funktional differenzierten Gesellschaft stellt sich noch ein weiteres Problem: Insofern Systemdifferenzierung nicht die Zerlegung einer Einheit in mehrere Teile, sondern (innere) Differenzierung von System/Umwelt-Differenzen bedeutet muss jedes Funktionssystem eine eigene funktionsspezifische Beschreibung der Gesamtgesellschaft anfertigen. Denn „die Funktion liegt im Bezug auf ein Problem der Gesellschaft, nicht im Selbstbezug oder der Selbsterhaltung des Funktionssystems.“ (Luhmann 1997; 746) Die Funktionssysteme sind auf einen spezifischen Beitrag für die Gesellschaft angelegt, den sie jeweils exklusiv erfüllen. Damit sollte klar sein: Funktion, so wie Luhmann sie fasst, ist losgelöst von der Gesellschaft nicht denkbar. Man darf also erwarten, dass Luhmann für den Gesellschaftsbegriff, also das Wofür und das Woraus der Differenzierung, eine brauchbare Konzeption erbringt. Er müsste darlegen, wie Gesellschaft als soziales System über eigene Operationen seine Grenzen festlegt. Der Gesellschaftsbegriff bleibt jedoch bei Luhmann theoretisch weitgehend unbestimmt. „Der funktionalen Differenzierungsthematik fehlt daher der Bezugspunkt und Rahmen.“ (Schwinn 2001; S. 58) Luhmann bestimmt die Einheit der Gesellschaft zunächst sehr weit als die operative Einheit der füreinander erreichbaren Kommunikationen (vgl. Krause 1996; S. 103). Gesellschaft ist demnach das umfassende Sozialsystem, dass alle anderen sozialen Systeme in sich einschließt. Außerhalb der Gesellschaft gibt es keine Kommunikation. „Die Einheit der Gesellschaft ist [...] die Einheit aller Kommunikationen“ (Schwinn 2001; S. 82). Dieser Gesellschaftsbegriff taugt jedoch nicht als Grundlage einer Theorie der Gesellschaft. Sein Aussagewert ist „völlig belanglos. [...] Die Gesellschaft ist hier ein bloßer Summenbegriff oder Sammelname: Gesellschaft ist das, was geschieht und das, was an Kommunikation übrigbleibt. Die Entscheidungen fallen dann in und durch die einzelnen Systeme, nicht aber durch »Gesellschaft«.“ (ebd.; S. 84) In einem engeren Sinne ist Gesellschaft bestimmt durch die „Einheit der Differenz der Teilsysteme“ (Krause 1996; S. 103). Die Einheit der Gesellschaft ist in diesem Fall durch die jeweils primäre Differenzierungsform bestimmt. Diese Form legt fest, wie im umfassenden System die Beziehungen zwischen den Teilsystemen realisiert werden, und selegiert dadurch die Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb der Gesellschaft vor. „Dieser enge Gesellschaftsbegriff kollidiert aber mit dem weiteren, in dem alles, was in Interaktionen kommuniziert wird, auch zur Gesellschaft gehört.“ (Schwinn 2001; S. 84) Wie Luhmann selbst feststellt: „Keine gesellschaftliche Teilsystembildung, keine Form gesellschaftlicher Systemdifferenzierung kann alle Bildung sozialer Systeme so dominieren, daß sie ausschließlich innerhalb der Primärsysteme des Gesellschaftssystems stattfindet.“ (Luhmann 1997; S. 812) Das Gesellschaftssystem umfasst in jedem Fall auch funktional nicht zuordenbare, freie Kommunikation, auf die es keinen Zugriff hat und „bleibt [damit HS] indifferent gegenüber funktionalen, funktionsindifferenten oder gar dysfunktionalen Interaktionen (Schwinn 2001; S. 84) Aus diesem Grund kann „die Einheit der Gesellschaft nicht in der funktionalen Differenzierungsform ihren Ausdruck finden.“ (ebd.; S. 83) Gesellschaft bleibt bei Luhmann letztendlich „eine nicht vorhandene Aggregatebene.“ (ebd.; S. 27) Ein weiteres Problem stellt in diesem Zusammenhang die ungleichgewichtige Ausbildung der Funktionssysteme dar, auf die bereits in Kapitel 4.2 eingegangen wurde. Die Differenzierungsform der Gesellschaft besitzt keinerlei Regelungspotenzial für die Größenverhältnisse zwischen den Funktionssystemen. Im Gegenteil: „An alle Teilsysteme ergeht der Auftrag, sich selbst im Verhältnis zu den anderen zu überschätzen.“ (ebd.; S: 76) Die Chancen der einzelnen Funktionssysteme, Kommunikation an sich zu binden, ist jedoch alles andere als gleich, so dass einzelne Funktionssysteme sich zu Ungunsten anderer Systeme erheb- lich ausgeweitet haben. Potenziert wird die Ungleichgewichtigkeit noch dadurch, dass „manche Funktionsbereiche an nationalen Grenzen haltmachen, wie Politik und Recht, während andere, Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst, weitgehend unabhängig von nationalen Grenzen operieren.“ (Schwinn S. 76f) Wie die einzelnen Funktionssysteme unter diesen Umständen der räumlichen und quantitativen Ungleichgewichtigkeit eine spezifischen Beschreibung der einen Gesamtgesellschaft anfertigen sollen, deren Gegenstandsbereich sich zumindest annähernd mit der Beschreibung der anderen Systeme deckt, bleibt unklar. 4.5. Exklusion Ein schier unermessliches Reservoir für ungebundene Kommunikationen ist auch der wachsende gesellschaftliche Exklusionsbereich, der der Systemtheorie seit einigen Jahren Kopfschmerzen bereitet. Spätestens die überraschende Entdeckung des massenhaften Elends der aus den Funktionssystemen ausgeschlossenen Individuen hätte auch Luhmann davon abbringen müssen, „alles, was in der sozialen Welt geschieht“ von einer „‚außerhalb’ der Menschen etablierten und von Interessen und Akteuren unabhängigen ‚Gesellschaft’ her“ (Esser 2000; S. 259) bestimmen zu wollen. Denn in Bezug auf die Einheit der Gesellschaft passt die überraschende Entdeckung der Totalexklusion von Individuen aus den Funktionssystemen nicht ins Konzept. Findet sich im gar nicht so neuen Exklusionsbereich doch „jener Typus an Vergesellschaftung, den Luhmann stets als unerheblich abgetan hat: Die Entstehung sozialer Systeme und deren Erklärung als ‚Emergenz von unten’.“ (ebd.) Dieser Umstand lässt sich natürlich mit Bezug auf die Bestimmung der Einheit der Gesellschaft als Gesamtheit aller aufeinander bezogener Kommunikation theoretisch einbeziehen. Aber damit bleibt Gesellschaft, wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt, völlig unbestimmt. Sie ist ein System ohne Grenzen, in dem letztendlich alles möglich ist. Auch im Hinblick auf die Primatsthese ist die überraschende Entdeckung von gesellschaftlichem Ausschluss nicht unproblematisch. Denn die Funktionssysteme können – anders als Luhmann angenommen hatte – die von ihnen postulierte Vollinklusion ohne ersichtlichen Grund nicht realisieren. Aber damit nicht genug: Die wechselseitige Verstärkung von Exklusion steht zudem im Gegensatz zur These der Autonomie und Hierarchielosigkeit der funktionalen Teilsysteme, wonach diese nur nach jeweils eigenen Kriterien inkludie- ren/exkludieren und kein Funktionssystem eine Vorrangstellung innehat. Einerseits schließt „das Prinzip funktionaler Differenzierung die Integration der funktionsspezifischen Ressourcen, Macht, Geld, Bildung etc., untereinander aus, andererseits wird aber die Kumulation dieser einzelnen sozialen Ressourcen zu stabilen Soziallagen [bzw. Exklusionslagen HS] festgestellt.“ (Schwinn 1998; S. 4) Trotzdem hält Luhmann – abgesehen von vagen Andeutungen in Richtung einer neuen Leitdifferenz (vgl. Luhmann 1999; S. 147) – an der funktionalen Autonomie der Teilsysteme fest und betont diesbezüglich die funktionale Irrelevanz von Exklusion für die Reproduktion der gesellschaftlichen Teilsysteme, denn in den Favelas gebe es letztendlich nichts, „was auszubeuten oder zu unterdrücken wäre.“ (ebd.) Anstatt die Widersprüche zu bearbeiten, die dieser Inkompatibilität der funktionssystemischen Beschreibung mit der gesellschaftlichen Realität zugrundeliegen, versucht Luhmann mit der Ausweitung des Exklusionsbegriffes einem Auseinanderfallen des Theoriegebäudes entgegenzuwirken. Die nunmehr zwei Begriffsbedeutungen von Exklusion (vgl. Kap. 2.3 & 3.1) sind jedoch ihrerseits zueinander inkompatibel. Einerseits stellen Inklusion und Exklusion einander voraussetzende Seiten einer Unterscheidung dar, die in jedem Teilsystem nach ausschließlich internen Kriterien getroffen wird. Andererseits schließen sich Inklusion und Exklusion gegenseitig aus – Exklusion aus einem Funktionssystem blockiert die Inklusion in andere Funktionssysteme. Die Unterscheidung Inklusion/Exklusion bezeichnet also zwei unvereinbare Sachverhalte: (1) die spezifische Form der Vergesellschaftung in der modernen Gesellschaft und (2) die Ordnung eines wachsenden Exklusionsbereiches (vgl. Kronauer 1998). Die zweiwertige Logik von Inklusion und Exklusion müsste durch ein Konzept mit höherem Auflösungsvermögen ersetzt werden, das gesellschaftlichen Ausschluss durch graduelle Unterschiede der Anschlussfähigkeit an Kommunikation erklärt. Letzteres erscheint auch deshalb angebracht, weil es eigentlich unmöglich ist, nicht an gesellschaftlicher Kommunikation teilzunehmen. Selbst die Verweigerung eines Bankkontos oder die Verurteilung zu einer Haftstrafe erfolgen als Kommunikation der jeweiligen Funktionssysteme. „Die Vorstellung von sozialer Ausgrenzung führt in die Irre, wenn sie ein Herausfallen von Individuen oder Gruppen aus allen gesellschaftlichen Zusammenhängen suggeriert. Ein solches Ende aller Soziabilität ist allenfalls für Extremsituationen, die dem Tod nahekommen, denkbar.“ (Kronauer 1999; S. 62) So gesehen lässt sich nur ein Bruchteil der gesellschaftlichen Ausschlüsse als Totalausschluß beschreiben; es geht vielmehr um – in der Terminologie von Luhmann gesprochen – problematische Inklusionen (vgl. Göbel & Schmidt 1998).15 5. Epilog Ausgangspunkt dieses Textes ist nach wie vor die These, Soziale Arbeit habe sich als gesellschaftliches Funktionssystem ausdifferenziert, wenngleich die Validierung dieser These – angesichts der auf den vorangegangenen Seiten aufgezeigten Kritikpunkte am theoretischen Unterbau – als nunmehr obsolet gelten kann. Das ehrgeizige Unterfangen einer theoretischen Bestimmung der Einheit Sozialer Arbeit im Kontext der Luhmannschen Systemtheorie endet in einem Scherbenhaufen. Die Luhmannsche Systemtheorie – angetreten um die Selbstblockade der Soziologie aufzulösen – bringt ihrerseits eine Vielzahl von Problemen mit sich, die gegen ihre Verwendung – nicht nur im Kontext der Sozialarbeitstheorie – sprechen. Gerade für die Soziale Arbeit bedeutsame Aspekte des Sozialen, wie Macht, soziale Ungleichheit und sozialer Ausschluss können im Rahmen der Theorie nicht adäquat gefasst werden. Soziale Arbeit steht damit weiterhin vor dem Problem, eine einheitliche the- 15 Andererseits sprechen viele Indizien für eine Spaltung der Gesellschaft. Aber innerhalb der Theorie funktionaler Differenzierung kann nicht plausibilisiert werden, wie „die paradoxe Vorstellung einer Innen-Außen-Spaltung der Gesellschaft“ (Kronauer 1999; S. 62) möglich ist. oretische Bestimmung ihrer disziplinären bzw. professionellen Identität nicht leisten zu können – und sich gegenüber benachbarten, spezialisierteren Professionen/Disziplinen nicht in ausreichendem Maße abgrenzen zu können. Mit diesem Problem steht die Soziale Arbeit jedoch keinesfalls alleine da. Die um die Jahrhundertwende noch junge soziologische Fachdisziplin stand ebenfalls vor der Frage, wie sie ihre Existenzberechtigung gegenüber den bereits etablierten Sozialwissenschaften begründen könne. „Denn da Rechtswissenschaft und Philologie, die Wissenschaft von der Politik und die von der Literatur, die Psychologie und die Theologie und alle anderen, die den Bezirk des Menschlichen unter sich aufgeteilt haben, ihre Existenz fortsetzen werden, so ist nicht das geringste dadurch gewonnen, dass man die Gesamtheit der Wissenschaften in einen Topf wirft und diesem das Etikett: Soziologie – aufklebt. Die Gesellschaftswissenschaft befindet sich also, unterschieden von anderen, wohlgegründeten Wissenschaften in der ungünstigen Lage, zunächst ihr Recht auf Existenz überhaupt beweisen zu müssen.“ (Simmel 1970; S. 6 zitiert aus: Schwinn 2001; S. 32f) Eine Lösung war, von der Gesellschaft als Gegenstand der Soziologie auszugehen, und sich damit einem allen Sozialwissenschaften übergeordneten Objektbereich zuzuwenden. Gesellschaft steht der Sozialen Arbeit jedoch im Hinblick auf ihre fehlende begriffliche Fassbarkeit in nichts nach. Gesellschaft ist ein „vieldeutiger, intensional wie extensional gleichermaßen diffuser Begriff“ (Endruweit & Trommelsdorf 1989; S. 245) Im Laufe der Theorieentwicklung haben sich daher eine Vielzahl von Gesellschaftsdefinitionen herausgebildet, ohne dass das Problem hätte abschließend gelöst werden können. Die theoretische Unterbestimmtheit des Luhmannschen Gesellschaftsbegriffs ist hierfür nur ein Beispiel. Trotzdem ist es der Soziologie gelungen, sich als wissenschaftliche Disziplin zu etablieren und gegenüber den anderen Sozialwissenschaften zu emanzipieren. Warum sollte dies ausgerechnet im Fall der Sozialen Arbeit anders sein? Möglicherweise ist das Anliegen der Sozialen Arbeit, als Profession und wissenschaftliche Disziplin ernst genommen zu werden, nicht so zwingend an die Bestimmung eines eigenständigen Gegenstandsbereiches gebunden. Max Weber ist vielleicht der prominenteste Vertreter seiner Fachdisziplin, der sich bewusst gegen eine am Gesellschaftsbegriff als zentralem Bezugspunkt ausgerichtete Soziologie wandte. Seine Ablehnung des organizistischen, von Kollektivbegriffen ausgehenden Denkens war sogar das bestimmende Moment für sein Interesse an der Soziologie: „Wenn ich nun einmal Soziologe geworden bin [...] dann wesentlich deshalb, um dem immer noch spukenden Betrieb, der mit Kollektivbegriffen arbeitet, ein Ende zu machen.“ (Weber; zitiert aus: Schwinn 2001; S. 31f) Seine Absage an den Gesellschaftsbegriff verstand er im übrigen nicht als ein Problem für die Soziologie als Disziplin, weil nach seiner Auffassung „Wissenschaften und das, womit sie sich beschäftigen, dadurch entstehen, daß Probleme bestimmter Art auftauchen und spezifische Mittel ihrer Erledigung postulieren.“ (Weber 1924; S. 473 in: Endruweit & Trommelsdorf 1989; S. 248) Dies wäre nach meinem Dafürhalten auch ein guter Ausgangspunkt für die Sozialarbeitswissenschaftliche Disziplin. Der Aufwand, der – nicht zuletzt auf systemtheoretischen Terrain – betrieben wurde, um die Einheit und den gesellschaftlichen Bezug der Sozialen Arbeit zu bestimmen, hat bislang zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt. Der systemtheoretische Beitrag zur Bearbeitung dieser Fragestellung, Soziale Arbeit ausgehend von einer Funktion für ein umfassendes Gesellschaftsystem zu bestimmen, stellt hier – wie gezeigt wurde – keine Ausnahme dar. Die „Besinnung“ der Sozialarbeitswissenschaft auf die keineswegs triviale Frage, wie konkrete Probleme als soziale Probleme gefasst und mit den spezifischen Mitteln der Sozialen Arbeit – im Sinne einer Arbeit am Sozialen – gelöst werden können, erscheint mir im Hinblick auf die Emanzipation der Sozialen Arbeit als Profession und Disziplin weitaus dienlicher. Literatur Baecker, Dirk (1994). Soziale Hilfe als Funktionssystem der Gesellschaft. Zeitschrift für Soziologie 2/94: 93-110 Baraldi, Claudio & Corsi, Giancarlo & Esposito, Elena (1998). GLU. Glossar zu Niklas Luhmann. 2. Aufl. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. Böhnisch, Lothar & Lösch, Hans (1975). Das Handlungsverständnis des Sozialarbeiters und seine institutionelle Determination. In: Otto, Hans-Uwe & Schneider, Siegfried (Hg.) Gesellschaftliche Perspektiven der Sozialarbeit. Bd 2. 3. Aufl. Hermann Luchterhand Verlag. Neuwied und Darmstadt: 21-40 Bommes, Michael & Scherr, Albert (1996). Exklusionsvermeidung, Inklusionsvermittlung und/oder Exklusionsverwaltung. Zur gesellschaftstheoretischen Bestimmung Sozialer Arbeit. neue praxis 2/96: 107-123 Bommes, Michael & Scherr, Albert (2000). Soziologie der Sozialen Arbeit. Eine Einführung in Formen und Funktionen organisierter Hilfe. Juventa Verlag. Weinheim und München Endruweit, Günter & Trommsdorff, Gisela (Hg.) (1989) Wörterbuch der Soziologie. 3 Bd. Ferdinand Enke Verlag. Stuttgart Esser, Hartmut (2000). Soziologie – Spezielle Grundlagen. Band 2: Die Konstruktion der Gesellschaft. Campus Verlag. Frankfurt/New York Fuchs, Peter & Schneider, Dietrich (1995). Das Hauptmann-von-Köpenick-Syndrom. Überlegungen zur Zukunft funktionaler Differenzierung. Soziale Systeme 2/95: 203-224 Fuchs, Peter (1993). Niklas Luhmann - beobachtet. Eine Einführung in die Systemtheorie. 2. Aufl. Westdeutscher Verlag. Opladen Göbel, Markus & Schmidt, Johannes FK (1998). Inklusion/Exklusion: Karriere, Probleme und Differenzierung eines systemtheoretischen Begriffspaars. Soziale Systeme 1/98: 87-117 Gripp-Hagelstange, Helga (1995). Niklas Luhmann: eine erkenntnis-theoretische Einführung. Wilhelm Fink Verlag. München. Heiner, Maja (1995). Nutzen und Grenzen systemtheoretischer Modelle für eine Theorie professionellen Handelns (Teil 1). neue praxis 5/95, 427-441. Heitmeyer, Wilhelm (Hg.) (1997). Bundesrepublik Deutschland: Auf dem Weg von der Konsens- zur Konfliktgesellschaft. 2 Bde. Suhrkamp Verlag. Frankfurt a.M. Kastl, Dr. Jörg Michael (1999). Grenzen der Intelligenz. Die soziologische Theorie und das Rätsel der Intentionalität. Habilitationsschrift. Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Kleve, Heiko (1997). Soziale Arbeit zwischen Inklusion und Exklusion. neue praxis 5/97: 412-432 Kleve, Heiko (1999a). Postmoderne Sozialarbeit. Ein systemtheoretisch- konstruktivistischer Beitrag zur Sozialarbeitswissenschaft. Wissenschaftlicher Verlag des Instituts für Beratung. Aachen Kleve, Heiko (1999b). Soziale Arbeit und Ambivalenz. Fragmente einer Theorie postmoderner Professionalität. neue praxis 4/99: 368-382. Kneer, Georg & Nassehi, Armin (1997). Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Eine Einführung. 3. Aufl. Wilhelm Fink Verlag. München Krause, Detlef (1996). Luhmann Lexikon. Eine Einführung in das Gesamtwerk von Niklas Luhmann. Ferdinand Enke Verlag. Stuttgart Kronauer, Martin (1998). „Exklusion“ in der Systemtheorie und die Armutsforschung. Anmerkungen zu einer problematischen Beziehung. Zeitschrift für Sozialreform 11/12 1998 Kronauer, Martin (1999). Die Innen-Außen-Spaltung der Gesellschaft. Eine Verteidigung des Exklusionsbegriffs gegen seinen mystifizierenden Gebrauch. In: Herkommer, Sebastian (Hg.) Soziale Ausgrenzung. Gesichter des neuen Kapitalismus. VSA Verlag. Hamburg. Kunstreich, Timm (1997). Grundkurs Soziale Arbeit. Bd 1. Agentur des Rauhen Hauses. Hamburg. Luhmann, Niklas (1975). Formen des Helfens im Wandel gesellschaftlicher Bedingungen. In: Otto, Hans-Uwe & Schneider, Siegfried (Hg.) Gesellschaftliche Perspektiven der Sozialarbeit. Bd. 1. 3. Aufl. Hermann Luchterhand Verlag, Neuwied und Darmstadt: 21-43 Luhmann, Niklas (1980). Begriff des Politischen (Interview). In: Baecker, Dirk & Stanitzek, Georg (Hg.) Archimedes und wir. Merve Verlag. Berlin: S. 2-13 Luhmann, Niklas (1985a). Biographie, Attitüden, Zettelkasten (Interview). In: Baecker, Dirk & Stanitzek, Georg (Hg.) Archimedes und wir. Merve Verlag. Berlin: S. 125-155 Luhmann, Niklas (1985b). Zum Begriff der sozialen Klasse. In: Luhmann, Niklas (Hg.) Soziale Differenzierung – Zur Geschichte einer Idee. Westdeutscher Verlag. Opladen: S. 119-162 Luhmann, Niklas (1988). Macht. 2. Aufl. Ferdinand Enke Verlag. Stuttgart Luhmann, Niklas (1996a). Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität. 3. Aufl. Suhrkamp Verlag. Frankfurt a. M. Luhmann, Niklas (1996b). Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. 6. Aufl. Suhrkamp Verlag. Frankfurt a. M. Luhmann, Niklas (1997). Die Gesellschaft der Gesellschaft. 2 Bd. Suhrkamp Verlag. Frankfurt a. M. Luhmann, Niklas (1999). Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. 4. Suhrkamp Verlag. Frankfurt a. M. Luhmann, Niklas (2000). Die Politik der Gesellschaft. Suhrkamp Verlag. Frankfurt a. M. Maturana, Humberto & Varela, Francisco, J (1987). Der Baum der Erkenntnis - Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. Goldmann. München Maturana, Humberto (1994). Was ist Erkennen? Piper Verlag. München und Zürich Nassehi, Armin (1997). Inklusion, Exklusion, Integration, Desintegration. Die Theorie funktionaler Differenzierung und die Desintegrationsthese. In: Heitmeyer, Wilhelm (Hg.) Was hält die Gesellschaft zusammen? Suhrkamp Verlag. Frankfurt a. M.: 113-148 Rauschenbach, Thomas (1999). Dienste am Menschen - Motor oder Sand im Getriebe des Arbeitsmarktes. Die Rolle der Sozial-, Erziehungs- und Gesundheitsberufe in einer sich wandelnden Arbeitsgesellschaft. neue praxis 2/99: 130-146 Reese-Schäfer, Walter (1992). Luhmann zur Einführung. 2. Aufl. Junius Verlag. Hamburg Reinhold, Gerd (Hg.) (1997). Soziologie-Lexikon. 3. Aufl. R. Oldenbourg Verlag. München Scherr, Albert (2000). Was nützt die soziologische Systemtheorie für eine Theorie der Sozialen Arbeit?. Widersprüche 77. September 2000: 63-80 Scherr, Albert (2001). Nüchterne Analysen und engagierte Praxis – Eine Replik auf Michael Mays Kritik der „Luhmannisierung“ Sozialer Arbeit. Widersprüche 79. März 2001: 63-76 Schimank, Uwe (1998). Funktionale Differenzierung und soziale Ungleichheit: Die zwei Gesellschaftstheorien und ihre konflikttheoretische Verknüpfung. In: Giegel, HansJoachim (Hg.) Konflikt in modernen Gesellschaften. Suhrkamp Verlag. Frankfurt a. M.: 61-88 Schwinn, Thomas (1998). Soziale Ungleichheit und funktionale Differenzierung. Wiederaufnahme einer Diskussion. Zeitschrift für Soziologie 1/98: 3-17 Schwinn, Thomas (2001). Differenzierung ohne Gesellschaft. Umstellung eines soziologischen Konzepts. Velbrück Wissenschaft. Weilerswist Staub-Bernasconi, Silvia (1995). Systemtheorie, soziale Probleme und Soziale Arbeit: lokal, national, international. Haupt Verlag. Bern, Stuttgart, Wien Staub-Bernasconi, Silvia (1998). Systemtheorie In: Stimmer, Franz Prof. Dr.: Lexikon der Sozialpädagogik und der Sozialarbeit. 3. Aufl. R. Oldenbourg Verlag. München Staub-Bernasconi, Silvia (2000). Machtblindheit und Machtvollkommenheit Luhmannscher Theorie In: Merten, Roland (Hg.) Systemtheorie Sozialer Arbeit. Neue Ansätze und veränderte Perspektiven. Leske + Budrich. Opladen: 225 - 242 Viskovatoff, Alex (1999) Foundations of Niklas Luhmann’s Theory of Social Systems. Philosophy of the Social Sciences Dec. ’99: 481-516