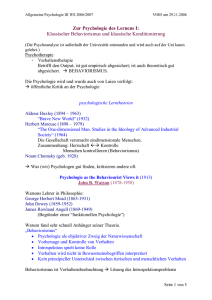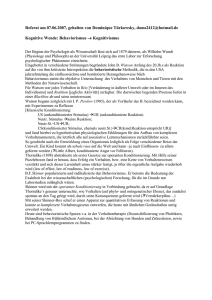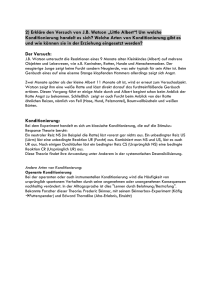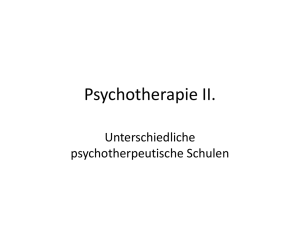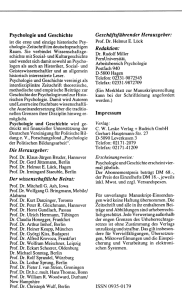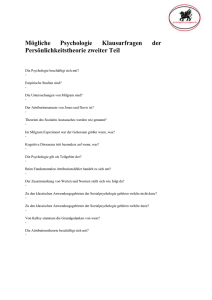Psychologie des Lernens I_Skriptum
Werbung
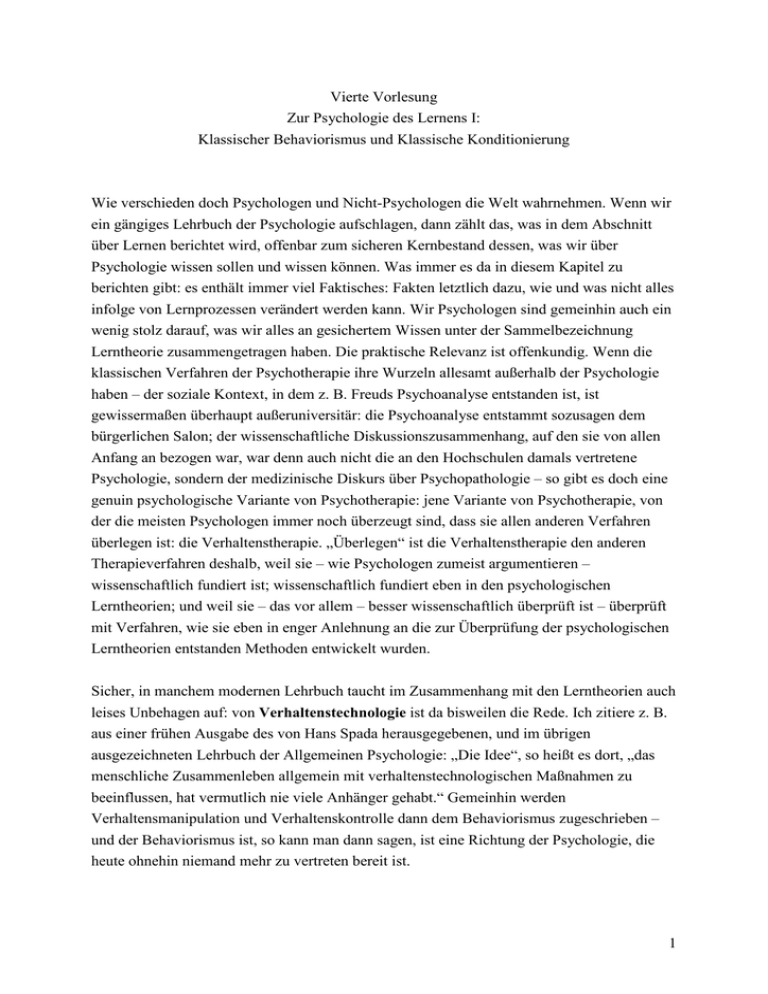
Vierte Vorlesung Zur Psychologie des Lernens I: Klassischer Behaviorismus und Klassische Konditionierung Wie verschieden doch Psychologen und Nicht-Psychologen die Welt wahrnehmen. Wenn wir ein gängiges Lehrbuch der Psychologie aufschlagen, dann zählt das, was in dem Abschnitt über Lernen berichtet wird, offenbar zum sicheren Kernbestand dessen, was wir über Psychologie wissen sollen und wissen können. Was immer es da in diesem Kapitel zu berichten gibt: es enthält immer viel Faktisches: Fakten letztlich dazu, wie und was nicht alles infolge von Lernprozessen verändert werden kann. Wir Psychologen sind gemeinhin auch ein wenig stolz darauf, was wir alles an gesichertem Wissen unter der Sammelbezeichnung Lerntheorie zusammengetragen haben. Die praktische Relevanz ist offenkundig. Wenn die klassischen Verfahren der Psychotherapie ihre Wurzeln allesamt außerhalb der Psychologie haben – der soziale Kontext, in dem z. B. Freuds Psychoanalyse entstanden ist, ist gewissermaßen überhaupt außeruniversitär: die Psychoanalyse entstammt sozusagen dem bürgerlichen Salon; der wissenschaftliche Diskussionszusammenhang, auf den sie von allen Anfang an bezogen war, war denn auch nicht die an den Hochschulen damals vertretene Psychologie, sondern der medizinische Diskurs über Psychopathologie – so gibt es doch eine genuin psychologische Variante von Psychotherapie: jene Variante von Psychotherapie, von der die meisten Psychologen immer noch überzeugt sind, dass sie allen anderen Verfahren überlegen ist: die Verhaltenstherapie. „Überlegen“ ist die Verhaltenstherapie den anderen Therapieverfahren deshalb, weil sie – wie Psychologen zumeist argumentieren – wissenschaftlich fundiert ist; wissenschaftlich fundiert eben in den psychologischen Lerntheorien; und weil sie – das vor allem – besser wissenschaftlich überprüft ist – überprüft mit Verfahren, wie sie eben in enger Anlehnung an die zur Überprüfung der psychologischen Lerntheorien entstanden Methoden entwickelt wurden. Sicher, in manchem modernen Lehrbuch taucht im Zusammenhang mit den Lerntheorien auch leises Unbehagen auf: von Verhaltenstechnologie ist da bisweilen die Rede. Ich zitiere z. B. aus einer frühen Ausgabe des von Hans Spada herausgegebenen, und im übrigen ausgezeichneten Lehrbuch der Allgemeinen Psychologie: „Die Idee“, so heißt es dort, „das menschliche Zusammenleben allgemein mit verhaltenstechnologischen Maßnahmen zu beeinflussen, hat vermutlich nie viele Anhänger gehabt.“ Gemeinhin werden Verhaltensmanipulation und Verhaltenskontrolle dann dem Behaviorismus zugeschrieben – und der Behaviorismus ist, so kann man dann sagen, ist eine Richtung der Psychologie, die heute ohnehin niemand mehr zu vertreten bereit ist. 1 Die Idee der Verhaltensmanipulation hat vermutlich nie viele Anhänger gehabt – ich fürchte, dass dieser Satz, auf die Geschichte der Psychologie bezogen, nicht richtig ist. Dafür aber, wie die behavioristische Lerntheorie von außen, d. h. von Nicht-Psychologen wahrgenommen wurde (und zum Teil auch immer noch wird), stimmt er aber allemal. Sie kennen das berühmte Buch von Aldous Huxley: „Brave New World“ aus 1932 (der deutsche Titel lautet: „Schöne neue Welt“)? Huxleys eindringliche Schilderung der Schockbehandlung von Kindern in „Neo-Pawlowschen-Normungssälen“ kann sich unmittelbar auf John Broadhus Watsons berühmten Versuch mit dem Kleinen Albert berufen. Erinnern Sie sich, wozu in Huxleys Roman die Techniken der Konditionierung eingesetzt werden? Als drastisches Mittel, sozial erwünschtes Verhalten schon vom frühesten Kindesalter an zu erzeugen. Für Herbert Marcuse – ein vor allem von der 68er Bewegung viel gelesener und viel zitierter Philosoph – war der Behaviorismus geradezu die wissenschaftliche Legitimation jener Herabminderung des Geistes auf eindimensionales Denken und Verhalten, wie es von der modernen, kapitalistischen Industriegesellschaft den Menschen abverlangt wird. Vielleicht ist es in diesem Kontext für sie nachvollziehbar, dass der von den Kritikern behauptete immanenten Zusammenhang zwischen Behaviorismus und totalitärer gesellschaftlicher Kontrolle (das ist ja das Thema, das Huxley in seinem Roman abgehandelt hat) schließlich bei Noam Chomsky im Faschismus-Vorwurf an die Adresse Skinners gipfelte. Das mag zur Einführung genügen. Wenn wir in der heutigen Vorlesung also über die Anfänge der behavioristischen Psychologie – und in diesem Zusammenhang natürlich auch über die Rolle der Pawlowschen Klassischen Konditionierung – sprechen werden, möchte ich, dass Sie diesen Kontext in Erinnerung behalten: Die Entwicklung der psychologischen Lerntheorien war von allen Anfang an von heftigen politischen Kontroversen begleitet – von Kontroversen, die im Bewusstsein vieler Generationen von Psychologen keinerlei Spuren zu hinterlassen haben scheinen. In den Lehrbuch-Darstellungen über die Geschichte unserer Disziplin wird darauf jedenfalls keinerlei Bezug genommen. Damit wir uns richtig verstehen: Ich behaupte nicht, dass Chomsky recht hat. Ich finde es nur wichtig, in unsere Auseinandersetzung mit psychologischen Wissen auch zu berücksichtigen, was Nicht-Psychologen bisweilen von diesem Wissen halten. Über die Entstehung des klassischen Behaviorismus habe ich Ihnen schon im Wintersemester ein wenig erzählt. Vielleicht kann ich Ihnen, wenn ich Ihnen jetzt ein wenig mehr darüber berichte, begreiflich machen, woher das gesellschaftliche und politische Unbehagen gegenüber dieser, historisch gesehen, so wichtigen Grundströmung der Psychologie herrührt. 2 Die Geburt des Klassischen Behaviorismus lässt sich genau datieren: 1913 erschien in der renommierten amerikanischen Fachzeitschrift Psychological Review ein nicht einmal 20 Seiten umfassendes Manifest mit dem Titel: Psychology as the Behaviorist Views It. Sein Autor war eine der schillerndsten Figuren in der Geschichte der amerikanischen Psychologie: John Broadus Watson. Watson, der in einem kleinen Dorf in South Carolina geboren wurde, hatte in Chicago studiert, Neurologie, experimentelle Psychologie, aber auch Philosophie, letzteres unter anderem bei George Herbert Mead und John Dewey, einem der Hauptvertreter des Pragmatismus. Seine Arbeit im experimentalpsychologischen Labor wurde gefördert und angeleitet von James Rowland Angell, der aus der pragmatistischen Philosophie William James und John Deweys eine funktionalistische Psychologie entwickelt hatte. Mit 25 Jahren erhielt Watson seinen PhD; er war, wie er selber immer wieder stolz erzählte, damit der bislang jüngste Absolvent in Chicago. Im Herbst des Jahres 1908 erhielt er einen Ruf an die renommierte John Hopkins University, wo er ein eigenes Laboratorium als Direktor übernahm. Hier ist dann auch das behavioristische Manifest entstanden. In den Folgejahren profilierte sich Watson als unermüdlicher und – vor allem: wortgewaltiger Prediger seiner neuen Psychologie. Zwar war die von ihm verfochtene Programmatik weit davon entfernt, von einer Mehrheit seiner Fachkollegen akzeptiert zu werden. Trotzdem genoss er einen glänzenden Ruf. Seine Karriere kam zu einem jähen Ende, als er, der seit 1904 verheiratet war, eine Affäre mit seiner Studentin und engsten Mitarbeiterin Rosalie Rayner einging. Seine Frau ließ sich scheiden, Watson musste seine Professur niederlegen. Fernab vom akademischen Betrieb einer amerikanischen Universität gelang ihm eine spektakuläre zweite berufliche Karriere, und zwar in der Werbebranche. Nebenbei wurde er nicht müde, sein Konzept einer behavioristischen Psychologie in zahlreichen Publikationen weiter und weiter auszuarbeiten. Das folgende Foto zeigt ihm nach seinem Rückzug aus dem akademischen Leben. Kehren wir zurück zur Programmschrift von 1913: Gleich am Beginn steht – kurz zu Formeln zusammengerafft – all das, was dann in der Folge ständig wiederholt und ausgetreten wird: „Psychologie, wie sie der Behaviorist sieht, ist ein vollkommen objektiver, experimenteller Zweig der Naturwissenschaft. Ihr theoretisches Ziel ist die Vorhersage und Kontrolle von Verhalten. Introspektion spielt keine wesentliche Rolle in ihren Methoden, und auch der wissenschaftliche Wert ihrer Daten hängt nicht davon ab, inwieweit sie sich zu einer Interpretation in Bewusstseinsbegriffen eignen. Bei dem Bemühen, ein einheitliches Schema der Reaktionen von Lebensweisen zu gewinnen, erkennt der Behaviorist keine Trennungslinie zwischen Mensch und Tier an.“ – Folie 3 Zu Beginn des Wintersemesters habe ich Ihnen diese Programmatik im Zusammenhang mit der Herausbildung der modernen, wissenschaftlichen Psychologie im deutschen Sprachraum vorgestellt. Erinnern Sie sich noch? Wundt und nach ihm auch die positivistischen Psychologen hatten die Psychologie als Wissenschaft vom Bewusstsein und Erleben aufgefasst. Die – vor allem methodischen – Probleme, die sich aus dieser Gegenstandsbestimmung ergaben, haben wir ausführlich besprochen: Psychisches Erleben ist immer nur dem erlebenden Subjekt zugänglich; bei der wissenschaftlichen Beobachtung dieses inneren Erlebens müsste sich daher das forschende Subjekt selbst als Forschungsobjekt nehmen. Forschungspraktisch formuliert: Das beobachtende Subjekt fällt mit dem zu beobachtenden Objekt zusammen. Seit Kants Einwand, dass in diesem Falle der Vorgang der Beobachtung den zu beobachtenden Zustand alteriert und verstellt, war die Methode Selbstbeobachtung oder Introspektion als wissenschaftliches Hilfsmittel obsolet. Ich habe Ihnen zu zeigen versucht, mit welchen Methoden sich die deutsche Psychologie aus diesem ihrem Grunddilemma zu befreien versuchte. Watson trat nun mit dem Programm an, das Bewusstsein aus der Psychologie überhaupt zu eliminieren. Statt Wissenschaft vom Bewusstsein sollte die Psychologie nun nur mehr Wissenschaft vom Verhalten sein. Mit diesem Schritt erübrigt sich natürlich das Problem der Introspektion. Wenn die Psychologie nicht mehr Wissenschaft vom inneren Erleben ist, bedarf es auch keiner Methoden mehr, dieses innere Erleben irgendwie wissenschaftlich zu erschließen. An die Stelle der Introspektion trat nun die Methode der objektiven Verhaltensbeobachtung. Wir müssen uns die ganze Radikalität des Watsonschen Neuansatzes bewusst machen: Mit dem Begriff des Bewusstsein fallen auch all die anderen altvertrauten Begriffe der Psychologie: Wahrnehmen, Vorstellen, Denken, Wollen, Fühlen etc. Das alles ist, weil nur dem erlebenden Subjekt gegeben und damit nur ihm zugänglich, nicht objektiv fassbar, nicht objektiv zu kontrollieren. Objektiv gegeben sind nur die äußerlich wahrnehmbaren Bewegungen eines Organismus. Äußerlich wahrnehmbar ist im weitesten Sinne gemeint: der Behaviorist gibt sich nicht nur mit den groben, mit freiem Auge sichtbaren Verhaltensweisen zufrieden. Auch innere, verdeckte, implizite Bewegungen, die sich nur mehr mit physiologischen Methoden registrieren lassen, werden einbezogen. Denken und Vorstellen erscheinen als Denk- und Vorstellungsverhalten: Die motorische Theorie des Denkens postuliert, dass jeder Denkakt und Vorstellungsakt sich gleichsam in einem verborgenen Selbstgespräch äußert, das an den mikroskopisch feinen Bewegungen des Kehlkopfs, der Zunge etc. abzulesen ist – und daher ein ebenso objektives Verhalten darstellt, wie Fußballspielen. Diese Abwendung vom Bewusstsein fand sich in der amerikanischen Psychologie vor Watson bereits vorbereitet. Zwar war in Deweys Pragmatismus Bewusstsein noch eine zentrale Kategorie: Das Bewusstsein vermittelt sozusagen Anpassung: Anpassung an die soziale 4 Umwelt, aber auch umgekehrt: Anpassung der sozialen Umwelt an die Bedürfnisse des Individuums. Im Funktionalismus Angells ist der sozialreformerische Kontext, in dem Deweys Pragmatismus stand, aufgegeben. Anpassung heißt nun Anpassung an die spezifischen Anforderungen der Umwelt. Auf der Ebene der Humanpsychologie wird am Begriff des Bewusstseins weiter festgehalten: Bewusstsein vermittelt sozusagen zwischen den Umweltgegebenheiten und den Bedürfnissen des Organismus. Entscheidend ist, wie es das tut. Das, was den Funktionalisten interessiert, sind mentale Operationen, und nicht mehr – wie in der alten Bewusstseinspsychologie – Inhalte des Bewusstseins. Das ist nun kein Forschungsprogramm mehr, bei dem die Introspektion eine Rolle spielt: Wie sich eine Versuchsperson gegenüber für sie neue Umweltbedingungen verhält, lässt sich beobachten, aus dem Verhalten kann auf die dem Verhalten zugrundeliegenden mentalen Prozesse rückgeschlossen werden. Wichtig für die Entstehung des Behaviorismus ist die große Bedeutung, die die Tierpsychologie im Funktionalismus erhielt. Aus Tierexperimenten, so lautete das Credo, sind allgemeine, d. h. auch für den Humanbereich relevante psychische Gesetze zu entdecken. Das hatte Watson direkt aus dem Funktionalismus übernehmen können. Über den Funktionalismus hinaus ging er, indem er eben die Kategorie des Bewusstseins aus der Psychologie überhaupt verbannen wollte. Mit welchen Argumenten? Weil Bewusstseinsprozesse (und damit auch die von den Funktionalisten behauptete Beziehung zwischen Verhalten und Bewusstsein) nicht objektiv, d. h. experimentell bestimmbar sind. Aber daraus folgt noch nicht automatisch, dass eine Psychologie ohne Rekurs auf die Kategorie des Bewusstseins möglich ist. Daher muss Watson noch einen Schritt weitergehen: Er musste behaupten, dass das Bewusstsein irrelevant ist für alle Probleme, die in der Psychologie experimentell untersucht werden können. Das aber konnte Watson zunächst eben nur behaupten, nicht aber – nicht einmal an einem Beispiel! zeigen. Jetzt sind wir darauf vorbereitet, zu erahnen, welche Rolle die Entdeckung der Methode der Konditionierung für Watson spielen musste. Als Watson sein Manifest schrieb, wusste er darüber offenbar noch nichts. Erst in den Folgejahren lernte er die in der russischen Physiologie (von Pawlow und Bechterew) entwickelten Methoden kennen. Idee und Methode des bedingten Reflexes rückten Schritt um Schritt immer mehr in den Mittelpunkt seines Systems. Jetzt erst hatte Watson die Mittel in der Hand, die Behauptung von der Irrelevanz von Bewusstseinsvorgängen für die Vorhersage und Kontrolle von verhalten zu demonstrieren. 5 Demonstriert hat Watson (und zwar gemeinsam mit Rosalie Rayner, seiner Assistentin und späteren Frau) seine Psychologie ohne Bewusstsein in einem auch heute noch viel zitierten, wenn auch immer öfter mit kritischen Kommentaren versehen Experiment mit einem kleinen Jungen namens Albert. In diesem Experiment sollten drei Fragen vor allem geklärt werden: 1. Kann bei einem Kind Angst gegenüber einem Tier konditioniert werden, wenn dieses Tier wiederholt gleichzeitig mit einem lauten, angstauslösenden Geräusch auftritt? 2. Wird diese Angst auf andere Tiere generalisieren? 3. Wie lange wird diese Angst bestehen bleiben? Das Verfahren war denkbar einfach: Dem elf Monate alten Buben wurde eine weiße Ratte gegeben. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wurde jedes Mal, wenn Albert sich der Ratte zuwandte und sie berührte ein erschreckenden lautes Geräusch gesetzt. (Es wurde mit einem Hammer auf eine Stahlstange geschlagen). Nach sieben „Durchgängen“ von gleichzeitiger Darbietung Lärm und Ratte reagierte Albert mit Weinen und Vermeidung, wenn ihm die Ratte präsentiert wurde. Um die zweite Frage zu beantworten, wurde Albert fünf Tage nach dieser ersten Konditionierungsphase mit verschiedenen Gegenständen konfrontiert: einer Ratte, Holzbausteinen, einem Hasen, einem kurzhaarigen Hund, einem Seehundmantel, Baumwolle, mit den Hinterköpfen von Watson und zweier Assistenten (so dass Albert die Haare berühren konnte) und einer Santa Claus Maske. Albert zeigte starke Angstreaktionen auf Ratte, Hasen, Hund, Seehundmantel; eine – was immer damit gemeint war – „negative“ Reaktion („response“) auf die Maske und Watsons Haare; eine „mild“ Reaktion (response) auf die Baumwolle. Nach weiteren fünf Tagen wurde ein weiterer Versuchsdurchgang durchgeführt: Ratte + Lärm; Hase + Lärm und Hund + Lärm. Als die Effekte dieser Prozedur in einem anderen Raum überprüft wurden, zeigte Albert gegenüber Ratte, Hase und Hund nur eine leichte Angstreaktion zeigte. Als Watson die Konditionierung auf die Rate wieder auffrischen („to freshen“ steht im Original!) wollte, begann der Hund Albert anzubellen – der Versuch musste abgebrochen werden. Um die dritte Frage nach der Dauer des Bestehens der konditionierten emotionalen Reaktion zu beantworten, wurde Albert nach 31 Tagen ohne Lerndurchgänge (also weder Konditionierung noch Extinktion) zeigte Albert Angst gegenüber der Santa Claus-Maske, dem Seehundmantel, der Ratte, dem Hasen und dem Hund. Er mied aber die Tiere nicht durchgängig (wie es etwa bei Tierphobien der Fall ist) Z. B. fasste er das Ohr des Hasen an und spielte damit. 6 Nach dem Abschluss dieser Testreihe nahm Alberts Mutter ihren Sohn aus der Klinik, in der diese Untersuchungen gemacht wurden. Der eigenen Darstellung gemäß haben Watson Rayner ein Monat zuvor schon gewusst, dass Albert nach diesen Tests nicht mehr als Versuchsperson zur Verfügung stehen wird. Ich erzähle Ihnen von diesem Experiment so ausführlich, damit sie verstehen, warum der Behaviorismus bei Nicht-Psychologen bisweilen so unbeliebt ist. Ich erzähle Ihnen aber auch deshalb so ausführlich, weil dieses Experiment in vielen Lehrbüchern sehr verschieden und ganz anders als von mir hier dargestellt wird. Ich bitte Sie, mir zu vertrauen. Ich habe mir die Sache auch im Original angeschaut. In diesem Originalartikel findet sich übrigens auch eine interessante Bemerkung, die auch von vielen, die über dieses Experiment seriös berichten, offenbar übersehen wurde: der kleine Albert hatte, wenn er aufgeregt war, ständig den Daumen im Mund. Mit dem Daumen im Mund war er dann auch gegenüber den – wie es bei den Autoren der Studie hieß – „normalerweise“ angstauslösenden Stimuli sozusagen unempfindlich. Um die Versuche mit dem kleinen Kind durchführen zu können, musste man ihm immer wieder den Daumen aus dem Mund nehmen. Soviel nur ergänzend zur objektiven Stimuluskontrolle in der frühen behavioristischen Psychologie! Mit der Konditionierung glaubte Watson – und das sollte das Little-Albert-Experiment eigentlich zeigen – endlich jenes technische Hilfsmittel in der Hand, mit dem die Irrelevanz von Bewusstseinsprozessen für das Zustandekommen x-beliebiger Verhaltensweisen demonstriert werden konnte. Die Außenweltreize waren jetzt nicht mehr – wie etwa noch im Funktionalismus – Bedingungen, sondern – buchstäblich – Determinanten des Verhaltens. Die Kontrolle der Außenweltreize schien die sichere Kontrolle über das Verhalten von Organismen zu versprechen. Das war dann auch die heilsversprechende Vision von Watsons und später auch von Skinners Behaviorismus: Die gesellschaftlich durchgesetzte allgemeine Anwendung von Lerntechniken sollte die Lösung aller gesellschaftlichen Probleme, letztlich das Wohl der Welt und der Menschheit garantieren. Für ethische Diskussionen über Freiheit und Würde der Menschen war in dieser Vision allerdings kein Platz mehr: Über Freiheit konnte Watson nur witzeln: „Ich trete übertrhaupt nicht für Freiheiten ein – am wenigsten für freie Rede“. Und weiter: „Ich will nur einen verbalen Reiz setzen, der, wenn die darauf reagiert wird, nach und nach die ganze Welt umgestaltet.“ Damit möchte ich meine historische Einführung in das Thema behavioristische Lerntheorien schließen und mich der Vermittlung von Inhalten zuwenden. Zentrale Begriffe sind bislang ganz nebenbei eingeführt worden – Konditionierung, bedingter Reflex etc. –., nun gilt es diese Begriffe systematisch zu entwickeln. Ohne Geschichte geht es freilich auch dabei nicht ab. 7 Watson hat – so haben wir gesehen – das technische Kernstück seines Behaviorismus der russischen Physiologie entnommen. Der wollen wir uns jetzt zuwenden. Es sind vor allem drei Persönlichkeiten, die die Ausrichtung dieser russischen Physiologie geprägt haben: Iwan Michailowitsch Sechenow, und dann seine beiden Schüler und lebenslange Kontrahenten Ivan Petrowitsch Pawlow und Wladimir Michailowitsch Bechterew. Das Gründungmanifest der – im übrigen im engen Kontakt zur europäischen Physiologie sich entwickelnden – russischen Schule war Sechenows Schrift: Die Reflexe des Gehirns aus dem Jahre 1863. Sechenows Grundthese lautete, dass alles menschliche Handeln, wie komplex es sich auch immer darstellen mag, insbesondere aber auch das Denken, sich letztlich auf Reflexgeschehen zurückführen lässt. Diese Grundidee wurde von Bechterew und Pawlow aufgegriffen und weiter ausgeführt. Aus Zeitgründen kann ich auf Bechterew und seine Psychoreflexologie hier nicht weiter eingehen. Nur so viel: auch dieses Kapitel der Geschichte der Wissenschaft ist geprägt von dem, was man mit Freud als Narzissmus der kleinen Differenz bezeichnet könnte: je ähnlicher sich die Konzeptionen zweier wissenschaftlicher Persönlichkeiten sind, desto dringlicher wird es offenbar für beide, sich voneinander abzugrenzen und einander zu befehden. Das war auch im Falle von Pawlow und Bechterew so. In der modernen Psychologie wirkungsmächtig geworden ist dann vor allem die Pawlowsche Konzeption (Foto: jung) – dies wohl nicht zuletzt auch deshalb, weil sie vom Beginn der zwanziger Jahre auch, obwohl Pawlow der bolschewistischen Revolution kritisch gegenübergestanden war, offiziell als mit der Lehre des Marxismus-Leninismus übereinstimmend anerkannt wurde und Pawlows Arbeit in der Folge staatlicherseits großzügig gefördert wurde. (Foto alt) Die große Wertschätzung der Bolschewiki mag seinen Grund auch darin gehabt haben, dass Pawlow schon zu Lebzeiten ein international anerkannter Wissenschafter war. Für seien Arbeiten zur Physiologie der Verdauung hatte bereits 1904 den Nobelpreis erhalten. Für die Psychologie bedeutsam wurden dann aber seine klassischen Arbeiten über den „bedingten Reflex“. Reflexe sind angeborene Beziehungen zwischen auslösenden Reizen und unwillkürlichen Reaktionen auf diese Reize. Das Prinzip der Pawlowschen Experimente lässt sich dann in einem einzigen Satz formulieren: Es geht darum, die Übertragung von Reflexen auf ursprünglich neutrale, d. h. nicht reflexauslösende Reize zu demonstrieren. Pawlow hat vor allem mit Hunden experimentiert. Die folgende Abbildung zeigt die klassische Versuchsanordnung. 8 Pawlow untersuchte den Speichelreflex. Erhält ein Hund Futterpulver ins Maul, dann sondert er Speichel ab. Der Auslöserreiz (Futterpulver) wird (entsprechend der bei der Übersetzung der Pawlowschen Publikationen ins Englische gebrauchten Termini) unconditioned stimulus (unkonditionierter Reiz) UCS genannt; der Speichelreflex entsprechend unconditioned reaction (unbedingte Reaktion). Im Zuge des Experiments wurde dem Versuchstier dann in Verbindung mit dem Futterpulver mehrmals ein neutraler Stimulus (S0), zumeist ein Glockenton, dargeboten. Nach mehrmaliger Darbietung der Kombination Ton und Futterpulver genügt schließlich die Vorgabe des Glockentons allein, um die Speichelflussreaktion auszulösen. Aus dem ursprünglich neutralem Reiz ist ein conditioned stimulus, ein konditionierter Reiz geworden, der jetzt eine conditioned reaction, eine konditionierte Reaktion oder – was dasselbe ist – einen bedingten Reflex auslöst. Diesen Vorgang kann man schematisch etwa wie folgt darstellen. – Abbildung – Wichtig bei diesem Prozedere ist die zeitliche Beziehung zwischen SO und dem UCS. In der folgenden schematischen Darstellung sehen sie vier Varianten: die verzögerte Konditionierung, die simultane Konditionierung, die Spurenkonditionierung und die rückwirkende Konditionierung. Die besten Ergebnisse erzielt man mit der verzögerten Konditionierung. Das optimale Zeitintervall zwischen Einsetzen des S0 und Einsetzen des UCS liegt bei etwa einer halben Sekunde. Bei machen unwillkürlichen Reaktionen kann das optimale Interstimulusintervall aber auch größer (nämlich einige Sekunden) sein. „Beste Ergebnisse“ und optimales Interstimulusintervall“ bezieht sich auf die Reaktionsstärke. Im Falle des Speichelflusses, den Pawlow untersucht hat, wird die Reaktionsstärke durch die Menge des jeweils abgesonderten Speichelflusses gemessen. Eine andere Möglichkeit ist, z. B. die Reaktionszeit zu messen. Je schneller die Reaktion nach Darbietung des CS auftritt, desto stärker ist sie. Wichtig ist, dass die bedingte Reaktion der unbedingten meistens sehr ähnlich ist, im allgemeinen aber nie ihr gleich ist. Das zeigt sich eben auch an der Reaktionsstärke. Im allgemeinen gilt, dass die CR schwächer ist als die UCR. Das ist übrigens auch der Hauptgrund, warum man terminologisch zwischen CR und UCR unterscheidet. Kehren wir jetzt nochmals zu unserem Ausgangsexperiment zurück: Wird nach dem Konditionierungsvorgang mehrmals hintereinander der CS (also der Glockenton) alleine (d. h. ohne dem UCS, also ohne Futterpulver) vorgegeben, dann wird die Reaktionsstärke der CR immer schwächer, bis sie schließlich völlig erlischt. Man nennt diesen Vorgang Extinktion oder Löschung. Das Verfahren lässt sich wie folgt schematisch darstellen. 9 Der gesamte Vorgang – also Konditionierungsvorgang und anschließende Löschung – ist in folgender Grafik veranschaulicht. Wird dem Versuchstier nach vollständiger Extinktion und nach einer längeren Pause im Anschluss daran nochmals der CS geboten, dann tritt die zuvor gelöschte Reaktion wieder auf. Man nennt das „Spontanerholung“. Die CR ist dabei aber deutlich schwächer als zu Beginn der Löschungsphase und verschwindet bei weiteren Durchgängen (ohne gleichzeitige Darbietung des UCS) sehr rasch. Der Vorgang ist in folgender Grafik dargestellt. Für Pawlow hatte Löschung mit Hemmungsvorgängen zu tun. In der Pause wird diese Hemmung gleichsam wieder abgebaut, so das die vorangegangene Konditionierung wieder wirksam werden kann. Das ist wichtig: Löschung ist für Pawlow kein passiver Vorgang, sondern ein aktiver Lernvorgang: Das Versuchstier lernt gleichsam, dass zwischen CS und UCS keine Koppelung mehr besteht. Bis jetzt sind wir immer davon ausgegangen, dass der CS bei jeder Darbietung identisch ist. Die CR wird aber nach einem Konditionierungsvorgang nicht nur von dem Reiz hervorgerufen, der während der Konditionierung als CS verwendet wurde, sondern auch von ähnlichen Reizen. Hat ein Versuchstier in der Konditionierungsphase z. B. gelernt, auf den optischen Reiz „Kreis“ mit Speichelfluss zu reagieren, so wird es danach auch auf kreisähnliche optische Reize, also z. B. auf Ellipsen, mit Speichelfluss antworten. Man nennt dieses Phänomen Reizgeneralisierung. Grundsätzlich gilt: Je ähnlicher ein Reiz dem ursprünglichen CS ist, desto stärker wird die Reaktion sein, die durch ihn ausgelöst wird. Das komplementäre Phänomen dazu ist die so genannte Reizdiskrimination. Sie bewirkt, dass die bedingte Reaktion nur durch einige wenige, einander sehr ähnliche Reize ausgelöst werden, durch andere Reize derselben Dimension aber nicht mehr. Bei einem Diskriminationstraining werden zwei oder mehrere einander ähnliche, aber doch hinreichend verschiedene Reize in unregelmäßiger Folge vorgegeben, aber immer nur auf einen Reiz – natürlich auf immer denselben – folgt unmittelbar darauf der unkonditionierte Reiz. Also, um ein einfaches Beispiel zu nehmen: Auf den optischen Reiz „Kreis“ folgt Futterpulver, auf den optische Reiz Ellipse aber nicht. Nach mehrmaligen Durchgängen antwortet das Versuchstier auf den Kreis mit der konditionierten Reaktion, auf die Ellipse aber nicht. Der Diskriminationsfähigkeit der Versuchstiere sind natürlich Grenzen gesetzt. In diesem Zusammenhang hatte Pawlow ein höchst bemerkenswertes Phänomen beobachten können. Eine Überschreitung dieser Grenzen zieht bei den Versuchstieren im Labor schwere Verhaltensstörungen nach sich. Um bei unseren Beispiel zu bleiben. Wenn man das 10 Diskriminationstraining, in dem die Hunde zwischen Kreis und Ellipsen zu unterscheiden lernen, in der Art weitertreibt, dass man den Unterschied zwischen den Reizen immer weiter verringert, so sinkt daraufhin die Diskriminationsleistung drastisch ab; zudem zeigen die Versuchstiere starke emotionale Reaktionen: Die Hunde werde unruhig, winseln, bellen, verweigeren zum Teil die Nahrungsaufnahme. Pawlow sprach in diesem Zusammenhang von einer experimentellen Neurose, die er theoretisch auf einen Konflikt von Erregungs- und Hemmungsinnervationen zurückführte. Auf ein – vor allem für die Behavioristen besonders interessantes – Phänomen sei hier schließlich noch aufmerksam gemacht: Auf das Phänomen der Konditionierungen höherer Ordnung. Das Prinzip besteht darin, dass man dem ursprünglichen CS, auf den die Konditionierung erfolgt ist, die Funktion eines UCS verleiht. Es handelt sich also um einen Lernprozess, der auf einen vorangegangenen Lernprozess aufbaut. (Prinzip veranschaulichen!) Das mag zur Darstellung der Klassischen Konditionierung an Fakten einmal genügen. Kehren wir nochmals zum ersten Teil der heutigen Vorlesung zurück. Dort habe ich Ihnen gezeigt, dass für Watson die Entdeckung der Methode der Klassischen Konditionierung jenen entscheidenden Schritt bedeutete, mit dem er jetzt die von ihm zunächst nur programmatisch postulierte Möglichkeit einer Psychologie ohne Bewusstsein in Forschungspraxis umsetzen zu können glaubte. Hat Watson Pawlow richtig verstanden? War also auch schon Pawlow eigentlich ein Behaviorist? Nein! Pawlow hatte gänzlich anderes im Sinne als Watson und seine Gefolgsleute: Keine praktisch verwertbare Verhaltenstechnologie, sondern eine Theorie der – eben nicht direkt beobachtbaren! – höheren Nerventätigkeit. „Der dem praktischen Leben zugewandte amerikanische Geschäftssinn fand“, so heißt es in einer Publikation von Pawlow, „dass die genaue Kenntnis des äußeren Verhaltens des Menschen wichtiger ist, als über seinen inneren Zustand mit allen seinen Kombinationen und Schwankungen Mutmaßungen anzustellen.“ Die Differenz zwischen Pawlow und dem Programm der Behavioristen wird allein schon darin deutlich, dass Pawlow die Verbindung zwischen UCS und CS nicht als Assoziation beschrieben wissen wollte. Den CS nannte er ein „Signal“, das dem Versuchstier den UCS ankündigt. So betrachtet, lernt das Versuchstier durch die Konditionierung eigentlich eine Erwartung: die Erwartung, dass auf das Auftreten des CS der UCS folgen wird. Für die antimentalistische Denkungs- und Redensart der Behavioristen war ein solcher Gedanke grundsätzlich unannehmbar. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit 11