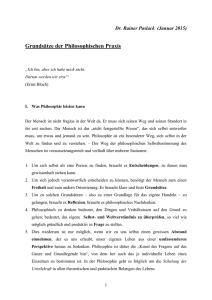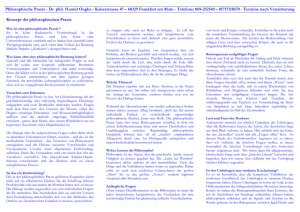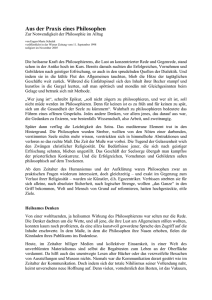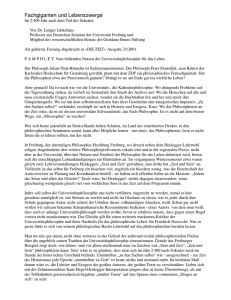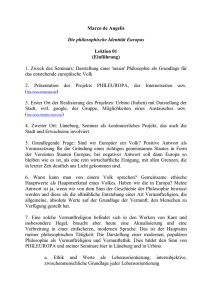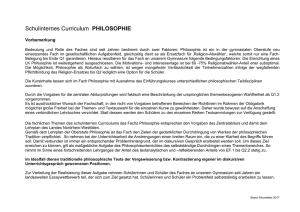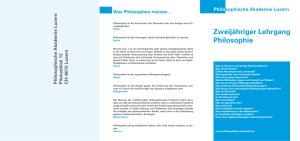Mehr Licht. Erfahrungen aus der philosophischen Praxis
Werbung
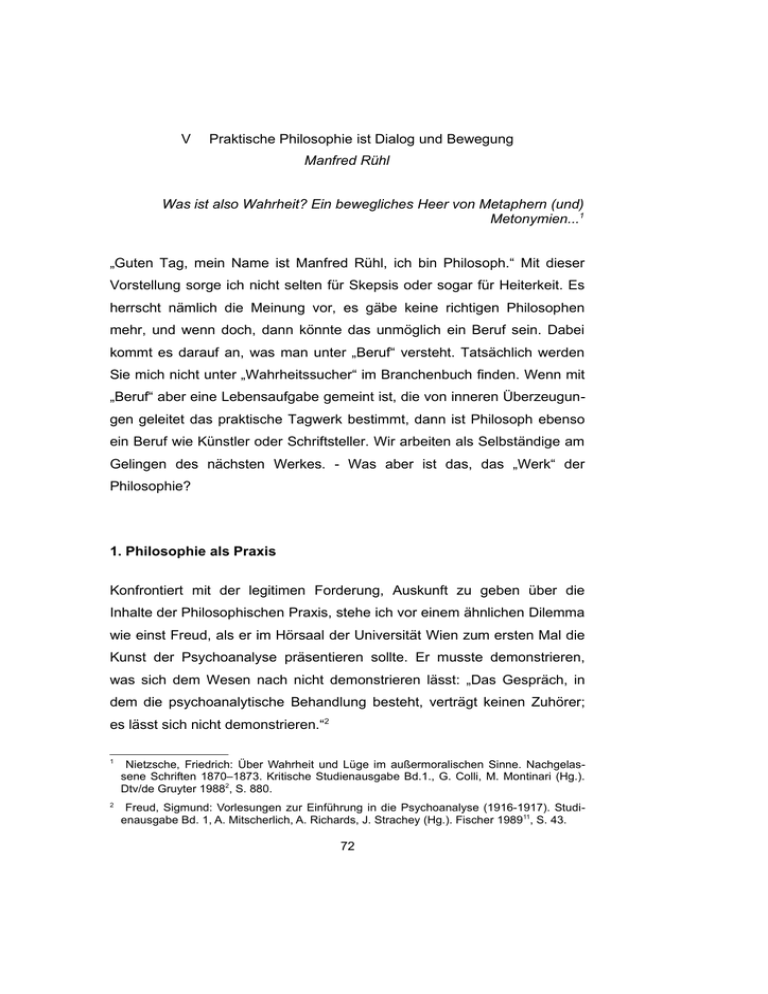
V Praktische Philosophie ist Dialog und Bewegung Manfred Rühl Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern (und) Metonymien...1 „Guten Tag, mein Name ist Manfred Rühl, ich bin Philosoph.“ Mit dieser Vorstellung sorge ich nicht selten für Skepsis oder sogar für Heiterkeit. Es herrscht nämlich die Meinung vor, es gäbe keine richtigen Philosophen mehr, und wenn doch, dann könnte das unmöglich ein Beruf sein. Dabei kommt es darauf an, was man unter „Beruf“ versteht. Tatsächlich werden Sie mich nicht unter „Wahrheitssucher“ im Branchenbuch finden. Wenn mit „Beruf“ aber eine Lebensaufgabe gemeint ist, die von inneren Überzeugungen geleitet das praktische Tagwerk bestimmt, dann ist Philosoph ebenso ein Beruf wie Künstler oder Schriftsteller. Wir arbeiten als Selbständige am Gelingen des nächsten Werkes. - Was aber ist das, das „Werk“ der Philosophie? 1. Philosophie als Praxis Konfrontiert mit der legitimen Forderung, Auskunft zu geben über die Inhalte der Philosophischen Praxis, stehe ich vor einem ähnlichen Dilemma wie einst Freud, als er im Hörsaal der Universität Wien zum ersten Mal die Kunst der Psychoanalyse präsentieren sollte. Er musste demonstrieren, was sich dem Wesen nach nicht demonstrieren lässt: „Das Gespräch, in dem die psychoanalytische Behandlung besteht, verträgt keinen Zuhörer; es lässt sich nicht demonstrieren.“2 1 Nietzsche, Friedrich: Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne. Nachgelassene Schriften 1870–1873. Kritische Studienausgabe Bd.1., G. Colli, M. Montinari (Hg.). Dtv/de Gruyter 19882, S. 880. 2 Freud, Sigmund: Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1916-1917). Studienausgabe Bd. 1, A. Mitscherlich, A. Richards, J. Strachey (Hg.). Fischer 198911, S. 43. 72 Freud begründet hier seine Absage an die Erwartungen der Zuhörer mit dem Hinweis auf den intimen Charakter der Gesprächsinhalte. Im Fall der Philosophischen Praxis jedoch ist der Grund für die Zurückhaltung nicht die Diskretion, sondern die Individualität der Personen. Philosophische Praxis ist kasuistisch. Jede Wegbegleitung ist ein einzigartiger Verlauf, der sich nicht verallgemeinern lässt. Eine Falldarstellung zur Erläuterung verbietet sich also, da ein stets individueller Verlauf kein Schema für weitere philosophische Begegnungen liefert. Philosophische Praxis, verstanden als Abfolge einzigartiger Begegnungen zwischen Einzelpersonen, kann ich daher im Folgenden nur charakterisieren durch die Offenlegung der Haltung, die hinter dieser Begleitung steht. Was in der Philosophischen Praxis geschieht, beschreibt am deutlichsten ohnehin die Metapher, die diesem Buch den Titel gibt: Wir suchen gemeinsam „mehr Licht“. Im Bewusstsein der Endlichkeit, der Macht der Liebe und der Pflicht zu handeln und mit Hilfe des Humors begleite ich Menschen so, wie es Platon im Höhlengleichnis als Aufgabe des Philosophen beschrieben hat. Anders gesagt - mit Worten, die sich in die moderne Selbsterfahrungs-Landschaft besser einbetten lassen -, ich philosophiere mit Menschen, deren Fragen für ein Coaching zu existentiell sind, für eine Psychotherapie aber zu gesund. Das klingt, als ob ich der Frage nach meinen Methoden ausweichen wollte. Dazu gleich eine philosophische Überlegung: Als Philosoph weigere ich mich, meinen Beruf über Methoden zu definieren, weil dieser Zugang das Wesentliche verfehlte. Berufe werden heute wie selbstverständlich über ihre Methoden kategorisiert. Diese Art der Kategorisierung orientiert sich an handwerklichen Berufen, bei denen es tatsächlich einen großen Unterschied macht, ob ich diese oder jene Methode anwende. Die Methode des „Erhitzens auf tausend Grad“ hat allerdings sehr unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem, ob ich mit Glas oder mit Holz arbeite. Diese Art zu kategorisieren wird jedoch auch gerne auf Berufe übertragen, in denen Menschen mit Menschen arbeiten: Bevor wir jemanden Hand an uns legen lassen, wollen wir wissen, ob wir nachher transparent sein werden oder 73 ausgebrannt. Wer sich hier nicht deutlich machen kann, macht sich suspekt. Als Philosoph mache ich mich in diesem Fall suspekt, weil ich darauf bestehe, dass die Menschen, mit denen ich philosophiere, kein Material sind und ich kein Handwerker bin. Praktische Philosophie folgt keinen handwerklichen Metaphern, sondern musikalischen und poetischen. Philosophie ist soziale Poesie, ein gemeinsames Dichten und Denken. Die Vorstellung, dass praktische Philosophie durch Methoden definiert werden kann, ist nicht nur unzutreffend, sondern irreführend. Für den eingangs angesprochenen Erklärungsbedarf bringt das natürlich erhebliche Nachteile. Die Absage an Methoden missachtet das berechtigte Bedürfnis nach Sicherheit ebenso (Was geschieht hier mit mir?) wie die Forderung nach Zielklarheit (Was habe ich davon?). Der Verzicht auf eine eingetragene Methode nimmt den philosophischen Praktikern als Berufsgruppe weiters die Chance, auf dem öffentlichen Marktplatz wahrgenommen zu werden. Auf dem zunehmend unübersichtlicher werdenden Markt des Beratungswesens werden die Positionen seit langem über Methoden bezogen, über das X®. Psychologisch orientierte Schulen präsentieren unterschiedliche „Tools“, esoterische Weisheitslehren versprechen höhere Bewusstseinszustände, mal durch diese, mal durch jene Methode, körpertherapeutische Ansätze suchen das Heil im Sitzen, im Stehen oder im Atmen, und selbst die religiösen Fraktionen unterscheiden sich durch die Rituale, die sie vorschreiben. Sollten wir deshalb eine Methode einführen, die „praktische Philosophie“ heißt? Ich denke nicht. Ich lehne dieses Ansinnen ab, weil es nur wenig mehr ist als die Verbeugung vor einer allgemein herrschenden Methodengläubigkeit. Aufgrund dieses Glaubens an die Möglichkeit eines „mehr oder weniger planmäßigen Verfahrens zur Erreichung eines Zieles“ („Methode“ laut Wikipedia) wächst die Zahl der Methoden® am Beratungsmarkt explosionsartig. 74 Es gibt zudem auch gute Gründe, sich der Definition durch Methoden tatsächlich zu entziehen. Diese Gründe sind zwingend, wenn man sich dem einzelnen Menschen und seiner Suche verpflichtet fühlt: in der philosophischen Begleitung von Menschen. Hier bedeutet Erfolg, existentielle Begegnung zu wagen und ein gemeinsames Fortschreiten um der Wahrheit willen. Hier zählt nicht die Methode, sondern die Haltung. Die philosophische Berufsqualifikation beruht auf der Fähigkeit zur didaktischen Abstinenz, dem bewussten Verzicht auf ein planmäßiges Vorgehen. Weniger ist mehr, oder wie es der Urvater aller praktischen Philosophie, Sokrates, für alle Zeit prägte: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Es ist die Haltung des Anfängers, des Nicht-Wissens, der Unvoreingenommenheit, der epoché, um Husserls Fachausdruck zu verwenden, die den praktisch-philosophischen Dialog eröffnet. Die Einladung zum Philosophieren gleicht einer Aufforderung zum Improvisations-Tanz. Sie hat nichts zu tun mit der irrigen Vorstellung von Beratung als Anwendung von „Tools“ oder von Philosophie als Belehrung über den richtigen Umgang mit kritischen Lebenssituationen. Das Erkennungsmerkmal der gelungenen Philosophischen Praxis ist nicht die Methode, sondern ihr Gegenteil: die Unwiederholbarkeit. Eine echte philosophische Begegnung findet so nur einmal statt. Sie entzieht sich dem Gerede, dem Jammern und Phantasieren, dem Planen und Sorgen. Sie lässt sich nicht wiederholen, weil in diesem Gespräch zwei Menschen im Strom der Zeit einen Moment innehalten und sich erkennen, bevor sie sich wieder dem Fluss des Lebens anvertrauen. Diese Begegnung kann ein Leben lang nachwirken, aber wiederholen lässt sie sich nicht. Wir steigen nicht zweimal in denselben Fluss. 2. Der Dialog Der Prozess, der zu einer philosophischen Begegnung führen kann, beruht auf Neugierde, Frage und Ermutigung. Er lebt von der Sprache, in der Sprache und aus ihr heraus. Er ist Poesie im literarischen wie im sozialen 75 Sinn. Fachlich gesprochen, ist der philosophische Prozess existentielle Hermeneutik. Es philosophiert, wer nach einem umfassenderen, tieferen und vorurteilsfreieren Verstehen sucht. Wo dies im Gespräch geschieht, nenne ich es Dialog. Der Dialog ist das Herz praktischer Philosophie und die eine Erfahrung, die viele Menschen nie gemacht haben. Sie kennen Gespräche nur in der Form des wechselseitigen Monologes. Diese Art, zueinander zu sprechen, ist unabhängig vom Geschlecht. Einem findigen Autor ist es freilich zu verdanken, dass die Vorstellung des begegnungslosen Monologs inzwischen in der Öffentlichkeit fast ausschließlich als verhinderte Kommunikation zwischen Mann und Frau gesehen wird: Er käme vom Mars, sie von der Venus. Diesem Autor zufolge ließe sich manches mühsam übersetzen, vieles würde man nie verstehen, und einiges wäre schlichtweg gelogen. - Das fehlende Verständnis der Menschen für sich selbst und füreinander ist aber keine Sache des Geschlechts, sondern Ausdruck einer nicht entwickelten Dialogfähigkeit, unabhängig vom Geschlecht. Der philosophische Dialog ist daher zunächst ein Bemühen um Verstehen. Hier spricht ein Mensch nicht zu einem anderen, sondern mit einem anderen. Dieser Unterschied ist bedeutsam und folgenreich. Es ist das Verdienst Martin Bubers, hier Sprache gefunden zu haben, wo vorher keine Worte waren. Nahezu alle therapeutischen Schulen, die das heilende Moment in der echten Begegnung sehen, lassen sich auf Bubers Sichtung des Grundwortes Ich-Du zurückführen. Der Mensch im Grundwort Ich-Du ist kein Ding, kein Material, kein „Es“, das methodisch behandelt, von außen betrachtet oder geformt werden kann, sondern ein „Du“: „Stehe ich einem Menschen als meinem Du gegenüber, spreche ich das Grundwort Ich-Du zu ihm, ist er kein Ding unter Dingen und nicht aus Dingen bestehend. Nicht Er oder Sie ist er, von anderen Er und Sie begrenzt, im Weltnetz aus Raum und Zeit eingetragener Punkt [...] sondern nachbarnlos und fugenlos ist er Du und füllt den Himmelskreis.“3 3 Buber, Martin: Das dialogische Prinzip. Lambert Schneider 19978, S. 12. 76 Der philosophische Dialog steht also direkt in der Nachfolge Bubers und versteht sich als Einladung, als Zurückweichen und als Bemühen um Verstehen. Er erreicht sein Ziel, wenn es gelingt, einen Menschen anzusprechen, wie er noch nie angesprochen wurde; wenn es zu Berührung und Begegnung kommt; wenn sich ein „Aha-Effekt“ einstellt; wenn eine Sache in völlig neuem Licht erscheint. Auf dem Weg dorthin werden Urteile überprüft, Meinungen hinterfragt und Sichtweisen gewechselt. Dabei geht es nicht um Konkurrenz, sondern einzig um „mehr Licht“: darum, klarer zu sehen, was ist. Das Ziel ist Selbsterkenntnis: die eigene Situation in neuem Licht zu sehen. Der Weg zu diesem Ziel ist dabei nicht immer so klar. Zweideutigkeit und Verwirrung sind halblichte Zwischenstufen auf dem Weg in die Sonne. Sie gehören zum Leben ebenso wie Eindeutigkeiten und klare Entscheidungen. Es gibt eine Zeit für Dämmerung, Nebel und Halbdunkel ebenso wie für Sonne und Licht. Zum Mensch-Sein gehört beides. Es gehört viel Mut dazu, sich in diese Grauzonen und dunklen Bereiche zu begeben, denn zumeist wird es dunkler, bevor es wieder heller wird. Paul Watzlawick hat zu diesem Paradoxon das schönste Gleichnis beschrieben: „Unter einer Straßenlaterne steht ein Betrunkener und sucht und sucht. Ein Polizist kommt daher, fragt ihn, was er verloren habe, und der Mann antwortet: ‚Meinen Schlüssel.‘ Nun suchen beide. Schließlich will der Polizist wissen, ob der Mann sicher ist, den Schlüssel gerade hier verloren zu haben, und jener antwortet: ‚Nein, nicht hier, sondern dort hinten - aber dort ist es viel zu finster.‘ “4 In jedem Leben gibt es Licht. Wozu sich also ins Dunkel wagen, um den Schlüssel zu suchen? In Abwandlung eines alten Sprichworts gilt hier: Das Gute ist der Feind des Besseren. Der Lichtkegel rund um die Laterne steht für unseren vertrauten Lebenskreis. Hier kennen wir uns aus und fühlen uns sicher. Aber viele Menschen spüren oder ahnen, dass sie diesen Lichtkreis verlassen müssen; sie spüren eine Sehnsucht, die ihnen sagt, dass sie den vertrauten Lichtkegel hinter sich lassen müssen, um den Schlüssel 4 Watzlawick, Paul: Anleitung zum Unglücklichsein. Piper 199919, S. 27. 77 zu finden, der sie nach Hause bringt. Hier trennt sich mein Gleichnis von jenem Platos. Die Sonne, die zugleich erhellt und wärmt, scheint nicht außerhalb der Höhle, sondern in uns selbst; dort, wo unsere Heimat ist. Wer seine Heimat kennt und sie aus eigener Kraft erreichen kann, sieht das Licht. Praktische Philosophie ist folglich Begleitung auf dem Weg nach Hause. 3. Die Bedeutung des Leibes Meine Auffassung von Philosophischer Praxis unterscheidet sich von anderen Formen der Beratung nicht nur durch die Absage an die Methodenhörigkeit. Philosophie praktisch zu machen, bedeutet auch, sich vom Klischee des „rein Geistigen“ zu verabschieden. Diesem Klischee entsprechend, ist der philosophische Mensch erstens männlich und zweitens ein sitzender Denker. Manchmal hat er den Kopf in die Hand gestützt. Was er denkt, sind Gedanken - keine Erinnerungen, Hoffnungen, Wünsche oder Sehnsüchte, sondern Gedanken über Gott und die Welt. Was er sich dann so erdenkt, schreibt er in ein Buch, das andere Menschen lesen, die sich Gedanken über diese Gedanken machen. Und obwohl sehr viel gesessen wird, entsteht der Eindruck, als würde nie die Erde berührt; als seien die Ereignisse, mit denen hier gehandelt wird, unerreichbare Fixsterne, deren Bedeutung für die Orientierung über die Jahrtausende hinweg weitergereicht wird. Diese Art der philosophischen Richtungsweisung hat ohne Zweifel auch ihren wohlverdienten Platz unter den Errungenschaften der humanistischen Bildungsgüter. Für die meisten Menschen ist sie aber zu unpersönlich und zu abstrakt, um im täglichen Leben einen Unterschied zu machen. Philosophische Praxis, die ich meine, ist das Gegenteil. Diese Art der Philosophie ist körperlich, sie ist weiblich und sinnlich, dialogisch, praktisch und lebendig. Wenn wir uns „die Philosophie“ überhaupt als Person vorstel- 78 len wollen, dann als anspruchsvolle Geliebte, wie sie Meredith Brooks in ihrem Song beschreibt: „I´m a bitch, I´m a lover, I´m a child, I´m a mother, I ´m a sinner, I´m a saint, I do not feel ashamed, I´m your hell, I´m your dream, I´m nothing in between [...]“. Sie gibt dir alles, aber nie das Ganze. Es ist gerade in diesem Zusammenhang wieder erwähnenswert, dass auch der große Philosoph Sokrates auf dem wichtigsten Gebiet des menschlichen Lebens von einer Frau unterwiesen wurde. Es war eine gewisse Diotima, die ihn das Wesen der Liebe lehrte. Platon beschreibt diese Szene im Symposion, wo eine Männerrunde unter Verzicht auf Alkohol über die wahre Liebe redet, der Hauptredner Sokrates aber unumwunden zugibt, in dieser Sache verstünde eine Frau mehr als er. Aber zurück zum Verhältnis von Körper und Geist. In meiner Praxis kommen wir auf unserem gemeinsamen Weg nicht nur in einem übertragenen Sinne weiter, so wie man sagt, man sei durch ein Gespräch weitergekommen, sondern wir setzen uns auch tatsächlich in Bewegung. Geistiges Weiterkommen wird unterstützt, bekräftigt und oftmals erst in Gang gesetzt durch physisches „Weiter-Gehen“. Auf der Basis dieses Ansatzes ist auch verständlich, wie mein Rat zum Thema „mehr Licht“ lautet: Wer ans Licht will, muss sich leibhaftig in Bewegung setzen. Das bedeutet wörtlich, er muss losgehen, sich über Wasser halten, sich fallen lassen, standhalten oder auch zum Rhythmus des eigenen Lebens tanzen. Über die angemessene Form der Bewegung entscheidet die Situation. Es ist für mich in diesem Zusammenhang nicht verwunderlich, dass die Tradition des Pilgerns gerade eine große Renaissance erlebt. Wer diese Erfahrung gemacht hat, weiß, was es heißt, vom Vertrauten wegzugehen, um zu sich selbst zu kommen. Die Wahrheiten, mit denen man von einer Pilgerreise zurückkehrt, sind vielleicht nicht die, die man traditionell der Philosophie zuschreibt, die großen, die absoluten und allumfassend letztgültigen Aussagen über das Wesen von allem; aber es sind Wahrheiten, die die eigene Existenz näher an diese große Wahrheit rücken; näher ans Licht, wenn man so will. Aus diesem Grund mache ich mich einmal im Jahr mit 79 einer Gruppe von Männern auf den Weg. Gemeinsam sind wir eine Woche unterwegs, und wir gehen unsere Lebenswege nach. Dabei beschäftigen wir uns mit den Kräften und Einflüssen, die uns geprägt haben, und mit den Plänen und Träumen, die wir noch haben. Das sind die Themen, über die gesprochen wird. Darüber stehen die Themen, die wirken: die Fähigkeit zum Dialog, die gerade unter Männern oft völlig abhanden gekommen ist, die Freiheit und Gebundenheit des Weges, der Wert der Gemeinschaft und der Individualität. Wer genau hinsieht, erkennt die Parallelen zwischen dem Weg, den wir gehen, und seinem eigenen Lebensweg. 4. Exkurs zu Psyche, Pneuma und Soma Mit der Idee der körperlichen Bewegung um des geistigen Fortschritts willen befinde ich mich in einer langen und weit verzweigten Tradition. Als Psychosomatik hat sie Einzug gehalten in die moderne ärztliche Psychiatrie. Dazu ein kurzer philosophischer Abriss: Grundsätzlich liegt allen psycho-physischen Theorien die Annahme zugrunde, dass Körper und Geist Unterschiedliches sind, sich aber gegenseitig beeinflussen. Ausgehend von dieser Grundmetapher haben sich vier unterschiedliche Arten der Sorge um sich selbst etabliert. Auf der einen Seite alle Versuche, die Wechselwirkungen zwischen dem Körper (Soma) und der individuellen Seele (Psyche) zu erklären, auf der anderen Seite alle Versuche, die Zusammenhänge zwischen dem Körper und der überindividuellen „Weltseele“ (Pneuma) zu erhellen. Je nachdem, ob nun eher die Wirkung des Materiellen auf das Immaterielle untersucht wird oder umgekehrt, ergeben sich die erwähnten vier Zugänge zur Selbstsorge. Die begriffliche Trennung zwischen individueller und überindividueller Seele, die solche Sorge überhaupt in Gang kommen ließ, reicht zurück bis zu den Ursprüngen unserer Kultur. Die hebräische Bibel trennt ruach als „Geist, der über den Wassern schwebt“, von näphäsch, der individuellen 80 Seele. In der griechischen Übersetzung wird das dann zu „Psyche“, als individuelle Lebenskraft im Gegensatz zu „Pneuma“, dem allumfassenden Geist5. Nachdem diese Unterscheidung wirksam wurde, trennten sich körperlich-seelische Interventionen in psychosomatische und - begrifflich weniger gebräuchlich, aber inhaltlich ebenso weit verbreitet - pneumosomatische. Leiblich-seelische Arbeit am Selbst gliedert sich daher auf in psychosomatische Interventionen, die alle Versuche umfassen, körperliche Symptome durch geistige Arbeit zu lösen, etwa indem man Kindheitstraumen in einer Psychoanalyse durcharbeitet. Somato-psychische Heilswege hingegen gehen den umgekehrten Weg: Körperliche Aktivitäten sollen psychische Leiden kurieren, etwa wenn in einigen Kliniken Depressionen durch Jogging-Einheiten gemildert werden. Pneumo-somatische Initiativen folgen einem ähnlichen Schema, nur geht es dabei um „das Ganze“. Ignatianische Exerzitien oder die Asanas des Hata-Yoga verfolgen nicht das enge Ziel des Ausgleichs zwischen Körper und Geist im individuellen Sinn, sondern das weite Ziel der Synchronisation mit der ursprünglichen Weltseele. Es waren Philosophen, die den vertrauten Lichtkegel dieser Begriffe verlassen haben und mit neuen Begriffen „mehr Licht“ in die Zusammenhänge zwischen Körper und Geist gebracht haben: Martin Heidegger, indem er vom Dasein spricht und nicht vom Menschen; Merleau-Ponty, indem er von Leiblichkeit spricht und nicht vom Körper. Gemeinsam ist ihnen der Versuch, den Menschen unbefangen und in neuem Licht zu betrachten. Das Lexikon nennt diesen Zugang phänomenologisch: den Versuch, die Dinge nur so zu sehen, wie sie sich zeigen, nicht so, wie sie sind - ein schwieriges Unterfangen mit verblüffenden Ergebnissen. Versuchen Sie doch einmal, den Menschen zu beschreiben, ohne dabei die Begriffe „Körper“, „Geist“ oder „Seele“ zu verwenden. Wie das geht? Wenn diese Frage Ihr Interesse weckt, dann sind Sie reif für eine philosophische Erfahrung. 5 Zur Überprüfung der Unterschiede zwischen der hebräischen und griechischen Auslegung der Begriffe siehe: Probst, Peter: Kant, Bestirnter Himmel und moralisches Gesetz. Zum geschichtlichen Horizont einer These Immanuel Kants. Königshausen & Neumann 1994, S. 38 ff. 81 5. Universelle Metaphorik Zuletzt gilt es noch mit einem weiteren Vorbehalt aufzuräumen, wie er der Philosophie oft entgegengebracht wird. Es wurde gesagt, dass die Philosophen die Welt nur interpretierten, anstatt sie zu verändern. Das Gegenteil ist der Fall. Philosophen sind Menschen, und Menschen interpretieren die Welt in Metaphern. Radikal formuliert: Wir machen aus unseren Bildern Tatsachen, nicht umgekehrt. Wie oben gezeigt, betrifft das auch und gerade so elementare Begriffe wie Körper oder Seele. Universelle Metaphorik, ganz im Sinne des vorangestellten Zitats Nietzsches, ist daher die dritte Säule meiner Philosophischen Praxis. Menschen leben in Metaphern, und wer Metaphern verändert, verändert die Welt. Der junge Wittgenstein, noch überzeugt davon, die Welt objektiv erklären zu können, schrieb: „2.1 Wir machen uns Bilder der Tatsachen.“ 6 Er selbst ist von dieser These in seinem späteren Werk abgerückt. Die Vorstellung, dass es uns möglich sei, von Tatsachen zu entsprechenden Bildern zu gelangen, wurde ihm zweifelhaft, wenn es um die Wirklichkeit der Wirklichkeit ging. Die Tatsachen gingen ihm verloren und was blieb, waren Bilder und die Spiele, die wir mit ihnen spielen. Wir machen uns Bilder, soviel steht fest: Gottesbilder, Menschenbilder, Bilder zu Gut und Böse, Bilder vom Traumpartner, Bilder von der Zukunft und der Vergangenheit. Was diese Bilder mit Tatsachen zu tun haben, ist fragwürdig und auf jeden Fall wert, untersucht zu werden, aber nicht in der Philosophischen Praxis. Es gibt andere Wissenschaften, die sich damit beschäftigen: die Chemie, die Biologie, die Psychologie, die Soziologie, die Politologie. Wer philosophisch mit Menschen zu tun hat, die in ihren Bildern leben, darf diese Bilder nicht zerstören, indem er Farbe für eine Untersuchung abkratzt. Das ist nicht der Sinn. Philosophieren bedeutet, zu sehen, wie der Pinsel geführt wurde, wie Licht und Schatten verteilt sind und wo die Lichtquelle liegt, die dieses einmalige Kunstwerk beleuchtet. Alles ist Metapher. Alles lebt in Bildern. 6 Wittgenstein, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus. Werkausgabe Bd.1, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 19907, S. 14. 82 Ein westlicher Gelehrter besuchte einst einen buddhistischen Meister, um ihn über ein Bild zu befragen, das die Welt zeigt, getragen von einem weißen Elefanten. „Worauf steht denn der weiße Elefant?“, war die Frage. „Auf einem weiteren weißen Elefanten“, war die Antwort, „und bevor Sie weiterfragen: Dieser steht wiederum auf einem weißen Elefanten. Es sind alles weiße Elefanten, bis ganz unten.“ Was glauben Sie? Wer ist der Wahrheit näher: der buddhistische Mönch oder der westliche Gelehrte? Ich nehme an, Ihre Antwort hängt stark davon ab, ob Sie selbst Mystiker oder Wissenschaftler sind. Aber geben Sie sich keinen Illusionen hin: Wir wissen nicht, welche Erklärung näher an der Wahrheit ist. Fest steht, dass Bilder die Menschen, die sie besitzen, stark verändern. Wer also diese Bilder verändert, verändert die Welt. Das ist das Werk der praktischen Philosophie. 83