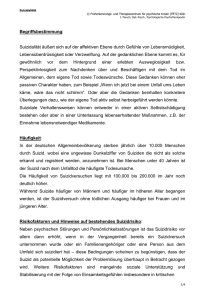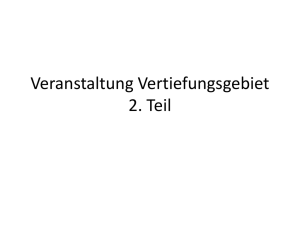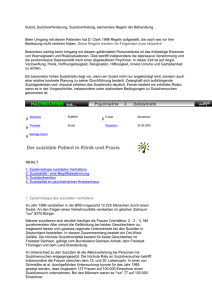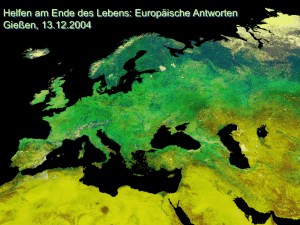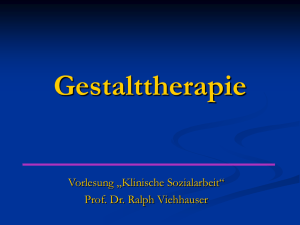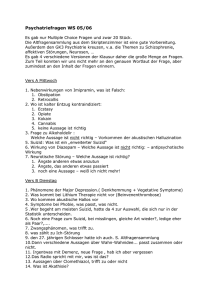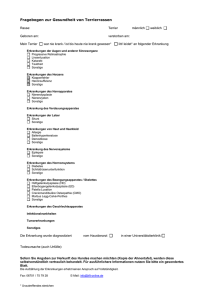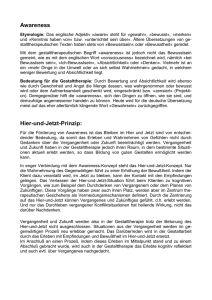öffnen - Gestalttherapie Groß
Werbung

Petra Franziska Schröder Hedwig-Dohm-Straße 19, D - 64521 Groß-Gerau [email protected] Psychotherapie und Suizid Erlaubt oder fordert die Palliative Care eine andere Vorgehensweise Master Thesis zur Erlangung des akademischen Grades Master of Advanced Studies „Palliative Care“/MAS Eingereicht im Rahmen des Internationalen Universitätslehrgangs 2011 – 2013 Palliative Care/MAS an der Alpen-Adria Universität Klagenfurt | Wien | Graz IFF-Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung Institut für Palliative Care und Organisationsethik Gutachter: Mag. Dr. Erich Lehner Groß-Gerau/Wien, 24. April 2013 „Ich bin nicht auf dieser Welt, um deinen Erwartungen zu entsprechen – und du bist nicht auf dieser Welt, um meinen Erwartungen zu entsprechen.“ Fritz Perls (1976) Danke für alles, Oliver. Danke Harald! 2 Zusammenfassung Suizidalität im Bereich der Palliative Care und der professionelle Umgang der Psychotherapie, hier speziell der Gestalttherapie, mit dieser Problematik sind Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Es wird die Frage gestellt, ob die Herangehensweise bei einer terminal erkrankten Person anders ist als bei einer nicht terminal erkrankten Person. An einem Praxisbeispiel wird zunächst aufgezeigt, wie gemeinsame Arbeit verschiedener Professionen aus den Bereichen der Psychotherapie und der Palliative Care gelingen kann. Gleichwohl wirft sie für die Beteiligten viele ethische und rechtliche Fragen auf. Zunächst werden Verbindungen in der Problemstellung und den Vorgehensweisen in der Psychotherapie im Allgemeinen, der Gestalttherapie im Besonderen und der Palliative Care hergestellt. Es wird herausgearbeitet, inwieweit die Professionen, die mit terminal erkrankten Menschen arbeiten, mit dem Thema Suizidalität in Kontakt kommen. Die Rollen der unterschiedlichen Berufsfelder werden beleuchtet. Den Sichtweisen der psychotherapeutischen Professionen hinsichtlich Suizidalität werden Stellungnahmen der Rechtswissenschaft ergänzend gegenübergestellt. Ein Zusammentragen von Überlegungen und Äußerungen der Palliative Care Bewegung zum Umgang mit Suizidalität bei terminaler Krankheit soll Aufschluss darüber geben, welche Rolle das Thema für die Helfenden einnimmt und wie sie in ihrer Arbeit mit dieser Personengruppe vorgehen. Im Folgenden werden Quellen aus dem Bereich der Ethik gesichtet. Im Abschlusskapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst und Schlussfolgerungen gezogen. 3 Gliederung Zusammenfassung ...................................................................................... 3 1 Einleitung ................................................................................................ 5 1.1 Allgemeines..................................................................................................... 5 1.2 Persönliche Motivation und Relevanz der Themenwahl .................................. 6 1.3 Vorgehen und Methoden ................................................................................. 9 2 Praxisbeispiel ....................................................................................... 12 3 Gestalttherapie und Suizid .................................................................. 18 3.1 Der Ursprung der Gestalttherapie.................................................................. 18 3.2 Grundannahmen und Methoden der Gestalttherapie..................................... 22 3.3 Die Sicht der Gestalttherapie auf den suizidalen Menschen .......................... 30 3.4 Suizidabsicht und Krise ................................................................................. 32 3.5 Relevanz von Supervision ............................................................................. 33 4 Psychotherapie und Suizid.................................................................. 35 4.1 Suizidalität erkennen ..................................................................................... 35 4.2 Erhebung einer Diagnose am Beispiel der Depression.................................. 37 4.3 Die Aufgabe der Therapierenden .................................................................. 40 4.4 Die narzisstische Kränkung ........................................................................... 42 4.5 Juristische Grenzen in der Psychotherapie ................................................... 44 5 Palliative Care und Suizid .................................................................... 48 5.1 Die Verbindung von sterbenskrank und lebensmüde..................................... 48 5.2 Gutes Sterben und der anspruchsvolle Weg dahin........................................ 50 5.3 Suizidalität ansprechen und erkennen........................................................... 53 5.4 Wie sich die Pionierinnen der Hospizbewegung zum Suizid positionieren..... 54 6 Ethik und Suizid.................................................................................... 57 6.1 Ethos und Ethik ............................................................................................. 57 6.2 Suizidprophylaxe – Anmaßung oder Verpflichtung ........................................ 58 6.3 Das Spannungsfeld von Autonomie, Fremdbestimmung und sozialer Verbundenheit ....................................................................................................... 60 6.4 Gesellschaftliche Bewertung von Auslösern suizidaler Handlungen .............. 63 7 Ergebnisse und Schlussfolgerungen ................................................. 66 Literaturverzeichnis ...................................................................................... 74 4 1 Einleitung 1.1 Allgemeines In der Begleitung von unheilbar erkrankten Menschen mit vorhersehbar begrenzter Lebenszeit fällt auf, dass diese sich häufig die Frage nach einem selbst gewählten Todeszeitpunkt stellen. Die Aufgabe der Psychotherapie ist hierbei, diese Menschen in ihrer Entscheidungsphase zu begleiten. Es gilt, sie dabei zu unterstützen, alle Bereiche abzuwägen und insbesondere die Bereiche mit ihnen zu beleuchten, die ihnen einen Lebenssinn geben könnten. „Du hast die Freiheit, dich zu vernichten. Ich werde dich nicht hindern, aber alles tun, damit du eine andere Perspektive erhältst.“ (Schneider 1990, 219). Zur geschilderten Situation kommt hinzu, dass die Therapierenden verpflichtet sind zu eruieren, ob die suizidale Person möglicherweise psychisch krank und somit behandelbar ist. Diese Abklärung sollte bestenfalls durch eine zweite fachärztliche Meinung untermauert werden. Einige Fachpersonen sind der Meinung, dass Suizidalität an sich bereits eine psychische Erkrankung darstellt. Das würde bedeuten, dass die betreffende Person mit Suizidabsicht gegebenenfalls auch gegen ihren Willen zu behandeln wäre. An diesem Punkt steht die Selbstbestimmung der Erkrankten nicht mehr unbestreitbar im Vordergrund. Hier werden die psychotherapeutisch Tätigen wie auch die anderen Professionen eines behandelnden Teams mit einer Ambivalenz konfrontiert. Einerseits besteht der Auftrag, den Erkrankten zu helfen, dazu würden selbstverständlich auch die psychiatrische Abklärung und gegebenenfalls Behandlung gehören. Andererseits entwickelt sich häufig bei den Helfenden ein ausgeprägtes, hoch empathisches aber nicht sehr differenziertes Gefühl des Verständnisses beziehungsweise Mitgefühls oder gar Mitleids für die suizidale Person. Diese befindet sich offensichtlich am Lebensende und will ihren Verfall nicht bis zum Ende miterleben. Hier kamen so manchen Kolleginnen und Kollegen aus dem Palliative Care Kontext Sätze wie: “Das 5 ginge mir doch genau so.“ oder „Das wollte ich doch auch nicht mehr“ in den Sinn. Anstelle des eigentlichen beruflichen Zieles, erkrankten Menschen zu Besserung beziehungsweise Gesundung zu verhelfen, tritt im palliativen Kontext das Ziel der Linderung von Belastungen aller Art. “Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problem associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual.” (World Health Organisation 2013) Der Schwerpunkt liegt auf der Patientenautonomie und die Unterstützung gilt maßgeblich den Vorstellungen und Wünschen der Erkrankten. Im Sinne des Palliative Care Verständnisses werden unheilbar erkrankte Menschen nicht heilend, kurativ und rehabilitativ, sondern Lebensqualität erhaltend und Symptome lindernd behandelt und umsorgt. Es stellt sich die Frage, ob dieser Grundsatz beibehalten werden kann, wenn eine unheilbar erkrankte Person bei akuter Suizidabsicht in die Psychiatrie eingewiesen würde, um eine Suizidhandlung zu verhindern. Andersherum würde sich die Frage stellen, ob psychotherapeutisch Tätige ihrer Aufgabe gerecht werden können, wenn sie nicht alles Mögliche unternehmen, um einen Suizid zu vermeiden. 1.2 Persönliche Motivation und Relevanz der Themenwahl Das Thema Suizidalität beschäftigt mich bereits seit meiner ersten Ausbildung im Bereich der Psychotherapie. Damals schon suchte ich nach einer sicheren Handlungsanleitung, wie ich damit umzugehen hätte, wenn ich bei einem Menschen Suizidalität erkennen würde. 6 Am Ende meiner Ausbildung fand ich mich mit einer eher formalen Anleitung ab. Danach hätte ich dafür zu sorgen, dass eine suizidale Person freiwillig, wenn erforderlich gegen ihren Willen, möglicherweise mit polizeilicher Unterstützung, in der Psychiatrie untergebracht würde. So startete ich in meine selbständige psychotherapeutische Arbeit mit der Beklommenheit, in einem solchen Fall eine immens große Verantwortung zu tragen. Es ginge um Leben und Tod und das würde gegebenenfalls von meiner Vorgehensweise abhängen. Ein sehr bedeutsamer Aspekt in meinem bisherigen Berufsleben, hier allgemein im Feld der sozialen Arbeit, war und ist es, einen Schwerpunkt darauf zu legen, die Autonomie der sich mir anvertrauenden Menschen zu schützen und zu fördern. Somit würde eine Einweisung in die Psychiatrie unter Zwang, die ich in die Wege zu leiten hätte, zu einer besonderen Aufgabe, die meinen bisherigen Vorsätzen weitgehend widerspräche. Hinzu kommt, dass akute Suizidalität in der ambulanten psychotherapeutischen Praxis selten vorkommt und somit ein geringes Übungsfeld darstellt. Dieser Umstand könnte gewissermaßen sogar dazu verleiten, diesem Thema den notwendigen Raum abzusprechen, in der Hoffnung, dass es einem selbst in der täglichen Arbeit nicht begegnen möge. Vor dem Erkennen von Suizidalität im ambulanten Setting kommt in den meisten Fällen zunächst die Frage nach Suizidgedanken. Damit wird erst die Tür für eine Aussprechbarkeit solcher Überlegungen geöffnet. Für die psychotherapeutische Arbeit ist es verpflichtend notwendig, die Frage nach Suizidgedanken zu Beginn einer Therapie abzuklären und gegebenenfalls auch in der laufenden Therapie wiederholt zu eruieren. Weil dies ein klar formulierter Auftrag an psychotherapeutisch Tätige ist, überrascht es, dass in Schriften zur Suizidprävention unermüdlich darauf hingewiesen wird, dass es ein Irrglaube sei, dass man mit dem Ansprechen dieses Themas „schlafende Hunde“ wecken könne. Die Vermutung, dass Professionelle dem Thema ausweichen, um sich auf diese Weise selbst zu schützen, liegt nahe. Diese Tatsache beinhaltet zwei wichtige Aspekte. 7 Einerseits weichen Professionelle unreflektiert oder unbewusst dem Thema aus, andererseits entziehen sie sich unbewusst der Verantwortung, da ihnen die nötige Handlungssicherheit fehlt. Die ambulante wie auch die stationäre psychische Betreuung in der spezialisierten Palliativversorgung sterbenskranker Menschen und deren Angehörigen entspricht im Allgemeinen nicht dem psychotherapeutischen Setting. Gleichwohl scheint es selbsterklärend, dass gerade in diesem Lebensbereich suizidale Gedanken nicht ungewöhnlich sind. Anlass dafür, auch Sterbenskranken die Frage nach Suizidalität außerhalb einer klassischen Psychotherapie zu stellen, könnte sein, dieser Person in ihrer außergewöhnlichen Lebenssituation die Möglichkeit zu geben, ihre Gedanken angeleitet zu beleuchten und somit nicht in ihren eigenen Fantasien allein zu lassen. Hierzu gehört es unweigerlich, sich auf die Ebene des Gegenübers einzuschwingen, eine Ich-Du-Beziehung herzustellen (siehe Kapitel 3.2) und diesem schwierigen Thema eine gewisse Normalität zu verleihen. Meine praktische Erfahrung in der ambulanten Arbeit mit Menschen in der Endphase ihrer Erkrankung hat gezeigt, dass meine Frage an die unheilbar erkrankte Person, ob sie nach der Diagnose schon einmal daran gedacht habe, sich das Leben zu nehmen, von den meisten Menschen bejaht wird. Die Überlegung, sich das Leben zu nehmen oder sich dem weiteren (Krankheits)Verlauf mit eigens erwartetem Leid zu stellen, drängt sich nahezu jeder unheilbar erkrankten Person mit infauster Prognose auf. Sie beinhaltet für viele Menschen eine gewisse Nachvollziehbarkeit. Die Frage nach Suizidgedanken ist einerseits notwendig, um der sterbenskranken Person die Möglichkeit zu geben, im psychotherapeutischen Setting ihre ganz persönliche Antwort zu finden. Sie ist aber auch notwendig, damit sich die betreffende Person gegebenenfalls für das Sterben frei entscheiden kann. 8 Selbstbestimmung hat im Palliative Care einen ausgesprochen hohen Stellenwert und gibt jedem Menschen grundsätzlich das Recht, das eigene Leben zu einem selbst gewählten Zeitpunkt zu beenden. Eine unbestreitbare Ausnahme besteht dann, wenn die Entscheidungsfähigkeit einer Person beispielsweise durch eine schwere psychische Erkrankung eingeschränkt ist. Trotz der Wahlfreiheit, die jedem Menschen zusteht, stellt sich die Realität so dar, dass Angehörige wie Professionelle auf vollzogenen Suizid mit Bestürzung, Scham und Schuldgefühlen reagieren. Immer bleibt die Frage offen, ob tatsächlich alles erdenklich Mögliche getan wurde und der suizidalen Person jede Möglichkeit eines Sinnes am Weiterleben ins Sichtfeld gerückt wurde. Diese Frage muss sich jede an der Versorgung beteiligte professionelle Person verpflichtend stellen. Gleichwohl kann sie vielfach nicht abschließend mit einem guten Gewissen beantwortet werden, weil es vermutlich ein zutiefst menschlich verinnerlichtes Ziel ist, Leben zu schützen, statt es vergehen zu lassen. Dies mag in besonderem Maße auf heilberufliche Professionen zutreffen. Das Ziel meiner Arbeit ist es, zu erweiterten Erkenntnissen zu gelangen, um mehr Klarheit und Handlungssicherheit zu schaffen. Der aktuelle Standard der Vorgehensweisen bei Suizidgefährdung im Palliative Care bedarf einer zusätzlichen Betrachtung der Vielschichtigkeit der Patientinnen und Patienten und deren besonderer Anliegen. 1.3 Vorgehen und Methoden Im Rahmen dieser Master Thesis setze ich mich mit den unterschiedlichen Lehrmeinungen Fachliteratur in der bezüglich psychotherapeutischen der Vorgehensweisen und bei psychiatrischen Suizidabsicht im Allgemeinen und Suizidalität im Zusammenhang mit Palliative Care auseinander. 9 Hierzu ist es notwendig, sich sowohl mit den herrschenden Auffassungen der Autorinnen und Autoren älterer Schulen als auch mit den aktuellen Auseinandersetzungen in der Literatur zur Thematik Suizidalität zu beschäftigen. Hinsichtlich der Auseinandersetzung mit der Ungewissheit, ob Suizidhandlungen ausschließlich im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen zu sehen sind oder ob eine Entscheidung zum Suizid auch mit absolut klarem Menschenverstand getroffen werden kann, liegt im Rahmen dieser Master Thesis eine rein inhaltliche Fragestellung vor. Auf die Erhebung von Zahlenangaben, Prävalenzraten, bzw. der Häufigkeit des Auftretens von Suizidalität bei terminaler Erkrankung oder Depression habe ich weitgehend verzichtet. Meine Auseinandersetzung mit der Vorgehensweise in Krisensituationen von Suizidalität bezieht sich nicht auf Häufungen, sondern auf die Frage, welches das bestmögliche und individuell gerechtfertigte Vorgehen sein kann. Eine detaillierte Literaturrecherche habe ich anhand von Büchern aus Universitätsbibliotheken und aus eigenem Bestand, wissenschaftlicher Journals aus den Internet Suchmaschinen PubMed, Medline und Google Scholar sowie wissenschaftlicher Artikel aus Zeitschriften der betreffenden Berufsverbände durchgeführt. Weitere Informationen erhielt ich in themenvertiefenden kollegialen Gesprächen und durch Erfahrungsaustausch mit meiner eigenen Berufsgruppe, berufsnahen Professionen wie auch dem juristischen Themenfeld. Für das Vorgehen, sein Leben eigenständig zu beenden, gibt es ein umfangreiches Vokabular. Im verbalen Austausch mit Klientinnen und Klienten benutze ich den Terminus „sich das Leben nehmen“. „Selbsttötung ist eine, gegen das eigene Leben gerichtete Handlung mit tödlichem Ausgang. Es ist nicht entscheidend, ob der Tod beabsichtigt wurde oder nicht.“ (Hömmen 1989, 16) In der vorliegenden Master Thesis wird für die Handlung der Selbsttötung der Begriff Suizid, aus dem Lateinischen sui und caedere = sich töten (vgl. Dorsch 2009, 975), verwendet. Dieser ist 10 mittlerweile auch außerhalb der Fachwelt zu einem gängigen und allgemein verständlichen Ausdruck geworden. Bezeichnungen wie zum Beispiel Selbstmord oder Selbsttötung verleiten dazu, die Tat mit einer Straftat in Verbindung zu bringen. Der Terminus Suizid hingegen distanziert sich von gesellschaftlich eher unreflektierten Bewertungen. Die internationalen Klassifikationen „International Classification of Diseases“ und „Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders“ haben den Krankheitsbegriff mit dem der „Störung“, respektive „Disorder“, ersetzt. Damit würde einem unscharfen Gebrauch der Bezeichnung der Erkrankung sowie einer verstärkten Medizinalisierung entgegengewirkt. (vgl. Küchenhoff 2012, 13) Die Gestalttherapie versteht den Menschen immer in seinem gegenwärtigen Prozess. Es widerspricht meinem Ethos als Gestalttherapeutin, einen Prozess als psychische Störung zu beschreiben. In der gestalttherapeutischen Lehre kann ein Kontakt gestört sein, jedoch nicht ein Mensch. Obwohl auch der Begriff der psychischen Krankheit in der Gestalttherapie nicht vorbehaltlos einzusetzen ist, erscheint er mir für diese Arbeit angemessener. Einschränkend muss ich einräumen, dass das Abrechnungssystem der deutschen Krankenversicherungen eine Diagnosestellung im Sinne der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen verlangt und diese in dem Zusammenhang auch von den gestalttherapeutisch Tätigen ausgeführt wird. Herangezogene Aussagen der Nationalen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin der Schweiz NEK-CNE, Stellungnahme Nr.9/2005, die sich grundsätzlich zwar auf die Beihilfe zum Suizid aber vergleichend auch auf Suizide und Suizidversuche bezieht, werden in der vorliegenden Arbeit auf die Suizidabsicht von Sterbenskranken übertragen. Die Entscheidung für das Erbeten professioneller Beihilfe zum Suizid oder für den Suizid durch eigene Handlung erlaubt einen Vergleich. Im Kapitel 3.5 beziehen sich die Aussagen zu Zivil- und Strafrecht auf deutsche Rechtsnormen und deutsche Rechtsprechung. 11 Es wird der Umgang mit Suizidalität in den Bereichen der Psychotherapie im Allgemeinen und der Gestalttherapie im Speziellen beleuchtet. Dazu werden zunächst die Gestalttherapie und ihr Ursprung, ihre Positionen, Anschauungen und Methoden abgebildet. Die Auswahl wurde auf die im Praxisbeispiel angewendeten Methoden begrenzt. Gemeinsamkeiten und Überschneidungen mit der Versorgung und Fürsorge in der Palliative Care werden herausgestellt. In der Arbeit werden ausgehend von den einzelnen Kapiteln immer wieder Bezüge zur Person aus dem Praxisbeispiel und zu ihrer Situation hergestellt. Eine religiöse Betrachtung der Thematik der Suizidalität würde unabdingbar zusätzliche Aspekte in die Untersuchung einbringen. Darauf wird bei der Abhandlung im Folgenden verzichtet. 2 Praxisbeispiel Das Palliative Care Team, in dem ich arbeitete, erreichte der Anruf eines Ehemannes, der um Unterstützung in der Betreuung seiner 34 Jahre alten Ehefrau bat. Diese war an einer Amyotrophen Lateralsklerose (im Folgenden: ALS) erkrankt und lag zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme im Krankenhaus. Sie habe wiederholt den Wunsch geäußert, „in die Schweiz gehen“ zu wollen, um dort Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Als ich die Patientin zum ersten Mal besuchte, war ihre Mutter anwesend. Unter vielen Tränen erzählte mir die Patientin, dass sie seit sechs Jahren unter stetig wachsenden, massiven Einschränkungen leiden würde. Sie sprach angestrengt, mit leiser Stimme und musste immer wieder husten. Die Diagnose, die erst nach vielen ergebnislosen Untersuchungen gestellt worden war, habe plötzlich ihr komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Zunächst habe sie alles versucht, sich dem fortschreitenden Prozess ihrer Erkrankung immer wieder anzupassen. Sie habe ihre Arbeitszeit reduziert, als sie in einem Versandlager gearbeitet und täglich viele Wege zurückzulegen hatte. Irgendwann hätten ihr ihre Beine immer weniger 12 gehorcht und so musste sie sich mithilfe eines Rollators fortbewegen. Später habe sie dann im Rollstuhl gesessen und letztendlich ihren Job kündigen müssen. Eigentlich habe sie Kinder gewollt, doch die Angst, diese nicht groß ziehen zu können, habe sie davon abgehalten. Auch ihr Mann konnte ihr diesbezüglich keine Sicherheit geben. Er sei ja selbst sehr ratlos und verunsichert gewesen. Die Unsicherheit des Ehemannes habe mit dem Auf und Ab bis zur Diagnosestellung begonnen und bis zum heutigen Tag nicht mehr aufgehört. Nur eines sei für sie sicher gewesen: dass sie ihr Leben aktiv beenden würde, bevor sie dazu nicht mehr selbständig in der Lage sei. Zu dem Zeitpunkt, als ich die Patientin kennen lernte, beschäftigte sie sich mit der Frage, ob sie eine Magensonde akzeptieren wolle, da sie sich bei der Nahrungsaufnahme vermehrt verschluckte und zudem kaum mehr Appetit hatte. Sie empfand es als entwürdigend, sich wie ein kleines Kind oder wie eine alte Frau füttern zu lassen. Ihre Beine konnte sie nicht mehr aktiv und ihre Arme nur noch eingeschränkt bewegen. Sie rauchte gern Zigaretten, diese fielen ihr jedoch immer häufiger aus der Hand. Sowohl ihre Mutter als auch ihr Ehemann hätten ihr versprochen, sie „in die Schweiz zu bringen“, wenn sie ihren Zustand nicht mehr ertragen könne. Beide bestätigten ohne Vorbehalt. Sie wusste allerdings nicht, wie dies geschehen solle. Von ärztlicher Seite konnte bestätigt werden, dass der Verlauf der Krankheit unaufhaltsam sei. Eine vorbestehende und nicht reaktive psychische Erkrankung wurde ausgeschlossen. Die Psychologin der Klinik attestierte die volle Einsichtsfähigkeit der Patientin. Sie sei leicht depressiv, was in diesem Stadium der Erkrankung aber nicht ungewöhnlich, sondern eher nachvollziehbar sei. In ihrer Entscheidungsfähigkeit sei sie nicht beeinträchtigt. 13 Mit der Patientin vereinbarte ich, dass sie keine überhasteten Entscheidungen treffen müsse. Die häusliche Versorgung nach ihrem Klinikaufenthalt konnte von dem Palliative Care Team zugesichert werden. Dies sollte unter anderem die Voraussetzung schaffen, die Patientin und ihre Angehörigen bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen und eventuelle, noch nicht in Betracht gezogene Möglichkeiten zu beleuchten. Sie ließ sich von mir versichern, dass ich sie in ihrer Autonomie absolut ernst nehmen würde. In den folgenden Gesprächen zeichnete sich ab, dass der Plan, in die Schweiz zu gehen, zwar bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Erkrankung gemacht aber nie konkretisiert wurde. Über den genauen Hergang der Sterbehilfe für deutsche Staatsbürger in der Schweiz wussten weder die Patientin noch die Angehörigen Näheres. Die Entwicklung der progredienten Erkrankung war bereits so weit fortgeschritten, dass die Sorge, bald nicht mehr in der Lage zu sein, selbständig ihr Leben zu beenden, berechtigt schien. Unabhängig davon besprachen wir verschiedene Hilfsmöglichkeiten, Veränderungen im häuslichen Umfeld und Möglichkeiten der Unterstützung durch Ehrenamtliche. Dem ungeachtet blieb die Patientin sehr klar bei ihrer Entscheidung. Eine Patientenverfügung lag vor. Eine Vorsorgevollmacht hatte sie auf ihren Ehemann ausgestellt. Unsere Sitzungen fanden über elf Wochen bei ihr zu Hause statt. Der Ehemann wie auch die Mutter, die sowohl beratend als auch haushaltstechnisch eine große Stütze für das Paar war, wurden immer häufiger zu den Sitzungen eingeladen. Dies war notwendig, damit möglichst alle Entscheidungen gemeinsam getragen werden konnten. 14 Bereits im Krankenhaus konnten wir zu einer ICH-DU-Haltung (siehe Kapitel 3.2) kommen, die einer Hinwendung zum anderen Menschen auf gleicher Ebene entspricht. Die Gestalttherapie sieht in dieser Haltung eine Voraussetzung dafür, dass die Patientin die Expertin ihrer eigenen Lebensgestaltung bleibt. Dies war für die Patientin äußerst wichtig, weil sie einerseits die Harmonie in ihrer Familie suchte und sich das Verständnis ihres Ehemannes und ihrer Mutter wünschte, gleichzeitig aber großen Wert auf ihre Autonomie legte, die zusehends abnahm. Diese Abnahme der Autonomie war der Hauptgrund dafür, ihr Leben beenden zu wollen. Wenn sie die Maßnahme der Lebensbeendigung nicht mehr selbst vollziehen konnte, würde sie in eine Abhängigkeit geraten. Zusätzlich lag mein Auftrag in der Beratung zur Patientenverfügung für die Umsetzung der Wünsche der Patientin. Aus der Idee, „in die Schweiz zu fahren“, wuchs eine Bereitschaft, selbst aktiv zu werden. In die bereits vorhandene Patientenverfügung wurde nachgetragen, dass im Falle eines Suizids der Patientin nicht gegen ihren Willen zum Weiterleben verholfen werden dürfe. Somit blieb die Möglichkeit bestehen, das Palliative Care Team zu Hilfe zu rufen, wenn das Sterben diese Unterstützung notwendig machen würde. Dies war wichtig für die Patientin wie auch für die Angehörigen. Gemessen an den Beschreibungen der präsuizidalen Phasen nach Pöldinger (siehe Kapitel 3.3) befand sich die Patientin während der überwiegenden Zeit unserer therapeutischen Arbeit in der Entschlussphase. Ihre Entscheidung, ihr Leben zu beenden, hat sie in den Sitzungen nie in Frage gestellt. Alles, was sie sich erarbeitete, diente dazu, noch unerledigte Dinge abzuschließen. Die Gestalttherapie beschreibt Abschnitte der Ausweglosigkeit einer suizidalen Person (siehe Kapitel 3.3). Innerhalb derer pendelte die Patientin. Psychotherapeutisch boten sich viele Ansatzpunkte, mit der Patientin zu arbeiten. Ihr fester Entschluss, ihr Leben zu beenden solange sie selbst dazu in der Lage war, drängte sich jedoch immer wieder in den Vordergrund. Die Therapie fand in dem Spannungsfeld statt, dass einerseits vorbestehende 15 Schwierigkeiten im Leben der Patientin zum positiven gewendet werden konnten, andererseits das größte Problem, nämlich die Erkrankung, nicht gelöst werden konnte. Durch die Begegnung auf gleicher Augenhöhe entstand eine Basis, auf der viele Fragen, Ängste, Verletzungen, Kränkungen und Wut reflektiert werden konnten. Diese waren sowohl bei der Patientin als auch den Angehörigen, die sie aus dem Leben gehen lassen sollten, vorhanden. Bei der Patientin waren deutliche Aggressionshemmungen zu spüren. Sie sprach darüber, dass sie sich dem Fortschreiten ihrer Erkrankung machtlos ausgeliefert und von ihren Freunden, die sich in den letzten Jahren von ihr abkehrten, verlassen fühle. Zudem müsse sie sich von den Eltern zunehmend wie ein kleines Kind versorgen lassen. Ihre Gefühle konnte sie aber mit den Geschehnissen und den beteiligten Personen nicht in Verbindung bringen und redete darüber mit einer nicht nachvollziehbaren Gleichgültigkeit. Es schien als stünde eine unüberwindliche Barriere vor ihr. Sie richtete ihre Aggression gegen sich selbst indem sie eine stoische Ruhe ausstrahlte, die Erkrankung als gottgegeben hin nahm und sich gleichzeitig jeglichen Ärger auf Gott verbot. Es schien, als sei dies ihre vermeintliche Umgangsstrategie. Der Zugang zu ihrer Umwelt war von einer großen Ambivalenz geprägt. Ihrer Mutter fühlte sie sich einerseits zu Dank verpflichtet, andererseits war sie ihrer überdrüssig. Sie stieß sie oft weinend zurück, um gleich darauf in kindlicher Regression die körperliche Nähe zu suchen. Den Hass auf die eigene Unzulänglichkeit zeigte sie nur selten offen. Ihre Freunde schonte sie, indem sie sich selbst Glauben machte, dass sie in ihrem Zustand für die anderen Menschen nicht zumutbar sei. Nach außen repräsentierte sie ein stilles Leiden und vermittelte, dass alle Schuld auf ihren Schultern läge. Auch Neid zu formulieren, gestand sie sich nicht zu. Ebenso wenig stellte sie die in der Palliative Care oft gehörte Frage: „Warum ich?“. Wenn man sie auf ihr häufiges Weinen ansprach, konnte sie keinen Grund dafür finden. Sie wollte nur, dass es aufhört. 16 Die Basis meiner psychotherapeutischen Arbeit waren Awareness (siehe Kapitel 3.2) und die Paradoxie der Veränderung (siehe Kapitel 3.2). Durch das uneingeschränkte Annehmen ihrer Person konnte sie die Erfahrung machen, dass sie so sein durfte, wie sie ist. Verhaltensweisen und Gesten, wie der traurige Gesichtsausdruck und ihre herunter hängenden Schultern beim Erzählen von unerfüllten Wünschen, die sie in den Sitzungen zeigte, forderte ich sie auf zu wiederholen und zu verstärken. Dies wirkte erlebnisaktivierend, wodurch sie sich ihren Gefühlen nähern konnte. Ihrem Ärger über ihre Erkrankung gab ich Raum, indem ich diesen für sie stellvertretend ausdrückte. Ich gab ihr beispielhaft Möglichkeiten, ihre Gefühle zuzulassen und sie auszudrücken. Ihr Verhalten spiegelte ich, indem ich ihr sagte, dass ich bei der Schilderung der liebevollen Fürsorge durch ihren Ehemann und ihre Mutter ihren ärgerlichen Gesichtsausdruck sehe und sie gleichzeitig sagen höre, dass sie glücklich sei, von ihren Eltern umsorgt zu werden. Ich fragte, wie sie es schaffe, Ärger und Glück gleichzeitig zu empfinden. Um mögliche Introjekte (siehe Kapitel 3.2) in ihr anzusprechen, fragte ich sie, ob sie dieses Verhalten von früher kenne und ob ihr andere Situationen dazu einfallen. Die Patientin hatte Schuldgefühle gegenüber ihrer Mutter und sah bei sich die Pflicht, Dank zu zeigen und ihre Enttäuschung über ihr Leben vor der Mutter zu verbergen. Dies stellt eine zurück gehaltene Aggression beziehungsweise Aggressionshemmung (siehe Kapitel 3.2) dar. Der Patientin fielen weitere Beispiele im Zusammenhang mit der elterlichen Ehescheidung in ihrer frühen Kindheit ein. Sie glaubte damals, ihre Mutter schonen und trösten zu müssen. Es waren Situationen wie heute, da sie ihre Mutter stabilisieren musste, obwohl sie selbst sehr hilflos war. Ihre eigene Verzweiflung verbot sie sich. In extremen Belastungssituationen zog sie sich in die Retroflexion (siehe Kapitel 3.2) zurück und riss sich die Haut um ihre Fingernägel ab bis die Finger bluteten. In unseren Sitzungen konnte sie Angebote nutzen, um auszuprobieren, was passieren würde, wenn sie nicht mehr die liebe Tochter ist. Auf der Kontaktkurve (siehe Kapitel 3.2) erlebte die Patientin wiederholt eine Kontaktunterbrechung durch Retroflexion. Die offene Gestalt, ihre Wünsche nach eigener Anerkennung, drängte danach geschlossen zu werden. 17 Parallel dazu stand dauerhaft der gefasste Entschluss, ihr Leben zu beenden. Die Patientin erarbeitete in unseren Sitzungen Strategien und leichtere Umgangsformen mit schwierigen Situationen. Einige bisher diffuse und unausgesprochene Differenzen mit ihrer Mutter konnten Gestalt annehmen. Im Nachhinein half ihr dies dabei, sich gefestigter aus dem Leben zu verabschieden. Die Patientin suizidierte sich mit einer Überdosis an Schlafmitteln. Als Mitarbeiterin des ambulanten Palliative Care Teams erfuhr ich drei Tage nach unserer letzten Zusammenkunft von ihrem Tod. 3 Gestalttherapie und Suizid 3.1 Der Ursprung der Gestalttherapie Begründer und Begründerin der Gestalttherapie sind Fritz Perls (geboren 1893 als Friedrich Salomon Perls in Berlin; gestorben 1970 in Chicago), Laura Perls (geboren 1905 als Lore Posner in Pforzheim; gestorben 1990 ebenda) und Paul Goodman (geboren 1911 in New York; gestorben 1972 ebenda) (vgl. Blankertz und Doubrawa 2005, 201; 212; 130 und 134). Die ersten Ansätze der Gestalttherapie wurden in den 1930er und 1940er Jahren, während des Nationalsozialismus von Lore und Fritz Perls im südafrikanischen Exil entwickelt. Beide hatten ihren beruflichen Ursprung in der Psychoanalyse, von der sie sich durch Reformierung der Freudschen Therapievorstellungen distanzieren wollten (vgl. Doubrawa 2003, 13f). Fritz und Laura Perls „[…] haben den ‚sicheren‘ Platz der Psychoanalytiker hinter der Couch aufgegeben und sich vor den Klienten gesetzt“ (Doubrawa 2003, 14). Ende der 1940er Jahre siedelten sie nach New York um, wo sie dem Schriftsteller und späteren Gestalttherapeuten Paul Goodman begegneten (vgl. Doubrawa 2003, 14). 18 Doubrawa beschreibt die Zeit Ende der 1960er Jahre, in der die Gestalttherapie bekannt wurde, als eine Zeit der psychologischen, spirituellen und politischen Aufbruchbewegung, des „Human Potential Movement“ in Kalifornien. Hier entstand unter anderem die Idee, dass in den Menschen noch nicht genutztes Entwicklungspotential stecke, welches ihnen zu mehr Lebensqualität, Ausgeglichenheit und Kreativität verhelfen sollte (vgl. ebd.). Die Autonomie jedes einzelnen Menschen wurde in den Vordergrund gerückt, entsprechend zur Ära der 68er Bewegung für Selbstbestimmung und Befreiung. Die Gestalttherapie versteht sich als erlebnisaktivierende Psychotherapie, die vordergründig hermeneutisch und phänomenologisch vorgeht. Sie ist ein Psychotherapieverfahren aus der humanistischen Psychologie. Der Begriff Hermeneutik kommt aus dem Griechischen und bedeutet ursprünglich Kunst der Auslegung. Später erlangt der Begriff eine philosophische und historische Deutung, die Lehre des Verstehens und Auslegens (vgl. Dorsch 2009, 422). Der Begriff Phaenomenon stammt aus dem Lateinischen und bedeutet die Lehre von den Erscheinungen (vgl. Dorsch 2009, 747). Die Phänomenologie bezieht sich immer auf die Wahrnehmung der betreffenden Person. Das, was ein Mensch wahrnimmt, ist auch dann wahr, wenn es nicht mit einem tatsächlichen Vorkommnis übereinstimmt. „Wahr ist, was wir wahr „nehmen“ (Blankertz und Doubrawa 2003, 221). Das phänomenologische Vorgehen findet in der Gestalttherapie Anwendung, indem bearbeitet wird, wie etwas erlebt wurde und nicht was erlebt wurde. Laura und Fritz Perls, die beide ehemals psychoanalytisch tätig waren, entwickelten die Gestalttherapie nachdem sie ihre eigenen Erkenntnisse aus der Gestaltpsychologie nicht mehr mit denen der Psychoanalyse in Verbindung bringen konnten beziehungsweise wollten. 19 Fritz Perls beschäftigte sich mit der Unterdrückung von Lebensenergie, die er Aggression nannte. Er sah das Leben immer in Verbindung mit aktiver Umgestaltung und Veränderung. Den dafür notwendigen aktiven Einsatz von Lebensenergie nannte er Aggression (siehe Kapitel 3.2) (vgl. Blankertz und Douberawa, 119). Die Gestalttherapie hat ihre eigenen Grundannahmen, durch die sie sich klar von anderen psychotherapeutischen Vorgehensweisen abgrenzt. Sie ist aber auch ein tiefenpsychologisch begründetes Verfahren, deren Begründer und Begründerin ihren Ursprung in der Psychoanalyse haben, weshalb sich ebenso Analogien zu dieser erkennen lassen. „Psychoanalyse und Gestalt erweisen sich als Therapiesysteme, die die Ganzheit des Menschen im Blick zu behalten und Störungen sinnhaft zu verstehen versuchen. […] Im Zentrum der therapeutischen Arbeit stehen […] der Glaube daran, dass vielfältige Erfahrungen in uns gespeichert und reaktualisierbar sind, und die Vorstellung eines differenzierten psychischen Geschehens, das vielfältige Symbolisierungs- und Ausdrucksmöglichkeiten enthält […]“ (Baulig 2001, 250). Eine präzise Differenzierung beziehungsweise Abgrenzung zur Psychoanalyse ist nicht immer scharf durchzuführen. So schreibt Bocian (2000, 14), „[…] daß [sic] scheinbar gestalttypische Begriffe und Konzepte, wie Ganzheit, Hier-und-Jetzt, Wachstum, Kontakt und Awareness sich schon bei den analytischen Freigeistern finden lassen.“ Zudem entstand die Gestalttherapie chronologisch nach der Psychoanalyse. Man könnte sagen, dass die Gestalttherapie von der Psychoanalyse abstammt beziehungsweise aus ihr erwachsen ist. Gleichwohl will sie sich klar und eigenständig positionieren. „Zwar besteht ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen Psychonanalyse und Gestalttherapie. Doch das Kind hat laufen gelernt“ (Baulig 2001, 259). Die Gestalttherapie befasst sich mit nicht angemessenem Verhalten, welches sich darin zeigt, dass eine Person nicht das erreicht, was sie erreichen will beziehungsweise dass sie mit dem 20 Erreichten nicht zufrieden ist. Dies deutet auf einen gestörten Kontakt mit der Umwelt hin (vgl. Blankertz und Doubeawa, 119). Eine grobe Einteilung von psychotherapeutischen Verfahren könnte in folgender Unterscheidung gelingen: Eine ätiologische Herangehensweise ist in der Psychoanalyse nach Sigmund Freud zu finden, die sich vordergründig mit der Ursache und Entstehung von Krankheiten beschäftigt. Die lerntheoretische Herangehensweise in der Verhaltenstherapie nach John Broadus Watson stützt sich auf die Kognition der zu behandelnden Person. Als hermeneutisch, phänomenologische Vorgehensweise, die erlebnisaktivierend eingesetzt wird, sieht sich die Gestalttherapie nach Fritz und Laura Perls. Freuds eigene Definition ist in Dorschs Psychologischem Wörterbuch (2009, 788) wie folgt nachzulesen: „Psychoanalyse ist der Name (1) eines Verfahrens zur Untersuchung seelischer Vorgänge, welche sonst kaum zugänglich sind; (2) einer Behandlungsmethode neurotischer Störungen, die sich auf diese Untersuchung gründet; (3) einer Reihe von psychologischen auf solchen Wegen gewonnenen Einsichten, die allmählich zu einer neuen wissenschaftlichen Disziplin zusammenwachsen.“ Weiter heißt es in Dorsch (2009, 788), dass Siegmund Freud und Josef Breuer Ende des 19. Jahrhunderts das Verfahren der ‚Seelenzergliederung‘ zum Heilen seelischer Krankheiten entwickelt haben. Die Verhaltenstherapie vertrat nach Jaeggi (1997, 99) eine der Hauptrichtungen der Psychotherapie und ist in den 1960er Jahren entstanden. Sie gründete auf die von dem Psychologen Hans Jürgen Eysenck formulierte These, dass das Symptom selbst die Neurose sei. Damit wollte man sich von bisherigen tiefenpsychologischen Spekulationen über das was unter und hinter den Symptomen stecken könnte distanzieren. Man beschäftigte sich ausschließlich mit dem gestörten Verhalten, welches als falsch gelerntes Verhalten angesehen wurde. Auch die 21 Verhaltenstherapie entwickelt sich als Reaktion auf die Psychoanalyse (vgl. Dorsch 2009, 1066). 3.2 Grundannahmen und Methoden der Gestalttherapie Ein bedeutender Lehrsatz der Gestalttherapie ist die paradoxe Theorie der Veränderung nach Arnold Beisser. Der Gestalttherapeut war als junger Mann an Poiliomyelitis erkrankt und nahezu vollständig gelähmt. An seiner Geschichte, die erzählt wie er mit der radikalen Veränderung durch die Erkrankung in seinem eigenen Leben zurecht kam, zeigt er beispielhaft wie Veränderung auf dem Boden der Akzeptanz der aktuellen Situation gelingen kann. „Veränderung geschieht, wenn jemand wird, was er ist, nicht wenn er versucht zu werden, was er nicht ist. […] Der Gestalttherapeut verweigert die Rolle des ‚Veränderers‘, weil seine Strategie darin besteht, den Klienten zu ermutigen, ja sogar darauf zu bestehen, daß [sic] er sein möge, wie und was er ist. […] Vielmehr entsteht Veränderung, wenn der Klient – zumindest für einen Moment – aufgibt, anders werden zu wollen, und stattdessen versucht zu sein, was er ist. Dies beruht auf der Prämisse, daß [sic] man festen Boden unter den Füßen braucht, um einen Schritt vorwärts zu machen, und daß [sic] es schwierig oder gar unmöglich ist, sich ohne diesen Boden fortzubewegen.“ (Beisser 2005, 139) Beisser greift in seiner Geschichte und der darin entwickelten paradoxen Theorie der Veränderung beständige, unbewusste Vorgänge in Menschen auf, die nach der Erfüllung ihrer Anliegen, die in der Zukunft liegen, streben. Die Annahme dessen, was jetzt ist, ist der Boden auf dem Veränderung geschehen kann. Sie muss der erste Schritt sein, um dann im zweiten Schritt das Vorhandene zu verändern oder anzupassen. 22 Bezogen auf die Patientin mit ALS aus dem Praxisbeispiel würde Beisser deren Entschluss, ihr Leben zu beenden, als Streben nach etwas, dass in der Zukunft liegt, betrachten. Eine Veränderung ihrer Situation kann demnach erst dann geschehen, wenn die Patientin bereit ist, ihre jetzige Situation anzunehmen. Eine der entscheidenden Grundannahmen der Gestalttherapie ist die Gestaltbildung im Figur-Grund-Prozess. Danach kann sich eine Figur klar vor einem blassen Hintergrund herausheben, sie kann diffus sein oder es können mehrere Figuren um die Aufmerksamkeit konkurrieren. Die Differenzierung in Figur und Grund bedeutet zwischen dem zu unterscheiden, was ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt und dem, was indifferent, eventuell unbewusst, im Hintergrund bleibt. Der Begriff Gestalt wird international verwendet und in der Gestaltpsychologie mit Ganzheit gleichgesetzt. Die Gestalt ist eine Vordergrunderscheinung, die sich vom übrigen Hintergrund abgrenzt (vgl. Hartmann-Kottek 2008, 8). Auch wird eine beirrende oder widersprüchliche Verhaltensweise oder eine mit Beharrlichkeit durchgesetzte Überzeugung, die aus ihrem Kontext heraus sticht als Gestalt begriffen. Sie tritt nach dem Figur-Grund-Prinzip nach vorn. Sie löst sich aus dem Kontext heraus und wird zu einer konkreten Figur, das heißt eine Gestalt wird prägnant. Suizidgedanken, die sich als offene Gestalten immer wieder in den Vordergrund schieben und sich folglich als Figur vom Grund abheben, drängen danach geschlossen zu werden. Versucht die betreffende Person jene Gedanken in den Hintergrund zu schieben oder zu verdrängen, werden sie sich wiederholt als Figur in den Vordergrund drängen. Die Prägnanztendenz besagt, dass Menschen eine Neigung dazu haben, Gestalten zu schließen. Mit dem Wort Prägnanztendenz meint die Gestaltpsychologie, dass die menschliche Wahrnehmung zur Vervollständigung neigt. So fügt sich eine nur durch Punkte abgebildete Figur in unserer Wahrnehmung beispielsweise zu einer Linie oder zu einem Kreis zusammen und schließt sich auf diese Weise (vgl. Leitmeier 2010, 145f). 23 Für die Gestalttherapie ist es unumgänglich, den Menschen, die in die Therapie kommen, auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. Diese Art der Begegnung heißt in der Gestalttherapie Ich-Du-Haltung und wird von Dreitzel (2004, 24) folgendermaßen beschrieben: „Die Konzentration auf die direkte Interaktion von Therapeut und Klient in einer Ich-Du-Beziehung, also einer Beziehung, in der der Patient nicht nur als ‚Symptomträger‘ wahrgenommen wird und in der der Therapeut sich in selektiver Authentizität selbst mit einbringt.“ Die Ich-Du-Haltung ist eine absolut bedeutsame Grundhaltung in der Gestalttherapie. Gestalttherapeutisch Tätige würden es als unangemessen empfinden, ein weißes Blatt bleiben zu wollen. Das würde übersetzt bedeuten aus dem Kontakt zu gehen (siehe Kapitel 3.2, Kontaktkurve). Im Kontakt erhält die Klientin und der Klient die Möglichkeit, die eigenen Anteile in Augenschein zu nehmen, zu überprüfen und möglicherweise sogar zu verändern beziehungsweise an die aktuelle Lebenssituation anzupassen. Auf einer horizontalen Ich-Du-Ebene begegnen sich Therapeutin und Therapeut und Klientin und Klient, um etwas über sich zu lernen. „In der vertikalen Beziehung bleibt das Ich des Therapeuten privat und versteckt und fördert […] Abhängigkeit und Übertragung“ (Simkin 2000, 84f). Im prozessualen gestalttherapeutischen Geschehen dient die aktuelle Situation als Medium für den Kontakt. Die Gestalttherapie geht davon aus, dass der Kontakt in einer ebenbürtigen Begegnung Blockaden aktualisiert und somit zu einer Figur werden lässt. Diese gelangen in das Gewahrsein der Klientin und des Klienten und können dann bearbeitet werden. Die gestalttherapeutische Ich-Du-Haltung geht auf das Werk „Ich und Du“ des österreichisch-israelischen, jüdischen Religionsphilosophen des 20sten Jahrhunderts Martin Buber zurück. Heute kennzeichnet das Ich-Du in der Gestalttherapie eine menschliche Haltung, in der sich Klientin und Klient und Therapeutin und Therapeut gleichwertig begegnen (vgl. Blankertz und Doubrawa 2005, 41). 24 Die Gestalttherapie hat sich durch Fritz Perls abweichend zum Umgang mit Aggression und Aggressionshemmung positioniert. Im Psychologischen Wörterbuch (Dorsch 2009, 15) ist die Aggression eine Verhaltensweise, die mit der Absicht ausgeführt wird, ein Individuum direkt oder indirekt zu schädigen. Perls hat den Inhalt des Aggressionsbegriffs umgedeutet, wodurch ein Unterschied zur Umgangssprache entstanden ist. Nach Blankertz und Doubrawa (2005, 11) besteht in der Gestalttherapie das Wesen der Aggression darin, dass sie nicht nach zweckloser Entladung sucht, sondern danach, zielgerichtet eingesetzt zu werden. Erst ihre Unterdrückung führt zu Destruktivität. „Aggression wird als natürliche Lebensäußerung verstanden, als Zugehen auf die Welt und als Zugreifen und gegebenenfalls auch Zerstören (wie beispielsweise beim Kauen von Nahrung)“ (Gremmler-Fuhr 2001, 371). Hat die betreffende Person die Erwartung, dass ihre Aggressivität negative Zuwendung zur Folge haben würde, wird sie möglicherweise ihre Aggression zurückhalten oder gegen ihr eigenes Selbst zurückwenden. Ersteres wäre im gestalttherapeutischen Sinn die Auswirkung einer Introjektion, zweiteres beschreibt eine Retroflexion. Ein Zurückhalten oder das Zurückwenden von Aggressivität gegen den eigenen Organismus kann sich in Form von Grübeln oder einer Denkhemmung wie auch in der übertriebenen Fürsorge um sich selbst beziehungsweise übertriebenen Eigenbefriedigung aber auch Selbstquälerei oder Selbstschädigung äußern (vgl. Gremmler-Fuhr 2001, 371). Die Bildung der Grenze zwischen Organismus und Umweltfeld während eines Kontaktprozesses kann sich auf unterschiedliche Arten vollziehen, die in der Gestalttherapie mit Kontaktfunktionen beschrieben werden. Eine Kontaktfunktion hebt sich in ihrer Bedeutung von der Kontaktunterbrechung oder der Kontaktstörung ab. Die Funktion ist eine neutrale Bezeichnung, während eine Unterbrechung oder Störung darauf hinweisen, dass es auch einen richtigen beziehungsweise normalen Kontakt geben müsste. Würde eine Gestalttherapeutin oder ein Gestalttherapeut 25 feststellen, dass die Klientin oder der Klient den Kontakt unterbricht, läge die Vermutung nahe, dass die betreffende Person sich in einem anderen Kontaktvorgang befindet als dem, den die Therapeutin oder der Therapeut gerade fokussiert. Die vermeintlich kontaktunterbrechende Person, die Klientin oder der Klient, wäre dann immer noch in Kontakt mit ihrem bisherigen Thema (vgl. Gremmler-Fuhr 2001, 366). Einige der klassischen Kontaktfunktionen der Gestalttherapie, die in der therapeutischen Arbeit mit Menschen mit Suizidgedanken häufiger vorkommen, sind die Introjektion, Projektion und Retroflexion. Sie werden im Folgenden am Beispiel von Suizidgedanken beschrieben. Introjektion ist die ungeprüfte Aufnahme oder Verarbeitung von Fremdem. Der Gegenpol ist das Ablehnen von allem, was spontan als fremd erlebt wird. Dies drückt sich wiederum in berechtigtem oder unberechtigtem Misstrauen gegenüber Fremdem aus (vgl. Gremmler-Fuhr 2001, 369). Ein Mensch mit Suizidgedanken hat möglicherweise das Introjekt, das man sich nicht suizidieren darf. Er setzt damit voraus, dass kein anderer Mensch seine Ideen und Fantasien verstehen könnte. Möglicherweise verbietet er sich die Gedanken daran, die sich ihm jedoch immer wieder aufdrängen. Die Projektion ist durch die Verlagerung der eigenen Grenze nach innen gekennzeichnet, wodurch dem Organismus zugehörige Elemente ausgegrenzt und als der Umwelt zugehörig erlebt und somit auf diese projiziert werden. Durch die Verschiebung der Grenze weit in den Organismus hinein wird dieser als stark reduziert gegenüber der Umwelt erlebt. Bei der Projektion wird das, was im Organismus im Verlauf des Kontaktprozesses entsteht, für etwas gehalten, das real außerhalb des Organismus existiert (vgl. Gremmler-Fuhr 2001, 370). Eine Projektion dient gegebenenfalls als Erklärungsversuch, das Unfassbare fassbar zu machen. Der Mensch, der einen Ausweg aus der Krise darin sieht, sein Leben zu beenden, projiziert in die ihn betreuenden Menschen, dass sie sich wünschten, er wäre nicht mehr da, damit er ihnen nicht mehr zur Last fallen würde. Weil Suizid für den betroffenen Menschen ein Tabu ist, gesteht er sich den Gedanken nicht ein und spielt ihn den anderen zu. 26 Die Retroflexion ist gekennzeichnet durch deutliche Abgrenzung und Widerstand nach außen. Impulse und beabsichtigte Aktivitäten, die auf die Umwelt gerichtet sind und darauf abzielen, die Grenzen zur Umwelt zu überschreiten, werden zurück gehalten und stattdessen auf den eigenen Organismus gerichtet. Der Gegenpol ist das ungehemmte und unkontrollierte Ausleben der Impulse, was je nach situativer Gegebenheit konstruktiv oder destruktiv sein kann (vgl. Gremmler-Fuhr 2001, 370f). Eine Retroflexion könnte offenbar werden, wenn eine auf Unterstützung angewiesene Person angebotene Hilfe zurückweist, obwohl für sie dadurch Nachteile entstehen. Ursprünglicher Ärger über wahrgenommene Ungerechtigkeit und Eifersucht gegenüber den Helfenden werden nicht an der Grenze zur anderen Person ausgetragen, sondern zurückgewendet gegen das eigene Selbst. Ein Motiv hierfür könnte wiederum ein Introjekt aus der Vergangenheit sein. Auf dem Weg vom Erkennen eines Bedürfnisses bis zu dessen Befriedigung ist Awareness, was wache Bewusstheit bedeutet, notwendig, um zwischen dem eigenen Organismus und der Umwelt zu unterscheiden, damit Raum für Kontakt, Erfahrung und Entwicklung entstehen kann. Diese wache Bewusstheit findet auf zwei Ebenen statt. Auf der Ebene der äußeren Bewusstheit besteht der Kontakt zur Situation, zu dem, was außerhalb des eigenen Organismus geschieht. Auf der Ebene der inneren Bewusstheit besteht Kontakt zu dem, was im eigenen Organismus vorgeht. Dieser Prozess kann nur im Hier und Jetzt stattfinden. In der Vermeidung mit dem direkten Kontakt weicht ein Individuum auf so genannte Zwischenzonen aus. Diese können aus Fantasien, Befürchtungen, Gedanken und Wunschträumen bestehen und befinden sich außerhalb des Hier und Jetzt. In den Zwischenzonen verliert sich der Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen. Diese treten erst wieder in der wachen Bewusstheit, der Awareness, in den Vordergrund. Ist ein Kontakt blockiert, interessiert vordergründig wie er blockiert ist und nicht warum. Wird Awareness, die wache Bewusstheit im Hier und Jetzt, zugelassen, kann ein Bedürfnis spürbar werden, sich vom Grund abheben und zur Figur werden. Wahrzunehmen was da ist, statt daran zu denken was sein könnte, bedeutet zuzulassen was gegenwärtig ist (Vollkontakt). Die Phase der Assimilation 27 entspricht der Integration des vom Organismus Aufgenommenen beziehungsweise der Verdauung. Das bedeutet anzunehmen was gut ist und auszuscheiden was schlecht ist. Eine neue Gestalt kann prägnant werden, d.h. sie tritt als Figur in den Vordergrund (Figur-Grund-Prinzip). Der Kontaktzyklus kann von neuem beginnen (vgl. Dinslage 1995, 28f). Am Beispiel einer Person mit Suizidgedanken, die sich immer wieder als Möglichkeit einer Problemlösung aufdrängen, werden diese aus Sorge vor Unverständnis nie einer anderen Person mitgeteilt und besprochen. Die quälenden aber vielleicht auch Hoffnung versprechenden Suizidgedanken fordern die Reflexion mit einem Gegenüber. Das könnte möglicherweise dazu führen, eine Entscheidung gegen oder für eine Suizidhandlung zu treffen. In diesem Fall bliebe die betreffende Person vor der Ebene der Kontaktnahme stecken. Der Prozess des Kontaktzyklus wäre blockiert. Diese offene Gestalt drängt nach Schließung und schiebt sich somit unaufhörlich in den Vordergrund. Das Leiden dieser Person wird nachvollziehbar und verlangt nach dem Ansprechen der Thematik Suizidalität. Womöglich besteht ein spürbares Bestreben der Familie oder des Behandlungsteams das Thema Suizidalität nicht anzusprechen, aus Angst, die betroffene Person dadurch vielleicht erst auf diese Idee zu bringen. Mit diesem Auftrag der anderen könnte die Person mit Suizidgedanken in die Kontaktnahme gehen. Sie würde dann ihre eigene Bedürfnisbefriedigung dem Bedürfnis der anderen hintanstellen. Suizidgedanken. Der Es herrschte Kontaktvollzug Stillschweigen im Sinne über der ihre eigenen Bedürfnisbefriedigung müsste scheitern. Die eigentliche Gestalt, hier das Aussprechen von Suizidgedanken, bleibt offen und verlangt nach Schließung, indem sie sich erneut vom Grund abhebt. 28 Der Kontaktprozess veranschaulicht an der Kontaktkurve: Kontaktvollzug Kontaktnahme Vorkontakt Assimilation Nachkontakt Im Vorkontakt hebt sich eine Figur, hier beispielhaft Suizidgedanken, gegenüber einem Hintergrund allmählich hervor. Ins Bewusstsein tritt zunächst die diffuse Existenz eines Bedürfnisses. In der Phase der Kontaktnahme klärt sich die Frage nach der Art des Verlangens, beispielsweise sich einer Person anzuvertrauen, und die Umgebung wird auf Befriedigungsmöglichkeiten hin geprüft. Im Vollkontakt, zu dem es im vorangegangenen Beispiel nicht kommt, da die betreffende Person ihrem Introjekt folgt, welches „Darüber spricht man nicht.“ heißen könnte, kommt es zum Austausch zwischen dem eigenen Organismus und der Umwelt. Die Phase der Assimilation entspricht der Integration des vom Organismus Aufgenommenen beziehungsweise der Verdauung dessen. Wäre es im Beispiel dazu gekommen, könnte das die Aussprache von quälenden Gedanken sein. Im Nachkontakt wird die Figur, das nun erfüllte Bedürfnis, wieder los gelassen. Die Person aus dem Beispiel könnte nach dem Gespräch zum Beispiel Erleichterung oder Unverständnis der anderen spüren. Der 29 Nachkontakt ist der Wechsel vom Kontakterlebnis zur Rückbesinnung des Organismus auf sich selbst. „Werden Kontaktaufnahme oder Kontaktvollzug wie in dem Beispiel vermieden, entsteht eine unvollendete Gestalt, die nach einer Schließung drängt“ (Hutterer-Krisch 2001, 757). Diese offenen Gestalten in Form von unerwünschten Gefühlen, vermiedenen äußeren Konflikten oder peinlichen Wünschen lassen sich nicht auf Dauer verdrängen, sondern schieben sich immer wieder in den Vordergrund (vgl. Hutterer-Krisch 2001, 757). 3.3 Die Sicht der Gestalttherapie auf den suizidalen Menschen Das innere Befinden einer suizidalen Person wird laut Schneider (1990, 218) vordergründig von zwei Fragen gelenkt. „Werde ich ernst genommen?“ und „Werde ich angenommen?“ Die Anzeichen, die einer Suizidabsicht nahezu immer vorausgehen, wurden von dem österreichischen Psychiater Walter Pöldinger wie auch von der Gestalttherapeutin Kristine Schneider ähnlich beschrieben. Die suizidale Person leidet nach Pöldinger unter einer starken Einengung. Die sogenannte Präsuizidalität hat er in drei Phasen unterteilt. - Erwägungsphase: Suizid wird als Problemlösung in Betracht gezogen. Die Distanzierungsfähigkeit ist erhalten. - Ambivalenzphase: Es findet ein innerer Kampf zwischen Ablehnung und Befürwortung des Suizids statt. 30 In dieser Phase werden häufig Andeutungen, Drohungen, Appelle ausgesprochen. - Entschlussphase: Die Distanzierungsfähigkeit ist aufgehoben. Die Suizidvorbereitung findet statt. Eine innere Ruhe, die sogenannte „Ruhe vor dem Sturm“, tritt ein. (vgl. Meise und Sulzenbacher 2006) Das präsuizidale Syndrom „[…] besteht aus Einengung, Aggressionsumkehr und Suizidphantasien, die zwar nicht zwingend zum Suizid führen, aber nahezu jeder Suizidhandlung vorausgehen“ (Plein 2003, 5). Schneider (1990, 218f) beschreibt die Ausweglosigkeit, mit der sich eine suizidale Person konfrontiert sieht, aus gestalttherapeutischer Sicht folgendermaßen: - Erlebte Ohnmacht, ohne Gestaltungskraft. - Einengung durch Verluste und Schicksalsschläge, diese könnten in der Depression inszeniert sein. Das Selbstwertgefühl ist zerstört. Die Person ist vereinsamt. Beziehungen werden als wertlos angesehen. - Die Person befindet sich im Zustand implodierter Aggression, angefüllt mit schwelender, unausgedrückter Wut. - Flucht in eine Fantasiewelt visionärer Leidensfreiheit im Tod und Verselbständigung und Verfestigung der Isolation von der Lebenswelt. „Einen ausweglosen Menschen kann man nur und ausschließlich bei seiner Ausweglosigkeit erreichen, sonst zunächst nirgends. Trost für einen 31 Trostlosen ist Spott“ (Hutterer-Krisch 2001, 839: zit. nach Dörner, Plog 1990, 333). 3.4 Suizidabsicht und Krise „Krise [gr. krisis: Entscheidung, Sichtung] ist der entscheidende Punkt oder auch Abschnitt im Verlauf einer Krankheit, i. w. S. jede Auseinandersetzung“ (Dorsch Psychologisches Wörterbuch 2009, 553). Das Außerordentliche an einer suizidalen Krise ist, dass es für die Betroffenen keine Vorbereitung darauf gibt. Wolfersdorf und Etzersdorfer (2011, 80) beschreiben die Krise als einen Zustand, wie er von Betroffenen nach einer unverhofft gestellten Diagnose häufig erlebt wird. Sie sei eine Situation der eine überraschende, belastende Erfahrung oder ein lebensveränderndes, nicht zu bewältigendes Ereignis zugrunde liegt. „Krisen können in Situationen entstehen, bei denen die Versorgung von außen ausfällt, die Fähigkeit zur Selbstversorgung aber noch nicht entwickelt ist“ (Schigutt, Schigutt zit. in Hutterer-Krisch 2001, 840). Perls zieht einen Vergleich zwischen einem Baby, dass nach Durchtrennung der Nabelschnur die Eigenversorgung mit Sauerstoff plötzlich selbst durchführen muss. Dies kann akut als eine lebensbedrohliche Krise empfunden werden. Sobald die Atmung möglich ist und sich die Fähigkeit dazu etabliert hat ist sie überwunden (vgl. Schigutt, Schigutt in Hutterer-Krisch 2001, 840). „Bei einer Krise handelt es sich um eine Situation, in der ein suizidaler Mensch eine Lebensveränderung nicht adäquat bewältigen kann“ (Ahrens und Freyberger 2002, 426). So fragt Spiegel-Rösing (1992, 146): „[…] kann […] das Wissen um mein Sterben nicht viele der mir vorher zur Verfügung stehenden Bewältigungsmöglichkeiten überfordern oder angesichts der physischen Realität der Krankheit (Schwäche, Verstümmelung, Funktionsverlust) entmachten?“ Eine Krise ist immer ein Zustand, der so niemals vorher erlebt oder dessen Umgang präventiv eingeübt werden konnte. Sie ist der Wendepunkt einer 32 Entwicklung und ein Ort der Entscheidung. Sie beinhaltet also auch die Möglichkeit eines Neuanfangs. Um im Kontakt mit einer Person mit Suizidabsicht zu bleiben, ist es notwendig, diesem Menschen im Gestaltsinn in der Ich-Du-Haltung auf horizontaler Ebene zu begegnen. Die Therapierenden bringen sich in selektiver Authentizität ein. Mit den Worten von Ruth Cohn ausgedrückt bedeutet das: „Nicht alles, was echt ist, will ich sagen, doch was ich sage, soll echt sein […]“ (Cohn 1979 zit. nach Pfaff 2002, 40). Wenn sich die Therapierenden vordergründig auf die Verhinderung eines Suizids konzentrieren, verlieren sie den Kontakt zu dem Menschen. Sie gehen aus dem Kontakt mit der betroffenen Person und sind sich möglicherweise ihrer Gegenübertragung (siehe Kapitel 3.5) nicht bewusst beziehungsweise sind verhindert diese wahrzunehmen. Bei der Patientin aus dem Praxisbeispiel wird deutlich, dass die Arbeit einseitig und außerhalb des Kontakts stattgefunden hätte, wenn das Ziel der therapeutischen Arbeit vorrangig gewesen wäre, den Suizid zu verhindern. 3.5 Relevanz von Supervision In der Beziehung zu Sterbenden im psychotherapeutischen Setting erleben Therapierende tiefgehenden Kontakt zu ihren eigenen Verlustängsten und ihrer Sterblichkeit (vgl. Lehner 2011, 171). Dies braucht notwendigerweise eine regelmäßige supervisorisch begleitete Reflexion, um eigene Anteile zu erkennen und diese nicht ungefiltert in den Übertragungs- und Gegenübertragungsprozess fließen zu lassen. Dass psychotherapeutisch Tätige sich und ihre Arbeit regelmäßig mit fachlicher Unterstützung reflektieren und analysieren ist unabdingbar, um sich Übertragungen und Gegenübertragungen bewusst zu machen. In der Übertragung besteht bei Betroffenen eine starke Tendenz dazu, die therapierende Person mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil zu identifizieren. In der Gegenübertragung kann es dann vorkommen, dass die therapierende Person die Rolle des Elternteils annimmt und wiederum die 33 betroffene Person mit dem Kind identifiziert. Dies würde die Objektivität beziehungsweise Neutralität in der psychotherapeutischen Arbeit massiv beeinträchtigen (vgl. Blankerz und Doubrawa 2005, 277). Am Beispiel von Suizidalität im palliativen Kontext könnte durch das Annehmen der Rolle eines Elternteils die Neutralität der Therapierenden eingeschränkt werden. Das könnte zu einer Übernahme von Verantwortung für die erkrankte Person führen und diese damit eventuell in ihrer Autonomie begrenzen. Auch ein unbewusstes Ausweichen vor dem Thema Suizidalität, indem die behandelnde Person es beispielsweise nicht anspricht, führt unreflektiert zu einer Gegenübertragung. Nach Hutterer-Krisch (2001, 852) differenziert die Gestalttherapie zwei Möglichkeiten der Gegenübertragung. Sie kann Ausdruck eigener zu bearbeitenden Schwierigkeiten oder Anteilen der psychotherapeutisch Tätigen sein oder eine angemessene emotionale und bewusste Resonanz auf die Klientin oder den Klienten. Im ersteren Fall müssen Therapierende ihre Reaktionen beachten und reflektieren, das heißt in Supervision, Intervision oder Eigentherapie bearbeiten, um den psychotherapeutischen Prozess nicht zu behindern. Die Gegenübertragung ist mit dem gestalttherapeutischen Konzept der Projektion in Verbindung zu bringen. Projektion in diesem Kontext besagt, dass die therapierende Person ihr Gegenüber nicht unvoreingenommen wahrnimmt, sondern das eigene Empfinden oder Erleben in die betroffene Person hinein interpretiert beziehungsweise auf sie projiziert. Für den Verlauf der Gestalttherapie ist therapeutisches Gewahrsein, ohne das Gegenüber zu bewerten unerlässlich, um Offenheit für einen Ich-Du-Dialog, der auf Martin Buber zurückführt, zu bewahren (vgl. Blankerz und Doubrawa 2005, 277). 34 4 Psychotherapie und Suizid 4.1 Suizidalität erkennen Für einen professionellen Umgang mit suizidgefährdeten Personen ist es notwendig, die am häufigsten vorkommenden Umstände zu kennen, die Menschen zu dem Entschluss bringen können, über ihr Lebensende selbst zu bestimmen. Um Suizidalität erkennen zu können, müssen diese Anzeichen frühzeitig wahrgenommen werden. Differentialdiagnostisch ist eine Suizidabsicht aufgrund einer gezogenen Bilanz von einer Entscheidung aufgrund einer krankhaften Unzurechnungsfähigkeit wie beispielsweise einer Psychose abzugrenzen. Bilanzierung Auch eine Entscheidung aufgrund einer ist genau zu hinterfragen. Es kann notwendig sein, sehr kurzfristig Maßnahmen zur Abwendung einer Suizidhandlung zu ergreifen. Fleming et. al. (2000) kamen in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass die Entscheidung für einen Suizid in hohem Maße mit Autonomieverlust, schwindender Kontrolle über körperliche Funktionen und sozialer Zurückgezogenheit einhergeht. „Da menschliches Leben weder in uneingeschränkter Autonomie noch in völliger Abhängigkeit sinnvoll denkbar und möglich ist, ist für die meisten Menschen in nahezu allen Lebensepochen ein spürbares Schwanken zwischen diesen beiden Polen charakteristisch“ (Wedler 2001, 169). Zur Verdeutlichung stellt Wedler (2001, 169) die Psychodynamik des Antagonismus von Autonomie- und Abhängigkeitstendenzen als ein Pendeln zwischen Unabhängigkeit und Geborgenheit in Form eines Kreislaufs dar. Zunächst fordert die Sehnsucht nach Autonomie eine Ablösung. Diese macht Angst und ruft wiederum eine Sehnsucht nach Geborgenheit hervor. Geborgenheit erfordert Abhängigkeit. Diese erzeugt Wut und ruft wiederum Sehnsucht nach Autonomie hervor. Umstellungen und Veränderungen in einem Leben, wie eine schwere Erkrankung, die in absehbarer Zeit zum Tode führen wird, liegen partiell außerhalb der Kontrolle der erkrankten 35 Person. Eine Akzeptanz dieses Zustandes beziehungsweise das Zulassen der Nichtkontrollierbarkeit der eigenen Situation hat zur Voraussetzung, dass beim Durchlaufen des oben beschriebenen lebenslangen Kreislaufes zwischen Unabhängigkeits- und Abhängigkeitswünschen eine innere Freiheit gewonnen werden konnte, durch die beide Tendenzen annehmbar werden. Der Begriff der Freiheit beansprucht das Zulassen einer Ablösung, die grundsätzlich mit Angst verbunden ist. Daran wird deutlich, dass der Kreislauf nicht endlich ist. Zur Verdeutlichung und Abgrenzung von psychischen Beeinträchtigungen und psychotischen Zuständen ist eine Aufschlüsselung von Begrifflichkeiten notwendig. Die Bezeichnung Psychose wird in den psychiatrischen Klassifikationen der International Classification of Diseases, aktuell ICD-10, und dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, aktuell DSMIV, nicht mehr genannt. Mit dem Begriff der Störung (ICD-10), respektive Disorder (DSM-IV) ergänzend der jeweiligen Benennung der Kategorie, wurde der Begriff Psychose verlassen. Als Gegenpart zu den Psychosen zählten die Neurosen zu den psychogenen Leiden. Die Neurosen wurden als Ergebnis einer hinderlichen Lebensgeschichte oder von psychischen Konflikten betrachtet, die von den Betroffenen unbewusst abgewehrt werden müssen. Psychosen wurden als organisch verursacht (exogene Psychosen) oder als Folge eines nicht zu identifizierenden biologischen Prozesses (endogene Psychosen) verstanden. Sie betrafen die gesamte Person wie auch ihr Verhältnis zur Außen- und Mitwelt und waren oft durch den Verlust der Realitätsprüfung gekennzeichnet. Ob psychische Konflikte die Ursache für psychotisches Leiden sein können, wurde lange kontrovers diskutiert (vgl. Küchenhoff 2012, 12f). Sowohl neurotische als auch psychotische Symptome, die zu einer Suizidabsicht führen oder beitragen, benötigen eine Behandlung. Eine Suizidabsicht, die nicht Ausdruck oder Symptom einer psychischen Erkrankung ist oder im symptomfreien Intervall einer chronischen, psychischen Krankheit auftritt, muss gesondert beurteilt werden. Es ist zu unterscheiden, ob die Suizidabsicht in direktem Zusammenhang mit der 36 psychischen Erkrankung Lebenssituation ist steht (vgl. oder Nationale Folge des Leidens Ethikkommission im an der Bereich Humanmedizin 2005, 71). Im vorangehenden Praxisbeispiel der Patientin mit ALS ist die unheilbare und fortschreitende Erkrankung die vordergründige Ursache für das Leiden, das zur Suizidabsicht führt. Das Leiden zog Autonomieverlust, schwindende Kontrolle über körperliche Funktionen und soziale Zurückgezogenheit nach sich. Dennoch lag auch ein Leiden in Form von mangelnder Kompetenz im Umgang mit Frustrationen vor, welches die Erarbeitung von Copingstrategien erforderte. 4.2 Erhebung einer Diagnose am Beispiel der Depression Die Depression ist eine psychische Erkrankung, die im psychotherapeutischen Setting die Aufmerksamkeit der Therapierenden wecken muss. Insbesondere im Zusammenhang mit möglicher Suizidalität ist nicht nur eine Abklärung eventueller psychischer Krankheiten notwendig sondern auch deren Schweregrad. Nur auf dieser Grundlage kann die Depression als starker Einflussfaktor für eine Entscheidung zu einer Suizidhandlung gewertet werden. Bezugnehmend auf das Praxisbeispiel der ALS-Patientin ist es notwendig, deren freie geistige Entscheidungsfähigkeit zu prüfen und abzuklären, ob möglicherweise eine psychische Erkrankung vorliegt und in welchem Ausmaß die freie Entscheidungsfähigkeit der Patientin davon beeinträchtigt ist. „Suizidgefährdung ist keine Krankheit eigener Art. Sie ist Ausdruck einer Lebenskrise. Sie kann aus einer als ausweglos erlebten […] Situation erwachsen. Sie kann aber auch Begleitsymptom einer psychischen Krankheit sein“ (Finzen 1997, 62). Suizidalität wird Zusammenhang sehr häufig mit gebracht. In der einer depressiven Erkrankung in Tat sind Suizidgedanken und Suizidhandlungen bei schwerer Depression häufig (vgl. Krollner und Krollner, 37 2013, F32.2). Lebensmüdigkeit kann somit als ein Anzeichen einer schweren Depression gelten. Chochinov et. al. (1995) fanden in ihrer Studie heraus, dass der Sterbewunsch bei terminal Erkrankten in engem Zusammenhang mit einer depressiven Symptomatik steht. 58,8 Prozent der untersuchten 200 sterbenskranken Personen, die einen deutlichen Wunsch vorzeitig zu sterben aufwiesen, erfüllten die Kriterien einer Major Depression. „Die Häufigkeit depressiver Syndrome ist bei Personen mit schweren körperlichen Erkrankungen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung um circa das Zwei- bis Vierfache erhöht. Depressive Störungen sind sehr häufig mit Angstsyndromen vergesellschaftet. Es kann schwierig sein, eine manifeste depressive Erkrankung von einer tiefen Trauer des Patienten angesichts des drohenden Verlusts von Gesundheit und Leben abzugrenzen“ (Klaschik 2010, 39). „Abhängig von Anzahl und Schwere der Symptome ist eine depressive Episode als leicht, mittelgradig oder schwer zu bezeichnen“ (Krollner; Krollner 2013, F32.0 – 32.9). Sowohl beim Studium der wissenschaftlichen Literatur als auch im kollegialen Austausch in der Palliative Care fällt auf, dass diagnostische Leitlinien teilweise ignoriert werden und eine Unterteilung der Erkrankung Depression in leichte, mittelgradige und schwere depressive Episode ohne oder mit psychotischen Symptomen unterlassen wird (vgl. Krollner und Krollner, 2013, F32.0 - 32.9). Eine gewissenhafte Behandlungsplanung für die suizidale Person erfordert unerlässlich eine präzise Diagnosestellung. So entspricht es den klassischen Behandlungsregeln, eine leichte Depression psychotherapeutisch, eine mittelgradige Depression psychotherapeutisch und eventuell begleitend pharmakologisch sowie eine schwere Depression psychotherapeutisch und pharmakologisch zu behandeln (vgl. Rose und Waltering 2012). “The term ‚depressed‘ is so ubiquitous in colloquial expression that its specific clinical meaning, as a diagnostic term identifying a discrete and treatable syndrome is often blurred” (Chochinov, Lander, Wilson 2009, 39). 38 Die Definition des Begriffes Depression ist durch den häufigen Gebrauch in der Alltagssprache sehr unscharf geworden. Leider konnte im Laufe der Zeit nicht verhindert werden, dass die ursprüngliche Bedeutung verwässert wurde. Traurige oder auch nur ansatzweise gedrückte Stimmungen wurden als depressiv bezeichnet, was der tatsächlichen Diagnose Depression beziehungsweise depressive Verstimmung als affektive Störung nicht gerecht wird. Möglicherweise muss dem wie auch der Umbenennung der Diagnose der hysterischen Persönlichkeitsstörung in histrionische Persönlichkeitsstörung (vgl. Krollner und Krollner 2013, F 60.4) entgegengetreten werden, um wieder Klarheit herzustellen. Andererseits werden depressive Symptome bis hin zur Major Depression häufig als der terminalen Erkrankung zugehörig beziehungsweise als normale Reaktion darauf eingestuft (vgl. Chochinov, Lander, Wilson 2009, 61). Symptome werden wahrgenommen und der Krankheit Depression zugeordnet, ohne konkret zu prüfen, ob und wenn ja welche Form einer Depression vorliegt. Demgegenüber werden depressive Symptome einer Grunderkrankung zugeordnet, ohne deren eigenständigen Krankheitswert abzuwägen. So besteht neben der Schwierigkeit, dass depressive Erkrankungen häufig nicht korrekt erfasst werden, da sie nicht als Krankheit sondern als gewöhnliche Reaktion auf die nachvollziehbar hoffnungslose Situation angesehen werden, das Problem der Abgrenzung zu den Symptomen der körperlichen Erkrankung, respektive der Differenzialdiagnose. Insbesondere bei palliativ erkrankten Menschen ist das Stellen der Diagnose Depression mit Schwierigkeiten verbunden. So beschreibt die International Classification of Diseases, ICD-10, (vgl. Krollner und Krollner 2013, F32.0 – 32.9) für die Diagnose einer Depression unter anderem somatische Symptome wie z. B. ausgeprägte Müdigkeit, Schlafprobleme, deutliche psychomotorische Hemmung, Agitiertheit, Appetitverlust, Gewichtsverlust und Libidoverlust. 39 Die oben genannten somatischen Symptome sind häufig ebenso Folge einer schweren körperlichen Erkrankung beziehungsweise deren Therapie, was die zweifelsfreie Zuordnung der Symptome zur somatischen oder psychischen Krankheit erschwert oder unmöglich macht (vgl. Keller 2011, 1079). „Auch wenn es nicht immer möglich ist, Symptome zweifelsfrei der somatischen oder der psychischen Erkrankung zuzuordnen, sollte berücksichtigt werden, dass sie sich gegenseitig beeinflussen, potenzieren oder maskieren können“ (Keller 2011, 1079). Um Fehldiagnosen und den damit verbundenen falschen Therapieansatz zu umgehen, fordert Keller (2011, 1079) dazu auf, depressive Symptome von Symptomen die durch die körperliche Erkrankung oder deren Therapie bedingt sind, abzugrenzen. Dies gelingt oft erst durch bessere Kenntnis der Betroffenen über einen längeren Beobachtungszeitraum. Keller empfiehlt bei Schwerkranken kognitive Einschränkungen stärker zu gewichten und nicht zu vernachlässigen, dass körperliche Krankheitszeichen wie zum Beispiel Schmerzen depressive Verstimmungen auslösen oder verstärken können. Umgekehrt können körperliche Schmerzen durch eine depressive Symptomatik gesteigert werden. 4.3 Die Aufgabe der Therapierenden Für psychotherapeutisch Tätige ist es wichtig, den Umfang ihrer Aufgaben ebenso wie die Begrenzung ihres Tätigkeitsfeldes zu kennen. Um nicht einem Irrglauben zu erliegen, die gesunde therapierende Person sei der suizidalen Person überlegen, ist hervorzuheben, dass eine Begegnung zwischen Professionellen und einer Person mit suizidalen Fantasien unbedingt auf gleicher Ebene erfolgen soll. Sie ist als Expertin ihrer eigenen Situation zu sehen. Breitbart et. al. (2009, 403) erklären den Nutzen der Psychotherapie für Menschen mit einer Schmerzproblematik mit der Bereitstellung 40 professioneller und empathischer Unterstützung sowie Kontinuität in der Beziehungsgestaltung. In der Psychoedukation werden Kenntnisse über die Erkrankung vermittelt, die Möglichkeiten des Einsatzes von individuellen Ressourcen im Umgang mit der Erkrankung diskutiert und schließlich der Anpassungsprozess begleitet. Sie empfehlen die Anwendung supportiver Kurzzeittherapien mit dem Fokus auf die durch die körperliche Erkrankung ausgelöste Krise. Auch Lehner (2011, 171) beschreibt eine positive Auswirkung auf Sterbenskranken das Befinden durch die und auf die kontinuierliche Selbstregulation Verfügbarkeit bei sicherer Bindungspersonen. Dorrmann (2009, 16) sieht es für die psychotherapeutische Arbeit mit suizidalen Menschen als eine Voraussetzung, dass die Therapierenden sich weitgehend selbst mit den eigenen Ängsten vor dem Tod auseinandergesetzt haben. Er beschreibt es als unerlässlich, dass die Therapierenden für sich selbst reflektieren, wie es um ihren eigenen Lebensmut steht und ob sie möglicherweise selbst Tendenzen haben ihr Leben zu beenden. Sie sollten weniger Angst im Umgang mit der Thematik haben als ihre Klientel. Die Therapierenden sollten sicher sein, dass es für sie keinen Grund gäbe, sich das Leben zu nehmen. Mit der Ausstrahlung dieser Sicherheit würden sie die suizidale Person in ihrer Entscheidung für einen Suizid zumindest verunsichern. Dorrmann selbst gibt an, mit dieser Meinung in Fachkreisen häufig auf Widerstand zu stoßen. Die Situation von terminal Erkrankten, die weitere Therapien und lebensverlängernde Maßnahmen ablehnen, sieht er als einen Sonderfall. Ein Ablehnen von medizinischen Behandlungen und lebensverlängernden Therapien ist vom Suizid abzugrenzen. Ersteres ist ein passiver Verzicht auf Lebensverlängerung durch medizinische Maßnahmen, während ein Suizid eine aktive Handlung gegen das Weiterleben darstellt. Zum Suizid in der Lebensphase einer terminalen Erkrankung äußert sich Dorrmann in seiner Arbeit nicht. Haltenhof (2004, 245) formuliert das Ziel psychotherapeutischer Maßnahmen bei suizidalen Personen folgendermaßen: „Ziel der Intervention ist nicht die 41 Verhinderung des Suizids um jeden Preis, sondern die Wiederherstellung der Entscheidungsfreiheit durch Aufhebung innerer und äußerer Zwänge.“ Zunächst soll das psychotherapeutische Gespräch zum Ziel haben, die betroffene Person zu verstehen und damit zu deren Entlastung beizutragen. Eine diagnostische Einschätzung, ob möglicherweise eine psychische Erkrankung vorliegt, ist grundsätzlicher Bestandteil jeder Psychotherapie und letztendlich jeder Therapiesitzung. Finzen (1997, 8) empfiehlt für den Umgang mit suizidgefährdeten Menschen eine sorgfältige Diagnostik, eine individuell auf die Persönlichkeit, die Symptome und die Belastbarkeit abgestimmte Therapie, Offenheit und Empathie in der Psychotherapie und die Reflexion der eigenen Emotionen bei der Behandlung von Personen, die ihrem Leben verzweifelt und hoffnungslos gegenüberstehen. Dabei sollte eine Psychopathologisierung von Menschen mit Suizidabsichten unbedingt vermieden werden. Eine Ansammlung von psychotherapeutischen Maßnahmen, Interventionsmöglichkeiten und Techniken könnte nach Dorrmann (2009, 141) dazu verleiten, einen therapeutischen Aktionismus aufzubauen, der dazu führen würde, die Macht der therapeutischen Interventionen zu überschätzen. Ein reflektierter Einsatz therapeutischer Mittel, der die persönlichen Bedingungen einer suizidalen Person beachtet und wertschätzt und ein Prinzip der minimalen therapeutischen Intervention seien von hoher Bedeutung, um Betroffene in ihrer Individualität wahrzunehmen und sie nicht mit dem eigenen Erfolgsdruck zu konfrontieren. 4.4 Die narzisstische Kränkung Jeder Mensch hat seine natürlichen narzisstischen Persönlichkeitsanteile und ein Bestreben, sein persönliches Bedürfnis nach Anerkennung zu erfüllen. Hartmann (2006, 3) setzt den Narzissmusbegriff mit Überheblichkeit, starkem Geltungsbedürfnis und überhöhter Ich-Bezogenheit gleich. Das lässt darauf schließen, dass eine sterbenskranke Person die 42 Befriedigung ihrer natürlichen narzisstischen und selbstbezogenen Bedürfnisse nicht bewerkstelligen kann. Das Selbst unterliegt fortwährend einer intrapsychischen Bewertung. Das narzisstische Regulationssystem bemüht sich um Ausgleich zwischen Zustimmung und Entwertung des Selbst. Je weiter die Idealvorstellungen vom realen Zustand des eigenen Selbst entfernt sind, desto größer ist das Gefühl der eigenen Entwertung, was eine narzisstische Kränkung verursacht. Die tödliche Krankheit führt zu Kontrollverlust durch die Entfernung des Menschen von der Realisierung seines Zukunftsentwurfes. Seine Lebensbilanz muss in Bezug auf seine aktuellen Möglichkeiten der Selbstverwirklichung neu angepasst werden (vgl. Rudolf 2008, 64). Laut Henseler (2000, 58) ist Suizid eine aktive Vorwegnahme einer massiv gefürchteten Gefahr wie dem Kontrollverlust bei rasch fortschreitender und zum Tode führender Erkrankung. Ein Beispiel für Kontrollverlust und die Angst von schwerkranken Menschen, den Zeitpunkt zu verpassen zu dem sie noch selbst in der Lage sind, ihrem Leben ein Ende zu setzen, zeigt sich bei der beschriebenen ALS-Patientin. Die für diese Situation möglicherweise höchste Form narzisstischer Kränkung droht mit der Beendigung jeglicher Selbstbestimmung und dem Zwang, ein nicht mehr gewolltes Leben weiter leben zu müssen. Die Suizidalität ist nach Henseler (2000, 11) die Labilisierung des narzisstischen Regulationssystems und die Suizidhandlung der krisenhafte Versuch, das gefährdete Selbstwertgefühl zu retten. Menschen in einer suizidalen Krise fantasieren den Tod häufig als harmonischen Zustand, der die Möglichkeit verspricht, aus einer als unerträglich empfundenen Situation zu fliehen (vgl. Plein 2003, 6). Die narzisstische Kränkung spielt in der Psychotherapie sowohl auf der Seite der Betroffenen als auch auf der Seite der Therapierenden eine maßgebliche Rolle und braucht unerlässlich eine bewusste Betrachtung. Psychotherapeutisch Tätige haben eine Tendenz, die Ursache eines Therapieausgangs auf sich selbst zu beziehen. Der Suizid einer sich in 43 Behandlung befindenden Person stellt die narzisstischen Strukturen von Therapierenden vor eine besondere Herausforderung. Eine Suizidäußerung oder Suizidabsicht kann als therapeutischer Misserfolg gewertet werden und beinhaltet somit eine klassische Kränkungssituation (vgl. Kind 2005, 155f). Dass das therapeutische Wirken als Mittel zur Behandlung auch schädlich sein kann, ist nicht zu bestreiten. Daraus folgt, dass die narzisstischen Anteile der Therapierenden eine Reflexion benötigen. Eine für suizidale Menschen spürbare narzisstische Kränkbarkeit der Therapierenden könnte Betroffene unter Druck setzen, die therapierende Person zu schonen und vor ihr die belastenden Probleme zurück zu halten (vgl. Kind 2005, 193f; siehe S. 56? Studie von Fegg et. al.). 4.5 Juristische Grenzen in der Psychotherapie Für die psychotherapeutische Arbeit mit Menschen mit Suizidabsicht ist es notwendig, rechtswissenschaftliche Aspekte einzubeziehen. Die psychotherapeutisch Tätigen werden nicht umhin kommen, sich mit der Freiverantwortlichkeit Wortbestandteile des einer im Handlung auseinander bundesdeutschen zu setzen. Rechtswesen Die geläufigen Begriffes freiverantwortlich verdeutlichen den Sinn des Ausdruckes. Eine Person ist frei, die Verantwortung für ihr Tun zu übernehmen. Bei bestehender Unsicherheit darüber, ob eine Person mit Suizidabsicht in der Lage ist freiverantwortlich für sich zu entscheiden, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, eine Ärztin oder einen Arzt für eine Einschätzung hinzu zu ziehen. Im Weiteren ist zu klären, ob eine mögliche psychische Erkrankung eine freie Entscheidung zulässt oder verhindert beziehungsweise ob die psychische Erkrankung ein auslösender aber therapierbarer Faktor für diese Absicht ist. Das Praxisbeispiel der ALS-Patientin veranschaulicht, dass neben der Frage nach der Freiverantwortlichkeit im juristischen Sinne die Frage relevant ist, ob einer terminal erkrankten Person gegen ihren Willen eine ärztliche 44 Untersuchung zugemutet werden darf. Wenn für die Klärung der Freiverantwortlichkeit eine ärztliche Untersuchung eingeleitet werden soll, muss die betroffene Person zustimmen. Für eine ärztliche Konsultation ist gleichfalls eine freiverantwortlich zu treffende Entscheidung von Patientenseite notwendig. Die Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin NEK-CNE (2005, 56f) setzt sich in ihrer Stellungnahme Nr.9/2005 mit der Suizidbeihilfe auseinander. Sie befasst sich mit der Frage des freien Willens. Dies wird im bundesdeutschen Sprachgebrauch als „Freiverantwortlichkeit“ bezeichnet. Wenn der Verdacht auf eine psychische Erkrankung besteht, rät die Kommission zu einer psychiatrischen Beurteilung mit dem Ziel, eine psychische Erkrankung als Ursache des Todeswunsches zu erkennen oder auszuschließen. Gropp (1996, 25) bezieht sich mit der folgenden Aussage über die Freiverantwortlichkeit auf der Grundlage eines Verantwortungsprinzips auf die Rechtswissenschaftler Roxin und Bottke. „Vertreten insbesondere von Roxin und Bottke, geht diese Meinung von der Freiverantwortlichkeit als Regelzustand aus, der negativ nur ausnahmsweise entfalle. Die Verantwortungslehre untersucht folglich nicht, ob der Suizident freiverantwortlich handelt, sondern sie geht davon immer bereits dann aus, wenn keine gegenteiligen Anzeichen vorliegen“ (Gropp 1996, 25). Im Weiteren macht Gropp (1996, 20) die Einschränkung, dass eine Freiverantwortlichkeit dann nicht besteht, wenn die suizidale Person noch ein Kind ist oder wegen einer krankhaften seelischen Störung, tiefgreifenden Bewusstseinsstörung, Schwachsinn oder schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, die Problematik des Suizids zu erkennen und dementsprechend zu handeln. Dorrmann (2009, 137) bezieht sich mit seiner Auslegung der (Bundesmisnisterium Freiverantwortlichkeit der Justiz 2013). auf den Demnach § 20 StGB wird von einem freiverantwortlichen Entschluss ausgegangen, wenn keine der von Gropp genannten Merkmale vorliegen. Er verweist einschränkend darauf, dass 45 diese Anzeichen weit gefasst sind, wodurch eine Abgrenzung von neurotischen Entwicklungen erschwert ist. Um Missverständnisse abzuwenden, werden die von Gropp und Dorrmann genannten Merkmale, die eine Freiverantwortlichkeit verhindern, im Folgenden definiert. Eine krankhafte seelische Störung wurde früher als krankhafte Störung der Geistestätigkeit bezeichnet (vgl. Rosenau und Schreiber 2009, 85). Nach Otto ist die krankhafte seelische Störung als eine psychische Störung anzusehen, die auf organische Ursachen, wie sie eine Hirnverletzung darstellen würde, zurückzuführen ist. Ebenso fällt eine exogene Psychose, verursacht zum Beispiel durch Alkoholabusus oder eine endogene Psychose wie zum Beispiel die Schizophrenie unter diese Beschreibung (vgl. Otto 2004, 213). Die Bezeichnung Schwachsinn wird heute wegen ihrer diskriminierenden Aussage nicht mehr verwendet. In der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen fällt Schwachsinn unter Intelligenzminderung, beschrieben im Kapitel F 7 (vgl. Krollner und Krollner 2013). Nach der Aussage von Schreiber (2003, 7) ist mit schwerer anderer seelischer Abartigkeit der Bereich psychischer Abweichungen von einer zugrunde gelegten Normalität gemeint, die nicht auf nachweisbaren organischen Defekten beruhen. Wenn akute Suizidgefahr bei einer freiverantwortlich handelnden Person besteht, verlangt nach Wolfslast (1985, 167) weder das deutsche Zivilrecht noch das deutsche Strafrecht ein Einschreiten, um den Suizid zu verhindern. Ist jedoch eine Person nicht imstande den Entschluss und seine Tragweite bewusst zu erfassen, so müssen psychotherapeutisch Tätige den Suizid nach allen Möglichkeiten versuchen zu verhindern (vgl. Wolfslast 1985, 167). Obige Ausführungen sind vergleichbar mit der von Birnbacher (1990, 412) vertretenen Lehrmeinung zum schwachen Paternalismus, der ein Eingreifen 46 mit Zwangsmitteln nur dann erlaubt, wenn die Einsichtsfähigkeit der suizidalen Person nicht gegeben ist (siehe Kapitel 6.3). Eine Entscheidung gegen den Willen suizidaler Personen trotz vorhandener Freiverantwortlichkeit käme dem sogenannten starken Paternalismus gleich und würde die Autonomie der Betroffenen untergraben. „Das heißt für ambulant arbeitende Psychotherapeuten, daß [sic] sie auch bei akut suizidalen Patienten keine Maßnahmen zur Verhinderung des Suizids einleiten müssen, wenn deren Entschluß [sic] reiflich überlegt und auf einer freien Willensentscheidung beruht“ (Dorrmann 2009, 136). Aufgrund akuter Suizidalität erfüllt ein terminal erkrankter Mensch somit keineswegs die Voraussetzungen für eine stationäre Einweisung in eine Psychiatrie, wenn nicht die Einengung des Bewusstseins der betroffenen Person, welche eine freie Entscheidung verhindern würde, vorliegt. Klare Behandlungsvorgaben erfordern einheitliche Vorgehensweisen, die der Individualität der Betroffenen nicht immer gerecht werden. „Jeder, der mit einem drohenden Suizid konfrontiert wird, muß [sic], will er nicht die annähernd totale Sicherheit, die fast immer nur durch unverhältnismäßige Maßnahmen zu erreichen wäre, auf ‚Glück‘ vertrauen, auf sein eigenes und auf das des Gefährdeten“ (Wolfslast 1985, 167). Baltz (2010, 18) erachtet die unterlassene Verhinderung eines Suizids als nicht strafwürdig, wenn feststeht, dass es sich dabei um einen freiverantwortlichen und endgültigen Entschluss gehandelt hat, und davon auszugehen ist, dass die lebensmüde Person mit ihrer Rettung nicht einverstanden ist. Eine Hilfeleistung ist grundsätzlich solange zu erbringen wie ein freiverantwortliches Handeln des suizidalen Menschen angezweifelt werden kann. 47 5 Palliative Care und Suizid 5.1 Die Verbindung von sterbenskrank und lebensmüde Menschen in einer palliativen Situation treten in einen neuen Lebensabschnitt, der den Betroffenen einen völlig neuen Blick in die Zukunft abverlangt. Das führt häufiger als landläufig vermutet zu Resignation und Lebensmüdigkeit. Fann et. al. (2008) fanden in ihrer Studie zu Suizidhäufigkeit bei Krebserkrankten heraus, dass diese Gruppe in den USA im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung eine nahezu verdoppelte Suizidrate aufweist. Die Suizidrate war dabei in den ersten fünf Jahren nach Diagnosestellung am höchsten. Im palliativen Kontext ist es notwendig, dass die Helfenden auf das Erkennen und den Umgang mit suizidalen Gedanken vorbereitet sind. Dieser Aspekt erweitert das Aufgabenfeld der an der Versorgung beteiligten Personen. Die folgenden Aussagen zeigen die multiprofessionelle Beteiligung und Mitwirkung an dieser Thematik, denn jede helfende Person steht in der Versorgung der Betroffenen mit deren eventuellen lebensmüden Gedanken in Kontakt. Dieser besteht entweder darin, der betreffenden Person hinsichtlich dieses Themas mit Interesse zu begegnen oder ihrem Thema, möglicherweise unbewusst, aus dem Weg zu gehen. Beide Reaktionen konfrontieren die schwerkranke Person mit einer Resonanz. Braun (2012, 28) vertritt in seiner Arbeit über das Lindern von Leiden am Lebensende die Auffassung, dass Angst vor Autonomieverlust, vor dem Verlust sozialer Beziehungen, vor Verletzung und Leiden, vor Verlust und Schuld, Trennungsangst, Angst vor dem Tod und dem Jenseits die Palliativpatienten quälen. Alle von Braun genannten Leiden stehen in engem Zusammenhang mit der letzten Lebensphase im terminalen Krankheitsstadium. Die Helfenden haben die Aufgabe, den erkrankten Menschen derart zu unterstützen, dass das Leiden so gering wie möglich ist. Es ist auch ihre Aufgabe zu erkennen, wann ihre Hilfsangebote nicht mehr mit der Autonomie der Sterbenskranken 48 in Einklang stehen. Die kranke Person in ihrer individuellen Lebenslage ist anzuerkennen und wertzuschätzen, ohne sie in Frage zu stellen oder eigene Bedürfnisse nach Harmonie und Heilung vorn anzustellen. Breitbart et. al. (2009, 103ff) zählen Depression, Hoffnungslosigkeit, Schmerzen, kognitive Einschränkungen und mangelhafte soziale Unterstützung zu den Risikofaktoren für Suizidgedanken und Suizidabsichten. “Suizidgedanken sind der klinischen Erfahrung nach nicht ungewöhnlich und stellen vor allem in terminalen Erkrankungsstadien häufig ein Mittel oder eine Art Ventil im Sinne eines letzten möglichen Auswegs dar, der Bedrohung durch die Erkrankung und deren Fortschreiten zu entgehen und nicht von ihr überwältigt zu werden“ (Breitbart und Mehnert 2006, 106). „Schwere Krankheit wird von Suizidgedanken begleitet, insbesondere dann, wenn die Diagnose mitgeteilt wird, die Krankheit sich verschlimmert, eingreifende therapeutische Maßnahmen bevorstehen und wenn schließlich Ärzte von ‚austherapiert‘ sprechen“ (Klie und Student 2007, 107). Klie und Student (2007, 107) kommen zu der Auffassung, dass die Empathie der Helfenden sie davon abhält, die notwendige Unterstützung für die erkrankte Person mit lebensmüden Gedanken zu leisten, weil sie sich mitfühlend und mitleidend in deren Situation hinein versetzen. Die Autoren betonen dass es hilfreich ist bei den Betroffenen das Thema Suizidalität in jeder Lebenskrise anzusprechen. Um verbleibender Unsicherheit in den Teams entgegenzutreten, stellen sie sogar eine konkrete Handlungsanweisung für diese Fragestellung zur Verfügung. „Wenn wir also bei schwer kranken Menschen – nicht zuletzt in der letzten Lebensphase – Suizidgedanken finden, ist dies in keiner Weise erstaunlich. […] Sie gehören gerade in der letzten Lebensphase dazu“ (Klie und Student 2007, 108). Völkel beschreibt, dass durch Empathie im Gespräch mit der betroffenen Person in der Akutsituation wie auch in der präventiven Phase der Suizidalität Nähe hergestellt und Angst aufgelöst werden kann. Sie schildert auch, dass die Helfenden selbst in einer psychisch stabilen Position sein müssen und keine Angst vor dem Thema des Suizids haben dürfen (vgl. 49 Völkel 2012, 267f). „Suizidale Äußerungen müssen ‚Aktives Zuhören‘ auslösen“ (Völkel 2012, 267). 5.2 Gutes Sterben und der anspruchsvolle Weg dahin Der Begriff Palliative Care wird häufig mit der Ermöglichung eines Sterbens ohne Leid in Verbindung gebracht. Die Vorstellungen über die Bedeutung von gutem Sterben gehen bei Betroffenen und Helfenden auseinander. „Normative Vorstellungen über einen ‚idealen‘ ‚d. h. sanften, friedvollen Tod können im Rahmen der Palliative Care zu Belastungen für Betroffene und Fachkräfte führen. Für sich betrachtet bildet die Einsicht, dass das gute Sterben nicht für alle Menschen dasselbe bedeutet, ein Korrektiv für diese Idealbildungen“ (Heller, B. 2007, 433). „Tod und Sterben werden oft als sehr eng verbunden und fast identisch in ihrer Bedeutung angesehen. Erstaunlicherweise erzählen uns Patienten, sie hätten keine Angst vor dem Tod, wohl aber vor dem Sterben“ (Braun 2012, 28). „Ausgang jeder hospizlichen und palliativen Arbeit ist die Aufmerksamkeit für die Betroffenen, eine einfühlende Compathie (Mitleidenschaft), die es ermöglicht, aus der Perspektive der Betroffenen zu denken, zu fühlen und Versorgung mit ihnen und in ihrem Sinne zu entwickeln“ (Heller, A. 2007, 191). Es hat sich eine Leitidee des guten Sterbens herausgebildet, an der sich Professionelle in der Palliative Care orientieren. Ein Konzept für gutes Sterben ist jedoch nicht generalisierbar, sondern es ist abhängig von Biografie, Kultur, Lebenseinstellung, Verlusterfahrung, Schmerzen und Jenseitsglauben, um nur einige Aspekte zu nennen (vgl. Heller, B. 2007). Heller, A. (2007, 198) schreibt, dass für die an der Versorgung beteiligten Professionellen verschiedener Berufe und die freiwillig Helfenden die 50 Aufgabe darin bestehe, mit und für die zu ver- und umsorgenden Menschen eine adäquate, individuelle Betreuung, eine Lebensqualität bis zuletzt zu entwickeln ist. Dieser Anspruch könnte sowohl Behandelnde als auch Patientinnen und Patienten unter Erfolgsdruck setzen. Möglicherweise verspürt eine aufgrund ihrer Erkrankung lebensmüde Person bei ihrer Bilanzierung zusätzlich eine Unzulänglichkeit, die Lebensqualität bis zuletzt nicht wahrnehmen zu können. Dies würde sie zusätzlich belasten. Bei einer depressiven Person wäre das zumindest naheliegend. Beyer (2008, 32) schreibt in ihrer Arbeit, dass das betreuende Personal aufgefordert ist, Individualität zu organisieren, optimale Schmerztherapie und Symptomkontrolle zu leisten, mit den Sterbenskranken und deren Angehörigen zu kooperieren und sie in den Krankheitsverlauf, die Behandlungsmethoden und Entscheidungen mittels interdisziplinärer Aufklärungsgespräche einzubeziehen sowie Begleitung und Unterstützung der Angehörigen beziehungsweise der nahen Personen zu gewährleisten. Es könnte einerseits der Eindruck entstehen, man müsse nur gut genug sein damit die sterbenskranke Person Lebensqualität bis zuletzt verspürt. Ebenso könnte es zu einer übersteigerten Selbstüberzeugung und Allmachtsfantasien kommen, die den Behandelnden quasi die Macht über den Lebenswillen der kranken Menschen zuspricht. Eink und Haltenhof (2006, 19) bezeichnen eine Haltung, die vermittelt, dass Suizidhandlungen mit professioneller Kompetenz immer verhindert werden können, als Allmachtsfalle. Der Umkehrschluss würde bedeuten, dass die Therapierenden einen Fehler begangen haben beziehungsweise die Schuld tragen, wenn sich eine Person trotz Therapie suizidiert. Klie und Student (2007, 104) beschreiben eine beispielhafte Situation, in der der behandelnde Palliativmediziner auf einer AIDS Station entsetzt ist, als er entdeckte, dass ein Patient große Mengen Beruhigungsmittel versteckt hatte. „Mein Entsetzen rührte vor allem daher, […] dass dieser junge Mann ernsthafte Zweifel daran hatte, dass wir Helfenden ihm den zugesicherten 51 Beistand am Lebensende geben könnten. In meinem Gekränktsein war ich zunächst gar nicht in der Lage, das Problem (mein Problem) offen anzusprechen“ (Klie und Student 2007, 104f). Das Thema Suizid spielt gerade bei Sterbenden eine große Rolle. So gibt es wahrscheinlich kaum einen längeren Sterbeprozess ohne Suizidgedanken (Mühlum; Student J.-C.; Student U. 2007, 75). Borasio (2012, 167) verdeutlicht am Beispiel eines Patienten, der unter stärksten Schmerzen litt, die gelindert werden konnten, wie er die Behandelnden, in diesem Fall die Ärzteschaft, vor Schwierigkeiten verschonen wollte. „Der Patient war sehr zufrieden, bedankte sich bei allen, ging nach Hause und nahm sich das Leben“ (Borasio 2012, 167). Sterbenskranke, die eigentlich gerne über ihren Suizidwunsch sprechen möchten und denen vielleicht eine Alternative aufgezeigt werden könnte, tun dies teilweise nicht. Möglicherweise haben sie Angst, psychiatrisiert oder zwangseingeliefert zu werden oder sie wollen ihre Behandelnden vor Schwierigkeiten schützen (vgl. Borasio 2012, 170). Fegg et. al. (2005, 158) zeigen in ihrer Studie über persönliche Werte und Lebensqualität, dass Betroffene in der Palliative Care verglichen mit gesunden Erwachsenen unter anderem verstärkt Wert auf Nächstenliebe legen. “Patients receiving palliative care appear to seek preservation and enhancement of the welfare of friends, relatives, and all people.” (Fegg et. al. 2005, 158) „Eine Suizidentscheidung angesichts schwerster Erkrankung und einer begrenzten Lebenserwartung kann im Einzelfall aus psychiatrischer Sicht freiverantwortlich sein und sollte dann auch respektiert werden.“ (Borasio 2012, 168) Die Situation von Sterbenskranken zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass ihr Leben, das zum Zeitpunkt vorhandener Suizidgedanken an einem Punkt ist, an dem nicht mehr damit zu rechnen ist, dass es sich zu einer verbesserten Lage wenden wird. Die meisten Menschen mit Suizidgedanken lehnen nicht das Leben an sich ab, sondern das Leben so wie es gerade ist. (vgl. Haltenhof 2004, 245) An einem weiteren Beispiel zeigt Borasio (2012, 170) auf, wie ein Patient, der den Wunsch nach Lebensverkürzung äußerte, von seinem behandelnden Arzt wegen Selbstgefährdung in die Psychiatrie eingewiesen wurde, wo er die letzten beiden Wochen seines Lebens auf der geschlossenen Abteilung verbringen musste, ehe er dort verstarb. 52 5.3 Suizidalität ansprechen und erkennen Sollte man Suizidalität zuerst ansprechen, um sie im Folgenden zu erkennen oder sollte man sie erst ansprechen, wenn man sie erkannt hat? „Es ist ein hartnäckiges Vorurteil, dass man durch das Sprechen über Suizidalität jemanden erst auf den Gedanken bringen könnte, gewissermaßen ‚schlafende Hunde‘ wecken könnte. Sprechen ist der ‚Königsweg‘, und wir haben auch keinen anderen. Zweitens können in vielen Situationen dieses Gespräch, und damit die Beziehung, auch bereits entlastend und unmittelbar hilfreich sein, in manchen Fällen bis hin zur Auflösung der unmittelbaren Suizidalität“ (Etzersdorfer 2012, 133). Obwohl sich Müller-Busch (2007, 313) in seiner Arbeit auf die Studie von Chochinov et. al. (1995) bezieht, nach der 44,5 Prozent der sterbenskranken Menschen sich gelegentlich einen baldigen Tod wünschen und 8,5 Prozent sich intensiv mit Suizidgedanken beschäftigen, kommt er zu dem Ergebnis, dass Suizidgedanken von Sterbenskranken selten geäußert werden. Eine Begründung für diese Diskrepanz könnte seine Aussage sein, dass die Beachtung, das Erkennen und der Umgang mit Suizidalität in der Palliativbetreuung ein häufiges Tabuthema ist. Trotzdem kommt er zu der Ansicht, dass die meisten Menschen ihre Suizidabsicht im Rahmen einer guten Palliativbetreuung zurücknehmen. Müller-Busch (2007, 313) empfiehlt auf Verhaltensweisen zu achten, die auf Suizidabsichten hinweisen. Keller (2011, 1081) stellt fest, dass viele Betroffene in der palliativen Versorgung zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Erkrankung Suizidgedanken haben. Jenen misst sie die Funktion der einem Kontrollverlust entgegenzusetzenden Selbstbestimmung bei. „Immer sollte jedoch die aktuelle Suizidgefährdung eruiert werden und gegebenenfalls in unklaren Fällen und insbesondere bei manifester Suizidalität ein Psychiater zugezogen werden“ (Keller 2011, 1081). Unbestreitbar bleibt die Aufforderung von Keller, stets die aktuelle Suizidgefährdung zu eruieren. Die von ihr empfohlene Konsequenz aus dem möglichen Ergebnis einer 53 manifesten Suizidalität ist in der Situation einer ambulanten Betreuung fraglich. Der Aufforderung Kellers steht konträr die Aussage Birnbachers (1990, 417) gegenüber, die eine Anwendung von Zwang nur dann als gerechtfertigt erachtet, wenn greifbare Hoffnung existiert, die Fähigkeit einer befriedigenden Lebensführung wiederzuerlangen. Stiefel und Voltz (2007, 492) weisen auf die Bedeutung der Suizidfantasien in Bezug auf die Autonomie einer terminal erkrankten Person hin. Ihre Empfehlung, offen über Suizidfantasien zu sprechen, um das Risiko eines Suizids zu verringern, geht an die ärztliche Berufsgruppe. Für eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik sehen sie keine Indikation. Die Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin (2005, 50f) vertritt die Ansicht, dass die Fürsorgepflicht für suizidale, unheilbar erkrankte Menschen die Pflicht einschließt, die Suizidabsicht einer suizidalen, urteilsfähigen Person zum einen mit ihr zu besprechen und ihr zum anderen alternative hilfreiche Optionen anzubieten wie zum Beispiel die Behandlung einer bestehenden Angstproblematik oder eine verbesserte schmerztherapeutische Behandlung mit dem Ziel einer Erhöhung der Lebensqualität. Dies muss unter Einbeziehung der Bewertung und der Sichtweise der erkrankten Person auf die eigene Situation geschehen. Sie soll sich unter bestmöglichen Bedingungen selbst bestimmen und herausfinden, was sie will. 5.4 Wie sich die Pionierinnen der Hospizbewegung zum Suizid positionieren Jemand, der den Tod herbei sehne, solle vor allem nicht verurteilt werden. Bei der Frage nach Suizid durch Verweigerung der medikamentösen Behandlung bejaht Kübler-Ross das Recht zur Bestimmung über den eigenen Körper. Allerdings macht er die Einschränkung, dass die Person geistig zurechnungsfähig sein müsse. Psychotische Personen begingen Suizid aus anderen Gründen als nicht psychotisch Erkrankte. Hinsichtlich der Frage nach den Phasen der Trauer, des Verlustes und des Abschieds vor 54 dem Tod differenziert Kübler-Ross zwischen Personen mit einer chronischen Depression, die den Betroffenen viel Zeit einräume die Beendigung des eigenen Lebens zu planen und psychotischen Personen, die spontanen Impulsen folgten (vgl. Kübler-Ross 1982, 58-62). In gleicher Weise bekräftigt Saunders (1993, 120) die These, dass eine psychische Erkrankung wie zum Beispiel die Depression nicht in allen Abstufungen eine frei verantwortliche Entscheidung zum Suizid verhindert. Im Gegenteil stellt Saunders sogar die Wohlüberlegtheit über einen längeren Zeitraum als Zeichen einer verlässlichen Entscheidung heraus. Häufig gibt es Situationen mit für die keine klaren Kriterien festgelegt werden können, ob bei einem Menschen ein Suizidrisiko besteht. Um dieser Unsicherheit zu begegnen, rät Dorrmann (2009, 40) Professionellen zu einer Sensibilisierung für indirekte Äußerungen und versteckte Hinweise und gibt Beispiele für solche Anzeichen. „Ich falle jedem zur Last. – Ich mache das nicht mehr mit. – Meine Lage wird sich nie bessern. – Ich möchte, daß [sic] das alles aufhört. – Ich schaffe das nicht mehr. – Manchmal habe ich Gedanken, das ist eine richtige Sünde. – Wenn ich mal nicht mehr (da) bin. – Die werden schon noch sehen. – Die am Friedhof sind manchmal zu beneiden. – Mein ganzes Leben ist sinnlos gewesen. – Manchmal möchte ich nur noch schlafen. – Vielleicht sehen wir uns nicht mehr. – Ich danke für Ihr Bemühen und die Geduld, Sie haben wirklich alles versucht. – Leben Sie wohl. (statt Auf Wiedersehen) – Man kann sich doch auch nicht so einfach davon stehlen. – Ich hasse dieses Leben. – Wenn ich meinen Glauben nicht hätte, hätte ich schon längst aufgegeben. – …dann ist es schon zu spät. – Es gibt auch noch einen anderen Weg. – Ich will einfach Ruhe haben, nichts mehr hören und sehen“ (Dorrmann 2009, 40). Dorrmann (2009, 41) weist darauf hin, dass es für die Beurteilung des Suizidrisikos immer nur eine subjektive Einschätzung gibt. 55 Auch Kübler-Ross (1982, 55) unternimmt den Versuch, das Risiko einer Suizidhandlung anhand von Kriterien zu bewerten und teilt Menschen mit Suizidgedanken in fünf Gruppen. 1. Menschen mit dem starken Bedürfnis alle und alles zu beherrschen. 2. Menschen, denen gefühllos mitgeteilt wurde, dass sie eine bösartige, für weitere Behandlungen zu weit fortgeschrittene Krankheit haben. 3. Menschen, denen man zu viel Hoffnung mit einer unrealistischen Prognose gemacht hat und die dann den passiven Tod sterben. 4. Menschen, die nicht ausreichende medizinische, seelische und geistliche Hilfe in ihrer Krise erhalten. 5. Menschen mit Suizidneigung, die nicht religiös sind, sondern den Sterbeprozess lieber abkürzen als nutzlos empfundenes Leid zu ertragen. Neben einer Richtschnur zur Vorgehensweise im Kontakt mit Menschen, die sich in einer Krise befinden, ist es unerlässlich für die Helfenden Unterstützungsmöglichkeiten zu schaffen. Diese sollen vorbeugend dafür sorgen, dass Mitglieder der helfenden Berufe nicht durch fehlende Handhabbarkeit der Krisen der anderen selbst in eine Krise geraten. Saunders (1993, 119f) beantwortet die Frage nach der Vorgehensweise bei der Konfrontation mit Suizidgedanken mit der Wichtigkeit eines interdisziplinären Teams, welches die Helfenden in der Gruppe unterstützt. Weiter hebt sie hervor, dass die Helfenden womöglich die Diskussion mit den Teammitgliedern brauchen, um mit dem Gesagten zurecht zu kommen. Der erkrankten Person würde es oft schon reichen, dass die Beziehung durch ihre Offenheit keinen Bruch erleidet. Es kommt vor, dass Menschen sich trotz größter Anstrengungen des versorgenden Teams dafür entscheiden, ihr Leben selbst zu beenden oder von ihren suizidalen Gedanken nicht lassen können. Es bleibt offensichtlich ein wesentlicher Teil vorhanden, der die Autonomie und Individualität der 56 Betroffenen schützt und nicht von den Helfenden zu beeinflussen ist. „Man kann einer anderen Person nicht vermitteln, welchen Sinn es hat, die letzte, verbleibende Zeit aus-zu-leben“ (Saunders 1993, 120). 6 Ethik und Suizid 6.1 Ethos und Ethik Ethos und Ethik unterscheiden sich und bedingen sich gleichzeitig. Monteverde (2007, 521) beschreibt den Ethos der Palliative Care als die Identifikationsgrundlage der Palliative Care und die Philosophie des auf Palliation bezogenen Betreuungskonzeptes. Die Ethik konzentriert sich auf moralische Probleme, die durch das Ethos selbst generiert werden sowie auf konkrete Fragestellungen der interdisziplinären ethischen Entscheidungsfindung. Von Beauchamp und Childress (vgl. 2009, 99-287) stammen die folgenden vier Prinzipien der Medizinethik, die entsprechend auf die Psychotherapie anwendbar sind: Respekt vor der Autonomie, Non-Malefizienz, Benefizienz und Gerechtigkeit. Die folgende Erläuterung dieser Prinzipien auf die Suizidalität angewendet ist an Bormuth, Marckmann, Wiesing (2004, 31-33) angelehnt. 1. Das Prinzip des Respekts vor der Autonomie verlangt die Beachtung der Wünsche, Ziele und Wertvorstellungen der Betroffenen. Dies beinhaltet für die Betroffenen, frei zu sein von manipulativer Einflussnahme durch die Behandelnden und die Förderung ihrer Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Das Ergebnis ist das informierte Einverständnis der Betroffenen, „informed consent“. 2. Das Prinzip Non-Malefizienz steht in Konkurrenz zum Prinzip der Benefizienz. Jede therapeutische Maßnahme beinhaltet auch ein Schadensrisiko. Es geht um das Abwägen der Relation von Nutzen und Risiko. 57 3. Das Prinzip der Benefizienz fordert von den Behandelnden Wohltun, indem Schäden verhindert oder beseitigt werden und das Wohl der betroffenen Person hin zu Gesundheit und Lebensqualität gefördert wird. 4. Das Prinzip der Gerechtigkeit spielt bei der Ressourcenverteilung eine bedeutende Rolle. Es behandelt die Frage, wer bei welchen Problemen in welchem Ausmaß unterstützt wird. Heller und Reitinger (2010, 743) stellen ergänzend fest, dass sich das menschliche Leben im Spannungsfeld von Autonomie und Fremdbestimmung bewegt und Autonomie kein unumschränkter Wert ist. Das zeigt sich deutlich in den Situationen, in denen Menschen aufgrund von Krankheit, Alter und Schwäche auf andere angewiesen sind. 6.2 Suizidprophylaxe – Anmaßung oder Verpflichtung Das Recht oder die Pflicht, einen Suizid zu verhindern, beinhaltet widersprüchliche wie auch sich ergänzende Aspekte, ohne dabei von der terminalen Situation beeinflusst zu sein. Der Bilanzsuizid wird nach Peters (2000, 80) als überlegte Selbsttötung einer psychisch gesunder Personen gesehen. „Die rationale und affektive Freiheit eines solchen Entschlusses wird von vielen bestritten“ (Peters 2000, 80). Manuela Völkel (2012, 265) sieht in den Begriffen „Freitod“ und „Bilanzsuizid“ einen Euphemismus, der den Menschen eine „Schein-Autonomie“ vortäuscht. Das würde dazu führen, dass weitere Anstrengungen zur Suizidprävention als nicht erforderlich erscheinen. Völkel bezieht sich mit obiger Aussage auf Suizide bei alten Menschen. Überträgt man ihre Feststellung auf Menschen aller Altersgruppen, entsteht ein Konflikt zu der Definition des Bilanzsuizides von Eink und Haltenhof (2006, 22). Sie beschreiben den Bilanzsuizid als eine Selbsttötung, die bei voller und umfassender Entscheidungsfähigkeit durchgeführt wird und eine Willensentscheidung als Ergebnis einer Abwägung von Pro und Kontra ist. 58 Eine grundsätzliche Frage stellt Dorrmann (2009, 134). „Wer gibt uns eigentlich das Recht, Suizidprävention zu betreiben oder gar andere am Suizid zu hindern?“ Damit stellt er die angenommene Selbstverständlichkeit helfender Berufe in Frage, dass Hilfe mit dem Erhalt von Leben gleichzusetzen wäre. Die Vorstellung davon, wie Leiden zu lindern sind, kann unter dem Aspekt der Suizidabsicht einen Bedeutungswechsel erfordern. Trotz aller zum Einsatz gebrachten Mittel und Möglichkeiten, dem Menschen mit Suizidgedanken wieder zum Lebenswillen zu verhelfen, kann es letztlich die wahre Hilfe sein, diesen Menschen nicht aus einer Selbstverständlichkeit heraus kurieren zu wollen, sondern seine individuelle Situation anzunehmen. Paradoxerweise entstehen daraus wiederum zwei Möglichkeiten eines Auswegs aus der Leidenssituation. Die Person mit Suizidgedanken kann sich frei und unterstützt fühlen ihre Entscheidung gegen das Leben zu treffen. Sie kann sich auch auf dem Boden des Verstehens und der Geborgenheit neu dazu entschließen dem Weiterleben zu begegnen. Letztendlich kann sich natürlich auch beides in genannter Reihenfolge zutragen. „Psychisch Kranke sollen sowohl das Recht auf Fürsorge und Behandlung wie auch bei Urteilsfähigkeit das Recht, über ihr Lebensende zu entscheiden, in Anspruch nehmen können“ (Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin 2005, 57). Fürsorge und Autonomie ergänzen sich, wenn Menschen in ihren Krisensituationen angemessen unterstützt werden. „Dem Prinzip der Autonomie steht das Prinzip der Fürsorge gegenüber. […] Ziel der Fürsorge ist dabei nicht, die Autonomie des Patienten zu ersetzen, sondern den Patienten in seiner Selbstbestimmung zu unterstützen“ (Duttge et. al. 2006, 124). Es ist zu unterscheiden zwischen einer Entscheidung unter Berücksichtigung verbleibender Therapieoptionen bei fortgeschrittener Erkrankung und einem Hilferuf aus akuter Verzweiflung, weil ein Mensch unter aktuellen Umständen keinen Sinn zum Weiterleben mehr erkennt. Eine weitere Variante kommt hinzu, wenn die suizidale Person ein psychisches Leiden hat, das ihre selbstbestimmte Entscheidung einschränken könnte. Analog ist die Frage zu 59 stellen, wie weit Gesunde in ihren Entscheidungen immer frei sind und ob absolute Selbstbestimmung nicht eine Illusion ist. Die Selbstbestimmung hat ihre Wurzeln im Erkennen und der kritischen Bewertung der Gründe für das eigene Tun sowie der daraus resultierenden Konsequenzen. Das Eingreifen in beziehungsweise das Verhindern eines Suizids um jeden Preis ist nur dann gerechtfertigt, wenn eine begründete Hoffnung besteht, dass die Ursachen für die Suizidhandlung nach der Rettung behoben werden können (vgl. Duttge et. al. 2006, 124). 6.3 Das Spannungsfeld von Autonomie, Fremdbestimmung und sozialer Verbundenheit Autonomie wird häufig in Abgrenzung zu Fremdbestimmung behandelt, ohne dabei den einzelnen Menschen in seinem sozialen Kontext zu begreifen. Der Paternalismus in seiner starken und schwachen Version unterscheidet, wie stark ein Mensch in die Entscheidungsautonomie einer anderen Person eingreifen darf beziehungsweise wie viel Autonomie einem Menschen zugestanden werden soll oder wie viel Fremdbestimmung die betreffende Person benötigt. Autonomie und Fremdbestimmung kann es nicht ohne das Eingebundensein der Menschen in ihren jeweiligen sozialen Kontext geben. „Unterschieden werden kann zwischen einem ‚starken‘ Paternalismus, welcher sich auf Entscheidungen für einwilligungsfähige Personen bezieht und einem ‚schwachen‘ Paternalismus, bei dem über das Wohl nicht einwilligungsfähiger Personen entschieden wird“ (Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften 2013). „Charakteristisch für den Paternalismus in allen seinen Varianten ist, daß [sic] die Interessen, in deren Namen er eine Zwangsintervention rechtfertigt, die Interessen des Betroffenen selbst sein müssen“ (Birnbacher 1990, 416). Der starke Paternalismus rechtfertigt das Verhindern eines Suizids, wenn die betroffene Person ihren langfristigen Interessen zuwiderhandelt (vgl. Dorrmann 2009, 134). Birnbacher (1990, 411) nennt die bewusste 60 Entscheidung einer terminal erkrankten Person, das Leben zu beenden bevor die Erkrankung so weit fortgeschritten ist, dass eine freie Willensentscheidung nicht mehr möglich ist beziehungsweise der körperliche Zustand eine Selbsttötungshandlung nicht mehr zulässt, eine Erhebung menschlicher Rationalität und Autonomie über den physischen Verfall der Natur. In diesem Fall ist die körperliche Erkrankung der Auslöser für den Suizidwunsch, nicht aber der Suizidwunsch Auslöser für die Erkrankung. Sowohl in der Gestalttherapie als auch in der Palliative Care steht der starke Paternalismus in Behandlungskonzept. grobem Er ist Widerspruch weder mit der zum ursprünglichen Ich-Du-Haltung in der Gestalttherapie noch mit der zu schützenden, zu fördernden und zu respektierenden Patientenautonomie in der Palliative Care in Vereinbarung zu bringen. Während hier die Selbstbestimmung eines der höchsten Güter darstellt, beansprucht der starke Paternalismus das Wohl der betroffenen Personen besser einschätzen zu können als sie es selbst könnten. Der starke Paternalismus beruht auf der Meinung, dass jeder Mensch, der eine Suizidhandlung begeht, unter einer psychischen Beeinträchtigung leidet. So schreibt Birnbacher (2004, 197), dass gelegentlich die These vertreten werde, dass als Täter jeder Suizident krank wäre und darum für sein Handeln nicht verantwortlich sein könne. Nimmt man diese Sichtweise als gegeben, müsste eine andere befähigte Person für den suizidalen Menschen die Verantwortung übernehmen. Dies hätte für die Helfenden zur Folge, dass sie sich immer in der Verantwortung für die in Behandlung stehenden Menschen sehen müssen und diese Belastung nie an die betroffene Person selbst abgeben oder besser noch bei ihr belassen können. Birnbacher (2004, 198) verweist darauf, dass selbst eine gut gemeinte Zwangsverhinderung die Autonomie der betroffenen Person gravierend einschränkt und deshalb immer bedenklich ist. Selbst dann, wenn eine Suizidhandlung aus subjektiver Sicht als rational und aus objektiver Sicht als irrational erachtet wird, ist ein Eingreifen mit Zwangsmitteln zwar nachvollziehbar aber kaum zu rechtfertigen. Eine Ausnahme muss dann 61 zulässig sein, wenn davon auszugehen ist, dass die suizidale Person die Zwangsverhinderung des Suizids nach kurzer Frist gutheißen wird. Letztere Aussage von Birnbacher beschreibt den schwachen Paternalismus, der davon ausgeht, dass die Einsichtsfähigkeit der betroffenen Person zum Handlungszeitpunkt nicht gegeben ist, so dass für ihr Wohl und gegen ihren derzeitigen Willen durch eine fremde Person entschieden werden muss. Menschen, die mit der Unheilbarkeit ihrer Erkrankung konfrontiert werden, müssen sich mit Verlusten ihrer Zukunft und ihrer Unversehrtheit auseinandersetzen. Pohlmeier (1983, 96) nennt dieses Verlusterlebnis als den häufigsten Anlass für Suizidhandlungen. Dies hat seinen Grund in der Ambivalenz zwischen Leben und Sterben. Möglicherweise sucht die betreffende Person einen Ausweg aus der derzeitigen Situation. Das muss nicht bedeuten, dass sie mit dem Leben abgeschlossen hat (vgl. Pohlmeier 1983, 96). Pohlmeier (1983, 95f) stellt fest, dass in der suizidalen Krise die Ausweglosigkeit als solche erlebt wird und dass andere Auswege nicht gesehen werden, obwohl es sie gäbe. Ein Suizid, der als Problemlösungsverhalten angewendet wird, kann auch ein Versuch zu leben sein. „Nicht selten wirkt der Suizidversuch als kathartisches Ereignis, das zu vorübergehender Beruhigung und Entspannung führt […]“ (Finzen 1997, 85). Einen weiteren Aspekt bringt Walser (2010, 33) ein. Sie verbindet Autonomie als verzweifelte Angst vor Schwäche, Verletzlichkeit und Angewiesenheit auf andere in unserer westlichen Kultur mit Abhängigkeit. Diese Abhängigkeit setzt sie mit Fremdbestimmtheit gleich. Dies wirkt besonders auf Menschen in der verletzlichen Situation einer terminalen Erkrankung beängstigend. Die Vorstellung von Fremdbestimmung lässt Betroffene befürchten, dass Entscheidungen nicht abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen der Erkrankten getroffen werden, sondern möglicherweise nach den Bedürfnissen der anderen. Das aufeinander angewiesen sein beschreibt sie als eine Bedingung des Menschseins, die sich nicht verdrängen lässt. Walser vertritt die Auffassung, dass hinter der Hervorhebung der Bedeutung des Autonomiebegriffs die Absicht steht, die Angst vor der Abhängigkeit zu verbannen. 62 Den oben beschriebenen Prinzipien der Medizinethik von Beauchamp und Childress, die sich vorrangig mit den Fragen beschäftigen was getan oder gelassen werden soll, stellen Heller und Reitinger (2010, 743) die Fragen gegenüber wer jemand ist und wie sie oder er behandelt werden will. Letztere Fragen stellen die angesprochene Person in den Vordergrund und gehen davon aus, dass alles Handeln und jedes Verhalten einer Person immer in Beziehung zu anderen Menschen stattfindet. Sie beschreiben Stärke, Gesundheit, Durchsetzungsfähigkeit, Unabhängigkeit und rationale Orientiertheit als Voraussetzung für autonome Entscheidungen. Dagegen führt die Erfahrung von Schwäche, Krankheit, Verunsicherung und Abhängigkeit bei vielen Menschen dazu, sich wertlos zu fühlen und zu glauben für andere eine Belastung darzustellen. Betroffene fühlen sich aufgefordert, eigene Ansprüche zurückzuhalten und möglicherweise auch bereit zu sein aus dem Leben zu treten, wenn die Last für die anderen spürbar zu groß wird (vgl. Heller und Reitinger 2010, 743). Heimerl und Wegleitner (2010, 690) beschreiben die Sicherung autonomer Entscheidungen, hier durch Patientenverfügungen, als ein Bild der Autarkie statt der Autonomie. Die Selbstbestimmung ist immer auch in einem Beziehungskontext zu sehen. Das widerspricht einer Interpretation, die die Fürsorge und Mitmenschlichkeit vernachlässigt. 6.4 Gesellschaftliche Bewertung von Auslösern suizidaler Handlungen Die unterschiedlichen Anlässe für die Durchführung eines Suizids erfahren unwillkürlich eine gesellschaftliche Bewertung. Ebenso könnte die Bewertung einer suizidalen Person für die gesellschaftliche Akzeptanz eine Rolle spielen. Améry beschreibt (1976, 14) das Beispiel einer Hausgehilfin, die sich aus unerfüllter Liebe zu einem Medienstar aus dem Fenster stürzte. Die gesellschaftliche Bewertung beziehungsweise Assoziation zu einer Hausgehilfin spiegelt sich höchstwahrscheinlich in geringer Bildung der Betroffenen wider. Der Anlass für den Suizid würde vermutlich als 63 unverhältnismäßig eingeschätzt werden. Die Vermutung liegt nahe, dass diese Person nach einer Rettung wieder glücklich werden würde. In ähnlicher Weise findet eine Bewertung der Person und der Situation des vielerorts bekannten deutschen Fußballspielers Robert Enke statt, der 2009 erfolgreich seinen Suizid durchführte. Er war dem Anschein nach ein beruflich sehr erfolgreicher junger Mann mit Familie, der vermeintlich die besten Voraussetzungen gehabt hätte, von seiner Depression, mit der er sich bereits in psychotherapeutischer Behandlung befand, respektive seiner Suizidalität geheilt zu werden. In einem anderen Beispiel beschreibt Amèry (1976, 15) einen Umstand, den wohl die meisten Menschen nachvollziehen können. Ein Schüler von Sigmund Freud erschoss sich in hohem Alter, weil er an einem inoperablen Prostatakrebs litt und zudem seine Lebensgefährtin verloren hatte. Er konnte auf ein erfülltes Leben zurückblicken, aber die Zukunft schien nur noch Schmerz und Einsamkeit zu bringen. Auch Sigmund Freud selbst, der an einem Gaumenkarzinom erkrankt war und dessen Lieblingshund ihn im Endstadium bereits wegen seines üblen Geruches ablehnte, bat seinen Leibarzt darum seinem Leben ein Ende zu setzen. Auch hier scheint ein Common Sense beziehungsweise eine Volkes Meinung zu bestehen, dass Freuds Schüler wie auch Freud selbst sich einerseits diesen Schritt wohl überlegt haben, andererseits der Blick in die Zukunft eines jeden der beiden ein unzumutbares Dasein verheißen hätte. In den Perspektiven, die das Leben nach erfolgreicher Suizidverhinderung vorhält, liegt offensichtlich ein wesentlicher wie auch allgemein nachvollziehbarer Aspekt bezüglich der Bewertung einer suizidalen Situation. In diesem Sinne beschreibt Birnbacher (1990, 416) sowohl die Verpflichtung, einen Suizid aus Liebeskummer bei einem jugendlichen Menschen zu verhindern wie auch die Verpflichtung, einen Suizid bei einer terminal erkrankten Person zuzulassen. Dörner et. al. (2012, 315) heben die bisher getroffenen Betrachtungsweisen auf eine sachliche Ebene. „Sich […] töten […] ist […] die endgültige Art, eine Ausweglosigkeit auszudrücken, ein 64 Lebensproblem zu lösen und daher immer auch eine Lösungsmöglichkeit jeder Krise.“ Pohlmeier (1983, 129) lenkt den Blick zusätzlich auf die Situation, die entsteht, wenn der Erfolg einer Suizidhandlung verhindert wurde und der betroffene Mensch gegen seinen Willen weiter lebt. „Nach dem Wiederaufwachen von Selbstmordpatienten entsteht bei allen die bange Frage wie es weitergehen soll und ob die ganze Mühe wirklich zum Nutzen und Glück des Betroffenen aufgewendet wurde“ (Pohlmeier 1983, 129). Die häufig vertretene These, dass Suizidale immer krank seien und deshalb für ihr Tun keine Verantwortung tragen können und quasi vor ihrem eigenen Tun geschützt werden müssten, benötigt unbedingt eine verfeinerte Betrachtung. Im Besonderen muss differenziert werden zwischen der Betrachtung im klinischen Setting und der in der ambulanten Versorgung (vgl. Birnbacher 2004, 197). „Eindeutige Beispiele für wohlerwogene Suizide sind die von terminal Kranken, die sich der qualvollen Endphase der Krankheit durch Suizid entziehen wollen“ (Birnbacher 2004, 197). In diesem Fall ist zwar die Erkrankung ein Beweggrund für den Selbsttötungswunsch, dieser aber keine Bedingung für einen kranken oder gestörten Willen der betroffenen Personen (vgl. Birnbacher 2004, 197). Eine große Herausforderung besteht unzweifelhaft darin, den freien, unbeeinflussten Willen bei psychisch erkrankten Menschen zu ergründen und sie gleichzeitig nicht in ihrer Autonomie zu begrenzen. Immer stellt sich die Frage, ob es einen absolut uneingeschränkten Willen gibt. Dass es keine allgemeingültige Antwort auf die Frage gibt, ob ein Suizid unbeeinflusst und aus freiem Willen wohl erwogen und durchdacht ist, bestärken Dörner et. al. (2012, 327) mit ihrer Feststellung: „Jede Selbst- oder Fremdtötung hat einen Freiheitsanteil, aber keine ist ganz frei. […] kein Mensch würde freiwillig sich oder andere töten, wenn seine Lebensbedingungen zur Tatzeit ihm gemäß wären.“ 65 7 Ergebnisse und Schlussfolgerungen Die öffentliche Bewertung und Akzeptanz von Suizidhandlungen ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Es gibt Suizidhandlungen, deren Gründe von der Allgemeinheit besser nachvollzogen werden können und die Mitglieder unserer Gesellschaft emotional mehr berühren als andere. Attribute einer suizidalen Person, die größeres Mitgefühl oder Mitleid bei anderen Menschen auslösen sind Jugendlichkeit, Gesundheit und familiäres Eingebundensein. Weniger Mitgefühl lösen Alter, Krankheit und Einsamkeit aus. In den Perspektiven, die ein Leben vorhält, liegt ein wesentlicher Aspekt der Nachvollziehbarkeit und damit der gesellschaftlichen Bewertung. Die Rechtswissenschaft setzt bei allen erwachsenen Menschen zunächst grundsätzlich voraus, dass sie in der Lage sind, Verantwortung für das eigene Tun zu übernehmen. Sie macht Ausnahmen, die jeweils einer besonderen Begründung bedürfen. Eine endogene oder exogene Psychose sowie eine schwere Intelligenzminderung bei einer suizidalen Person werden als Gründe dafür angeführt, dass eine Freiverantwortlichkeit nicht bestehen kann. Die Anzeichen für dieses Nicht-Vorhandensein der freien Willensentscheidung müssen jeweils individuell beurteilt werden. Besteht eine solche Freiverantwortlichkeit, fordert weder das deutsche Zivilrecht noch das Strafrecht die Verhinderung eines Suizids und sieht keine Pönalisierung für die Unterlassung der Verhinderung vor. Die Meinungen zum bilanzierten Suizid in der ethischen Auseinandersetzung sind geteilt. So gehen Eink und Haltenhof (2006, 22) bei einem Bilanzsuizid davon aus, dass der in voller und umfassender Entscheidungsfähigkeit ausgeführt wurde. Auch Peters setzt für den Bilanzsuizid psychische Gesundheit voraus, macht jedoch die Einschränkung, dass die rationale und affektive Freiheit einer solchen Entscheidung bestritten wird. Als Euphemismus beschreibt Völkel den Bilanzsuizid und fürchtet, dass die beschönigende Beschreibung von Autonomie zur Unterlassung weiterer Suizidprävention führen könnte. 66 Der starke Paternalismus, der den Behandelnden die Kompetenz zur Beurteilung der Situation einer suizidalen Person zuspricht und den Betroffenen die freie Entscheidung abspricht, ist nicht vereinbar mit dem Behandlungskonzept der Palliative Care und der Ich-Du-Haltung der Gestalttherapie als Demgegenüber steht ein der humanistisches schwache Psychotherapieverfahren. Paternalismus, der die Handlungskompetenz der Helfenden auf die Situationen begrenzt, in denen ein Mensch nicht in der Lage ist, die Verantwortung für seine Entscheidung und sein Tun zu tragen. Viele Autoren befassen sich mit dem Spannungsfeld zwischen Autonomie und Fürsorge. Heimerl und Wegleitner sehen die Selbstbestimmung in einem permanenten Beziehungskontext, das widerspricht einer Vernachlässigung von Fürsorge und Mitmenschlichkeit. Heller und Reitinger gehen davon aus, dass alles Handeln und jedes Verhalten einer Person immer in Beziehung zu anderen Menschen stattfindet. Es wird jedoch vor der Gefahr gewarnt, dass die gesellschaftliche Einschätzung von lebenswertem Leben sich auf die Kriterien von Leistungsfähigkeit stützt. Walser verweist auf die Angst vor Abhängigkeit, die mit der Hervorhebung des Autonomiebegriffs in den Hintergrund gedrängt wird. Die Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin fordert sowohl das Recht auf Fürsorge und Behandlung wie auch bei Urteilsfähigkeit das Recht, über das eigene Lebensende zu entscheiden. Duttge sieht in der angemessenen Unterstützung für Menschen in Krisensituationen eine gegenseitige Ergänzung von Fürsorge und Autonomie. Die Fürsorge soll nicht die Autonomie ersetzen, sondern den Menschen in seiner Selbstbestimmung unterstützen. Der Autonomiebegriff bei Beauchamp und Childress verlangt die Beachtung der Wünsche, Ziele und Wertvorstellungen der Betroffenen und die Förderung zur Selbstbestimmung ohne manipulative Einflussnahme durch die Behandelnden. 67 In Ergänzung zur ethisch orientierten Literatur, beschäftigen sich die psychotherapeutisch orientierten Quellen mit den Fragen nach den intrapsychischen Hintergründen der Suizidentscheidung. In den herangezogenen Studien und Aussagen von Wedler, Fleming, Chochinov et. al. besteht Einigkeit darin, dass die am häufigsten vorkommenden Anlässe für Suizidabsicht bei terminal erkrankten Menschen Autonomieverlust, schwindende Kontrolle und Depression sind. Bei einem Vergleich der Kriterien für die Diagnosestellung einer Depression nach der International Classification of Diseases wird deutlich, dass die körperlichen Symptome, die bei einer Depression auftreten, denen bei einer terminalen Erkrankung ähneln. Die Lebensmüdigkeit an sich kann bereits Symptom einer Depression sein. Eine klare Abgrenzung wird als schwierig angesehen. Klaschik weist darauf hin, dass eine tiefe Trauer in Anbetracht des bevorstehenden Verlustes von Gesundheit und Leben eine klare Diagnosestellung erschwert. Breitbart, Lehner et. al. heben die professionelle und empathische Unterstützung sowie Kontinuität in der Beziehungsgestaltung hervor, die Psychotherapie einer sterbenskranken Person mit Suizidabsicht anbietet. Mit dem Ziel einer Anpassung an die veränderten Lebensumstände werden im Krankheitsprozess psychoedukativ Kenntnisse über die Erkrankung vermittelt und der Einsatz eigener Ressourcen erarbeitet. Das bevorstehende Ende der Selbstbestimmung und der Verlust der Kontrolle führen zu Entwertung der eigenen Person durch das narzisstische Regulationssystem. Das Selbst der terminal erkrankten Personen erfährt eine narzisstische Kränkung. Henseler formuliert die Suizidhandlung als krisenhaften Versuch, das labile narzisstische Regulationssystem zu retten. Eine klassische Kränkungssituation auf der Seite der Therapierenden beschreibt Kind. Wird die Suizidhandlung einer in Psychotherapie befindlichen Person als Misserfolg gewertet, könnte das auf die zu behandelnde Person Druck ausüben und sie dazu veranlassen die Therapierenden zu schonen. 68 Konsens besteht bezüglich der Quellen darin, dass in der Psychotherapie bei einer Person mit Suizidabsicht Entlastung, die Wiederherstellung von Entscheidungsfreiheit und ebenso die Behandlung von neurotischen und psychotischen Symptomen angestrebt werden. Die Gestalttherapie arbeitet mit dem Thema der Suizidalität nach der Beschreibung von Simkin auf der horizontalen Ich-Du-Ebene. Auf dieser Ebene begegnen sich Therapeutinnen und Therapeuten und Klientinnen und Klienten, um beide etwas über sich zu lernen. Die Basis bildet die Paradoxie der Veränderung nach Beisser. Danach kann Veränderung auf dem Boden der Akzeptanz der aktuellen Situation gelingen. Das Fundament jeder gestalttherapeutischen Begegnung ist der Kontakt. Die Differenzierung in Figur und Grund bedeutet zwischen dem zu unterscheiden, was ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt und dem, was indifferent, eventuell unbewusst, im Hintergrund bleibt. Die Auseinandersetzung mit dem inneren Befinden einer suizidalen Person verbindet Schneider mit zwei Fragen. „Werde ich ernst genommen?“ und „Werde ich angenommen?“ Schneiders Beschreibung von der Ausweglosigkeit, in der sich eine suizidale Person befindet, ist vergleichbar mit der Situation eines terminal erkrankten Menschen. Sie führt erlebte Ohnmacht, verlorene Gestaltungskraft, Einengung durch Verluste, zerstörtes Selbstwertgefühl, Vereinsamung, unterdrückte Wut bis hin zur Flucht in visionäre Leidensfreiheit im Tod an. Schigutt und Schigutt beschreiben die Krise als Situation, in der die gewohnte Versorgung nicht mehr vorhanden und die Fähigkeit, die Existenz aus eigenen Kräften zu bewältigen, noch nicht verfügbar ist. Somit kann die Krise als Wendepunkt einer Entwicklung betrachtet werden und ein Ort der Entscheidung und eines Neuanfangs sein. Die Therapierenden konzentrieren sich nicht vordergründig auf die Suizidverhinderung. Dies würde im gestalttherapeutischen Sinne den Kontakt zu der betroffenen Person unterbrechen oder gar nicht erst zustande kommen lassen. Die therapierende Person würde in der Gegenübertragung 69 arbeiten. Heller nennt es die einfühlende Compathie, die es ermöglicht, aus der Perspektive der Betroffenen her zu denken, zu fühlen und die Versorgung mit ihnen in ihrem Sinne zu entwickeln. Bei den mehr an Palliative Care orientierten Arbeiten wird deutlich, dass alle an der Palliative Care beteiligten Personen mit dem Thema Suizidalität in Kontakt kommen. Der Kontakt kann offen im Gespräch stattfinden oder unbewusst in der Kontaktvermeidung liegen. Es ist notwendig, den terminal Erkrankten einen Gesprächsraum zu eröffnen. Deshalb ist es eine Voraussetzung, dass die an der Versorgung Beteiligten das Thema Suizidalität aus ihrer eigenen Perspektive reflektieren. Borasio zeigt an Beispielen aus seiner Berufspraxis, dass Betroffene ihre Suizidfantasien nicht ansprechen, um einerseits das behandelnde Personal zu schonen und andererseits, um der Gefahr, in ihrer letzten Lebensphase psychiatrisiert zu werden, zu entgehen. Durch ihr Nichtansprechen entgeht ihnen die Chance, mit Hilfe der Behandelnden eine eventuell mögliche Alternative zu entwickeln. Müller-Busch beschreibt das Erkennen und den Umgang mit Suizidalität in der Palliativbetreuung als häufiges Tabuthema. Etzersdorfer appelliert an die Helfenden, Suizidalität in jeder Lebenskrise anzusprechen. Auch Völkel weist darauf hin, dass suizidale Äußerungen aktives Zuhören auslösen müssen. Eink und Haltenhof warnen vor der Allmachtsfalle, die glauben macht, dass die Helfenden mit professioneller Kompetenz eine Suizidhandlung immer verhindern könnten. Auch der Anspruch, Lebensqualität für die Betroffenen bis zum Schluss aufrecht erhalten zu können, setzt sowohl den Professionellen als auch die kranken Menschen, die möglicherweise keine Lebensqualität mehr wahrnehmen, unter Erfolgsdruck. Suizidgedanken in terminalen Erkrankungsstadien sehen Breitbart und Mehnert als letzte Möglichkeit, der Bedrohung und Überwältigung durch die fortschreitende Erkrankung zu entgehen und daher als nicht ungewöhnlich. Auch Klie, Student, Keller et. al. bekräftigen, dass es kaum einen längeren Sterbeprozess ohne Suizidgedanken gibt und dass ein Zusammenhang von 70 Suizidgedanken und schwerer Krankheit besteht, insbesondere nach Mitteilung der Diagnose, wenn eine Verschlimmerung der Krankheit eingetreten ist, entscheidende therapeutische Maßnahmen bevorstehen oder wenn keine mehr möglich sind. Kübler-Ross und Saunders als Pionierinnen der Hospizbewegung machen die Einschränkung, dass für eine Bilanzierung, die zur Entscheidung für einen Suizid führt, die geistige Zurechnungsfähigkeit vorausgesetzt wird. Im Weiteren stellen sie die These auf, dass eine psychische Erkrankung nicht in allen Abstufungen eine frei verantwortliche Entscheidung für einen Suizid verhindert. Sie nennen als Beispiel eine Depression die den Betroffenen viel Zeit einräume. Dies führe zu Wohlüberlegtheit über einen längeren Zeitraum und sei als Zeichen einer verlässlichen Entscheidung zu sehen. Eine freiverantwortliche Entscheidung zum Suizid ist nach Auffassung Borasios angesichts schwerster Erkrankung und begrenzter Lebenserwartung möglich und sollte von den Helfenden respektiert werden. Keller plädiert in unklaren Fällen bei manifester Suizidalität für das Hinzuziehen einer Psychiaterin oder eines Psychiaters. Birnbacher erachtet eine Anwendung von Zwang nur dann als gerechtfertigt, wenn greifbare Hoffnung existiert, die Fähigkeit, ein befriedigendes Leben zu führen, wiederzuerlangen. Die Gesamtschau der gesichteten Literatur zeigt, dass radikale Forderungen und Positionen fehlen. Alle Quellen zeigen eine differenzierte Herangehensweise an das Problem der Autonomie im Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Fürsorge. Duttge und Birnbacher können stellvertretend für die Ergebnisse der vorgelegten Arbeit genannt werden. Das Eingreifen in einen Suizid beziehungsweise das Verhindern eines Suizids um jeden Preis ist nach Duttge et. al. nur dann gerechtfertigt, wenn 71 eine begründete Hoffnung dazu besteht, dass die Ursachen für die Suizidhandlung nach der Rettung behoben werden können. 72 Literaturverzeichnis • Ahrens, Bernd; Freyberger, J. Harald (2002): Mortalität und Suizidalität bei psychischen Störungen. In: Freyberger, J. Harald; Schneider, Wolfgang; Stieglitz, Rolf-Dieter (Hrsg.): Kompendium Psychiatrie Psychotherapie Psychosomatische Medizin. (11. vollständig erneuerte und erweiterte Auflage) Basel: Karger, 420-431. • Améry, Jean (1976): Hand an sich legen. Diskurs über den Freitod. Stuttgart: Klett. • Baltz, Petra (2010): Lebenserhaltung als Haftungsgrund. Berlin: Springer, „MedR Schriftenreihe Medizinrecht“. • Baulig, Volkmar (2001): Psychoanalytische Wurzeln der Gestalttherapie. Psychoanalyse und Gestalttherapie – Analogien, Akzente, Abgrenzungen. In: Fuhr, Reinhard; Sreckovic, Milan; Gremmler-Fuhr, Martina (Hrsg.): Handbuch der Gestalttherapie. (2. unveränderte Auflage) Göttingen: Hogrefe, 245-261. • Beauchamp, Tom L.; Childress, James F. (2009): Principles of Biomedical Ethics. (6th Edition) New York: Oxford University Press. • Beisser, Arnold R. (2005): Wozu brauche ich Flügel. Ein Gestalttherapeut betrachtet sein Leben als Gelähmter. (3. Auflage) Wuppertal: Peter Hammer. • Beyer, Sigrid (2008): Frauen im Sterben. Gender und Palliative Care. Freiburg im Breisgau: Lambertus. • Birnbacher, Dieter (1990): Selbstmord und Selbstmordvorsorge aus ethischer Sicht. Ethische Aspekte der Selbstmordverhütung. In: Leist, Anton (Hrsg.): Um Leben und Tod. Moralische Probleme bei Abtreibung, künstlicher Befruchtung, Euthanasie und Selbstmord. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 395-422. 73 • Birnbacher, Dieter (2004): Suizid und Suizidverhütung – aus Sicht eines Ethikers. In: Wiesing, Urban (Hrsg.): Ethik in der Medizin. Ein Studienbuch. (2. überarbeitete und erweiterte Auflage) Stuttgart: Reclam, 197-199. • Blankertz, Stefan; Doubrawa, Erhard (2005): Lexikon der Gestalttherapie. Wuppertal: Peter Hammer. • Bocian, Bernd (2000): Von der Revision der Freudschen Theorie und Methode zum Entwurf der Gestalttherapie. Grundlegendes zu einem Figur-Hintergrund-Verhältnis. In: Bocian, Bernd; Staemmler, Frank-M. (Hrsg.): Gestalttherapie und Psychoanalyse. BerührungspunkteGrenzen-Verknüpfungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 11-108. • Borasio Gian D. (2012): Über das Sterben. Was wir wissen Was wir tun können Wie wir uns darauf einstellen. (2. Auflage) München: Beck. • Borasio, Gian D.; Fegg, Martin J.; Neudert, Christian et. al. (2005): Personal Values and Individual Quality of Life in Palliative Care Patients. Journal of Pain and Symptom Management 30(2): 154-159. • Bormuth, Matthias; Marckmann, Georg; Wiesing, Urban (2004): Allgemeine Einführung in die medizinische Ethik. In: Wiesing, Urban (Hrsg.): Ethik in der Medizin. Ein Studienbuch. (2. überarbeitete und erweiterte Auflage) Stuttgart: Reclam, 21-35. • Braun, Harald (2012): Palliativversorgung. Das Leiden am Lebensende lindern. Pharmazeutische Zeitung 157(23), 2- 29. • Breitbart, William; Mehnert, Anja (2006): Diagnostik und Behandlung psychischer Störungen in der Palliativmedizin. In: Koch, Uwe; Lang, Klaus; Mehnert, Anja et. al. (Hrsg.): Die Begleitung schwer kranker und sterbender Menschen. Grundlagen und 74 Anwendungshilfen für Berufsgruppen in der Palliativversorgung. Stuttgart: Schattauer, 90-122. • Breitbart, William; Casper, David J.; Passik, Steven D. et. al. (2009): Psychiatric Aspects of Pain Management in Patients with Advanced Cancer and AIDS. In: Breitbart, William; Chochinov, Harvey Max (Hrsg.): Handbook of Psychiatry in Palliative Medicine. (2nd Edition) New York: Oxford University Press, 384-416. • Chochinov, Harvey Max; Lander, Mark; Wilson, Keith G. (2009): Diagnosis and Management of Depression in Palliative Care. In: Breitbart, William; Chochinov, Harvey Max (Hrsg.): Handbook of Psychiatry in Palliative Medicine. (2nd Edition) New York: Oxford University Press, 39-68. • Chochinov, Harvey Max; Clinch, J. J.; Enns, M. et. al. (1995): Desire for death in the terminally ill. American Journal Psychiatry 152(8): 1185-1195. • Cohn, Ruth (1979): zit. in Pfaff, Ilona (2002): Die soziale Kompetenz in der Erlebnispädagogik – Möglichkeiten zur Initiierung selbstorganisierter Lernprozesse mit Hilfe der Erlebnispädagogik. München: GRIN. • Dinslage, Axel (1995): Gestalttherapie. Was sie kann, wie sie wirkt, wem sie hilft. (3. Auflage) Mannheim: PAL Therapieverfahren unserer Zeit. • Dörner, Klaus; Plog, Ursula; Teller, Christine et. al. (2012): Irren ist menschlich. Lehrbuch der Psychiatrie und Psychotherapie (21. Auflage) Bonn: Psychiatrie-Verlag. • Dorrmann, Wolfram (2009): Suizid. Therapeutische Interventionen bei Selbsttötungsabsichten. Stuttgart: Klett-Cotta, Band 74 der Reihe „Leben Lernen“, 6. aktuaslisierte Auflage. 75 • Dorsch Psychologisches Wörterbuch (2009): Häcker Hartmut O.; Stapf,. Kurt-H. (Hrsg.). (15. überarbeitete und erweiterte Auflage) Bern: Hans Huber. • Doubrawa, Erhard Die (2003): Seele berühren. Erzählte Gestalttherapie. (2. Aufl.) Wuppertal: Peter Hammer. • Dreitzel, Hans Peter (2004): Gestalt und Prozess. Eine psychotherapeutische Diagnostik oder: Der gesunde Mensch hat wenig Charakter. Bergisch Gladbach: Edition Humanistische Psychologie. • Duttge, Gunnar; Müller-Busch, Hans Christof; Simon, Alfred (2006): Suizid in palliativer Betreuung. Zeitschrift für Palliativmedizin 7(4), 123-127. • Eink, Michael; Haltenhof, Horst (2012): Basiswissen: Umgang mit suizidgefährdeten Menschen. Bonn: Psychiatrie-Verlag. • Etzersdorfer, Elmar; Wolfersdorf, Manfred (2011): Suizid und Suizidprävention. Stuttgart: W. Kohlhammer. • Etzersdorfer, Elmar (2012): Über das Gespräch mit suizidalen Menschen, über den Common Sense, Hindernisse und Fallstricke. Suizidprophylaxe 39(4), 130-138. • Fann, J. R.; Misono, S.; Redman, M. et. al. (2008): Incidence of Suicide in persons with cancer. Journal of Clinical Oncology 26(29): 4731-4738. • Finzen, Asmus (1997): Suizidprophylaxe bei psychischen Störungen. Bonn: Psychiatrie-Verlag. • Fleming, David W.; Hedberg, Katrina; Sullivan, Amy D. (2000): Legalized Physician-Assisted Suicide in Oregon – The Second Year. The New England Journal of Medicine 342: 598-604. 76 • Gremmler-Fuhr, Martina (2001): Grundkonzepte und Modelle der Gestalttherapie. Kontaktfunktionen. In: Fuhr, Reinhard; Sreckovic, Milan; Gremmler-Fuhr, Martina (Hrsg.): Handbuch der Gestalttherapie. (2. unveränderte Auflage) Göttingen: Hogrefe, 345392. • Gropp, W. (1996): Zur Freiverantwortlichkeit des Suizids aus juristisch-strafrechtlicher Sicht. In: Pohlmeier, Hermann, Schöch, Heinz; Venzlaff, Ulrich (Hrsg.): Suizid zwischen Medizin und Recht. Stuttgart: G. Fischer, 13-31. • Haltenhof, Horst (2004): Suizidalität. In: Bauer, Manfred; Lamprecht, Friedhelm; Machleidt, Psychosomatik und Wielant et. al. Psychotherapie. (7. (Hrsg.): Psychiatrie, aktualisierte Auflage) Stuttgart: Georg Thieme. • Hartmann, Hans-Peter (2006): Narzisstische Persönlichkeitsstörungen – ein Überblick. In: Hartmann, Hans-Peter; Kernberg, Otto F. (Hrsg.): Narzissmus. Grundlagen - Störungsbilder Therapie. Stuttgart: Schattauer, 3-36. • Hartmann-Kottek (2008): Gestalttherapie. (2. aktualisierte und erweiterte Auflage) Berlin: Springer. • Heller, Andreas (2007): Die Einmaligkeit von Menschen verstehen und bis zuletzt bedienen. Palliative Versorgung und ihre Prinzipien. In: Heimerl, Katharina; Heller, Andreas; Husebo, Stein (Hrsg.): Wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun. Wie alte Menschen würdig sterben können. (3. aktualisierte und erweiterte Auflage) Freiburg im Breisgau: Lambertus, 191-208. • Heller, Andreas; Reitinger, Elisabeth (2010): Ethik im Sorgebereich der Altenhilfe. Care-Beziehungen Verständigungsarrangements und in organisationsethischen Entscheidungsstrukturen. In: Heller, Andreas; Krobath, Thomas (Hrsg.): Ethik organisieren. 77 Handbuch der Organisationsethik. Freiburg im Breisgau: Lamberus, 737-765. • Heller, Birgit (2007): Spirituelle Begleitung in der palliativen Betreuung. In: Knipping, Cornelia (Hrsg.): Lehrbuch Palliative Care. (2. durchgesehene und korrigierte Auflage) Bern: Hans Huber, 432437. • Henseler, Heinz (2000): Narzisstische Krisen. Zur Psychodynamik des Selbstmords. (4. aktualisierte Auflage) Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. • Hömmen, Christa (1989): Mal sehen, ob ihr mich vermißt [sic]. Menschen in Lebensgefahr. Reinbek: Rowohlt. • Hutterer-Krisch, Renate (2001): Zur Krisenintervention im psychiatrischen Bereich. Einschätzung der Suizidalität. In: Fuhr, Reinhard; Sreckovic, Milan; Gremmler-Fuhr, Martina (Hrsg.): Handbuch der Gestalttherapie. (2. unveränderte Auflage) Göttingen: Hogrefe, 839-856. • Jaeggi, Eva (1997): Zu heilen die zerstoßnen Herzen. Die Hauptrichtungen der Psychotherapie und ihre Menschenbilder. Reinbek: Rowohlt. • Keller, Monika (2011): Depression. In: Aulbert, Eberhard; Nauck, Friedemann; Radbruch, Lukas (Hrsg.): Lehrbuch der Palliativmedizin. (3. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage) Stuttgart: Schattauer, 1077-1095. • Kind, Jürgen (2005): Suizidal. Die Psychoökonomie einer Suche. (4. Auflage) Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. • Klaschik, Eberhard (2010): Palliativmedizin Praxis. Leitfaden für die palliativ-medizinische Alltagsarbeit. Bonn: Pallia Med. 78 • Klie, Thomas; Student, Johann-Christoph (2007): Sterben in Würde. Auswege aus dem Dilemma Sterbehilfe. Freiburg im Breisgau: Herder. • Kübler-Ross, Elisabeth (1982): Was können wir noch tun? Antworten auf Fragen nach Sterben und Tod. (2. Auflage) Gütersloh: Mohn. • Küchenhoff, Joachim (2012): Psychose. Gießen: PsychosozialVerlag, Band 5 der Reihe „Analyse der Psyche und Psychotherapie“. • Lehner, Erich (2011): Psychotherapie mit Schwerkranken und Sterbenden im Rahmen von Palliative Care. Psychotherapie Wissenschaft 1(3), 169-176. • Leitmeier, Walter (2010): Kompetenzen fördern. Gestalttherapeutisches Lehrertraining für Religionslehrer. Berlin: LIT. • Monteverde, Settimio (2007): Ethik und Palliative Care. Das Gute als Handlungsorientierung. In: Knipping, Cornelia (Hrsg.): Lehrbuch Palliative Care. (2. durchgesehene und korrigierte Auflage) Bern: Hans Huber, Hogrefe, 520-535. • Meyer, Elisabeth; Meyer, Fritz; Meyer, Thomas (2012): Suizidalität. Ein hausärztlicher Notfall. Der Allgemeinarzt 34(16), 18-23. • Mühlum, Albert; Student, Johann-Christoph; Student, Ute (2007): Soziale Arbeit in Hospiz und Palliative Care. (2. Auflage) München: Reinhardt. • Müller-Busch, Hans C. (2007): Vom Umgang mit Angst und Depressionen in der Palliativbetreuung. In: Knipping, Cornelia (Hrsg.): Lehrbuch Palliative Care. (2. durchgesehene und korrigierte Auflage) Bern: Hans Huber, Hogrefe, 307-315. 79 • Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin (2005): Beihilfe zum Suizid. Stellungnahme Nr. 9/2005. Bern: Bundesamt für Gesundheit. • Otto, Harro Strafrechtslehre. (2004): (7. Grundkurs Auflage) Strafrecht. Berlin: Allgemeine De Gruyter Rechtswissenschaften. • Perls, Fritz (1976): zit. nach Stiehler, Matthias; Stiehler, Sabine (2002): Ich bin Ich und Du bist Du. Symbiose, Autonomie und Bezogenheit in Zweierbeziehungen. Beratung Aktuell 3(4), 196-208. • Peters, Uwe H. (1999): Psychiatrie Psychotherapie Medizinische Psychologie. (5. Auflage) München: Urban & Fischer. • Pohlmeier, Herrmann (1983): Selbstmord und Selbstmordverhütung. (2. neubearbeitete und erweiterte Auflage) Wien: Urban und Schwarzenberg. • Rose, Olaf; Waltering, Isabell (2012): Fallbasiertes Medikationsmanagement und Arzneimitteltherapie – Sicherheit am Beispiel von Psychopharmaka. Unveröffentlichtes Unterrichtsmaterial des 50. Internationalen Fortbildungskurses für praktische und wissenschaftliche Pharmazie der Bundesapothekerkammer. Meran. • Rosenau, Henning; Schreiber, Hans-Ludwig (2009): Rechtliche Grundlagen der psychiatrischen Begutachtung. In: Dreßing, Harald; Foerster, Klaus (Hrsg.): Psychiatrische Begutachtung. Ein praktisches Handbuch für Ärzte und Juristen. (5. Auflage) München: Elsevier, 77152. • Rudolf, Gerd (2008): Die Struktur der Persönlichkeit. In: Henningsen, Peter; Rudolf, Gerd (Hrsg.): Psychotherapeutische Medizin. Ein einführendes Lehrbuch auf psychodynamischer Grundlage. (6. neu bearbeitete Auflage) Stuttgart: Georg Thieme, 55-72. 80 • Saunders, Cicily (1993): Hospiz und Begleitung im Schmerz. Wie wir sinnlose Apparatemedizin und einsames Sterben vermeiden können. (4. Auflage) Freiburg im Breisgau: Herder. • Schigutt, Schigutt (o. O.; o. J.) (unveröffentlichtes Manuskript) zit. nach Hutterer-Krisch, Renate (2001): Zur Krisenintervention im psychiatrischen Bereich. Einschätzung der Suizidalität. In: Fuhr, Reinhard; Sreckovic, Milan; Gremmler-Fuhr, Martina (Hrsg.): Handbuch der Gestalttherapie. (2. unveränderte Auflage) Göttingen: Hogrefe, 839-856. • Schneider, Kristine (1990): Grenzerlebnisse. Zur Praxis der Gestalttherapie. Köln: Edition Humanistische Psychologie. • Schreiber, Hans-Ludwig: In: Boor, Wolfgang de; Kammeier, Heinz; Rode, Irmgard A. (Hrsg.) (2003): Der Krankheitsbegriff und seine strafrechtlichen Folgen. Neue Diskussionen um die „schwere andere seelische Abartigkeit“, § 20 StGB. Köln: LIT, Band 24 der Reihe „Schriftenreihe des Instituts für Konfliktforschung“. • Simkin, James S. (2000): Gestalttherapie. Minilektion für Einzelne und Gruppen. (2. Auflage) Wuppertal: Peter Hammer. • Spiegel-Rösing, Ina (1992): Ziele psycho-sozialer Intervention beim Sterbenden. In: Petzold, Hilarion; Rösing Ina (Hrsg.): Die Begleitung Sterbender. Theorie und Praxis der Tanathotherapie. Paderborn: Jungfermann, 141-182. • Stiefel Friedrich; Voltz, Raymond (2007): Psychiatrische Symptome. In: Bausewein, Claudia; Roller, Susanne; Voltz, Raymond (Hrsg.): Leitfaden Palliativmedizin – Palliative Care. München: Elsevier, 486519. • Völkel, Manuela (2012): Suizidalität im Alter – Prävention durch Salutogenese. In: Heimerl, Katharina; Heller, Andreas; Wegleitner, 81 Klaus (Hrsg.): Zu Hause sterben – der Tod hält sich nicht an Dienstpläne. Ludwigsburg: der hospiz verlag, 264-273. • Walser, Angelika (2010): Autonomie und Angewiesenheit: ethische Fragen einer relationalen Anthropologie. In: Beyer, Sigrid; Reitinger, Elisabeth (Hrsg.): Geschlechtersensible Hospiz- und Palliativkultur in der Altenhilfe. Frankfurt am Main: Mabuse, 33-43. • Wedler, Hans (2001): Umgang mit Suizidalität und Sterbewünschen im Alter1. Suizidprophylaxe 28(4), 165-171. • Wolfslast, Gabriele (1985): Psychotherapie in den Grenzen des Rechts. Stuttgart: Enke. Internetquellen/Websites: • Bundesmisnisterium der Justiz (2013): §20 Strafgesetzbuch. Verfügbar auf: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__20.html [Website besucht am 15.04.2013] • Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften (2013): Medizinischer Paternalismus. Verfügbar auf: http://www.drze.de/im-blickpunkt/patientenverfuegungen/module/ medizinischer-paternalismus [Website besucht am 21.02.2013]. • Krollner, Björn; Krollner, Dirk (2013): ICD und OPS Code Suche. Verfügbar auf: http://www.icd-code.de/icd/code/F32.1.html [Website besucht am 21.02.2013]. • Krollner, Björn; Krollner, Dirk (2013): ICD und OPS Code Suche. Verfügbar auf: http://www.icd-code.de/icd/code/F32.2.html [Website besucht am 23.03.2013]. 82 • Krollner, Björn; Krollner, Dirk (2013): ICD und OPS Code Suche. Verfügbar auf: http://www.icd-code.de/icd/code/F60.0.html [Website besucht am 12.03.2013]. • Krollner, Björn; Krollner, Dirk (2013): ICD und OPS Code Suche. Verfügbar auf: http://www.icd-code.de/icd/code/F70-F79.html [Website besucht am 21.02.2013]. • Meise, Ulrich; Sulzenbacher, Hubert (2006): Präsuizidale Entwicklung. Verfügbar auf: http://www.buendnis-depression.at/ Praesuizidale-Entwicklung.210.0.html [Website besucht am 06.02.2013]. • Plein, Sabine (2003): Hausarbeit: Welche Rolle spielt das narzißtische Regulationssystem in der Psychodynamik von Suizidimpulsen? Verfügbar auf: http://www.grin.com/de/ebook/108279/welche-rolle-spielt-das-narzisstische-regulationssystemin-der-psychodynamik [Website besucht am 11.03.2013]. • World Health Organization (2013): WHO Definition of Palliative Care. Verfügbar auf: http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ [Website besucht am 21.02.2013]. 83 Ehrenwörtliche Erklärung Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende wissenschaftliche Arbeit „Psychotherapie und Suizid“ selbstständig angefertigt und die mit ihr unmittelbar verbundenen Tätigkeiten selbst erbracht habe. Ich erkläre weiter, dass ich keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Alle aus gedruckten, ungedruckten oder dem Internet im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt übernommenen Formulierungen und Konzepte sind gemäß den Regeln für wissenschaftliche Arbeiten zitiert und durch Fußnoten bzw. durch andere genaue Quellenangaben gekennzeichnet. Die während des Arbeitsvorganges gewährte Unterstützung einschließlich signifikanter Betreuungshinweise ist vollständig angegeben. Die wissenschaftliche Arbeit ist noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt worden. Diese Arbeit wurde in gedruckter und elektronischer Form abgegeben. Ich bestätige, dass der Inhalt der digitalen Version vollständig mit dem der gedruckten Version übereinstimmt. Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird. Unterschrift Ort, Datum 84