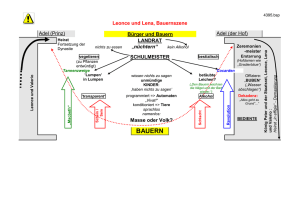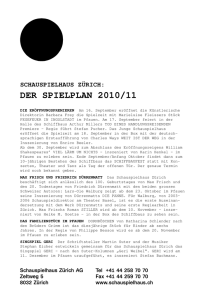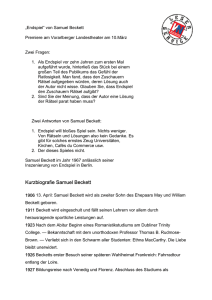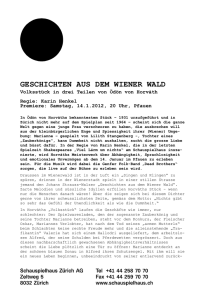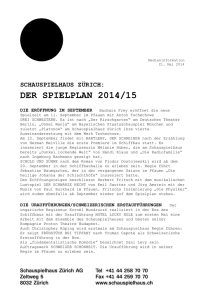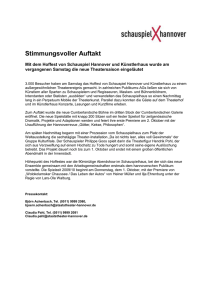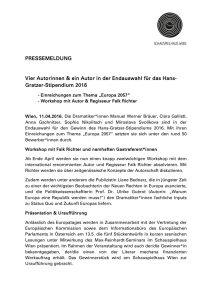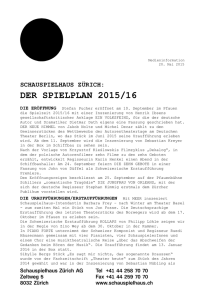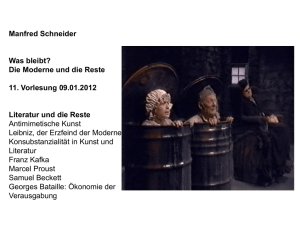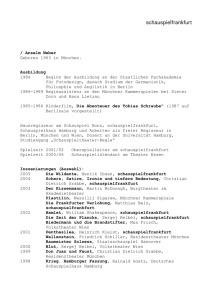Schauspielhaus Zürich Zeitung #3
Werbung

1 Schauspielhaus Zürich Zeitung #3 2 3 Vorwort Herbstzeitlose Der Herbst ist da und man nimmt das eine oder andere Bändchen mit Herbstlyrik zur Hand, um mit kühleren Temperaturen und schattigeren Tagen besser umgehen zu können. Eine Art jahreszeitliche Entgleisung in Gedichtform stammt von der Aargauer Lyrikerin Mary Stirnemann-Zysset, die in ihren unfreiwillig komischen Erzeugnissen eine ganz eigene Welt erschaffen hat. Eine Welt des „Reim-Zwangs“ – bis zur Absurdität. Man könnte Stirnemann-Zysset durchaus als Florence Foster Jenkins der Poesie bezeichnen. Ihr Buch „Sonnenschein ins tägliche Leben“ erschien 1936 in Aarau im „Eigenverlag der Verfasserin“ und wurde eifrig erworben. Peter von Matt hat erfreulicherweise zwei ihrer Gedichte in seine wunderbare Sammlung „Die schönsten Gedichte der Schweiz“ aufgenommen und damit auf ihre besondere Bedeutung hingewiesen. Nach Aussage meiner Verwandten, die Stirnemann-Zysset in Aarau noch gekannt haben, wurde sie öfter mit auffallender Kleidung und grossem Hut gesehen, ganz versunken in ihren Kosmos. Hier eine Kostprobe ihrer unvergleichlichen Kunst: Inhalt 4 Wilhelm Genazino über Büchner, Beckett und die Langeweile – „Leonce und Lena“ und „Endspiel“ im Pfauen 8 Drei Bühnenbilder zur Saisoneröffnung – Bettina Meyer im Porträt 13 Das perfekte Stück – Werner Düggelin und Stefan Pucher über Becketts „Endspiel“ 16 Herbert Meier über Thomas Jonigk und dessen neues Stück „Weiter träumen“ – ab 22.10. im Pfauen 19 Mit dem Regisseur Christian Stückl durch Oberammergau – „Merlin“ ab 26.11. im Schiffbau/Halle 21 So köstlich war es nie – Kinder kochen nach Wilhelm Hauff – „Zwerg Nase“ ab 19.11. im Pfauen 24 Schon immer Schauspieler – Patrick Güldenberg spielt Werner Schwab im Schiffbau/Box 26 Wald in Farbe – Schicht mit Malsaal-Chef Thomas Unseld 28 Büchner hören und sehen – Ins Theater mit Katharina Epprecht 29 Mörderisches Zürich – Kolumne von Lukas Bärfuss Herbstzeitlose Als letzter floristischer Wiesenschmuck, Erscheint im Herbst die Herbstzeitlose, Mit ihr ist es zwar so eine Chose, Jedem Tier sie verursacht einen Ruck. Auch der Landwirt verspürt so einen Druck, Ausrotten möchte er sie erbarmungslose, Doch ein so grosses Feld ist hoffnungslose, Nur nicht das Messer in der Tasche zuck‘. In der Sprache der Liebenden bedeute Die Zeitlose Erinnerung an glückliche Tage, Auf einen strengen Winter sie deute: Wenn tief in die Erde die Knolle sich wage, Aus dem Gift der Pharmazeute Erleichtere Gicht- und Rheuma-Plage. Auf in den Herbst! Wir freuen uns auf Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihre Barbara Frey Titel Jirka Zett als Leonce und Markus Scheumann als Valerio in „Leonce und Lena“ Rücktitel Nicolas Rosat und Patrick Güldenberg in „Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos“ 4 5 Essay Es genügt, das Gras anzustarren Über Büchner, Beckett und die Langeweile, aus Anlass der Neuinszenierungen von „Leonce und Lena“ und „Endspiel“ im Pfauen von Wilhelm Genazino Die Langeweile stört uns dann am meisten, wenn wir sie nicht brauchen können. Wir arbeiten, wir verhandeln, wir boxen uns durch, wir streiten und plötzlich trifft uns der Pfeil der „richtungslosen Zeit“ (Simone Weil): die Langeweile. Was uns eben noch angetrieben hat, verlässt uns im Handumdrehen. Wir bleiben zurück wie die Totenmaske unserer Interessen. Wir schauen uns um, wir brauchen sofort eine Anregung; wir hoffen, niemand möge unsere Geistesverlassenheit bemerken. Im Grunde ist Langeweile nur ein anderes Wort für Zwiespältigkeit. Martin Heidegger nannte sie einen „schweigenden Nebel“, der das „Seiende im Ganzen offenbart“ – was immer das heissen mag. Siegfried Kracauer bekannte sich mutiger und deutlicher zur Langeweile: „Ist man aber vorhanden, so muss man sich notgedrungen über das abstrakte Getöse ringsum langweilen, das nicht duldet, dass man existiere, und über sich selber, dass man in ihm existiert“. „Irgendetwas geht seinen Gang“: Robert Hunger-Bühler und Jean-Pierre Cornu in „Endspiel“ Für die Dauer einer als zu lang empfundenen Zeitphase konfrontiert uns die Langeweile mit unfreundlichen Selbstvorwürfen. Wenn du eine andere Frau (einen anderen Mann) geheiratet hättest, wären deine Sinnabstürze ausgeblieben. Wenn du einen anderen Beruf gewählt hättest, müsstest du nicht über die Ödnis deiner Tage klagen. Die Langeweile ist ausserdem niederträchtig, weil sie uns in der Krise nicht sagt, wo der Notausgang ist. Wer sich langweilt, ist antriebslos und hat keine Ideen, noch nicht einmal langweilige. Langeweile ist ironiefrei und bierernst und so traurig wie eine Tankstelle nachts um halb vier. Glück haben wir schon, wenn wir uns als Gelangweilte inmitten einer grösseren Menschenmenge befinden. Man wartet mit vielen anderen auf einen Abflug, auf eine Durchfahrt, auf einen Ober. In der schier uferlosen Wiederholung des Wirklichen haben wir plötzlich Interesse für das Belanglose. Das Belanglose ist das Zeichen für unsere Ankunft in der Langeweile. Eine Frau zieht ihren rechten Stöckelschuh aus und stellt ihn auf den Tisch. Auch die Frau langweilt sich und entgrenzt sich gerade. Der Stöckelschuh steht zwischen einer Tasse Kaffee und einem halb aufgegessenen Stück Streuselkuchen. Die Frau legt ihr nacktes Bein in den Schoss ihres Mannes. Der Mann beginnt, seinen gestreckten Zeigefinger in den Zwischenräumen der Zehen der Frau hin- und herzuschieben. Die Langeweile wird philosophisch, weil sie drei Dutzend Menschen zwingt, noch einmal und noch einmal hinzuschauen. Dabei werden die Zuschauer auf stille Weise mit ihrer Deplaciertheit vertraut, die sie jetzt nicht mehr Langeweile nennen würden. Heute Abend, wenn sie in anderen Ländern angekommen sind, werden sie von dieser Szene erzählen, als hätten sie grosses Theater erlebt. Vielleicht war es das tatsächlich. Unter den Zuschauern befindet sich ein junges Liebespaar. Sie sind beide um die zwanzig. Sie sitzen nebeneinander, beide haben eine offene Flasche Bier in der Hand. In kurzen Abständen küssen sich die Liebenden, in den Intervallen dazwischen trinken sie Bier. In den Gesichtern der älteren Wartenden zeigt sich Abscheu. Ich vermute, die Liebenden bemerken gerade (vielleicht zum ersten Mal), dass auch Liebe Langeweile hervorbringt. Diese fürchterliche Entdeckung beantworten sie mit viel Gekicher und Herumhampeln mit den Flaschen. Man kann das Paar mit Leonce und Lena vergleichen. Natürlich mit einem wichtigen Unterschied: Leonce und Lena stellen ihre Welt mit einem eigenen Sprachaufwand dar. Leonce und Lena erfinden ihre Gegenwart, indem sie miteinander sprechen. Eben dieser Sprachreichtum macht sie besonders, ja einzigartig. Die Sätze von Leonce und Lena beschreiben sogar das Bier trinkende Paar. Zum Beispiel sagt Leonce im 1. Akt: „Was die Leute nicht alles aus Langeweile treiben! Sie studieren aus Langeweile, sie beten aus Langeweile, sie verlieben, verheiraten und vermehren sich aus Langeweile.“ Man kann ruhig hinzufügen: Sie trinken aus Langeweile. Weil Leonce und Lena miteinander sprechen können, zeigen sie den Unterschied zwischen einer integrierten, sozusagen humanisierten Langeweile und einer bloss erlittenen, modernen Langeweile, die sich einem zufälligen Zeitstau verdankt. Das heutige, moderne Liebespaar kommuniziert fast nonverbal (man trinkt, kichert, küsst, begrabscht sich und ist ein bisschen ordinär) und nimmt damit teil an Massenunterhaltungen, die nicht zufällig sprachlos angelegt sind. Leonce und Lena dagegen sind sich der Zumutung ihrer Existenz bewusst. Im 1. Akt sagt Lena: „Mein Gott, mein Gott, ist es denn wahr, dass wir uns selbst erlösen müssen mit unserem Schmerz?“ An einem solchen Satz erkennen wir, wie fern uns heute die Selbsterlösung liegt und wie nötig sie uns plötzlich scheint. An die Utopie der individuellen Befreiung durch eine eigene Sprachanstrengung rührt Büchners Stück. Momentweise haben wir den Eindruck, „Leonce und Lena“ ist nicht für Büchners Zeit, sondern für unsere Gegenwart geschrieben. „Leonce und Lena“ ist ein Traumspiel, das uns die Angst vor der Langeweile nehmen möchte. Denn das Trauma der endlos wuchernden Langeweile ist nichts anderes als die Angst vor einer überraschend eintretenden Spracharmut. Nur wer seine Trauer ausdrücken kann, ist ihr gewachsen. Und: Nur eine ausgedrückte Trauer ist eine annehmbare Trauer. Leonce und Lena können sagen, was ihnen fehlt und sie können deswegen auch sagen, was der Welt fehlt, damit wir uns endlich mit ihr abfinden können. Der Schmerz, der sich ungefragt im Sprachmangel mitteilt, ist die treibende Kraft in Büchners Lustspiel. Aber man muss davon ausgehen, dass die grosse Mehrheit der Menschen mit der Langeweile ihren Frieden gemacht hat. Wie gross wäre die Panik, wenn wir plötzlich entdeckten, dass unser Leben spannend und bereichernd sein kann wie das Leben von Leonce und Lena. Darin zeigt sich ein schwer zu verstehendes Paradox: Nur in einer auf persönliche Bedürfnisse zurechtgestutzten Langeweile kann der Mensch die Rätsel der Normalität unbedrängt studieren und schliesslich annehmen. So ähnlich, wie 6 7 es Beckett oft beschrieben hat. Beckett leistet ein Übriges: Seine Figuren, gezeichnet durch irdische Auszehrung und Monotonie, erleben fast alle ihre gloriose Wiederaufrichtung, sei es als Gespenst, Clown oder Landstreicher. Dabei kommt bei Beckett das Wort Langeweile nicht vor. Becketts Worte für Langeweile sind: Trauer, Einsamkeit, Ratlosigkeit, Leere, Scheitern, Stille, Zusammenbruch und – das Schönste von allen – Endseufzer. Beckett hat oft vorgeführt, mit welchen Miniaturhandlungen seine Figuren aus der nicht genannten Langeweile wieder herausfinden. Das klingt zum Beispiel so: „Es genügt, das Gras anzustarren. Wie es regungslos hängt. Bis zu dem Moment, da unterm unerbittlichen Blick es zu zittern beginnt. Ein kaum sichtbares Zittern aus seinem tiefsten Innern. Desgleichen das Haar. Regungslos gesträubt, erzittert es schliesslich unter dem beinahe aufgebenden Auge …“. In „Endspiel“ fragt Hamm: „Was ist denn los, was ist denn eigentlich los?“ Und Clov antwortet überwältigend wissendunwissend: „Irgendetwas geht seinen Gang.“ Genauso ist es: Irgendetwas geht seinen Gang – und wir merken es nicht. Zum Beispiel erleiden Menschen Verwandlungen, die so fundamental sind, dass es für sie keine Worte zu geben scheint. Man kann auch sagen: Wer nicht aufhören kann, die Welt ernst zu nehmen, wird komisch werden müssen. Praktisch sieht das so aus, dass die Zuschauer hinter dem Rücken von Hamm und Clov (ebenso hinter dem Rücken von Nagg und Nell) über deren ernstes Gehabe zu lachen anfangen. Es ist (nach Becketts Einsprüchen) nicht leicht zu verstehen, warum Langeweile immer noch verpönt ist. Im Grunde müsste sie uns willkommen sein. Sie bringt endlich das, wonach wir so oft verlangen: eine Unterbrechung der Lebensraserei. „Was die Leute nicht alles aus Langeweile treiben!“: Sarah Hostettler und Ursula Doll in „Leonce und Lena“ Man muss daran erinnern, dass Becketts Stücke zu seinen Lebzeiten durchweg ohne Augenzwinkern präsentiert worden sind. Er selbst hat „Warten auf Godot“ 1975 in Berlin todernst inszeniert. Todernst heisst: unter Einschluss von Langeweile. Erst die wiederholte Begegnung mit den Stücken hat deren komische Abgründe offen gelegt – wobei ich diesen Satz nur mit Weh und Ach niederschreibe. Es kann auch sein, dass der nicht nachlassende Druck des Kulturklimas der Nachkriegszeit die Komik erzwungen hat – und wir haben es wieder nicht bemerkt. Aber vielleicht ist die allgemeine Lesart auch wahr und wirklich. Dann ist die ewige Wiederkehr der Langeweile so komisch wie (zum Beispiel) die ewige Wiederkehr unserer Geburtstage. Nur Kinder können, weil sie noch nicht viele Geburtstage erlebt haben, deren Ernst ungeschmälert erleben. Dann aber steigert sich deren Komik (die Langeweile), andererseits nähert sich mit der Anzahl der Geburtstage das Ende des Lebens. Deswegen steckt in jeder Langeweile eine kleine Anzahlung an den Tod; vermutlich ahnen wir das, und vermutlich ist Langeweile deswegen so wenig gelitten. Becketts Herangehensweise besteht darin, dass er beide Optiken, die lächerliche und die ernste, auf halsbrecherische Weise miteinander in Einklang bringt. Man ist versucht zu sagen, bei Beckett harmonisieren die Schrecken. Nur wer den Ausweg der Komik kennt, kann den Ernst ertragen, und nur wer den Ernst erleidet, muss die Komik nicht verdächtigen. Für die immer wieder aufkommende Frage, ob Beckett ein philosophischer, ein realistischer oder ein transzendentaler Autor ist, gibt es in „Endspiel“ einen deutlichen Hinweis. Ausgerechnet der schwerfällige Hamm, der das ganze Stück über seinen Sessel nicht verlässt, ruft einmal „schwungvoll“ aus: „Lass uns beide abhauen, nach Süden! Übers Meer … die Strömungen werden uns forttreiben, weit weg … Mach mir sofort das Floss. Morgen bin ich schon weit weg!“ Aber dann, nur wenig später, hat Hamm das Meer wieder vergessen und fragt seinen Kumpan Clov: „Muss ich noch immer nicht meine Pillen einnehmen?“ Fortan ist vom Meer nicht mehr die Rede. Was ist nun die Realität? Das Meer, das wir wieder vergessen oder die Pillen, die wir schlucken müssen? Die Frage bleibt unentschieden. Bei Beckett fasziniert der hohe Grad der Abstraktion und der gleichzeitig mitlaufende Realismus. Insofern beherrscht uns die metaphysische Achterbahn: Wir sehnen uns nach dem Meer, aber wir schlucken unsere Pillen. Der Autor Wilhelm Genazino wurde 1943 in Mannheim geboren und lebt seit 1970 als freier Schriftsteller in Frankfurt am Main. Sein 20 Romane umfassendes Werk wurde vielfach ausgezeichnet, 2007 erhielt er den Kleist-Preis, 2004 den Georg-Büchner-Preis (seine Dankesrede „Der Untrost und die Untröstlichkeit der Literatur“ ist in den Jahrbüchern der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung im Wallstein Verlag erschienen). Seine aktuelle Roman-Veröffentlichung „Wenn wir Tiere wären“ (Hanser Verlag, München 2011) wurde für den Deutschen Buchpreis nominiert. Genazino erzählt darin ironisch, witzig und böse von einem Mann, der den Alltag nur ertragen kann, indem er das ordentliche Regelwerk durchbricht. Neu im Pfauen Leonce und Lena von Georg Büchner Regie Barbara Frey, Bühne Bettina Meyer, Kostüme Bettina Walter Mit Jan Bluthardt, Ursula Doll, Sarah Hostettler, Sean McDonagh, Michael Neuenschwander, Markus Scheumann, Lilith Stangenberg, Jirka Zett und dem Musiker Claus Boesser-Ferrari Endspiel von Samuel Beckett Regie Stefan Pucher, Bühne Barbara Ehnes, Kostüme Marysol del Castillo, Musik Christopher Uhe, Video Stephan Komitsch Mit Jean-Pierre Cornu, Iris Erdmann, Robert Hunger-Bühler, Siggi Schwientek 8 9 Werkporträt Ohne Skizzen Über die Bühnenbildnerin und Ausstattungsleiterin Bettina Meyer, die sich zu Saisonbeginn mit drei neuen Arbeiten präsentiert von Andrea Schwieter Was für eine Verlockung zur SaisonEröffnung im Pfauen: Nüsse, Tee und Kaffee in diversen Sorten, Dörrfrüchte und Süsswaren soweit das Auge reicht ... Die Schaufensterfassade des stadtbekannten und traditionsreichen Kolonialwarengeschäftes Schwarzenbach war unverkennbares Vorbild für Bettina Meyers Bühnenbild von „Leonce und Lena“ in der Regie von Barbara Frey. Eine altmodisch von Hand beschriftete Tafel lehnt am Rahmen der Eingangstür – und erst auf den zweiten Blick enttarnt sie sich als trompe l’oeil, als gemaltes Detail eines scheinbar realistischen Geschäftes. Überhaupt der zweite Blick: Ist nicht auch die Hausnummer erstaunlich gross geraten? Die Eingangstür riesenhaft? Als sich das Schwarzenbach mittels Videoprojektion der Schaufenster auf nahezu magische Weise in ein gehobenes Modegeschäft der Zürcher Bahnhofstrasse verwandelt, dann in eines für Dessous, später in ein Hotel, wird deutlich: Nichts ist klar in dieser Welt von Sein und Schein, weil es Dinge gibt, die mittels Ratio nicht zu fassen sind. „Alles muss weg!“ Begehbare Stadtinstallation in der Schiffbauhalle Wieder ein paar Tage später in der Schiffbauhalle: „Kollision am Bürkliplatz!“ Lautsprecherverzerrte Stimmen kündigen Unvorhergesehenes und Geplantes an in der gewaltigen begehbaren Stadtinstallation „Alles muss weg!“, die Bettina Meyer zusammen mit Lukas Bärfuss, Katja Hagedorn, Anja Kerschkewicz und Zwei Tage später in der Box: Zwischen Nadia Schrader erfunden und in der Wänden aus grossen Papierbahnen Schiffbauhalle realisiert hat. Aus steht die viel zu kleine weisse, leicht Gerüstmaterial, Containern und Teilen heruntergekommene Einbauküche, in bestehender oder abgespielter der sich der Krüppel und verhinderte Künstler Hermann Wurm und seine Mutter Bühnenbilder ist eine ganz eigene temporäre Stadt entstanden, die sich in Werner Schwabs Radikalkomödie mittels künstlerischer Interventionen, „Volksvernichtung oder Meine Leber ist Dokumentation, theoretischem sinnlos“ (Regie Heike M. Goetze) Diskurs mit den architektonischen, mehr oder weniger wohnlich eingerichtet städteplanerischen, philosophischen haben, der Herd ist zu niedrig, der Perspektiven Zürichs auseinandersetzt. Küchenschrank zu schmal, der Tisch zu Der „Stadtwald“ (aus den Bäumen klein. Familie Kovacic hingegen, ein der „Malaga“-Aufführung) lädt zum Drehbühnendrittel weiter ansässig und Spaziergang ein, ein Container bietet mit zwischen den durch die Drehung der Bühne zerrissenen Papierbahnen hausend, „Raum pro Kopf“ erlebbare Statistik, in verwinkelten Ecken und Gängen findet besitzt nebst einer unbedeutenden sich Dokumentarisches und Spielerisches. Schrankwand nur ein einziges Möbel: ein unendlich grosses plastikbezogenes Drei Szenerien, die unterschiedlicher lachsfarbenes Sofa, das den nicht sein könnten, stehen am Anfang der unverrückbaren und inzestuösen dritten Saison unter der Intendanz von Lebensmittelpunkt der Familie bildet. Barbara Frey am Schauspielhaus Zürich und alle tragen sie die Handschrift der Bühnenbildnerin Bettina Meyer – dass drei grosse Arbeiten parallel realisiert werden können, ist für jede Bühnenbildnerin eine Ausnahmesituation, die nur mit einer gewaltigen Kraftanstrengung, einem gewissen Mass an Sturheit und Durchsetzungskraft sowie einer grossartigen Assistentenriege an der Seite bewältigt werden kann. Bereits in den letzten beiden Jahren waren einige von Bettina Meyer entworfene Bühnenbilder am Schauspielhaus zu sehen: Auf die Eröffnungspremiere „Maria Stuart“ folgten „Warum läuft Herr R. Amok?“, „Triumph der Liebe“ (ein Bühnenbild, das regelmässig beklatscht wurde, sobald sich der Vorhang hob), „Malaga“, „Fegefeuer in Ingolstadt“, „Stiller“, „Der Hodler“, „Quartett“. Zu Beginn ihrer Karriere als Bühnenbildnerin – sie war noch Assistentin am Hamburger Schauspielhaus bei der damaligen Ausstattungsleiterin Anna Viebrock – stand eine Arbeit, über die Bettina Meyer noch heute auffallend oft spricht: In einem stillgelegten Schiessstand ausserhalb Hamburgs, in 10 11 „Medea“ von Euripides, Regie Barbara Frey (Berlin, 2006 / Zürich, 2011) „Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos“ von Werner Schwab, Regie Heike M. Goetze (Zürich, 2011) „Fegefeuer in Ingolstadt“ von Marieluise Fleisser, Regie Barbara Frey (Zürich, 2010) „Leonce und Lena“ von Georg Büchner, Regie Barbara Frey (Zürich, 2011) 12 dem in den letzten Monaten des NSRegimes sogenannte Wehrkraftzersetzer Erschiessungskommandos gegenübergestellt wurden, erfand sie eine Welt aus mechanischen Skulpturen und bewegten Bildern, einen Gedächtnisraum als Auseinandersetzung mit Erinnerungsritualen. Dass das Installative nun im Zürcher Urbanitätsprojekt eine Fortsetzung gefunden hat, ist kein Zufall – auch ihre Bühnenräume haben oft fast installativen Charakter; sie sucht die Reibung an der Realität, die leichten Wahrnehmungsverschiebungen im Blick auf scheinbar Bekanntes. Es sind keine gemütlichen Räume, die zum Verweilen oder Wohlfühlen einladen, die Bettina Meyer entwirft, keine Rückzugsorte, die Schutz oder Wärme bieten. Vielmehr sind die Figuren auf sich selbst zurückgeworfen, oft sogar fast voyeuristisch der Beobachtung anderer ausgesetzt, wie in „Fegefeuer in Ingolstadt“, wo es unangenehm dunkle und sich über das ganze Bühnenbild ziehende Sehschlitze gab, die das misstrauische und jede Privatheit negierende Klima von Marieluise Fleissers Figuren gnadenlos offenbarten. In „Geschichten aus dem Wiener Wald“ in Salzburg und München waren weisse Wände mit runden Öffnungen versehen, durch die neugierige Blicke und Gesichter von aussen das Geschehen verfolgten. In der Uraufführung von Lukas Bärfuss‘ „Malaga“ waren es die Zuschauer selbst, die zu Voyeuren wurden und die drei Schauspieler auf einer minimal kleinen Spielfläche mitten in einem Wald aus Koniferen und Farnen ausgestellt sahen. Überhaupt entsprechen die Grössenverhältnisse in Bettina Meyers Räumen selten der Realität – sei es das überdimensionierte Kovacic-Sofa in „Volksvernichtung“, die riesenhafte Eingangstür zu den verheissungsvollen Geschäften in „Leonce und Lena“ oder der über 30 Meter lange Leuchtsteg in Heiner Müllers „Quartett“, der von zwei langen Zuschauertribünen gesäumt quer durch die Schiffbauhalle verlief und damit spielte, dass man die beiden Protagonisten mal voyeuristisch viel zu nah, mal aus einer viel zu grossen Distanz verfolgte. Auch scheint Bettina Meyer 13 Gespräch Das perfekte Stück einem dokumentarischen oder falschen Naturalismus zu misstrauen. Selten sind ihre Räume ausformuliert, selten gibt es viele Requisiten, die ein bestimmtes Milieu näher definieren würden. Meist bleiben sie abstrakt und hinterfragen auf zeichenhafte und poetische Weise Sehgewohnheiten, schärfen den Blick und die Wahrnehmung des Zuschauers. Das zeigt sich insbesondere in ihren Bühnenbildern für Arbeiten der Regisseurin Barbara Frey, mit der sie eine inzwischen achtzehnjährige Zusammenarbeit an unzähligen Theatern von Basel über Mannheim, Berlin, Wien, Salzburg, München bis nach Zürich verbindet. Barbara Freys überaus präzise und tiefenforschende Regiearbeit erfährt in Bettina Meyers Räumen eine bildnerische Entsprechung, oft auch eine Reibung, die den Blick auf die auf sich selbst verwiesenen Figuren befördert. Ihre Bühnenbilder ermöglichen und lenken den Fokus auf jede noch so kleine Geste, Schauspielergesichter werden gross und enorm präsent. Bettina Meyer schätzt die Arbeit mit so unterschiedlichen Regisseurinnen und Regisseuren wie Barbara Frey, Heike M. Goetze oder Ruedi Häusermann (zuletzt „Der Hodler“ in der Box im Schiffbau). Während Barbara Frey Theatermittel wie Video, Requisiten, Theaterblut etc. sehr reduziert einsetzt, leben die Arbeiten von Heike M. Goetze davon, dass die Mittel benutzt werden, manchmal bewusst im Übermass und in einer grossen Form – und immer mit einer enormen Körperlichkeit. In Ruedi Häusermanns Arbeiten wiederum bildet der Raum gleichberechtigt mit Text und Musik eine Art Gesamtkunstwerk. Nebst Bühnenund auch Kostümbildern im Schauspiel arbeitet Bettina Meyer auch regelmässig und gerne im Musiktheater – sei es mit Christoph Marthaler („Invocation“), Barbara Frey oder demnächst in Antwerpen. An einer Arbeit wie dem Urbanitätsprojekt weiss sie zu schätzen, wie ihre Arbeiten mit denen der Assistentinnen in einen Dialog treten. Denn wenn sie als Ausstattungsleiterin junge Leute ans Schauspielhaus Zürich holt, sie fördert und fordert – dann auch, um selbst immer wieder neu inspiriert zu werden. Weil die Nachkommenden sich mit anderen Künstlern beschäftigen, andere Fragen stellen, anders auf die Welt schauen. Der Prozess des Erfindens eines Bühnenbildes bleibt jedoch unabhängig von der Regie derselbe: Wichtig ist Bettina Meyer dabei nebst der Lektüre des Textes das allererste Gespräch mit der Regisseurin oder dem Regisseur, in dem Assoziationsfelder oder Atmosphären besprochen werden. Später arbeitet sie fast ausschliesslich über Adjektive, über die sich ihre ganz subjektive Wahrnehmung einstellt: Ihre Räume entstehen dreidimensional im Kopf und nicht anhand von Skizzen. Wenn sich eine Idee noch nicht einstellen will, kann sie nicht durch Fleiss am Reissbrett erzwungen werden. Während ihres Bühnenbildstudiums an der HdK Berlin hat sie vor allem eines gelernt: dass man sich die Fragen nicht nur selbst stellen, sondern auch selbst beantworten muss. Der Auftrag muss von einem selbst kommen. Vielleicht, sagt die Künstlerin Bettina Meyer, sei das der Unterschied zwischen Handwerk und Kunst. W.D. – Einmal hat man Beckett gefragt: Sind Sie eigentlich gegen die Alten, dass Sie die … S.P. – … in die Mülltonnen stecken? Das hat man ihn wirklich gefragt? (lacht) W.D. – Er meinte nur: Nein, aber wie soll ich sie sonst auftreten lassen? So muss ich nur den Deckel aufmachen und schon sind sie da. Aber ich habe noch einen schönen Satz von Beckett: „Ich habe keine Erklärung für Rätsel anzubieten, die Journalisten selbst erfunden haben. Bei meinem Werk geht es um Grundtöne, die so voll wie möglich gestaltet sind. Für alle anderen bin ich nicht verantwortlich. Wenn die Leute im Bereich der Obertöne Kopfschmerzen bekommen, dann sollen sie sich ihr Aspirin selbst beschaffen.“ „Das Spiel muss man ernstnehmen“: Werner Düggelin und Stefan Pucher Der Regisseur einer legendären „Endspiel“-Inszenierung am Pfauen, Werner Düggelin, und der Regisseur der aktuellen Neuinszenierung, Stefan Pucher, im Gespräch über Beckett und über Spiele, auf der Bühne und auf dem Rasen Stefan Pucher – Im Unterschied zu Ihnen habe ich ja noch nie ein Stück von Samuel Beckett inszeniert ... Werner Düggelin – Ich kannte Beckett ziemlich gut. Als er „Endspiel“ aus dem Französischen ins Englische übersetzte, schlug man ihm „End of Game“ als Titel vor, also Ende des Spiels. Beckett fand das aber völlig falsch und nannte sein Stück „Endgame“, wie beim Schach. S.P. – Oder beim Fussball. Es steht 0:0 – und man will nur nicht mehr verlieren. Der Titel kommt tatsächlich vom Sport. W.D. – Ja, und von Marcel Duchamp. S.P. – „Endspiel“ ist so unglaublich genau geschrieben, dass wirklich alles schon da steht, wie bei Duchamps „Readymades“ – alles ist schon da, man muss die Kunst nur sehen. Meine Regieanweisungen sind im Prinzip nur die, die auch im Text stehen. Einer muss halt auf das Spiel gucken und das bin ich. Aber es ist schon schwer genug, es so zu machen, wie es da steht. Auch für die Schauspieler. W.D. – Das Faszinierende ist ja, dass wenn du aus dem Streichholz-Turm ein einziges Streichholz herausnimmst, alles in sich zusammenfällt. S.P. – Ich muss gestehen, dass ich schon Lust habe, das eine oder andere Streichholz herauszuziehen und zu schauen, was dann zusammenfällt ... Man kann ja auch was umwerfen und dann sagen, es war nur Spass! Und sofort steht das alles wieder. Beckett ist, genau wie Tschechow oder Shakespeare, einfach Theater. W.D. – Das sind für mich die drei Grössten ... Ach, die Leute ärgern mich so oft mit Beckett. Am meisten ärgern sie mich, wenn sie sagen, seine Stücke seien Absurdes Theater. S.P. – Im Gegenteil: Seine Stücke sind sehr konkretes Theater. S.P. – Beckett hatte – wie man am Beispiel mit den Mülltonnen sieht – ein unglaubliches Theaterverständnis, wie eben auch Shakespeare oder Tschechow. Wenn bei Shakespeare jemand stirbt, gibt es fast immer ein Wortspiel, das klarmacht, dass er nicht wirklich tot ist: „It’s just a counterfeit“, sagt Falstaff. Es gibt immer ein Bewusstsein des Spiels. Es geht um nichts, aber es geht um alles. Bestimmte Sätze tauchen auch bei Beckett immer wieder auf, wie zum Beispiel „Jetzt bin ich dran“, also: „Jetzt spiele ICH“. Oder es kann auch bedeuten „Jetzt SPIELE ich“ im Sinne von „das ist nicht Ernst“. W.D. – Ich glaube Letzteres! Beckett hat unglaublich viel über den Schauspieler, über das Theater an sich verstanden. Und ich glaube, er hat auch einfach grausam viel über Menschen gewusst. Er war ein unendlich belesener Mensch. In seiner ganzen Zeit als Sekretär bei James Joyce hat er nichts anderes getan als zu lesen. S.P. – Bei Shakespeare gibt es in jedem Stück Monologe, die darauf hindeuten, dass alles nur ein Spiel oder ein Traum ist. Beckett zitiert das in seinen Monologen und fragt auch, was das eigentlich ist, ein Monolog? Meistens geht es in Monologen um die menschliche Existenz oder den Tod – aber solange ich rede, lebe ich! Ich spüre 14 15 sich irgendwie verlagert. Der Rausch besteht derzeit ja darin, dass man den Ball eigentlich nur für eine oder zwei Sekunden hat. Früher bestand der Rausch im Dribbeln. manchmal einen, vielleicht auch gespielten, Nihilismus in der Frage, ob es überhaupt richtig ist, dass etwas existiert. W.D. – Dass es weitergehen würde – das wäre doch die grösste Katastrophe, oder? Persisch (Farsi) oder Swahili und 28 weitere Sprachen Wussten Sie, dass die Wörter Schach oder Pistazie ihren Ursprung in der persischen Sprache haben? Erlernen Sie diese Kultursprache! Die am weitesten verbreitete Verkehrssprache Ostafrikas ist Swahili. Freuen Sie sich darauf, sich mit 80 Millionen Menschen besser verständigen zu können. Neben den 5 Hauptsprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch) bieten wir 25 weitere Sprachen an, z. B. Arabisch, Chinesisch, Finnisch, Hindi, Isländisch, Latein, Rätoromanisch, Schwedisch, Thai, Ungarisch oder Züritüütsch... Jetzt anmelden. www.klubschule.ch Klubschule Migros Zürich: 044 278 62 62, Rapperswil: 055 220 64 20, Glarus: 055 640 68 71 Tonhalle Zürich, Grosser Saal, jeweils 19.30 Uhr Mi, 9.11.2011 Di, 17.1.2012 WIR BRINGEN EUCH KLASSIK PROGR A MM SA IS ON 20 11/12 ZÜRI CH Mo, 19.3.2012 Mo, 23.4.2012 Mo, 7.5.2012 Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino Zubin Mehta (Leitung), Francesco Piemontesi (Klavier)* Werke von Mozart, Beethoven Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt Howard Griffiths (Leitung), Julian Rachlin (Violine) Daniel Schnyder (Saxophon)* Werke von Daniel Schnyder, Mendelssohn, Bruckner Orchestre National de France Daniele Gatti (Leitung), Antonio Meneses (Violoncello)* Werke von Fauré, Saint-Saëns, Debussy, Ravel Moscow Virtuosi Chamber Orchestra Vladimir Simkin (Leitung), Sarah Chang (Leitung und Violine «Die vier Jahreszeiten») David Pia (Violoncello)* Werke von Vivaldi, Tschaikowski Philharmonia Orchestra Philippe Jordan (Leitung), Oliver Schnyder (Klavier)* Werke von Brahms, von Weber, Beethoven *Schweizer Talente und Solisten Karten-Vorverkauf: Billett-Service, Migros City, Tel. 044 221 16 71; Tonhalle, Billettkasse, Tel. 044 206 34 34 und übliche Vorverkaufsstellen. www.migros-kultuprozent-classics.ch S.P. – Es ist wirklich ganz schwer, darüber zu sprechen. Das Stück berührt Fragen, die jeder Mensch, der sich diesen Text anhört, mit seiner eigenen Existenz assoziiert, z.B. mit der grossen Frage nach dem Tod – wie kommt er, wie sieht er aus? Was kommt danach? W.D. – Es stellt die grossen Fragen – aber eben auf Beckett’sche Art. Bei den Proben für die Uraufführung von „Warten auf Godot“ – bei denen ich dabei sein durfte – kam Beckett hin und wieder vorbei. Das Schlimmste war für ihn immer, dass ihn die Schauspieler fragten, was denn dieser oder jener Satz heisse? Beckett sagte dann immer: „Rien“. Er meinte damit natürlich nicht, dass der Satz nichts heisst, sondern er wollte, dass der Schauspieler diesen Satz dem Publikum nicht erklärt. Genauso, wie er die Mülltonnen nicht erklärt hat – er hat sie einfach aus technischen Gründen benötigt. Was mich aber immer wieder beschäftigt und worauf ich keine Antwort habe: Als „Warten auf Godot“ uraufgeführt wurde, war es unendlich schwer zu verstehen und voller Rätsel. Heute ist das komplett anders, es ist ganz einfach zu verstehen. S.P. – Die Zeit kommt dem Stück entgegen – es wird eigentlich immer verständlicher. Damit meine ich aber kein PseudoVerständnis, z.B. in Bezug auf unseren Umgang mit den Alten in der Gesellschaft. Das wäre völlig idiotisch. „Warum hast Du mich gemacht?“, fragt der Sohn. Darauf der Vater: „Ich wusste doch nicht, dass DU es werden wirst.“ Da werde ich todtraurig. Das ist einfach genial von Beckett. Ich habe wirklich noch nie ein Stück inszeniert, das so perfekt ist. Ich bin auch sehr froh, dass das Stück so viel Humor hat ... W.D. – Beckett schrieb es für Roger Blin, den Regisseur von „Godot“, was ein Riesenerfolg war. Als sie in Paris „Endspiel“ probten, wurden sie nach zwei Monaten vom Theater rausgeschmissen. Und fanden tatsächlich kein Theater in Paris. Deshalb erfolgte die Uraufführung in London. „Endspiel“, nicht „Godot“, war Becketts Lieblingsstück. S.P. – Was an „Endspiel“ auch ganz toll ist, ist, dass dem Regisseur vorgeführt wird, wenn seine Arbeit leerläuft. Hamm beispielsweise gibt immer Kommandos, als wäre er auch eine Art Regisseur und Clov führt diese einfach aus. Unsinnige Kommandos – wie ein Regisseur, dem nichts Richtiges einfällt, der aber, um seine Autorität zu wahren, halt irgendwelche Anweisungen gibt. Wie dann der Schauspieler, oder eben Clov, W.D. – Das kann heute nur noch einer, nämlich Messi. S.P. – Das Spiel hat immer eine Bedeutung. Auch bei Beckett. Norbert Schwientek und André Jung (1991) W.D. – Ohne Spiel könnten Hamm und Clov nicht leben. S.P. – Das ist ja die einzige Chance, die sie noch haben. W.D. – Mich fasziniert an „Endspiel“ auch diese wahnsinnige Angst, dass es NICHT zu Ende sein könnte. Hamm hat doch eine fürchterliche Angst, dass die Welt nicht zu Ende sein könnte, dass es weitergeht. Und deshalb hat er auch Angst vor jeder Mikrobe, weil die ja etwas zeugen könnte. Robert Hunger-Bühler und Jean-Pierre Cornu (2011) den Chef aushebelt mit seinem Widerstand, das ist toll. W.D. – Aber immer als Widerstand, der nicht als Widerstand deklariert ist, das finde ich so wichtig. S.P. – Es gibt ja Leute, die spielen Gesellschaftsspiele, sagen wir Monopoly, verlieren und sagen dann: „Ist ja eh nur ein Spiel ...“ Da werde ich immer wahnsinnig. Das Spiel muss man ernstnehmen. Im Fussball, in einem WM-Endspiel zum Beispiel, geht es ja eigentlich um nichts … W.D. – Ach, Fussball ist ein Traumspiel. Es ist eine Katastrophe für mich, wenn ich ein Spiel von Dortmund verpasse. Ich habe das „Champions League“-Endspiel gesehen, Manchester gegen Barcelona … S.P. – Das war zum Niederknien. Sowas gibt es ja nicht oft, das ist geradezu magisch, dass elf Leute ohne Telepathie in solch einer traumwandlerischen Sicherheit zusammen Fussball spielen. W.D. – Es gab einmal einen grossen Trainer, Helmut Benthaus – übrigens ein Theaterverrückter. Der war zu meiner Zeit in Basel, und ich durfte einmal bei einem Freundschaftsspiel des FCB gegen die Bayern auf der Trainerbank sitzen. Und ich frage Benthaus: „Du, erklär mir mal, warum der Beckenbauer so viel besser ist als die anderen.“ Und er: „Das ist ganz einfach. Der hat auch hinten zwei Augen.“ Heute haben die alle hinten zwei Augen und wissen genau, wo sich der andere gerade jeweils aufhält. S.P. – Interessant, wie sich das Spiel momentan entwickelt – der Rausch hat S.P. – Ich frage mich immer, ob das die Angst ist, dass die Welt ohne ihn weitergeht … W.D. – Nein, ich glaube nicht. Sondern dass die Welt überhaupt weitergeht. – Sag, gegen wen spielt Dortmund am Samstag? S.P. – Keine Ahnung, ich bin Bayern-Fan. W.D. – Bayern-Fan … Transkription Eva-Maria Krainz Redaktion Andrea Schwieter Werner Düggelin, geboren 1929 im schwyzerischen Siebnen, erlernte in Paris die Theaterregie und war 1953 beteiligt an der Uraufführung von Samuel Becketts „Warten auf Godot“. Von 1968 bis 1975 war Düggelin Künstlerischer Direktor des Theater Basel. Seitdem arbeitet er als freier Regisseur an den grossen deutschsprachigen Theatern. Am Schauspielhaus Zürich inszenierte Düggelin 1991 „Endspiel“ mit Norbert Schwientek und André Jung in den Hauptrollen. Zuletzt war am Pfauen seine Inszenierung „Volpone“ zu sehen, im Mai 2012 führt er bei „Das Glas Wasser“ von Eugène Scribe Regie. Stefan Pucher, 1965 in Giessen geboren, war von 2000 bis 2004 Hausregisseur am Schauspielhaus Zürich und blieb diesem Haus auch danach verbunden. Seine Zürcher Inszenierungen von „Drei Schwestern“, „Richard III.“ und „Homo Faber“ wurden zum Berliner Theatertreffen eingeladen, ebenso 2011 „Tod eines Handlungsreisenden“ von Arthur Miller. Seine Inszenierung von „Endspiel“ mit Robert Hunger-Bühler als Hamm und Jean-Pierre Cornu als Clov hatte am 30. September im Pfauen Premiere. 16 17 Stückporträt Hinweg über die Verwundungen des Lebens Über Thomas Jonigk und sein neues Stück „Weiter träumen“, das im Pfauen uraufgeführt wird von Herbert Meier Wie Thomas Jonigk brennende Gesellschaftsstoffe in Theater zu transformieren vermag, zeigte im vergangenen Mai in der Box im Schiffbau sein Stück „Täter“, das vom sexuellen Missbrauch handelt. Das Gespielte wird bei ihm zum abgespiegelten Leben, wie man es zu kennen meint. Im Innenraum des Theaters aber wirkt es szenisch entfremdet und erscheint umso eindringlicher. In ihrem Hintergrund verraten die Dialoge, so leicht sie daherkommen, eine tiefe Verletztheit vom Leben selbst, wie es ist und doch anders sein könnte. Das lässt sich auch bei seinem neuen Stück „Weiter träumen“ beobachten. Beim Lesen dieser melancholischen Komödie versuche ich, der Verfahrensweise des Autors auf die Spur zu kommen. Dabei ist mir natürlich bewusst, eines ist der geschriebene Text, ein anderes seine inszenierte Lesart und ein drittes das Erlebnis eines Stückes in den Augen des Zuschauers. Theater ist eine Kunst der wechselnden Anschauungen und Interpretationen. Thomas Jonigk schreibt seine Stücke in einer Zeit, die man als postdramatisch bezeichnet. Er erzählt nicht Geschichten nach einer klassischen Dramaturgie. Er stellt Augenblicke und Situationen von Figuren dar, in denen Traumata der Gesellschaft erlitten und kritisch befragt werden. In seinem Libretto „Der Sandmann“ (nach E.T.A. Hoffmann) kann man Themen zum Stück „Weiter träumen“ entdecken. Es sind dies die sexualisierten Beziehungen der heutigen Gesellschaft, die Kälte in der menschlichen Welt, die „atomisierten“ Gefühle. Ein formelhafter Ausdruck aus dem „Sandmann“: „Fatalistisch. Und doch utopisch“ könnte auch die Grundstimmung des neuen Stückes bezeichnen. „Fatalistisch. Und doch utopisch“: Der Schriftsteller Thomas Jonigk In solchen Paradoxien bewegen sich Handlung und Personen. Nicht die Handlung hat ihre Peripetien (etwa im aristotelischen Sinne von „Umschwüngen der Glücksumstände in ihr Gegenteil“), sondern die Figuren. Nicht deren Handlungen, sondern ihre inneren Wünsche und Abgründe werden zu Szenen. Das Ausgedachte und Erträumte selbst ist der Grundimpuls ihres Daseins. Sie sind unmittelbar ihren Traumata und Sehnsüchten ausgeliefert und fallen von einem Verhalten ins andere, von Aggression in Freundlichkeit, von heftigen Hassausbrüchen in Umarmungen, von Gleichgültigkeit in Leidenschaft, von Nüchternheit in Emphase. Sie sind „atomisiert“, im innersten Kern gespalten, nicht nur in ihren Gefühlen, auch in ihrem Denken und Verhalten zum anderen. Die Situationen folgen sich sprunghaft, unerwartet und überraschend als ein szenisches Puzzle. Das Ganze findet nicht als geschlossenes Drama statt, vielmehr in oft rasch vorüberziehenden Minidramen. Es hinterlässt indessen ein Grundgefühl von Mitleiden und Befreiung und bewirkt so eine kritische Katharsis. Es möchte die Gesellschaft trotz allem Unabwendbaren nicht in ihren traumatischen Fatalitäten belassen. Immer wieder blitzen neue, wenn auch utopische Hoffnungen auf. Das bedeutet, wer weiter(hin) über die Verwundungen des Lebens hinwegträumt, kann es ertragen. „Weiter träumen“ spielt in einem Krankenhaus. Doch will es keine Spitalrealität auf der Bühne. Was im leeren Raum steht, ist ein Weihnachtsbaum. Er weist auf die Zeit hin, wo es in Krankenhäusern einsam wird. Das Ganze spielt auf der Intensivstation, vor „Zimmer 114“, in dem der Diplomat Bockmann im Koma liegt. Er ist der kaum sichtbare Protagonist. Um ihn dreht sich buchstäblich alles. Seine Frau Silvia hofft, nach einer über 40 Jahre geführten Ehe, er erwache als ein anderer, als der, der er zeitlebens war. Durch sie und die andern Personen: eine Krankenschwester, ein Arzt, Tochter Hildegard, Hans und die Anwältin Ursula werden die Lebensverhältnisse rund um Bockmann aufgedeckt und entlarvt. Eine erste expositionelle Szene deutet schon Jonigks Verfahrensweise beim Stückeschreiben an. Nach zwei, drei kaltschnäuzigen Repliken gibt Ursula sich als die Retterin des Verunfallten zu erkennen. Woraufhin die Stimmung in eine angestrengte Freundlichkeit umschlägt. Man isst Kekse und unterhält sich: Frauen unter sich. Dann einer der anklagenden Ausbrüche, wie sie Jonigks Figuren oft haben: Ursula ereifert sich, in scheinbar unsinniger Weise, plötzlich über die Übergewichtigen und Fettleibigen in den USA. Solche Ausbrüche können seelische Verwundungen tarnen, die nach und nach in der fortschreitenden Entwicklung einer Person ans Licht kommen. Es folgt dann, wie an anderen Stellen auch, einer jener Momente, wo ein Wort mitten in ein unversehenes Schweigen fällt. „Ursula versinkt in Gedanken. Silvia schüttelt traurig den Kopf“, lautet die Regieanweisung. Dann: „SILVIA (für sich) Das Leben.“ – „URSULA (aufschreckend) Wo?“ Silvia, die ein Wohlstandsleben führte, wird von den Geliebten ihres Mannes verhöhnt als eine „unten rum versteinerte“ Frau. Und wieder folgt mitten im aggressiven Streit durch ein einziges Wort („Haben Sie gar keine Achtung vor sich selbst?“) ein perplexer Umschwung: „Eine Attacke von Nachdenklichkeit.“ Dann: „Schweigen.“ In solchen Momenten wird eine für Jonigks Theater typische Hintergrundstimmung spürbar: Liebe und Selbstachtung wären doch das Bessere als purer Sex und Aggression. Indessen sexualisiert sich die Gesellschaft zusehends, Einsamkeit und Selbstentfremdung greifen um sich, Zustände, an denen die Menschen im Grunde leiden. Sie schwimmen im Leeren ihrer Verhältnisse und wissen im Innersten doch um jenes andere, das sie ersehnen. Im Ausdenken und Träumen wird es flüchtig Gegenwart. Über dem Ganzen schwebt bei aller komödienhaften Leichtigkeit der Dialoge und Einfälle eine Melancholie. Das Wort „Liebe“ ist längst zum gesellschaftlichen Tabu geworden. Die Vokabel „Sex“ hat es verdrängt, als könnte Sexualität die Liebe ersetzen. Sex ist das Abenteuer, nicht mehr die 18 dauerhafte Liebe. Und doch scheint die Liebe mitten in der sexualisierten Gesellschaft so etwas wie eine höhere Traumexistenz zu führen. Sie produziert in den Menschen Imaginationen, in denen sie gleichsam Leben annimmt und doch als das Ungreifbare erfahren wird. Silvia kann ein Wort wie „Liebe“ nicht mehr hören. Die enttäuschende Beziehung ihres Lebens hat es in ihr abgetötet, obschon es das nennt, was sie sich im Innersten noch jetzt in ihren späteren Jahren erwünscht. Die Begegnung mit einem jungenhaften Mann namens Hans erweckt in ihr eine neue Liebesempfindung. Hans ist die heitere Person in „Weiter träumen“. Auch er trägt wie andere Figuren ein Gegengesicht. Seine Heiterkeit ist die Maske eines Selbstmordversuchs, dem er entgangen ist. Nun kommt er mit der Leichtigkeit eines Harlekins daher und bezaubert Silvia. Allein schon zu reden mit ihr findet er erotisch. Als einziger in diesem Stück spricht er die Worte „Liebe“ und „lieben“ aus, auch wenn er weiss, wie abgenutzt sie sind. Er erklärt Silvia seine Liebe und beschenkt sie. Er versetzt sie in ihre jungen Jahre, in denen sie Balletttänzerin war. Endlich erlebt sie in einem selbstvergessenen Tanz wieder soetwas wie Liebesbegeisterung. 19 Reise Doch die Ernüchterung folgt auf dem Fuss. Ihr Mann erwacht aus dem Koma und zeigt sich als der Gleiche, der er schon immer war. französischer Übersetzung ausgezeichnet. Der Autor inszeniert auch selbst, zuletzt das libanesische Stück „Biokhraphia“ in der Kammer des Pfauen. Silvia findet indessen in Hans eine neue Liebe, oder schwebt diese Liebe am Ende doch im Irrealen? Das Stück endet in einem lyrischen Akkord, in dem atmosphärisch noch einmal seine Grundstimmung aufklingt: ein Schweben zwischen Realität und Imagination, zwischen „Aufwachen“ und „Weiter träumen“, wie es, nach einem Wort Thomas Jonigks, der „Ungreifbarkeit der Liebe“ entspricht. Herbert Meier lebt als Autor und Übersetzer in Zürich. Von 1977 – 1982 war er Chefdramaturg am Schauspielhaus Zürich. 2009 wurde Paul Claudels „Der Tausch“ in seiner Neuübertragung in der Box gespielt. Jüngste Publikation: „Das Erhoffte will seine Zeit – Gedichte und Prosa“ (Johannes Verlag, Freiburg 2010). Thomas Jonigk ist seit 2009 am Schauspielhaus Zürich als Schriftsteller und Dramaturg tätig. Seine Bearbeitung von Gottfried Kellers Roman „Martin Salander“ wurde im Pfauen von Stefan Bachmann uraufgeführt, sein Stück „Täter“ lief in Daniela Löffners Regie in der Box im Schiffbau. Nun kommt sein Stück „Weiter träumen“ im Pfauen zur Uraufführung, inszeniert von Christof Loy. Ausser Theaterstücken schreibt Jonigk Drehbücher, Libretti (u.a. für Olga Neuwirth und Andrea Lorenzo Scartazzini, der momentan sein Libretto „Der Sandmann“ für das Theater Basel vertont). Jonigk erhielt zahlreiche Preise, 2009 wurde sein zweiter Roman „Vierzig Tage“ mit dem „Prix Amphi“ als bester nicht-französischer Roman in Grias di, Grisdian! Ein Besuch beim „Merlin“-Regisseur Christian Stückl in seinem bayerischen Heimatort Oberammergau von Roland Koberg Weiter träumen von Thomas Jonigk Uraufführung Regie Christof Loy, Bühne Jan Versweyveld, Kostüme Ursula Renzenbrink, Musik Mathis Nitschke, Choreographie Thomas Wilhelm Mit Klaus Brömmelmeier, Fritz Fenne, Silvia Fenz, Julia Kreusch, Christoph Quest, Friederike Wagner, Susanne-Marie Wrage Ab 22. Oktober im Pfauen Endlich wieder soetwas wie Liebesbegeisterung: Silvia Fenz (Silvia) und Fritz Fenne (Hans) Die Träume, die man als Kind so hat, hat Christian Stückl schon verwirklicht. Mit zehn Jahren wusste er, dass er einmal im Haus gegenüber des elterlichen Wirtshauses wohnen wollen würde – und lebt da nun, als Hausbesitzer, nachdem er zuerst als Untermieter eingezogen war. Ebenso wusste er als Kind, dass er einmal Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele sein wolle, jenem alle zehn Jahre angesetzten katholischen Mysterientheater mit 2000 Laiendarstellern, das zigtausende Besucher aus aller Welt anzieht – er wurde der jüngste Spielleiter aller Zeiten, leitet die Passion nun seit mehr als 20 Jahren, zuletzt 2010. Als Spielleiter hat er sogar erreicht, dass auch in den spielfreien neun Sommern unterm Dach des riesigen Passionstheaters Oberammergau Schauspiel gemacht wird, zuletzt gab man „Joseph und seine Brüder“ nach Thomas Mann. Stückl hat also wieder einen Grund mehr, nach Hause in den Ort seiner Kindheitsträume zu fahren, meistens von München aus. Dort leitet der in unverfälschtem Oberbairisch parlierende 49-jährige seit 2002 das Volkstheater. Wenn man mit Christian Stückl in Oberammergau unterwegs ist, dann gibt es praktisch keinen einheimischen Passanten, der nicht schon nach seinen Anweisungen gespielt hat. Die Kinder sowieso, die meisten Erwachsenen auch. Mit dem ersten Auftritt als Kind erwirbt man hier ein lebenslanges Recht auf Mitwirkung an den Passionsspielen, zwei Jahre vor dem Ereignis meldet man sich jeweils an und lässt sich dann ein Jahr lang die Haare wachsen, damit es auf der Bühne auch wirklich aussieht wie in unserer kollektiven Vorstellung von Jerusalem bei der Kreuzigung Jesu. Danach haben die Friseure viel zu tun, und jetzt, ein Jahr nach den letzten Passionsspielen, sehen eigentlich alle wieder ganz ordentlich aus in ihren Trachtengeschäften, Holzschnitzereien und Hotelpensionen. Einen Tag mit Stückl auf den Strassen von Oberammergau zu wandeln bedeutet, im Minutentakt Grüsse zu vernehmen: Grias di, Grisdian! Kinder werden entgegengehalten, Fotos geschossen, Komplimente gemacht („Sehr schee wars gestern“). Zwischendurch setzt sich der Wirt an den Tisch, um sich zu bedanken. Die Bespielung des Passionstheaters habe ihm den Sommer gerettet, sagt der Wirt. Zehn Mal 2000 Zuschauer, das ist zwar bescheiden im Vergleich zu dem, was bei den Passionsspielen los ist (da finden im Passionstheater fast 5000 Zuschauer Platz), aber genug, damit der Ort mitsamt seinem reichhaltigen touristischen Angebot auch im MallorcaZeitalter überleben kann. Untertags zieht es Stückl immer wieder hinein ins Passionstheater, unter das himmelszeltartige, von eleganten Stahlträgern gestützte Runddach. Die Oberammergauer haben es gebaut, als ein begeisterter Thomas Cook die Engländer mobilisierte, nach Oberammergau zu kommen. 1900 war das, doch die Tradition der Passionsspiele ist noch um einiges älter. Seit 1634 erfüllen die Oberammergauer ihr „Pestgelübde“: Sollte die Pest ein Ende nehmen, wollten sie kollektiv die Passionstragödie spielen. Bei der Premiere taten sie das noch auf den frischen Gräbern der Pesttoten. In späteren Jahren zog man um, „und seit 1830 san mir auf dera Wiesn“, sagt Stückl, als wir am heutigen Standort im Ortszentrum stehen. Wenn es um Oberammergau geht, sagt Stückl immer „wir“. Kein Wunder: Seit Generationen sind die Stückls federführend beteiligt, ein Besuch in der Ferienpension seiner Eltern gerät zur Zeitreise. An den Wänden hängen die Familiengruppenbilder seit 1950, alle zehn Jahre in anderer Konstellation. Mit den Menschen altern auch ihre Rollen. In seiner Karriere hat es Christian Stückl geschafft, his own private Oberammergau weiter zu tragen. Bekannt wurde er, der in München als Assistent an den Kammerspielen begann, für seine Uraufführungsinszenierung von „Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos“. Diese kräftige, lodernde, groteskwitzige Aufführung über die bigotten Familienverhältnisse im Hause Wurm machte 1991 auch den Dramatiker Werner Schwab über Nacht berühmt. Seitdem packt Stückl an, wo er kann, gerne bei Texten, bei denen theologische Kenntnisse von Vorteil sind: Seit 2002 trägt der Salzburger „Jedermann“ seine Handschrift, 2011 wurde in seiner Regie an der Münchner Staatsoper das metaphysische Papst- und Künstlerdrama „Palestrina“ ausgegraben und für „Merlin“ mit seinen Teufeln und der Suche nach dem Heiligen Gral kann etwas Kirchengeschichtswissen ebenfalls nicht schaden. Am nicht eben üppig bezuschussten Volkstheater München hat sich Stückl als Theaterleiter wie als Regisseur viel Respekt verschafft. Das von ihm ins Leben gerufene Theaterfestival „Radikal jung“ ist eine wichtige Börse für junge Regisseure geworden (nicht selten landen diese auch am Volkstheater selbst), er selbst inszeniert „Hamlet“, „Richard III.“ oder zuletzt „Dreigroschenoper“ und kontert damit die übermächtigen Institutionen Residenztheater und Kammerspiele immer wieder geschickt aus. Auch hier, am Volkstheater, ist Oberammergau längst daheim: Stefan Hageneier stattet nicht nur Stückls Profi-Inszenierungen aus, er gestaltet auch die Passionsbühne und hatte mit Stückl ein revolutionär neues Konzept für die Passionsspiele 2000 entwickelt; Stückls Jesus-Darsteller (im vergangenen Sommer: Joseph-Darsteller) macht in München die Pressearbeit, sein Judas ist da wie dort technischer Direktor und auch seinen Regieassistenten verdankt Stückl einem unverhofften Wiedersehen. Ein 19-jähriger türkischstämmiger Mann hat ihn eines Tages angesprochen, ob er nicht am Volkstheater anfangen könne und Stückl erinnerte sich sofort: Abdullah war der kleine Junge gewesen, der bei einer Passionsspiel-Probe als einziger aus seiner Klasse singen konnte und den er deswegen nach vorne zu sich auf den Schoss nahm, um den anderen das gewünschte Chorlied beizubringen. Er hatte kurz geschorenes Haar gehabt, weil Abdullahs Vater nicht wollte, dass er bei 20 21 Reportage So köstlich war es nie Kochen mit Zwerg Nase: acht Mädels, drei Gänge und das eine oder andere Geheimnis von Meike Sasse Selbstbewusst tritt Zwerg Nase vor den Oberküchenmeister des Herzogs und bewirbt sich. Der verzauberte Junge, eigentlich Jakob mit Namen, hat sieben Jahre gegen seinen Willen in den Diensten der Hexe Kräuterweis gestanden, dabei aber in strenger Lehrzeit ausgezeichnet kochen gelernt … Der Regisseur Christian Stückl vor seinem Haus in Oberammergau diesem katholischen Brimborium mitmacht, und als Stückl das erfuhr, erwirkte er persönlich beim Vater die Spiel-Erlaubnis – gegen das Versprechen, die Familie nicht zum Katholizismus bekehren zu wollen ... Jetzt arbeitet Abdullah am Volkstheater. Zum Katholizismus wollte Stückl tatsächlich noch niemanden bekehren, auf der Passionsbühne setzt er gerne aufklärerische Akzente, lässt hebräische Lieder singen und bindet ortsansässige Muslime ein. Seine freien Tage verbringt er in Indien, die ganze Welt kennt seine bisher populärste Inszenierung: die Eröffnung der Fussball-WM 2006 in München. Nicht zuletzt weil sein (Volks-) Theaterverständnis über den Betrieb hinausgeht, wird er mit Auszeichnungen überhäuft, die in seiner Branche sonst eher selten vergeben werden: Er bekam schon den Ehrenpreis des Oberbayerischen Integrationspreises, den Oberbayerischen Kulturpreis und das Grosse Verdienstzeichen des Landes Salzburg. Ausserdem ist er Träger der so genannten Bayerischen Sprachwurzel – eine urige Trophäe wie aus den Holzschnitzereien Oberammergaus. Einen Preis für Kühnheit verdient auch sein nächstes Münchner Regievorhaben: Rolf Hochhuths „Stellvertreter“. Wenn er noch in der Kirche ist, dann deshalb, weil man mit seiner Familie als Mitglied besser streiten kann denn als Nicht-Mitglied. Kämpfe pflastern seinen Passionstheaterweg, mehrfach war seine Stellung als Spielleiter gefährdet, einmal als er Versöhnung mit passionsspielkritischen Juden suchte, einmal als er sich mit einem altgedienten Protagonisten anlegte, der Oberammergaus grösster Nazi gewesen war. Aber er hat den Job immer noch, konkurrenzlos mittlerweile. Sein streitbares Temperament, das durch eine wilde Lockenmähne und funkelnde Augen äussere Gestalt annimmt, zeigte sich schon früh. Weil ihn der Herr Pfarrer nicht als Messdiener zugelassen hat, erklärte er sich selbst zum Mesner, quasi zum Kirchen-Dekorateur, und bald war er es, der die Fronleichnamsprozession künstlerisch auffettete, angefangen bei einem Stabfigurentheater, das er im Speicher der Kirche entdeckt hatte. Die Figuren waren einst gemacht worden, um aus dem Holzrahmen hervorzutreten, in dem sonst das Altarbild hängt – Mesner Stückl erneuerte diese vergessene Tradition. Die Kirche, in der dies geschah, betritt er nur noch selten, etwa um dem Besuch aus Zürich das Deckengemälde zu zeigen: ein Wachhund des Herrn (will meinen: ein Dominikaner), stösst mit einer Fackel die Ungläubigen von Gottes Thron. Die Schriftgelehrten zählen zu den Verstossenen, aber auch der Satan, dargestellt als ein von einer Schlange umschlungener Drache. Mit der Vertreibung der heidnischen Götter beginnt auch „Merlin“, bevor sich darin alle Figuren zwischen Himmel und Hölle in ihren Leidenschaften verirren. Schon wieder Passion. Wir haben uns im Hiltl Kochatelier versammelt, um gemeinsam den Rezepten von Zwerg Nase auf die Spur zu kommen. „Eigentlich hat nur der Chefkoch eine Kochmütze auf, aber heute seid ihr die Chefs der Küche“, mit diesen Worten begrüsst die Leiterin des Kochateliers, Dorrit Voigt, acht mutige Mädchen aus Zürich und Umgebung (Jungs waren keine zu gewinnen) und verteilt die Mützen. Ganz unvorbereitet sind die jungen Köchinnen im Alter von sieben bis neun Jahren nicht: Zumindest geholfen haben Annalena, Bengi, Gil, Leslie, Nadine, Lilli, Johanna und Mette in den Küchen ihrer Eltern schon. Den Hut auf hat Kochatelier-Köchin Anna Schlatter. Bevor es richtig losgeht, gibt sie noch Anweisungen:„ Beim Schneiden die Hand zu Krallen zusammenziehen, damit das Messer nicht den Finder erwischt!“ – „Händewaschen nicht vergessen“ – „Und wenn noch jemand auf die Toilette muss ...“ In Zweiergruppen widmen sich die Mädchen je einem geheimnisvollen Rezept an ihren Kochinseln. Die Hiltl-Köche haben die Rezepte eigens für uns entwickelt und sich dabei von Wilhelm Hauffs Märchen inspirieren lassen. Allerdings unter einer Vorgabe: Im Haus Hiltl wird seit Generationen vegetarisch gekocht! Zauber-Kräutersüppchen. Verzaubert wird der kleine Jakob, weil er sich am Marktstand seiner Mutter über das Aussehen der alten Hexe lustig gemacht hat. Aus Rache kocht diese ihm ein Kräutersüppchen, das er niemals vergessen soll: „Iss nur dieses Süppchen, dann wirst du alles bekommen, was dir an mir so gefallen hat. Sollst auch ein guter Koch werden, aber das Kräutlein, hi hi hi ... nein, das Kräutlein sollst du nimmer finden.“ Von welchem Kraut ist hier wohl die Rede? Johanna und Mette bilden das Team für die Kräutersuppe – sie stecken die Köpfe zusammen, studieren die Zutaten, sammeln ihre Kochwerkzeuge zusammen. Mit beängstigend grossen Messern beackern sie Kartoffeln und einiges Gemüse mehr. Die Zwiebeln sind schon in ganz kleine Stücke gehackt, ich sehe Dinkel, verschiedene Gewürze und eine grosse Schüssel mit Erbsen ... Denken die beiden auch an das Kraut? Klösschen mit roter Sauce. Um Leibkoch des dicken Herzogs zu werden, muss Zwerg Nase Geschicklichkeit beweisen. Zum Frühstück befiehlt der Herzog „dänische Suppe und rote Hamburger Klösschen“. Das Küchenpersonal auf dem Schloss hält den Atem an, aber Zwerg Nase sagt: „Nichts leichter als dies, man gebe mir ... zu den Klösschen brauche ich ...“ Ein gewisses Kraut namens Magentrost scheint besonders wichtig zu sein. Auf dem Weg zu vegetarischen „Fleischklösschen“ greifen sich Nadine und Lilli Karotten, im Nu sind sie klein gewürfelt. Die Zwiebeln sehen sie als Herausforderung und veranstalten ein Tränenwettrennen: „Guck, ich weine!“ Stolz werden die Augen noch einmal extra zusammengekniffen. Annalena und Bengi stehen an ihrer Arbeitsfläche und sortieren Kräuter, Paprika, Knoblauch und Schalotten. Ihre rote Sauce soll die Klösschen unvergesslich machen. Konzentriert und recht routiniert zupfen sie ihre Kräuter – ein Meer aus grünen Farben und verführerischen Gerüchen strömt mir entgegen. Rosmarin, Majoran, Estragon, Petersilie – eine Explosion für Augen und Nase. Merlin oder Das wüste Land von Tankred Dorst Regie Christian Stückl, Bühne und Kostüme Stefan Hageneier, Musik Michael Acher Mit Gábor Biedermann, Gottfried Breitfuss, Ursula Doll, Nicola Fritzen, Michael Gempart, Lukas Holzhausen, Sarah Hostettler, Fabian Müller, Jost Op den Winkel, Matthias Renger, Anna Schinz, Jonas Schlagowsky, Siggi Schwientek, Milian Zerzawy, Jirka Zett u.a. Ab 26. November im Schiffbau/Halle Das Zauber-Kräutersüppchen: kein Problem für Johanna und Mette Königin-Pastete. „Köstlich, köstlich“, alle sind von Zwerg Nases Speisen begeistert – doch muss vor allen Dingen der Herzog überzeugt werden. Indessen ruft auch er: „So köstlich war es nie!“ – Somit isst er nun fünfmal statt dreimal am Tag, findet alles neu und trefflich und wird dabei fetter und fetter. Als der Herzog eines Tages Besuch von einem benachbarten Fürsten und grossen 22 23 Mit grossem Appetit verspeisen Nadine, Bengi, Lilli, Mette und Gil die Königin Pastete Kenner der feinen Küche bekommt, muss sich Zwerg Nase an der „Königin der Speisen“ versuchen: Pastete Souzeraine. Der Schrecken ist gross, denn Zwerg Nase weiss nicht recht, wie er diese Speise zuzubereiten hat … Gil und Leslie sind da schon einen Schritt weiter. Die Pilze sind geputzt und in Scheiben geschnitten, die Frühlingszwiebel kleingehackt und die Cherrytomaten halbiert, zum „Kosten“ wandert immer wieder eine kleine Tomate in die Münder der beiden. Die Blätterteigrechtecke mit ihren kleinen Krönchen stehen schon goldgelb bereit, das angebratene Gemüse wird noch kräftig gewürzt, frische Kräuter dazu und dann können die aufgeschnittenen Blätterteigstücke gefüllt werden. Mittlerweile sind wir alle hungrig, aber Erlösung naht – die gekochten Speisen werden serviert. Die kleinen Köchinnen sind im Grossen und Ganzen mit sich zufrieden und haben auch allen Grund dazu. Ihre Rezepte hüten die Mädchen allerdings wie einen Schatz – ganz im Stile der Meisterköche. Nur eines davon bekomme ich zur Verfügung gestellt – zum Nachkochen für unsere grossen und kleinen Leser, als kulinarische Vorbereitung auf den Theaterbesuch. Um jedoch zu erfahren, wie man Kräutersuppe mit Zauberkraft macht, wird man wohl sehr genau auf die Bühne schauen müssen … Königin Pastete Rezept der Hiltl-Köche (für 4 Portionen) 125 g Blätterteig 1 Eigelb 220 g Waldpilze, gemischt (Champignons, Austernseitlinge) 1 Frühlingszwiebel 70 g Cherry-Tomaten 2 EL Öl, Meersalz, Pfeffer aus der Mühle wenig frische Kräuter oder Kresse 1. Den Backofen auf 220 ˚ C vorheizen. 2. Blätterteig 3 mm dick auswallen und mit Wasser bestreichen. Auf den ausgewallten Blätterteig eine zweite Schicht Blätterteig legen und vier Quadrate mit ca. 6 cm Seitenlänge herausschneiden. Mit einem Ausstechförmchen oder von Hand jeweils vier kleine Krönchen aus dem restlichen Blätterteig schneiden, diese jeweils mittig auf die Teigquadrate setzen. 3. Die Teigquadrate 15 Minuten kühl stellen. Auf ein Blech mit Backpapier legen, mit Eigelb bestreichen und in der Mitte des Ofens in 10–15 Minuten goldbraun backen. Auskühlen lassen und quer durchschneiden. 4. Die Pilze putzen, in Scheiben bzw. Streifen schneiden. Die Frühlingszwiebel längs halbieren und schräg in feine Streifen schneiden, Cherry-Tomaten halbieren. 5. Das Öl in einer Bratpfanne erhitzen, die Pilze heiss anbraten. Cherry-Tomaten und Frühlingszwiebeln dazugeben, kurz mit anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. 6. Die Blätterteig-Böden auf vier Tellern auslegen, Pilze darauf verteilen, Deckel schräg auflegen. Mit frischen Kräutern oder Kresse garnieren. Das Hiltl Kochatelier bietet u.a. Kochkurse für Kinder, Jugendliche und Familien Anmeldungen unter: www.hiltl.ch/atelier Hiltl Kochatelier Sihlstrasse 28 8001 Zürich [email protected] 044 227 70 13 Zwerg Nase nach Wilhelm Hauff Regie Corinna von Rad, Bühne Ralf Käselau, Kostüme Sabine Blickenstorfer Mit Irene Eichenberger, Thomas Douglas, Pascal Goffin, Jürg Kienberger, Nicolas Rosat, Lilith Stangenberg, Rainer Süssmilch Ab 19. November im Pfauen Die rote Sauce macht die Klösschen unvergesslich: Bengi schmeckt ab 24 25 Porträt: Patrick Güldenberg Schon immer Schauspieler Patrick Güldenberg ist neuerdings als Volksbürger Herrmann in einer Radikalkomödie von Werner Schwab zu sehen von Thomas Jonigk Hamburg, 1984: Patrick Güldenberg besucht mit seinen Eltern eine Vorstellung von „Tom Sawyer und Huckleberry Finn“. Er ist beeindruckt. Beim Auftritt der Figur mit dem politisch unkorrekten Namen „Neger-Joe“ verstecken sich die Kinder im Zuschauerraum instinktiv unter den Sitzen. Spätestens in dem Moment ist sich der Vierjährige sicher: Er will Schauspieler werden. Im Alter von sieben Jahren ist das Ziel erreicht: Er steht auf der Bühne. Das Stück: „Urmel aus dem Eis“. „Man brauchte jemand, der in ein Ei aus Pappmaché passte, für das mein Rollenvorgänger zu gross geworden war“, sagt er, „und es darin eine halbe Stunde aushält.“ Man entschied sich für Patrick: Er wurde grün bemalt und war Urmel. Später, mit zwölf Jahren, kam das Fernsehen dazu: eine feste Rolle in der Serie „Neues vom Süderhof“, 1999 dann der erste Kinofilm: „Sonnenallee“ in der Regie von Leander Haussmann, seine Filmographie ist bereits jetzt, mit Anfang 30, äusserst umfangreich. Seit der Spielzeit 2009/10 ist Patrick Güldenberg nun Ensemblemitglied am Schauspielhaus Zürich. Nach Arbeiten u.a. am Thalia Theater Hamburg, am Hamburger Schauspielhaus oder am Nationaltheater Weimar (wo er „Hamlet“ war) entschied er sich erstmalig für ein Festengagement und spielte so unterschiedliche Rollen wie den seelenlosen Wirtschaftskriminellen Isidor Weidelich in „Martin Salander“, einen beflissen-anbiedernden Postdirektor in Gogols „Revisor“ oder beeindruckte in Lenz‘ „Der Hofmeister“ als rücksichtsloser Pätus. Und dann sein Sir Andrew Aguecheek. „Was ihr wollt“ stellt 2010 seine erste Zusammenarbeit mit Barbara Frey dar. Patrick Güldenberg schafft eine Figur Den Abgrund hinter der Pointe aufspüren: Patrick Güldenberg zwischen Grössenwahn, Profilneurose, Minderwert und Depression: „Ich wollte die Unvereinbarkeiten dieser Pole verdeutlichen“, erklärt er. „Seine Selbstwahrnehmung ist die eines Helden, nur leider ist er der einzige, der sich so sieht“. Das Resultat: eine ebenso Mitleid erregende wie umwerfend komische Figur. Als man ihn an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover, wo er von 1999–2003 Schauspiel studierte, als komödiantisches Talent bezeichnete, konnte er damit nichts anfangen. Heute geniesst er es, spielerisch mit Traurigkeit und Verzweiflung umzugehen, den Abgrund hinter dem Lachen und der Pointe aufzuspüren. Und spielt wieder Komödie, Radikalkomödie: Werner Schwabs „Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos“. Patrick Güldenberg ist Herrmann Wurm, ein verkrüppelter, künstlerisch ambitionierter Volksbürger, der unter der Last seiner Mutter, unter einem rassistischen, sexistischen und brutalen Umfeld leidet – und daran teilhat. Bei der Lektüre fand er das Stück „extrem komisch“, mittlerweile findet er es im wahrsten Sinne des Wortes „schrecklich komisch“. Das liege vor allem an der (sprach-)gewaltigen Kraft des Textes: Die Sprache hat keine Innerlichkeit, könne auch vom Schauspieler nicht mit Gefühl oder Befindlichkeit befrachtet werden, werde vielmehr wie ein Schutzschild oder eine Waffe vor sich hergetragen: „Die Sprache bei Schwab kennt weder Tabu noch Zensur“, sagt Patrick Güldenberg, „sie ist losgelöst von den Figuren. In ihr formuliert sich das Unbewusste ohne unseren zivilisatorischen Filter: ein aussergewöhnlicher Autor.“ Aussergewöhnlich auch die Besetzung der Kunigunde von Thurneck in Kleists „Käthchen von Heilbronn“ mit Patrick Güldenberg. Er sah im Rahmen des Konzepts von Regisseur Dušan David Pařízek die Chance, von einem Menschen zu erzählen, der sich in seiner Haut nicht wohlfühlt, tatsächlich aus ihr nicht heraus kann. „Die Figur ist ungreifbar“, sagt er, „nicht transsexuell, keine Alte, die sich über Schönheitsoperationen jung hält, kein Automat.“ Bei den Proben hat er sich vorgestellt, wie sich ein Mann, der in seinem eigenen Körper nicht zuhause ist, zu Kleists Zeiten gefühlt haben mag. Entstanden ist eine melancholische, verführerische und in jedem Sinne schöne Figur, bei deren finalem Scheitern keine Häme im Publikum zu spüren war. Patrick Güldenberg ist in Zürich angekommen. Dem Theater bleibt er treu, was künftige Filmprojekte nicht ausschliessen soll: Der Schauspieler ist Fan von Fernsehserien wie „True Blood“, „Twin Peaks“ oder der frühen Staffeln von „24“, Dominik Graf verehrt er und wünscht sich, eines Tages in einem seiner Filme mitzuwirken. Wunsch Nummer zwei: Dass das Publikum ins Theater strömt, um „Volksvernichtung“ zu sehen und es anders macht als der Autor selbst, der gesagt hat, dass er vor der Aufführung seines ersten Stücks „nur ein einziges Mal im Theater war – und das in der Pause“. Thomas Jonigk ist Schriftsteller und Dramaturg am Schauspielhaus Zürich. Siehe auch den Text auf Seite 17. Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos von Werner Schwab Regie Heike M. Goetze, Bühne Bettina Meyer, Kostüme Inge Gill Klossner Mit Ludwig Boettger, Patrick Güldenberg, Franziska Machens, Miriam Maertens, Isabelle Menke, Nicolas Rosat, Milian Zerzawy Im Schiffbau/Box 26 27 Schicht mit: Thomas Unseld Wald in Farbe Im Malsaal ist man dem Spielplan immer schon ein bisschen voraus, denn Bühnenbilder entstehen oft, bevor die Proben beginnen. Thomas Unseld ist seit 2001 Leiter des Malsaals in den Schiffbau-Werkstätten von Eva-Maria Krainz 8.10 Uhr Ich treffe Thomas Unseld in seinem Büro in der Zwischenetage zwischen den beiden grossen Arbeitsräumen des Malsaals – in den Stockwerken darüber und darunter wird bereits gearbeitet. Holzboden, dazwischen kann man bei Bedarf Drähte spannen. Dadurch entsteht ein Raster, an dem sich die Malerinnen orientieren können. Ganz einfach also … Thomas wirkt entspannt und zufrieden mit seinem hochkonzentriert arbeitenden Team. 8.42 Uhr Im Pausenraum beantwortet mir Thomas ein paar Fragen zu seinem Werdegang: Am Schauspielhaus ist er seit 1994 – nach seinem Malerei-Studium an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien hat er hier als Werbemaler begonnen. Werbemaler? Ja, im Pfauenfoyer seien damals gemalte Bilder 8.12 Uhr Auch Thomas ist schon in zu den laufenden Stücken aufgehängt Arbeitskleidung – in seinem Fall eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt, worden. Seit 2001 ist er Leiter des beides mit reichlich Farbspritzern verziert. Malsaals, sieht sich aber nicht als „Chef“: „Einer muss es ja machen, aber im Kurz geht er seinen Posteingang durch, Grunde arbeiten wir hier einfach alle nur eine wirklich wichtige Mail würde er zusammen.“ beantworten. Die dringlichere Aufgabe sehen wir durch eine Glasscheibe einen Stock tiefer vor uns: Das Bühnenportal 9.17 Uhr Wir machen uns auf den Weg für „Volksvernichtung“ wartet darauf, noch ins Sitzungszimmer des Schiffbaus, mit einigen letzten Schichten an GrauThomas muss zur Werkstattbesprechung und Silbertönen überzogen zu werden. für „Zwerg Nase“. Der Bühnenbildner Damit muss er heute noch fertig werden, Ralf Käselau ist gekommen, um mit den denn ab morgen ist der gesamte Malsaal Mitarbeitern der Werkstätten die der Produktion des „Merlin“-Bühnenbildes Produktion des Bühnenbildes zu planen. gewidmet. Ab Mitte November soll sich Auch wenn nicht alles, was im Laufe der die Schiffbauhalle nämlich in eine riesige Besprechung geklärt werden muss, direkt Urwaldlandschaft verwandeln. für Thomas’ Arbeit relevant ist, findet er es doch hilfreich, um einen Gesamteindruck von dem Projekt zu 8.23 Uhr Thomas und ich gehen eine bekommen. Etage nach oben, wo bereits erste Teile des Horizonts zu sehen sind, der bei „Merlin“ nicht nur die Spielfläche, 11.04 Uhr Es geht immer noch um „Zwerg sondern auch die Zuschauertribünen mit Nase“, inzwischen um die Gestaltung „Urwaldpflanzen“ umschliessen wird. des Parkettbodens. Thomas bespricht mit Baumwollstoff ist auf den Boden dem Bühnenbildner die verschiedenen gespannt. Bäume, Sträucher und Farne Holzarten und deren Vor- und Nachteile wurden bereits mit Kohlestift betreffend Aussehen und Belastbarkeit. Er vorgezeichnet, Thomas’ Mitarbeiterinnen wird in den nächsten Tagen mehrere erfüllen den Wald allmählich mit Farbe. Muster liefern und die Maserung jeweils speziell herausarbeiten, damit das Holz bis in die hinteren Reihen lebendig wirkt. 8.28 Uhr Ich folge Thomas vorsichtig Ein Teil des Bodens wird im Übrigen gar durch den Raum und staune über die nicht aus echtem Holz bestehen, sondern Detailgenauigkeit, mit der die Malerinnen „nur“ gemalt werden – was man aus dem die Pflanzen von der verhältnismässig Zuschauerraum natürlich nicht bemerken winzigen Vorlage – einer Reihe von soll. Fotografien im DIN A4-Format – auf die riesigen Stoffflächen übertragen. Amüsiert über meine Verblüffung zeigt 12.35 Uhr Zeit für eine kleine mir Thomas, wie das funktioniert: Am Mittagspause. Im Malsaal wartet eine Rand der Stoffflächen stecken Nägel im willkommene Überraschung auf uns: Begann am Schauspielhaus 1994 als Werbemaler: Thomas Unseld (hier im Malsaal, vor „Merlin“-Prospekten) Einer von Thomas’ Kollegen hat für alle Wildschweinbraten zubereitet – den hat das Team von einem begeisterten Jäger (und ehemaligen Technischen Direktor des Schauspielhauses) bekommen. 13.00 Uhr Thomas trifft sich mit der Theaterplastikerin und dem Konstrukteur, um einen Produktionsplan für die „Merlin“-Landschaft zu erstellen. Die Unterkonstruktion aus Styropor gibt es bereits, nun geht es um die Wahl der Bodenabdeckung und die „Bepflanzung“. Drei grosse Landschaftsteile sollen dicht mit Bäumen, Sträuchern, Farnen und Moos bewachsen sein. 13.06 Uhr Zunächst müssen für jeden einzelnen der zwölf verschiedenen, vom Bühnenbildner gewünschten Baumtypen Material und Herstellung der Äste und Blätter festgelegt werden. Thomas konstatiert, dass die Bäume zu individuell und unterschiedlich sind, als dass man sie in irgendeiner Form käuflich erwerben könnte. Der Wald muss also von den Werkstätten selbst hergestellt werden. Damit ist für ihn klar, was als nächstes zu tun ist: Er wird sich morgen einen ganzen Tag Zeit nehmen, um die Herstellung jedes Baumes detailliert zu planen. Klingt kompliziert. Ist es auch, meint Thomas. In zehn Wochen muss alles fertig sein. 15.25 Uhr Die Besprechung ist für heute zu Ende, man wird sich wieder zusammensetzen, wenn Thomas seine „Baum-Pläne“ erstellt hat. Doch zunächst muss er noch einen Stock tiefer, das Portal für „Volksvernichtung“ mit dem letzten Schliff, besser gesagt: den letzten Farbschichten versehen. Dann ab in die Box damit. „Merlin“ kann kommen. 28 Ins Theater mit: Katharina Epprecht Hören und sehen zusammen Am 15. September 2011 ging Katharina Epprecht auf unsere Einladung hin in die Premiere von „Leonce und Lena“. Sie sass in der 11. Reihe Parkett auf Platz 294. Am nächsten Morgen beantwortete sie den unten stehenden Fragebogen. Katharina Epprecht ist stellvertretende Direktorin des Museums Rietberg und Kuratorin der Japan-Abteilung. Dort eröffnete zuletzt die weltweit erste kulturvergleichende Ausstellung zum Thema Mystik. Von woher kamen Sie zur Vorstellung ins Schauspielhaus? Ich kam mehr oder weniger direkt mit einem kurzen Umziehstopp von meinem Arbeitsort, dem Museum Rietberg, per Fahrrad und zu Fuss. Wie war der erste Eindruck, den das Haus auf Sie gemacht hat? Das Schauspielhaus nehme ich als Eingang und nicht als eigenständiges Gebäude wahr. Dem Heimplatz fehlt der Platz. Der Kulturstadt Zürich fehlt die Piazza oder eine grosse, Schauspielhaus und Kunsthaus im Blick haltende Freilufttreppe wie sie Roger Diener in seinem Entwurf für die KunsthausErweiterung vorgesehen hatte. Was hatten Sie an? Sind Sie aufgefallen? Ein schlichtes auberginefarbenes Kleid von Fidelio, das man nicht bügeln muss und dessen seidener Glanz gut zu meiner schwarzen Lederjacke passt. Ich bin kaum wegen meiner Kleidung aufgefallen, ich mag keine auffälligen, extravaganten Kleider. Es muss praktisch und bequem und wenn irgend möglich fahrradtauglich sein. Wenn ich aufgefallen sein sollte, dann wohl eher, weil ich selbst intensiv beobachte, und dies nehmen dann wiederum andere wahr, was bisweilen zu neugierigen Blickkontakten führt. In welcher Stimmung waren Sie in dem Moment, als im Zuschauerraum das Licht ausging? Glücklich. Ja wirklich, das ist nicht so daher gesagt. Ich war noch ganz erfüllt von dem Tag im Museum, wo wir gerade unsere neue Sonderausstellung über Mystik einrichten. Dies sind die schönsten Momente, wenn die Kunstwerke aus der ganzen Welt eintreffen und man den Objekten physisch ganz nahe ist. Diese Berührungen haben etwas Magisches. So war ich also noch mit unserer eigenen Bühne beschäftigt als das Licht ausging. Haben Sie während der Vorstellung gelacht, und wenn ja, worüber? Ich habe oft gelacht. Meist hing es mit dem Einsatz von Bewegungen oder musikalischen Intermezzi zusammen, die den tiefsinnig satirischen Text kongenial unterstrichen oder verstärkten. Hat Sie etwas an der Vorstellung berührt? Wenn ja, was? Ja, die klägliche Figur des Königs, der sich seine Aufgabe als Staatsoberhaupt und seine Freude an der Hochzeit seines Sohnes wie eine Medizin selbst verordnen muss. Nichts, nicht einmal ein stimmiger Ton kommt aus seinem Innern, es ist alles leer und oberflächlich wie die Konsumgüter, die er mit sich herumschleppt. Entsprach die Aufführung Ihren Erwartungen? Wenn ja, wie sahen diese Erwartungen aus? Wenn nein, warum nicht? Ich hatte keine Erwartungen, ich kannte das Stück nicht, also liess ich mich einfach überraschen. Einzig vielleicht, dass es mich Wunder nahm, ob mich das Stück genauso fesseln würde wie Büchners „Woyzeck“, den ich vor nicht allzu langer Zeit am Stadelhofer Puppentheater sah. Hatten Sie während des Zusehens den Gedanken, dass es besser gewesen wäre, wenn Sie sich vor Ihrem Besuch noch einmal genauer über den Text und den Autor informiert hätten? Nein. Ich lasse generell die Kunst – egal ob Schauspiel, Musik oder bildende Kunst – ganz gerne erstmal unvoreingenommen auf mich wirken. Das schränkt die Wahrnehmung weniger ein. Im Nachhinein will ich dann mehr wissen und bin froh um gute Begleitschriften. Es stört mich nicht, Aha-Erlebnisse mit der Erinnerung zu verbinden oder zu testen, ob ich das Wesentliche auf Anhieb erfasst habe oder nicht. Finden Sie, dass die Aufführung etwas mit Ihnen zu tun hat? Wenn ja, was? Was die Thematik betrifft wenig. Langweile quält mich nicht, eher die begrenzte Zeit, die mir für kreativen Müssiggang bleibt. Hätten Sie Lust, das Bühnenbild zu betreten? Welchen Platz würden Sie sich darin suchen? Eine interessante Frage. Nein, ich verspürte keine Lust, schliesslich sitzt man sehr komfortabel im Dunkeln und kann ganz im Schauen versinken ohne gesehen zu werden. Wenn ich aber aufgefordert worden wäre, auf die Bühne zu treten, hätte ich sicher die Treppe gewählt. Ja, ich merke nun selbst, wie sehr ich Treppen mag. Das liegt wohl daran, dass ein Teil meines Elternhauses aus einem über zwei Stockwerke offenen Raum bestand, durch den eine Treppe in der Art einer stark geneigten Leiter führte. Hier fand alles statt, hier wurde die Weihnachtsgeschichte gelesen, hier konnte man sich bequem einen Dorn aus den Zehen ziehen lassen und das Wichtigste, hier konnte man als Kind etwas abseits seine eigene Perspektive auf die Erwachsenenwelt wählen. Haben Sie sich nach der Vorstellung über das Stück unterhalten? Ja, ich stiess gerade beim Verlassen der Sitzreihe direkt auf Herrn und Frau Muschg. Adolf Muschg meinte, „Leonce und Lena“ sei eines seiner liebsten Bühnenstücke, er habe sicher schon zehn Inszenierungen gesehen, denn ihn fasziniere dieser facettenreiche und fortschrittliche Text immer wieder aufs Neue. Welche Frage würden Sie dem Regieteam dieser Aufführung gerne stellen? Wie sie mit dem Zusammenwirken zwischen Hören und Sehen umgehen. Dies scheint mir die grösste Herausforderung bei einem so dichten Text. Wie vermeide ich, dass das Sehen vor das Hören tritt und Inhalt verloren geht? Welches Stück würden Sie gerne als nächstes sehen? „Die Frau in den Dünen“ von Abe Kôbô. 29 Lukas Bärfuss: Mörderisches Zürich Kann aufgelöst werden Vom Theater bleibt nichts übrig. Nichts, was man anfassen könnte. Wenn am Sonntagabend die letzten Besucher die Stadtinstallation „Alles muss weg!“ in der Schiffbauhalle verlassen haben und der Abbau beginnt, erinnert schon am Tag darauf wenig an die neun Tage urbanen Ausverkauf. Wehklagen wird nicht helfen: Auch diese Produktion ist den Weg aller Theaterproduktionen gegangen. Sie ist „abgespielt“, wie es im Jargon heisst. Der künstlerische Betriebsdirektor hat den „Auflöser“ an alle Abteilungen geschickt. Gut sichtbar hängt dieser Exekutionsbefehl am Schwarzen Brett. „Die Produktion ist bedauerlicher Weise abgespielt. Sie kann aufgelöst und die Ausstattung verwertet werden.“ Und das heisst: Was keine Aussicht auf Wiederverwendung hat, landet im Sperrgut und wird vernichtet, die Kostüme werden eingemottet, die Plakate abgehängt. Die Menschen am Theater sind an die Vorläufigkeit ihrer Arbeit gewöhnt, aber gewöhnen kann man sich nicht daran. Man lebt mit einer Kunst, von der kein materielles Zeugnis bleibt und die ausschliesslich in der Erinnerung jener fortdauert, die sie erlebten – ob hinter, vor oder auf der Bühne. Während seiner kurzen Existenz ist das Theater einem beständigen Wandel unterworfen. Und dieser vollzieht sich für die Beteiligten oft ungleichzeitig. An der Leseprobe, wenn für die Schauspieler die eigentliche Arbeit beginnt, legt der Autor sein Werk endgültig in fremde Hände und sagt Adieu. Und für die Zuschauer und die Schauspieler ist die Premiere der Anfang ihres Zusammentreffens, doch für den Regisseur ist es das Ende seiner Arbeit. Für ihn gibt es nichts mehr zu tun; Schauspielhaus Zürich Zeitung #3 Herausgegeben von der Schauspielhaus Zürich AG Zeltweg 5, 8032 Zürich www.schauspielhaus.ch Intendanz Barbara Frey Diese Zeitung wird ermöglicht durch Swiss Re und Credit Suisse. erwartet wird nur noch seine Abreise. Theatermenschen sind Experten im Abschiednehmen. Deshalb war der Titel der Stadtinstallation „Alles muss weg!“ im Schiffbau auch ein wenig das geheime Motto der Theaterarbeit. Der Umgang mit dem Ephemeren, mit der Tatsache, dass nichts lange währt, belebt. Gewohnheiten können sich nicht einspielen, aus jeder Routine wird man bald gerissen. Aber das Gegenteil trifft auch zu. Gerade, wenn man es sich gemütlich gemacht hat und angekommen ist, wird die Behaglichkeit zerstört. Das ist oft unangenehm und manchmal grausam. Aber es ist unvermeidlich, weil das Theater hier nur einem Lebensprinzip folgt. Fausts Todeswort „Oh, Augenblick verweile doch, du bist so schön!“ beendet nicht nur sein Leben, sondern auch den Theaterabend. Träumen, dann müssen sie einen Zugang zu ihrer Erinnerung finden. Nur dann können sie wissen, was schlecht und was gut war an der alten Zeit. Erst dann kann man sich fragen, wie man die Rückkehr des einen verhindert und des andern befördert. Vielleicht, so meinte einmal der Schriftsteller Gerhard Meier, vielleicht leben wir nur, um uns zu erinnern. Erst wer erzählt, sich und anderen, wie es früher gewesen und warum die Welt von heute so ist, wie sie ist, kann vergleichen. Und nur wer vergleichen kann, kann sich ein Urteil bilden. Darüber, was einfach nur neu ist – und was von diesem Neuen lebenswert. Theater ist eine Erinnerung, die uns die Gegenwart erklärt. Wandel vernichtet und erzeugt. Man kann das in Zürich zur Zeit deutlich sehen. Wohnblöcke, Fabriken, Kneipen. Städte verschwinden und entstehen neu. Die in Stein gehauene Wirklichkeit muss dem erst Gedachten weichen. Wo jemand seine ersten Jahre verbrachte, entsteht einem Kind eine neue Heimat. Es gibt nur die Erinnerung, die uns mit dem Vergangenen verbindet. Nur sie ist dem Lauf der Zeit enthoben. Die Geschichten, die wir uns erzählen, in Romanen, Filmen und Theaterstücken, sind Zeitmaschinen. Die Welt Goethes und Shakespeares wird durch die Lektüre zu unserer Gegenwart. Wenn die Menschen den Wandel gestalten wollen, nach ihren Wünschen, nach ihren Redaktion Lukas Bärfuss, Katja Hagedorn, Thomas Jonigk, Roland Koberg (Leitung), Eva-Maria Krainz, Meike Sasse, Andrea Schwieter Gestaltung velvet.ch / Daniel Peter Druck Speck Print AG, Baar Auflage 20 000, erscheint am 6.10.2011 Partner des Schauspielhauses Zürich Fotos Matthias Horn S. 1/4/6/10/ 11 unten/15 unten, Roland Koberg S. 20 T+T Fotografie S. 8/9/11 oben/13/16/ 18/21 – 26/32, Leonard Zubler S. 15 oben 30 31 carNage ist grosses, raffiNiertes Boulevardtheater, das geNüsslich WeltaNsichteN uNd eheglücke filetiert. der BuNd jodie FOSTER kate WINSLET christoph WALTZ john c. REILLY Die Essenz des Lebens finden Sie täglich im Schauspielhaus Zürich. Kultur schafft gemeinsame Werte. Deshalb unterstützen wir Organisationen und Institutionen, die diese Herausforderung annehmen. Mehr über unsere Partnerschaft mit dem Schauspielhaus Zürich erfahren Sie auf unserer Website. www.swissre.com/sponsoring E G A N R A C EtzEls m E G s E D t t o DER G Nach dem erfolgsstück «der gott des gemetzels» voN YasmiNa reza eiN film voN FILMFESTIVAL VENEDIG 2011 Venezia 68 - Competition Ab 1. DEZEmbER Im RIffRAff & WEITEREN KINoS 32 „Immer stürzen aus deinen Innereien solche gemeinen Fragen hervor.“ aus „Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos“ von Werner Schwab