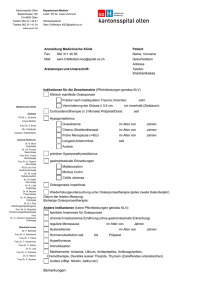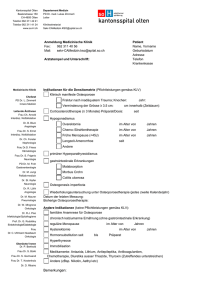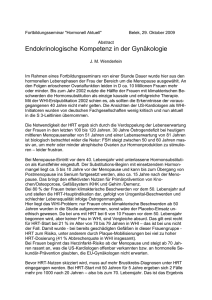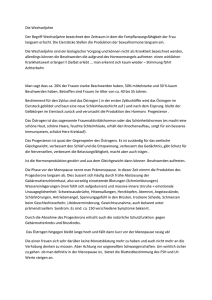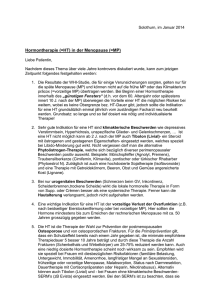1 AKE Innsbruck 2007 Dr. Jörg Niewöhner, Labor - AKE
Werbung
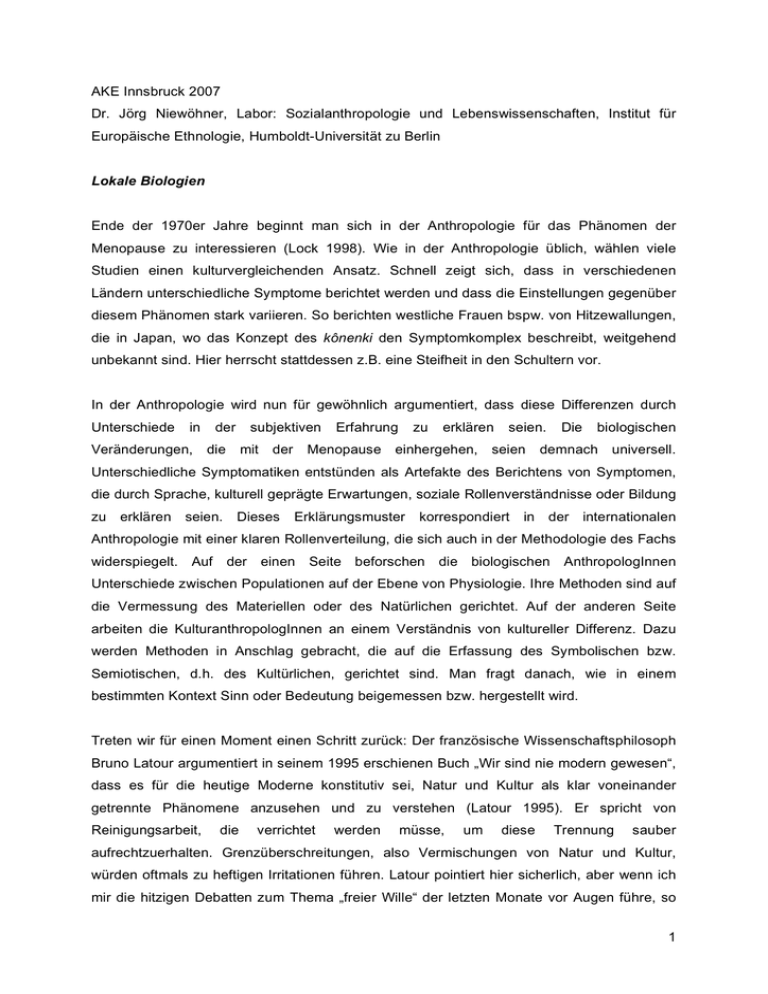
AKE Innsbruck 2007 Dr. Jörg Niewöhner, Labor: Sozialanthropologie und Lebenswissenschaften, Institut für Europäische Ethnologie, Humboldt-Universität zu Berlin Lokale Biologien Ende der 1970er Jahre beginnt man sich in der Anthropologie für das Phänomen der Menopause zu interessieren (Lock 1998). Wie in der Anthropologie üblich, wählen viele Studien einen kulturvergleichenden Ansatz. Schnell zeigt sich, dass in verschiedenen Ländern unterschiedliche Symptome berichtet werden und dass die Einstellungen gegenüber diesem Phänomen stark variieren. So berichten westliche Frauen bspw. von Hitzewallungen, die in Japan, wo das Konzept des kônenki den Symptomkomplex beschreibt, weitgehend unbekannt sind. Hier herrscht stattdessen z.B. eine Steifheit in den Schultern vor. In der Anthropologie wird nun für gewöhnlich argumentiert, dass diese Differenzen durch Unterschiede in Veränderungen, der subjektiven die mit der Erfahrung zu erklären Menopause einhergehen, seien. seien Die biologischen demnach universell. Unterschiedliche Symptomatiken entstünden als Artefakte des Berichtens von Symptomen, die durch Sprache, kulturell geprägte Erwartungen, soziale Rollenverständnisse oder Bildung zu erklären seien. Dieses Erklärungsmuster korrespondiert in der internationalen Anthropologie mit einer klaren Rollenverteilung, die sich auch in der Methodologie des Fachs widerspiegelt. Auf der einen Seite beforschen die biologischen AnthropologInnen Unterschiede zwischen Populationen auf der Ebene von Physiologie. Ihre Methoden sind auf die Vermessung des Materiellen oder des Natürlichen gerichtet. Auf der anderen Seite arbeiten die KulturanthropologInnen an einem Verständnis von kultureller Differenz. Dazu werden Methoden in Anschlag gebracht, die auf die Erfassung des Symbolischen bzw. Semiotischen, d.h. des Kultürlichen, gerichtet sind. Man fragt danach, wie in einem bestimmten Kontext Sinn oder Bedeutung beigemessen bzw. hergestellt wird. Treten wir für einen Moment einen Schritt zurück: Der französische Wissenschaftsphilosoph Bruno Latour argumentiert in seinem 1995 erschienen Buch „Wir sind nie modern gewesen“, dass es für die heutige Moderne konstitutiv sei, Natur und Kultur als klar voneinander getrennte Phänomene anzusehen und zu verstehen (Latour 1995). Er spricht von Reinigungsarbeit, die verrichtet werden müsse, um diese Trennung sauber aufrechtzuerhalten. Grenzüberschreitungen, also Vermischungen von Natur und Kultur, würden oftmals zu heftigen Irritationen führen. Latour pointiert hier sicherlich, aber wenn ich mir die hitzigen Debatten zum Thema „freier Wille“ der letzten Monate vor Augen führe, so 1 komme ich nicht umhin, die Scharmützel zwischen Philosophie und Neurowissenschaften in der Tat als eine Art Reinigungsarbeit zu begreifen, die Deutungshoheiten klärt und Untersuchungsobjekte abgrenzt. Latour, und mit ihm viele andere, sehen den Beginn dieser Entwicklung in der kartesianischen Trennung von Körper und Geist (Scheper-Hughes & Lock 1987). Eine Trennung, die für uns so fundamental geworden ist und die sich in disziplinären Denkstilen der Wissenschaften, in Politik und Wirtschaft wie in den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens in mannigfaltigster Weise derart manifestiert hat, dass wir sie gemeinhin gar nicht mehr wahrnehmen. Dieser kurze Exkurs soll uns vor Augen führen, dass die Trennung in eine biologische und eine symbolische Menopause nicht lediglich ein Phänomen der Menopause selbst und auch nicht der Anthropologie oder der 80er und 90er Jahre ist, sondern dass es sich hier um eine historisch wie gesellschaftlich tief verwurzelte Verfasstheit handelt. Wenn wir also beginnen, darüber nachzudenken, ob und wie es sinnvoll sein könnte, die Dichotomie von Biologie und Kultur nicht bereits im Forschungsdesign und in den Methoden zu reproduzieren, so begeben wir uns genau in diesen so argwöhnisch beäugten Grenzbereich. Margaret Lock, eine der herausragenden Medizinanthropologinnen der letzten 25 Jahre, hat es sich wie keine Andere zur Aufgabe gemacht, diesen Grenzbereich zu besiedeln und sich darin wohlzufühlen. Ihre wegweisenden Arbeiten zu Menopause in Japan und Kanada haben von Anfang an die Idee eines biologisch universellen Phänomens problematisiert (Lock 1982; 1986a; b; 1995). Lock arbeitete mit dem Konzept der menopausal experience, d.h. der Frage, wie Menopause in verschiedenen Kontexten erlebt wird. Dieser Ansatz zieht nicht schon im Design eine deutliche Trennung zwischen Biologie und kulturellem Kontext ein. Zwar hat Lock den Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere auch in biologischen Laboren zugebracht. Ihre methodischen Kompetenzen liegen allerdings eindeutig auf dem Gebiet der Kulturanthropologie, d.h. klassischer Feldforschung, teilnehmender Beobachtung und Interviews. Ihre Version der erlebten Menopause schloss daher zu Beginn ihrer Arbeit zwar biologische Unterschiede theoretisch mit ein, produzierte aber eine dichte Beschreibung auf der Ebene von Sprache und Symbolik. Parallel dazu wurde selbstverständlich in den Naturwissenschaften untersucht, welche der Unterschiede in den berichteten Symptomen „realer“ Natur sind, d.h. inwiefern biologische Parameter zwischen verschiedenen Populationen variieren. Zumeist im Kontext national vergleichender Studien wurden hormonelle Faktoren, BMI, Alter und andere identifiziert. Gemeinsam mit den Grenzgängerinnen Melissa Melby und Patricia Kaufert, beides biologisch orientierte Medizinanthropologinnen, hat Lock sich in den letzten Jahren die 2 breitgefächerte und unübersichtliche Literatur, die aus den oben skizzierten Forschungsstrecken entstanden ist, noch einmal vorgenommen (Melby et al 2005). Dabei legen sie ihrer Analyse das Konzept der local biology, also der lokal spezifischen Biologie, zugrunde (Lock 2005; Lock & Kaufert 2001). Dieses verweist zum einen auf die Dialektik zwischen und die Interdependenz von Biologie und Kultur. Zum anderen betont es die Plastizität biologischer Konstellationen. Ein Beispiel aus dem Bereich der Ernährung macht deutlich, was mit diesem Konzept gemeint ist: Das japanische Symptommuster des kônenki unterscheidet sich in den 80er Jahren wesentlich deutlicher von einem nordamerikanischen, als dies heute der Fall ist. Man beobachtet eine Verschiebung des japanischen Musters, die als Verwestlichung interpretiert wird. Zu einem Teil lässt sich dies biologisch erklären, da eine Veränderung der Ernährung die Sojaaufnahme in Japan und damit auch die Isoflavonaufnahme reduziert und die Hormonbalance in Richtung Nordamerika verschoben hat. Zwar ist die Datenlage für eine exakte Quantifizierung dieses Effekts noch ungeeignet, aber die Erklärung scheint plausibel. Allerdings unterscheidet sich das heutige japanische Symptommuster weiterhin deutlich von Japanerinnen, die in den USA leben. Parallel zu einer Veränderung von Essgewohnheiten kommt es in Japan in den 90er Jahren zu einer Medikalisierung von kônenki durch extensive Berichterstattung in der Presse (Kaufert & Lock 1997). Kônenki wird jetzt erstmals als ein medizinisches Phänomen diskutiert, das mit hormonellen Verschiebungen zu tun hat und das daher Hitzewallungen und Reizbarkeit mit sich bringt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass japanische Frauen diese Symptome nun vermehrt angeben, das Muster sich also dem nordamerikanischen annähert. Kulturelle Veränderungen führen hier also zum einen zu biologischen Veränderungen, zum anderen aber auch zu einer veränderten Selbstwahrnehmung und einer anderen Art über Körperlichkeit zu berichten. Unsere moderne Art nach einer biologischen Grundlage zu fragen und Kultur lediglich als Epiphänomen zu betrachten, scheitert im Fall der Menopause, da uns keine zufrieden stellende biologische Definition gelingt, mit der wir die biologische Menopause von der erlebten, kultürlichen Menopause separieren können. Selbstverständlich könnten wir beginnen, einen biologischen Kriterienkatalog festzulegen, der Menopause für bestimmte Populationen über Hormonspiegel, BMI, Alter etc. festlegt. Wir könnten auch einen kulturellen Kriterienkatalog aufstellen, der Menopause für bestimmte Gruppe über Sprache, kulturelle Praxen, Artefakte etc. definiert. Beides würde der menopausal experience nicht gerecht. Es hilft uns nicht, nach einer Essenz der Menopause in Biologie oder Kultur zu 3 suchen, denn, wenn wir schon eine Essenz benötigen, so ist sie in der dynamischen Interdependenz der beiden zu suchen. Inwiefern kann uns nun das Konzept der local biology im Kontext von Ernährung, Krankheit und Nutrigenomik nützlich sein? Kardiovaskuläre Erkrankungen sind Phänomene, deren Definition heutzutage den MedizinerInnen obliegt. Zwar werden Definitionen immer wieder debattiert und überarbeitet, aber prinzipiell sind diese Erkrankungen messbar und damit vor allem biologische Ereignisse. Zu Fragen, wie sie erlebt werden scheint unnötig, denn wir können objektiv bestimmen, wann bspw. ein Herzinfarkt vorliegt und wann nicht. Gleiches gilt für die verschiedenen Risikomarker, die seit den 1950er Jahren etabliert wurden. Ein metabolisches Syndrom, zum Beispiel, lässt sich mit Waage, Maßband und Blutbildanalysen erkennen. Nun müssen wir drei Ebenen auseinanderhalten: zum einen, wie biologisch klar definierte nosologische Einheiten angesichts zunehmender Komplexität überhaupt zustande kommen, wie sie stabilisiert werden und welche Vorannahmen dafür wesentliche Rollen spielen (Aronowitz 1998; Hacking 1990; Young 1995); hier bewegen wir uns in den wichtigen Bereich der empirischen Wissenschaftsforschung und der Wissenschaftsgeschichte, den ich in diesem Kontext aber ausklammern möchte; zweitens, wie vor dem Hintergrund dieser klar definierten nosologischen Einheiten Symptome erlebt werden und, zum dritten, wie sich diese erlebten nosologischen Einheiten zum Konzept einer local biology verdichten. Den zweiten Punkt, das Erleben der Symptome, möchte ich nur kurz anschneiden: Die Tatsache, dass Frauen aufgrund kultureller Prägungen Herzinfarktsymptome anders berichten als Männer, führt dazu, dass Rettungsdienste im Fall von Herzinfarkten bei Frauen signifikant später am Einsatzort eintreffen als bei Männern (Maier et al 2004). Dies hat massive biologische Konsequenzen. Gleiches gilt für Übergewicht in kulturellen Kontexten, in denen Dick-sein positiv konnotiert ist oder für Magersucht in westlichen Gesellschaften, in denen dünn sein ein wichtiger Statusmarker geworden ist. Hier werden direkte feedback Effekte zwischen Körper und Kultur sichtbar. Die kulturell wie institutionell geprägte Eigenund Fremdwahrnehmung der Körper verändert sowohl diese Körper wie auch die Kultur, in der sie sich bewegen. Der kanadische Wissenschaftsphilosoph Ian Hacking spricht von looping Effekten und betont damit die Rolle von medizinischen Klassifikationen in diesem Kontext (Hacking 2006). Wenn aktuelle Kriterien für das metabolische Syndrom 90% der über 50-Jährigen eines norwegischen Bezirks als at risk klassifiziert, muss die Frage erlaubt sein, ob wir die Konsequenzen dieser medizinischen Praxis ausreichend im Blick haben (Westin & Heath 2005). Dies verweist auch auf eine wichtige Unterscheidung zwischen 4 Körper als Material und Biologie als Bios Logos, d.h. als wissenschaftliche Praxis durch die wir Körper auf eine spezifische Art und Weise wahrnehmen können. Der letzte Punkt, der Bezug zwischen erlebter nosologischer Einheit und local biology, ist zentral und bringt mich erstens näher an die Nutrigenomik und zweitens zum Schluss. Artikel zu Nutrigenomik, und ich hoffe, Sie verzeihen mir diese Bemerkung, zeichnen sich für HalbAußenstehende z.Z. vor allem dadurch aus, dass sie über hochspezifische Phänomene berichten, deren Bedeutung nur noch für wenige Spezialisten nachzuvollziehen sein dürfte. Von dieser molekularen Ebene geht es dann ohne Übergang im nächsten Satz zu der These, dass man dadurch bald individuelle Risikoprofile bzw. Präventionsmaßnahmen wird erstellen können. Es ist klar und nicht weiter von Interesse, warum papers mit diesen letzten Absätzen schließen. Interessant ist jedoch zu überlegen, wie man das Molekulare mit dem Phänotyp zu verbinden gedenkt. Hier geht es, so scheint es mir, letztlich weniger um Individualisierung, sondern um die Aufgabe, Subpopulationen zu identifizieren, die im Hinblick auf relevante Biomarker eine ausreichende Homogenität aufweisen. Das Konzept der local biology signalisiert nun, dass diese Biomarker eine kulturelle Spezifik aufweisen. Gerade hier ist die Nutrigenomik als eine junge Wissenschaft, die epigenetische Erkenntnisse bereits in systembiologische Ansätze einbaut, auf einem interessanten Weg, da die kulturelle Spezifik sowohl des Nährstoffangebots als auch der genetischen Ausstattung mitgedacht wird. Hier ist es nun allerdings wichtig, den Kulturbegriff ein wenig zu differenzieren. In den allermeisten Studien wird Kultur entweder mit Nationalität gleichgesetzt oder über das Konzept der Ethnie mit einer spezifischen Physiologie/Genetik verbunden. Dieser Ansatz erwächst vor allem aus einer verständlichen Forschungspragmatik und notwendigem methodischen Reduktionismus. Kultur im sozialanthropologischen Sinne bezeichnet jedoch zum einen den hochgradig ausdifferenzierten sozialen Alltag in einem bestimmten Raum, z.B. einer Region, einer Metropole oder einer Organisation. Gerade im urbanen Raum, der durch seine hohe Dichte und Durchmischung unterschiedlichster Lebensformen quasi als ein Labor für gesellschaftlichen Wandel betrachtet werden kann, gelten ethnische Zugehörigkeiten nur noch bedingt als relevante Parameter. Zum anderen bringt ein sozialanthropologischer Kulturbegriff auch eine historische Tiefenschärfe mit sich, der Alltagspraxis immer auch in einem zeitlichen Kontext versteht. Die Forschungsstrecke, die sich nun anbietet, erweitert die bisherigen Ansätze auf zweifache Art und Weise. Erstens, die bereits von Vielen geforderte stärkere und präzisere Ausdifferenzierung von Phänotypen sollte auch bedeuten, ein Methodenrepertoire 5 aufzubauen, das soziale, kulturelle, räumliche und zeitliche Spezifik mitdenken und beobachten kann (Ordovas & Corella 2004). Zweitens, und brisanter, kann es meines Erachtens nicht mehr darum gehen, ätiologische Modelle und Interventionen auf Populationen auszurichten, die lediglich über bestimmte Biomarker charakterisiert werden. Denn die zunehmende Ausdifferenzierung unseres Wissens über biologische Prozesse trägt nicht zu Erklärungsmodellen bei, die von kulturellem bias gereinigt wären, sondern, im Gegenteil, produziert immer mehr Verweise auf die Notwendigkeit einer komplexen Integration kulturell dominierter Phänomene (Griesemer 2002; Jablonka & Lamb 2006). Das wachsende molekulare Verständnis biologischer Prozesse produziert also keinen hermetischen biologischen Körper, der durch die Haut als last line of defense begrenzt und geschützt ist, wie es Arthur Bentley bereits in den 1940ern problematisierte (Bentley 1941). Stattdessen stellt bspw. ein Methylierungsmuster eine Verbindung her zwischen einer spezifischen molekularen Konstellation in einem Patienten und der Nahrungsversorgung seiner Urgroßmutter, d.h. einem Phänomen, das mittels biologischer Methoden allein gar nicht erfassbar ist (Kaati et al 2002). Hier geht es also nicht um eine Verschiebung innerhalb eines Modells linearer Kausalität, sondern um die komplexen Interdependenzen und Rückkopplungseffekte zwischen verschiedenen Faktoren, die mittels biologischer oder sozial und kulturwissenschaftlicher Instrumentarien sichtbar und verständlich gemacht werden können (Fox Keller 2006). Wissenschaftstheoretisch begeben wir uns hier von einem statischen Denken in Strukturen und Funktionen in Richtung prozessorientierter Ansätze (Whitehead 1968). Diese Pfade in die black box zwischen Genom und Phänotyp werden nicht nur in der Nutrigenomik hauptsächlich mit der epidemiologischen Machete geschlagen. Epidemiologie hat allerdings eine Tendenz entweder upstream auf soziale und materielle Bedingungen oder downstream auf biologische Konstitutionen zu fokussieren (Charlesworth et al 2004). Die intersubjektive Ebene, das Erlebte, der Alltag spielen eine geringe Rolle. Dabei spielen sich hier die elementaren und alltäglichen Vermittlungsprozesse ab, die Biologisches mit Kulturellem verweben. Konzepte wie Scham, Demütigung oder Mitgefühl sind wichtige Parameter, die bisher als biokulturelle Phänomene nur völlig unzureichend untersucht wurden. Dieses Zitat stammt von einem 30-jährigen Arbeitslosen, der sich im Wartesaal des Sozialamts einen Platz sucht (Charlesworth et al 2004): „ Da waren halt so Stühle gewesen neben dieser eingebildeten Tussi, dünn, attraktiv, middle class. Und ich so: Neben der sollst Du nicht sitzen. I hab’ mich plötzlich unförmig gefühlt, 6 übergewichtig. Ich habe angefangen zu schwitzen, angefangen zu stümpern, rumzurutschen. Ich dachte nur: ‚Nein, da setz’ ich mich nich hin. Das wär für die ja krass peinlich.’ [...] Das is dann wie ne Barriere, die sagt ‚Hör mal zu low life, wehe Du kommst mir zu Nahe. [...] Wir bezahlen dafür, dass wir nicht neben Dreck wie Dir sitzen müssen.’ [...] Natürlich sind die fuck all, die haben nix, aber da is so ne Atmosphäre um die rum. Die haben das richtige, den Körper, die Klamotten un alles, das Selbstvertrauen, die Attitude, verstehst Du? Wir haben‘s nicht, wir können es nicht haben. Wir kommen rein wie ein geprügelter Hund, schlurfen mit den Füssen, wenn wir rein kommen. Du fühlst Dich, als wollste Dich verstecken.“ (Übersetzung des Autors) Ich denke, dieses Zitat zeigt sehr gut eine komplexere Art der Verzahnung von Biologie und Kultur, die im bisherigen Methodenspektrum nicht sichtbar wird. Die permanent empfundene Demütigung der sozialen Differenz, oder medizinischer formuliert, der chronische soziale Stress, produziert akute und wohl auch langfristige physiologische Effekte (McEwen 2000). Und hier zeigt sich auch eine politisch-moralische und wenn Sie wollen ethische Komponente der derzeitigen Forschung. Sie macht bestimmte Dinge sichtbar aber sie verdeckt andere. Lassen Sie mich zusammenfassen: Das Konzept der lokalen Biologie oder, spezifischer formuliert, des lokalen oder situierten Bios wendet sich gegen Forschungsansätze, die eine markante Trennung zwischen Biologie und Kultur reproduzieren. Es unterstreicht die komplexe Interdependenz von Kultur und Biologie und betont die Plastizität des Bios. Die Nutrigenomik, bzw. die Ernährungswissenschaften im weitesten Sinne, bieten meines Erachtens einen guten Ansatzpunkt neue Wege auszuprobieren, da zum einen auf der naturwissenschaftlich-medizinischen Seite durch Epigenetik, (epi)genetische Epidemiologie und Systembiologie die Ansätze für ein komplexeres und dynamischeres Verständnis von Biologie Fuß fassen. Zum anderen, aus sozialanthropologischer Sicht, stellt Ernährung eine hochgradig kulturell geprägte Praxis dar, die immer auch soziale Differenzen, materielle Bedingtheiten und Körperkonzepte reflektiert. Abseits des disziplinären Forschungsalltags wird es also darum gehen, innovative Forschungsdesigns auszutüfteln und durchzusetzen, die diese Anfänge einander annähern können und die mit den entstehenden Interdependenzen umgehen können. Dabei stehen zum einen biographische und intergenerationale Aspekte im Vordergrund (Langzeitstudien). Zum anderen gilt es in Querschnittstudien entweder kulturelle Differenz in experimentelle Designs zu integrieren oder experimentelle set-ups in die jeweiligen Alltage zu tragen. Auch eine kulturelle Erweiterung einer epigenetischen Epidemiologie stellt keine leichte 7 Herausforderung dar. Letztlich muss sowohl der Suche nach systematischen Mustern als auch den Spezifika lokaler Kontexte Aufmerksamkeit zu teil werden. Vielen Dank. 8 Literaturverzeichnis: Aronowitz R. 1998. Making sense of illness. Science, Society and Disease. Cambridge: Cambridge University Press Bentley AF. 1941. The Human Skin: Philosophy's last line of defense. Philosophy of Science 8:1-19 Charlesworth SJ, Gilfillan P, Wilkonson R. 2004. Living inferiority. British Medical Bullettin 69:49-60 Fox Keller E. 2006. Is "epigenetic inheritance" a contradiction in terms? Zwischen "Vererbung erworbener Eigenschaften" und Epigenetik. Berlin Griesemer J. 2002. What is epi about epigenetics. Annals of the New York Academy of Sciences 981:97-110 Hacking I. 1990. The taming of chance. Cambridge: Cambridge University Press. 264 pp. Hacking I. 2006. Kinds of People: Moving Targets. British Academy Lecture 10:1- 18 Jablonka E, Lamb MJ. 2006. The evolution of information in the major transitions. Journal of Theoretical Biology Special Issue in Memory of John Maynard Smith 239:236-46 Kaati G, Bygren LO, Edvinsson S. 2002. Cardiovascular and diabetes mortality determined by nutrition during parents' and grandparents' slow growth period. European Journal of Human Genetics 10:682-8 Kaufert PA, Lock M. 1997. Medicalization of women's third age. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology 18:81-6 Latour B. 1995. Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie. Berlin: Akademie Verlag Lock M. 1982. Models and Practice in Medicine - Menopause as Syndrome or Life Transition. Culture Medicine and Psychiatry 6:261-80 Lock M. 1986a. Ambiquities of Aging - Japanese Experience and Perceptions of Menopause. Culture Medicine and Psychiatry 10:23-46 Lock M. 1986b. Anthropological Approaches to Menopause - Questioning Received Wisdom - Introduction. Culture Medicine and Psychiatry 10:1-5 Lock M. 1995. Women, Middle-Age, and Menopause in Japan and North-America. Womens Health Issues 5:74Lock M. 1998. Menopause: lessons from anthropology. Psychosom Med 60:410-9 Lock M. 2005. Cross-cultural vasomotor symptom reporting: conceptual and methodological issues. Menopause-the Journal of the North American Menopause Society 12:239-41 Lock M, Kaufert P. 2001. Menopause, local biologies, and cultures of aging. American Journal of Human Biology 13:494-504 Maier B, Theres H, Gothe RM, Kallischnigg G, Thimme W. 2004. Unterschiede in der Behandlung und in der Krankenhaussterblichkeit von Männern und Frauen mit akutem Herzinfarkt – Ergebnisse des Berliner Herzinfarktregister 1999–2002. Gesundheitswesen 66 McEwen BS. 2000. Protective and damaging effects of stress mediators: central role of the brain. Biological Basis for Mind Body Interactions 122:25-34 Melby MK, Lock M, Kaufert P. 2005. Culture and symptom reporting at menopause. Human Reproduction Update 11:495-512 Ordovas JM, Corella D. 2004. Nutritional genomics. Annu. Rev. Genomics Hum. Genet. 5:71-118 Scheper-Hughes N, Lock M. 1987. The mindful body. Medical Anthropology Quarterly 1:? Westin S, Heath I. 2005. Thresholds for normal blood pressure and serum cholesterol. BMJ 330:1461-2 Whitehead AN. 1968. Modes of Thought. New York: The Free Press Young A. 1995. The Harmony of Illusions: Inventing Post-Traumatic Stress Disorder. Princeton: Princeton University Press 9