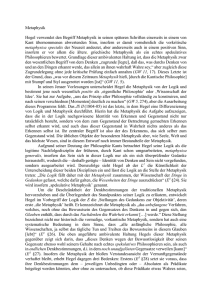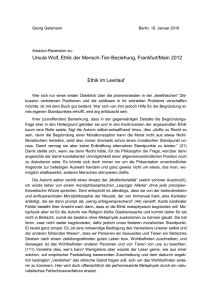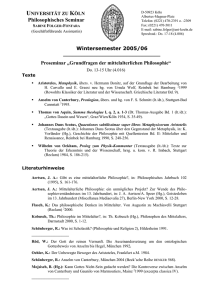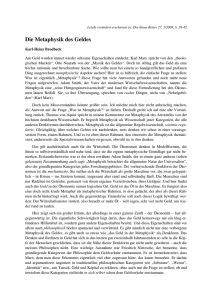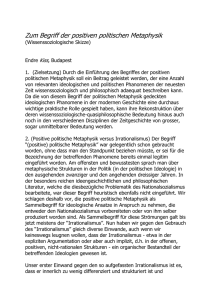Guardini lecture Metaphysik.2
Werbung
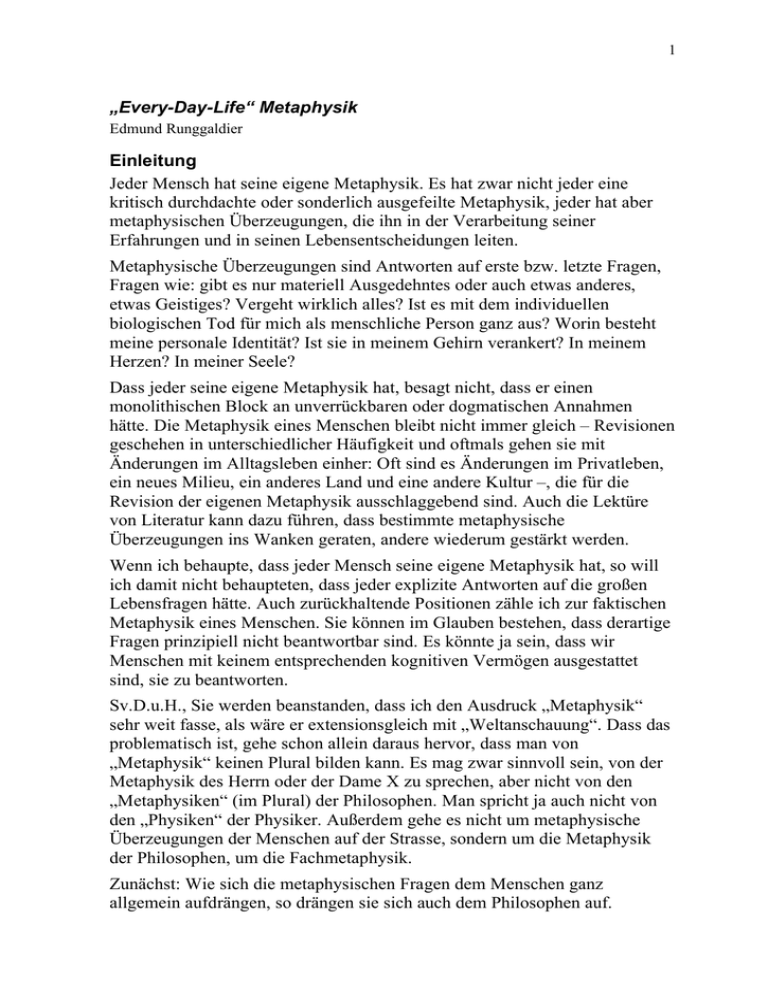
1 „Every-Day-Life“ Metaphysik Edmund Runggaldier Einleitung Jeder Mensch hat seine eigene Metaphysik. Es hat zwar nicht jeder eine kritisch durchdachte oder sonderlich ausgefeilte Metaphysik, jeder hat aber metaphysischen Überzeugungen, die ihn in der Verarbeitung seiner Erfahrungen und in seinen Lebensentscheidungen leiten. Metaphysische Überzeugungen sind Antworten auf erste bzw. letzte Fragen, Fragen wie: gibt es nur materiell Ausgedehntes oder auch etwas anderes, etwas Geistiges? Vergeht wirklich alles? Ist es mit dem individuellen biologischen Tod für mich als menschliche Person ganz aus? Worin besteht meine personale Identität? Ist sie in meinem Gehirn verankert? In meinem Herzen? In meiner Seele? Dass jeder seine eigene Metaphysik hat, besagt nicht, dass er einen monolithischen Block an unverrückbaren oder dogmatischen Annahmen hätte. Die Metaphysik eines Menschen bleibt nicht immer gleich – Revisionen geschehen in unterschiedlicher Häufigkeit und oftmals gehen sie mit Änderungen im Alltagsleben einher: Oft sind es Änderungen im Privatleben, ein neues Milieu, ein anderes Land und eine andere Kultur –, die für die Revision der eigenen Metaphysik ausschlaggebend sind. Auch die Lektüre von Literatur kann dazu führen, dass bestimmte metaphysische Überzeugungen ins Wanken geraten, andere wiederum gestärkt werden. Wenn ich behaupte, dass jeder Mensch seine eigene Metaphysik hat, so will ich damit nicht behaupteten, dass jeder explizite Antworten auf die großen Lebensfragen hätte. Auch zurückhaltende Positionen zähle ich zur faktischen Metaphysik eines Menschen. Sie können im Glauben bestehen, dass derartige Fragen prinzipiell nicht beantwortbar sind. Es könnte ja sein, dass wir Menschen mit keinem entsprechenden kognitiven Vermögen ausgestattet sind, sie zu beantworten. Sv.D.u.H., Sie werden beanstanden, dass ich den Ausdruck „Metaphysik“ sehr weit fasse, als wäre er extensionsgleich mit „Weltanschauung“. Dass das problematisch ist, gehe schon allein daraus hervor, dass man von „Metaphysik“ keinen Plural bilden kann. Es mag zwar sinnvoll sein, von der Metaphysik des Herrn oder der Dame X zu sprechen, aber nicht von den „Metaphysiken“ (im Plural) der Philosophen. Man spricht ja auch nicht von den „Physiken“ der Physiker. Außerdem gehe es nicht um metaphysische Überzeugungen der Menschen auf der Strasse, sondern um die Metaphysik der Philosophen, um die Fachmetaphysik. Zunächst: Wie sich die metaphysischen Fragen dem Menschen ganz allgemein aufdrängen, so drängen sie sich auch dem Philosophen auf. 2 Allerdings: Nicht jeder Philosoph muss sich, insofern er Philosoph ist, mit metaphysischen Fragen beschäftigen. Viele Bereiche der Philosophie sind von derlei Fragestellungen nicht tangiert. Wenn es aber um Erkenntnistheorie, Ontologie, Orientierungswissen und speziell Ethik geht, so wirken sich die metaphysischen Überzeugungen des jeweiligen Philosophen sehr wohl aus – und umgekehrt: Die philosophische Arbeit wirkt zurück auf die metaphysischen Überzeugungen des Philosophen. Die metaphysischen Thesen, die Philosophen faktisch vertreten, variieren stark. Die Palette der inhaltlichen metaphysischen Überzeugungen unter Fachphilosophen dürfte in etwas der Vielfalt der Positionen unter NichtPhilosophen entsprechen. Wie steht es aber um die Fachmetaphysik? Einige unter Ihnen werden meinen: Ist die Metaphysik als philosophisches Fach nicht obsolet? Leben wir nicht in postmetaphysischen Zeiten? Hat nicht schon Kant nachgewiesen, dass Metaphysik unmöglich sei? Hat schließlich nicht die Sprachanalyse die Metaphysik endgültig überwunden? Ich habe vor, auf ein weit verbreitetes Argument für den Glauben an die Unmöglichkeit von Metaphysik einzugehen und dann auf aktuelle metaphysische Debatten unter analytischen Philosophen zu verweisen. Diese neuere, fast explosionsartige Entwicklung in der analytischen Metaphysik zeigt, dass metaphysische Fragestellungen keineswegs obsolet sind. Ich möchte sodann zwei verschiedene Typen von Metaphysik bzw. metaphysischen Überzeugungen umreißen. Der Unterschied zwischen diesen beiden ergibt sich aus dem Ansatz bzw. Ausgangspunkt sowie den faktischen Rationalitätskriterien, nach denen man sich in den Argumenten richtet. Der eine Typ ist naturalistisch geprägt und geht von den Daten der Naturwissenschaften aus, der andere hingegen vom größeren Kontext der Alltagswelt, in der wir alle leben, handeln und untereinander interagieren. In Anlehnung an Lynne Rudder Baker nenne ich diesen zweiten Typ „EveryDay-Life“-Metaphysik. Methodisch wie auch inhaltlich entspricht er großteils dem aristotelischen Typ von Metaphysik. Möglichkeit von Metaphysik Die Überzeugung, Kant habe nachgewiesen, dass Metaphysik unmöglich sei, ist weit verbreitet. Eine schnelle, nicht sehr überzeugende Reaktion auf diese Auffassung besteht darin, sie durch eigenes Tun falsifizieren zu wollen. Der Metaphysiker Peter Van Inwagen meinte im Rahmen einer Tagung, dass die Behauptung, Metaphysik sei unmöglich, schon allein deshalb falsch sei, weil er als Metaphysiker Metaphysik betreibe: „I do it“! Die Überzeugung von der Unkmöglichkeit der Metaphysik hängt letztlich ab von der Vorstellung, die man von ihr hat. Erwartet man von ihr unerfüllbare 3 Aufgaben oder verlangt man von ihr eine Art apodiktische Gewissheit, die sie gar nicht bieten kann, so wird man sie für unmöglich halten müssen. Kant scheint jedenfalls von der Metaphysik eine derartige absolute Gewissheit zu fordern. So lesen wir z.B. in den Prolegomena: „Nur zwei Dinge muß ich […] verbitten: erstlich, das Spielwerk von Wahrscheinlichkeit und Mutmaßung, welches der Metaphysik ebenso schlecht ansteht, als der Geometrie, zweitens die Entscheidung vermittelst der Wünschelrute des so genannten gesunden Menschenverstandes, die nicht jedermann schlägt, sondern sich nach persönlichen Eigenschaften richtet. Denn was das erste anlangt, so kann wohl nichts Ungereimteres gefunden werden, als in einer Metaphysik, einer Philosophie aus reiner Vernunft, seine Urteile auf Wahrscheinlichkeit und Mutmaßung gründen zu wollen. Alles, was a priori erkannt werden soll, wird eben dadurch vor [?] apodiktisch gewiß ausgegeben, und muß also auch so bewiesen werden.“ (Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, 1783, 195f) Wer nun überzeugt davon ist, dass Metaphysik in diesem Sinne gänzlich a priori und folglich apodiktisch gewiss sein muss, wird zur Überzeugung gelangen, dass Metaphysik unmöglich ist. Muss aber Metaphysik a priori sein? Und was ist schon apodiktisch gewiss, d.h. unmöglich falsch? Eingangs verwies ich auf die faktischen metaphysischen Überzeugungen der Menschen. Die Gesamtheit der metaphysischen Überzeugungen einer Person nannte ich die Metaphysik dieser Person. Wie soll solch eine Gesamtheit gänzlich a priori und apodiktisch gewiss sein können? Selbst wenn man annähme, die Grenzen zwischen einer empirischen und einer metaphysischen Überzeugung wären klar erkennbar. Die faktischen metaphysischen Überzeugungen der Menschen sind jedenfalls alles andere als a priori. Sie stützen sich auf Traditionen, auf Lebenserfahrungen, Bewährungen in der Praxis, usw. Ist ein Mensch von einer metaphysischen Position überzeugt – glaubt er, dass sie wahr ist –, so impliziert das nicht, dass er auch glaubt, sie könne unmöglich falsch sein. Der Grund für die Annahme, dass metaphysische Überzeugungen auch fehlbar sind, ist letztlich der, dass sie sich großteils auf Sachverhalte beziehen, die nicht a priori sind. Wir können uns darin täuschen, gerade weil das, worauf sie sich beziehen, unabhängig von uns und unseren Überzeugungen ist. Nehmen wir die Überzeugung, dass die personale Identität über den biologischen Tod hinaus fortdauert. Wenn sie wahr ist, so ist es eine Tatsache, dass es mit dem biologischen Tod für eine menschliche Person nicht aus ist. Diese Tatsache ist aber unabhängig davon, ob ich davon überzeugt bin oder nicht. sie richtet sich jedenfalls nicht nach meiner Überzeugung. 4 Wer von einer metaphysischen Annahme überzeugt ist, glaubt, dass sie wahr ist – aber nicht deshalb, weil sich die Wirklichkeit nach seiner Annahme richten würde, sondern umgekehrt, weil die Annahme der Wirklichkeit entspricht. Gewiss, das setzt eine realistische Sicht der Metaphysik voraus. Der kritische Realismus erinnert aber daran, dass auch die metaphysischen Überzeugungen gerade deshalb fehlbar sind, weil sich die Wirklichkeit, auf die sie sich beziehen, nicht nach unseren Überzeugungen richtet. Wenn man von Metaphysik Apriorizität und apodiktische Gewissheit verlangt, ist es unmöglich, Metaphysik zu betreiben. Tut man es nicht, so ist ein grundlegender, weit verbreiteter Einwand gegen die Möglichkeit von Metaphysik zurückgewiesen. Metaphysische Überzeugungen können mehr oder weniger gewiss sein, mehr oder weniger wahrscheinlich. Neuere Religionsphilosophen stufen auch die Frage nach der Existenz Gottes als Wahrscheinlichkeitsfrage ein. (Richard Swinburne) Unsere metaphysischen Überzeugungen als wahrscheinlich einzustufen heißt nicht, dass sie bloße Vermutungen wären. Kant scheint im besagten Zitat Wahrscheinlichkeit und Mutmaßung gleichrangig zu sehen. Was eine Überzeugung wahrscheinlich bzw. wahrscheinlicher als ihr Gegenteil macht, sind aber Indizien bzw. Gründe. Wenn Überzeugungen sehr gut begründet sind, so ist es unvernünftig, sie zu bezweifeln, obwohl sie – wie gesehen – auch falsch sein könnten. Metaphysische Überzeugungen können jedenfalls so gewiss sein, dass es vernünftig ist, unser Leben darauf zu setzen. An der Wurzel der radikalen Ablehnung von Metaphysik stehen häufig Verzerrungen von dem, was Metaphysik sein kann. Wenn heute mancherorts Metaphysik nicht nur von Philosophen, sondern auch von Theologen zurückgewiesen wird, so z.T. deshalb, weil man von ihr und ihren Aufgaben Vorstellungen hat, die vernünftigen und zeitgemäßen Einstellungen widersprechen und notgedrungen Widerspruch provozieren. Die weit verbreitete Auffassung, Metaphysik sei heute obsolet, geht aber auch auf die Ansicht zurück, die Sprachphilosophie und die so genannte analytische Philosophie habe die Metaphysik „überwunden“, was immer dieser Ausdruck bedeuten mag. Metaphysik in der analytischen Philosophie Trotz der weit verbreiteten Auffassung, dass es im Rahmen der analytischen Philosophie wegen ihrer positivistischen und empiristischen Wurzeln keine Metaphysik geben könne, haben gerade analytische Philosophen in den letzten Jahren viele Theorien entwickelt und Thesen vorgebracht, die sie selber als metaphysisch charakterisieren. So haben sie zahllose Bücher, Sammelwerke und Einzelbeiträge zur Metaphysik herausgegeben (siehe z.B.: 5 Metaphysics. An Anthology (Ed. J. Kim and E. Sosa). Oxford 1999; The Oxford Handbook of Metaphysics (Ed. M. Loux and D. W. Zimmerman). Oxford 2003; Metaphysics: The Big Questions (Ed. P. Van Inwagen and D. W. Zimmerman). Oxford 1998; Contemporary Readings in the Foundations of Metaphysics. (Ed. St. Laurence and C. Macdonald). Oxford 1999), Speziell formal-semantische Arbeiten haben erneut zu metaphysischen Überlegungen angeregt. Die Probleme, die man heute im Rahmen der analytischen Philosophie als metaphysisch einstuft, entsprechen jenen, die man in der Scholastik im Rahmen der Ontologie oder der klassisch aristotelischen Metaphysik behandelt hat. Um das festzustellen, genügt eine Gegenüberstellung des Inhaltsverzeichnisses einer beliebigen, vornehmlich allerdings englischsprachigen Einführung in die philosophische Logik oder analytischen Ontologie, und des Inhaltsverzeichnisses eines beliebigen metaphysischen Traktats der Neuscholastik. Zentrale Themen, die heute im Rahmen der analytischen Philosophie unter der Bezeichnung „Metaphysik“ behandelt werden sind: das Problem der Modalitäten, Aktualität und Möglichkeit (de ente existenti et possibili), die Individuation, Identität und Wahrheit (de proprietatibus entis) sodann die Kategorienfrage mit dem Universalienproblem (de substantia et accidente) und schließlich die Fragen nach der Wirksamkeit und Intentionalität von Agenten (de causis). Die Lösungsvorschläge auf die behandelten Fragen und die daraus resultierenden metaphysischen Thesen sind unterschiedlich. Es gibt analytische Fachontologen, die die Existenz von Substanzen ablehnen, und solche, die sie annehmen. Es gibt Ontologen, die an einen objektiven Fluss der Zeit glauben, und solche, die alle Zeitpunkte als objektiv gleich real bestimmen. Viele glauben, dass jegliche Kausalität Ereingiskausalität sei, andere wiederum verteidigen die Annahme, dass es auch Agentenkausalität gibt. Die von neuem aufgeflammte metaphysische Debatte über die Frage nach dem Werden bzw. der Veränderung entstand aus Engpässen im Denken über die Zeit. Denkt man bestimmte Annahmen, die zunächst ganz selbstverständlich scheinen, zu Ende, gerät man in Aporien. Aber auch die klassische aristotelische Metaphysik verdankt ihre Anfänge verschiedenen Perplexitäten und Aporien wie jenen des Werdens oder der Veränderung. Diese hatten bereits Platon in mehreren Dialogen beschäftigt: Wie sollen wir das Werden oder den Fluss der Zeit deuten, ohne in Aporien zu geraten? Die Annahme von Substanzen (ουσιαι, heute Kontinuanten oder endurers), die im Laufe ihrer Existenz Eigenschaften annehmen bzw. verlieren, gilt von alters her als aristotelischer Beitrag zur Lösung der angeschnittenen Probleme. 6 Tiefschneidende Unterschiede unter analytischen Fachontologen gehen aber auf unterschiedliche Hintergründe ihrer Forschungsarbeit zurück. Die einen gehen – wie in der Einleitung angedeutet – in ihren metaphysischen Überlegungen von den Erkenntnissen oder Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschungen aus. Die anderen gehen von der gemeinsamen Lebenswelt (every day life) aus und wollen auf sie zurückverwiesen bleiben. Die gemeinsame Alltagswelt, in der wir handeln, sprechen und auch forschen, ist einerseits reicher als das, was uns die positive Wissenschaft darüber sagt, andererseits ärmer, weil wir ohne die Wissenschaft sehr wenig darüber wüssten. Die Abweichungen unter den zeitgenössischen Metaphysikern betreffen auch das Metaphysikverständnis selbst, d.h. die Meta-Überlegungen zur Ontologie und Metaphysik. „Every-Day-Life“-Metaphysikverständnis Was ist und was soll der Kontext sein, Metaphysik zu betreiben? Für den „Every-Day-Life“-Metaphysiker ist es – wie bereits zuvor erwähnt – die gemeinsame Lebenswelt. Er will zwar die Ergebnisse der positiven Wissenschaften nicht ausklammern – ganz im Gegenteil! Sie sind aber nicht die alleinige Ausgangsbasis für metapyhsische Überlegungen. Es wäre ein Missverständnis, würde man meinen, durch Betonung dieses Ausgangspunktes der gemeinsamen Lebenswelt würde man die Grundannahmen, die wir in unserem Alltagsleben über die Wirklichkeit machen und die uns faktisch in unseren Lebensvollzügen leiten, bildeten die unrevidierbare Basis unserer metaphysischen Annahmen. Dass sie Ausgangspunkt sind, impliziert nicht, dass sie nicht revidierbar wären. Dass man die gemeinsame Lebenswelt als Ausgangs- und Bezugspunkt für die Metaphysik wählt, besagt nicht, dass man im Sinne der „ordinary language philosophy“ oder der „common sense philosophy“ den alltäglichen faktischen Konsens oder das faktische Verständnis zur normativen Richtschnur des Philosophierens erheben würde. Es heißt auch nicht, dass man im Sinne des in den letzten Jahren so oft in Anspruch genommenen „linguistic turns“ nicht die Sache untersuchen würde, sondern sich mit der Untersuchung der Art, wie man über die Sache spricht, begnügen würde. Der Ausgangspunkt und die Rückbindung an die Lebenswelt ermöglichen metaphysische Überzeugungen, die alle Lebensbereiche betreffen. Diese metaphysischen Überzeugungen ergeben sich aus dem Bemühen zu klären, welchen Status die verschiedenen Arten von Erfahrung für unser Orientierungswissen und unsere Lebensgestaltung haben und welche Rolle den wissenschaftlichen Theorien zukommt – Wie hängen die einzelnen Lebensbereiche miteinander zusammen? Was ist primär? Was ist grundlegend? 7 Die gemeinsame Lebenswelt war auch in der aristotelischen Tradition erster Bezugspunkt für die Identifizierung der unterschiedlichen Lebensbereiche in ihrer Vielfalt und Differenziertheit. Sie war es auch für Gilbert Ryles Betonung der Vielfalt der „Kategorien“ bzw. für Wittgensteins Sprachspiele. Der Metaphysiker will es allerdings nicht bei der Feststellung der Vielfalt bewenden lassen, wie es bei Wittgensteinanhänger gelegentlich der Fall ist, sondern will – gerade als Metaphysiker – verstehen, wie sie miteinander zusammenhängen und was die Ontologie ist, auf die diese Vielfalt gründet. Der „Every-Day-Life“-Metaphysiker erhebt nicht den Anspruch, das Ganze des Lebens und der Welt gleichsam überblicken zu können, wohl aber dessen Teilbereiche als Teilbereiche einzuordnen. Er bemüht sich um die Aufdeckung der Bedingtheit von Sichtweisen und somit um die Erkenntnis von eingeschränkten Sichtweisen als solchen. Im Rahmen einer Alltags- oder Lebenswelt-Metaphysik wird grundsätzlich alles betrachtet, was Gegenstand menschlicher Erfahrung und menschlichen Verhaltens sein kann, aber nicht auf die Weise einer einzelwissenschaftlichen Betrachtung. Es geht vielmehr um eine Interpretation des Einzelnen im Rahmen der Gesamtheit dessen, womit es der Mensch zu tun hat. Es wäre ein grobes Missverständnis zu meinen, der genannte Typ von Metaphysik würde mit dem Anspruch einer besonderen Weise der Erkenntnisgewinnung in Konkurrenz zu einzelnen Erkenntnisweisen treten, z.B. zu den wissenschaftlichen Betrachtungsweisen. Der Metaphysiker soll vielmehr wie der Weise sein, der in seiner Weisheit unberechtigte Verabsolutierungen und Verallgemeinerungen durchschaut. Der Weise versteht es, das Erlebte und Gewusste richtig einzuordnen. Dem Wissen, welches wir den Wissenschaften verdanken, kommen grundlegende Funktionen und Aufgaben für die Bewältigung unseres Alltags und für die Befriedigung unserer intellektuellen Grundbedürfnisse zu. Der „Every-Day-Life“-Metaphysiker will aber die wissenschaftlichen Erkenntnisse wegen der methodischen Einschränkungen und Abstraktionen, die ihnen zu Grunde liegen, in ihrer Bedingtheit erkennen und so richtig einordnen. Sein naturalistisch geprägter Kontrahent neigt dagegen dazu, naturwissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse zu verallgemeinern. Ein Teil der neu entwickelten metaphysischen Entwürfe im Rahmen der analytischen Philosophie entpuppt sich als Folge von Verallgemeinerungen wissenschaftlicher Daten – man denke beispielsweise an die typischen Tropenontologien, die heute weit verbreitet sind. Die ontologische Fragestellung, was die allgemeinsten Kategorien und die letzten Bestandteile der Wirklichkeit seien, verleitet nämlich allzu leicht zu meinen, nur die positiven Wissenschaften könnten uns sagen, was es heißt zu existieren, und worin die Wirklichkeit letztlich besteht. 8 „Every-Day-Life“-Metaphysik ist auch für unser Orientierungswissen von Relevanz. Ein derartiges Wissen kann und soll uns helfen, unser Leben gut zu meistern und uns selbst sowie unsere Stellung in der Welt besser zu verstehen. Rationalitätskriterien für Metaphysik Die Unterschiede zwischen den zwei Typen von Metaphysik betreffen auch die Meta-Ebene, also auch die Auffassungen von der Metaphysik selbst. Der „Every-Day-Life“-Metaphysiker will auch Maßstäbe oder Kriterien ausdrücklich machen, um inhaltliche metaphysische Einzelüberzeugungen sowie weltanschauliche Einstellungen, die uns in unserem Alltag faktisch in der Lebensorientierung leiten, zu prüfen. Sie nach Kriterien einer Einzelwissenschaft beurteilen zu wollen, ist jedenfalls nicht stichhaltig. Wenn sie andererseits gültig sein können, ist auch die weit verbreitete skeptische Auffassung, man könne sie überhaupt nicht prüfen und darüber könne man nicht rational argumentieren, fehl am Platze. Der Alltagsmetaphysiker glaubt jedenfalls, dass es Kriterien gibt, die rational kritische Auseinandersetzungen auch auf dem Gebiet der Metaphysik zumindest ansatzweise ermöglichen. Naheliegend ist es, zuallererst die innere Kohärenz und die Widerspruchsfreiheit zu den grundlegenden Kriterien zu zählen. Es leuchtet ein, dass metaphysische Ansichten, die in Weltanschauungen und in einem entsprechenden Orientierungswissen ihren Ausdruck finden, nur dann als vernünftig gelten können, wenn sie in sich stimmig und nicht widersprüchlich sind. Für den „Every-Day-Life“ Metaphysiker ist besonders das Kriterium der Offenheit für alle Lebensbereiche von Relevanz: Klammert eine metaphysische Theorie von vornherein bestimmte Lebensbereiche als irrelevant aus, so kann sie nicht als allumfassend im oben besprochenen Sinn gelten. Naturalistisch geprägte metaphysische Überzeugungen neigen dazu, die subjektiven Seiten des Handelns und Lebens zugunsten der objektiven Betrachtung auszuklammern. Für wissenschaftliche Zwecke ist das unerlässlich. Muss es aber auch für eine rational vertretbare Deutung der Gesamtwirklichkeit so sein? Ganz im Gegenteil! Eine vernünftige metaphysische Position hat auch diese Seiten und die entsprechenden Probleme des Zugangs der ersten Person und der Indexikalität zu berücksichtigen. Einem weiteren Kriterium zufolge muss eine vernünftige, rational vertretbare Metaphysik offen für Erfahrung und auf Erfahrung rückbezogen sein. Man muss sich aber dessen bewusst bleiben, dass es vielfältige Arten von Erfahrung gibt. Für den Alltagsmetaphysiker wäre es ein grobes Missverständnis, würde man für die Metaphysik nur einen Typ von Erfahrung gelten lassen, nämlich jenen, auf den die positive Wissenschaft gründet und 9 der durch Wiederholbarkeit und intersubjektive Zugänglichkeit gekennzeichnet ist. Wissenschaftliche Hypothesen müssen durch Experimente getestet werden. Als wissenschaftlich gelten Tests allerdings nur dann, wenn sie zumindest prinzipiell wiederholbar sind und von mehreren Beobachtern als solche festgestellt werden können. Die dafür erforderlichen Erfahrungsberichte können sich folglich nur auf einen Teilbereich von Erfahrungen beziehen. Sie müssen um der Objektivität der getesteten wissenschaftlichen Aussagen willen jene Erfahrungen ausschließen, die nicht wiederholbar sind. Die Thesen der „Every-day-Life“ Metaphysik beruhen auf Erfahrungen in einem umfassenderen Sinn. Sie klammern den Bereich der praktischen Rationalität und der entsprechenden subjektiven Erfahrungen nicht aus. Dazu sind Leid, Schmerz, Erfüllung, Freude, Wert einer Person, Familie, aber auch institutionelle Gegebenheiten zu rechnen. Derartige Erfahrungen sind für unser Handeln und die Alltagspraxis von zentraler Relevanz. Man subsumiert sie unter die so genannten „Lebenserfahrungen“. Für die Zielsetzungen der positiven Wissenschaft müssen stattdessen methodische Einschränkungen, Ausklammerungen und Idealisierungen vorgenommen werden. Abstraktion und Idealisierung waren bereits für die Entwicklung der Prinzipien der Mechanik (Galilei, Descartes) wichtig. Entsprechendes dürfte aber auch für die Entwicklung der wissenschaftlichen Medizin gelten. Die Betrachtung des menschlichen Organismus nach der cartesisch- galiläischen Methode – als ob er eine Maschine sei – ermöglichte die grundlegenden Erkenntnisse des Blutkreislaufs. Dass man den menschlichen Organismus wie einen rein physikalischen Gegenstand betrachten muss, um bestimmte wissenschaftliche Ziele zu realisieren, impliziert allerdings nicht, dass er eine Maschine ist! Die für wissenschaftliche Zwecke und für die Vermittlung ihrer kognitiven Inhalte unerlässlichen Bezüge auf Strukturen und funktionale Verhältnisse sind nur durch Abstraktion und Beschränkung möglich. Damit soll nicht gesagt sein, dass durch die Wissenschaft lediglich ganz bestimmte regional beschränkte Gebiete untersucht werden könnten. Die Einschränkung betrifft nicht Bereiche, sondern lediglich die Rücksicht oder Perspektive. Handlungen und Indexikalität Die Unterschiede zwischen den zwei Typen von Metaphysik wirken sich in der Erforschung des menschlichen Handelns ganz besonders aus. Wie sollen wir unsere Alltags-Erfahrung deuten, dass wir handelnd in den Verlauf der Dinge eingreifen, dass wir verantwortlich für unser gewusst gewolltes Tun sind? Handlungen werden von Handelnden hervorgebracht und ergeben sich aus einem komplexen Gefüge von Fähigkeiten und Eigentümlichkeiten, zu denen auch die subjektive Perspektivität und Indexikalität gehören: 10 Handelnde erfahren sich als Zentrum ihrer Welt, in die sie handelnd eingreifen. Diese Erfahrungen werden aufgrund der unterschiedlichen Typen von Metaphysik unterschiedlich eingeordnet und gedeutet. Handelnde drücken ihre Perspektivität durch so genannte indexikalische Ausdrücke aus, das sind Ausdrücke wie "ich", "hier", "dort", "jetzt", "gestern" usw. Durch derartige Ausdrücke verweisen sie auf den subjektiven Gesichtspunkt des jeweiligen "ego". Dass ich über etwas indexikalisch spreche, denke und fühle, heißt dass ich in Beziehung zu mir selbst darüber spreche, denke und fühle. Die indexikalische Rede wird somit nicht nur als egozentrisch, sondern auch als selbst-bezüglich (self-referential) oder als de se charakterisiert (Roderick Chisholm). Das Bedürfnis, die indexikalischen Ausdrücke durch nicht-indexikalische Ausdrücke zu ersetzen, entspricht dem Bedürfnis, sich im Erkenntnisprozess der Abhängigkeit von subjektiven Faktoren zu entledigen. Für die Entwicklung einer wissenschaftlichen oder "idealen" Sprache ist das unumgänglich. Die Beseitigung bzw. Ersetzung der indexikalischen Ausdrücke ist relativ zur Zielsetzung der objektiven Erkenntnisgewinnung sinnvoll, ja sogar gefordert; relativ zur Zielsetzung der Beschreibung und Erklärung von Handlungen führt sie allerdings zu einem Verlust an Aussagekraft. Wie soll man in einer Sprache der objektiven Wissenschaft unsere Erfahrung zum Ausdruck bringen, dass wir immer nur im Jetzt handeln? Dieser jetzige Augenblick ist nämlich ständig ein anderer, er fällt mit immer neuen Zeitpunkten aus der objektiven Zeit zusammen. Welcher Zeitpunkt als Jetzt von uns erlebt wird, kann daher nicht in der objektiven Sprache, die keine indexikalischen Ausdrücke kennt, festgehalten werden. Die Zeit ist für uns und unsere Erlebniswelt wie im Fluss. Der gegenwärtige Augenblick ist von ganz anderer Relevanz als ein gewesener oder ein zukünftiger. Die einen Zeitpunkte sind nicht mehr aktuell, und die anderen sind es noch nicht. Oft wird verlangt, dass man sich in der eigenen Metaphysik entweder für den ontologischen Vier-Dimensionalismus, der keine Indexikalität zulässt, oder aber für eine Ontologie mit drei-dimensionalen Entitäten, mit Kontinuanten, denen indexikalische Einstellungen zukommen, zu entscheiden habe. Es wird vorausgesetzt, dass man sich entweder für eine positiv wissenschaftliche Ontologie oder aber gegen sie zu entscheiden habe. Aufgrund des zum Typ der „Every-Day-Life“-Metaphysik Gesagten dürfte es aber einleuchten, dass die positive Wissenschaft uns nicht zwingt, den Vier-Dimensionalismus als allgemeine Ontologie anzunehmen. Dass ich vom indexikalischen zeitlichen Fluss absehe oder abstrahiere, impliziert nicht, dass es ihn nicht gibt. Für den Alltagsmetaphysiker ist es zwar verständlich, dass die wissenschaftliche Arbeit mit dem vier-dimensionalen Raum-Zeit-System die naturalistische These nahelegt, dass alles vier-dimensional ist. Die 11 wissenschaftliche Perspektive als solche ist aber auch mit der Annahme kompatibel, dass wir als Handelnde in der Zeit weiterexistieren. Der Wissenschaftler muss aber – um der Objektivität des Inhalts seiner Theorien willen – alle Art von zeitlicher Indexikalität ausklammern. Wissenschaftliche Theorien kennen keinen privilegierten „point of view“. Für wissenschaftliche Zwecke soll man den methodischen VierDimensionalismus – sofern er wissenschaftlichen Zielsetzungen dient – gelten lassen; für eine zufrieden stellende Deutung der Handlungen und des Handlenden als Handelnden muss man aber drei-dimensionale Kontinuanten annehmen. Die Gründe für die Annahme von Kontinuanten sind nicht strikt wissenschaftlich, sondern resultieren aus unserem Handeln und unserem gängigen Zeitverständnis mit der für unser Leben wichtigen Dreiteilung in Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. In der Reaktion auf die von neuem erwachte naturalistische Herausforderung, dass das personale Selbst und die Willensfreiheit Illusion seien, wird sich der „Every-Day-Life“-Metaphysiker davor hüten, die wissenschaftlichen Methoden und Ergebnisse in Frage zu stellen; er wird aber auf Fehlschlüsse hinweisen, wenn aus methodischen Ausklammerungen auf ontologische geschlossen wird, nach dem Motto: Das, wovon man für die Zwecke der Objektivität und Intersubjektivität der Wissenschaft absehen muss, könne es nicht geben. Die „Every-Day-Life“-Metaphysik fragt nach den letzten Kategorien des umfassend Wirklichen, versteht sich aber nicht als eine allgemeinere Form von naturwissenschaftlicher Theorie über die letzten Konstituenten der physikalischen Wirklichkeit. Sie will auch die Voraussetzungen der lebensweltlichen Alltagspraxis berücksichtigen. Wer diese umfassendere Sicht teilt, wird die genannten metaphysischen Positionen zur Indexikalität und Drei-Dimensionalität nicht von vornherein im Namen der Wissenschaftlichkeit ablehnen. Personale Identität In vier-dimensionalistischen Ontologien kann es keine diachrone Identität und somit auch keine personale Identität durch die Zeit geben. Wenn nämlich alles auch zeitlich ausgedehnt ist und somit aus zeitlichen Phasen oder „Teilen“ zusammengesetzt ist, kann sich nichts durch die Zeit als es selbst bewegen. Wenn aber die oben genannten Voraussetzungen der Alltagspraxis und der praktischen Rationalität gültig sind, so sind wir mit uns selbst identisch bleibende drei-dimensionale Kontinuanten. Wenn aber wir als lebendige Organismen Kontinuanten sind, so sind es auch unsere Organe, ja auch die letzten zellularen Einheiten, aus denen wir bestehen. Das spricht für den DreiDimensionalismus. 12 In drei-dimensionalistischen Kontinuanten-Ontologien gibt es diachrone Identität. Ein Kontinuant bleibt vom ersten Moment seiner Existenz bis zu seinem Zerfall mit sich selbst identisch. Empirische Forschungen können beitragen, besser zu verstehen, worin die diachrone Identität besteht, sie muss aber nicht erst „konstituiert“ oder konstruiert werden – die diachrone Identität ist „basic“ oder vorgegeben. Im Kontext von vier-dimensionalistischen Ontologien hingegen muss die im Alltag angenommene diachrone Identität von Organismen weginterpretiert und durch schwächere Relationen wie Kontinuitäts- oder Ähnlichkeitsrelationen ersetzt werden. Dass wir im Laufe unseres Lebens mit uns selbst identisch bleiben, bedeute letztlich nichts anderes, als dass unsere zeitlichen Abschnitte oder Phasen in einer Art Kontinuitäts- oder Ähnlichkeitsbeziehung zueinander stehen. Vier-dimensionalistische Ontologen bemühen sich daher, Kriterien zu entwickeln, um das, was wir im Alltag personale Identität nennen, konventionalistisch zu „konstituieren“. Die einen neigen zu organischen Kriterien, die anderen zu psychologischen oder Erinnerungskriterien. Dreidimensionalistische Ontologen nehmen stattdessen an, dass Kriterien zwar hilfreich sind, um die Identität festzustellen, dass aber personale Identität nicht von sprachlichen Festsetzungen oder kulturellen Konventionen abhängig ist. Drei-Dimensionalisten unterscheiden somit zwischen Kriterien und Bedingungen personaler Identität. Instrumente und komplexe Maschinen Betreibt man „Every-Day-Life“-Metaphysik, so fragt man sich auch nach der Realität und Identität der Dinge, mit denen wir Tag ein Tag aus interagieren. Unser soziales Leben ist heute unter anderem durch Interaktionen mit Maschinen geprägt. Maschinen entlasten uns, indem sie verschiedene Arbeiten oder Aufgaben für uns erledigen. Was sind die ontologischen Verpflichtungen, die wir mit der Rede über Maschinen und unser Interagieren mit ihnen eingehen, wenn wir von Funktionen oder Aufgaben von Maschinen, von komplexen Artefakten, sprechen? Ergeben sich ihre Identitäts- und Kontinuitätsbedingungen allein aus ihren Verwendungszwecken? Es leuchtet ein, dass ein Hammer nur solange Hammer ist, als er für den Zweck eines Hammers verwendet wird bzw. verwendet werden kann – solange es also Menschen gibt, die wissen, wofür Hämmer konstruiert wurden, und es verstehen, mit ihnen umzugehen. So gesehen sind Hämmer ontologisch, also auch in ihren Identitätsbedingungen, von uns abhängig. Die Frage nach dem ontologischen Statuts von Maschinen ist aber komplexer als jene nach Instrumenten wie Hämmern, Briefbeschwerern oder von Gebrauchsgegenständen wie Wanderstöcken, Vasen, Schuhen, Mützen. Der 13 ausschlaggebende Grund für die Differenz besteht – in der Alltagssprache ausgedrückt – darin, dass die einen von sich aus nichts tun können, die anderen hingegen aufgrund ihrer aktiven Dispositionen oder powers sehr viel bewirken, erledigen können. Die einen sind in ihrer Funktion passiv, die anderen auch aktiv. Motoren setzen Pumpen, Autos, Flugzeuge in Bewegung; Bagger reißen Strassen auf und heben Gruben aus; Automaten produzieren Socken und Pullover; Computer lösen komplexe Probleme. Viele Aufgaben erfüllen Maschinen viel besser als die Menschen. Es ist plausibel, dass einfache Instrumente ontologisch von ihrem Zweck, also von einem Bewusstsein von Menschen, die sie gebrauchen, abhängig sind. Bei Maschinen dürfte die These der Bewusstseinsabhängigkeit aber so nicht haltbar sein. Maschinen können nämlich, sofern sie funktionsfähig sind, unabhängig von Menschen – wie wir gesehen haben – sehr vieles tun. Sie brauchen zwar in der Regel eine Bedienung; Maschinen funktionieren und arbeiten aber unabhängig von Menschen. Die Identitäts- und Kontinuitäts- oder Persistenzbedingungen von Maschinen sind komplexer als jene einfacher Instrumente. Was für die Identitäts- und Kontinuitätsbedingungen von Maschinen von Relevanz ist, ergibt sich nicht primär aus dem Nutzen, sondern aus dem, was sie können, unabhängig davon, ob jemand das in Anspruch nimmt oder nicht, unabhängig davon, ob sie ihre Kapazitäten actualiter realisieren oder nicht. Besonders problematisch ist die These, dass Artefakte identisch mit dem sind, woraus sie bestehen, mit einer Menge von simples (siehe Peter v.Inwagen). Man muss nicht Aristoteliker sein, um zwischen der Frage zu unterschieden, was oder welcher Art eine Maschine ist, und dem, woraus sie besteht. Lynne Rudder Baker entfaltet in aller Breite die These, dass die klassischen Argumente, die für die ontologische Kategorie der Substanz vorgebracht wurden und noch werden, an sich auch auf Maschinen zutreffen, dass sie somit nicht ausreichen, um zwischen eigentlichen Substanzen und ontologisch minderwertigen Artefakten zu unterscheiden. Auch Maschinen haben beispielsweise ein internes Aktivitätsprinzip (Wiggins, Aristoteles), und ihre Identität und Persistenz ist - wie gesehen - unabhängig von intentionalen Einstellungen. Dass es wesentliche Unterschiede zwischen Lebewesen und modernen komplexen Maschinen gibt, wird wohl niemand bestreiten. Aus dem folgt aber nicht, dass komplexen Maschinen schon allein deshalb ein besonderer ontologischer Status abgesprochen werden müsste. Baker argumentiert dafür, dass ein ontologisches Inventar der Wirklichkeit auch jene Fs enthalten müsse, unter die die komplexe Artefakte, also Maschinen, fallen. Sie vertritt mit guten Gründen die Ansicht, dass die klassischen Kriterien für Substantialität auch auf komplexe Artefakte zutreffen. 14 Die bisherigen Überlegungen setzen voraus, dass es – ontologisch betrachtet – aktive Dispositionen, powers oder potentialities, tatsächlich gibt und dass die teleologische Rede von Funktionen nicht auf die Beschreibung und Erklärung von Handlungen limitiert werden muss. Diese Voraussetzungen sind zwar nach wie vor umstritten, werden aber heute thematisiert. Teleologie und Dispositionen Können und sollen Aussagen über natürliche Gegebenheiten in Hinblick auf Ziele und Zwecke gedeutet werden? Der naturalistisch eingestellte Denker neigt dazu, die teleologische Rede auf den praktischen Bereich menschlicher Handlungen zu beschränken. Vermeintlich teleologische Erklärungen von Naturgegebenheiten hätten – wenn überhaupt – lediglich eine heuristische Rolle. Der „Every-Day-Life“-Metaphysiker fragt sich aber, ob teleologische Beschreibungen und Erklärungen nicht auch ontologisch verpflichten. Er will jedenfalls die Alltagsrede von Funktionen als Dispositionen ernst nehmen: Nieren haben beispielsweise die Funktion, das Blut zu reinigen, das Herz hat die Funktion, Blut zu pumpen. Nieren und Herzen tun zwar viele andere Dinge, das sind aber nicht ihre eigentlichen Funktionen. Man versteht erst dann, warum ein Organ da ist, wenn man seine eigentliche Funktion (proper function) erfasst hat. Wie soll man aber eine proper function von einem zufälligen kausalen Beitrag unterscheiden können, wenn man nicht auf Ziele oder Zwecke Bezug nehmen könnte? Schreibt der Metaphysiker Organismen und Maschinen zielgerichtetes Verhalten zu, so bedeutet dies nicht, dass er ihnen Intentionen zuschreiben würde. Um den Heliotropismus von Pflanzen teleologisch zu beschreiben, müssen wir den Pflanzen keine mentalen Haltungen zuweisen. Funktionsaussagen über natürliche können informative Aussagen über den gesollten Beitrag von Eigenschaften, Teilen oder Prozessen zum Erreichen eines Zieles sein. Im Kontext lebensweltlicher metaphysischer Betrachtungen drängt sich schließlich die Frage nach der Realität von Dispositionen auf. Unsere Lebenspraxis ist nämlich von der Kenntnis der Dispositionen von Materialien, chemischen Substanzen, Tieren, menschlichen Personen und heute auch von Maschinen abhängig. Köche müssen wissen, wie ihre Ingredienzien schmecken, Ärzte müssen wissen, welche Nebenwirkungen Medikamente haben. Ein Dobermann ist bereits aufgrund seiner Art gefährlich. Um uns gut orientieren und um unsere Zukunft planen zu können, richten wir uns aber vornehmlich nach den Dispositionen von menschlichen Personen. Kennt man jemanden gut, weiß man, was ihre oder seine Dispositionen sind, d.h. man 15 weiß um die Haltungen, Neigungen, Charakterzüge, Einstellungen, welche das Verhalten bestimmen. Dispositionen werden in der Regel so genannten kategorischen Eigenschaften gegenübergestellt. Dispositionen sind im Unterschied zu diesen auf Manifestationen bezogen. Das Zerbrechen des Glases ist die Manifestation seiner Zerbrechlichkeit, die Explosion der Bombe die Manifestation ihrer Gefährlichkeit, Peters Widerspruch die Manifestation seines Mutes, usw. Die Nicht-Dispositionen werden kategorisch genannt, insofern sie nicht von Manifestationsbedingungen abhängig sind. In welcher Beziehung stehen diese zwei Arten von Eigenschaften, die dispositionalen einerseits und die kategorischen andererseits, zueinander? Sind sie völlig getrennt, oder gibt es ein gewisses Ausmaß an Interaktion zwischen beiden? Welche Eigenschaften sind die eigentlichen Ursachen für jene Ereignisse, die normalerweise als die Manifestationen von Dispositionen gelten? Dualisten neigen zur Annahme, die dispositionalen Eigenschaften unterscheiden sich fundamental ihrer Art nach von den kategorischen. Monisten hingegen führen die eine Kategorie auf die andere zurück: Letztlich gibt es nur eine grundlegende Kategorie von Eigenschaften. Die monistische Reduktion kann eine zweifache sein, je nachdem ob Dispositionen auf kategorische Eigenschaften oder kategorische Eigenschaften auf Dispositionen zurückgeführt werden. Für den kategorischen Monismus sind alle Eigenschaften kategorische Eigenschaften – dispositionale Eigenschaften gibt es nicht – und für den dispositionalen Monismus sind alle Eigenschaften dispositionale Eigenschaften – kategorische Eigenschaften gibt es nicht. Die Debatte verläuft parallel zu jener zwischen Dualismus und Monismus in der philosophy of mind. So tauchen für dualistische Positionen die typischen Interaktions- oder Überdeterminationsprobleme auf. Sollte z.B. die Welt kausal geschlossen sein und alle Erklärungen durch kategorische Zuschreibungen erfolgen, würde die Annahme, Dispositionen kämen kausale Rollen zu, zu kausaler Überdetermination führen. Versteht man Metaphysik als „Every-Day-Life“-Metaphysik oder klassisch aristotelisch als umfassende erste Philosophie, so wird man die Frage nach der Realität der Dispositionen nicht auf eine rein physikalistische Fragestellung einengen, sondern von der Lebenswelt ausgehen und auf sie zurückverwiesen bleiben. Lebensweltlich gesehen, scheinen Dispositionen reale Eigenschaften zu sein, die Materialien, Lebewesen und auch Maschinen zukommen. Einige kommen ihren Trägern lediglich temporär, andere immer zu. Einige Dispositionen rechnen wir zu den wesentlichen Eigenschaften der Dinge. In dieser unserer Lebenswelt ist, wie wir gesehen haben, die Kenntnis von 16 Dispositionen für unser Handeln von größter Bedeutung. Unser Wissen um Dispositionen bestimmt unser Interagieren mit der Umwelt. Der dispositionale Aspekt unserer lebensweltlichen Rede und Praxis wird der Tatsache gerecht, dass sich die Welt verändert. Eine rein strukturell bzw. allein anhand von kategorischen Eigenschaften beschriebene und erklärte Welt würde keine Veränderung kennen. Um Ereignisse, Prozesse und Bewegungen beschreiben und erklären zu können, müssen wir uns auf das beziehen, was Lebewesen tun und Dinge bewirken können: Durch dispositionale Ausdrücke geben wir an, wie sie sich in verschiedenen Umständen verhalten, an welchen Prozessen sie beteiligt sein können, und wie sie von anderen Objekten und Substanzen beeinflusst werden. Schluss Metaphysik ist keineswegs obsolet. In den letzten Jahren hat es eine geradezu explosionsartige Wiederbelebung metaphysischer Forschungsarbeit gegeben. Der Großteil der neueren metaphysischen Theorien im Rahmen der analytischen Philosophie ist naturalistisch geprägt. Es gibt aber auch den „Every-Day-Life“ Typ von Metaphysik, der von der gemeinsamen Lebenswelt ausgeht, in der wir untereinander und mit Maschinen interagieren. Er fragt nach den ontologischen Verpflichtungen unserer Alltags-Rede und berücksichtigt auch die Erfahrungen der Vergänglichkeit, des Zeitflusses und der personalen Identität. Wir haben eingangs gesehen, dass jeder Mensch metaphysische Überzeugungen hat, die aber in der Regel nicht sehr ausgefeilt und kritisch durchdacht sind. Der Fach-Metaphysiker vertritt demgegenüber differenziertere, wenn auch sehr unterschiedliche Thesen. Er entwickelt zudem eine Art Meta-Metaphysik. Der „Every-Day-Life“ Metaphysiker betont dabei die Kriterien, der Offenheit für alle Lebensbereiche sowie für die nicht repetierbare „Lebenserfahrung“. Ich schließe mit Baker: „…the every day world – that part of reality that includes us, our language, and the things we interact with – is no less ontologically significant than the microphysical parts of reality.“ (The Metaphysics of Everyday Life, Cambridge University Press 2007, 20)