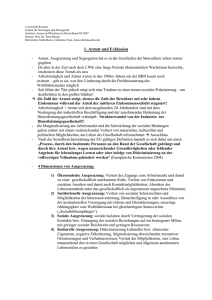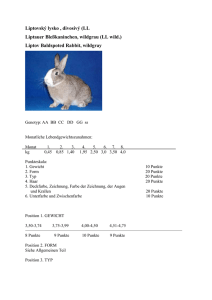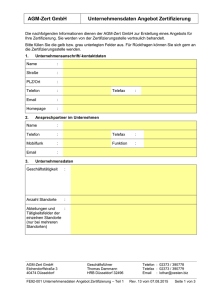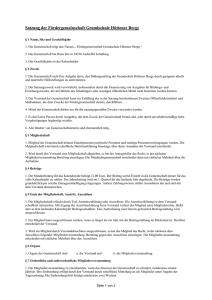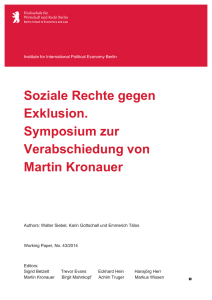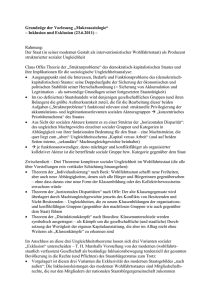M. Kronauer: Integration und Ausschluss
Werbung

Martin Kronauer, Fachhochschule für Wirtschaft Berlin Integration und Ausschluss: Neue Formen der sozialen Ungleichheit, neue Fragen für die Forschung Vortrag in der Eröffnungsveranstaltung des Schwerpunkts „Integration und Ausschluss“ des Schweizerischen Nationalfonds, Bern, 12. Sept. 2003. Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich mich sehr herzlich für die Einladung bedanken. Ich freue mich, bei diesem besonderen Anlass dabei zu sein. Mit der Entscheidung, das Thema Integration und Ausschluss zu einem Schwerpunkt der Forschungsförderung zu machen, hat der Schweizerische Nationalfonds einen Schritt getan, der in Deutschland von den entsprechenden Einrichtungen bislang – leider – in dieser Form nicht unternommen wurde. Dabei gäbe es in Deutschland sicherlich nicht weniger Gründe für eine solche Schwerpunktsetzung. Umreißt doch das Begriffspaar „Integration“ und „Ausschluss“ in der Tat meiner Überzeugung nach eine der kritischsten Problemlagen der gegenwärtigen Gesellschaftsentwicklung. „Integration“ und Ausschluss“: Ein umstrittenes Begriffspaar Diese Behauptung ist nicht selbstverständlich. Sie führt direkt ins Zentrum der wissenschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen über das Thema. Ich sage bewußt „wissenschaftliche“ und „politische“ Auseinandersetzung. Denn wie bei kaum einem anderen Begriffspaar der jüngeren sozialwissenschaftlichen Debatte liegen Wissenschaft und Politik so dicht beieinander wie hier. Selbst in der Begriffsgeschichte lässt sich kaum entscheiden, ob etwa der in Europa gebräuchlichere Begriff „Exklusion“ von der Wissenschaft in die Politik oder umgekehrt von der Politik in die Wissenschaft übernommen wurde. Und wie an kaum einem anderen Begriffspaar entzünden sich an diesem wissenschaftliche und politische Kontroversen. Wissenschaftliche Kontroversen über die Fragen: Wie lässt sich „Integration“ überhaupt angemessen fassen? Welche normativen Voraussetzungen gehen dabei ein? Steht die Integration der Gesellschaft im Vordergrund – also die gesellschaftliche Stabilität, oder die Teilhabe von Individuen an der Gesellschaft – also die Demokratie? Und wie steht es mit dem Begriff „Ausschluss“? Ist ein „Ausschluss“ aus gesellschaftlichen Bezügen, gar aus „der“ Gesellschaft, überhaupt denkbar? Führt die Vorstellung von einem „Innen“ und einem „Außen“ der Gesellschaft, vor aller Empirie, nicht bereits in logische Sackgassen? Politische Kontroversen: Sie wissen, dass sich unter dem Etikett „Kampf gegen Ausgrenzung“ sehr unterschiedliche Politiken verbergen können und tatsächlich verbergen. Allzu 1 häufig laufen sie noch immer darauf hinaus, die „Ausgeschlossenen“ zum Problem zu erklären mit dem Ziel, sie in die Gesellschaft zu „integrieren“ – wenn es nicht anders geht auch mit mehr oder weniger starkem Zwang. Schließlich das Amalgam von Wissenschaft und Politik: Stehen Wissenschafter, die sich auf das Begriffspaar von Integration und Ausschluss einlassen und damit die Vorstellung von einem gesellschaftlichen „Innen“ und „Außen“ in Kauf nehmen, nicht in der Gefahr, die Integration, das „Innen“, allzu kritiklos hochzuhalten, oder gar unbeabsichtigt zur Stigmatisierung der Außenseiter als den schlechthin anderen beizutragen? Ich will keine Eulen nach Athen tragen. Als Wissenschaftler, die über das Thema arbeiten, kennen Sie all diese Einwände und Kontroversen. Wichtiger erscheint mir die Frage, wie mit ihnen umgegangen werden kann. Das grundsätzliche Problem der Abgrenzung von Sozialwissenschaft, Alltagsbewußtsein und Politik ist nicht neu. Sozialwissenschaftliche Kategorien, gerade wenn sie heikle Probleme der sozialen Ungleichheit betreffen, sind häufig nicht nur wissenschaftlich umstritten, sondern mit kontroversen politischen und alltagsweltlichen Deutungen verknüpft. In hohem Maße gilt das etwa auch für die Kategorie „Armut“. In all diesen Fällen zeigt sich nur, wie sehr die Sozialwissenschaften von ihren sog. „Gegenständen“ affiziert und wie sehr sie in das gesellschaftliche Leben, das sie untersuchen wollen, unhintergehbar eingebunden sind. Die einzig angemessene Antwort darauf scheint mir nach wie vor zu sein, sich dieses Sachverhalts bewußt zu bleiben, die Spannung zwischen wissenschaftlichem Abstandhalten und interessierter Nähe zu ertragen und durch die Schärfung der eigenen Kategorien noch gezielt zu fördern. Es gibt aber auch noch eine andere Art von Einwänden, weniger grundsätzlich als vielmehr gegen das Begriffspaar Integration und Ausschluss bzw. seine Äquivalente, z. B. Inklusion und Exklusion gerichtet. Eine Reihe von französischen und amerikanischen Autoren, die der Diskussion um Exklusion und die Entstehung einer neuen städtischen Unterklasse wichtige Anstöße gegeben haben, indem sie aufzeigten, dass sich in Europa und den USA neue Formen der gesellschaftlichen Ungleichheit herausbilden, haben sich inzwischen gegen die Verwendung von Begriffen wie „Exklusion“ oder gar „Underclass“ ausgesprochen. Sie befürchten, dass derartige Kategorien politisch zu ambivalent und wissenschaftlich zu uneindeutig sind, um sie nutzen zu können. Vor allem befürchten sie, dass sie personalisierend gedeutet und zur Identifizierung spezifischer Gruppen von „Ausgeschlossenen“ verwendet werden könnten – und damit dazu beitragen, deren vermeintliche Andersartigkeit erst hervorzubringen und ihre Sonderbehandlung zu rechtfertigen. Sie schlagen deshalb andere Begriffe vor, um die neue Qualität der sozialen Ungleichheit zu fassen: „Désaffiliation“1 oder „disqualification sociale“2 statt „exclusion“, 1 Robert Castel, Nicht Exklusion, sondern Désaffiliation. Ein Gespräch mit François Ewald. In: Das Argument 217, 1996, S. 775-780. 2 Serge Paugam, La disqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté, 3. Auflage. Paris 1994. 2 „advanced marginality“3 statt „underclass“. Alle diese begrifflichen Alternativen verfolgen ein Ziel: die Vorstellung von einem „Innen“ und einem „Außen“ der Gesellschaft, die sich statisch und als Gegensatzpaar gegenüberstehen, aufzubrechen. „Ausschluss“ muss stattdessen als „Ausschließung“ verstanden werden, als aktiver Prozess, der von gesellschaftlichen Akteuren und Institutionen vorangetrieben wird und der seine Spuren in den Erfahrungen, der Gegenwehr und den Bewältigungsversuchen derer, die „ausgeschlossen werden“, zeitigt. Was lässt sich zu dieser Art von Einwänden sagen? Ich denke, sie treffen einen wesentlichen Punkt. Die Vorstellung einer Innen-Außen-Spaltung der Gesellschaft, die in den Begriffspaaren „Integration und Ausschluss“, „Inklusion und Exklusion“ oder im Begriff „Underclass“ mitschwingt, ist zutiefst ambivalent. Sie kann kritisch gegen ausschließende gesellschaftliche Verhältnisse gewendet werden. Sie kann aber auch affirmativ Ungleichheitsverhältnisse im gesellschaftlichen „Innern“ als unveränderbar unterstellen und stigmatisierende Zuschreibungen rechtfertigen. An den Einwänden zeigt sich jedoch noch etwas anderes: Selbst die angebotenen alternativen Begriffe, die helfen sollen, die Ambivalenz zu überwinden, kommen nicht umhin, auf die Vorstellung vom gesellschaftlichen Innen und Außen zu rekurrieren. Auch die „Désaffiliation“ und die „Disqualification“, die Ausschließung also, müssen als Fluchtpunkte, auf die sie hinauslaufen, den „Ausschluss“ unterstellen. Und selbst die „advanced marginality“ muss noch den qualitativen Unterschied bezeichnen können, der sie von gewöhnlicher Marginalität trennt. Ein unauflösbares Dilemma also? Meines Erachtens stellen sich beim Thema „Integration und Ausschluss“ insbesondere zwei Fragen, die ich zugleich als Herausforderungen an die Forschung verstehe. Gibt es triftige, überzeugende Gründe dafür, von neuen Formen der sozialen Ungleichheit auszugehen, die es sinnvoll, ja erforderlich machen, sie in einem begrifflichen Rahmen von Integration und Ausschluss, Teilhabe und Ausgrenzung zu untersuchen? Und wenn diese Frage bejaht wird, zweitens: Wie ist es möglich, den Ausgrenzungsgedanken und somit die Innen-Außen-Unterscheidung in einer Weise begrifflich zu fassen, die den zuvor angesprochenen Einwänden Rechnung trägt? Die es also erlaubt, neue Fragen zu stellen und unseren Erkenntnishorizont erweitert, nicht verengt? Zu beiden Fragen möchte ich im folgenden Stellung nehmen. Ich werde dabei erstens die Position vertreten, dass sich der Fokus auf Integration und Ausschluss in der Tat durch die besondere historische Konstellation rechtfertigt, in der die wissenschaftliche und politische Diskussion gegenwärtig stattfinden. Das heißt aber auch, dass die Kategorien der wissenschaftlichen Untersuchung nicht „zeitlos“ sind, sondern dieser historischen Konstellation gerecht werden müssen. Und ich werde zweitens argumentieren, dass der Ausschluss- oder Ausgrenzungsbegriff wesentliche Fortschritte in den Erkenntnissen über 3 Loïc J. D. Wacquant, The Rise of Advanced Marginality. Notes on its Nature and Implications. In: Acta Sociologica, 39. Jg., 1996, 121-139. 3 den gegenwärtigen gesellschaftlichen Umbruch verspricht, weil er neue Fragen zu stellen erlaubt – vorausgesetzt, er wird immer wieder kritisch anhand der angeführten Einwände überprüft.4 Ich komme zu meinem ersten Argument. Der historische Bezugspunkt der Ausgrenzungsdebatte: Die Krise sozialstaatlich vermittelter Integration Die Ausgrenzungsdebatte – die wissenschaftliche wie die politische – setzte in verschiedenen Ländern Europas etwa zur gleichen Zeit, aber in unterschiedlicher Intensität ein. In den achtziger Jahren ergänzte sie zunächst die Diskussion um die „neue Armut“ und löste diese dann ab. Ende der achtziger Jahre erhielt sie einen mächtigen Schub durch die Europäische Union, die den Exklusionsbegriff in ihren offiziellen Spachgebrauch übernahm und Forschungen zu diesem Thema anstieß. Parallel zur europäischen „Entdeckung“ der Ausgrenzung machte in den USA der Begriff „Underclass“ Furore, ursprünglich eine Wortschöpfung der sechziger Jahre, die aber bis in die achtziger Jahre hinein zunächst weitgehend folgenlos geblieben war. Zwischen der europäischen und der amerikanischen Diskussion gibt es nicht nur überraschende Ähnlichkeiten, sondern auch direkte Beziehungen. Vor allem in England wurde der Underclass-Begriff aufgegriffen, noch vor dem mittlerweile prominenteren der „social exclusion“. Ausgangspunkt dieser historischen Koinzidenz von Debatten war eine Koinzidenz in den Anzeichen einer bemerkenswerten gesellschaftlichen Veränderung: der Wiederkehr von Arbeitslosigkeit und der Zunahme von Armut in Europa und den USA nach einem Vierteljahrhundert relativer Vollbeschäftigung und der Verringerung von Einkommensungleichheit. Nun sind Arbeitslosigkeit und Armut sicherlich nichts neues, sondern haben den Kapitalismus von Anbeginn begleitet. Auch die Ausgrenzung von Arbeitslosen und Armen hat eine lange Geschichte. Dennoch gibt es gute Gründe, von einem historischen Einschnitt zu sprechen. Die Massenarbeitslosigkeit vor dem Krieg war eine der wirtschaftlichen Depression. Die zunehmende Arbeitslosigkeit der achtziger und neunziger Jahre jedoch existierte in einer insgesamt, wenngleich mit mäßigen Wachstumsraten, prosperierenden Ökonomie. Bedenklicher noch: Über die Jahre hinweg baute sich ein Sockel von Arbeitslosigkeit bzw. in den USA bis in die Mitte der neunziger Jahre ein Sockel von Armut auf, der selbst in konjunkturellen Aufschwüngen kaum abschmolz. Arbeitslosigkeit, vor allem Langzeitarbeitslosigkeit, wurde damit in Europa zu einem sozialen Ungleichheitsfaktor eigener Art. Wer in das Erwerbssystem eingebunden blieb, konnte lange Zeit noch die damit verbundene soziale Sicherheit, bis vor wenigen Jahren auch noch Einkommenszuwächse genießen. Wer längerfristig arbeitslos war, wurde von beiden zunehmend abgekoppelt. 4 Ausführlich hierzu: Martin Kronauer, Exklusion. Die Gefährdung des Sozialen im hoch entwickelten Kapitalismus. Frankfurt am Main 2002. 4 Einen historischen Einschnitt bedeutete die Wiederkehr und Verfestigung der Arbeitslosigkeit aber vor allem noch in einer weiteren Hinsicht. Sie wurden und werden vor dem Hintergrund einer bis dahin historisch einmaligen Phase des wirtschaftlichen Wohlstands, der Anhebung des allgemeinen Lebensstandards und der institutionellen Einbindung der arbeitenden Bevölkerung erfahren. Arbeitslosigkeit und Armut waren mit der Ausweitung wohlfahrtsstaatlicher Sicherungen und Dienstleistungen nach dem Zweiten Weltkrieg gewissermaßen entlegitimiert worden. Wie Franz Xaver Kaufmann schreibt, war nun der Wohlfahrtsstaat und nicht mehr der Markt für „Inklusion“ verantwortlich: „Die Programmatik des Wohlfahrtsstaats postuliert, dass Inklusion nur auf politisch-staatlichem (und nicht z.B. auf rein marktwirtschaftlichem) Wege zustande kommen kann, da es um die Gewährleistung subjektiver Rechte geht“5. Damit stellte und stellt sich aber auch das Problem der Ausgrenzung durch Arbeitslosigkeit und Armut auf grundlegend neue Weise. In früheren Epochen bedeutete Ausgrenzung, wie Robert Castel und andere gezeigt haben, den Ausschluss von den zentralen Institutionen einer Gesellschaft. Dieser Ausschluss wurde durch Rechte und Regelungen vollzogen. Er betraf zwei Kategorien von Armen auf jeweils unterschiedliche Weise. Zum einen gab es die arbeitenden, entrechteten Armen. Zu ihnen gehörten beispielsweise im 16. Jahrhundert, am Übergang in die Neuzeit, die Handlanger, Tagelöhner und Dienstboten in den Städten. Sie trugen zwar zur wirtschaftlichen Wohlfahrt bei, blieben aber gleichwohl von den Zünften und Gesellenvereinigungen ausgesperrt. Auch das Schicksal des städtischen Proletariats im 19. Jahrhundert lässt sich noch weitgehend als das der arbeitenden, entrechteten Armen beschreiben. In diesem Sinne bezeichnete Friedrich Engels 1845 die englische Arbeiterschaft als die „arme Klasse“. Die Kämpfe der Arbeiterbewegung fanden noch über weite Strecken an den Frontlinien von institutioneller Zugehörigkeit oder Ausschluss statt: der Kampf um die Organisationsfreiheit, das Wahlrecht, den Zugang zur Bildung und zu medizinischer Versorgung, kurz: der Kampf um die Demokratie. Die zweite Kategorie der Ausgegrenzten bestand aus den arbeitsfähigen, aber erwerbslosen Armen, den „Überzähligen“ oder „Überflüssigen“ der ländlichen und städtischen Produktion. Sie waren nicht nur ausgeschlossen von den zentralen gesellschaftlichen Institutionen, sondern unterlagen überdies dem Verdikt, „unwürdige“ oder gar „gefährliche“ Arme zu sein. Dementsprechend wurden sie behandelt: verfolgt, eingesperrt, umerzogen. Die Bettler und Landstreicher des 16. Jahrhunderts, Opfer der massenhaften sozialen Entwurzelung der Landbevölkerung, wurden aus den Städten gejagt, in Arbeitshäuser gezwungen. Die Paupers im England des 19. Jahrhunderts verloren ihre bürgerlichen Rechte, wenn sie um Unterstützung in den Armenhäusern nachsuchten. 5 Franz-Xaver Kaufmann, Varianten des Wohlfahrtsstaats. Frankfurt am Main 2003, S. 42. 5 Die Stellung der Armen änderte sich mit der rechtlichen und institutionellen Einbindung der Arbeiterschaft und damit auch der arbeitenden Armen in die bürgerliche Gesellschaft seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mit dem Auf- und Ausbau moderner Wohlfahrtsstaaten nach dem Zweiten Weltkrieg erreichte die institutionelle „Inklusion“ einen vorläufigen Höhepunkt. Thomas Humphrey Marshall beschrieb diesen Prozess in seinen berühmten Vorlesungen über „Bürgerrechte und soziale Klassen“ als eine schrittweise Ergänzung persönlicher und politischer Rechte durch soziale Rechte. Er wurde dafür kritisiert, dass er die Entwicklung zu widerspruchs- und konfliktfrei skizzierte und sich zu sehr am englischen Vorbild orientierte. In der Substanz aber, was den inneren Zusammenhang zwischen persönlichen, politischen und sozialen Rechten betrifft, hat seine Argumentation Bestand. Soziale, vom Wohlfahrtsstaat garantierte Rechte sollen Marshall zufolge zweierlei leisten. Zum einen sollen sie allen Mitgliedern der Gesellschaft gleichen, nicht-diskriminierenden Zugang zu den zentralen gesellschaftlichen Institutionen verschaffen, vor allem zu den Institutionen der Bildung, des Gesundheitswesens und der sozialen Sicherung. Sie sollen also eine Statusgleichheit der Individuen herstellen, ungeachtet aller sonstigen ökonomischen und Herkunftsunterschiede zwischen den Bürgern. Zum andern sollen sie dabei zugleich für alle ein Minimum an gemeinsamen Lebenschancen und kulturell, dem erreichten Wohlstandsniveau angemessenen Lebensstandard gewährleisten. Also nicht nur der Zugang zu institutionellen Leistungen, sondern auch die Qualität der Leistungen selbst ist Gegenstand sozialer Rechte. Mit der Durchsetzung sozialer Rechte ist nach Marshalls Überzeugung zwar nicht die ökonomische und soziale Ungleichheit beseitigt – deren negative Auswirkungen würden allerdings mehr und mehr abgeschwächt – wohl aber die Ausgrenzung. Der Gedanke, dass persönliche und politische Rechte durch soziale Rechte ergänzt werden müssen, damit die Individuen ihre persönliche Integrität wahren und ihren politischen Einfluss wahrnehmen können, ist mittlerweile zu einer Grundüberzeugung in modernen Demokratien geworden. Ja, die demokratische Qualität eines Landes bemisst sich geradezu daran, wie weit sie diese Verbindung der Rechtsarten ihren Mitgliedern gewährleistet. Marshalls Ausführungen zur Soziologie des Wohlfahrtsstaat machen allerdings auch deutlich, dass diese Form der Integration durch Teilhabemöglichkeiten an zwei, mehr oder weniger stillschweigend unterstellte Voraussetzungen gebunden ist. Die eine ist der Bürgerstatus. Wohlfahrtsstaatliche Teilhabe wird Bürgern zugestanden, was in der Regel heißt: Staatsbürgern. Der Bürgerstatus markiert eine rechtliche Grenze, an der nach wie vor in der traditionellen Form der Ausgrenzung über institutionelle Teilhabe oder Ausschluss entschieden wird. Mit der Schaffung transnationaler Einheiten wie der Europäischen Union löst sich der Bürgerstatus zunehmend vom Staatsbürgerstatus ab. Dies gilt erst recht, wenn und in dem Maße wie internationale Konventionen gewissermaßen einen Weltbürgerstatus in 6 der Form humanitärer Rechte institutionalisieren. Gleichwohl bleibt der Bürgerstatus, wie das Schicksal vieler Migranten zeigt, bislang eine hohe Ausgrenzungshürde. Die zweite Voraussetzung ist weniger offensichtlich, aber deshalb nicht weniger wirksam: die Erwerbsarbeit. Marshall verbindet in seinen Ausführungen die sozialen Rechte gar mit einer „Pflicht zur Erwerbsarbeit“ – zumindest für alle arbeitsfähigen Männer. Vollbeschäftigung ist für ihn die Voraussetzung und die Kehrseite der wohlfahrtsstaatlichen Integration über soziale Rechte. Gleichzeitig – und das ist der Widerspruch – kann Erwerbsarbeit in einer kapitalistisch organisierten Marktwirtschaft nicht als soziales Recht garantiert werden. Für Marshall stellte dies Ende der vierziger Jahre, als er seine Vorlesungen hielt, kein Problem dar. Denn damals, kurz nach dem Krieg, herrschte Vollbeschäftigung. Gerade deshalb hielt er es für geboten, auf die „Pflicht“ zur Erwerbsarbeit hinzuweisen – nicht die Pflicht, überhaupt zu arbeiten, das war selbstverständlich, sondern die Pflicht, sich bei der Arbeit ins Zeug zu legen. Die zunehmende institutionelle Einbindung der Bevölkerung und die Erweiterung von Teilhabemöglichkeiten in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg beruhte also auf zwei Säulen: Auf der Ausweitung sozialer Rechte und auf der relativen Vollbeschäftigung. Eine dritte Säule kam hinzu, die immer für soziale Einbindung wesentlich ist: die Einbindung in soziale, insbesondere familäre Nahbeziehungen. Aber diese dritte Säule wurde in dem Maße, wie die beiden anderen tragfähiger wurden, geschwächt. Familiärer Rückhalt war weniger überlebensnotwendig, wenn Markt und Staat es den Individuen erlaubten, sich ökonomisch unabhängig zu machen. Das Besondere an der wohlfahrtsstaatlich vermittelten Integration der Nachkriegszeit besteht darin, dass alle drei Säulen in einer engen Beziehung und Abhängigkeit zueinander stehen, aber gleichwohl jeweils Unterschiedliches zur gesellschaftlichen Einbindung der Individuen beitragen. Wenn eine Säule versagt, kann sie deshalb auch nicht ohne weiteres durch eine andere in ihren Leistungen ersetzt werden. Erwerbsarbeit bindet die Menschen in die wechselseitigen Abhängigkeiten objektivierter, arbeitsteiliger Sozialbeziehungen ein. Es ist dies der von den französischen Vertretern in der Exklusionsdebatte immer wieder hervorgehobene Aspekt der organischen Solidarität im Sinne Durkheims. Erwerbsarbeit, die unter dem Gesetz der Reichtumsvermehrung durch Kapitalakkumulation steht, kann aber weder für alle Erwerbstätigen, schon gar nicht für die Nicht-Erwerbstätigen, einen angemessenen Lebensstandard garantieren noch eine materiell und sozial abgesicherte Lebensperspektive. Soziale Rechte wiederum – sie werden im angelsächsischen Verständnis von Integration durch „Citizenship“ betont – können zwar sozialen Status, Lebensstandard und Lebenschancen in dieser Wechselseitigkeit absichern helfen und in einem gewissen Maß auch Nicht-Erwerbstätigen Schutz zukommen lassen, aber nicht für Erwerbsarbeit sorgen und schon gar nicht für persönliche Bindungen, die dritte Säule also. 7 Interdependenz – die Einbindung in die formalisierten Wechselbeziehungen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und in die Reziprozität informeller Nahbeziehungen – auf der einen Seite und Partizipation – also die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben entsprechend allgemein anerkannter Standards, vermittelt über Bürgerrechte – auf der anderen Seite stellen somit jeweils eigenständige Zugehörigkeits- oder Integrationsmodi dar, die gleichwohl aufeinander verweisen und aufeinander angewiesen sind. Ihre Verbindung, die historisch keinen Vorläufer hatte, machte die besondere integrative Leistungsfähigkeit insbesondere der europäischen Gesellschaften nach dem Krieg aus. Die Komplexität der Verbindung aber bedeutete auch eine besondere Anfälligkeit. Wird eine „Säule“ brüchig, dann gerät, um im Bild zu bleiben, das ganze Gebäude ins Wanken. Für Marshall war dieser Fall undenkbar. Seit den achtziger Jahren aber ist er soziale Realität. Die strategische Säule, die brüchig zu werden begann, war die Erwerbsarbeit. Damit bin ich bei meinem zweiten Argument. Begriffliche Annäherung an die neuen Formen der Ausschließung In der Tat sind wir also heute wieder, zugleich aber auch in besonderer und neuer Weise mit Ausschluss- oder Ausgrenzungsproblemen konfrontiert. Nach wie vor gibt es die „traditionellen“ Formen der rechtlichen und institutionalisierten Zugangsverweigerung. Vermutlich nehmen sie sogar wieder zu. Die sog. Sozialhilfereform in den USA aus dem Jahr 1996 zum Beispiel beschränkte das Recht auf Sozialhilfe auf fünf Jahre während einer gesamten Lebenszeit. Dies bedeutet nichts anderes als eine Drohung mit dem Entzug jedes sozialstaatlichen Schutzes. Zugleich aber sind die Menschen in den hoch entwickelten kapitalistischen Gesellschaften heute mehr denn je in Marktbeziehungen und staatliche Regelungen eingebunden und von ihnen abhängig. Trotzdem oder vielmehr: gerade deshalb ist Ausgrenzung möglich. Sie bemißt sich nun aber an Maßstäben, die im und durch die modernen Wohlfahrtsstaaten und die durch sie vermittelte Integration gesetzt wurden. Sozialhilfeempfänger verlieren heute nicht ihren Bürgerstatus, jedenfalls sofern sie Staatsbürger und nicht Migranten sind. Im Gegenteil ist Sozialhilfe durch einen Rechtsanspruch gesichert. Wenn sie aber mit Diskriminierung, etwa auf dem Weg der Bedürftigkeitsprüfung, verbunden ist und in ihren Leistungen unterhalb des kulturell angemessenen Lebensstandards bleibt, wirkt sie, am Maßstab sozialer Rechte beurteilt, ausgrenzend. Ein anderes Beispiel: Armut bedeutet nicht nur Einschränkung sondern grenzt aus, weil und insofern die Menschen heute in einem früher unbekannten Maße mit verallgemeinerten Konsumstandards jenseits von Milieugrenzen konfrontiert sind, an denen sie sich selbst messen und an denen sie von anderen gemessen werden. Ausgrenzungen dieser Art können weniger denn je in einer Begrifflichkeit des Ausschlusses aus der Gesellschaft, der Entgegensetzung von „Innen“ und „Außen“ verstanden werden. 8 Vielmehr müssen sie als Ausgrenzungen in der Gesellschaft begriffen werden, als gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse – allerdings Ungleichheitsverhältnisse besonderer Art, die sich von anderen Ungleichheiten unterscheiden. Ausschluss aus Interdependenzbeziehungen und Ausschluss von Partizipationsmöglichkeiten: Zwei Klassiker der Soziologie haben uns wichtige Hinweise gegeben, wie derartige Ausgrenzungen als Ausgrenzungen in der Gesellschaft begriffen werden können. Georg Simmel analysierte das Fürsorgeverhältnis als ein Verhältnis der „Gleichzeitigkeit“ von „Drinnen“ und „Draußen“. Der Fürsorgeempfänger befindet sich in der Obhut des Staates und somit im gesellschaftlichen „Drinnen“. Die Gesellschaft bezieht sich auf ihn. Das Verhältnis selbst ist jedoch gekennzeichnet durch das Ende aller Wechselseitigkeit oder Interdependenz, durch einseitige Abhängigkeit und Machtlosigkeit. Das unterscheidet ihn selbst vom ausgebeuteten Lohnarbeiter. In diesem Sinne befindet er sich außerhalb der Gesellschaft, im „Draußen“. Die Zuweisung des Armen in die externalisierte Position aber dient, Simmel zufolge, der Verteidigung des gesellschaftlichen Status quo.6 Thomas Marshall wiederum dachte zwar nicht, dass es im Wohlfahrtsstaat noch Ausgrenzung geben könnte, aber er hat uns Kriterien an die Hand gegeben, mit deren Hilfe wir erkennen können, ob der Zugang zu und die Behandlung durch wohlfahrtsstaatliche Institutionen tatsächlich Partizipationsmöglichkeiten eröffnen oder verschließen: Statusgleichheit und kulturell angemessene Lebenschancen. In diesem Sinne einer nur vordergründig realisierten Status- und Chancengleichheit durch eine wohlfahrtsstaatliche Institution ist es zu verstehen, wenn Bourdieu und Champagne von den „intern Ausgegrenzten“ 7 des Bildungswesens sprechen. Die Verschiebung der Problemdefinition von „Ausschluss aus der Gesellschaft“ „Ausschluss in der Gesellschaft“ scheint mir nicht nur notwendig, um insbesondere neuen Ausgrenzungsformen angemessen wahrnehmen und untersuchen zu können. erlaubt es darüber hinaus, wie ich meine, auch die Fallstricke zu vermeiden, die dichotomische Ausgrenzungsbegriff – der des „Drinnen oder Draußen“ – mit sich bringt. zu die Sie der Der Ausgrenzungsbegriff ist somit eine Kategorie von zentraler Bedeutung für die Untersuchung von sozialer Ungleichheit heute. Er fällt nicht in eine „Randgruppentheorie“, sondern zielt auf das Verständnis grundlegender Veränderungen, in denen sich die hoch entwickelten kapitalistischen Gesellschaften Europas und Nordamerikas gegenwärtig befinden. Der Erkenntnisfortschritt, den er verspricht, ergibt sich zum einen daraus, dass er darauf angelegt ist, die verschiedenen Dimensionen der gesellschaftlichen Zugehörigkeit in ihrem Ergänzungs- und Spannungsverhältnis in den Blick zu nehmen: die Erwerbsarbeit, die 6 Georg Simmel, Soziologie, 6. Auflage. Berlin 1983, S. 345 ff. Pierre Bourdieu und Patrick Champagne, Die intern Ausgegrenzten. In: Pierre Bourdieu u.a., Das Elend der Welt. Konstanz 1997, S. 527. 7 9 sozialen Nahbeziehungen, die sozialen Rechte und sozialstaatlichen Institutionen. Zugleich zwingt er dazu, danach zu fragen, wer oder was schließt aus und auf welche Weise? Wann setzt – in der Erwerbsarbeit, in den sozialen Beziehungen, in den Institutionen des Sozialstaats – Gefährdung ein, wann und warum schlägt sie in Ausgrenzung um? Wie lassen sich Gefährdungs- und Ausgrenzungsprozesse aufhalten oder revidieren? Von den „Ausgeschlossenen“ lenkt er somit den Blick immer wieder zurück auf die gesellschaftlichen Verhältnisse. Und schließlich: Dieser Ausgrenzungsbegriff ist eminent politisch. Denn in den Veränderungen, die er untersucht, steht die Zukunft der Demokratie auf dem Spiel – der Demokratie jedenfalls, wie wir sie nach den Erfahrungen von Wirtschaftskrisen, Faschismus und Krieg zu begreifen gelernt haben – als sozial fundierte Demokratie. Anschrift: Prof. Dr. Martin Kronauer, Fachhochschule für Wirtschaft Berlin, Badensche Straße 50-51, D-10825 Berlin. E-mail: [email protected] 10