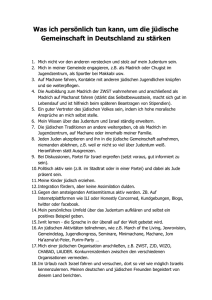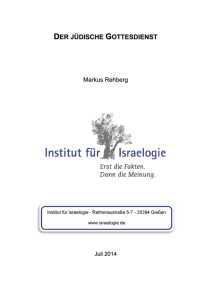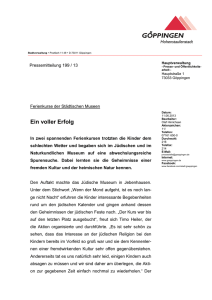Mit dem Gesicht nach vorne gewandt Judentum und Schoah im
Werbung

Mit dem Gesicht nach vorne gewandt Judentum und Schoah im Denken der jüdischen Studenten Europas JULIAN VOLOJ Erinnerungskultur Im Mythos über den Verlauf des Titanenkrieges entmannt Kronos, Sohn von Uranos (Himmel) und Gaia (Erde), seinen Vater und bemächtigt sich der Weltherrschaft. Aus Angst, ihm könne das gleiche Schicksal widerfahren, verschlingt Kronos seine eigenen Kinder bis auf Zeus, der von seiner Mutter versteckt wird. Als Erwachsener fordert Zeus seinen Vater zum Kampf auf und zwingt ihn, die Geschwister wieder auszuspeien. Mit Zeus tritt ein neues Zeitalter ein. Kronos’ Versuch, die Nachfahren zu verschlingen, steht symbolisch für den Versuch der Überwindung eines chronologischen Zeitverlaufes. Zeus zeugt mit Mnemosyne, der Göttin der Erinnerung, die neun Musen und führt somit in das Zeitalter der Erinnerung ein. Die Erinnerungskultur ist ein universales Phänomen und zentraler Bestandteil des europäischen Erbes und hat im Judentum einen zentralen Stellenwert. Der Imperativ „zachor“ „( זחורGedenke!“, „Erinnere dich!“) findet sich mehrfach im Zusammenhang mit der AmalekEpisode des Auszuges aus Ägypten im Buch ( שׁמוֹתExodus). Die damals vertriebenen Juden werden als Hebräer bezeichnet, wobei das Wort Hebräer „( איבריIwri“) im etymologischen Zusammenhang mit „leawor“ „( לאבורüberqueren“, „passieren“) und „awar“ אבר („Vergangenheit“) zu sehen ist. Ein Hebräer ist somit ein Passant beziehungsweise Vorüberschreitender, der sich seiner Vergangenheit bewusst ist. Mit der Zerstörung des zweiten Tempels im Jahre 70 der christlichen Zeitrechnung beginnt dieses Vorüberschreiten, das im allgemeinen mit dem griechischen Wort für Zerstreuung, „Diaspora“, bezeichnet wird. Das Volk Israel hat sich unter dem Imperativ „ זחורzachor“, der im Pentateuch manifestiert ist, konstituiert und kontinuiert.1 Der Grundzyklus des hebräischen und später jüdischen Lebens, der im Ritus seinen nachhaltigen Niederschlag findet, kommt deutlich in dieser ersten Wocheneinheit zum Ausdruck: Die sechs Tage der Schöpfung entsprechen der Geschichte, 1 Vgl. JAN ASSMANN, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 1997, S. 30. der siebte dient der Reflexion durch Erinnerung. Über Generationen hinweg bildete dieser temporale Zyklus von Vergegenwärtigung und Reflexion eines der Fundamente der jüdischen Kultur. Während in der griechischen Mythologie die Genealogie durch die Überwindung der Generationen, der Väter, entsteht – Kronos bezwingt seinen Vater Uranos und wird von seinem Sohn Zeus entmachtet –, gründet die hebräische, später jüdische Geschichtsauffassung auf der Sukzessivität, auf der Übergabe des geschichtlich-kulturellen Vermächtnisses von einer Generation an die nächste. In der jüdischen Kultur bleiben alle Zeitdimensionen präsent, daher stellt der Modus Vergangenheit keine Ansammlung gewesener Ereignisse dar, sondern bildet eine gegenwärtige Vergangenheit. Gewesenes wird in der Bibel häufig mit dem Verb „lefanim“ לפניםeingeleitet, das wörtlich übersetzt „mit dem Gesicht nach vorne gewandt“, zugleich aber „vorher“, „in früheren Zeiten“ bedeutet. In die Zukunft zu schauen, impliziert im Judentum immer das Bewusstsein der Vergangenheit. Die wöchentlichen Thoralesungen und die narrativ-geschichtliche Form nahezu aller jüdischen Feiertage reflektierten das Verhältnis der Vergangenheit zur Gegenwart immer neu. Der kollektiven Vergangenheit wurde die zyklische Qualität liturgischer Zeit verliehen, doch glich Geschichte nicht dem Schicksal, sondern dient zur Reflexion der Gegenwart. Ein zentrales Moment des geschichtsdurchdrängten jüdischen Ritus stellt der Seder-Abend am Pessachfest dar. Der Auszug aus Ägypten wird Jahr für Jahr von neuem nicht nur erzählt, sondern auch als ein Schlüsselprozess in der jüdischen Kollektivgeschichte und im geistigen Wesen jedes einzelnen Teilnehmers an der Lektüre gedeutet. Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen zu einer Einheit. Seit dem Ende des zweiten Weltkrieges ist in allen Segmenten der jüdischen Kultur eine neue Dimension akuten historischen Bewusstseins spürbar. Die Schoa und die Folgen dieses modernen Vernichtungszuges, der das ganze jüdische Volk zum Ziel hatte, hinterließen unzählige Spuren im Leben jedes einzelnen Juden. Sehnsucht nach Heimat Die Schoa war die bisher extremste Form des Genozids, da dieser systematische Massenmord im Unterschied zu anderen universell und total sein sollte. Der Mord war antipragmatisch und rein ideologisch motiviert und steht in einer langen Tradition christlicher Judenfeindschaft.2 Die Schoa ist daher auch der gescheiterte Integrationsversuch einer nicht-christlichen Minderheit in ein christliches Europa. Die Schoa zerstörte eine Sehnsucht nach Heimat. In der deutschen Sprache ist kaum ein Begriff so gefühlsbeladen sind wie das Wort „Heimat“, das ursprünglich ein Neutrum, also das Heimat, war und mit seiner Mutation zu einem Femininum emotional aufgeladen wurde. Etymologisch ist „Heimat“ mit dem Wort „Heim“ verbunden und bezeichnet einen positiven Aspekt der Sesshaftigkeit. Der Begriff gehört zur Sprache der neolithischen Revolution der Ackerbauern und ist eng verbunden mit dem agrarischen Patriotismus für den Heimvorteil des eigenen Raumes, zugleich wird der Anspruch einer Verbundenheit mit einem geographischen Ort erhoben.3 Alle Hochkultursprachen sind imstande, das Konzept „Heimat“ mit ihren spezifischen Mitteln auszudrücken. Das lateinische Wort patria bezeichnet eine nationale Gesamtheit und hat die Konnotation von Vaterland. Diese Etymologie findet sich in allen romanischen Sprachen. Im slawischen Sprachraum finden wir verschiedene Interpretationsmöglichkeiten des Begriffs „Heimat“. So entspricht der polnische Begriff ojczyzna der romanischen Interpretation des Vaterlands, im Tschechischen hängt das Wort vlast mit dem Wort für Eigenschaft (vlastnost) zusammen, was als Definition des Heimvorteils des eigenen Raumes zu interpretieren wäre, im Kroatischen finden sich dòmovina, in dem das Wort dôm („Heim, Haus“) steckt, und zävicaj, das von zävézati („verbinden“) abgeleitet wird und die Verbundenheit mit einem Ort unterstreicht. Im Russischen entspricht Heimat dem Femininum родина (rodina), abgeleitet von родить (rodit’), „gebären“: die Heimat als Mutterfigur, die den Menschen gebärt. Eine ebenso simple wie einleuchtende Definition findet sich – neben der fatherland Variante – im Englischen, home. „Heimat“ ist immer ein „Zuhause“. 2 Zum Einfluss christlicher antijüdischer Literatur seit dem Mittelalter vgl. ARNE DOMRÖS, THOMAS BARTOLDUS, JULIAN VOLOJ (Hg.), Judentum und Antijudaismus in der deutschen Literatur im Mittelalter und an der Wende zur Neuzeit. Ein Studienbuch, Berlin 2002. 3 Vgl. PETER SLOTERDIJK, Der gesprengte Behälter, Notiz über die Krise des Heimatbegriffs in der globalisierten Welt, in: Sehnsucht nach Heimat, Spiegel Spezial 6/1999, S. 24-29, hier: S. 24. Traditionell stellte das Diasporajudentum ein Volk ohne „Grund“ dar. Heinrich Heine sprach davon, dass das Judentum ein „portatives Vaterland“ besäße und meinte damit, dass das jüdische Volk nicht in einem Land, sondern in einem Buch, der Thora, zuhause sei. Religion und Geschichte bildeten traditionell die Grundlage für die jüdische Identität. Ein Volk ohne Land kann nicht dem Trugschluss erliegen, das Land selbst als Volksbehälter zu verstehen und den eigenen Boden als Prinzip des Lebenssinns oder der Identität aufzufassen. Der Denkfehler der territorialen Vernunft ist eine obsessive Gleichsetzung von Ort und Selbst. Wenn man daher von einer ‚Provokation’ des Judentums im Galut, der Exilperiode, reden kann, so bestand diese darin, dass das Judentum das Paradoxon eines faktisch existierenden Selbst ohne Ort vor Augen hielt.4 Altneuland? Die Schoa und der Zweite Weltkrieg haben Europa und seine Realitäten verändert. Der Nationalstaat, als bisher größtes politisches Wohnverhältnis, wird zunehmend zur Disposition gestellt und die Hoffnung auf ein neues „Europa der Minderheiten“ geprägt, in dem religiöse, ethnische, nationale, ideologische, kulturelle oder linguistische Identitäten Teil einer breiteren europäischen Identität sind. Der Hoffnung nach einer Heimat in Europa steht die Erinnerung an die Schoa und eine jahrhundertealte Tradition des europäischen Judenhasses gegenüber. Der Glauben an ein neues Europa, das auch eine Zukunft für die jüdische Diaspora darstellt, manifestierte sich erst sehr langsam. Mit der Gründung der European Union of Jewish Students (EUJS) wurde diesem Glauben an eine Zukunft 1978 ein bedeutendes Zeichen gesetzt. Jüdische Identität nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich verändert. Auch wenn die Mehrheit der jüdischen Studenten heutzutage ihr Judentum primär als kulturelle Identität auffasst, so gehört nach wie vor die Kenntnis von Religion und Geschichte zur eigenen Identität. Eine moderne jüdische Identität hat jedoch zwei weitere zentrale Bestandteile: Die Erinnerung an die Schoa als Negativfaktor und der Staat Israel als Positivfaktor. Wurde der Zionismus 4 Vgl. ebd., S. 26. Anfang des 19. Jahrhunderts überwiegend von den westeuropäischen Juden abgelehnt, so gehört er heutzutage fast selbstverständlich zur jüdischen Identität. Die Gründung der European Union of Jewish Students negierte dies nicht, jedoch setzte sie der zionistischen Erziehung einen Glauben an eine Zukunft in der Diaspora entgegen. Nicht Alija, die Immigration nach Israel, sollte als Ziel angestrebt werden, sondern die Unterstützung von jüdischen Studenten überall in Europa. Heutzutage ist EUJS ein Dachverband von 34 nationalen Organisationen mit europaweit etwa 200.000 Mitgliedern. So verschieden wie Europa sind auch die Realitäten von jüdischen Studierenden, selbst wenn die Grundfragen nach Heimat, Integration, Identität und dem Verhältnis zu Israel in allein Gemeinden vorhanden sind. Besonders seit dem Fall der Berliner Mauer ist in Europa eine Renaissance jüdischen Lebens zu spüren. Wegbereiter dieser Bewegung sind oftmals Jugendliche und Studenten, die sich auf die eigenen Wurzeln zurückbesinnen und eine positive jüdische Identität anstreben, in der zwar die Schoa ebenso wie Israel zur Identität gehören, jedoch auch der Glauben an eine Zukunft in der Diaspora. Im März 2002 organisierte beispielsweise EUJS in Zusammenarbeit mit jugoslawischen Studenten das erste internationale jüdische Seminar seit 1988 (!) in Belgrad. Nach mehr als einem Jahrzehnt, das von Krieg, Isolation und Diktatur geprägt war, sollte dieses vollkommen von Studierenden für Studierende organisierte Seminar ein Zeichen für eine friedliche Koexistenz im Balkan setzen, zu der die sefardisch-jüdische Kultur wie selbstverständlich gehört. Dieser offensichtlichen Renaissance steht jedoch eine nicht bewältigte Identitätskrise gegenüber. Die Frage nach dem eigenen Judentum als halachische oder kulturelle Identität findet ebenso wie die zum Verhältnis zu Israel je nach Region verschiedene Antworten. Der Nahostkonflikt ist jedoch Grund dafür, dass der nötige innerkulturelle und innerreligiöse Dialog nicht stattfindet. Die antiisraelische und antijüdische Stimmung in Europa wird zurecht als starke Bedrohung empfunden und sorgt für eine allgemeine Verunsicherung, von der gerade Studierende, die sich im allgemeinen in einer Orientierungsphase befinden, betroffen sind. Die gegenwärtige Vergangenheit wird als Reflexion der Gegenwart gesehen und trägt zu der aktuellen Krise bei. Der schwierige Spagat zwischen einerseits aktiv gegen Antizionismus, Antiisraelismus und Antisemitismus zu kämpfen und andererseits unabhängig vom Konflikt im Nahen Osten eine positive europäisch-jüdische Identität zu fördern, scheint von nichtjüdischer Seite nicht verstanden zu werden. Ein anderes Phänomen „jüdischer“ Identität hat sich erst in den letzten Jahrzehnten herausgebildet und muss an dieser Stelle auch Erwähnung finden: Die israelische Diaspora. Den als „Klein-Jerusalem“5 bezeichneten Zentren jüdischer Kultur des 19. Jahrhunderts können im 21. Jahrhundert die kleinen Tel Avivs der israelischen Diaspora gegenübergestellt werden, die in ihrer Selbstdefinition keineswegs „jüdisch“ sind. Säkulare Israelis sehen ihre Identität als primär national israelisch und erst sekundär kulturell jüdisch. Falls überhaupt, hat die israelische Diaspora in Amsterdam, Berlin, Prag oder New York nur kaum Kontakt zu den jeweils ansässigen jüdischen Gemeinden. Seit dem Ausbruch der zweiten Intifada wächst die israelische Diaspora in Europa und trägt zu einer neuen Selbstdefinition der jüdischen Diaspora bei. Bereits jetzt scheint sich abzuzeichnen, dass gerade Studenten hierbei ein wichtiger Integrationsfaktor sein können, auch wenn sich noch keine nachhaltigen Tendenzen erkennen lassen. Europäische Utopien? Der momentanen Krise zum Trotz überwiegt der Glauben an eine Zukunft in Europa. Im Hebräischen sind die Worte „kadima“ ‚( קדימהvorwärts’) und „kodma“ ‚( קודמהrückwärts’) etymologisch verbunden, was impliziert, dass keine Zukunft ohne Vergangenheit existieren kann. Entscheidend ist daher, welche Schlüsse wir aus der Vergangenheit ziehen, um ein neues Europa aufzubauen, das Heimat aller seiner Bürger ist. Selbst wenn eine Trennung von Kirche und Staat existiert, darf die Dominanz der etablierten Mehrheitsreligion im Alltag nicht unterschätzt werden. Die Gesellschaften sind im Wandel und auch das kollektive Identitätskonstrukt bleibt davon nicht unberührt. Trotz der zunehmenden Säkularisierung der Gesellschaft basieren zahlreiche institutionelle Kontexte auf einer christlichen Tradition wie etwa die staatliche Sanktion religiöser Feiertage. Die 5 Beispielsweise wurde Thessaloniki als „Jerusalem des Balkans“, Wilna als „Jerusalem des Baltikums“ und Odessa „Jerusalem am Schwarzen Meer“ bezeichnet. scheinbare Homogenität einer christlich abendländischen Gemeinschaft produziert gleichzeitig eine integrative wie exklusive Identität. Integrationsmechanismen einer solchen Gemeinschaft sind Konfliktpotentiale. zugleich Soziologisch Exklusionsmechanismen gesehen kann und Religion implizieren zur Formierung latente von Zivilgesellschaften beitragen und diese stabilisieren, jedoch auch nationalistisch oder ethnisch motivierte Abgrenzungen fördern. Der Kosovokrieg als ethnoreligiöser Konflikt ist hierfür ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist. Erweist sich eine Gesellschaft gegenüber Minderheitsreligionen latent oder offen feindlich, fördert dies fundamentalistische Tendenzen. Die Selbstgettoisierung kann auf den Erfahrungen einer nicht-integrativen, egozentrischen und im extremen Fall feindlich gesinnten Umwelt basieren. Eine Form der Ausgrenzung ist Desinteresse oder Ignoranz. Das Interesse und Wissen an der jüdischen und islamischen Kultur und Religion ist nach wie vor erschreckend gering. Durch diese desinteressierte und ignorante Toleranz werden Nachbarn zu Fremden stilisiert. Die christlich ausgeprägte Identitätslegitimierung Europas formiert und uniformiert die europäische Gesellschaft und führt zwangsläufig zur Ausgrenzung aller, die sich nicht in dieser fortwährend reproduzierten Identität wiederfinden. Franz Kafkas Erzählung „Das Schloss“ dient als Parabel für die aktuelle Situation. Ein Fremder versucht anerkannt und integriert zu werden, doch scheitert am herrschenden System. Er wird als Fremder geduldet, jedoch nicht als Teil der Gesellschaft akzeptiert. Viele Menschen in Europa können Kafkas Erzählung als Metapher ihrer eigenen Existenz verstehen. Eine religiös pluralistische Gesellschaft muss sich der Dominanz und Partikularität einer Religion bewusst sein und Solidarität zum Ziel haben. Von religiöser Überheblichkeit muss hin zu ethischer Moralerziehung und Toleranz aus dem Bewusstsein der eigenen Relativität erzogen werden. Ein neues Europa muss sich auf sein eigenes kulturelles Erbe zurückbesinnen. Das Judentum ist ebenso wie die griechische und römische Kultur Teil dieses europäischen Erbes, doch leider wird Judentum heutzutage fast ausschließlich mit Antisemitismus und Schoa assoziiert. Natürlich ist ein kritisches Geschichtsbewusstsein wichtig, jedoch ohne ein tieferes Verständnis des Judentums als Teil der europäischen Kultur werden Juden immer als „Fremde“ entfunden. So wichtig es für jüdische Studenten heutzutage ist, eine positive jüdische Identität zu haben, so wichtig ist es auch für das nichtjüdische Europa das Judentum als Teil des eigenen kulturellen Erbes zu verstehen. Der Schlüssel zu all dem liegt in der Erziehung. Das lateinische Wort educare bedeutet wörtlich übersetzt „herausführen“. Bleibt zu hoffen, dass Erziehung den Weg zu einer offenen und toleranten Gesellschaft ebnen wird, die Heimat für alle Kulturen wird. In: HANS ERLER (Hg.), Erinnern und Verstehen. Der Völkermord an den Juden im politischen Gedächtnis der Deutschen, Frankfurt a.M. 2003, S. 145-151.