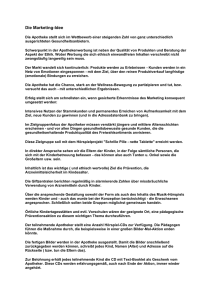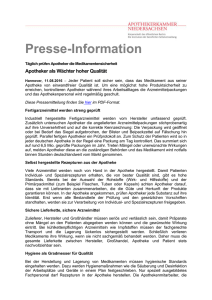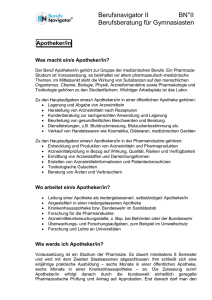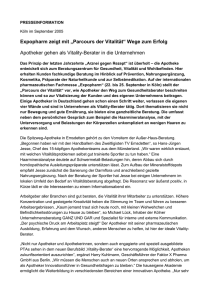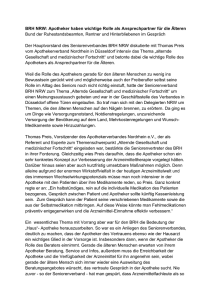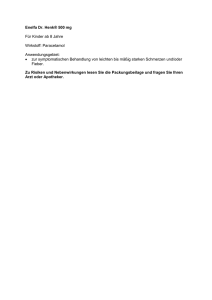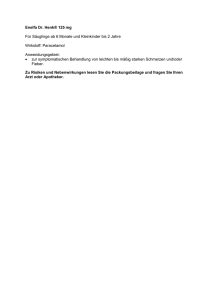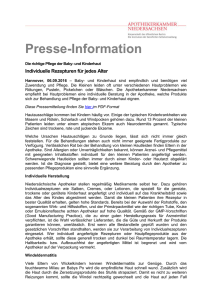Ein gefährlicher Versuch
Werbung

WIRTSCHAFT Artikel vom 21.08.2016 / Ausgabe 34 / Seite 4 Ein gefährlicher Versuch Steffen Fründt Die Krankenkassen wollen bei der Krebsbehandlung sparen: Die Medikamente sollen nur noch von den billigsten Apotheken gemischt werden. Schon nach wenigen Tagen beklagen Mediziner chaotische Zustände Es sind 17 identische Liegesessel, die sich im Obergeschoss der onkologischen Praxis in der Duisburger Innenstadt aneinanderreihen, vor jedem steht ein kleines Bänkchen für die Füße. Sie sehen gemütlich aus, wie Fernsehsessel. Doch die Menschen, die dort Platz nehmen, kommen, um sich eine hochtoxische Substanz verabreichen zu lassen. Während sie nebeneinander sitzen, in Magazinen blättern oder auf dem Kopfhörer Musik hören, tropft ein für jeden speziell zusammengemixter Cocktail aus Medikamenten in ihre Blutbahn, die das Zellwachstum stoppen oder verlangsamen und damit den Krebs, wie sie hoffen. 40 bis 50 Patienten am Tag bekommen hier ihre Chemotherapie, viele haben Stammplätze. Der Kampf gegen den Tod kann zur Routine werden. Doch nun gibt es ein Problem mit dem Medikamentenmix, die Patienten sind in Aufruhr, in ganz Deutschland. Zwei Wochen ist es her, dass im Medizinischen Versorgungszentrum Hämatologie und Onkologie Duisburg die Krankenschwester Ute Jöris, 54, bemerkte, dass etwas nicht stimmte. Sie bereitete die Therapien für den Tag vor. Für zwei Patienten waren keine Infusionsbeutel geliefert worden. Sie rief die Apotheke an. Der Apotheker versprach, er werde die Präparate gleich nachschicken. Später am Tag kam ein Fax mit dem Hinweis, dass man leider keine Chemotherapien mehr liefern werde. Und zwar schon ab dem nächsten Tag. Jöris begann die Behandlung der anderen Patienten. Die beiden AOK-Versicherten – ein an Bronchialkrebs erkrankter Mann und eine Frau mit einem Eierstockkarzinom – konnte sie nur hinhalten. Jöris gab ihnen eine Vorinfusion gegen Übelkeit. Sie drehte den Tropf extra langsam, um das Warten zumindest subjektiv zu verkürzen. "Zeit ist für Krebspatienten etwas sehr Wertvolles", bemerkt die 54-Jährige. Die AOK ist die erste von mehreren Krankenkassen, die ein Sparprogramm eingeführt haben, das schon nach wenigen Tagen zu einem ziemlichen Chaos in Deutschlands onkologischen Arztpraxen geführt hat. Bisher werden die Ärzte von spezialisierten Apotheken mit eigens angemischten Chemotherapien beliefert, oft sind die Geschäftsbeziehungen über viele Jahre gewachsen. Künftig sollen nur noch die billigsten Apotheker Krebsmittel mischen. Wer den Zuschlag im Ausschreibungsverfahren bekommt, darf eine ganze Region versorgen. Andere Kassen wollen es der AOK gleichtun, die DAK, Knappschaft und viele Betriebskrankenkassen etwa. Die Neuerung wird bald wohl mindestens 30 Millionen Versicherte betreffen. Die Änderung ist kaum in Kraft, da stellt sich schon heraus, dass einige Anbieter womöglich gar nicht in der Lage sind, die Versorgung todkranker Menschen zu gewährleisten. Jedes Jahr wird in Deutschland bei rund einer halben Million Menschen ein bösartiger Tumor diagnostiziert. Mehr als 40 Prozent von ihnen sterben daran. Die meisten Patienten aber können den Krebs für einige Zeit oder ganz besiegen, durch Operationen, Bestrahlung, neue Behandlungsmethoden – und durch Chemotherapien. Die haben teils heftige Nebenwirkungen, Haarausfall, schwere Übelkeit. Doch sie können Leben retten oder verlängern. Ärzte und Apotheker hatten deshalb gegen die Pläne der Kassen protestiert und vor gravierenden Folgen gewarnt. Vergeblich. Für die Versicherten der AOK ist das neue Verfahren nun in mehreren Bundesländern Wirklichkeit. Seit Anfang des Monats erhalten sie ihre Zytostatika nur noch von der Apotheke, die das Los für ihre Region gezogen hat. Nun berichten Mediziner, dass die ersten Erfahrungen die Befürchtungen bestätigen. "Es kam in den betroffenen Praxen wiederholt zu ernsthaften Problemen. Da bricht eine Welle über uns herein", sagt Erik Engel vom Vorstand des Bundesverbands der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen (BNHO). Der Verband hat ein wissenschaftliches Institut beauftragt, die Auswirkungen des neuen Systems auf die Zytostatika-Versorgung in der Praxis zu analysieren. Der Zwischenbericht, dessen Zusammenfassung der "Welt am Sonntag" vorliegt, liest sich dramatisch: fehlende Chemotherapien, nicht lieferbare Begleitmedikationen, unbefüllte Infusionsbestecke, unbeschriftete Spritzen, falsche Packungsgrößen, Lieferverzögerungen, Kommunikationsprobleme und vieles mehr. Binnen nur 15 Tagen kam es demnach in 60 untersuchten Arztpraxen zu mehr als 60 als gravierend oder sehr gravierend eingestuften Vorfällen. "Einige Apotheker scheinen mit der Lage komplett überfordert", sagt Ralf Lohse, Geschäftsführer der Nädler GmbH. Das Unternehmen betreibt an neun Standorten Medizinische Versorgungszentren, 21 Onkologen arbeiten dort. Auch die berichten nichts Gutes: In der Rhein-Ruhr-Region etwa habe eine Apotheke den Zuschlag für die Versorgung von sechs großen onkologischen Einrichtungen bekommen, die nicht einmal über ein vollwertiges Labor zur Herstellung der Zytostatika-Infusionen verfüge – und deshalb auf einen Drittanbieter zurückgreifen müsse. Das führe zu folgenreichen Verspätungen. Obwohl laut Ausschreibungsbedingungen der AOK eine Ad-hoc-Versorgung binnen 45 Minuten garantiert sein muss, kämen die oft nur wenige Stunden haltbaren Medikamente regelmäßig zu spät, sagt Lohse: "Patienten sitzen bis zu sechs, sieben Stunden in der Praxis." Für Krebskranke, denen die Therapie manchmal nur noch einige Monate schenkt, sei das besonders bitter. Lohse erzählt zudem, dass eine Apotheke eine Chemotherapie kurzerhand in einem zweckentfremdeten Kochsalzbeutel lieferte, gängige Medikamente seien nicht verfügbar gewesen, Infusionsbestecke unpassend. Lohses Zwischenbilanz ist verheerend: "Bei annähernd 100 Prozent der betroffenen Patienten kam es in den ersten 15 Tagen zu irgendwelchen Unregelmäßigkeiten." In anderen Bundesländern ist es offenbar ähnlich. In Hamburg vergab die AOK das Los zunächst an einen wegen Arzneimittelbetrugs vorbestraften Apotheker, der Krebsmedikamente aus Ägypten bezogen haben soll und gegen den die Staatsanwaltschaft auch aktuell wegen des Verdachts von Unregelmäßigkeiten bei der Zytostatika-Herstellung ermittelt. Die Kasse hat dem Mann die Lizenz inzwischen wieder entzogen. In Hessen befindet sich eine Onkologin in einem intensiven Schriftverkehr mit der ihr zugewiesenen Apotheke und der Kasse, nachdem ihr eine nur wenige Stunden haltbare Infusion mit großer Verspätung geliefert worden war. Der Apotheker forderte die Ärztin auf, das verfallene Präparat trotzdem zu verabreichen, es sei noch gut. Vermutlich wollte er verhindern, dass seine Verspätung ihn teuer zu stehen kommt. Eine einzige AntikörperTagesdosis kann mehrere Tausend Euro kosten. Im Fachjargon heißen die Zytostatika, die nicht verabreicht werden können, "Verwürfe". Auch sie spielen im neuen Ausschreibungsverfahren eine Rolle – und können die Kassen am Ende viel Geld kosten. Es kommt häufig vor, dass eine geplante Therapie nicht durchgeführt werden kann, weil der Patient zu schwach ist, Nebenwirkungen erleidet oder kurzfristig ins Krankenhaus muss. Bisher nahmen die Apotheken die Präparate dann meist zurück. Bei ausreichender Haltbarkeit konnten sie die steril verpackten Zytostatika noch für die Therapie anderer Patienten verwenden. "In den Ausschreibungen ist die Rücknahme der Verwürfe nicht mehr vorgesehen", sagt Michael Schaefers, niedergelassener Arzt in der Onkologie Duisburg. "Wir müssen sie wegschmeißen und normal rezeptieren. Es wirkt fast so, als hätten die Kassen nie mit einem Arzt gesprochen." Die AOK dagegen sagt, die neuen Versorgungsverträge seien "sehr positiv angelaufen". Nur "in wenigen , einzelnen Fällen" habe die Umstellung "nicht vom ersten Tag an reibungslos" geklappt. Zudem habe sich ein ähnliches Ausschreibungskonzept in Berlin schon seit Jahren bewährt. Es komme Bewegung in einen bisher intransparenten Markt. "Dass sich einige Onkologen und Apotheker aufregen, war vorprogrammiert", heißt es in der Stellungnahme ungewöhnlich flapsig. "Da sieht so mancher Beteiligte seine Geschäftsbeziehungen und Traummargen in Gefahr." Allerdings räumt die AOK ein, dass sie in zwei nordrhein-westfälischen Losgebieten wieder zum bisherigen Versorgungssystem zurückkehren musste. Dort hätten Apotheker ihre Verträge schon wieder gekündigt. Die Hintergründe würden derzeit aufgeklärt. Wenn die Krankenkasse im Rahmen der Ausschreibung prüft, ob ein Apotheker geeignet ist, verlässt sie sich erst einmal auf dessen Angaben. Die Kassen müssen sparen, Krebsmittel sind ein teurer Posten im deutschen Gesundheitswesen. Es wundert also nicht, dass sie die Onkologie ins Visier nehmen. Die Ausgaben für Chemotherapien beziffern Experten auf ungefähr drei Milliarden Euro pro Jahr. Die Frage ist bloß, ob die Behandlung todkranker Menschen das geeignete Experimentierfeld für neue Sparkonzepte ist. "Das Ausschreibungsverfahren bedeutet einen massiven Eingriff in Arbeitsabläufe mit gefährlichen Substanzen", sagt Onkologe Engel, in dessen Praxis in Hamburg-Altona pro Jahr mehr als 5000 Chemotherapien verabreicht werden. Die Präparate werden von einer spezialisierten Apotheke im selben Haus zubereitet, der Lieferweg ist nur eine Fahrstuhlfahrt. Trotz dieser fast familiären Versorgungskette sorgt ein penibles, mehrfach redundantes Dokumentations- und Kontrollsystem dafür, dass in den sterilen Behältnissen auch immer das richtige Medikament in der richtigen Menge zum richtigen Zeitpunkt beim richtigen Patienten landet. Ein Sicherheit gebendes System, das durchbrochen wird, wenn zukünftig die Kuriere von fünf oder sechs Apotheken mit jeweils eigenen Kennzeichnungs- und Verpackungssystemen in der Praxis aufschlagen. "Wenn ich einem Patienten eine glasklare Flüssigkeit verabreiche, habe ich keine Möglichkeit, den Inhalt zu überprüfen", sagt Engel. Nur Apotheker hätten zum Beispiel Zugriff auf internationale Datenbanken, mit denen Wechselwirkungen bestimmter Medikamente abgeklärt werden könnten. Durch die Ausschreibungen würden die eingespielten Arzt-Apotheker-Beziehungen nun zerbrochen und dadurch viele potenzielle Fehlerquellen geschaffen, fürchtet Engel. Schon eine falsche Dosierung eines Medikamentes könne zu massiven Blutbildveränderungen oder einer wirkungslosen Therapie führen: "Ich habe den Eindruck, die Kassen wissen gar nicht, was sie da tun." Das dachte offenbar auch ein schwerkranker Patient, der kürzlich nach einem unbestätigten Bericht in eine AOK-Geschäftsstelle gestürmt sein und einer Mitarbeiterin gedroht haben soll. Wenn er nicht wieder wie bisher mit seiner Chemo versorgt werde, dann werde er wiederkommen und alle erschießen, soll er gesagt haben. © WeltN24 GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten