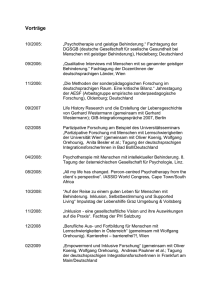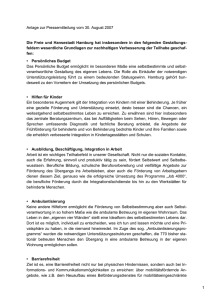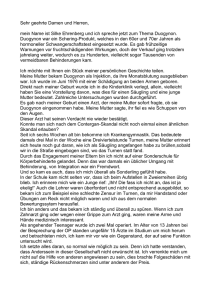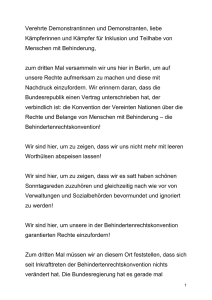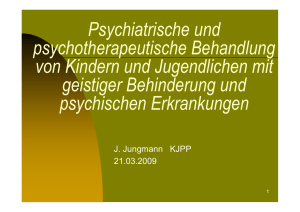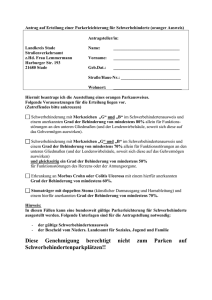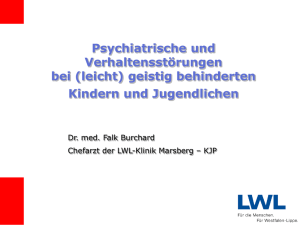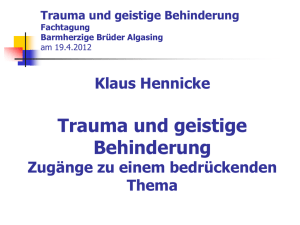archiv – LHÖ – medizin KRANKHEIT – ALTER
Werbung

ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 archiv – LHÖ – medizin KRANKHEIT – ALTER - MENSCHEN MIT INTELLEKTUELLER BEHINDERUNG Fachtagung "Gesundheit für's Leben", Potsdam 2009. Veranstaltung der Bundesvereinigung Lebenshilfe und der BAG Ärzte für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung Teil 3 THEMENHEFT 27 Inhalt: Fachartikel, Referate Seite 3 Zusammenstellung: Dr. Maria BRUCKMÜLLER Wien 2010 [email protected] 1 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 FACHBEITRÄGE: WARNKE, Prof. Andreas: Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung. Manuskript Tagung Potsdam 2009. Seite 3 HECKMANN, Beate, München: Demenzen Umsetzung einer spezifischen pädagogischen Betreuung bei Menschen mit geistiger Behinderung im Alter. Seite 15 VOSS Tatjana / ANYSAS Petra / BARRETT Brian : Somatisch krank in der Psychiatrie? Fehlplatzierung von Menschen mit geistiger Behinderung in der Psychiatrie auf Grund nicht diagnostizierter körperlicher Erkrankungen. Seite 20 SCHMIDT-OHLEMANN, Dr. med. Matthias: Mobile Rehabilitation für Menschen mit geistiger Behinderung - ein Modell für die Zukunft? Rehabilitationszentrum Bethesda. Workshop. Seite 24 2 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Andreas WARNKE Manuskript Tagung Potsdam 2009 PSYCHISCHE STÖRUNGEN BEI KINDERN UND JUGENDLICHEN MIT GEISTIGER BEHINDERUNG UND MEHRFACHBEHINDERUNG 1. Einleitung Geistige Behinderung ist keine psychische Krankheit. Jedoch haben Menschen mit geistiger Behinderung „das gleiche Recht“ psychisch zu erkranken, wie alle anderen Menschen ohne geistige Behinderung. Daraus leitet sich auch das „gleiche Recht“ ab zu einer qualifizierten Früherkennung, Diagnostik, Behandlung und Rehabilitation sowie sozialer Eingliederung, wenn Menschen mit geistiger Behinderung psychisch erkranken. Die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit seelischer Erkrankung hat noch nicht gleichwertige gesundheitspolitische Anerkennung im Vergleich zur Versorgung nicht-psychiatrisch Erkrankter. Dies gilt noch um so mehr für Menschen mit geistiger Behinderung. Nach Schuld zu suchen ist nicht sinnvoll. Sinnvoll ist es die besonderen Schwierigkeiten zu überwinden, die tatsächlich vorliegen, wenn es um die Erkennung, diagnostische Klassifikation und gesundheitliche Versorgung und Eingliederungshilfe bei Menschen geht, die aufgrund der Art und Schwere ihrer geistigen Behinderung und zusätzlich durch die Art und Schwere der seelischen Erkrankung sich selbst nicht hinreichend mitteilen können und in ihren bewältigungsrelevanten Handlungsspielräumen eingeschränkt und daher auf die Hilfe von Bezugspersonen und therapeutischen und pädagogischen Fachkräften angewiesen sind. So haben wir zunächst die Voraussetzungen für Diagnostik und Behandlung seelischer Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung ins Auge zu fassen. 2. Der Begriff der Entwicklungspsychiatrie Der Begriff der Entwicklungspsychiatrie setzt seelisches Erkranken in Beziehung zur Normalentwicklung des Menschen und den entwicklungs- bzw. alterskorrelierten körperlichen und geistigen Gegebenheiten in Wechselwirkung mit lebensgeschichtlichen Erfahrungen, aktuellen Lebenseinflüssen und gesellschaftlichen Verhältnissen, die wiederum selbst einer Entwicklung unterliegen. In Bezug zur geistigen Behinderung bedeutet dies, dass sich geistige Behinderung nicht nur aufgrund unterschiedlicher Art und Schwere jeweils ganz individuell beim einzelnen Menschen zu erkennen gibt. Sie wirkt sich auch in verschiedenen Kulturen unterschiedlich aus und dies auch in der Lebensentwicklung des Menschen von Säuglingsalter bis zum hohen Alter in sehr unterschiedlicher Weise. Die geistige Behinderung beim Säugling definiert sich z.B. noch nicht nach Normen des freien 3 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Laufens oder der schulischen Fertigkeiten eines Schulkindes, da diese Fertigkeiten reifungsbedingt noch nicht Entwicklungsaufgabe sind, so wie dies dann im Kindergarten- bzw. Schulalter der Fall sein wird. Daraus ergeben sich im Säuglingsalter andere diagnostische Kriterien und Verfahren als im Schulalter und natürlich auch andere therapeutische und rehabilitative Aufgabenstellungen. Die Aufgabenstellungen sind auch dann jeweils individuell besonders, wenn Komorbiditäten gegeben sind, etwa eine Mehrfachbehinderung vorliegt und z.B. geistige Behinderung mit Blindheit, Taubheit und Cerebralparese einhergeht. Das Prinzip der Entwicklungspsychiatrie betrifft auch das Verständnis seelischer Erkrankungen. Während im Säuglingsalter Regulationsstörungen, die Entwicklungsstörungen des Eßverhaltens, des Schlafens, des Schreiens und der mitmenschlichen Interaktion psychiatrische Aufgabenstellungen sein können, so treten etwa Lese-Rechtschreibstörungen und Rechenstörungen erst im Schulalter in Erscheinung, die Pubertätsmagersucht im späteren Kindesalter. Die schizophrenen Entwicklungen sind ebenfalls korreliert mit der Pubertätsentwicklung (weiterführend Herpertz-Dahlmann, Resch, Schulte-Markwort, Warnke, 2008, Warnke, Herpertz- Dahlmann, 2006). Definiert ist „Intelligenzminderung“ (geistige Behinderung) als „eine sich in der Entwicklung manifestierende, stehen gebliebene oder unvollständige Entwicklung der geistigen Fähigkeiten mit besonderer Beeinträchtigung von Fertigkeiten, die zum Intelligenzniveau beitragen, wie z.B. Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten (WHO, Dilling, Mombour, Schmidt, 2005). Mit der WHO-Klassifikation ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO 2001) warden dieser Definition die Begriffe der „Activity“ (anstatt „disability“), „Empowerment“ und „Teilhabe“ (anstelle von „Handicap“) zur Seite gegeben. Zur Voraussetzung aller therapeutischen Zuwendung zu Menschen mit geistiger Behinderung und seelischer Erkrankung gehört somit das diagnostische Erkennen und therapeutische Behandeln von Erkrankungen und Beeinträchtigungen einerseits und andererseits die Hinwendung zu den Fähigkeiten des Menschen mit geistiger Behinderung (Activity), die Bestärkung dieser Fähigkeiten (Empowerment) mit der Zielsetzung der Teilhabe (mit der Fähigkeit des Menschen zur Orientierung, schulischen und beruflichen Bildung, Freizeitgestaltung und dem Leben in sozialer Gemeinschaft). 3. Zur Ätiologie und Pathogenese: Bei Menschen mit geistiger Behinderung stellt sich die Frage der Erklärung von Störungen des Verhaltens in doppelter Weise. Zum einen sind die Ursachen der Intelligenzminderung und zum anderen Einflussfaktoren für das Entstehen der psychischen Erkrankung erklärungsrelevant. Eine Zusammenfassung organischer Ursachen ist aus Tabelle 1 zu ersehen. 4 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Pränatal begründete Intelligenzminderung, hereditär Dysplasien, Stoffwechselstörungen (z.B. Phenylketonurie, Mitrochondropathien, hormonelle Störungen, erbliche Hirn- und Schädelmissbildungen) Fehlbildungen des Nervensystems (dysraphische Fehlbildungen) Chromosomenanomalien Störungen der Körperchromosomen (z.B. Trisomie 21); Störungen der Geschlechtschromosomen; Marker-X-Syndrom, RettSyndrom Exogen verursachte biologische Schädigungen Pränatal (Virusinfektionen), chemisch-toxisch (Alkoholembryopathie); intrauterine Mangelernährung; Perinatal (Schädigung zwischen der 24. Gestationswoche und der 1. Woche nach der Geburt): Hirnblutungen, Enzephalitis; Postnatal: entzündliche Erkrankungen des ZNS, Schädelhirntrauma, Hirntumoren, Vergiftungen, hormonelle Störungen (Hypothyreose), zerebrales Anfallsleiden Ideopathische Intelligenzminderung (unbekannte Ätiologie) Normvariante der multifaktoriellen Intelligenzveranlagerung Tab. 1 Biologische Ursachen von Intelligenzminderung (nach Warnke 2006 a) Darüber hinaus gibt es auch psychosoziale Ursachen der Intelligenzminderung, insbesondere Schwere, chronisch-deprevierende Lebensverhältnisse. Die möglichen Einflussfaktoren für die Genese psychischer Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung sind Tabelle 2 zu entnehmen. Tabelle 2: Spezielle zusätzliche Risiken für die Entwicklung psychischer Störung bei Menschen mit geistiger Behinderung (vgl. Sarimski 2007; DEB et al. 2001; aus Hennicke et al 2008) Biologische Faktoren: • Genetisch bedingte erhöhte Vulnerabilität • Funktionsstörungen des Gehirns • Epilepsie • Erschwerte Interaktionen mit der Umwelt infolge von Störungen der Motorik, Sensorik und Sprache Psychologische Faktoren • Beeinträchtigte Intelligenz und aller damit zusammenhängender neuropsychologischer Funktionen (Adaptabilität) • Beeinträchtigte oder erlernte dysfunktionale Problemlösungsstrategien • Unreife Abwehrmechanismen in Konflikten und unter Belastungen • Erlernte dysfunktionale oder ungewöhnliche Copingstrategien 5 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 • Entwicklungshemmende Bindungsstile, Kollusionen und Symbiosen mit Bezugspersonen • Schwierigkeit, eine Identität zu entwickeln • Schwierigkeiten, erfüllende Beziehungen einzugehen Soziale Faktoren • Über- oder unterforderndes Milieu; Mangel an geeigneter sozialer Herausforderung oder Unterstützung durch andere; Überbetonung von Förderprogrammen („Förderterror“) zu Lasten von individueller Stabilität und Identität; hohe Misserfolgs- und Katastrophenerwartung der Eltern und Erzieher („Self-fulfilling prophecy“) • Mangel angemessener kommunikativer Strategien und spezifischer Kenntnis über individuelle kommunikative Besonderheiten im Umfeld • Modellernen in Gruppen mit nur behinderten KameradInnen • Primäre und sekundär-reaktive psychosoziale Probleme der Bezugspersonen; dysfunktionale Familienstrukturen • Fehlende Integration in die Gesellschaft, Stigmatisierung und Diskriminierung oder „Pseudointegration“ unter Leugnung spezifischer Assistenznotwendigkeit • Seelische, körperliche und/oder sexuelle Misshandlung • Soziale und psychische Isolation • Verlust allgemeingültiger Werte und Normen infolge von Diskriminierung oder Gratifikation von „Behinderung“ • Probleme, eine Arbeit oder Beschäftigung zu finden Zu beachten sind also Hirnschädigungen, die selbst für die Intelligenzminderung verantwortlich sind, Anpassungsstörungen als Folge von Alltagsüberforderung, Besonderheiten in der Informationsverarbeitung (Schwierigkeiten in der sprachlichen Kommunikation, der Interessensbildung, der Gedächtnisfähigkeiten), Missverständnisse in sozialen Situationen (Aufgrund mangelnder Mitteilungsfähigkeit kann es zu wechselseitigen Fehlbeurteilungen zwischen dem Menschen mit Intelligenzminderung und seinen Bezugspersonen kommen.) und schließlich ungünstige erzieherische Interaktionen. Ein Bedingungsmodell zum Verständnis psychopathologischer Entwicklungen bei Kindern mit Intelligenzminderung ist Abb. 1 zu entnehmen. 6 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Einseitige Lenkung in der Interaktion Sozial-kognitive Defizite im Verstehen sozialer und emotionaler Zusammenhänge und Wissen um Handlungsalternativen Probleme der emotionalen Selbstregulation Familiäre Bewältigungskräfte, Erziehungssicherheit Syndromspezifische Dispositionen Individuell Unterschiedliches Gelingen von sozialen Abstimmungsprozessen Weniger FreundschaftsBeziehungen und soziale Anerkennung Hyperaktivität/Aufmerksamkeitsstörung Oppositionelle Verhaltensstörung Emotionale Störung Soziale Probleme mit Gleichaltrigen Autistische Verhaltensmerkmale Abb. 1 Bedingungsmodell zum Verständnis psychopathologischer Entwicklungen bei Kindern mit Intelligenzminderung (Sarimski 2005) 4. Epidemiologie Angaben zur Epidemiologie psychischer Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung sind mit einer Unschäre behaftet. Übereinstimmung besteht darin, dass Menschen mit geistiger Behinderung an dem gleichen Spektrum psychischer Störungen erkranken können, wie dies auch bei Menschen ohne geistige Behinderung sein kann. Die Wahrscheinlichkeit jedoch, dass sich bei Menschen mit geistiger Behinderung psychische Störungen ausbilden, ist 3-4fach gegenüber der Gesamtpopulation erhöht. Damit ist davon auszugehen, dass in der Bundesrepublik insgesamt etwa 150.000 psychisch erkrankte Menschen mit geistiger Behinderung, die ei7 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 ner psychiatrischen Behandlung bedürfen, leben. Bei schwerer geistiger Behinderung sind psychische Störungen häufiger (etwa 43%) als bei leichter geistiger Behinderung (etwa 33%) festzustellen. Es gibt keine für die geistige Behinderung spezifische psychische Störung. Folgende psychischen Störungen sind bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung besonders häufig: - Hyperaktivität - Autistische Störungen - Stereotypien, Autoaggression - Störungen im Sozialverhalten (z.B. Aggressionen) - Emotionale Störungen (Angsterkrankungen, Depressionen) 5. Diagnostik: Die Diagnostik psychischer Störungen sowie der Intelligenzentwicklung erfolgt im Rahmen der Kinder- und Jugendpsychiatrie nach Maßgabe der multiaxialen Diagnostik mit den Definitionskriterien der Weltgesundheitsorganisation ICD-10 (Remschmidt, Schmidt, Poustka, 2006). Achse I: Klinisch-psychiatrisches Syndrom Die Diagnostik beinhaltet die Feststellung der psychischen Gesundheit (z.B. Autistische Störung, Hyperkinetisches Syndrom, Depression, Psychose?) Achse II: Umschriebene Entwicklungsstörungen Ist die Intelligenzminderung verbunden mit besonders schwergradigen, nicht wesentlich durch die Intelligenzminderung erklärten Beeinträchtigungen in den Bereich der Sprache, Motorik und der schulischen Fertigkeiten des Lesens, Rechtschreibens und Rechnens? Die Diagnose einer umschriebenen Entwicklungsstörung setzt definitorisch allerdings einen Intelligenzquotienten > 70 voraus. Dennoch kann ein völliges Ausbleiben der Sprachentwicklung bei einem Kind mit Intelligenzquotienten 70 die Diagnose einer umschriebenen Entwicklungsstörung der Sprache (rezeptiv und expressiv) durchaus rechtfertigen. Achse III: Intelligenzniveau Hierbei kommt es auf die Bestimmung des Schweregrades der Intelligenzminderung an. Dabei ist nicht der IQ-Wert alleine ausschlaggebend, sondern das Gesamt der Entwicklungsbeeinträchtigung und Entwicklungsressourcen (weiterführend Warnke, 2008). Achse IV: Körperliche Symptomatik Die Diagnostik ist auf die körperliche und neurologische Konstitution gerichtet. Liegen etwa Fehlbildungssyndrome, eine Epilepsie, Cerebralparesen oder eine Stoffwechselstörung vor? Achse V: Aktuelle abnorme psychosoziale Umstände Die anamnestischen und exploratorischen Fragestellungen sind auf die familiäre und außerfamiliäre Lebenssituation, die Ressourcen und Belastungen des Kindes und seiner Familie im Alltag gerichtet. Gefragt wird da8 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 nach, ob das Kind schulisch, im Freizeitbereich oder auch familiär ungünstigen sozialen Belastungen ausgesetzt ist, ob das Kind familiär oder außerfamiliär lebt, bei den Eltern selbst eine Behinderung oder seelische Erkrankung vorliegt. Achse VI: Globalbeurteilung der psychosozialen Anpassung Diese Beurteilung ist für die Frage relevant, ob im Einzelfall die Kriterien von Erkrankung und/oder von (drohender) seelischer oder anderer Art der Behinderung vorliegen. Sinn und Ziel multiaxialer Diagnostik ist es, die gesamte Persönlichkeit mit ihrer Lebensgeschichte, das aktuelle Lebensumfeld, die Beeinträchtigungen und Ressourcen in einer Weise sehen und verstehen zu lernen, sodass sich aus der diagnostischen Beurteilung und Verhaltensanalyse brauchbare Schlussfolgerungen für Behandlungsmaßnahmen ergeben. Die besten Informationsquellen sind die Verhaltensbeobachtung, Angaben der Bezugspersonen und apparative sowie psychometrische Untersuchungsverfahren (weiterführend Warnke, 2008, Neuhäuser, Steinhausen, 2003). Voraussetzung einer therapeutischen Intervention ist die Verhaltensanalyse (Abb. 2). Bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung bestehen folgende Erschwernisse bzw. Besonderheiten der Diagnostik, die auch von wesentlicher therapeutischer Relevanz sind. - Verständigungsmöglichkeiten des Kindes: Kann das Kind sich sprachlich mitteilen, seine Beschwerden, seine Bedürfnisse und Ziele aussprechen oder kommunikativ zu erkennen geben, hat es die sprachlichen oder andere kommunikative Fähigkeiten, um eine sprachlich orientierte Förderung und Therapie nutzen zu können? - Emotionale Mitteilungsfähigkeit: Sind wir in der Lage, das Kind in seinen Möglichkeiten, Gefühle auszudrücken, sei es sprachlich, mimisch oder gestisch, zu verstehen? - Motorische Mobilität: Welche therapeutischen Spielräume sind möglich, wenn das Kind aufgrund einer Mehrfachbehinderung bettlägerig und immobil ist? - Grad der Intelligenzminderung: Wie weit ist das Kind in der Lage, Verhaltensregeln und andere Lerninhalte zu memorieren, funktionelle Zusammenhänge zu begreifen und soziale Situationen zu erfassen? 9 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 1. Identifizierung des zu modifizierenden Problemverhaltens (R) (Ziel: Erhöhung oder Verringerung seiner Auftrittswahrscheinlichkeit) 2. Identifizierung der beim Auftreten (oder Ausbleiben) diese V erhaltens regelmäßig vorausgehenden und nachfolgenden Stimuli (S) 3. Lerntheoretische Interpretation: Überprüfung der für diese Interpretation erforderlichen Merkmale von R, von S und der S-R-S-Relationen: Tritt dieses Verhalten grundsätzlich bei allen Menschen in Form eines Reflexes auf – allerdings ausgelöst durch andere vorausgehende Stimuli? Ja Nein Tritt dieses Verhalten bei diesem Patienten immer nach Auftreten eines vorausgehenden Stimuli auf? Ja Nein Wird das Verhalten positiv oder negativ verstärkt (siehe unten)? Nein Ist der auf das Verhalten folgende Stimulus S ein positiver Verstärker (C +)? Ja Nein Reduziert sich nach Auftreten des Verhaltens ein bereits zuvor bestehender aversiver Zustand bzw. bleibt ein sich ankündigender aversiver Zustand aus? Ja Respondentes Verhalten (S – Rr) Operantes Annäherungs- Operantes Fluchtverhalten (Ro-C+) bzw. Vermeidungsverhalten (Ro-C+) Abb. 2 Schritte der Verhaltensanalyse (Schulte 2005) 10 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 6. Therapeutische Ansätze: Die Hilfestellung für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung und psychischer Störung hat in der Regel 3 Zielsetzungen zu beachten: - die Entwicklungsförderung, die sich aus der Intelligenzminderung ergibt - die Förderung der sozialen Integration - die Therapie der psychischen Störungen Die folgende Skizzierung der therapeutischen Ansatzpunkte beschränkt sich auf die Therapie psychischer Störungen. Zur Entwicklungsförderung siehe Neuhäuser, Steinhausen, 2003, Straßburg et al 2008. Prinzip des therapeutischen Vorgehens sind Behandlungsprogramme, die verschiedene therapeutische Interventionen in einem Förderplan integrieren. Psychotherapeutische Maßnahmen, psychopharmakologische Behandlung und verhaltensmedizinische Maßnahmen sind zusammenzuführen (weiterführend Warnke, 2008). Bei der Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung sind folgende Gesichtspunkte besonders zu beachten: - die Techniken sind eher körper- und handlungsorientiert (z.B. Rollenspiel, Beachtung körperlicher Hinweise, wie etwa Atmungsbeschleunigung, Schwitzen als Ausdruck von Ängsten). - Aktiv anleitende therapeutische Techniken mit sorgfältiger Strukturierung der Lernsituationen (z.B. sofortige Belohnung erwünschten Verhaltens) werden bevorzugt - Therapeutische Sitzungen sind relativ kurz und dafür häufiger - Die Gruppentherapie ist in besonderer Weise stark strukturiert - In die Therapie sind regelhaft Bezugspersonen einbezogen - Die Verhaltensweisen werden, wo immer möglich, im alltäglichen Lebensfeld des Kindes eingeübt - Zusammenarbeit mit der Familie ist die Grundlage jeglicher therapeutischer Zuwendung, dies um so mehr, je jünger das Kind ist. Die Psychoedukation beinhaltet die Klärung der Diagnose, der Bedürfnisse und Ziele der Familie, eine Verständigung über die inner- und außerfamiliären Möglichkeiten spezifischer pädagogischer Förderung und Therapie sowie der Entlastungsmöglichkeiten für die Familie. Dazu gehören auch die Vermittlung sozialer Netzwerke, die Hinführung zu Selbsthilfeorganisationen und die sozialrechtliche Beratung. Die Psychopharmakotherapie psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung hat zunächst einige Besonderheiten zu beachten. Dies um so mehr, da Personen mit geistiger Behinderung sehr häufig psychopharmakologisch behandelt werden (12-40%). Folgende Besonderheiten sind gegeben: - Aufgrund der Schwierigkeiten des Kindes mit geistiger Behinderung, seine seelischen Beschwerden selbst eindeutig mitzuteilen, ist oft nur eine Verdachtsdiagnose möglich. 11 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 - Wenn das Kind mit geistiger Behinderung sich nicht mitteilen kann, lassen sich Wirkung und unerwünschte Wirkung einer Medikation nur durch verlässliche Beobachtung von Bezugspersonen ermitteln. - Die Ursachen der geistigen Behinderung und psychischen Störung sind oft nicht zu sichern, sodass eine kausale medikamentöse Behandlung nur selten möglich ist. - Je schwergradiger die Intelligenzminderung und je weniger Krankheitseinsicht bei psychischer Erkrankung möglich sind und je ausgeprägter Komorbiditäten vorliegen umso schwieriger ist es die Wirkung einer Medikation zu bestimmen. Da dann oft eine Mehrfachmedikation stattfindet, stellen die Wechselwirkungen besondere Anforderungen an die diagnostisch-therapeutische Begleitung - Aufgrund der Besonderheiten der Hirnentwicklung können medikamentöse Wirkungen von der Regel abweichen und auch paradox sein. - Die Verlässlichkeit der Medikamenteneinnahme (Compliance) ist erschwert. Die Medikation setzt in der Regel die Medikamentengabe durch Bezugspersonen voraus. - Eine heilende medikamentöse Therapie der Intelligenzminderung an sich gibt es nicht. Doch lassen sich bei manchen Erkrankungen durch pharmakologische und diätetische Prävention Intelligenzminderungen verhindern (z.B. Diät bei Phenylketonurie, Medikation bei Epilepsie). (Weiterführend Gerlach et al., 2009, Fegert, 2005, Frank, 2006, Häßler, Fegert, 2005, Hennicke, 2008, a, b,. Neuhäuser, Steinhausen, 2003, Sarimski 2003,2005,2007; Sarimski, Steinhausen, 2007, 2008, a, b, Warnke, 2006 a, b, 2008, 2009). 7. Ausblick: Die Forschung zu den psychischen Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer psychotherapeutischen und medikamentösen Behandlung ist nicht hinreichend und benötigt insbesondere auch erhöhter Drittmittelförderung. Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der Ursachen der Intelligenzminderung und der Entstehung seelischer Störungen im Zusammenhang mit geistiger Behinderung. Dabei fehlt es an Verlaufsstudien. Erheblich sind auch die Mängel in Lehre und Forschung zur Psychotherapie und Psychopharmakotherapie psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung. In der klinischen Versorgung gilt es teilstationäre und insbesondere auch stationäre Möglichkeiten der Behandlung von Kindern und Jugendlichen von Schwer- und Mehrfachbehinderung und psychischer Erkrankung auszubauen. Schließlich ist auch die Vernetzung der differenzierten pädagogischen Einrichtungen in der Behindertenhilfe mit den differenzierten medizinischen und besonders auch kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen zu verbessern. 12 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Literatur: Dilling, H. Mombour, W. Schmidt M.H. (Hrsg.) (2005): Internationale Klassifikation psychischer Störungen – ICD-10 Kapitel V (F) Klinisch-diagnostische Leitlinien. 4.Auflage Huber, Bern. Fegert, J.M. (2005): Ethik, Patientenrechte von Menschen mit geistiger Behinderung unter besonderer Berücksichtigung der Gewalt und sexuellen Gewalt gegen Menschen mit geistiger Behinderung in institutionellen Abhängigkeitsverhältnissen – mit Verweis auf rechtliche Grundlagen. In: Häßler, F., Fegert J.M. (Hrsg.): Geistige Behinderung und seelische Gesundheit. Kompendium für Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter und Pflegekräfte. Stuttgart: Schattauer, 49-79. Frank, R. (Hrsg.) (2006): Geistige Behinderung. Freiburg i.B.: Lambertus. Gerlach, M., Warnke, A., Wewetzer, Ch., Mehler-Wex, C., Walitza, S. (Hrsg.) (2009):Neuro-Psychopharmaka im Kindes- und Jugendalter. Wien:Springer, 2. Auflage. Häßler, F., Fegert, J.M. (Hrsg.) (2005): Geistige Behinderung und seelische Gesundheit. Kompendium für Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter und Pflegekräfte. Stuttgart: Schattauer, Hennicke, K. (2005): Psychiatrische Diagnostik bei Menschen mit geistiger Behinderung. In: Stahl, B. und Irblich, D. (Hrsg.): Diagnostik mit geistiger Behinderung – Ein Interdisziplinäres Handbuch. Göttingen: Hogrefe, 349-366 Hennicke, K. (2008 a): Psychopharmaka in Wohnstätten der Behindertenhilfe – Vermutungen über eine zunehmende unerträgliche Situation. In: Hennicke, K. (Hrsg.) Psychopharmaka in der Behindertenhilfe – Fluch oder Segen? Materialen der DGSGB, Band 17, Berlin: Eigenverlag. 4-22 Hennicke, K. (2008 b): Zur Versorgung von Menschen mit Intelligenzminderung und psychischen Störungen in den Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie in Deutschland – Ergebnisse einer Fragebogenuntersuchung. Z. Kinder- und Jugendpsychiatrie. Psychother. 36, 127-134 Hennicke, K., Buscher, M., Häßler, F., Roosen-Runge, G. (2008): Psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen mit Intelligenzminderung und schwerer Lernbehinderung – Empfehlung zur Diagnostik und Therapie. Entwurf 1.6 (Endgültiger Entwurf). München: Sprintout Digitaldruck. Herpertz-Dahlmann, B., Warnke A. (2006): Psychosomatisches Kompendium der Pädiatrie – Leitfaden für den Kinder- und Jugendarzt. München: Hans Marseille. Herpertz-Dahlmann, B., Resch, F., Schulte-Markwort M., Warnke A., (Hrsg.) (2008): Entwicklungspsychiatrie – Biopsychologische Grundlagen und die Entwicklung psychischer Störungen. 2. Auflage. Stuttgart: Schattauer. ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health (WHO 2001) (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkei, Behinderung und Gesundheit. Hrsg. DIMDI). www.dimdi.de (2005) Remschmidt, H., Schmidt, M.H. Poustka, F. (Hrsg.) (2006): Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-10 der WHO. 5. vollständige überarbeitete und erweiterte Auflage. Bern: Hans Huber Sarimski, K. (2003): Psychologische Diagnostik. In: Neuhäuser, G., Steinhausen H.C., (Hrsg). Geistige Behinderung. 3. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer, 55-70. 13 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Sarimski, K. (2005): Psychische Störungen bei behinderten Kindern und Jugendlichen. Göttingen: Hogrefe, Sarimski, K. (2007): Psychische Störungen bei behinderten Kindern und Jugendlichen – Übersicht und Schlussfolgerung für die Psychodiagnostik. Z. Kinder- und Jugendpsychiatrie Psychother. 35, 19-31 Sarimski, K., Steinhausen, H.-C. (2007): KIDS-2 – Kinder-Diagnostik-System – Geistige Behinderung und schwere Entwicklungsstörungen. Göttingen: Hogrefe, Sarimski, K., Steinhausen, H.-C. (2008 a): Psychische Störung und geistige Behinderung. Leitfaden Kinder- und Jugendpsychiatrie. Bd. 11. Göttingen: Hogrefe, Sarimski, K., Steinhausen, H.-C. (2008 b): Ratgeber Psychische Störung und geistige Behinderung. Informationen für Eltern, Lehrer und Erzieher. Leitfaden Kinder- und Jugendpsychiatrie. Bd. 11. Göttingen: Hogrefe, Schanze, Ch. (2007): Psychiatrische Diagnostik und Therapie bei Menschen mit Intelligenzminderung. Ein Arbeits- und Praxisbuch für Ärzte, Psychologen, Heilerziehungspfleger und –pädagogen. Stuttgart: Schattauer, Schulte D. Verhaltensanalyse und Indikationsstellung (2005). In: Petermann, F., Reinecker, H., (Hrsg.). Handbuch der Klinischen Psychologie und Psychotherapie. Göttingen: Hogrefe. 147-157 Straßburg, H.-M., Dacheneder W., Kreß, W. (Hrsg.) (2008): Entwicklungsstörungen bei Kindern – Praxisleitfaden für die interdisziplinäre Betreuung. 4. Auflage. München: Urban & Fischer Warnke, A., Herpertz-Dahlmann, B., (2006): Was ist Psychosomatik – Begriffserklärung für die Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. In: Herpertz-Dahlmann, B., Warnke A. (Hrsg.). Psychosomatisches Kompendium der Pädiatrie – Leitfaden für den Kinder- und Jugendarzt, München: Hans Mareille. 9-36 Warnke, A. (2006 a): Intelligenzminderung und psychische Störungen. In: HerpertzDahlmann, B., Warnke A. (Hrsg.) Psychosomatisches Kompendium der Pädiatrie – Leitfaden für den Kinder- und Jugendarzt. München: Hans Marseille. Warnke, A. (2006 b): Lernbehinderung und geistige Behinderung. In: Mattejat F. (Hrsg.), Verhaltenstherapie mit Kindern, Jugendlichen und Familien. Stuttgart: CIPMedien, 461- 473 Warnke, A. (2008): Intelligenzminderung. In: Herpertz-Dahlmann, B., Resch, F., Schulte- Markwort M., Warnke, A., (Hrsg.). Entwicklungspsychiatrie. Biopsychologische Grundlagen und die Entwicklung psychischer Störungen. 2. Auflage. Stuttgart: Schattauer 487525 Warnke, A. (2009),: Anmerkungen zur Pharmakotherapie psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung. In: Gerlach, M., Warnke, A., Wewetzer, Ch., Mehler-Wex, C., Walitza, S. (Hrsg.): Neuro-Psychopharmaka im Kindesund Jugendalter, 2. Auflage. Wien: Springer-Verlag. 14 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Beate HECKMANN München DEMENZEN UMSETZUNG EINER SPEZIFISCHEN PÄDAGOGISCHEN BETREUUNG BEI MENSCHEN MIT GEISTIGER BEHINDERUNG IM ALTER Konzentration auf zwei Schwerpunkte •Noch in Werk- oder Förderstätte tätige Menschen mit Behinderung im Abbauprozess •Dementielle Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung in Wohnheimen Maßnahmen bei in Werk- oder Förderstätte tätigen Menschen mit Behinderung im Abbauprozess • Arbeitsanforderungen an Klientel anpassen • Kleine Gruppenstärke • Lärmintensives Arbeiten reduzieren oder vermeiden • Individuelle Pausenzeiten • Möglichkeit eines Ruheraums schaffen • KG/Ergo vor Ort als Förderung und Unterbrechung des Arbeitsalltags Maßnahmen bei in Werk- oder Förderstätte tätigen Menschen mit Behinderung im Abbauprozess • Gedächtnistraining • Toilettentraining • Sprachtraining • Feinmotorik • Förderung/Erhalt in Absprache und Zusammenarbeit mit der Wohneinrichtung Maßnahmen bei in Werk- oder Förderstätte tätigen Menschen mit Behinderung im Abbauprozess •Wünsche des Menschen mit Behinderung erfragen und mit einbeziehen • Pädagogische und medizinische Schulung des Personals vor Ort • Sozialdienst involvieren • Schulungen der Fahrdienste • Zusammenarbeit mit der Wohneinrichtung 15 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Individuelle Lösungen - Teilzeitmodelle • Veränderter Arbeitsbeginn, bzw. –ende (sinnvoll über ärztl. Abklärung der Leistungsfähigkeit bzw. Leistungskurve) • Halbtagsbeschäftigung (ebenso) • Einzelne Tage „Auszeit“(individuell mit der Werkstatt zu vereinbaren, mögliche Integration in bestehende Seniorengruppen, Vorbereitung auf Berentung, „Entspannen“des Abbauprozesses) • Menschen mit Behinderung involvieren, nach seinen Wünschen fragen (o.g. Möglichkeiten sind dem Menschen mit Behinderung oft nicht bewusst. Zusammenarbeit WfbM / Wohneinrichtung • Regelmäßige Reflexionen • Absprache bei pädagogischen Maßnahmen • Möglichst wenig Mitarbeiter- und Zuständigkeitswechsel • Körperlichen und geistigen Abbau genau dokumentieren • Überforderung und Überförderung vermeiden • Vermeidungsstrategien erkennen • Austausch der relevanten Dokumentation Förderung/Förderziele • Ziele dem Abbauprozess anpassen • Ziele mit dem Menschen mit Behinderung absprechen • Ziele klein fassen • Auf Erhalt von Fähigkeiten achten • Vermeidungsstrategien erkennen und dokumentieren • Förderzielbaum Aufgaben für Wohnheime • Enge Zusammenarbeit mit den WfbMs • Betreuungsformen verändern (TSM, TENE) • Ggf. Arbeitszeitmodelle der Mitarbeiter verändern • Flexibilität • Genau Dokumentation (ermöglicht ein frühes Reagieren) • Routineuntersuchungen einhalten • Bewohner mit einbeziehen (Wünsche, Ängste) Dementielle Erkrankung bei Menschen mit geistiger Behinderung in Wohneinrichtungen; Anforderungen an Wohneinrichtungen TSM / TENE bei Regens Wagner München • Freiwilligkeit • Erhalt und Stabilisierung der vorhandenen Handlungsfähigkeit • Konstruktive Gestaltung und Strukturierung des neuen Lebensabschnitts • Erhalt und Förderung der Kommunikations- und Kontaktfähigkeit • Erhalt und Förderung des Sozialverhaltens und der sozialen Kompetenzen • Entdecken neuer Fertigkeiten, Lust auf Neues wecken 16 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Verlauf einer dementiellen Erkrankung: Stadium 1 Leichter Verlust des Kurzzeitgedächtnisses, beginnende Sprachstörungen Stadium 2 Gravierender Verlust von Sprache und Auffassung, Desorientierung, Verwirrung, Unruhe, Reizbarkeit, Aggression, Störung der motorischen Funktionen, Epilepsie, psych. Veränderungen wie Depressionen, Psychosen, Halluzinationen Stadium 3 Zunehmende Bettlägerigkeit, Inkontinenz, wenig bis keine Eigenaktivitäten, Schluckproblematiken, zunehmendes Schlafbedürfnis Altern Ist ein hochinteressanter Vorgang: Man denkt und denkt und denkt – Plötzlich kann man sich an nichts mehr erinnern Ephraim Kishon Diagnostik • Minimental State • Screeningbogen Uni Erlangen - Bestandsaufnahme der individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten - gemeinsame Auswertung durch Betreuungsteam und Fachdienst - zeitlich engmaschige Abstände der Überprüfung durch möglichst gesamtes Betreuungsteam • Individuelle und genaue Dokumentation • Detaillierte ärztliche Diagnostik Ist es überhaupt möglich, Menschen mit geistiger Behinderung und Abbauprozessen, bzw. Demenzen, in bestehende Wohngruppen zu integrieren? Anforderungen an Wohneinrichtungen • Im Vordergrund sollte stets der Mensch mit geistiger Behinderung stehen • Eigenheiten des Menschen mit Behinderung akzeptieren und respektieren • Wünsche des Menschen mit Behinderung registrieren und beachten • Förderzielbaum • Kostenträgerproblematik Anforderungen an Wohneinrichtungen • Angehörigenarbeit • Biografiearbeit • Bezugspersonenmodelle • Individuelle Gestaltung des Wohnraums • Orientierungshilfen • Farbgestaltung 17 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 • Erhalt der Mobilität • Ärztliche Versorgung • Schwerpunkt der Förderziele auf Erhalt von Fähigkeiten legen • Veränderungen sorgfältig überdenken und an alle beteiligten Stellen weitergeben. Bei Einweisung in Krankenhäuser: • Begleitung und Übergabe • Notfallblatt • Datenschutz beachten (Unterschriften zu Heilbehandlungen dürfen nur gesetzliche Betreuer mit dem entsprechenden Aufgabengebiet leisten!) • Leistungen im KH durch eigenes Personal • PEG • Palliativstationen. Freiheitsentziehende Maßnahmen: • Gute Orientierungshilfen der LH München • Mitarbeiter regelmäßig schulen • Immer nur das anwenden, was unbedingt erforderlich ist • Zeitnah die Notwendigkeit der Maßnahmen überprüfen • Beratungsangebote durch LH München und FQA. Problembereiche vermeiden: • Spiegel • Glänzende Böden • Licht und Schattenbereiche • Höhe • Große Fenster • Mischbatterien • Rolltreppen • Offene Lifte • Wasser (Badewanne) • Stolperschwellen • Freiheitsentziehende Maßnahmen • Tiere. Anforderungen an Wohneinrichtungen: • Dokumentation • Reflexionen • Fallbesprechungen • Supervision bei Bedarf • Fachdienste • Mitarbeiter-Schulungen • Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern. 18 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Erforderlich ist eine grundsätzliche Überlegung in jedem Einzelfall, unter welchen Bedingungen ein Mensch mit geistiger Behinderung im Abbauprozess oder mit voranschreitender Demenz in der Wohneinrichtung bleiben kann. Diese Entscheidung muss gemeinsam im Betreuungsteam gewonnen werden, nur so ist sie tragfähig und umsetzbar. Menschen mit Behinderung wünschen sich meist, auch im Abbauprozess in der Wohneinrichtung bleiben zu können –dies ist ihr Zuhause. Der Bedarf auf Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und auf Integration endet nicht mit dem Eintritt ins Rentenalter. 19 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Tatjana VOSS Petra ANYSAS Brian BARRETT SOMATISCH KRANK IN DER PSYCHIATRIE? Fehlplatzierung von Menschen mit geistiger Behinderung in der Psychiatrie auf Grund nicht diagnostizierter körperlicher Erkrankungen Das „Berliner Behandlungszentrum für erwachsene, psychisch kranke Menschen mit geistiger Behinderung“ • Ist Bereich der Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am evangelischen Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge in Berlin Lichtenberg • Umfaßt zwei Stationen ( P7 und P8) mit 32 stationären Behandlungsplätzen und eine „Spezialambulanz“ mit 365 Scheinen im Quartal • Untersucht und behandelt knapp 400 Patienten/Jahr stationär, deren Verweildauer bei im Schnitt 30 Tagen liegt • Stellt mit einem multiprofessionellen Team aus 44 MitarbeiterInnen ein psychiatrisch-psychotherapeutisches und heiltherapeutisches Behandlungsangebot für das Land Berlin zur Verfügung. Frau H., 45 Jahre, leichtgradige Intelligenzminderung: Vorstellungsgrund: Psychomotorische Unruhe, Depressive Verstimmung, Angstzustände, v. a. optische Halluzinationen; Ungewohntes, nach vorne übergebeugtes Gangbild Psychopatholgisch: Szenische Halluzinationen (➙ Angst!), Stimmung gedrückt, Affekt ängstlich, Antriebsarm, psychomotorische Unruhe, Nesteln Internistisch: Mamma rechts: multiple cutane Einziehungen incl. Mammille, über ¾ der Brust TU tastbar ,Vd. a. axilläre LK-Vergrößerung re. Paraklinik: Sturzsenkung, ALAT/CRP erhöht Paraneoplastisches Delir bei ausgedehntem Mamma-Ca. (invasivlobulär) Verlauf: Verlegung in das Brustzentrum der Charité, dort Ablatio mammae und Axilladissektion bds. Prognose: infaust. 20 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Herr A., 37 Jahre, schwere geistige Behinderung: Vorstellungsgrund: unklare Schwellung der rechten Leiste sowie Gewichtsabnahme, seit ca. 2 Jahren eine deutliche Schwellung des re. Hodens, vom behandelnden Urologen als Hydrozele eingeordnet, seit 5 Monaten deutliche Appetitminderung mit Gewichtsabnahme. Ebenfalls sei der Antrieb massiv zurückgegangen. Körperlicher Befund: RF ca. 10 cm im Durchmesser re. Mittelbauch. Derbe Schwellung re. Leiste. Äußeres Genitale: deutlich derber Raumforderung rechter Hoden. CT Thorax und Abdomen in Narkose: Rechtsseitige Hodentumor mit massiver Lymphknotenmetastasierung intraabdominell sowie mediastinal und Nachweis multipler intrapulmonaler Metastasen. Thrombose untere Hohlvene Pfortaderthrombose, Embolien Lungenarterien bds. Therapie und Verlauf: Nach ausführlicher Abwägung wurde Behandlung nicht empfohlen: Prognose war bei metastasiertem Tumor eingeschränkt. Im Rahmen des Down-Syndroms erhöhte Vulnerabilität für Blutbildschädigung und Spätlymphome durch die Chemotherapie. Wir entließen Herrn A. in ambulante Betreuung. Tod 3 Monate später. Differentialdiagnostik von Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung: • Körperliche Erkrankungen rufen in einem hohen Ausmaß Psychische Symptome hervor. • Sie können bei Menschen mit Behinderung jedes Verhaltenssymptom bewirken! • Wegen eingeschränkter Verständigungsmöglichkeiten zwischen Arzt und geistig behinderten Patient werden körperliche Beschwerden als Teil der Behinderung missdeutet. • Die diagnostische Unsicherheit nimmt mit Schweregrad der geistigen Behinderung zu. • 85 % aller Überweisungen an ein Behandlungszentrum (Colorado) ≥ 1 somatisch-medizinisches Problem • 50 % davon ≥ 2 solcher Probleme (Ryan 2001) Häufige somatische Erkrankungen: Epilepsie (unterbehandelt oder nicht diagnostiziert) 45,8 % (unte Hyperthyreose 12,7 % Tourettesyndrom 11,5 % gastroösophagealer Reflux 9,7 % geschlossenes Schädelhirntrauma 8,8 % chronisches Schmerzsyndrom 8,7 %% 21 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Seltener: Diabetes mellitus, Chronische Otitis media, Zahnabszesse. (bei N = 1135 Patienten, Ryan und Sunada 1997) Somatische Entlassungsdiagnosen als Hauptdiagnose (Beobachtungszeitraum Januar bis Dezember 2004) • Teerstuhl bei chronisch-entzündlicher Darmerkrankung • Perikarderguss (Blässe, Hypotonie, Synkopen) • Überlaufdiarrhoe bei medikamentös induzierter Obstipation • Exokrine Pankreasinsuffizienz (Gewichtsabnahme) • Helicobacter-assoziierte Gastritis • Paget-von-Schrötter-Syndrom bei Koagulopathie • Tiefe Beinvenenthrombose • Untere gastrotintestinale Blutung • Schwer einstellbare Epilepsie bei Lennox-Gastaut-Syndrom • Schmerzen bei Fixateur externe nach Tibia- und Fibulafraktur • Hämangiom der Leber und Leberzysten (Gewichtsverlust) Herr T., 35 Jahre, mittelschwere geistige Behinderung: • seit einem halben Jahr mehrfach pro Tag Zerreißen der Kleidung bis zum völligen Verlust seiner gesamten Garderobe • traurige, aber erhaltene affektive Modulierbarkeit, Morgentief • Autoaggressionen (Kratzen der Hände bis zu blutigen Wunden) • häufiger Essen abgelehnt und beim Anblick von Essen angeekelt gewirkt • bereits im Kindesalter und in der Adoleszenz in stationärer psychiatrischer Behandlung wegen Zerreißen der Kleidung und Autoaggression, Diagnosen: • Erosive Gastritis mit Helicobacter-Besiedlung, Eradikationstherapie, Nexium • Mittelgradige depressive Episode. 1. Menschen mit Behinderung weisen ein signifikant Höheres Risiko für körperliche Erkrankungen auf: • in Verbindung mit der Behinderung, wie. z. B. Spastik, angeborene Herzfehler, Sehfehler, Epilepsie • auf Grund ihrer behinderungsspezifischen Lebenssituation, wie z. B. somatische Schäden von Langzeitmedikationen, Obstipation, Adipositas u.v.m. 2. Menschen mit Behinderung präsentieren körperliche Erkrankungen häufig atypisch mit Auto- und Fremdaggressionen: Rückzug, Schreien oder Schlafstörungen im Sinne von Verhaltensauffälligkeiten. 63% der im KEH in den vergangenen 5 Jahren aufgenommenen Patienten hatten mindestens ein somatisches Problem; 37% sogar 2 oder mehr. ( N=1565). 22 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 3. Verhaltensauffällige Menschen mit Behinderung Werden noch immer ohne ausreichende Diagnostik fälschlicherweise aus Hilflosigkeit zunächst medikamentös beruhigt, und dann, bei ausbleibendem Erfolg, in die Psychiatrie eingewiesen. Die medizinische Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung muss weiter verbessert werden. Dazu bedarf es: Einer finanziell angemessenen Vergütung; Spezieller Kenntnisse der betreuenden Ärzte und Teams; Einer behindertengerechten räumlichen und personellen Ausstattung; Medizinischer Grundkenntnisse im komplementären System. 23 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Dr. med. Matthias SCHMIDT-OHLEMANN Rehabilitationszentrum Bethesda Workshop MOBILE REHABILITATION FÜR MENSCHEN MIT GEISTIGER BEHINDERUNG EIN MODELL FÜR DIE ZUKUNFT? Gesundheitliche Situation von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung 1. Geistige Behinderung ist keine Krankheit 2. Häufig setzen Alterungs- oder Verschleißprozesse bei ihnen früher ein, insbesondere die Demenz 3. Menschen mit geistiger Behinderung haben ein höheres Krankheitsrisiko 4. Bei ihnen sind bestimmte seltene Erkrankungen und Syndrome deutlich häufiger und erfordern spezifische, manchmal hochspezialisierte medizinische Versorgung. 5. Sie zeigen ihre Krankheit oft auf ihre besondere Weise, oft gar nicht, so dass man die Gesundheitsstörung aufspüren muss. (Aufdeckende Gesundheitsfürsorge) 6. Oft fehlt ihnen eine für Fremde verständliche Sprache. Sie benötigen oft kompetente und erfahrene, vertraute Begleitung 7. Verhaltensauffälligkeiten oder Schwierigkeiten in der Anpassung an fremde Situationen oder Erfahrungen aus der Medizin (Spritze, Schmerzen, Anforderungen an Disziplin) machen besondere Vorgehensweisen seitens der Professionellen erforderlich. 8. Sie benötigen im Durchschnitt deutlich mehr Zeit als andere Patienten 9. Sie zeigen oft wenig Eigeninitiative, zum Arzt zu gehen oder gesund zu leben. Deshalb brauchen sie Begleitung und Unterstützung 10. Für die Klärung der Gesundheitsprobleme und ihre Lösung sind meist mehrere Personen/Team zu beteiligen 11. Nicht selten liegen mehrfache Behinderungen bis zur schwersten Mehrfachbehinderung vor, die die Behandlung schwierig und komplex machen und ein interdisziplinäres Team erfordern. 12. Auch bei Erwachsenen sind oft die Eltern oder Angehörige bzw. gesetzliche Betreuer höchst engagiert bzw. emotional beteiligt oder gelegentlich auch gleichgültig und sind einzubeziehen. 13. Sie benötigen einen barrierefreien Zugang zu den Einrichtungen des Gesundheitswesens. 24 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Krankheiten /Anlässe für Rehabedarf bei Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung: Operationen (bei Spastik, nach Unfall, Bereich Bewegungsorgane, Neurochirurgie Frakturen (Schenkelhalsfraktur, Wirbelfrakturen) Schlaganfall Entzündlich rheumatische Krankheiten Neurologische Krankheiten wie Parkinson, MS, Guilllain-Barre u.a. Lähmungen, z.B. Querschnitt, peripher, Amputationen Im Zusammenhang mit Botulinum-Behandlung / BaclofenPumpe o.ä. Plötzliche Funktionsverluste unklarer Art, z.B. durch Medikamentenumstellung, Stürze, Krisen à Beeinträchtigung von Funktionen wie: Gehen, Sitzen, ADL, Kommunikation, Kontaktaufnahme, manuelle Betätigung. Praxis der Rehabilitation bei Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung: Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung erhalten nur selten eine Maßnahme medizinischer Rehabilitation, insbesondere bei schwerer Mehrfachbehinderung. Es wird kein Antrag gestellt, der Antrag wird abgelehnt, es findet sich keine Einrichtung, Begleitpersonen können nicht organisiert / finanziert werden. Gründe dafür sind u. a. Die Rehanotwendigkeit wird nicht erkannt Die Rehanotwendigkeit wird wegen der Behinderung verneint („macht nichts“) Die Rehafähigkeit wird generell verneint Die Rehafähigkeit wird für eine bestimmte Einrichtung verneint Es werden keine realistischen Zehaziele formuliert Die Rehaprognose wird als ungünstig eingeschätzt Es gibt keine Einrichtung, die MmgB aufnimmt, allenfalls mit Bezugspers. Die Rehaprogramme sind nicht für MmgB geeignet Die fremde Umgebung und das Unverständnis sowie die Anforderungen lassen oft Verhaltensauffälligkeiten verstärkt auftreten. Unterversorgung von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung mit Rehabilitationsleistungen In Deutschland gibt es eine deutliche Unterversorgung mit Leistungen der medizinischen Rehabilitation für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung Dies konnte partiell durch die stationären Einrichtungen kompensiert werden, wird unter den Bedingungen der Dezentralisierung weniger möglich sein 25 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Der Bedarf an geriatrischer Rehabilitation steigt wegen der Alterung von MmgB Rehabedarf besteht in erheblichem Umfang bei Menschen mit erworbenen Behinderungen Es bestehen Hinweise, dass es auch für Menschen mit psychischen und Abhängigkeitserkrankungen eine rehabilitative Unterversorgung gibt, erst recht für Menschen mit geistiger Behinderung. Mobile Rehabilitation Die Versorgungslücke in der Rehabilitation bei Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung könnte durch Mobile Rehabilitation weitgehend geschlossen werden. Sie kann und sollte aber nicht allein für Menschen mit geistiger Behinderung organisiert werden. Besondere Bedeutung für MmgB hat in Zukunft die Geriatrie bzw. die geriatrische Rehabilitation in allen Organisationsformen einschl. der Mobilen geriatrischen Rehabilitation. Sichtweisen in der Medizin Kuration: Beseitigung von Krankheit (Beseitigung der Ursache – kausale Orientierung) Prävention: Verhinderung von Krankheit Palliation: Sterbehilfe und Hilfe bei schwerster Krankheit Rehabilitation: Besserung der funktionalen Gesundheit, d.h. der Behinderung und der Teilhabe. Früheres Verständnis von Behinderung: Sie ist gleichbedeutend mit: Krankheit Leiden Folge fehlgeschlagener Behandlung Strafe kurzes Leben Unwertes Leben Belastung ICF – neu denken: ICF = International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO 2001 deutsch: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, Klassifikation der funktionalen Gesundheit und ihrer Beeinträchtigungen. 26 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Sie gehört zu der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelten „Familie“ von Klassifikationen für die Anwendung auf verschiedene Aspekte der Gesundheit und ergänzt insbesondere die Klassifikation der Krankheiten (ICD). ICF: Die ICF beruht auf einem biopsychosozialen Modell, das Beeinträchtigungen auf den Ebenen Strukturen des Körpers, Funktionen des Körpers, Aktivitäten des Menschen, Teilhabe des Menschen am Leben der Gesellschaft auf der Basis der realen Lebensverhältnisse abbilden kann durch Berücksichtigung der Kontextfaktoren. Hauptkapitel der Klassifikation der Aktivitäten und Teilhabe: 1. Lernen und Wissensanwendung (z.B. Bewusste sinnliche Wahrnehmungen, Elementares Lernen, Wissensanwendung) 2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen (z.B. Aufgaben übernehmen, Die tägliche Routine durchführen, Mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen) 3. Kommunikation (z.B. Kommunizieren als Empfänger, Kommunizieren als Sender, Konversation und Gebrauch von Kommunikationsgeräten und -techniken) 4. Mobilität (z.B. Die Körperposition ändern und aufrecht erhalten, Gegenstände tragen, bewegen und handhaben, Gehen und sich fortbewegen, Sich mit Transportmitteln fortbewegen) 5. Selbstversorgung (z.B. sich waschen, pflegen, an- und auskleiden, die Toilette benutzen, essen, trinken, Auf seine Gesundheit achten) 6. Häusliches Leben (z.B. Beschaffung von Lebensnotwendigkeiten), Haushaltsaufgaben), Haushaltsgegenstände pflegen und anderen helfen) 7. Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen (z.B. Allgemeine interpersonelle Interaktionen, Besondere interpersonelle Beziehungen) 8. Bedeutende Lebensbereiche (z.B. Erziehung/Bildung, Arbeit und Beschäftigung, Wirtschaftliches Leben) 9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben (z.B. Gemeinschaftsleben, Erholung und Freizeit, Religion und Spiritualität). ICF: Gesundheit – Beispiel: Frau H. ist aufgrund bestimmter Funktionsstörungen und Strukturschäden des Bewegungsapparates (schwere Gonarthrose) im Gehen stark eingeschränkt (erhebliche Aktivitätseinschränkung des Gehens) und möchte selbst bei der Post ein Paket aufgeben (Wunsch nach Teilhabe am üblichen Alltagsleben), wozu sie physisch und psychisch in der Lage ist (keine Einschränkung der Aktivität „ein Paket bei der Post aufgeben können“). 27 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Sie verfügt über einen Rollstuhl (Rollstuhl als Kontextfaktor) und kann damit allein zur Post fahren (keine Aktivitätseinschränkung in der Mobilität mit Hilfsmittel, Kontextfaktor „Rollstuhl“ wirkt sich positiv aus= Förderfaktor). Dort angekommen trifft sie auf eine für sie unüberwindbare Treppe, die zur Schalterhalle führt (Treppe als Barriere). Ein Aufzug für Rollstuhlfahrer ist nicht vorhanden (Aufzug als Förderfaktor). Diese Gegebenheit ihrer Welt lässt nicht zu, dass sie selbst das Paket aufgibt. Wäre das Postamt barrierefrei, hätte sie keine Probleme mit der Aufgabe des Paketes. „Behindert ist man nicht. Behindert wird man.“ Kontextfaktoren der ICF: Philosophie Zur Anwendung des bio-psycho-sozialen Modells der ICF gehört das Denken in Variationen der Kontextfaktoren (was wäre, wenn ...), um mögliche Barrieren oder das Fehlen von Förderfaktoren zu identifizieren, so dass auf Änderungen hingewirkt werden kann. Mit der Methode der Variation der Kontextfaktoren bei fest vorgegebenem Gesundheitsproblem ist es in der Praxis leicht möglich, Barrieren und Förderfaktoren zu identifizieren. Auf dieser Grundlage kann rehabilitativ (oder auch politisch) gehandelt werden. Definition von Rehabilitation: Rehabilitation umfasst den koordinierten Einsatz medizinischer, sozialer, beruflicher, pädagogischer und technischer Maßnahmen sowie Einflussnahmen auf das physische und soziale Umfeld zur Funktionsverbesserung, zum Erreichen einer größtmöglichen Eigenaktivität und zur weitestgehend unabhängigen Partizipation in allen Lebensbereichen, damit der Betroffene in seiner Lebensgestaltung so frei wie möglich wird.“ (WHO, Definition der Rehabilitation: Technical Report 668/1981). UN-Konvention Artikel 26 Habilitation und Rehabilitation: (1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, einschließlich betreffend die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen, um Menschen mit Behinderungen in die Lage zu versetzen, ein Höchstmaß an Unabhängigkeit, umfassende körperliche, geistige, soziale und berufliche Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung in alle Aspekte des Lebens und die volle Teilhabe an allen Aspekten des Lebens zu erreichen und zu bewahren. Zu diesem Zweck organisieren, stärken und erweitern die Vertragsstaaten umfassende Habilitations- und Rehabilitationsdienste und -programme, insbesondere auf dem Gebiet der Gesundheit, der Beschäftigung, der Bildung und der Sozialdienste, und zwar so, dass diese Leistungen und Programme 28 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 a) im frühestmöglichen Stadium einsetzen und auf einer multidisziplinären Bewertung der individuellen Bedürfnisse und Stärken beruhen; b) die Einbeziehung in die Gemeinschaft und die Gesellschaft in allen ihren Aspekten sowie die Teilhabe daran unterstützen, freiwillig sind und Menschen mit Behinderungen so gemeindenah wie möglich zur Verfügung stehen, auch in ländlichen Gebieten. (2) Die Vertragsstaaten fördern die Entwicklung der Aus- und Fortbildung für Fachkräfte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Habilitations- und Rehabilitationsdiensten. (3) Die Vertragsstaaten fördern die Verfügbarkeit, die Kenntnis und die Verwendung unterstützender Geräte und Technologien, die für Menschen mit Behinderungen bestimmt sind, für die Zwecke der Habilitation und Rehabilitation. Rehabilitation für Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland?! Welcher Personenkreis? Welche Angebote? Stationäre Rehabilitation Stationäre Frührehabilitation Heilmittel Eingliederungshilfe Mobile Rehabilitation? Mobile Rehabilitation Modellprojekte an verschiedenen Standorten zwischen 1991 und 2005 Karlsruhe, Woltersdorf,Bad Kreuznach, Marburg, Bochum, Bremen, Magdeburg, St. Wendel, Gera Erprobung, Evaluation, Weiterentwicklung Regelfinanzierung einiger Standorte (Karlsruhe, Marburg, Bad Kreuznach) seit 1996 Rahmenkonzeption Mobile Rehabilitation 2001 und Beginn von Gesprächen mit Krankenkassen 2004 offizielle Gespräche mit den Spitzenverbänden Rahmenempfehlung Mobile geriatrische Rehabilitation 1.5.2007 Laufende Verhandlungen: Karlsruhe, Berlin, Chemnitz, Münster Mobile Rehabilitation: Definition: Mobile Rehabilitation ist ein neues Konzept der ambulanten wohnortnahen Rehabilitation, bei dem ambulante aufsuchende Rehabilitationsleistungen durch ein interdisziplinäres Team (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Rehabilitationspflege, Ernährungsbera29 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 tung, Neuropsychologie und Sozialberatung) unter ärztlicher Leitung in der Häuslichkeit des Rehabilitanden selbst erbracht werden. Dabei werden die wichtigen Kontextfaktoren, wie häusliche Umgebung, soziales Umfeld und Familie in die Rehabilitation unmittelbar einbezogen. Ressourcen können so erschlossen, Barrieren abgebaut werden. In der vertrauten Umgebung entfallen u. U. schwierige Gewöhnungs- und Transferprozesse. Mobile Rehabilitation schließt ein Case-Management der sozialen Problematik mit ein. Leistungsrechtliche Einordnung MoRe (Mobile Rehabilitation): In Deutschland wird MoRe als Leistung der medizinischen Rehabilitation organisiert und finanziert Gesetzliche Grundlage sind § 40 Abs. 1 SGB V und das SGB IX Kostenträger sind fast ausschließlich die Krankenkassen MoRe darf nur von speziell dafür zugelassenen Rehabilitationsdiensten erbracht werden Es gelten die allgemeinen Voraussetzungen für ambulante medizinische rehabilitation der BAR (mit MoRe-typischen Modifikationen) Rahmenempfehlungen der Krankenkassen sind dabei zu beachten Andere mobile Versorgungen können rehabilitative Ziele verfolgen, sind aber keine Mobile Rehabilitaion. Gründe für MoRe: Epidemiologische Gründe: Demographische Entwicklung (Altersstruktur) Krankheitsspektrum Pflegebedürftige Menschen Behinderte Menschen Versorgungspolitische Gründe: Unversorgte Gruppen Unzureichende Leistungsfähigkeit vorhandener Rehaangebote Stärkung ressourcenorientierter Ansätze Zusätzliche Alternativen Fachliche Gründe: Besonderer Bedarf einiger Personengruppen Methodisch-didaktisch neue Herangehensweise Beratung, Unterstützungs- und Case-Management ideal mit Reha kombinierbar Politische Gründe: Zeichen setzen Besondere Aktivitäten für Menschen im Alter. 30 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Ansatz der MoRe: Sie erfolgt in der Regel in aufsuchender Form in der eigenen Häuslichkeit des Patienten, sie kann bei Bedarf aber auch ambulant erbracht werden; sie nutzt und fördert die personellen und sachlichen Ressourcen des Patienten und seines Wohnumfeldes. Dabei bezieht sie das Wohnumfeld und das soziale Umfeld in die Rehabilitation mit ein und beseitigt ggf. Barrieren durch Anpassung der Wohnung und Optimierung der Hilfsmittel unter realen Bedingungen. Gleichzeitig verwendet sie speziell auf die Rehabilitation in häuslicher Umgebung angepasste Übungsmethoden. Sie arbeitet unter starkem Alltagsbezug mit direkter Einbindung des sozialen Netzwerkes. Sie schließt dabei ein Case- Management der gesundheitsbezogenen sozialen Problematik des Einzelfalles mit ein; sie geht weit über die Leistungen der kurativen Heilmittel hinaus und ist mit der vertragsärztlichen Versorgung nicht vergleichbar; sie versorgt eine definierte Versorgungsregion (max. 30 Min. Fahrzeit). Einige Kennzeichen Mobiler Rehabilitation: Multidisziplinäres Team mit interdisziplinärer und transdisziplinärer Arbeitsweise Komplexes Rehakonzept und umfassender Rehaplan Ärztliche Leitung Definierte Region und regionale Einbettung Methodisch-didaktisch erhebliche Unterschiede in den Vorgehensweisen gegenüber der stationären oder ambulanten Rehabilitation, da die Behandlung in der Häuslichkeit unter direktem Einbezug der Alltagsgestaltung und des primären soziale Netzes geschieht. Keine Reha-Light! Effekte plausibel gut und nachhaltig Organisierbar Wirtschaftlich interessant. MoRe und ICF: Wesentliches Ziel ist die Förderung der Teilhabe einschl. der Aktivitäten Grundlage für die Arbeit der MoRe ist die ICF MoRe zielt auf die Beeinflussung der Schädigungen von Strukturen oder Funktionen der Aktivitäten Der Teilhabe 31 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 der Kontextfaktoren im Sinne von Beseitigung von Barrieren und Förderung von Förderfaktoren. Die Möglichkeit der unmittelbaren Beeinflussung der Kontextfaktoren und in der Lebenswelt selbst, an der die Teilhabe sich vollzieht, stellt das entscheidende Merkmal der Mobilen Rehabilitation gegenüber allen anderen Rehaformen dar. Gesetzl. Grundlage im SGB V: § 40 Abs. 1 SGB V n.F.: „Reicht bei Versicherten eine ambulante Krankenbehandlung nicht aus, … ..erbringt die Krankenkasse aus medizinischen Gründen erforderliche ambulante Rehabilitationsleistungen in Rehabilitationseinrichtungen, für die ein Versorgungsvertrag nach § 111 besteht, oder, soweit dies für eine bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten mit medizinischen Leistungen ambulanter Rehabilitation erforderlich ist, durch (früher in) wohnortnahe Einrichtungen . Leistungen nach Satz 1 sind auch in stationären Pflegeeinrichtungen nach § 72 Abs. 1 des 11. Buches zu erbringen.“ MoRe - Auszug Gesetzesbegründung: zu § 40 Abs. 1 SGB V Die Änderung stellt sicher, dass Leistungen der medizinischen Rehabilitation nicht nur in wohnortnahen Einrichtungen, sondern auch als mobile Rehabilitationsleistungen erbracht werden können. Die mobile Rehabilitation ist ein aufsuchendes medizinisches Rehabilitationsangebot und damit eine Sonderform der ambulanten Rehabilitation. Ein interdisziplinäres Team erbringt Maßnahmen zur Rehabilitation in der Wohnung der Patienten. Zielgruppe sind multimorbide Patienten mit erheblichen funktionellen Beeinträchtigungen und einem komplexen Hilfebedarf. Das aufsuchende Rehabilitationsangebot bezieht damit einen Patientenkreis ein, der bislang keine Rehabilitationschancen hat; zugleich werden der Grundsatz des Vorrangs der Rehabilitation vor und in der Pflege und die Zielsetzung "ambulant vor stationär“ fachgerecht umgesetzt. MoRe - Auszug Gesetzesbegründung: zu § 40 Abs. 1 SGB V Mit Förderung durch das Bundesministerium für Gesundheit sind im Bereich der medizinischen Rehabilitation mehrere aufsuchende (mobile) Angebote entwickelt worden. Die Implementierung des Leistungsangebots der mobilen Rehabilitation ist jedoch aufgrund unterschiedlicher Auslegungen des § 40 Abs. 1 durch Landesverbände der GKV auf Schwierigkeiten gestoßen. 32 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Die jetzige Fassung des § 40 Abs. 1 ist nicht ausreichend auf die ambulante mobile Rehabilitation zugeschnitten, ohne diese aber ausdrücklich auszunehmen. Die Neuregelung stellt klar, dass auch diese Form der ambulanten Rehabilitation regelhaft erbracht werden kann. Warum Mobile Rehabilitation? Mobile Rehabilitation ist ein neues notwendiges Angebot auf gesetzlich eindeutiger Grundlage! Es ist notwendig für pflegebedürftige, immobile in der Regel schwer betroffene, d.h. in den Aktivitäten und der Teilhabe gravierend eingeschränkt Menschen, v.a. mit zusätzlichen kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen Sie ist ressourcenorientiert und unmittelbar lebensweltbezogen. Sie ist gerade in ethischem Horizont unverzichtbar als Chance der Befähigung, auch bei schwerer Behinderung sein eigenes Leben zu führen. Praxis der MoRe: Team: Physiotherapie Ergotherapie Logopädie Rehapflege Sozialarbeit Arzt (Teamleitung) Behandlung erfolgt zu Hause oder im Heim (auch Pflegeheim, ggf. auch WfbM Täglich 1-3 Behandlungen Zeitlich begrenzt für ca. 6-12 Wochen Schwerpunkte: Hilfsmittel Funktionen Teilhabe Anleitung der Bezugspersonen. Rehaantrag nach Konsilbesuch im Krankenhaus oder zu Hause an Krankenkasse Genehmigung von max. 35 Einheiten Abrechnung (Preis ca. 77-82 € je Behandlungseinheit) Ärztl. Eingangs-, Zwischen und Abschlussuntersuchung, Bericht Immer: Mitarbeit der Bezugspersonen Ggf. Integration in WfbM, Tagesförderung etc. 33 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 MoRe - Erfahrungen mit Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung: Erfahrungen praktisch ausschließlich in Bad Kreuznach (mit wenigen Ausnahmen) Angebot in Bad Kreuznach ist an das Rehazentrum Bethesda angebunden In Bad Kreuznach (z.T. auch den anderen Einrichtungen der Eingliederungshilfe) rel. gute therapeutische Infrastruktur in den Wohneinrichtungen Es steht ein funktionierendes SPZ mit mobilen Therapeuten, d.h. auch für Schulkinder zur Verfügung Schulen und WfbM verfügen über eigene therapeutische Dienste. Erfahrungen in der Mobilen Rehabilitation – KH: Kinder und Jugendliche nach Operationen (z.B. Sehnenverlängerungen) Beatmete Kinder mit unsicherer Prognose Schlaganfallpatienten mit geistiger Behinderung Patienten mit Endoprothese Patienten mit frischem Querschnitt Patienten im Wachkoma Eher: Menschen mit erworbenen Behinderungen Sowohl zu Hause als auch in Einrichtungen einschl. Betreute Wohnformen. Wer braucht MoRe ? Mobile geriatrische Rehabilitation ist konzeptionell etabliert. Rahmenempfehlung MoGeRe 1.5.2007 Aber: Nur 4 Standorte am Netz Fachübergreifende Mobile Rehabilitation statt ausschließlich geriatrischer und ggf. neurologischer, also indikationsspezifischer MoRe ist sinnvoll Deshalb: Mobile Rehabilitation muss in allen Regionen flächendeckend als Angebot für Menschen mit Behinderung verfügbar sein, insbesondere im Zuge der Dezentralisierung. Gesundheitliche Versorgung älterer Menschen mit geistiger Behinderung: Die Bedeutung gesundheitlicher Versorgung nehmen mit dem Alter zu – ihre Bereitstellung ist zentrales Anliegen der Eingliederungshilfe Gesundheitliche Probleme nehmen mit dem Alter zu, auch bei Menschen mit geistiger Behinderung Die Alterungsprozesse und altersassoziierte Erkrankungen treten bei Menschen mit geistigen Behinderungen oft früher auf, oft korreliert 34 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 mit den Ursachen der Behinderung (Trisomie, Hydrocephalus, Epilepsie, Doppeldiagnosen), vgl. z.B. Demenz Alterungsprozesse und damit assoziierte Erkrankungen verstärken oft die vorhandenen funktionellen Einschränkungen Alterungsprozesse und damit assoziierte Erkrankungen nehmen bei Menschen mit geistiger Behinderung oft einen schnellen verlauf Der Unterschied zwischen alten Menschen mit und ohne geistige Behinderung wird im Hinblick auf die gesundheitlichen Probleme geringer. Er besteht weiterhin in dem, was die Menschen zeitlebens getan und wie sie gelebt haben und folglich als Normalität im Alter weiter tun möchten= also von den Vorstellungen des Alltags und der alltäglichen praktischen Lebensvollzüge. Deshalb sind die Lebensentwürfe der beiden Gruppen im Alter oft nicht oder nicht voll kompatibel Die Pflegebedürftigkeit nimmt zu Auch Menschen mit geistiger Behinderung werden zu geriatrischen Patienten. Der geriatrische Patient: Patientenmerkmale des geriatrischen Patienten: über 70 Jahre oder biologisch vergleichbares Alter Multimorbidität Hat typische geriatrische Syndrome: Immobilität Sturzneigung und Schwindel Inkontinenz Kognitive Defizite Decubitaulcera Fehl- und Mangelernährung Störung Des Wasser- und Elektrolythaushaltes Depression, Angststörung Chronische Schmerzen Sensibilitätsstörungen Herabgesetzte körperliche Belastbarkeit Hörstörung Sehstörung Multimedikation Herabgesetzte Medikamententoleranz Häufige Krankenhausbehandlung (Drehtür) Ggf. Gerontopsychiatrische Syndrome Ggf. sekundäre Folgen eingeschränkter sozialer Ressourcen. Der ältere geistig behinderte Mensch als geriatrischer Patient: Die zuständige medizinische Disziplin für diese Personengruppe ab ca. 70 Jahren ist die Geriatrie. 35 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Die moderne Geriatrie schließt immer die geriatrische Rehabilitation mit ein und ist grundsätzlich, wenngleich nicht vollständig teilhabeorientiert. Die traditionelle Altenhilfe aber bleibt oft weit hinter den Möglichkeiten der Geriatrischen Rehabilitation und teilhabeorientierten Pflege zurück. Darin liegt ein wesentlicher Grund für die z. T. verheerenden Zustände in den Altenpflegeheimen. Ein Grund dafür sind unzureichende Angebote der teilhabeorientierten Gesundheitsversorgung Die Geriatrie ist eine Disziplin für die vorletzte und letzte Lebensspanne. Palliativmedizin, Sterbebegleitung und Schmerztherapie sind partiell integriert. Menschen mit geistiger Behinderung erfüllen oft schon in jüngeren Jahren die Kriterien des geriatrischen Patienten; z.T. schon mit 40 Jahren. Der geistig behinderte Mensch mit Pflegebedarf als geriatrischer Patient? In der Eingliederungshilfe gibt es in den Bereichen Körperbehinderte und Schwerstmehrfachbehinderte junge Menschen mit geriatrieähnlichen Syndromkonstellationen. Dort sind Konzepte entwickelt, wie Teilhabe auch im jüngeren Alter mit langer Lebenserwartung verwirklicht werden kann. Bettlägerigkeit vs. Sitzfähigkeit und Mobilisierung Ermöglichung eines 2. Lebensraumes Ermöglichung effektiver Kommunikation In manchen Bundesländern kommen auch diese Menschen schon in Pflegeeinrichtungen, in manchen eher in Eingliederungshilfeeinrichtungen. BRD: ca. 28000 Menschen mit Behinderung bei Pflegebedarf in Pflegeeinrichtungen unter 60 Jahren. Wahrscheinlich ist ein Teil dort fehlplaziert. Die Versorgung pflegebedürftiger Menschen in Pflegeheimen steht allgemein in der Kritik. Ist das Pflegeheim der richtige Ort für Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf? Versorgung pflegebedürftiger Menschen im Rahmen der Eingliederungshilfe: D.h.: Auch in Einrichtungen der Eingliederungshilfe können pflegebedürftige, kranke und schwerstbehinderte Menschen teilhabeorientiert versorgt werden, da auch dort die gesundheitliche Versorgung sichergestellt werden kann. Die Versorgung wird dort im Wesentlichen nicht durch Pflegefachkräfte sondern durch pädagogische Fachkräfte und Assistenzkräfte sichergestellt. 36 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Fachpflegekräfte arbeiten integriert. Eine komplementäre gesundheitliche Versorgung ist notwendig. Im System der Pflegeheime fehlt eine teilhabeorientierte gesundheitliche Versorgung weitgehend und ist durch die Fachlichkeit der Pflege allein auch nicht annähernd herzustellen. Deshalb die Frage: müssen Menschen mit schwerer Behinderung und Pflegebedarf in Pflegeeinrichtungen wechseln oder können sie in der Eingliederungshilfe verbleiben? Diagnosen für MoRe: Neurologische Rehabilitation, insbesondere im Übergang nach Hause und/oder in den Beruf (SHT, Hirn-Ops) Querschnitt, MS, ALS Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen nach OP, auch Kinder und Jugendliche Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder psychischen Erkrankungen und Rehabedarf, insbesondere Menschen mit geistiger Behinderung Menschen unter Beatmung Wachkoma/Apalliker/Schwerstbetroffene Intensivpatienten Rehabilitanden mit MRSA Rehabilitanden mit explizitem Wunsch nach häuslicher Rehabilitation Prolongierter Verlauf der Rehabilitation zu erwarten, wenn zugleich die vollständige Nutzung des rehabilitativ relevanten Zeitfensters notwendig ist. „Feuerwehrfunktion“. Was heißt Rehabilitation für Menschen mit geistiger Behinderung - spezifischer Rehabilitationsbedarf ? Am Beispiel des Sitzen: Einen bettlägerigen „Dauerpflegefall“ muss es heute nicht mehr geben!! 3-6 stündiges Sitzen ist zentrale Voraussetzung zur Inklusion Voraussetzungen für ein Sitzen im mobilen Stuhl von 3 bis 6 Stunden : Keine Schmerzen Stabiler Kreislauf Kein Toilettengang erforderlich Transfers gesichert (i. d. R. durch 1 Person!!) Vorbeugung Decubitus Facilitierung von Bewegungen Signalgeber und Notruf vorhanden Keine Unterbrechung von PEG/O2 Gabe Möglichkeiten für eigenes Handeln und Beteiligung sind gegeben Attraktivität durch Ermöglichung von Mobilität und Teilhabe U.a. 37 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Konzepte der Teilhabesicherung: Teilhabesicherungskonzepte (TSK) bestehen aus einem problem- und lebensbereichsbezogenen Ziel-, Methoden und Maßnahmenkatalog, der individuell modifiziert unter Beachtung der Kontextfaktoren unter Nutzung rehabilitationsmedizinischen Wissens entwickelt und zur Anwendung gebracht wird und eine strukturierte Problembewältigung mit dem Ergebnis verbesserter Aktivitäten und Teilhabe ermöglicht. Beispiele für TSK in der Behindertenhilfe: Teilhabeermöglichende Lokomotion –hier Transfer Transfer über den Stand durch eine vertraute Person =Voraussetzung ubiquitärer Transfermöglichkeit = Voraussetzung für Teilhabe. Problemlösungsbedarfe/ -möglichkeiten dazu u.a. Schuhe/Socken/Fußbelastung Angst Kinästhetik Ausreichende Streckfähigkeit der Knie- und Hüftgelenke Ergonomie der Hilfsmittel (Bett, Rollstuhl etc.) Sturzprophylaxe /Sicherheit OP Botulinum KG nach Bobath Wenn Transfer über Lifter, dann durch eine Person! Inklusion durch TSK praktisch: Zu Hause z.B.: Anwesenheit bei gemeinsamen Mahlzeiten Gemeinsames Fernsehen/Radio Anwesenheit bei Ankunft und Abfahrt Anwesenheit bei der Küchenarbeit Anwesenheit bei Gesprächen (aktuell, Alltag, Erinnerungen) Anwesenheit bei Kinderspiel etc. Anwesenheit bei Besuch Anwesenheit und Mitwirkung bei Entscheidungen Hobbies: Basteln, Garten, Tiere, Musik Bescheid wissen und Neues erfahren Tagesstruktur haben Beteiligung am religiösen/kirchlichen Leben: Besuch des Gottesdienstes Usw. Und: den Mitmenschen wichtig sein: Ihnen Bedeutung geben! 38 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Inklusion durch Kommunikation: Für jeden nichtsprechenden Menschen kann eine Kommunikationsstrategie entwickelt werden, die dem Betroffenen aktive, eindeutige, differenzierte und personenunabhängige, verständliche Äußerungen gestattet. Dazu gehört obligatorisch die Umsetzung des Konzeptes der Unterstützten Kommunikation (UK), z.B.: Systematische Nutzung von Mimik, Gebärden, also körpernaher Kommunikationsmittel Nichttechnische Kommunikationshilfsmittel Technische Kommunikationshilfsmittel Herstellung geeigneter Kommunikationssituationen Basale Stimulation und Kommunikation für Schwerstbehinderte Anpassung und Entwicklung unter Einbezug des gesamten sozialen Umfeldes Auch mit schwerstbehinderten Menschen kann man kommunizieren: auf Ihre Art: Über den Körper, achtsamen Umgang, empathische Beobachtung und körperliches Fühlen. Teilhabesicherungskonzepte: 1. Ermöglichung des ggf. mehrstündigen Sitzens im Sinne der Teilhabe am Leben im konkreten Wohnumfeld, ggf. mit in der Häuslichkeit benutzbaren und akzeptierten Hilfsmittel 2. Ermöglichung von Sitz, Mobilität und Pflege durch an die Wohnumgebung und die Assistenzpersonen angepasste Transfertechniken bzw. Hilfsmittel. 3. Ermöglichung von Kommunikation durch Verwendung von im konkreten persönlichen und gesellschaftlichen Umfeld angepassten, erprobten und akzeptierten Kommunikationsstrategien und Kommunikationshilfsmitteln bei eingeschränkter expressiver und rezeptiver Sprache 4. Ermöglichung der im sozialen Kontext akzeptierten Ernährung bei orofazialer Dysfunktion unter Förderung der Kompetenzen des sozialen Umfeldes bei Zubereitung und Nahrungsaufnahme (Schlucktraining) ggf. einschließlich der Akzeptanz veränderter Essensgewohnheiten 5. Bewältigung der Inkontinenz mit dem Ziel der (ggf. relativen) Kontinenz einschließlich Hilfsmittel, Management, Toilettengang und Toilettentraining im häuslichen Umfeld 6. Optimierte Lokomotion, d.h. eigenständige Beweglichkeit ggf. mit Hilfsmitteln zur Lagerung und Bewegung von ort zu Ort einschließlich Anleitung zur Eigenübung, Kontrollkompetenz. 39 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 MoRe und Eingliederungshilfe – Begriffsklärungen: 1. Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe sind solche der Eingliederungshilfe (SGB XII) oder anderer Sozialleistungsträger z.B. : a. Wohnheime b. Betreute Wohnformen c. Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) d. Förderkindergärten und –schulen (auch SGB VIII, Kultusverwaltung,) 2. Wohnheime der Eingliederungshilfe sind keine Pflegeheime. Sie stellen den Lebensmittelpunkt und Lebensort der behinderten Menschen dar. MoRe ist deshalb in diesen Einrichtungen nicht ausgeschlossen sondern möglich. Der enge Häuslichkeitsbegriff des SGB V gilt nicht für § 40 Abs. 1 SGB V. Dort werden auch Pflegeleistungen erbracht, vgl. i.Ü. § 43 a SGB XI) 3. Die Möglichkeiten der umfassenden Rehabilitation, insbesondere auch der medizinischen Maßnahmen mit rehabilitativer Zielsetzung sind in den Einrichtungen in sehr unterschiedlich Qualität und Quantität vorhanden. Dies liegt an der Verschiedenheit der Konzepte und Leistungs- bzw. Pflegesatzvereinbarungen. In vielen Einrichtungen sind die Möglichkeiten rehabilitativer Interventionen nicht umfangreicher sondern geringer als in der Familie, in manchen deutlich umfangreicher. Erfahrungen von MoRe in Einrichtungen der Behindertenhilfe der kreuznacher diakonie: Auf Grund guter medizinischer Infrastruktur bislang wenige Maßnahmen im stationären Bereich aber ca. 60 Fälle in 15 Jahren im teilstationären/ambulanten Bereich MoRe für jüngere Menschen hat oft als Ergebnis die Eingliederung in eine solche Einrichtung als Ermöglichung von Teilhabe, z.B. in eine WfbM, ggf. einschl. stationärer Aufnahme in eine Wohneinrichtung MoRe ermöglicht oft erst die Aufnahme in eine Eingliederungshilfeeinrichtung statt in eine Pflegeeinrichtung Ein Wartezeitraum zur Heimaufnahme wird zur Entwicklung von Funktionsverbesserungen und verbesserten Teilhabemöglichkeiten genutzt Heimaufnahmen werden hinausgezögert oder ganz vermieden. Zum Bedarf an MoRe in Einrichtungen der Behindertenhilfe: Bedarf an MoRe können Menschen haben mit vorbestehenden Behinderungen mit neu aufgetretenem Rehabedarf Geriatrische Patienten mit Behinderung 40 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Patienten mit Behinderung, die wegen akuter Erkrankung, Unfall, Operativer Behandlung rehabedürftig sind, aber wegen der Behinderung im regulären Setting nicht rehafähig sind, z.B. bei geistiger Behinderung (zwischen 19 und 70 Jahren bzw. nichtgeriatrisch), ggf. auch Heimbeatmung Behinderte Kinder und Jugendliche postop bzw. nach Unfall oder bei Beatmung Menschen nach Akutbehandlung, die so behindert bleiben, dass sie aktuell oder zukünftig eine Einrichtung der Behindertenhilfe in Anspruch nehmen wollen, dafür als Voraussetzung aber spezifische medizinische Rehabilitationsmaßnahmen benötigen (vgl. Neurologische Reha nach Schädel-Hirntrauma Phase D, E, F). Rehabilitation vs. Wohnen –Assistenz vs. Fachdienste: Einrichtungen der Behindertenhilfe dienen per se der Teilhabe und sind deshalb mit Diensten zur Förderung der Teilhabe ausgestattet. Ziele der Eingliederungshilfe und der medizinischen Rehabilitation sind deshalb theoretisch identisch Die Hilfestellungen in der Behindertenhilfe werden aber zunehmend als Assistenz bzw. als Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen aufgefasst, während der fachdienstliche Anteil, und hier insbesondere der medizinische zurücktritt, von Förderung bei spezifischen Problemen abgesehen. Deshalb benötigen die Menschen in den Einrichtungen das Angebot der MoRe wie andere auch. Je stärker das Normalisierungsprinzip und die Bewältigung des Alltagslebens in den Vordergrund gestellt wird, je weniger fachlich rehabilitative Hilfen im Heim selbst angeboten werden, desto mehr hat MoRe ähnliche Probleme wie in Pflegeheimen. Allerdings ist die Alltagsgestaltung grundsätzlich nicht primär auf Pflege sondern auf Teilhabe ausgerichtet, so dass MoRe hier in den Grundintentionen Unterstützung finden dürfte. Inhalte der MoRe in Einrichtungen: Wenn die Einrichtungen der Behindertenhilfe auf Teilhabe zielen, stellt sich die Frage der Aufgabe der MoRe in diesem Kontext: ist sie überhaupt notwendig? Diese Frage ist zu bejahen, da in vielen Fällen ein medizinisches Angebot fehlt. Die Schnittstellen ergeben sich in den Bereichen der Chancen und Beeinträchtigungen bei Aktivitäten und Teilhabe, wie sie im Konzept der ICF beschreibbar sind. MoRe stellt hierfür rehamedizinische, fachlich fundierte, zielorientierte Teilhabesicherungskonzepte bereit. 41 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 MoRe und Eingliederungshilfe: Einrichtungen der Behindertenhilfe können den Bedarf an medizinisch-therapeutischen Leistungen nicht allein durch MoRe decken, sondern benötigen eigene medizinisch-therapeutische Fachdienste, die regelmäßig und dauerhaft gesundheitsbezogene Leistungen, die für die Eingliederung unerlässlich sind und die im Regelsystem nicht vorgehalten werden, erbringen können. Das Modell Mobile Rehabilitation ist nicht zuletzt auf Grund von Erfahrungen der Behindertenhilfe auf den Weg gebracht und erfolgreich konzeptionell umgesetzt worden. Fazit: Mobile Rehabilitation ist ein notwendiges neues Angebot auch für Menschen mit Behinderungen Es ist in besonderem Maße barrierefrei und teilhabeorientiert Es wird an Bedeutung zunehmen müssen im Zuge der Dezentralisierung, da die Komplexeinrichtungen mit ihren umfassenden Angeboten so nicht mehr zur Verfügung stehen. Im Zusammenhang der Dezentralisierung ist aber die Sicherstellung der gesundheitlichen und sonstigen fachdienstlichen Versorgung insgesamt problematisch und erfordert konzeptionelle, organisatorische und finanzielle Konsequenzen Als Rehabilitationsleistung der Krankenversicherung ist sie eine zusätzliche Ressource zu Heilmitteln, der kurativen Versorgung und auch zu den Leistungen der Eingliederungshilfe. Gelingt es nicht, Leistungen der medizinischen Rehabilitation auch für Menschen mit geistiger Behinderung zu erschließen, stellt dies eine gravierende Benachteiligung dar. Auswirkungen des Menschenbildes auf die Medizin: Ein neues Bild vom behinderten Menschen bedeutet, dass die Medizin selbst sich in mindestens drei wesentlichen Hinsichten ändern muss: Sie muss in der Lage sein, nach intensiver Prüfung ihre Vorschläge fachlich sehr gut zu begründen 4Sie muss in der Lage sein, mit dem Patienten darüber angemessen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Sie muss die Lebensumstände mit berücksichtigen und ggf. mitgestalten helfen. Leitidee ist dabei, dass heute nichts dafür spricht, dass schwer behinderte Menschen keine oder gegenüber nichtbehinderten Menschen eine geringere Lebensqualität haben sollen: Alle Anzeichen aus Praxis und Wissenschaft sprechen dafür, dass die Schwere der Behinderung bezogen auf die Beeinträchtigung von Körperstrukturen und Funktionen nicht mit der erreichbaren Lebensqualität korreliert. 42 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Thesen: Für die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung bedarf es komplementärer Angebote, die unabhängig von der Wohnform zur Verfügung gestellt und mischfinanziert organisiert werden. Dies gilt auch für Menschen mit geistiger Behinderung im Alter. Für Menschen mit geistiger Behinderung und Pflegebedarf kann, auch schon in jüngeren Jahren, die geriatrische Medizin und Rehabilitation eine wichtige Rolle in der gesundheitlichen Versorgung spielen. Pflegebedürftigkeit, auch in erheblichem Ausmaß, schließt den Verbleib in der Zuständigkeit der Eingliederungshilfe nicht aus. Diese ermöglicht vielmehr gerade auch dieser Personengruppe gesellschaftliche Teilhabe. Allerdings muss sich die Eingliederungshilfe durch Qualifizierung, besonders in Fragen der Pflege und der Gesundheitsversorgung, und durch komplementäre Angebote an den Bedarf anpassen. Dies ist eine Aufgabe der Träger im Zusammenwirken mit den Sozialleistungsträgern. Die Möglichkeiten der vorgelagerten Sozialen Sicherungssysteme (Krankenversicherung, Rehaträger etc.) sind dazu zu nutzen. Inklusion: Inklusives, annehmendes und anerkennendes Verhalten traut den Menschen, behindert oder nicht, etwas zu und sichert Ihnen einen Platz in unserem Leben. Damit gewinnen sie oft große Bedeutung für uns und andere. Zugleich hat die Medizin die Aufgabe, beste fachliche Expertise für die Erhaltung der Gesundheit und Beseitigung von Krankheit und auch für die Minderung der Behinderung und ihrer Folgen als Möglichkeit bereitzustellen. Neben der Leidenslinderung ist leitendes Prinzip immer auch die Befähigung, das Empowerment und die Veränderung der umgebenden Verhältnisse (Kontextfaktoren) Die Auswahl aus den bereitgestellten Möglichkeiten trifft der Patient bzw. seine unterstützenden Bezugspersonen. Inklusion durch „Rehabilitationsmedizin“: Am Beispiel des Sitzen: Einen bettlägerigen „Dauerpflegefall“ muss es heute nicht mehr geben!! 3-6 stündiges Sitzen ist zentrale Voraussetzung zur Inklusion Voraussetzungen für ein Sitzen im mobilen Stuhl von 3 bis 6 Stunden : Keine Schmerzen Stabiler Kreislauf Kein Toilettengang erforderlich 43 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 Transfers gesichert (i. d. R. durch 1 Person!!) Vorbeugung Decubitus Facilitierung von Bewegungen Signalgeber und Notruf vorhanden Keine Unterbrechung von PEG/O2 Gabe Möglichkeiten für eigenes Handeln und Beteiligung sind gegeben Attraktivität durch Ermöglichung von Mobilität und Teilhabe U.a. e der betreuenden Ärzte und Teams einer finanziell angemessenen Vergütung einer behindertengerechten räumlichen und personellen Ausstattung 44 ARCHIV Medizin 2009 „Gesundheit für‘s Leben“ – Potsdam 2009 Fachtagung, Artikel – MB 2010 – Teil 3, Themenheft 27 medizinischer Grundkenntnisse im komplementären System Herr T., 35 Jahre, mittelschwere geistige Behinderung Herr A., 37 Jahre, schwere geistige Behinderung Frau H., 45 Jahre Intelligenzminderung 45