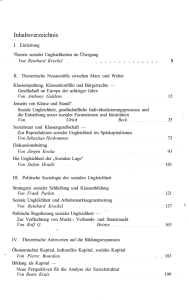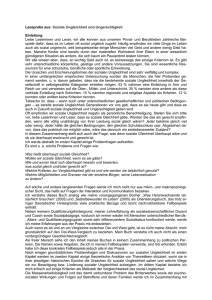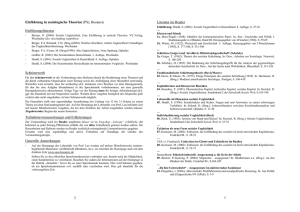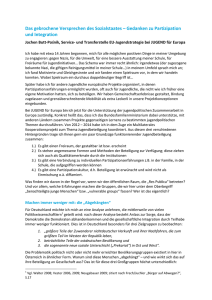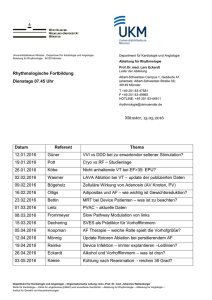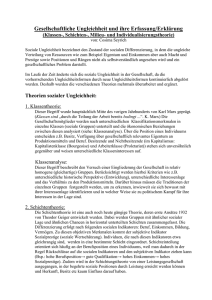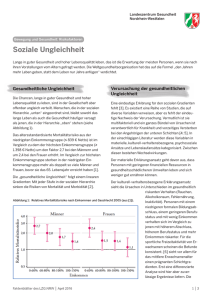Stadt - zurück
Werbung

Stadt ist – gelungen oder mißlungen, kultiviert oder trübsinnig – Gruppenausdruck und Ausdruck der Geschichte von Gruppen, ihrer Machtentfaltung und Untergänge; ein unsichtbares, aber ein sehr wirksames Band verknüpft Einstellungen, Mentalität, Beweglichkeit, Traditionalismus der in einer Stadt lebenden Geschlechterfolge. Ein Stilgefühl besonderer Art ist der »Stadtgeist«. Alexander Mitscherlich Die Stadt ist eine geistige Verfassung, ein Behältnis für Brauchtum und Tradition, für Gebärden und Gefühle, die sich in diesem Brauchtum ausdrücken und die über die Tradition weitergereicht werden. Robert E. Park 2 Begriffe: Stadt – Raum – sozial 2.1 Stadt In die „Stadt“ gehen. Endlich hier raus kommen. Weg vom Dorf, raus aus der „Provinz“, in die Großstadt. Das eigene Leben leben. Oder zumindest ein Anderes. Großstadtträume. Wer kennt sie nicht?! Die Träume und Hoffnungen von einem anderen, einem neuen, einem besseren Leben: Stadt der Möglichkeiten, der Begegnungen. Stadt des Erfolgs, Stadt der Kultur, der Bildung. Aber eben auch Stadt der Anonymität, des Scheiterns. Stadt der Ausgrenzung, der Armut, der Angst. Die Stadt ist vieles, manchmal alles und doch nicht zu greifen. Stadt verändert sich. Permanent. Sie nimmt einen mit oder lässt einen zurück. Sie polarisiert, sie spaltet, sie vereint. Stadt als Spiegel, als Ausdruck der Gesellschaft. Die Stadt gibt es nicht. Stadt hat viele Gesichter – und für jeden ein Anderes. 2.1.1 Annäherung an den Begriff „Stadt“ Etymologie Ausgehend vom Ursprung des Begriffs lässt sich „Stadt“ folgendermaßen fassen: 3 Stadt aus ahd., mhd. Stat „Standort, Stelle“. Im Deutschen seit dem 12.Jh. die Bedeutung von „Ortschaft“ bzw. „Wohnstätte, Siedlung“ als Rechtsbegriff: Marktrecht, Siedlungsrecht, Recht auf eigene Verwaltung und persönlichen Freiheitsrechten der Stadtbewohner. Begriff löst in dieser Bedeutung den älteren Bergriff der Burg ab, von dem sich der Begriff Bürger ableitet. (vgl. Duden 2001, S.797) Der Begriff „Stadt“ hat demnach eine Herkunft, eine Geschichte: Ein „Ort“, eine „Stelle“ hat an Bedeutung gewonnen, wurde mit Leben gefüllt und zeigt - mit dem Übergang von der Burg zur Stadt - einen Gesellschaftswandel an, der bis heute anhält und sicher noch nicht abgeschlossen ist: „Städte sind ein Spiegelbild historischer Prozesse von langer Dauer, die mit dem Beginn Europas einsetzen, nach Jahrhunderten messen und mitunter durch eben diese Städte weiter in Bewegung gehalten werden“ (Benevolo 1999, S.244). Umfrageergebnisse In einer nicht repräsentativen Umfrage zur Bedeutung von Stadt (n=10; siehe Fragebogen im Anhang 10.1), zeigt sich sehr deutlich, dass die Ambivalenz der Stadt von den Befragten auch als solche wahrgenommen wird. Für alle Befragten steht Stadt für Vielfalt der Möglichkeiten und für hinzunehmende Einschränkungen der Lebensqualität gleichermaßen. Für den eigenen Kiez bzw. das eigene Wohnumfeld zeigen sich meist praktische Aspekte, die im Hinblick auf die Wohnortwahl im Vordergrund stehen: zum Beispiel der Zugang zu städtischer Infrastruktur, wie U-Bahn, Bus usw., Einkaufsmöglichkeiten, Mietpreise. Das Entscheidende ist die individuelle Bilanz der Vor- bzw. Nachteile im jeweiligen Kiez. Alle Befragten haben für sich die Möglichkeit eines Wohnortwechsels beim Auftauchen von für sie schwerwiegenden Nachteilen in Betracht gezogen. Und: alle Befragten haben bereits einen Wunsch-Ort für sich parat. „Stadt“, so die Vermutung, wird von den Befragten als „Möglichkeitsraum“ verstanden: Verändern sich die individuellen Prioritäten, so verändert sich ggf. der Wohnort, d.h. er wird den Prioritäten angepasst. Das deutet auf eine hohe Bereitschaft, in Verbindung mit der entsprechenden Möglichkeit, zur Wohnortmobilität hin. Stadt, so die Folgerung, wird von der befragten Gruppe als Ressource zur Lebensgestaltung aktiv genutzt. Eine tiefe Verwurzelung mit bzw. direkte Abhängigkeit von dem jeweiligen Kiez, scheint nicht gegeben. D.h., diese Motive für ein individuelles Engagement im eigenen Kiez im Falle der Verschlechterung 4 der allgemeinen Situation vor Ort, würden bei der befragten Gruppe sehr wahrscheinlich ausfallen. 2.1.2 Die Stadt in der europäischen Geschichte Der Anfang Die Geschichte der Stadt reicht weit zurück. Schon 8000 v.Chr. gab es erste Siedlungen: Jericho gilt als eine der Ältesten. Gesichert ist, dass es 3000 v. Chr. Städte in Ägypten (Hierakonpolis), Mesopotamien (Uruk) und Iran (Susa) gab. In der damals klimatisch begünstigten Zone zwischen dem 20. und 40. Breitengrad nahm die Ausbreitung der Stadtkultur ihren Anfang an Meeresküsten und fruchtbaren Flussregionen. Mit dem einsetzenden Bevölkerungswachstum stieg die Zahl der Siedlungsgründungen immer weiter an. Die Entstehung der Stadt führte die Menschen von der „mythischen Vorzeit“ heraus in die „Geschichtlichkeit“ (Benevolo 1999, S.19). Die Stadt war in ihren Anfängen zentraler Sammelpunkt, Lagerort und Umschlagplatz landwirtschaftlicher Überproduktion (Benevolo 1999, S.19). Und natürlich ein Ort der Begegnung und des Schutzes. Mit ihrer Anlage – dem gezielten Bau von Lagerräumen, Wohngebäuden, Tempel, Palast und Schutzräumen bzw. der Stadtmauer – konstituierte sich der Stadt-Land-Gegensatz, der „für lange Zeit das Bild der Welt und gleichermaßen für das Bewusstsein wie für die soziale Wirklichkeit prägend sein [wird]“ (Benevolo 1999, S.20). Die „offene“ Stadt der Antike In der Stadt der griechischen Antike fand der Mensch seine Vollendung als „ein von Natur aus staatsbildendes Geschöpf“ (Benevolo 1999, S.21). Die „polis“ suchte nach Ausgewogenheit zwischen der sie umgebenden Landschaft und berechenbaren bzw. kontrollierbaren Größenverhältnissen im Inneren. Die „Teilnahme und Mitgliedschaft an einer Stadt“ war das Ziel eines jeden zivilisierten Menschen (Aristoteles in: „polis“): hier fanden nach damaliger Auffassung seine geistigen Bedürfnisse Befriedigung, während das Land nur zur Befriedigung körperlicher und animalischer Bedürfnisse taugte. In der Stadt konnte der Mensch „gut und richtig“ leben. Planung war dabei die Grundlage: Hippodames von Milet hat, so Aristoteles, „die Einteilung der Städte erfunden“ und die Städte 5 Piräus und Knidos geplant (vgl. Hotzan 1994, S.25). Das „Schachbrett“ als frühes städtebauliches Ordnungsprinzip war erfunden. Die „offene“ Stadt der Griechen bezog die Landbevölkerung mit ein und bot ihr in Notzeiten Obdach und Schutz. Der Stadt-Land-Gegensatz Mit dem Prozess des Untergangs des Römischen Reiches befestigten sich die Städte nach und nach, um sich gegen Angriffe von außen zu schützen. „Barbareneinfälle“ sorgten dafür, dass die Städte ihr Gesicht veränderten. Die Menschen zog es in oder in die Nähe der schützenden Siedlungen. Mit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches wurde die antike Monumentalität allerdings funktionslos und zerfiel (vgl. Benevolo 1999, S.31-39). Das Feudalsystem füllte das Machtvakuum in „Europa“ nach der Völkerwanderung. Für die Städte bedeutete dies, dass sie in ihrer Entwicklung zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert abhängig waren von den jeweiligen militärischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedingungen. Manche prosperierten als Residenzen, z.B. Pavia, Barcelona und Paris. Andere schrumpften wie Ravenna, Bolongna und Trier (vgl. Benevolo 1999, S.34f). Die Städte verloren ihre „urbane Kultur“ im antiken Sinne. Nicht mehr die Vollendung des Menschen, sondern der Erhalt und Ausbau der Stadt sowie das Überleben ihrer Bewohner stand im Vordergrund. Dabei spielten geographische und landschaftliche Gegebenheiten die entscheidende Rolle (vgl. Benevolo 1999, S.39). Auch entstanden seit dem 7. Jahrhundert an den „Kirchenkreuzen“ der Römisch-Katholischen Kirche die Kristallisationspunkte späterer Stadtkerne, wie z.B. das Münster in Bonn: zunächst außerhalb der römischen Stadtmauer erstellt, bildet die Grabeskirche St. Cassius im 9. Jahrhundert den neuen Stadtkern (vgl. Benevolo 1999, S.39). Im Inneren der Städte wurde das antike Erbe umgestaltet: das „Schachbrett“ bzw. die „Formation des Häuserblocks“ wurde aufgeschlossen und von Straßen durchschnitten. Kleinere Räume entstanden. Ungenutzte römische Bauten wurden in den Festungsbau einbezogen. Bei Neugründungen standen vor allem Verteidigungsaspekte und Handelserfordernisse im Vordergrund (vgl. Benevolo 1999, S. 42). Die Grundrisstypen der mittelalterlichen Stadt reichten von Ein6 straßensiedlungen (Straßenmarkttyp), über das bekannte „Schachbrett“ und dessen Abwandlungen (Parallelstraßen- und Querrippentyp) zu mehr oder weniger radial-konzentrischen Anlagen (Hotzan 1994, S.31). Generell lassen sich im Mittelalter v.a. sechs Ursprünge der Stadt erkennen (vgl. Hotzan 1994, S.31): 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ausbau ehemals römischer Städte Klostergründungen Anlage von kaiserlichen Pfalzen oder fürstlichen Burgen Marktsiedlungen freier Kaufleute Expansion freier Meierhöfe oder Flecken mit Marktrecht Gründungen aus bestimmtem Anlass, wie z.B. dem Abbau von Silber oder anderen Bodenschätzen Die „geschlossene“ Stadt im Mittelalter Während es auf deutschem Territorium im 9.Jahrhundert ca. 40 Städte bei einer Gesamtbevölkerung von rund zwei Millionen Menschen gab, so waren es vor der Pestwelle im 14. Jahrhundert etwa 3.000 Städte bei insgesamt 16 Millionen Einwohnern (Hotzan 1994, S.33). Die Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktivität durch die Einführung der Dreifelderwirtschaft und verbesserten Ackergeräten begünstigte zwar einerseits das Bevölkerungswachstum, führte aber auch dazu, dass die durch die technologische Entwicklung arbeitslos gewordene Landbevölkerung in die Städte abwanderte. Die Städte begannen schnell zu wachsen. Vor den Toren bildeten sich Siedlungen die später von neuen Mauern geschützt wurden (vgl. Benevolo 1999, S.59). Auch die voranschreitende Christianisierung in Verbindung mit einem prosperierenden Handel und Verkehr förderte neue Stadtgründungen im Norden und weit ins heutige Ost-Europa hinein. Allerdings dauert diese Phase nur rund 200 Jahre (von der Mitte des 12. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts). Bei den Neugründungen zeigt sich ein planmäßiges Vorgehen: zu Beginn wurde die Stadt in ihrer Anlage (Kirche, Marktplatz, Wohnhäuser, Straße und Wege, Befestigungsanlagen usw.) festgelegt und diese in der Ausführung und Entwicklung umgesetzt bzw. beibehalten. Da der Stadtgründer auch Eigentümer der Stadt war, ließ sich alles en detail planen (Benevolo 1999, S.90). 7 Mit der Festschreibung der Stadtrechte (z.B. in Nürnberg) entzog sich die Stadt dem Feudalsystem teilweise. Mit dem Recht auf Selbstverwaltung und Steuererhebung, Verteidigung, niederer Gerichtsbarkeit, Münz- und Marktrecht stand die Stadt auf eignen Beinen und bildete einen eigenen Mikrokosmos gegenüber Kaiser und Fürsten: „Stadtluft macht frei“. Die Stadt wurde „zu einer privaten Vereinigung mit öffentlicher Macht“ (Benevolo 1999, S.59), die von einer autonomen Verwaltung, deren Struktur die Machtverteilung innerhalb der Stadt abbildete, geführt wurde (vgl. Benevolo 1999, S.60). Diese Machstruktur bildete sich in ihrer Komplexität auch „in der Struktur des öffentlichen Raumes“ ab (Benevolo 1999, S.62). Nichts ging durcheinander, jede „Macht“ (Wirtschaft, Handwerk, Politik, Religion usw.) hatte ihr eigenes Zentrum mit eigenen Symbolen und eigener Organisation. Alles Städtische war auf diese Weise geordnet separiert mit einer Stadtmitte von – im wörtlichen Sinne – höchster Anziehungskraft (vgl. Benevolo 1999, S.62): Hohe Bauten, z.B. Kirchen, dominierten das Zentrum. Sie waren weithin zu sehen und schafften zusammen mit den die Stadt umgebenden Mauern eine Vorstellung von der Stadt als „einem dreidimensional proportionierten Objekt“, mit dem sich die Menschen der Stadt identifizierten (vgl. Benevolo 1999, S.62). Gleichwohl ist die Entwicklung der Stadt nie vollendet. Sie erscheint im Mittelalter eher als Bausstelle, denn als homogenes Gebilde. Die Suche nach „rationalen, zugleich allgemeingültigen und flexiblen Regeln“ brachte „neue Konstruktionsweisen und Dekorationsformen“ hervor, die später als „Gotik“ eine ganze Epoche prägten, von internationaler Wirkung waren und es ermöglichten „die immer schnelleren und umfangreicheren Veränderungen der Stadt zu steuern“ (Benevolo 1999, S.64). Mit der Ausbreitung der Gotik in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstand so etwas wie eine grenzüberschreitende architektonische Verbindung, die Europas Städte – in aller Unterschiedlichkeit – als selbstbewusste Produkte einer einheitlichen Zivilisation erscheinen lassen (vgl. Benevolo 1999, S.64). Mit der Pest von 1348 verlor Europa die Hälfte seiner Einwohner. Die Wirtschaft geriet in eine Krise und die Stadtneugründungen (bzw. die Stadtplanung als planmäßiges Vorgehen bei der Errichtung von Städten) kamen weitgehend zum erliegen. Dennoch waren bis Mitte des 14. Jahrhunderts in Europa viele urbane Zentren kirchlicher und weltlicher Macht entstanden, die bis heute besiedelt 8 sind und unser Verständnis von Stadt maßgeblich prägten. Stadt verstanden als „ein individuelles Gebilde, das nicht in moderne, abstrakte Kategorien – wie etwa Nation – eingeordnet werden kann. Nicht solchen Kategorien fühlen wir uns zugehörig, sondern wir fühlen uns als Einwohner von Paris oder London, als Venezianer oder gar als Bewohner eines bestimmten Stadtteils“ (Benevolo 1999, S.95). Die Stadt in der Renaissance (1400-1650) Während sich zum Ende des Mittelalters die Städte konsolidiert hatten und sich die Gestaltung der Stadt auf Erhalt und Verschönerung beschränkte (vgl. Benevolo 1999, S. 101), veränderte die Renaissance die Vorstellungswelt des Mittelalters radikal. Die Hinwendung zum Diesseits ging einher mit der Schaffung neuer Ideale unter Rückbezug auf die Antike. Die Eroberung und die Beherrschung der Welt unter der Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnis wurde das Ziel staatlichen Strebens. Das Geld dazu kam aus Augsburg oder Venedig: von den Fuggern oder den Medici. Die Entdeckung der Perspektive durch den Florentiner Baumeister Brunelleschi (um 1410) und deren wissenschaftliche Begründung durch Alberti 1435, veränderte den Standpunkt der Menschheit im Universum genauso wie die Stadtplanung. Erkenntnisse aus Naturwissenschaft und Forschung regten – nicht zuletzt aufgrund der Universitätsgründungen seit dem 13. Jahrhundert – planendes Vorgehen im Städtebau an. Idealstadtentwürfe entstanden, die sich an Perspektive und „Ebenmaß“ als die vollkommensten und obersten Naturgesetze orientierten (vgl. Hotzan 1994, S.37). Mit der nach der Pest in Europa wieder zunehmenden Gesamtbevölkerung und einer wachsenden Bewohnerdichte in den Städten, wurde eine verbindliche Regelung zur Stadtgestaltung notwendig. Der Druck auf die Städte wuchs dramatisch. Zwischen 70 und 80 Millionen Menschen lebten zu Beginn des 15. Jahrhunderts auf 2,5 Millionen Quadratkilometern Fläche in ca. 130.000 Ortschaften. Die Kolonisierung der Welt begann (Benevolo 1999, S.126). Und in den Städten Europas versuchte man mit Vorschriften auf den Druck zu reagieren. Die Institution des Baurechts wurde in Köln 1478 mit einer ersten Bauord9 nung etabliert. Die Bauordnung von Leonhard Frönsperger aus dem Jahre 1564 regelte die wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Aspekte des Bauwesens und gilt als Vorläufer der Preußischen Einheitsbauordnung von 1919 (vgl. Hotzan 1994, S.37). Die Stadt als Hauptstadt: Absolutismus – Aufklärung – Merkantilismus Im Zeitalter des Absolutismus ließ sich der Hofadel in planvoll angelegten Residenzen, meist vor einer Stadt oder in kleinen Dörfern davor, nieder. Großflächige Areale wurden von schnurgeraden Achsen durchschnitten, gewaltige Anlagen verkündeten die Idee der absoluten Monarchie. Versailles nahe Paris wurde zum stilprägenden Gebilde einer Zeit absoluter Macht. Die Städte blieben in ihren mittelalterlichen Anlagen erhalten. Die Arbeitsteilung in der vorindustriellen Produktionsweise des Merkantilismus spiegelt den Zeitgeist auf geradezu räumliche Art und Weise wieder: So wie der absolute Herrscher an der Spitze des Staates stand, dem sich alle zu unterwerfen hatten, so stand die Residenz, die Hauptstadt des Herrschers, hierarchisch an erster Stelle im Königreich. Sie war die Stadt der Städte. Hier war das Zentrum des gesellschaftlichen Lebens. Das Dorf war der Ort der einfachen Produktion (Lebensmittel, Bodenschätze usw.). Die Kleinstadt der Ort der ersten Bearbeitung, der Aufbereitung von gewonnenen Rohstoffen durch Handwerk und Handel. In der Residenz aber fand sich der Ort der Veredelung des Menschen zum Nutzen aller. Die „Hauptstadtidee“ als Residenz, Handelsstadt und Universität war geboren (vgl. Leibnitz, in: Hotzan 1994, S.39). Die den Städten weit vorgelagerten Reichsgrenzen, die mit einem Festungsgürtel gesichert wurden, erlaubten diese neuen Stadtplanungen, die das Land in Form von angelegten Grünanlagen in die Stadt holten (Benevolo 1999, S.172). Das Zeitalter der Vernunft und Aufklärung veränderte vor allem die Stellung des Individuums gegenüber der staatlichen Macht. Das mittelalterliche Ständewesen verlor seine Stellung. Kirche und Staat waren fortan getrennt. In England sicherte die „habeas-corpus-Akte“ von 1679 dem Einzelnen Schutz vor willkürlicher Verhaftung und persönliche Freiheit zu. Es wurden erste politische Parteien gegründet. Der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung folgte die Französische Revolution und im gleichen Jahr, 1789, die Erklärung der Menschen10 und Bürgerrechte (Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit). Die Demokratie war der Monarchie entgegengesetzt. Rechtsstaat und Gewaltenteilung breiteten sich nach und nach in Europa aus. (vgl. Hotzan 1994, S.39) Die Stadt und die industrielle Revolution Die Aufklärung bereitete den Weg zur industriellen Revolution. Die Auflösung der Ständeordnung und des Zunftwesens setzten das Individuum frei, das nun gezwungen war, seinen Platz in der Gesellschaft selbst zu finden. Der „Gesellschaftsvertrag“ (Rousseau) lieferte die staatspolitische Idee und der Kapitalismus - mit der Erwerbsarbeit als Schlüssel zum Wohlstand (Adam Smith) -, den Weg zur zweiten, der industriellen Revolution. Die erkämpften Freiheitsrechte sicherten dabei Eigentum und förderten die Privatinitiative (vgl. Benevolo 1999, S.190). Mit dem einsetzenden Liberalismus unter den Bedingungen des Marktes war auch der Grund und Boden der Stadt bewertet und vermarktet worden. Der Staat bzw. die öffentliche Gewalt – von Steuereinnahmen abhängig - unterlagen den Gesetzen, die ein steuerndes Eingreifen verhinderten. Detaillierte Regelungen fehlten. Der Markt bestimmte. „Jeder Eingriff der Verwaltung wird als Einmischung, als überflüssige Störung betrachtet, die es zu unterbinden gilt“ (Benevolo 1999, S.191). Das blieb bei zunehmendem Bevölkerungswachstum und wachsendem Bedarf an Arbeitskräften in der stark expandierenden Industrie nicht ohne Folgen für die Stadt: „Städtebaulicher Wildwuchs, dicht gedrängte Menschenmassen in primitiven Elendsvierteln, ungeordnete Mischung aller Nutzungen und hygienisch üble Zustände sind die Folgen der neuen `Freiheiten´“ (Hotzan 1994, S.41). Beispiel Dortmund: „Die Wohnflächen breiten sich `breiartig´ um die bestehenden Siedlungskerne aus und führen im Weichbild der Städte zur zunehmenden Zersiedlung (Hervorhebung im Original) der Landschaft. Die Industrieflächen, die eingestreut in Wohnbebauung entstehen, konzentrieren sich zunehmend um wachstumsfähige Betriebe und verdrängen Wohnbebauung. Die vom Staat allmählich geforderte Entmischung der Nutzungsarten führt zu einer hohen Verkehrsnachfrage, die selbst unsere Gesellschaft im 20. Jahrhundert nicht befriedigend bedient hat.“ (Hotzan 1994, S.45) In England, dem Mutterland der Industrialisierung, führte das Elend in den überfüllten Städten, die Epidemien in den Armenvierteln und die Unruhen unter den Arbeitern zum „Public Health Act“. Durch dieses 1848 verabschiedete Gesetz 11 wurden erstmals Rechte und Pflichten bezogen auf den öffentlichen und für Teile des bisher ungeregelten privaten Raums definiert. Im Einzelnen wurde geregelt: Kanalisation und Hausentwässerung, Müllabfuhr, die Beseitigung von Gesundheitsgefahren, Schlachten von Tieren, Belüften und Hygiene von Mietshäusern, Pflasterung und Instandhaltung von Straßen, Neubau und Ausbau von öffentlichen Grünanlagen, Wasserversorgung, Leichenbestattung und die Verwaltung und Finanzierung dieser Aufgaben durch Steuern und Gebühren (Hotzan 1994, S.49). Auch die Idee der „Gartenstadt“ wurde in England geboren: einer geplanten Stadt auf dem Lande, von einem Landschaftsgürtel umgeben, mit bestimmter Größe und Anlage, errichtet auf Land in öffentlichem Eigentum und von der Gemeinschaft treuhänderisch verwaltet (Hotzan 1994, S.49). Die staatliche Siedlungspolitik sollte nach der Vorstellung ihres Erfinders E. Howard (sein Buch „Tomorrow“ erschien 1898) damit der Landflucht und planlosem Stadtwachstum entgegenwirken können. In Paris zeigte sich ein Phänomen, das die veränderte Stellung der Stadt als Symbolträgerin über die Landesgrenzen hinaus verdeutlicht. „Sie [die Stadt] ist kein Symbol der Machtkonstellation [mehr], sondern eine Quelle der Macht selbst“ (Benevolo 1999, S.196). Paris war der Ort, an dem sich die Revolutionen in Frankreich entschieden hatten. Das ganze Land schaute auf die Hauptstadt und mit ihm ganz Europa. Stadtplanung erhielt eine (macht)politische Begründung bzw. Motivation. Die „Haussmannisierung“ hielt Einzug in die Städte. Sie war der Kompromiss zwischen Staatsinteressen einerseits und den privaten Interessen der Grundbesitzer andererseits. Die Stadt wurde geteilt in den öffentlichen und in den privaten Raum. Straßen, Plätze, infrastrukturelle Versorgung (Wasser, Kanalisation, Straßenbeleuchtung usw.) wurden von der Stadt bereitgestellt. Haussmann (sowohl Bauunternehmer als auch in der Verwaltung der Stadt Paris beteiligt) strukturierte so die Stadt, durchzog sie mit einem regelmäßigen Netz aus Straßen und Plätzen, schlug Schneisen in die mittelalterliche Stadt. Der öffentliche Raum endete an der Fassade, die sich nach und nach als geschlossene Front präsentierte. Hier machten die Grundstückseigentümer ihre Profite. Dahinter lag das Private. Lage und Ausstattung waren fortan die Merkmale, auf die sich der Preis von Stadtraum am Markt bezog. So bilde- 12 ten sich zwei charakteristische Bauweisen in der Stadt jener Zeit heraus: die geschlossene Häuserfront und die Einzelbauweise mit Garten. Da die Grundeigentümer in Paris nicht für die öffentlichen Aufwendungen in den Quartieren zahlen mussten und die Aufwendungen für die damalige Zeit astronomisch waren (Haussmann gab innerhalb von 17 Jahren ca. 2,5 Milliarden Franc aus), waren die stadtplanerischen Aktivitäten von den Steuereinnahmen und damit von der Konjunktur abhängig (vgl. Benevolo 1999, S.214). In den zwanzig Jahren starker Konjunktur (zwischen 1850 – 1870) wurden in ganz Europa einige Großprojekte realisiert: z.B. die Untergrundbahn in London oder der „Hobrecht-Plan“ in Berlin, verschiedene Bebauungspläne in Barcelona, Wien und Stockholm. „Diese Entwicklungen laufen bei aller Verschiedenheit der lokalen Verhältnisse nach dem Muster von Paris ab“ (Benevolo 1999, S.214). Nach der „großen Depression“ zwischen 1870 und 1890 wurden erneut große öffentliche Bauvorhaben umgesetzt. Darunter die Untergrundbahnen in Berlin, Paris und Wien, aber vor allem „die großen Programme des sozialen Wohnungsbaus, mit denen der spekulationsbedingte Nachfrageüberhang an Wohnraum beseitigt werden soll“ (Benevolo 1999, S.215). Suche nach einer neuen Stadt Der kapitalistisch begründete Zwang zur Rendite hatte nachhaltige Auswirkungen auf die Stadtentwicklung. Die ökonomische Leistungsfähigkeit des Einzelnen entschied darüber, in welchem urbanen Rahmen er sich bewegen konnte. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Städte und die Aufrechterhaltung ihrer Funktionen noch abhängig von den weniger wohlhabenden Schichten. Diese drängten sich in den „Mietskasernen“: hohe Bewohnerdichte sicherte die Rendite. Für die Bebauung mit öffentlichen Gebäuden bzw. Parkanlagen gab es keinen Platz. Flächenintensive Industriebetriebe wanderten an den Stadtrand (vgl. Benevolo 1999, S.226). Um dem entgegenzuwirken wurden Programme zum sozialen Wohnungsbau aufgelegt und mit öffentlichen Mitteln finanziert. Die Konzepte der Gartenstadt und der Industriestadt wurden miteinander verbunden. Planung soll Wildwuchs und öffentliche Finanzierung Immobilienspekulationen vorbeugen. „Das Ziel ist eine neue Stadt im weitesten Sinne des Wortes, ein urbaner Rahmen der dem Menschen im vollen Umfang gerecht wird“ (Benevolo 1999, S.227). 13 Die Bewegung „Neues Bauen“ trat 1924 auf den Plan. Das „Bauhaus“ (1919 von Walter Gropius gegründet) suchte nach einem alternativen Weg zur Gestaltung des menschlichen Lebensraumes: „Man möchte wieder einen Weg finden, den Lebensraum in verantwortbarer Weise, behutsam und gemeinschaftlich, gestalten und in diesem Sinne jede tendenziöse und künstliche `Modernität´ überwinden zu können“ (Benevolo 1999, S.229). So wie die Trennung von Stadt und Land aufgehoben wurde, so verband das Bauhaus Kunst mit Technik. Gleichzeitig sollte der Mensch wieder „das Maß aller Dinge“ sein. Für Le Corbusier hatte die Stadt verschiedene Funktionen zu erfüllen. Sie musste dem Menschen Wohnen, Arbeiten, Erholung, Bildung und Verkehr ermöglichen. Die Wohnung wird das wichtigste Element der Stadt. Seine Wohnblöcke mit Versorgungseinheiten, umgeben von Landschaft und Zugängen zu Verkehr unterschiedlicher Geschwindigkeit, sind berühmt geworden (vgl. Benevolo 1999, S229f). Die von ihm in Frankreich erbauten “Behausungsbehälter“ allerdings gelten als Beispiele für den Verlust jedes menschlichen Maßes (vgl. Hotzan 1994, S.187). Städtebau und Stadtentwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg In Deutschland dominierte nach dem Krieg der Wiederaufbau der zum Teil völlig zerstörten Städte. Erst in den 1960er Jahren begann eine Länder- bzw. Kreisplanung größeren Zuschnitts „Wirtschaftswunder“ sorgte Arbeitnehmermangel. Die (vgl. Benevolo 1999, S.238). Das bald für für Vollbeschäftigung und hohe Besiedlungsdichte erforderte keine Stadtneugründungen wie z.B. in Frankreich die „villes nouvelles“, die für Entlastung in den Ballungsräumen sorgen sollten (vgl. Benevolo 1999, S.237f). Die alten Städte wurden erweitert: Neubausiedlungen entstehen in den Stadtrandgebieten. Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus und der Wunsch nach dem Häuschen im Grünen, förderte eine Suburbanisierung an den Stadträndern. Die Zerstörung durch den Krieg, der Wunsch nach einem Neubeginn und die Notwendigkeit zur Schaffung von Wohnraum, ließ oftmals den Wert historischer Bauwerke als schützenswertes Kulturgut in den Hintergrund treten. Die Zerstörung alter Stadtteile rief in den 1970er Jahren den Denkmalschutz auf europäischer Ebene auf den Plan. Vor allem die historischen Städte Italiens waren in 14 Gefahr, einer unkontrollierten Entwicklung zum Opfer zu fallen. Man erkannte in den 1970er und 1980er Jahren, dass die Altstädte einen besonderen Schutz bedürfen. In ihnen sah man einen zusammenhängenden Organismus, der als Ganzes schützenswert sei. Zudem haben sie einen besonderen Charakter: „Sie sind bewohnte Gebilde, die über besondere Eigenschaften verfügen, die der modernen Stadt fehlen [...] Sie verkörpern die Kontinuität der Beziehung zwischen dem Bewohner und der baulichen Umgebung und damit letztlich die Versöhnung des Menschen mit seiner Umwelt“ (Benevolo 1999, S.242). Mit der Suburbanisierung setzte sich der Markt um die Innenstadtquartiere in Bewegung. Frei gewordene Innenstadtbereiche konnten neuer Nutzung zugeführt werden (z.B. als Bankenzentrum), was zu Spekulation und Preissteigerungen führte, was wiederum zur Verdrängung von Wohnraum und anderer Gebäudenutzungen führte. Das verstärkte die Abwanderung in die Randgebiete – eine Spirale setzte sich in Gang. Um diesen Kreislauf zu stoppen wurde einerseits ein planmäßiges Vorgehen der Verwaltung notwendig und andererseits eine umfassende Beteiligung der BürgerInnen der Stadt (vgl. Benevolo 1999, S.242f). 2.1.3 Stadtlandschaft in Deutschland heute Stadt- bzw. Gemeindetypen In Deutschland lassen sich folgende Stadt- bzw. Gemeindetypen unterscheiden: Großstädte (mehr als 100.000 Einwohner) Mittelstädte (weniger als 100.000 Einwohner) Kleinstädte (weniger als 20.000 Einwohner) Große Landgemeinden (mehr als 7.500 Einwohner) Kleine Landgemeinden (weniger als 7.500 Einwohner) Insgesamt leben in der Bundesrepublik 76,1% der Bevölkerung in Städten (siehe Tabelle_1). Fast die Hälfte davon (48,5%) lebt in Mittel- und Kleinstädten. Mehr als ein Viertel (27,7%) der Menschen in Deutschland leben in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern. 15 Tabelle_1: Stadt und Gemeindetypen (Quelle: BBR 2004, S.2) Ihre Arbeitsplätze (abhängige Beschäftigung) finden die meisten Menschen in Deutschland ebenfalls in der Stadt: rund 48% sind in Klein- bzw. Mittelstädten beschäftigt, etwas mehr als 37 % in einer Großstadt (vgl. BBR 2004). Tabelle_1 zeigt ein relativ statisches Bild der Verteilung der Menschen auf die zur Verfügung stehende Fläche. Die Städte in Deutschland sind jedoch in Bewegung. Schrumpfende und wachsende Städte Anhand von sechs Indikatoren ermittelt das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) kontinuierlich die Entwicklung der Städte in Deutschland quasi mehrdimensional. Zu den Indikatoren gehören: Bevölkerungsentwicklung, Gesamtwanderungssaldo, Arbeitsplatzentwicklung, durchschnittliche Arbeitslosenquote, durchschnittliche Realsteuerkraft und die durchschnittliche Kaufkraft je Einwohner. Es zeigt sich, dass in Ostdeutschland das Phänomen „schrumpfende Stadt“ (vier und mehr Indikatoren im unteren Quintil) massiv verbreitet ist, während im Westen die Städte wachsen. Laut den Angaben des BBR sind im Osten Deutschlands 53,5% aller Städte und Gemeinden mit einem Bevölkerungsanteil von 39% von einer Schrumpfung betroffen. Die wenigen Wachstumsgemeinden im Osten liegen im Berliner Umland und im Einzugsbereich einiger Großstädte wie Dresden, Leipzig, Magdeburg und Rostock. Karte_1 (siehe auch im Anhang mit höherer Auflösung) zeigt die Großflächigkeit des Phänomens im Osten. In Westdeutschland tritt Schrumpfung eher als ein lokales Problem in Erscheinung (vom Ruhrgebiet, Oberfranken und dem Saarland abgesehen). Hier dominieren die Stadtregionen Rhein-Main-Neckar, Hamburg, Stuttgart und München als Wachstumsräume (vgl. BBR 2004). 16 Karte_1: Schrumpfung und Wachstum der Städte in Deutschland (Quelle: BBR 2004, S.3) Bedeutungsverluste der Städte Vor allem in den Funktionsbereichen Wohnen, Arbeiten und Handel verlieren die Städte an Bedeutung – aber: fast ausschließlich im Osten der Bundesrepublik. Während sich im Westen im Bereich Handel moderate Verschiebungen von den Kernstädten in die großstadtnahen Kreise und ländlichen Räume abbilden lassen, verliert der Osten in allen Gebieten. Die Menschen wandern ab, sie finden keine Arbeit bzw. ziehen in Ballungsgebiete, um sich dort strategisch besser zu platzieren. Und das gilt auch im Westen. Wer kann, zieht ins Grüne. Allerdings nicht weil es, wie im Osten, Existenzen sichern hilft, sondern weil es sich halt „schöner wohnen“ lässt. Siedlungsstrukturelle Entwicklung Das Bundesamt (vgl. BBR 2004, S.8) sieht zwei Trends in der siedlungsstrukturellen Entwicklung: 17 Die Städte weiten sich aus, d.h. die Inanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke nimmt an den Stadträndern und im Umland zu. Vor allem in den neuen Bundesländern kommt es im Zuge der Schrumpfungsprozesse zu einer Abnahme der Besiedlungsdichte. Hauptsächlich Groß- und Mittelstädte sind von dieser Entwicklung betroffen. 2.1.4 Stadt und Wissenschaft: der soziologische Blick Begriff Die Soziologie als „Lehre von der Gesellschaft“ nimmt das Soziale in den Blick. Sie beschäftigt sich mit den „sozialen Subjekten, den sozialen Prozessen und den sozialen Katalysatoren“ (Endruweit 1989, S.656). Ihr Gegenstand ist demnach „die Gesellschaft in allen ihren internen und externen Bezügen. Ort des Soziologen `sind alle Plätze der Welt, wo Menschen mit Menschen zusammentreffen [...]´“ (Berger in Endruweit 1989, S.656). Max Weber definiert Soziologie als: "eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will. `Handeln´ soll dabei ein menschliches Verhalten (einerlei ob äußeres oder innerliches Tun, Unterlassen oder Dulden) heißen, wenn und insofern als der oder die Handelnde mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden. `Soziales´ Handeln aber soll ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist“ (Weber 1984, S.19). Im menschlichen Handeln verbindet sich so blankes Tun mit subjektivem Sinn. Und weiter: durch die Entscheidung unser Handeln auf unsere Mitmenschen auszurichten wird daraus soziales Handeln, bzw. es konstituiert sich das „Soziale“, indem das soziale Handeln in seinem Vollzug und seiner Wirkung erkennbar wird. Gegenstand der Stadtsoziologie Ein Ort der Begegnung von Menschen ist die Stadt. In der Stadt finden diese Begegnungen nicht nur in physisch-psychischer Form statt. Gleichwohl zeigt sich deren Manifestation als historisch-räumliches Gebilde quasi als einflussreiche Kulisse menschlicher Interaktion. So lässt sich Stadt auch als ein Ort verstehen, der aus der Geschichte in die Gegenwart wirkt, in der Gegenwart immer 18 wieder neu entsteht und als veränderbare Vision in die Zukunft getragen wird. Die Stadtsoziologie nimmt sich dieses Gegenstands an. Merkmale der Stadt Neben reinen statistischen Größen wie Bevölkerungszahl, Dichte, Ausdehnung und sozio-demographischen Merkmalen, zeigen sich aus stadtsoziologischer Perspektive bei der Betrachtung des Gebildes Stadt – im Gegensatz zum Land – Merkmale wie diese (vgl. Hartfiel 1982, S.725): Die Bevölkerungszahl ist so groß, dass allseitige persönliche Beziehungen und zumindest Bekanntschaften untereinander ausgeschlossen sind und soziale Distanz und Anonymität vorherrschen. Daraus folgt eine starke Polarisierung von privater und öffentlicher Sphäre im Leben der Bürger. Der Lebensinhalt wird in der Regel mit nicht-landwirtschaftlicher Arbeit verdient. Einkaufsstätten decken den größten Teil des Bedarfs der innerstädtischen und umliegenden Bevölkerung. Die Produktionsstätten arbeiten überwiegend für auswärtige Nachfrage. Dienst-, Handels-, Vermittlungs- und öffentliche Leistungen werden nicht nur von der städtischen Bevölkerung in Anspruch genommen. Ein Verkehrsnetz verbindet alle Wohn- und Arbeitsstätten, so dass relativ schnelle räumliche Mobilität zwischen den Bürgern ermöglicht wird. Wohn- und Arbeitsstätten sind in der Regel getrennt. Die Bevölkerung lebt überwiegend in der Zwei-Generationen-Familie. Es überwiegt eine rationale Lebenseinstellung, so dass es häufig zu technologischen und sozialen Innovationen kommt. Es besteht eine hohe soziale Mobilität – vertikal und horizontal – der Berufs- und Bildungspositionen zwischen den Generationen. Diese Beschreibung stellt vor allem einen möglichen Rahmen dar, in dem das flüchtige Bild einer Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt betrachtet werden kann. Stadt ist ein Prozess, eine konstante Veränderung. Daher wäre auch der Diskurs über die Stadt ein Merkmal, das obiger Beschreibung hinzugefügt werden könnte. Schließlich generiert ein solcher Diskurs Stadt im „Augenblick“ und schafft Schablonen für mögliche zukünftige Entwicklungen. Konzepte/Modelle/Theorien Bereits die Darstellung der Geschichte der europäischen Stadt hat gezeigt, dass sich das Konzept „Stadt“ seit der ersten Siedlung über die Epochen hinweg verändert hat. Ihre Entstehung und ihr Wandel liefern Anhaltspunkte für das Verstehen der menschlichen Vergesellschaftung. 19 Ferdinand Tönnies (1855 - 1936) Tönnies stellt die Begriffe “Gemeinschaft” und “Gesellschaft” in den Mittelpunkt seiner Theorie von gesellschaftlicher Entwicklung. Das Zeitalter der Gesellschaft hat das Zeitalter der Gemeinschaft abgelöst. Die Gemeinschaft ist von gefühlsmäßigen und engen sozialen Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Familie, zu Freunden, der Nachbarschaft und dem sozialen Netzwerk bestimmt. Diese emotionalen Verbindungen sind nicht-rational geprägt und entspringen dem „Wesenwillen“ der Beteiligten. Die Gesellschaft hingegen ist geprägt durch ein rationales strategisches Denken, dem „Kürwillen“. An die Stelle wesensbedingter und damit erwartbarer Verhaltensweisen, tritt das institutionalisierte Regulativ „Vertrag“. Vormals emotionale Beziehungen werden versachlicht, rationalisiert, individuell. Mit Hilfe dieses Begriffspaares lässt sich – wertfrei ausgedrückt - der Wandel der Organisation des Sozialen als einen über die Epochen hinweg beschrittenen Weg beschreiben: Von der sozial integrierenden Hausgemeinschaft frühester Zeit zum formalisiert-institutionalisierten sozialen System mit der Wohnung als Lebensmittelpunkt. Von einer geschlossenen Wirtschaftsform (Autarkie) zur freien Marktwirtschaft in Zeiten der Globalisierung. Von der Landwirtschaft über die arbeitsteilige Industrieproduktion zur Dienstleistung als primären Wirtschaftssektor. Vom Haus in der Natur über die Siedlung zur Stadt. Von der Tradition zur Modernität. Von der durch Standes- und Gildewesen reglementierten geschlossenen mittelalterlichen Stadt der Moral zu einer modernen grenzenlosen Stadt („Stadtregion“) mit unternehmerischer Freiheit. Tönnies sah in diesen Entwicklungslinien eher negative als positive Kräfte wirken. Seine Vorstellung der zukünftigen Gesellungsform bezog sich daher auf einen „genossenschaftlich-gemeinschaftlichen Sozialismus“ (Hartfiel 1982, S.766). Max Weber (1864 - 1920) Weber sieht in allem Handeln individuelle Entscheidungen nach Werten und Zielen. Das soziale Handeln steht im Mittelpunkt soziologischen Interesses. Dabei unterscheidet Weber idealtypisch – mit abnehmenden Grad der Rationa20 lität – zwischen zweckrationalem, wertrationalem, traditionalem und affektuellem Handeln (vgl. Weber 1984, S.44). Entsprechend seinem Vorgehen, soziologische Grundbegriffe als wissenschaftliche Diskursgrundlage zu definieren - z.B. entwickelt er u.a. die Idealtypen „Staat“, „Wirtschaft“, „Religion“, „Bürokratie“, „Recht“, „Macht“, „Herrschaft“,– arbeitet er auch an dem Idealtypus „Die Stadt“ (vgl. Eckardt 2004, S.12). Ihre Beschreibung wurde allerdings nicht vollendet. Die Stadtentwicklung zu Beginn des 20. Jahrhunderts ließ Weber einen Kulturvergleich zwischen asiatischen, orientalischen und europäischen Städten anstellen. Weber stellt fest: Die asiatischen Städte besaßen keine Autonomie. Ohne christlicher „Kommensalität“ (Abendmahlgedanke: Bereitschaft Brot zu teilen und zu essen) hätte sich kein mittelalterliches Stadtbürgertum bilden können. Hierin liegt der Bruch mit der Antike begründet. Diese „Verbrüderung“ war als Akt der Vergesellschaftung zu sehen, als ein Schöpfungsakt des Menschen: Geburt des Bürgertums durch Vertrag. Damit veränderte sich die Bedeutung und die Stellung des Einzelnen für und im Verband: „Nicht mehr die antike Wehrbarkeit begründete das Bürgerrecht, sondern die Bedeutung des Einzelnen für die Stadtökonomie in Friedenszeiten. Somit wurde die bürgerliche Partizipation mit der Teilhabe an einem rationalen Wirtschaftsbetrieb verknüpft“ (Eckhardt 2004, S.13). Weber beschreibt die Stadt in Europa als Produkt eines Rationalisierungsprozesses in Form eines „anstaltsmäßigen vergesellschafteten, mit besonderen und charakteristischen Organen ausgestatteten Verbandes von Bürgern“ (Weber in Eckhardt 2004, S.13). Ob die Analyse Webers zutrifft und der „Verbrüderung“ ein solcher Stellewert bei der Erklärung der europäischen Stadtentwicklung einzuräumen ist, wird bezweifelt. Auch sei die antike Stadtgesellschaft weit rationaler gestaltet gewesen, als Weber das zum damaligen Zeitpunkt wissen konnte. Wichtig ist die methodische Richtung, die Weber der Stadtsoziologie vorgab und gibt (vgl. Eckhardt 2004, S.14): Städtisches Leben ist nur aufgrund einer geschichtlichen Entwicklungsanalyse zu verstehen, und Städte sind vergleichend auf der Grundlage von analytischen Begriffen zu untersuchen (z.B. Rationalität, Herrschaft, Legitimität usw.). 21 Georg Simmel (1858-1918) Simmel, auch er neben Tönnies und Weber ein Mitbegründer der Soziologie in Deutschland, sieht Gesellschaft gekennzeichnet durch die Wechselwirkungen zwischen ihren Mitgliedern. In der modernen arbeitsteiligen Gesellschaft kann der Einzelne zwar „im Schnittpunkt“ verschiedener „sozialer Kreise“ existieren, was seine Möglichkeiten seine individuelle Persönlichkeit zu entfalten erweitert (vgl. Hartfiel 1982, S.683). Gleichzeitig sieht Simmel aber auch die Gefahr, dass „die Kluft zwischen der Entwicklung der Gesamtkultur und jener des Einzelmenschen immer größer wird“ (Hartfiel 1982, S.683). Das Großstadtleben konfrontiert den Einzelnen mit einer „außergewöhnlichen Erlebnisvielfalt“, die anregend wirke, aber auch die Gefahr einer nervlichen Erschöpfung (Neurasthenie) in sich trage. Die Folge sei eine unorientierte Sehnsucht und wirre Halt- und Rastlosigkeit (vgl. Eckardt 2004, S.15). Um sich zu schützen, bilden Großstadtbewohner eine „je individuelle Blasiertheit“ aus, womit sie sich von ihrer Umgebung distanzieren. Diese „Großstadtneurosen“ (Eckardt) können raumordnenden Charakter annehmen. Als problematische Beispiele nennt Simmel dabei die Ghettos von „Negern“ in Amerika und Menschen jüdischen Glaubens in Europa (Schtetl). Mit dieser Konzentration bestimmter Gruppen in der Stadt werde der Störung durch den „fremden Geruch“ abgeholfen (vgl. Eckardt 2004, S.15). Ferner weist Simmel darauf hin, dass durch die räumliche Gestalt der Großstadt ein übersteigerter Subjektivismus entstehe, der in seinen Auswirkungen auf die Persönlichkeit nicht durch das Gemeinschaftsleben aufgefangen werden kann. Das Verhältnis von Mensch zur Stadt und die Wahrnehmung dieser Verbindung, wirke sich auf die sozialen Beziehungen der Individuen aus. Der Mensch werde in der Stadt zu einem fragmentierten Wesen dessen Einheit – zumindest für einen bestimmbaren Zeitraum – durch das „Homogenitätsmoment der Mode“ wieder hergestellt werden kann. Je schneller bzw. nervöser ein Zeitalter, desto häufiger wechselt die Mode (vgl. Eckardt 2004, S.16). In der Lebensstil-Forschung spielt Simmel eine wichtige Rolle. Der Schlüsselbegriff dabei ist „Erleben“. Erleben wird durch Erkennen (geistige Ebene) und Erfahren (sinnliche Ebene) gebildet (Eckardt 2004, S.16). Die Frage nach den Grundlagen für die Gestaltung von „Erlebnisräumen“ hat daher einen beziehungsrelevanten Charakter. 22 „Chicago School“ Die legendäre „Chicago School“ beeinflusst seit den 1920er Jahren die Soziologie und damit alle Wissenschaften, die sich auf sie beziehen. Vor allem die sozialwissenschaftliche Methode wurde durch die „Chicago School“ befruchtet. Systematische Erkenntnisgewinnung durch den projektbezogenen Einsatz qualitativer und quantitativer Methoden kennzeichneten die Arbeit des Instituts, dessen Mitarbeiter die unterschiedlichsten Perspektiven in die wissenschaftliche Diskussion einbringen konnten. Robert E. Park gilt mit der Etablierung der „community studies“ an der „Chicago School“ als Begründer der Stadtsoziologie. Die Größe einer Stadt und das Verhältnis vom Bewohner zur genutzten Fläche: in diesem beschreibbaren Zusammenhang entsteht typisch städtisches Leben. Neben den Strukturen einer Stadt gerät auch die Psychologie in den Fokus der Wissenschaftler. Ausgangspunkt der Untersuchung ist dabei die Institution und ihre Entwicklung. Kontrolle und Macht sind dabei zentrale Kategorien (vgl. Eckardt 2004, S.21-23). Henri Lefèbvre (1901-1991) Für Lefèbvre zeigt sich im Städtischen die Auflösung des bekannten StadtLand-Gegensatzes zugunsten einer neuen Vergesellschaftungsform. In den 1960er Jahren, als die Innenstädte erneuert und an den Stadträndern Hochhaussiedlungen gebaut wurden, verlor die Stadt wesentliche Eigenschaften: Begegnungsorte (besonders mit dem Fremden) gingen verloren, genauso wie die Möglichkeit unterschiedliche Lebensstile zu „erleben“. Seine Analyse der Ursachen beinhaltete neben strukturell-gesellschaftlichen Aspekten auch die „Theorie der Zirkularität der Kapitalakkumulation“, die nach seiner Auffassung maßgeblichen Einfluss auf die Stadtentwicklung hat. Drei Kreisläufe greifen demnach ineinander: Im ersten Kreislauf wirken primäre Wirtschaftsprozesse wie Produktion, Verkauf, Investition. Diese können in verschiedenen Städten gleich sein. In der Immobilienwirtschaft wird ein zweiter Zyklus der Kapitalverwertung erschlossen, der sich aus der jeweiligen Spezifik der Städte ergibt und aus dem sich eigene soziale Interaktionen und ein spezifisches Raumverhalten (z.B. hinsichtlich der Nutzung) ergeben. Daraus folgt eine Differenz der Städte, die sie in einem dritten Zyklus, in unterschiedlichen Stadtbildern, ausdrückt. „`Urbanität´ wäre in diesem Sinne als die spezifische Aneig23 nung und Schaffung von Raumstrukturen durch ein jeweils differenziertes Raumverhalten innerhalb des zweiten Kapitalverwertungsprozesses zu verstehen“ (Eckhardt 2004, S.25). 2.1.5 Zusammenfassung „Stadt“ ist eng mit der Entwicklung der Menschheit verbunden bzw. die Entwicklung der Menschheit mit der Stadt. Aus dem Handelsplatz mit Schutzfunktion im Altertum hat sich ein multifunktionales Gebilde entwickelt. In der Bundesrepublik leben rund 76% der Menschen in Städten. Die Befragung von einigen wenigen Stadtbewohner hat ergeben, dass für alle Befragten „Stadt“ einen ambivalenten Charakter hat: die Vielfalt der Möglichkeiten bei gleichzeitiger Einschränkung individueller Lebensqualität. Maßgeblich für die Ausgestaltung der Stadt waren, das hat der historische Überblick gezeigt, die über die materielle Stadt hinausgehenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und deren Wandel in Verbindung mit den jeweiligen Interessen der (handlungsmächtigen) Bewohner innerhalb der Stadt. Ein Prozess der Abwägung zwischen Notwendigem und Möglichem begleitet die Stadt in ihrer Entwicklung seit Anbeginn. In der Antike fand der Mensch seine Vollendung in der Stadt. Während im Mittelalter die Stadt geordnetes Abbild der Machtverhältnisse war und alles und jeder seinen Platz hatte. In der Renaissance veränderte der Rückbezug auf die Antike und die moderne Wissenschaft das Stadtbild. Mit der Aufklärung und dem aufkommenden Kapitalismus erfuhr die Stadt eine Aufwertung. Einerseits wird die Hauptstadt, die Residenz, zur geplanten Repräsentantin der Staatsmacht. Zum anderen gerät die Stadt zum Machtquell einer aufsteigenden Klasse: dem Bürgertum. Die Stadt selbst wird käuflich, wird zur Immobilie. Und durch Spekulationsgeschäfte lässt sich künftig Geld verdienen. Bevölkerungswachstum und ein sprunghaft wachsender Bodenbedarf durch die industrielle Revolution machen es möglich. Die Arbeiterklasse, die den schnellen und großen Reichtum möglich macht, lebt in den „Mietskasernen“ der Großstädte unter meist erbärmlichen Umständen. Ein sozialer Wohnungsbau sollte dem seit dem 19. Jahrhundert regelmäßig abhelfen. Doch der Zusammenhang von Bodenpreisen und Bebauungs- bzw. Bewohnerdichte wurde bis heute, auch nicht mit 24 dem sozialen Wohnungsbau nach dem zweiten Weltkrieg in Westdeutschland, aufgebrochen. Aktuelle Phänomene in der Bundesrepublik, wie schrumpfende und wachsende Städte, die durch Wanderungsbewegungen der Bevölkerung und durch eine allgemeine demographische Entwicklung bedingt sind, lassen sich immer wieder in der Stadtgeschichte Europas finden. Das gilt auch für die Anpassungsleistungen, die die europäischen Städte in Anbetracht solcher Herausforderungen regelmäßig erbracht haben bzw. erbringen mussten. Für die Soziologie war „Stadt“ als Ort des Sozialen von großem Interesse. In der Stadt begegnen sich die Menschen. Hier wirken sie auf die Stadt und die Stadt auf sie ein. Für Tönnies zeigt sich mit der Stadt der Moderne der Übergang der Gesellschaft von der „Gemeinschaft“ hin zur „Gesellschaft“. Weber entwickelt seine Vorstellung an einem Kulturvergleich der Stadtidee entlang. Er zeigt auf, dass städtisches Leben – will man es verstehen – einer historischen Analyse bedarf. Und: Städtevergleiche erlauben nur Annäherungen mittels definierter Begriffe wie Rationalität, Herrschaft, Legitimität usw. Georg Simmel deutet in seiner Analyse auf den ambivalenten Charakter der (Groß-)“Stadt“ hin: einerseits erweitern sich die Möglichkeiten zur individuellen Persönlichkeitsentfaltung. Andererseits zeigen sich Anzeichen einer immer größer werdenden Kluft zwischen der Gesamtkultur und dem Einzelnen. Simmel deutet auf Separierungen in der Stadt hin (Ghettobildungen) und darauf, dass Stadt einen „übersteigerten Subjektivismus“ entstehen lasse, der sich in der Mode einen harmonisierenden, mit sich selbst versöhnenden Ausdruck suchte, der sich einer sich verändernden Zeit allerdings ständig anpassen müsse. Robert E. Park und die „chicago school“ nähert sich mittels systematischer Forschung dem Phänomen Stadt seit den 1920er Jahren an. Schließlich sieht Lefèbvre in der „Stadt“ eine neue Form menschlicher Vergesellschaftung, die vor allem durch Zyklen der Kapitalverwertung bestimmt wird, die zu einer, der jeweiligen Stadt eigenen, Raumstruktur gerinnen. 25 Die Realität eines Baus besteht nicht aus Mauern und Dach, sondern aus dem Raum, in dem man lebt. LAO TSE 2.2 Raum 2.2.1 Annäherung an den Begriff „Raum“ Perspektive Mensch Nach der Alltagsvorstellung ist der Mensch ein räumliches Wesen. Das heißt: seine Physis dehnt sich in drei Dimensionen aus und lässt sich entsprechend beschreiben. Als solcher war und ist der Mensch Orientierung für die Gestaltung seiner Umwelt.1 Aber der Mensch geht in seiner Existenz weit über das hinaus, was der Mittelwert einer Reihenvermessung von Körpermaßen zutage fördern kann. Kein Mensch existiert als identisches Abbild eines Anderen. Er verändert sich (in seinen Ausdehnungen) und mithin den ihn umgebenden Raum. Neben seiner biologischen Existenz, die ihn von seiner Umwelt in besonderem Maße abhängig macht, existiert der Mensch auch als psychisches Wesen, welches in der Regel eine historische Dimension (Mensch im Zeitverlauf) einschließt. Der aufrecht gehende Mensch nimmt die ihn umgebende Welt – genauso wie sich selbst – dreidimensional und in einem Zeitverlauf wahr. In welchem Verhältnis steht dieses bio-psycho-somatische Wesen, dieser menschlich-beseelte Körper zu seiner Umgebung? Phänomenologisch betrachtet werden fünf Dimensionen unterschieden, mit deren Hilfe ein gegebener Raum (z.B. ein Straßenzug) beschrieben werden kann (vgl. OFUBa): 1 physikalisch-geographischer Raum: Siehe beispielweise bei Michelangelo („Mensch-Kreis-Quadrat“) oder bei Le Corbusier („Modulor“). 26 Beschreibung mittels Zahlen und Maßeinheiten; der Raum wird „vermessen“. biologisch-körperlicher Raum: Individuell-einzigartige Wahrnehmung unseres Selbst in Raum und Zeit; wir bilden das Zentrum unseres eigenen Universums: die Welt kreist um uns. emotionaler Raum: Umwelt, die in diese Zonen eindringt – z.B. die Begegnung mit einem Artgenossen – löst Emotionen aus: Zuneigung, Angst, Gleichgültigkeit. Aber auch unser Handeln wird davon bestimmt, „wie nah uns etwas geht“: Liebe, Hass usw. biografischer Raum (Reichweite und Zeit): Auch bei gemeinsamer, zeitgleichen (gegenwärtigen) Nutzung z.B. öffentlicher Räume (Schwimmbad), bleibt jeder Mensch mit sich und seiner eigenen Geschichte vereint. Gleichzeitig befinden sich die Elemente seiner Umgebung in relativer Reichweite zu seinem Körper. Die Umgebung erschließt sich mittels sinnlicher Wahrnehmung, die individuell geprägt ist (sowohl hinsichtlich der Möglichkeiten der Wahrnehmung, z.B. blind/nicht blind, als auch hinsichtlich etwaiger Sinnzuschreibungen, z.B. ein Kunstwerk, schön/nicht schön). Weitere Faktoren: Welt als wiederherstellbarer Raum (z.B. Objektpermanenz; auf Vergangenheit bezogen), Welt als erreichbarer Raum (z.B. Motivation; auf Zukunft bezogen) gesellschaftlicher Raum: Dieser Raum beschreibt die Wirkmöglichkeiten menschlicher Existenz in unterschiedlichen Zonen (primäre Wirkzone: unmittelbares Handeln; sekundäre Wirkzone: Auswirkungen menschlichen Handelns) in Abhängigkeit von Zugang und Nutzbarmachung gesellschaftlicher und/oder individueller Ressourcen. Ohne viel Aufhebens bewegt sich der Mensch in einem kontinuierlichen und unbewegten Raum. Aber eigentlich bewegt sich der Mensch in einem Raumgebilde das - quasi übergangslos, geradezu gleitend oder stufenlos – seine äußeren Konstituenten verändert. Länge, Breite, Höhe – ändern sich pausenlos. Auch die Ausstattung dieses Umgebungsraums variiert – ständig. Andere Menschen, Gegenstände, Handlungen. Selbst vermeintliche Konstanten, wie z.B. die Architektur, verändert sich bei genauem hinsehen permanent. Der Mensch bewegt sich in einem gefüllten Raum, oder der Raum bewegt sich um ihn. Er greift aus diesem, für ihn aktuell präsenten Raum in Vergangenheit und Zukunft. Teile seiner Persönlichkeit kann in Echtzeit in völlig anderen geographischen oder gar virtuellen Räumen wirken (z.B. Tele-Arbeit): Mit einem „container“-Modell (Albert Einstein), einer Schachtel, in der „Dinge, Menschen und Handlungen“ geordnet und statisch abgebildet werden, können diese Entwicklungen nicht mehr erfasst werden. 27 Perspektive: Stadt Die Stadt stellt sich uns dar als bebautes Land und wird dadurch zu einem spezifischen Raum: Stadtraum eben. Von Planerseite dominiert beim Blick auf die Stadt im Allgemeinen ein naturwissenschaftliches Raumverständnis. Die Folge: „Das physikalische Raumbild blendet den funktionalen Kontext der gesellschaftlich-sozialen Inhalte des Raumes völlig aus, als ob der Raum unabhängig von den Menschen, die ihn organisieren und darin leben, eine eigenständige Kategorie sei“ (Schubert 2002, S.161). Für die dort herrschenden Wechselwirkungen zwischen räumlichen Gegebenheiten und sozialen Verhaltensweisen gibt es kaum Interesse bei Architektur und Stadtplanung, konstatiert Feldtkeller (vgl. Feldtkeller 2002, S.105). Noch immer überwiegt in den Köpfen die Trennung der städtischen Funktionen (Wohnen, Arbeiten, Versorgen, Freizeit und Verkehr), die den Alltag in „säuberlich getrennte Zonen einsortiert“ (Feldtkeller 2002, S.105). Stadt schließt keine Landschaft ein. Selbst vermeintlich freier Raum (Baulücken, Konversionsflächen usw.) gilt als „Ort“ (siehe unten) und ist damit als Teil eines Netzes erschlossen und entsprechend – zumindest in den äußeren Grenzen – festgelegt. Der physikalisch-geographische Blick des Architekten sieht im Raum daher etwas, das er mit Mitteln der Architektur gestalten kann (vgl. Feldtkeller 2002, S.105f). Vor dem Hintergrund des Zweckes, den eine Stadt zu erfüllen hat, erschließt sich ein sozialräumlicher Aspekt von gebautem Raum: Zweck einer Stadt ist „die baulich-räumliche Organisierung des gedeihlichen Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur“ (Feldtkeller 2002, S.107). Daraus leitet sich die Rolle der Architektur einer Stadt direkt ab: sie soll im Dienste dieses Zweckes wirken und ist damit von sozialräumlicher Bedeutung. 2.2.2 Raum als Produkt sozialen Handelns Bereits Henri Lefèbvre erkannte in seinen Analysen, dass der naturwissenschaftliche Raumbegriff die Realität in den Stadtquartieren nur ungenügend 28 abbildet. Mit seinem Text „Raum als soziales Produkt“ (1974) zeigt er, dass Raum immer sozial produziert ist und stellt fest: Raum ist zur Handelsware geworden: man kann ihn Kaufen, Verkaufen oder Tauschen. Daher gehört er in den Bereich der Produktion. Der Mensch, der in diesem Raum Seinesgleichen begegnet, formt ihn auf diese Weise. Die ökonomischen und politischen Kräfte einer Gesellschaft sind Grundlage für die Entstehung und Transformation von Raummustern. In seiner „Theorie des differentiellen Raums“ zeigt Lefèbvre, dass es „erkenntnistheoretisch keine nicht-räumliche soziale Realität [gibt], so wie es keinen nicht-sozialen Siedlungsraum geben kann“ (Schubert 2002, S.162). Der relationale Raumbegriff Die Idee des relationalen Raumes definiert Raum als eine „relationale (An)Ordnung von Menschen und sozialen Gütern“ (Löw zitiert nach OFUBb, S.2). Das, was Raum ausmacht, „Menschen und soziale Güter“, findet auf diese Weise bei der Betrachtung von Raum Berücksichtigung wobei der Begriff unter Einbeziehung der Beziehungen zwischen beiden in seiner Reichweite vergrößert wird (vgl. OFUBb, S.2). Wie lässt sich die Entstehung von Raum beschreiben? Entsprechend der Idee vom relationalen Raum sei dieser das Produkt menschlichen Verhaltens. In Anlehnung an Weber wäre entsprechend sozialer Raum das Produkt sozialen Handelns. Diese soziale Handlung besteht darin, „soziale Güter und/oder Menschen“ im Raum zu platzieren (vgl. OFUBb, S.3) und damit – relational - einen „subjektiv gemeinten Sinn“ zu verbinden. Dieses „spacing“, verstanden als „Errichten, Bauen und Positionierung“, hat als soziale Handlung auch symbolischen Charakter: Deutet das Platzieren bzw. Einrichten einer Beratungsstelle im Stadtteil in diesem Sinne nicht nur auf einen sozialen Raum hin, dessen BewohnerInnen Beratung benötigen (Hilfe und Etikettierung). Zudem weist diese Handlung auch auf die Handlungskompetenz der lokalen Politik bzw. Verwaltung hin (Definitionsmacht und Aktionsmacht): „Problem erkannt – Gefahr gebannt“. Raum wird durch soziales Handeln generiert, welches über den Akt des „spacing“ hinaus einen symbolischen Charakter hat, der auf den Raum zurück wirkt. 29 Dadurch wird deutlich, dass die Generierung von sozialem Raum auch das Ergebnis kognitiver Prozesse ist: „mittels Wahrnehmungs-, Erinnerungs- und Vorstellungsprozesse werden Güter und Menschen zu Räumen zusammengefasst“ (OFUBb, S.3). Ohne diese Fähigkeiten wäre der Mensch orientierungslos und sein Leben in Gefahr. Durch „spacing“ werden Orte geschaffen, die „einen bestimmten Platz bezeichnen, der konkret benennbar und einzigartig, unverwechselbar ist“ (OFUBb, S.4). Dieser Ort kann Kristallisationspunkt unterschiedlicher sozialer Raumkonstellationen sein: Menschen erleben mit anderen Menschen gemeinsam oder in bezug auf soziale Güter zu unterschiedlichen (Tages-)Zeiten ganz unterschiedliche Dinge. Die Konstante: der einzigartige Ort. Der soziale Raum: so unterschiedlich und individuell wie die Menschen die ihn erzeugen bzw. erleben. „Soziale Produktion urbaner Räume“ Mark Gottdiener lehnt sich in seinem Ansatz zur Erklärung der gegenwärtigen Situation in den Städten an die Theorie von Lefèbvre an. „Alle Raummuster und Designstile spiegeln danach den Status von historisch-zeitlichen Beziehungen zwischen Raum und der sozialen Organisation durch ökonomische, politische und kulturelle Werte wider“ (Schubert 2002, S.162). Im Einzelnen liefert Gottdieners Ansatz folgende Erklärungssätze (vgl. Schubert 2002, S.162f): Städtische Raummuster werden von Systemen der sozialen, gesellschaftlichen Organisation erzeugt. In diesem Prozess wirken ökonomische, politische und kulturelle Kräfte des Kapitalismus. Der Immobiliensektor hat eine Schlüsselfunktion bei der Vergegenständlichung der sozioökonomischen Entwicklung in Form von Raummustern in der Stadt. Die Raummuster sozialräumlicher Stadtorganisation bilden in ihrer Veränderung den Strukturwandel der sozioökonomischen Gesellschaftsorganisation ab. Die Entwicklung sozialräumlicher Muster ist neben Einflüssen des Privaten, durch nationalstaatliche Normen und Institutionen geprägt. Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern lassen sich damit erklären. Ideologien prägen die soziale Produktion von urbanem Raum, z.B. durch die kulturelle Fixierung auf ökonomisches Wachstum als prinzipielles Ziel für lokale Gebiete. Die wachsende Kluft zwischen Armut und Reichtum schlagen sich in den urbanen Raummustern nieder genauso wie die Externalisierung der Kosten des Stadtwachstums auf die Gebietskörperschaften. 30 Sozialer Raum aus städtebaulicher Sicht Architekten und Stadtplaner sehen demgegenüber im sozialen Raum einfach „einen physischen Raum (Außenraum oder Innenraum) mit ausgeprägter Eignung für das Zusammenleben von einander fremden Menschen; er vermittelt das Gefühl, eine gemeinsame Erfahrung zu machen etwa dadurch, dass unterschiedliche Menschen im selben Raum anwesend sind und visuellen Kontakt haben“ (Feldtkeller 2002, S.116). Der Begriff „sozialer Raum“ ist abzugrenzen von den Begriffen „öffentlicher Raum“ und „Freiraum“. 2.2.3 Raumprobleme: Herausforderungen verstehen Gesellschaftlicher Wandel hat, wie im Kapitel 2.1.2 dargestellt, „Stadt“ verändert. Die gegenwärtig beobachteten globalen Transformationsprozesse, verändern die Bedingungen des lokalen Lebens im sozialräumlichen Kontext fundamental. Hinzu kommen demographische Prozesse, Wanderungsbewegungen, konjunkturelle Einflüsse, die sich auf das struktur-funktionale System der Gesellschaft auswirken und über die Institutionen bis in die Lebenswelt des Einzelnen hineinreichen, die überwiegend in Städten leben. Daher wird über „die Krise der Städte“ (Heitmeyer 1998) gesprochen und über eine unter Umständen „bedrohte Stadtgesellschaft“ (Heitmeyer 2000). Segregation, Fragmentierung der Lebenswelten und Exklusionsprozesse werden konstatiert. Es wird gefragt, ob die Stadt ihrer Funktion als „robuste Integrationsmaschine“ (Häußermann 1995) noch nachkommen kann oder versagt (vgl. Heitmeyer 1998). Haben Verteilungs-, Rangordnungs- und Regelkonflikte, sowohl gesamtgesellschaftlich als auch gruppen- und gemeinschaftsspezifisch (Stichwort: „Parallelgesellschaften“), zugenommen und gelingt es, die Ambivalenz der Konflikte zu erfassen und als Chance zur positiven Veränderung zu nutzen? Die Zeit wird es zeigen. Inklusion – Exklusion Die Industrialisierung im 18. Jahrhundert veränderte das Phänomen „Stadt“ grundlegend. Der von der Moderne erzeugte Bedarf an Verdichtung funktionaler Systeme ließ eine neue Form gesellschaftlicher Verräumlichung sozialer Interaktionen entstehen (vgl. Eckardt 2004, S.27f): die Industriestadt. Sie war das Ergebnis rationalisierter Prozesse in Produktion und Verwaltung unter den Be31 dingungen des Kapitalismus. Stadt leistete dabei die Einbindung des Einzelnen in unterschiedliche soziale Einheiten, die Luhmann in seiner Systemtheorie als „Inklusion“ bezeichnet, wobei diese nur zeitlich begrenzt und symbolisch erfolgt (vgl. Eckard 2004, S.28). In neueren systemtheoretischen Arbeiten wird „Stadt als eine besondere Form der Verdichtung von Inklusionsangeboten“ definiert, „die sowohl als Möglichkeit wie auch als sozialer Zwang zur Integration in die moderne Gesellschaft dienen“ (Eckardt 2004, S.28). Um diese Angebote zu nutzen, ist der Einzelne einem hohen physischen und psychischen Anpassungsdruck im Stadtraum ausgesetzt. Anpassung wurde möglich, da die verschiedenen Funktionssysteme der Stadt inhaltlich-zeitlich aufeinander bezogen waren (Stadt als „Synchronisationsmaschine“) (vgl. Eckardt 2004, S.28f). Die Systemtheorie sieht die Inklusionsprozesse nur für jene als wirksam an, die nicht von ihnen ausgeschlossen sind. Die Proletarisierung in der arbeitsteiligen Industriestadt stellt sich also dar als der fortschreitende Ausschluss einer oder mehrerer Gruppen an der urbanen Integration. „Exklusion als Ausdruck sozialer Ungleichheit“, gehöre, so Luhmann, zum System „Stadt“. Soziale Ungleichheit repräsentiert „vertikale Differenzierungen“, die nicht mit den „funktionalen Differenzierungen“ verschiedener Systeme verwechselt werden dürfen und zu diesen in keinem theoretischen Zusammenhang stehen (vgl. Eckardt 2004, S.30). Da soziale Ungleichheiten jedoch kommunikativ thematisier- und verhandelbar sind, ermöglicht es die Entwicklung adäquater Kommunikationsformen, mit ihnen sozial verträglich umzugehen. „In der modernen Großstadt war es gelungen, diese Kommunikationsformen zwischen unterschiedlichen Systemen zu organisieren“ (Eckardt 2004, S.30). Das Konzept der sozial gemischten Stadt basiert auf der Idee, die kommunikative Nähe zwischen den Systemen zu nutzen, um integrativ wirkende Kommunikationsformen zu finden. „Politik und Ökonomie haben sich in der Stadt oftmals zu kompensatorischen Aushandlungen eingefunden, die mit der Bereitstellung sozialer Infrastruktur gegen die Folgen der städtischen Armut umgesetzt wurden“ (Eckardt 2004, S.30f). Differenzierung Für Emile Durkheim „ergibt sich das Wesen der Moderne aus der Dynamik der Differenzierung“ (Eckardt 2004, S.31). Das Konzept der Differenzierung zeigt die Unterschiede zwischen nicht-arbeitsteiligen und arbeitsteiligen Gesellschaf32 ten auf. Wenig differenzierte Gesellschaften verfügen über „mechanische Solidarität“. Integration erfolgt hier über breit geteilte Anschauungen und Gefühle. Störungen, d.h. Verstöße gegen diesen Wertekanon, werden repressiv beantwortet. In modernen Gesellschaften herrscht „organische Solidarität“ vor. Auch hier werden Werte und Gefühle von den Gesellschaftsmitgliedern geteilt, allerdings in reduziertem Maße. Zudem regeln Verträge die Beziehungen der Mitglieder zueinander. Motiviert zur Differenzierung wird eine Gesellschaft durch z.B. strukturelle Veränderungen. Mit Hilfe der Differenzierung soll gesellschaftliche Solidarität erhalten werden. Diese wird im „Kollektivbewußtsein“ gleichsam aufbewahrt und abrufbar (vgl. Hartfiel 1982, S.150f). Versagt dieser Normenund Wertebehälter, so kann eine Gesellschaft in den Zustand der „Anomie“ (Durkheim) fallen. „Mangelnde Integration und die Störung der kollektiven Ordnung machen nicht nur die Gesellschaft, sondern auch den Einzelnen krank“ (Eckhardt 2004, S.41). Das Auseinanderfallen von eigenen Bedürfnissen und realen Möglichkeiten zur Befriedigung derselben, kann zum (sozialen) Selbstmord führen. Segregation Ganz allgemein beschreibt der Begriff der Segregation ein (bedenkliches) „Auseinanderdriften der Lebens- und Wertewelten“ einer Gesellschaft im Zusammenhang mit einer „sozial-hierarchischen Differenzierung“ bei gleichzeitig „zunehmender Abschottung“ bzw. Isolation sozialer Milieus1 (vgl. OFUBd, S.14). Begonnen hat die Erforschung der Ursachen von räumlichen Separationsphänomenen mit der Untersuchung “residenzieller Segregation” durch die Wissenschaft der Stadtgeografie. Die „Chicago School“ entwickelte ein statistisches Verfahren, das die räumliche Verteilung sozialer Gruppen in einem definierten Gebiet sichtbar werden ließ. So wurden Aussagen über die unsichtbaren Grenzverläufe zwischen sozialer Gruppen innerhalb der Städte möglich. Der „Social Area Analysis“2 gelang so eine „multidimensionale Beschreibung von Stadtteilen und die Manifestation sozialer Ungleichheiten in der Stadt“ (Eckardt 2004, S.35). Heitmeyer (1998, S.446f) geht in seiner Analyse der Segregati1 Der Milieu-Begriff dient zur Beschreibung sozialer Ungleichheit im sozialen Raum. Zur Vertiefung sei auf die Arbeiten von z.B. Pierre Bourdieu und Michael Vester verwiesen. 2 „Sozialraumanalyse“. Einen guten Überblick über den Stand der methodologischen Entwicklung dieses Instruments liefert Riege (2002). 33 onsprozesse über die des Wohnorts hinaus. Gleichwohl sieht er in der residentiellen Segregation den „schwerwiegendsten Ausdruck von Desintegration im städtischen Kontext“ (Heitmeyer 1998, S.446) und konkretisiert: „Als Verräumlichung sozialer Ungleichheit bedeutet sie unterschiedliche Chancen der Nutzung und Zugangsmöglichkeiten zu Orten, Eigentum etc. sowie der Definitionsmacht über die Ästhetisierung und Symbolisierung von spezifischen Orten“ (Heitmeyer 1998, S.446). Exklusion Das Exklusionsmodell verschiebt den Fokus der bisherigen Milieu- und Lebensstilforschung auf jene soziale Gruppen, „die durch eine verhärtete und langfristig verfestigte Segregation unfreiwillig räumlich und sozial ausgeschlossen werden“ (Eckhardt 2004, S.38). Das Modell beschreibt eine Veränderung in der Qualität sozialer Ungleichheit: den Ausschluss aus mehreren sozialen Räumen als kommulativer Prozess. Dabei spielt die ökonomische Leistungsfähigkeit eine entscheidende Rolle. Der Verlust des Arbeitsplatzes zieht den Verlust von kultureller Partizipation nach sich; Stigmatisierungsprozesse münden in soziale Isolation. Hinzu kommen die Fähigkeiten und Möglichkeiten des Einzelnen und der Gemeinschaft, in der er sich sozial verhält, auf veränderte (z.B. ökonomischen) Rahmenbedingungen mit adäquaten Verhaltensmuster zu reagieren.1 Inwieweit sich aus diesen Prozessen eine neue „urban underclass“ formiert oder die Betroffenen in Isolation verschwinden, scheint noch nicht entschieden. Anomie Neben dem von Durkheim geprägten Anomie-Begriff (siehe Kapitel 2.1.4) verwendet die Sozialpsychologie hinsichtlich der krisenhaften Prozesse in den Städten den Begriff als Beschreibung eines Gefühls „der politischen und sozialen Machtlosigkeit“ bei den Betroffenen. Diese werden von den Eliten in ihren Bedürfnissen nicht wahr oder ernst genommen. Diesem Erlebnis der Ohnmacht steht die Wahrnehmung gesellschafts-verändernder Transformationen gegenüber. Eine pessimistische Zukunftsperspektive ist die Folge. Anomie scheint 1 Die Studie von Wiliam J. Wilson aus dem Jahre 1997 zeigt für „Ghettos“ in den USA Zusammenhänge zwischen strukturellen und habituellen Faktoren: fordistische Arbeitermentalität passt nicht zu postfordistischen Dienstleistungserfordernissen. 34 menschenfeindliche Haltungen und Handlungen (Rassismus, Xenophobie, Antisemitismus, Sexismus usw.) zu begünstigen und damit den sozialen Zusammenhalt der Stadt als sozialen Raum zu gefährden (vgl. Eckardt 2004, S.43). 2.2.4 Zusammenfassung „Raum“ umgibt den Menschen in mehreren Dimensionen. Der Mensch lebt darin, gestaltet ihn. Und: „Raum“ wirkt auf den Menschen zurück. Jeder Mensch lebt einzigartig in und mit seinen räumlichen Bezügen. Er generiert seinen Raum mittels sozialem Handeln. Er platziert soziale Güter oder Menschen in seinem, ihn umgebenden Raum („Spacing“) und verbindet damit einen Sinn (Weber). Der Mensch erschafft bzw. erlebt Räume, indem er für ihn sinnvolle Orte mittels Symbole generiert bzw. erkennt und dann zu einem Raumbild vernetzt. Sozialer Raum kann so auch als Ergebnis kognitiver Prozesse verstanden werden: ohne die Fähigkeit des Menschen wahrzunehmen, zu erinnern oder sich etwas vorzustellen, gäbe es keinen sozialen Raum und der Mensch wäre orientierungslos. Der Prozess der Schaffung von urbanen sozialen Räumen erfolgt ständig und wird wesentlich von den gesellschaftlichen Systemen (Wirtschaft, Politik, Kultur) geprägt. Daher spiegeln die beobachtbaren sozialen Raummuster den gesellschaftlichen Wandel wider. Diese Veränderungen in den Raummustern lassen sich mit Begriffen beschreiben wie: Inklusion, Exklusion, Differenzierung, Segregation und Anomie. 35 Der Begriff des Sozialen ist durch die idealistische Identitätsphilosophie, durch Psychologisierung, Entpolitisierung und Emotionalisierung so sehr belastet, dass man ihn nicht mehr benutzen sollte. Thomas Wilhelm 2.3 „sozial“ - Stadt als sozialer Raum 2.3.1 Annäherung an den Begriff „sozial“ Wie wir oben gesehen haben sind urbane Räume immer sozial konstruiert, also das Produkt menschlicher Aushandlungsprozesse. Es wurde gezeigt, dass Max Weber das Adjektiv „sozial“ auf eine bestimmte Form menschlichen Verhaltens bezieht: es soll dann soziales Handeln heißen, wenn es von einem subjektiven Sinn getragen ist, der im Verlauf bestehen bleibt und sich in seinem Vollzug auf den Anderen, den Sozialpartner, bezieht. Folgte man der Aussage von Wilhelm, so könnte hier auf eine Beschäftigung mit Wurzeln und Inhalt des Begriffs verzichtet werden. Da uns der Begriff hier nicht mit seinen politischen Dimensionen interessiert, soll versucht werden ihm so weit inhaltlich nachzuspüren, dass er uns im Folgenden eher nützt als stört. Etymologie Nachfolgend zwei Herkunftsbeschreibungen des Adjektivs „sozial“, die die Mehrdimensionalität des Begriffs verdeutlichen: Duden, Herkunftswörterbuch: „»das Zusammenleben der Menschen in Staat und Gesellschaft betreffend; auf die menschliche Gemeinschaft bezogen; gesellschaftlich; gemeinnützig; wohltätig; menschlich«: Das Adjektiv wurde im 18.Jh. – wohl unter dem Einfluss von entsprechend frz. social – aus gleichbed. lat. socialis entlehnt. Das zugrunde liegende Stammwort lat. cocius gemeinsam (Adjektiv); Genosse, Gefährte, Teilnehmer (Substantiv) gehört vermutlich mit einer ursprünglichen Bed. mitgehend; Gefolgsmann zum Stamm von lat. sequi (nach) folgend, begleiten“ (Duden 2001, S.778f). Etymologisches Wörterbuch (v. F. Kluge):“»Sozial Adjektiv Socialis gesellschaftlich (zu socius Genosse) ergibt französisch social, das durch Rousseaus Contrat social 1762 zum Schlagwort wird«“ (Schilling 1997, S.255). Der Duden gibt uns mehrere Hinweise: zum einen liefert er einen Begriffsbezug („das Zusammenleben der Menschen betreffend“); zum anderen die Beschrei36 bung einer positiven Handlungsqualität („gesellschaftlich, gemeinnützig, wohltätig, menschlich“). Diese Handlungsqualität steht vor dem Hintergrund der ursprünglichen Wortbedeutung von „sozial“ als einem dynamischen Akt des Beisammenseins: das Folgen oder Begleiten. Genau diese Dynamik spiegelt auch Kluges Beschreibung wider: sie zeigt einerseits den Bezug auf die Gesellschaft, und andererseits zusätzlich die politische Dimension des Sozialen unter Bezugnahme auf Rousseau und den Vergesellschaftungsakt durch den „Contrat social“. Der Begriff „Gesellschaft“ geht zurück auf das mittelhochdeutsche Wort Geselle (Gefährte) und beschreibt vor allem die räumliche-statische Dimension menschlichen Zusammenseins: das Beisammensein mehrerer Gefährten in demselben Saal (Wohnraum) (vgl. Duden 2001, S.272). Vier Aspekte des Sozialen Nach der Analyse von Mühlum (vgl. Schilling 1997, S.256) lassen sich mindestens vier Aspekte des „Sozialen“ beobachten: 1) „Sozial“ im Sinne von: auf Andere, auf die Gesellschaft bezogen im Gegensatz zu individualistisch, den Menschen als Einzelnen betreffend. 2) „Sozial“ im Sinne von zwischenmenschlichem Verhalten, das sinnhaft auf den Mitmenschen bezogen ist. 3) „Sozial“ im Sinne von Merkmalen oder Verhaltensweisen, die von der Gesellschaft positiv bewertet und erwünscht sind im Gegensatz zu asozialem oder gesellschaftsfeindlichem Verhalten. 4) „Sozial“ im Sinne von sozialer Gerechtigkeit als normative, handlungsleitende Idee. 2.3.2 Soziales Problem Gesellschaft als System Modellhaft kann Gesellschaft – und damit soll hier über das statische Verständnis des Mittelhochdeutschen hinausgegangen werden - als ein spezieller Organismus verstanden werden, der sich während seiner Existenz mit den sich ihm stellenden Problemen auf spezifische Weise auseinander setzt und sich dadurch auf einzigartige Art und Weise konstituiert. Hinter dieser Vorstellung von Gesellschaft steht die Idee eines Gebildes (System), das sich in einem fortwährenden Veränderungsprozess befindet und mit inneren bzw. äußeren Störungen auf spezifische Art und Weise umgeht, was 37 sich wiederum auf das Gebilde auswirkt (Autopoiese), dessen (Handlungs-)Ziel in der Regel der Selbsterhalt ist. Problem als Konstrukt Innere bzw. äußere Störungen werden dann zu Problemen1, wenn sie z.B. wahrgenommen werden als „Behinderungen auf dem Weg zum Erreichen eines Zieles“. Das, was wir als Individuen wahrnehmen ist allerdings unmittelbar mit dem verbunden, was wir Wirklichkeit nennen. Und diese ist individuell konstruiert. Folgen wir dieser konstruktivistischen Position, so entsteht für uns erst dann ein Problem, wenn wir es als solches wahrnehmen, und das wiederum ist abhängig von unserer Wahrnehmungsstruktur (Strukturdeterminiertheit von Systemen). Öffentlich – privat Übertragen wir diese Vorstellung von Problemkonstruktion auf eine größere Einheit - z.B. auf Gesellschaft2 – so wird ein bestimmtes Phänomen erst dann zum (sozialen) Problem, wenn es als solches auf gesellschaftlicher Ebene definiert wird. Das verdeutlicht die politische Dimension: „Auf der Schablone einer als verbindlich angesetzten Werteskala werden bestimmte (gesellschaftliche) Verhältnisse als defizitär qualifiziert und zwar so, dass zugleich von der Gesellschaft Abhilfe gefordert wird. Der Begriff [soziales Problem] ist also seinem Sinn nach nicht primär-analytisch, sondern präskriptiv oder provokativ. Er soll im gesellschaftlichen Kontext veränderndes, korrigierendes Handeln hervorrufen, und das ist etwas Politisches; der Begriff `soziales Problem´ ist ein politisches Instrument“ (Sidler in: Schilling 1997, S.258). Man könnte auch sagen: ein soziales Problem entsteht dann, wenn aus einem privaten Problem ein öffentliches Problem geworden ist. Die Kriterien, die bestimmen was öffentlich und was privat ist, unterliegen dem Einfluss des gesellschaftlichen Wandels. So war z.B. die Altersvorsorge vor der Einführung der 1 Obwohl der Problembegriff im systemischen Denken hinter dem Begriff der Lösungsorientierung zurücktritt, soll er hier verwendet werden. Er hat dabei vor allem die Funktion Aufmerksamkeit für die Herausforderungen zu schaffen, vor denen Gesellschaft heute steht. 2 Gesellschaft wird hier im demokratisch-pluralistischen Sinne verstanden und – zunächst idealtypisch – eine gleiche Wahrscheinlichkeit zur Thematisierung sozialer Probleme durch alle gesellschaftlichen Gruppen unterstellt. 38 Sozialversicherung ausschließlich ein privates Problem. Seither ist sie Aufgabe des Wohlfahrtsstaates und damit ein öffentliches Problem. Mit der Krise des Sozialstaates verweist die Gesellschaft das Problem nun wieder (in Teilen) zurück ins Private (vgl. Schilling 1997, S.259). Entscheidend bleibt in diesem Kontext der Adressat des Hilfeappells: so lange das, den Einzelnen umgebende soziale Netzwerk mit der Lösung eines (durchaus sozialen) Problems fertig wird, haben wir es mit einem privaten Problem zu tun. Die Ausbildung bzw. der Erhalt dieser Fähigkeit stellt im übrigen ein erklärtes Ziel der Gesellschaft dar („Hilfe zur Selbsthilfe“). Erst dann, wenn der Staat mit seinen Institutionen oder die Gesellschaft als Ganzes zum Adressaten des Hilfeappells wird und diese den Appell für sich als handlungsleitend anerkennen – sei es durch Skandalisierung mit dem Ziel der Systemanpassung oder durch Bezugnahme auf bestehende Rechte – entsteht ein soziales Problem im gesellschaftlichen Sinne. Soziales Problem als institutionell definiertes Problem Soziale Probleme lassen sich also definieren als: „Phänomene, die Einzelne oder Gruppen in ihrer Lebenssituation beeinträchtigen, öffentlich als veränderungsbedürftig definiert und zum Gegenstand spezieller Programme und Maßnahmen gemacht werden“ (Schilling 1997, S.260). Ferner beginnen, wie bereits angeklungen, soziale Probleme erst dann zu existieren bzw. institutionell handlungsrelevant zu werden, „wenn sie von öffentlich wirksamen Personen oder Institutionen als solche definiert werden. Damit wird gleichzeitig gesagt, dass die Definition sozialer Probleme von wirtschaftlichen, kulturellen und politisch-administrativen Strukturen abhängt“ (Schilling 1997, S.261). Problemursache: soziale Ungleichheit Soziale Ungleichheit in einer ungünstigen Konstellation und Aggregation kann als „Ursache“, also einem der öffentlichen Definition als soziales Problem quasi vorgeschaltetes Phänomen, gelten. Soziale Ungleichheit soll hier die qualitativ und quantitativ unterschiedliche Ausstattung des Einzelnen, Gruppen oder Gesellschaften mit Ressourcen bedeuten. Diese Ungleichheit in der Ressourcenverteilung macht sich in einem messbaren „mehr“ oder „weniger“ deutlich. Staub-Bernasconi konstatiert einen signifikanten Zusammenhang zwischen 39 vorhandenen Ausstattungsdefiziten und dem Auftreten von sozialen Problemen. Als auslösende Defizite identifiziert sie (vgl. Schilling 1997, S.260): „nicht erfüllte Grundbedürfnisse und Wünsche“: unzureichende Ausstattung gegenüber überdurchschnittlicher Ausstattung von Menschen oder Gruppen; „asymmetrisches Geben und Nehmen“: ungleichberechtigte Austauschbeziehungen; „behindernde Machtverhältnisse“; „ethisch-moralische Dilemmata und Asymmetrie im Hinblick auf die Ausbalancierung von Rechten und Pflichten gegenüber sich selbst und anderen Gesellschaftsmitgliedern“. Als Beispiel für ein soziales Problem, das auf ungleicher Ressourcenverteilung beruht, kann „Armut“ angesehen werden. Aber auch Arbeitslosigkeit, Diskriminierung sozialer Gruppen, Gewalt, Kriminalität, Terrorismus und der Zerfall der Städte sind, neben einigen anderen, als soziale Probleme zu benennen. 2.3.3 Zusammenfassung Dem Adjektiv „sozial“ lassen sich verschiedene Dimensionen zuschreiben: einerseits bezieht es sich auf das Zusammenleben der Menschen, auf deren „sinnhafte“ Interaktionen. Und zum anderen enthält es eine positive Handlungsqualität. Menschen verhalten sich in ihrem Umgang zueinander sozial, wenn sie sich auf positive Art und Weise aufeinander beziehen. Das deutet auf gesellschaftlich erwünschtes Verhalten hin und auf den normativen Charakter, den das „Soziale“ hat bzw. haben kann. Ein soziales Problem wird verstanden als eine innere oder äußere Störung, die als solche institutionell identifiziert und damit öffentlich wurde und sich in ihrer Ursache bzw. Folge auf die Interaktion von Menschen bezieht. Meist entstehen soziale Probleme im Zusammenhang von sozialen Ungleichheiten z.B. in der Verteilung bzw. dem Zugang zu individuellen oder kollektiven Ressourcen. Als soziale Probleme gelten Armut, Arbeitslosigkeit, Gewalt, Diskriminierungen usw. 40