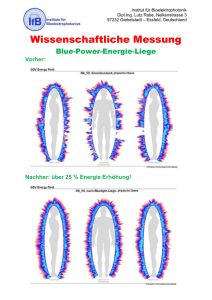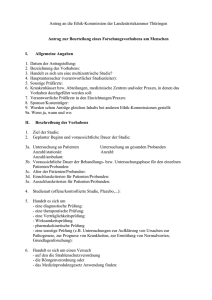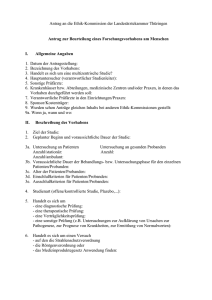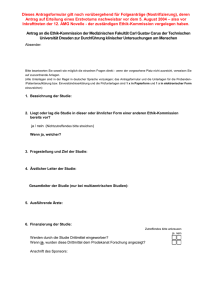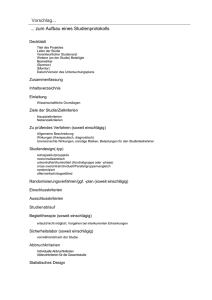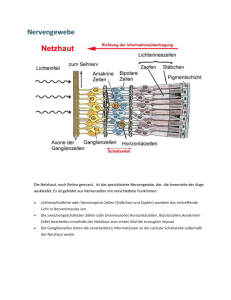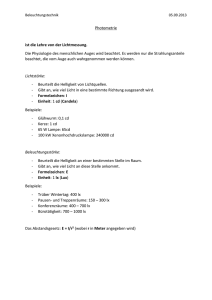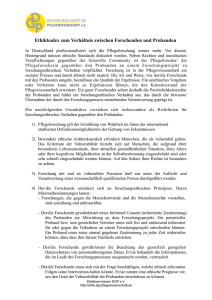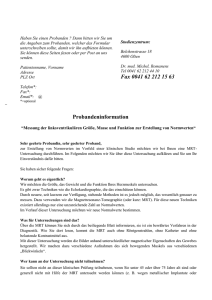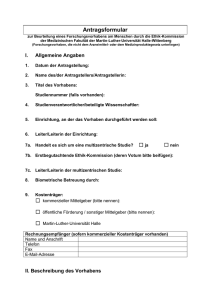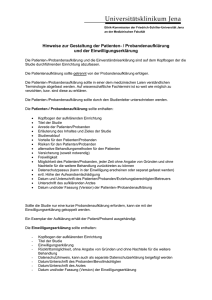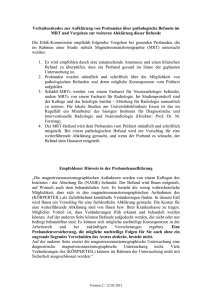Untitled - Logo IAW RWTH Aachen
Werbung
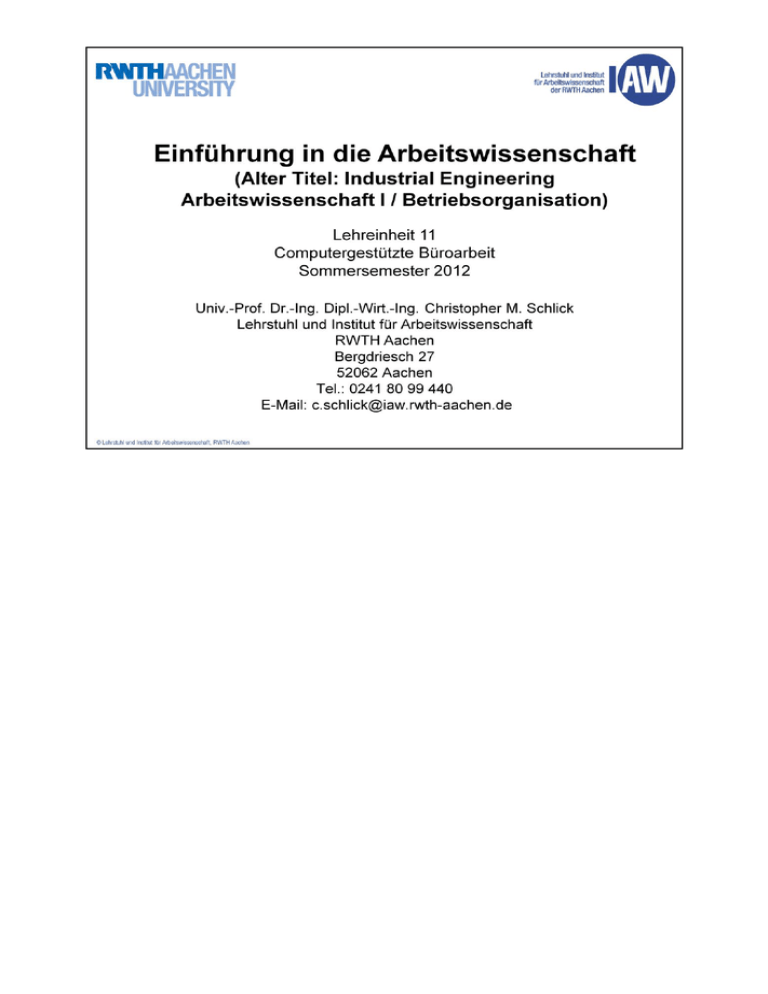
Immer mehr Deutsche arbeiten am Computer. Zum ersten Mal hat 2001 der Anteil der Beschäftigten, die im Job einen PC benutzen, die Marke von 50 Prozent erreicht (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien, kurz BITKOM). Mit einem Wert von 60 Prozent liegt Deutschland heute deutlich über dem EUDurchschnitt von 50 Prozent (Eurostat). Dahinter folgen Länder wie Großbritannien (55 Prozent) und Frankreich (54 Prozent). „Die jüngsten Entwicklungen sind ein gutes Signal für die technologische Modernisierung in Deutschland. Das gilt für Wirtschaft und Verwaltung gleichermaßen“ (BITKOM). Weil gleichzeitig fast alle Arbeitsplatz-Computer mit dem Internet verbunden sind, verbessern sich auch die Voraussetzungen für den elektronischen Handel und computergestützte Dienstleistungen. Im Jahr 2009 lag der prozentuale Anteil der Beschäftigten, die mindestens einmal pro Woche bei ihrer täglichen Arbeit an das Internet angeschlossene Computer nutzen, bei 46 Prozent (Vergleich 2003: 29 Prozent). Die Europäische Statistikbehörde Eurostat hat bei ihrer Erhebung Unternehmen berücksichtigt, die mindestens zehn Beschäftigte haben. Ausgenommen ist der Bankensektor. Karpal-Tunnel-Syndrom Der wohl wichtigste Nerv der Hand, der Nervus Medianus, läuft am Handgelenk zusammen mit allen Fingerbeugesehnen in einer Art Tunnel, dessen Dach durch ein querverlaufendes Band gebildet wird. Der Nervus Medianus versorgt den Daumen, den Zeige- und den Mittelfinger sowie den daumenseitigen Anteil des Ringfingers mit Gefühl, zusätzlich hat er noch motorische Anteile zur Versorgung der Daumenballenmuskulatur. Beim Karpal-Tunnel-Syndrom wird dieser Nerv unterhalb dieses Karpalbandes eingeengt. Die Hauptsymptome sind Missempfindungen (Kribbeln, Taubheitsgefühl) mit Einschlafen der Finger vom Daumen bis zum Ringfinger. Insbesondere nachts und bei Ruhe treten Schmerzen auf. Das Karpal Tunnel Syndrom kann sich langfristig zu einem sog. Repetitive Strain Injury Syndrom (RSI) entwickeln. Hierbei handelt sich um Gewebeveränderungen und Narbenbildungen, die durch kleinste Verletzungen entstehen. Diese Verletzungen führen zunächst zu Symptomen und können bei rechtzeitiger Behandlung wieder ausheilen. Bei chronischer Schädigung entsteht das eigentliche RSI, das einen chronischen Verlauf zeigt. Die RSI Symptome kommen vor allem bei Menschen vor, die sehr viel mit dem Computer arbeiten. In erster Linie sind Vielschreiber (Textverarbeitung o. ä.) betroffen. Insbesondere Bewegungsabläufe, wie Tasten- oder Maus-Clicks, die sich wiederholen, werden mitverantwortlich gemacht. Nach Schurr (2007) kann man zwischen Steh-Sitz-Dynamik und Sitz-Steh-Dynamik unterscheiden. Sitz-Steh-Dynamik beschreibt den Wechsel vom Sitzen zum Stehen mit dem Ziel, die einseitige Belastung der Wirbelsäule durch langes Sitzen zu vermeiden. Die Sitz-StehDynamik will also einen durch Dauersitzen geprägten Arbeitsstil durch den Wechsel zwischen Sitzen und Stehen zugunsten von mehr Bewegung verändern. Steh-Sitz-Dynamik dagegen beinhaltet den Wechsel vom Stehen zum Sitzen mit dem Ziel die einseitige Belastung durch langes Stehen zu vermeiden. Steh-Sitz-Dynamik will demnach einen durch Dauerstehen geprägten Arbeitsstil durch den Wechsel zwischen Stehen und Sitzen zugunsten von mehr Bewegung verändern. In einer Studien mit 90 Probanden zwischen 20 und 75 Jahren wurden verschiedene Eingabegeräte (Maus, Touchscreen, Blicksteuerung) anhand einer zweidimensionalen „Zeige-Aufgabe“ hinsichtlich der Bearbeitungszeit und mentalen Beanspruchung analysiert und bewertet. Die Aufgabe bestand darin, ausgehend von einem Startobjekt, Zielobjekte in verschiedenen Winkel so schnell und so genau wie möglich zu pointen. Hinsichtlich der Bearbeitungszeit konnten deutliche Alterseffekte ermittelt werden. Die älteren Probanden benötigten signifikant mehr Zeit als die jüngeren Probanden. Bezüglich der drei untersuchten Eingabegeräte konnte unabhängig vom Alter die geringste Bearbeitungszeit mit dem Touchscreen erzielt werden und die Eingabe über die Maus führte zur längsten Bearbeitungszeit. Der Effekt der Leistungssteigerung durch den Einsatz eines alternativen Interaktionsmediums, Touchscreen und Blicksteuerung, ist in den drei Altersgruppen unterschiedlich stark ausgeprägt. Die größte Leistungssteigerung wurde hier bei den 60-75-Jährigen ermittelt. Durch den Einsatz eines Touchscreens konnten die Leistungsunterschiede zwischen den drei Altersgruppen fast vollständig kompensiert werden. Die Folie zeigt einen Überblick über die wesentlichen Technologien für Elektronische Informationsdisplays. Die Technologien können in drei Kategorien unterteilt werden: Projektion, Direktsicht, und Schirmlos. Direktsicht-Displays: Bei diesen Displays wird das vom Gerät erzeugte Licht direkt auf einem Monitor gesehen, ohne vorher von einer Projektionsoberfläche reflektiert zu werden. Alle CRT, LCD oder Plasmamonitore sind Direktsicht-Displays. Diese Displays arbeiten gut in hellem Licht und haben eine größere Lichtausbeute als die Projektionsdisplays. Projektionsdisplays: Anders als die Direktsichtsysteme basiert das Projektionsdisplay auf der Projektion eines Bildes auf den Schirm. Es gibt frontale und hintere Projektionssysteme, welche sich wesentlich durch die Bildschirmtechnologie unterscheiden. Die frontale Projektion nutzt eine reflektive Bildschirmoberfläche, während die hintere Projektion eine transmittierende Oberfläche verwendet. Projektionsdisplays arbeiten am besten in einer schwach beleuchteten Umgebung. Besonders die frontale Projektion erfordert einen abgedunkelten Raum, um die optimale Betrachtungsqualität zu erreichen. Schirmlose Displays: Diese Displaysysteme benötigen keine spezielle Projektionsoberfläche. Stattdessen kann ein „natürliches“ Medium wie einfaches Glas oder sogar die Netzhaut im Auge (Retina) für die Projektion verwendet werden. Schirmlose Displays basieren entweder auf kohärenter oder nicht-kohärenter Lichtaussendung. Kohärenz ist die Fähigkeit von Wellen stationäre Interferenzerscheinungen hervorzurufen. VRDs (Virtual Retinal Displays) und 3D holografische Head-up Displays sind Beispiele für schirmlose Displaysysteme. . TFT steht für Thin Film Transistor. Dies beschreibt die eingesetzten planaren Schaltelemente, die aktiv die einzelnen Bildelemente ansteuern. Das Display besteht aus einer Matrix mit vielen Bildpunkten. Jeder dieser Bildpunkte kann in einer photoelektrisch vordefinierten Farbe Licht transmittieren. Dazu gibt es hinter der Matrix eine Hintergrundbeleuchtung, meist mehrere Leuchtstoffröhren. Damit nun ein Bild auf der Vorderseite der Elemente entsteht, wird eine Art ”Blende“ geöffnet, die das Licht für einen bestimmten Bildpunkt durchlässt oder verdeckt. Dafür werden elektrisch reagierende Flüssigkristalle verwendet, die sich in einer bestimmten Schicht, dem sog. alignment layer (Ausrichtungsschicht) befinden. Davor und dahinter befinden sich zwei Polarisationsfilter. Vor dem Eintreten in das alignment layer wird das Licht im ersten Filter polarisiert, d.h. die Schwingungsrichtung der Lichtwellen wird auf eine bestimmte Richtung fixiert. Beim Austreten aus dem alignment layer befindet sich auf der Seite ein um 90° gedrehter Filter, der auch nur in dieser Richtung gedrehte Lichtwellen durchlässt. Im spannungsfreien Zustand drehen die Flüssigkristalle im alignment layer die Schwingungsrichtung des Lichts um 90°, so dass das Licht ungehindert austreten kann (Twist). Es ist notwendig, die auf dem Bildschirm dargestellten Informationen in einer Größe und Qualität anzubieten, die ein leichtes, beschwerdefreies Erkennen ermöglichen. Dies ist für Zeichen, die unter einem Sehwinkel zwischen mindestens 16„ bis höchstens 31„ erscheinen, erfüllt. Ein Sehwinkel von mindestens 22„ ist gegeben, wenn die Höhe der Großbuchstaben in [mm] ohne Oberlänge dem vorgesehenen Sehabstand dividiert durch 155 entspricht. Die Schrifthöhe sollte jedoch auch nicht größer als der Sehabstand dividiert durch 110 sein, weil sonst ein flüssiges Lesen sehr erschwert wird (Schrifthöhe höchstens ca. 4,5 mm bei Sehabstand 500 mm, entsprechend einem Sehwinkel von höchstens 31„). Bei einem Sehabstand von 500 mm sind Schrifthöhen von 3,0 mm bis 4,0 mm erstrebenswert. In einer Studien mit 90 Probanden zwischen 20 und 75 Jahren wurden verschiedene Schriftgrößen altersdifferenziert sowie im Bezug zur Sehfähigkeit der Probanden analysiert. Eine Reiz-Reaktionsaufgabe basierend auf unterschiedlich groß dargestellten Landoltringen musste von den 75 Probanden zwischen 20 und 75 Jahren bearbeitet werden. Die Reaktionszeit, die Anzahl korrekt erkannter Landoltringe sowie die Anzahl „falscher Alarme“ wurden als abhängige Variablen aufgenommen. Hinsichtlich der Anzahl richtig erkannter Landoltringe bzw. „falscher Alarme“ lag eine sehr geringe Varianz zwischen den Probanden vor. Die Aufgabe wurde unabhängig vom Alter der Probanden überdurchschnittlich gut gelöst. Bezüglich der benötigten Reaktionszeit lag ein signifikanter Schriftgrößeneffekt vor. Je größer der Landoltring desto schneller wurde dieser erkannt. Eine signifikante Wechselwirkung konnte zwischen der Schriftgröße und der Altersgruppe gezeigt werden. Interessant ist, dass die Probanden der Altersgruppe 60-75a unter Verwendung der Schriftgrößen 16‟ und 22‟ ähnliche Reaktionszeiten erzielten als die Probanden der Altersgruppe 40-59a mit der jeweils kleineren Schriftgröße (12‟ und 16‟). Durch Vergrößerung der Schrift erzielen ältere Probanden demnach ähnliche Reaktionszeiten wie die Jüngeren. Bei bestimmten Augenerkrankungen kann die Negativ-Darstellung die Lesbarkeit der dargestellten Informationen für die betroffenen Benutzer verbessern. Zu diesen Erkrankungen gehören Retinitis Pigmentosa und Makuladegeneration. Retinitis Pigmentosa ist eine Netzhautdegeneration, bei der die Photorezeptoren zerstört werden, Makuladegeneration umfasst eine Gruppe von Erkrankungen des menschlichen Auges, welche die Makula lutea („der Punkt des schärfsten Sehens“, „Gelber Fleck“) der Netzhaut betreffen und mit einem allmählichen Funktionsverlust des dort befindlichen Gewebes einhergehen. Durch diese Erkrankungen kann es zur Erhöhung der Blendungsempfindlichkeit, zur Abnahme des Kontrastempfindens und zur Abnahme der Adaptionsfähigkeit kommen. Die Negativ-Darstellung reduziert die physiologische Blendung, da im Auge weniger Streulicht entsteht. Zeichen scheinen bei negativer Polarität größer, und sind somit für Sehbehinderte besser zu lesen. Ein weiterer Vorteil ist die Reduktion des Flimmerns. Die Flimmerempfindlichkeit ist im peripheren Gesichtsfeld deutlich höher als im zentralen, d.h. Augenerkrankungen mit einer Schädigung des zentralen Gesichtsfeldes erhöhen das Problem des Flimmerns. Abhängigkeit der Leuchtdichte von der Blickrichtung: Wenn die Leuchtdichte für die betrachtete seitliche verschobene Sichtsituation um mehr als 10% im Vergleich zu der normalen Blickposition senkrecht zur Bildebene abnimmt, dann spricht man von einem anisotropischen Bildschirm. Versuch zur Erkennungsleistung mit TFT-Bildschirmen: Ziel der Studie von Ziefle (2004) war es, den Einfluss der Anisotropie eines TFTBildschirms auf die Erkennungsleistung junger Erwachsener zu untersuchen. Die 28 Probanden (10 Männer, 18 Frauen) zwischen 19 und 30 Jahren (M=23) mussten eine visuelle Suchaufgabe bearbeiten, bei der ihnen Objekte (ähnlich zu Landoltringen) präsentiert wurden, und die Probanden für jedes Objekt entscheiden mussten, ob dieses nach oben, unten, rechts oder links geöffnet war. Der Betrachtungswinkel wurde zwischen 0° und 50° variiert sowie die Zielgröße. Die Erkennungszeit sowie die Fehlerrate wurden als abhängige Variablen aufgenommen. Aufgrund der negativen Auswirkung der Anisotropie steigt die Erkennungszeit für den TFT-Bildschirm mit 50° Betrachtungswinkel. Experimentelle Studien zur Doppelmonitoranordnung. Die Aufgabe der Probanden bestand in der Diskrimination von Zielobjekten, sog. ZiSo„s (ähnlich wie Landoltringe, jedoch quadratisch). Studie 1: Vergleich horizontale Doppelmonitoranordnung (zwei versus ein Monitor) In dieser Studie wurde die Leistung bei der simultanen Überwachung von zwei Monitoren bei horizontaler Anordnung (jeweils 50° links und rechts vom Betrachter) im Vergleich zur Arbeit an nur einem Monitor analysiert. Das Erkennen von Zielobjekten auf einem Bildschirm führt zu signifikant schnellerer Bearbeitung als das Erkennen von Zielobjekten an zwei horizontal angeordneten Bildschirmen. Bezüglich der Bearbeitungsgenauigkeit lagen keine signifikanten Unterschiede vor. Studie 2: Vergleich vertikale Doppelmonitoranordnung (oben oder unten angeordnet) Der Einfluss des Blickwinkel wird durch den Vergleich zwischen der oberen und unteren Bildschirmposition erfasst. Am unteren Bildschirm konnte die Aufgabe von den Probanden signifikant schneller gelöst werden als am oberen Bildschirm. Hinsichtlich Bearbeitungsgenauigkeit hatte der Blickwinkel keinen Einfluss. In dieser Studie wurde die Produktivitätssteigerung durch den Einsatz mehrere Bildschirme mit insgesamt 67 Probanden untersucht. Als Szenario wurde das Zusammenführen von Kommentaren bei der Erstellung einer Veröffentlichung gewählt. Die Aufgabe der Probanden bestand darin, bestimmte Korrekturvorschläge zu übernehmen und diese korrekt in den eigenen Text einzubauen. Alle Gruppen führten diese Aufgabe an einem 19-Zoll-Monitor als Referenzaufgabe durch. Im Anschluss wurde dann dieselbe Aufgabe entweder an demselben Arbeitsplatz (Gruppe 1: 19 Probanden), an einem Arbeitsplatz mit einem 22-Zoll-Widescreen-Monitor (Gruppe 2: 24 Probanden) oder an einem Arbeitsplatz mit drei zusammengeschalteten 19-Zoll-Bildschirmen (Gruppe 3: 24 Probanden) bearbeitet. Als Maß für die erzielte Produktivität wurde der Leistungsquotient aus erzielten Punkten (richtige Antworten minus Fehler) pro Zeiteinheit berechnet. Dieser dient als Grundlage für die Berechnung der prozentualen Steiderung der Produktivität durch größere oder mehrere Bildschirme. In Gruppe 1 erhöht sich der mittlere Leistungsquotient von Aufgabe 1 zu Aufgabe 2 um 1,8%. Um Lerneffekte auszuschließen wurden nur die Unterschiede der Leistungsquotienten bezogen auf Aufgabe 2 betrachtet und das Produktivitätsniveau von Gruppe 1 als Basis verwendet. Für Gruppe 2 ergibt sich eine Produktivitätssteigerung um 8,3% und für Gruppe 3 eine Erhöhung um 35,5%. Demnach kann eine größere Bildschirmfläche zu einem deutlichen Produktivitätszuwachs führen. Wenn ein Auge ein Objekt (z.B. A im Bild links) fokussiert, dann fallen die Abbildungen auf zentrale Punkte in der sogenannten Sehgrube (Fovea Centralis) der Netzhaut (Punkte a1 und a2). Ein weiter entferntes (oder näheres) Objekt (B) erzeugt Abbildungen auf, gegenüber den korrespondierenden Netzhautstellen versetzten (disparaten), Punkten (Punkte b1 und b2). Der seitliche Versatz wird Disparität genannt. Im rechten Bild ist die Darstellung eines Drahtwürfels auf die beiden Augen dargestellt. Aus den Bildunterschieden wird im Sehzentrum ein räumlicher Eindruck erzeugt. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass die Bilder im Auge auf Grund des Linsensystems immer „seitenverkehrt“ dargestellt werden. Eine Umrechnung auf das „tatsächliche“ Bild erfolgt rein kognitiv. Als Querdisparation bezeichnet man die Verschiedenheit der Bilder auf der rechten und der linken Netzhaut, die durch den Augenabstand (beim Menschen etwa 6,5 cm) entsteht. Das Sehsystem besitzt die Fähigkeit, aus der Verschiedenheit dieser zweidimensionalen Bilder Informationen für das räumliche Sehen zu gewinnen. Das Ergebnis bezeichnet man als stereoskopisches Sehen. Den theoretischen Punkt-Horopter bildet die Gesamtheit der Punkte, die bei einer festen Augenstellung in beiden Augen auf korrespondierende Stellen der Netzhaut abgebildet werden. Sofern korrespondierende Netzhautstellen durch identische Winkel gegen die Blickachse des Auges definiert sind, besteht der Horopter aus einem Kreissegment. Empirisch weichen korrespondierende Punkte jedoch von der Definition der Winkelgleichheit ab, was zu einem weniger gekrümmten empirischen Horopters führt. Punkte bzw. Objekte, die auf der Fläche des Horopters oder in geringem Abstand dazu liegen, werden einfach wahrgenommen (fusioniert), solche, die sich davor oder dahinter befinden, werden doppelt gesehen. Diese Doppelbilder werden in der Regel unterdrückt. Man unterscheidet zwischen gekreuzter Querdisparation und nicht gekreuzter Querdisparation. Von gekreuzter Querdisparation spricht man, wenn Objekte vor dem Horopter liegen und somit auf den äußeren Randbereich der Netzhaut fallen: Punkt B wird im linken Auge links von der Fovea und im rechten Auge rechts von der Fovea abgebildet. Von ungekreuzter Querdisparation spricht man, wenn Objekte hinter dem Horopter liegen und somit auf den inneren Randbereich der Netzhaut fallen: Punkt C wird im linken Auge rechts von der Sehgrube und im rechten Auge links von der Sehgrube abgebildet. Bei der künstlichen Stereoskopie werden dem Betrachter zwei Bilder aus unterschiedlichen Sichtpositionen gezeigt. Das natürliche Sehen unterschiedlicher Bilder mit zwei Augen wird so also nachgebildet. Die verschiedenen Techniken zur stereoskopischen Darstellung haben dementsprechend auch entweder zwei separate Bildbereiche oder funktionieren zeitmultiplex. Werden dem Betrachter Fotos gezeigt, so muss schon bei der Aufnahme der Bilder der Abstand und Winkel der Kameras beachtet werden. Bei der Darstellung von 3D-Szenen, die erst vom Computer berechnet werden, kann der Abstand der virtuellen Kameras, der Winkel der Kameras und die Perspektive der generierten Bilder bestimmt werden. Das Darstellen zwei unterschiedlicher Bilder ist allen stereoskopischen Anzeigesystemen inhärent. Erste Systeme, so genannte Stereoskope, gab es bereits im 18. Jahrhundert. Es wurden zwei Photographien, aufgenommen aus zwei Blickrichtungen, benötigt. Mit dem Stereoskop konnte der Betrachter die stereoskopischen Halbbilder betrachten. Dabei wurde dem linken Auge das linke Halbbild und dem rechten Auge das rechte Halbbild präsentiert. Durch das Zusammenbringen der zwei Halbbilder wird kognitiv ein Tiefeneindruck erzeugt. Ähnlich funktionieren auch heutige stereoskopische Monitore. Der Unterschied ist lediglich, dass die Bilder nicht statische Photographien sondern Abbildungen auf dem Display sind. Auch die haploskopische Trennung, also das Zuführen der jeweiligen Halbbilder zu den Augen, funktioniert bei stereoskopischen Monitoren anders als bei den historischen Stereoskopen. Für die haploskopische Trennung kommen heute neben der separaten Darstellung auf zwei Monitoren z.B. über Spiegelsysteme Multiplexverfahren zum Einsatz. So wird bei Shutterbrillen ein Monitorbild zeitlich abwechselnd dem linken und rechten Augen zugeführt, bei autosteroskopischen Monitoren wird das Bild eines Monitors räumlich alternierend für linkes und rechtes Auge dargestellt. Auf der linken Seite der Abbildung ist das Prinzip der alternierenden Halbbilddarstellung bei autostereoskopischen Monitoren zu sehen. Die Bilder für das linke und das rechte Auge werden schon im Computer verzahnt, so dass nur das integrierte Bild an den Monitor übertragen wird. Auf der rechten Seite der Abbildung ist die Funktionsweise der Prismenmaske dargestellt. Die Prismen sind so ausgerichtet, dass alternierende Pixelspalten jeweils an das linke und das rechte Auge abgelenkt werden. Befinden sich die Augen des Betrachters nun innerhalb des so genannten Sweet-Spots, also innerhalb des Bereiches zu dem das Licht abgelenkt wird, so erhält jedes Auge das für es bestimmte Bild und ein räumlicher Eindruck entsteht. Bei der Verzahnung von linkem und rechtem Halbbild gehen allerdings auch Informationen verloren. Praktisch wird die horizontale Auflösung der Bilder halbiert. Dies führt insbesondere bei der Textdarstellung zu verzerrenden Kanten. Auch bei der Raumwahrnehmung kommt es durch die praktische Halbierung der horizontalen Auflösung zu einer Verminderung der Tiefenauflösung. Volumetrische Displays ermöglichen die Darstellung eines Objektes oder einer Szene in drei Dimensionen, sodass diese aus allen Blickwinkeln betrachtet werden können. Volumetrische Displays basieren auf millionen von 3D-Pixeln, Voxel (Volume + Pixel) genannt, welche das Licht entweder absorbieren oder emittieren. Das dreidimensionale Bild entsteht i.d.R. durch die Projektion der Voxel auf einen rotierenden oder in der Tiefe zeitlich versetzen Schirm. Es wird ein röntgenartiges räumliches Abbild der zugespielten Bilddaten erzeugt. Perspecta Ein dreidimensionales Bild, das innerhalb einer Halbkugel aus Glas dargestellt wird, setzt sich aus 200 radial versetzten zweidimensionalen Einzelbildern zusammen. Diese werden von einem Projektor, der 4000 Bilder pro Sekunde produziert, innerhalb der Kugel auf einen rotierenden Schirm in Form einer Kunststoffscheibe mit matter Oberfläche projiziert. Für das menschliche Auge wirkt das Bild so dreidimensional. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren benötigt der Betrachter bei Perspecta keine 3D-Brillen und ist nicht auf eine bestimmten Blickwinkel festgelegt. Ein Farbbild aus einem Beamer wird auf hintereinander gestaffelte Glasplatten projiziert. Als Grundmaterial dienen 20 normale TFT-Display-Panels, die jetzt aber nur als einzelne Mattscheiben fungieren. 19 dieser Scheiben sind lichtdurchlässig, nur eine wirkt jeweils als Mattscheibe. Das 3D-Bild wird nun scheibchenweise aufgebaut, immer auf einem anderen TFT-Panel. 20 dieser Panels hintereinander ergeben eine räumliche Tiefe von rund zehn Zentimetern. Der Monitor dient quasi als „Sichtkörper“. Das Bild liefert ein recht leistungsstarker Beamer auf Digital Light Processing (DLP) Basis mit einer Leistung von rund 800 Watt. Die Leistung muss so groß sein, weil TFT-Panels nur wenig Licht durchlassen. Für die Farbe ist nur der Beamer zuständig. Damit keine Übergänge zwischen den einzelnen Scheiben sichtbar werden, sorgt ein spezieller Algorithmus für eine Kantenglättung im 3D-Bereich. Licht ist eine elektromagnetische Strahlung im Wellenlängenbereich von ca. 380 bis 780 nm, die im Auge zu visuellen Reizen führt. Strahler, die wenigstens teilweise in dem genannten Spektralbereich Energie aussenden, werden daher als Lichtquellen bezeichnet. Licht setzt sich aus unterschiedlichen Farben zusammen, die wiederum bestimmten Wellenlängen zuzuordnen sind. Dabei ist das Auge nicht für alle Farben gleich empfindlich. Die größte Empfindlichkeit liegt für Tagsehen im gelb/grünen Farbbereich bei ca. 550 nm Wellenlänge. Lichtstrom und Lichtstärke bezeichnen die Strahlung, die von einer Lichtquelle ausgeht, einmal allgemein in alle Richtungen (Lichtstrom), zum anderen in einen bestimmten Raumbereich (Lichtstärke). Häufig interessiert man sich außerdem für die Helligkeit, die dann eine bestimmte Fläche erhellt, hierfür verwendet man die Größe Beleuchtungsstärke. Für radialsymmetrisch strahlende Körper gilt bei senkrechtem Auffallen der Strahlung E = I / r², wenn r die Entfernung zwischen strahlendem und empfangendem Körper wiedergibt. Durch Veränderung der Entfernung kann also recht einfach die Beleuchtungsstärke variiert werden. Die Lichtstärke (Candela) ist die von einer Lichtquelle in einem bestimmten Raumwinkel abgegebene sichtbare Strahlung. Sie gehört zu den SI-Basiseinheiten. Der Raumwinkel (Steradiant) ist das Maß für die Größe des kegel- oder pyramidenförmigen Raumes, den die Lichtstrahlen einschließen. Er berechnet sich aus dem Verhältnis der senkrecht durchstrahlten Fläche zum Quadrat des Abstands zwischen dieser Fläche und dem Ausgangspunkt der Strahlung; = A/r2. Die Leuchtdichte (Candela/Quadratmeter) ist die Energie, die als sichtbares Licht ins Auge dringt. Sie resultiert aus der Reflexion einer beleuchteten Fläche oder aus der Lichtstärke eines selbstleuchtenden Körpers. Eine kleine Fläche, die eine bestimmte Lichtstärke erzeugt, muss also notwendigerweise heller sein (eine höhere Leuchtdichte besitzen), als eine größere Fläche gleicher Lichtstärke. Die Beleuchtungsstärke (Lux = Lumen/Quadratmeter) entspricht dem Verhältnis des auf einer bestimmten Fläche (oft die Arbeitsfläche) auftreffenden Lichtstroms zu der Größe dieser Fläche. Fällt ein Lichtstrom von 1 Lumen auf 1 m2 Fläche, so entspricht das einer Beleuchtungsstärke von 1 Lux (lx). Der Reflexionsgrad ist das Verhältnis vom reflektierten zum auffallenden Lichtstrom. Er gibt die Eigenschaften von Oberflächen wieder, auftretende Lichtstrahlen zu reflektieren. Die Beleuchtungsstärke ist eine empfängerseitige Größe. Sie ist unabhängig vom Reflexionsgrad der beleuchteten Fläche. Die nach der Flächenbeleuchtungsformel errechnete Beleuchtungsstärke ist als Mittelwert aufzufassen, da im Allgemeinen der Lichtstrom nicht gleichmäßig über die Fläche verteilt ist. E kann für große Verhältnisse von r² zu A auch aus der Lichtstärke I und dem Abstand r zwischen Lichtquelle und beleuchtetem Punkt berechnet werden. Wenn das Verhältnis von Abstand zur Lichtquelle zur Ausdehnung der Lichtquelle größer 5 ist, gilt E=I/ r². Oftmals steht die beleuchtete Fläche nicht senkrecht unter der Lichtquelle. In diesem Fall ist die resultierende Leuchtstärke E abhängig vom Winkel der betrachteten Fläche zur Lichtquelle und der Anbringungshöhe r. Der Lichtstrom einer Lichtquelle wird im Allgemeinen nicht gleichmäßig in alle Raumrichtungen abgestrahlt. Die von einer Lichtquelle in eine bestimmte Raumrichtung ε abgegebene sichtbare Strahlung Φ bezogen auf den dabei durchfluteten Raumwinkel Ω wird Lichtstärke I genannt. Die Einheit ist Candela [cd=lm/sr]. Die Energie, die als sichtbares Licht in das Auge dringt, wird durch die Leuchtdichte L beschrieben und in der Einheit [cd/m2] gemessen. Die Leuchtdichte stellt die objektive physikalische Größe dar, die ein subjektiven Helligkeitsempfindens hervorruft. Sie resultiert aus der Reflexion einer beleuchteten Fläche oder aus der Lichtstärke eines selbstleuchtenden Körpers und ist definiert als Lichtstärke I bezogen auf den senkrecht zur Betrachtungsrichtung projizierten Teil A der betrachteten Fläche A0. Mit Ausnahme des sog. Lambertstrahlers ist die Leuchtdichte vom Betrachtungswinkel abhängig. Der Lambertstrahler stellt den Idealfall konstanter Leuchtdichte über dem Raumwinkel dar. Das Verhältnis aus richtungsabhängiger Lichtstärke und projizierter Fläche (senkrecht zum Lichtstärkevektor) ist für alle Richtungen gleich. Die Leuchtdichte der Raumoberfläche lässt sich für vollkommen gestreut reflektierende Oberflächen (Näherung Lambertstrahler) mit Hilfe der Beleuchtungsstärke E, dem Reflexionsgrad ρ, dem Abstand r zwischen Auge und beleuchteter Fläche und der beleuchteten Fläche A berechnen. Für die Darstellung von Objekten ist es wichtig zu wissen, bis zu welchem Minimalabstand zwei Sehobjekte noch getrennt wahrgenommen werden können. Dieses Auflösungsvermögen des Sehapparats wird als Sehschärfe (Visus) bezeichnet und wird als Reziprokwert der individuellen angularen Sehschärfe ausgedrückt. Die individuelle angulare Sehschärfe ist definiert durch den kleinsten Winkel (in Bogenminuten), unter dem das Auge ein Detail (Objekt) gerade wahrnehmen kann. Neben den physikalischen Eigenschaften des Auges wird die Sehschärfe durch zentralnervöse Faktoren beeinflusst. So hat insbesondere die Formwahrnehmung erheblichen Einfluss auf die Erkennungsleistung. Die Sehschärfe ist nicht nur vom anatomischen Auflösungsraster der Netzhaut abhängig; sie lässt sich auch nicht allein anhand des Durchmessers der Rezeptoren berechnen. Die wesentlichen Einflussfaktoren der Sehschärfe sind das betrachtete Objekt, der Ort der Abbildung auf der Netzhaut, die Gesichtsfeldleuchtdichte und der Leuchtdichtequotient. Zwei Sehobjekte unterschiedlicher Leuchtdichte können nur dann vom Auge als getrennt wahrgenommen werden, wenn der Leuchtdichteunterschied einen Mindestwert überschreitet. Das gleiche gilt für die Sichtbarkeit gegenüber dem Umfeld. Der Leuchtdichteunterschied (Kontrast) zwischen Sehobjekt und Umfeld wird mit dem Leuchtdichtequotienten beschrieben. Er errechnet sich als Verhältnis der Infeld- zur Umfeldleuchtdichte. Die Sehschärfe steigt sowohl mit der Umfeldleuchtdichte als auch mit dem Leuchtdichteunterschied zwischen Infeld und Umfeld. Es wird aber auch deutlich, dass schon bei geringer Umfeldleuchtdichte sehr kleine Leuchtdichteunterschiede zum Anwachsen der Sehschärfe ausreichen. Die Anpassung des Auges an die Leuchtdichten im Gesichtsfeld geschieht durch photochemische und physiologische Anpassung der Netzhaut sowie eine Änderung der Pupillenöffnung. Diese Fähigkeit des Auges wird Adaptation genannt und beeinflusst in starkem Maße sämtliche Sehfunktionen. Der zeitliche Verlauf der Adaptation hängt wesentlich von den Leuchtdichten am Anfang und am Ende der Adaptation ab. Eine Änderung von hell nach dunkel wird als Dunkeladaptation bezeichnet, im umgekehrten Fall spricht man von Helladaptation.