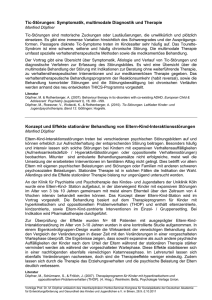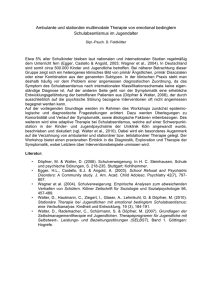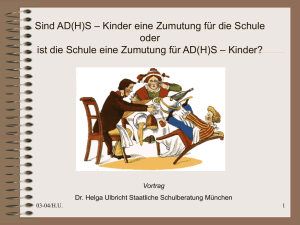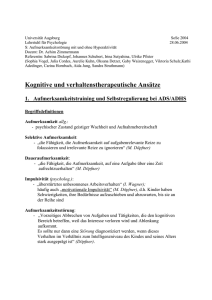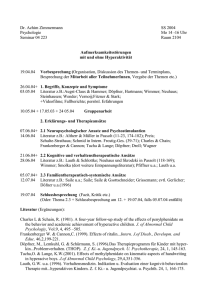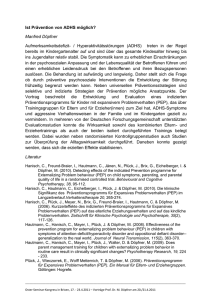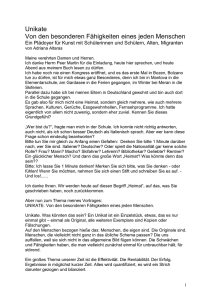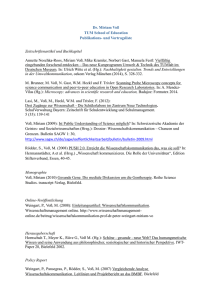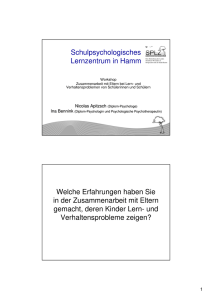Hans von Lüpke: AD(H)
Werbung

Hans von Lüpke AD(H)S: Ist alles wirklich so klar? Diskussionsbeitrag zu Daten, Denkmodellen, Hilfen Durch den Einsatz neuer bildgebender Untersuchungsmethoden konnte in den letzten 1 ½ Jahrzehnten eine Vielzahl von Daten zu Stoffwechselprozessen im Gehirn gesammelt werden. Damit schien sich der uralte Traum zu erfüllen, psychische Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten auf organische Ursachen zurückführen zu können. Die wichtigste Konsequenz daraus war eine neue Legitimation medikamentöser Therapien: schien man doch jetzt Anhaltspunkte dafür zu haben, wie Medikamente auf Störungen im Hirnstoffwechsel wirken. Dies ist exemplarisch am sprunghaften Anstieg der Medikamentenverschreibung beim "Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom" mit und ohne Hyperaktivität (ADS bzw. ADHS) zu verfolgen, die inzwischen eine lebhafte Diskussion in der Öffentlichkeit ausgelöst hat. Weder geht es dabei um ein neues "Krankheitsbild", noch um ein neues Medikament. Man benutzte bisher lediglich andere Begriffe (genauere Diskussion der Begrifflichkeit bei von Lüpke 2001). Dass dabei Medikamente wie Methylphenidat (Ritalin) bei bis zu 80% der behandelten Kinder eine Wirksamkeit zeigen, ist ebenfalls lange bekannt. Neu ist lediglich die Argumentation, dass das Medikament zur Behandlung einer Stoffwechselstörung den selben Stellenwert haben soll wie das Insulin beim Diabetes (Kühle 1998) oder die Brille bei Fehlsichtigkeit (Kanders 2001). Während auf der einen Seite die zunehmende Verschreibung eines unter dem Betäubungsmittelgesetz stehenden Medikaments auch im Hinblick auf eine Suchtgefahr Besorgnis auslöst, wird auf der anderen Seite geltend gemacht, dass noch längst nicht alle Kinder medikamentös behandelt würden, die einer solchen Behandlung bedürfen und dass gerade diese nicht behandelten Kinder von Sucht bedroht seien. Angesichts solcher weitreichenden Konsequenzen erscheint es angebracht, die hinter dieser Entwicklung stehenden Daten und Denkmodelle zu überprüfen. Dies ist vor allem für Pädagogen von Bedeutung: bliebe ihnen doch bei einer primär organmedizinischen Problematik nur noch die schadensbegrenzende Rolle. Dazu soll folgenden Fragen nachgegangen werden: 1. Wie gut sind die immer wieder zitierten biologischen Daten fundiert, welche Aussagen lassen sie zu und welche stillschweigenden Annahmen über Kausalitätsbeziehungen enthalten sie? 2. Welche Denkmodelle über Krankheitsbegriffe werden dabei a priori vorausgesetzt? 3. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für pädagogische, psychotherapeutische und medikamentöse Interventionen? Zu 1.: Die Vorstellung, daß biochemische Prozesse als Ursache für das "Aufmerksamkeits-DefizitSyndrom" anzunehmen sind, bezieht sich im wesentlichen auf die Ergebnisse von zwei Forschungsgruppen. Zametkin et al. veröffentlichten 1990 Ergebnisse, die mit der PositronenEmissions-Tomographie (PET) gewonnen wurden, nach denen Erwachsene, die in ihrer Kindheit als hyperaktiv eingeschätzt wurden und selbst wieder hyperaktive Kinder hatten, bei einer kontinuierlichen Konzentrationsleistung einen - im Vergleich zu den Kontrollen - um acht Prozent verminderten Glucoseverbrauch von Hirnregionen im Stirnhirnbereich aufwiesen. Zum anderen konnte das Team von Lou schon 1984 bei Untersuchungen mit radioaktivem Xenon 300 beobachten, daß hyperaktive Erwachsene in der selben Großhirnregion und den dazu gehörigen Basalganglien bei vergleichbaren Tests eine im Vergleich zu den Kontrollpersonen verminderte Durchblutung hatten (Lou et al. 1984). Nach Roth handelt es sich dabei um Gehirnregionen, die etwas zu tun haben mit "Aufmerksamkeit und selektiver Kontrolle von sensorischer Erfahrung, Handlungsplanung, der zeitlichen Kodierung von Ereignissen, Spontaneität des Verhaltens und Arbeitsgedächtnis". Eine andere, ebenfalls von dieser Abweichung betroffene Hirnregion, ist für die "Einschätzung von Konsequenzen, die das eigene Verhalten hat, Gefühlsleben und der emotionalen Kontrolle des Verhaltens" verantwortlich (Roth 1999b, A-1959). Damit erschien es plausibel, die Symptomatik des "ADS" als Folge einer Unterfunktion dieser Hirnregion zu interpretieren. Diese Unterfunktion wurde aus der relativen Verminderung von Glucoseverbrauch und Durchblutung als Ausdruck eines reduzierten Energieumsatzes abgeleitet. Molekulargenetische Untersuchungen zeigten darüber hinaus bei diesen Kindern Anomalien in Genen, die für den Transport und die Bindung von Dopamin verantwortlich sind (Barkley 1999). Da der Transmittersubstanz Dopamin ebenfalls in der beschriebenen Hirnregion eine wichtige Funktion zugeschrieben wird, schien es einleuchtend, diese Befunde im Sinne eines Dopamin-Mangels als Ursache für das ADS zu interpretieren. Ergänzt wurden diese Untersuchungen durch Familien-, Adoptions- und Zwillingsstudien. Die Häufung von hyperkinetischen Auffälligkeiten in Familien; die Tatsache, dass hyperkinetische Adoptivkinder im Hinblick auf diese Auffälligkeit mehr Ähnlichkeit mit den leiblichen Eltern als mit den Adoptiveltern aufwiesen und schließlich die bis zu 80 Prozent reichende Konkordanz unter eineiigen Zwillingen schienen dafür zu sprechen, daß die bereits 1902 von Still angenommene Erbanlage sich mit den heutigen Methoden belegen ließ (Barkley 1999, Droll 1998) Hier stellt sich die Frage, ob nicht von unbewiesenen Voraussetzungen ausgegangen wird. Aus der medizinischen Tradition stammt die Annahme, daß beim Zusammentreffen einer psychischen Auffälligkeit und einer organischen Abweichung dem Organbefund in der Regel eine ursächliche Bedeutung zugeschrieben wird. Wie voreilig diese Annahme ist, zeigt folgendes Gedankenexperiment: Man stelle sich vor, ein kleines Kind, das sich sprachlich noch nicht mitteilen kann, habe einen schweren Schock erlitten. Puls und Blutdruck sind erhöht, die Haut ist blass, die Pupillen sind weit, die Streßhormone erhöht. Nach der oben skizzierten Kausalität müssten die biochemischen Daten, etwa die Erhöhung des Adrenalin- und Kortisolspiegels, zu der Schlußfolgerung führen, das Kind habe eine Stoffwechselstörung. Die neuere Hirnforschung (Deneke 1999, Roth 1999a, Shore 1997) hat ergeben, daß nicht nur aktuelle biochemische Befunde, sondern auch die Entwicklung des Gehirns bis in die anatomischen Dimensionen hinein ständig von Umweltfaktoren mit bestimmt wird. Dabei ist entscheidend, welche Bedeutung ein Ereignis für das Individuum hat: Das "Zusammenspiel (innerhalb des zentralen Nervensystems v.L.) ist nicht durch Moleküle, Nervenzellen und ... Rezeptoren gesteuert, sondern durch die Bedeutung der Hirnaktivität" (Roth 1999a, 247). Bedeutung ist es, die Wachstums- und Vernetzungsprozesse im Zentralnervensystem organisiert: auf der molekularen Ebene, auf der Ebene der Synapsen und letztlich auf der von Zellstrukturen. Eine verminderte Stoffwechselaktivität in einer Hirnregion ist noch kein Beweis für einen Mangel an Transmittersubstanzen, sondern kann Ausdruck einer veränderten Gesamtregulation sein. Einer solchen Interpretation würde das Modell von Perry ( 1996) entsprechen, der von der Vorstellung aus geht, dass nach starken psychischen Belastungen die Entwicklung des Hirnstamms und des Mittelhirns die im Hirnrindenbereich und limbischen System übertrifft, was mit verstärkter Angst, Impulsivität, schlechter Affektregulation und Hyperaktivität verbunden ist. Stoffwechselprozesse im Gehirn können allein durch psychische Faktoren ausgelöst werden. So hat man in den akustischen Assoziationsfeldern bei Patienten mit akustischen Halluzinationen die selben hirnelektrischen Aktivitäten gefunden wie bei Personen, die realen akustischen Eindrücken ausgesetzt waren (Singer 2001). Parkinsonkranke können auf die Ankündigung, ihr Medikament zu bekommen, mit den meßbaren Stoffwechselprozessen reagieren, die sonst durch das Medikament ausgelöst werden (Frankfurter Rundschau 2001). Overmeyer & Taylor (2001) kommen nach Durchsicht der neueren Literatur und eigenen Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass die Bewertung der bisher beobachtbaren Befunde weder kausale noch diagnostische Rückschlüsse erlaubt. Für die Bewertung genetischer Faktoren ist zunächst von Bedeutung, dass bei der Steuerung des Hirnstoffwechsels die "Genexpression" eine entscheidende Rolle spielt. Im Gegensatz zu klassichen Vorstellungen von Genetik geht man heute davon aus, daß Gene nicht nur am Anfang wirksam sind, sondern daß die kodierten Informationen während der gesamten Entwicklung kontinuierlich über "Genexpression" Einfluß auf die Entwicklung nehmen. Darüber hinaus wird lediglich ein geringer Anteil der angelegten Möglichkeiten im Laufe des Lebens wirksam: nur etwa 15 Prozent kommen zur Auspägung. Umweltfakoren spielen dabei eine maßgebliche Rolle. Selbst bei abweichenden ("pathologischen") genetischen Informationen entscheiden Umwelteinflüsse, ob und in welchem Ausmaß diese wirksam werden (Deneke 1999). Nicht zuletzt kommen dabei auch Beziehungserfahrungen zum Tragen, also emotionale Einwirkungen im Zusammenspiel mit der Umwelt. Wie sieht es mit der Beweiskraft von Familien-, Adoptions- und Zwillingsstudien aus? Seit Jahrzehnten werden sowohl in der psychoanalytisch orientierten wie auch in der systemischen Familienforschung die vielfältigen psychodynamischen Verflechtungen zwischen den Generationen beschrieben, so daß es heute mehr als naiv erscheint, Familienähnlichkeiten - vor allem im Hinblick auf Verhaltensauffälligkeiten - als Beleg für Erblichkeit zu interpretieren. Adoptions- wie Zwillingsstudien gehen von der stillschweigenden Voraussetzung aus, dass Erfahrungen vor der Geburt oder aus der frühen Säuglingszeit für die weitere Entwicklung vernachlässigt werden können. Aus Platzgründen muß hier auf die Literatur verwiesen werden (Haibach und Janus 1997, Janus 1993). Edelman hat mit tierexperimentellen Untersuchungen herausgefunden, daß die neuronalen Netzwerkstrukturen bei neugeborenen Zwillingen nicht übereinstimmen (Deneke 1999). Zusammenfassend kann gesagt werden, daß Neurobiologie, Säuglingsforschung und die Erfahrungen aus Therapien vielfältige Hinweise auf die Bedeutung früher Einflüsse erbracht haben. Die erwähnte Ähnlichkeit zwischen Adoptivkindern und ihren leiblichen Eltern sagt daher eben so wenig über ein Vorwiegen genetischer Einflüsse wie die erhöhte Konkordanz von Verhaltensauffälligkeiten bei Zwillingen. Aus dem bisher Dargestellten ergeben sich schwerwiegende Zweifel am Modell eines primär genetisch bedingten Mangels an Botenstoffen. Bierbaumer und Schmidt schreiben in ihrer "Biologischen Psychologie" (1996, 475): "Theorien dieser Art, in denen ein bestimmter Wirkstoff für die Entstehung einer komplexen meist äußerst heterogenen Verhaltenstörung (bestehend aus mehreren abgrenzbaren Erkrankungen) verantwortlich gemacht wurden, erwiesen sich in allen Fällen als unrichtig. Dies um so mehr, als bei allen psychiatrischen und psychologischen Störungen nichtneuronale Faktoren eine wesentliche Rolle spielen". Letztlich geht es nicht um die Frage, ob biologische Faktoren wirksam sind, sondern darum, ob sie in jedem Fall eine ursächliche Rolle spielen. Dies gilt in besonderem Maße für die Frage der genetischen Belastung. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, zu welchen Folgen eine Etikettierung mit genetischen Merkmalen im Sinne eines unausweichlichen Schicksals führen kann. Wenn die heutigen Vorstellungen von Genetik nicht gleichzeitig erläutert werden, ist der Eindruck jener Zwangsläufigkeit immer noch nahe liegend. Von daher liegt in der Formulierung von Döpfner et al. (2000, S. 16), die "primären Ursachen dieser Störung" lägen "in genetischen Dispositionen, die eine Störung des Neurotransmitterstoffwechsels ... bewirken" ein Widerspruch: geht man davon aus, dass wirklich nur von "Disposition" und einer Genetik im oben erläuterten Sinne die Rede ist, so bleibt unklar, worauf sich angesichts der vielfältigen, auch sozialen Einflußgrößen (S. 14-16) die Klassifizierung von "primär" und "eher eine Reaktion auf die hyperkinetische Störung" stützt - es sei denn, dass der biologische Faktor wieder a priori als ursächlich angenommen wird. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass ein großer Teil der Untersuchungen aus ethischen Gründen (Einsatz radioaktiver Substanzen) an Erwachsenen teilweise aufgrund von anamnestischen (also immer sehr stark einer nachträglichen Bewertung ausgelieferten) Daten und nicht an der zur Diskussion stehenden Personengruppe der Kinder und Jugendlichen vorgenommen wurde. Barkley, einer der namhaftesten Vertreter der neurobiologischgenetisch orientierten Forschungsrichtung, dessen Handbuchartikel von 1998 zahlreiche andere Autoren (u.a. Döpfner 2001) als Quelle für "gesichertes Wissen" über die primär biologischen Ursachen des AD(H)S behandeln, schreibt 1999: "Zur Zeit kennen wir die eigentlichen Ursachen für das hyperaktive Syndrom ... noch nicht". Zu 2.: Stillschweigende Voraussetzung ist häufig die Vorstellung von einem Individuum, dessen Symptome als Ausdruck seiner Krankheit zu werten sind. Zu fragen bleibt, ob "Hyperaktivität" nicht auch als Bewältigungsstrategie verstanden werden könnte - als der Versuch, sich handlungsfähig und kohärent zu fühlen - ; ob bei der "Aufmerksamkeitsstörung" nicht die Bedeutung dessen, auf was sich Aufmerksamkeit beziehen soll, entscheidend ist - auch die Hirnforschung sprich ja heute davon - und ob "Impulsivität" erst recht keine primäre "Pathologie" darstellt, sondern nur im Kontext psychodynamischer Prozesse zu beurteilen ist. Hinzu kommt das Zusammenspiel mit der Umwelt und deren "Störungen" - das individuelle Symptom als Antwort in diesem Kontext. Als Bilanz ergibt sich aus dem bisher Dargestellten, dass es sich beim "ADS" bzw. "ADHS" um ein "Krankheitsbild" handelt, bei dem eine Vielzahl möglicher Auslöser in einem jeweils unterschiedlichen Zusammenspiel zu Manifestationen führen kann, deren Bedeutung sich erst im Zusammenhang klären läßt. Damit kommen wir zu 3.: Wieder stellt sich die Frage nach stillschweigend vorausgesetzten Denkmodellen. Wird professionelle Kompetenz als Bündelung aller Fachkenntnisse bei den Spezialisten und die Rolle der Hilfesuchenden als die von geduldigen, Hilfe anfordernden "Patienten" verstanden oder verbünden sich Fachleute und "Laien" in der Lösung eines Problems, indem jeder seine Kompetenzen beisteuert? Damit stellt sich weiterhin die Frage, ob es bei derart komplexen Problemen wie dem hier diskutierten überhaupt eine grundsätzlich "richtige" oder "falsche" Intervention geben kann. Werden nicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Hilfen wirksam? Eines entwickelt sich in jedem Fall bei der Begegnung zwischen einem Professionellen - sei es Psychologe, Pädagoge, Arzt oder ein Vertreter anderer Berufsgruppen - und einer hilfesuchenden - in der Regel - Familie: eine Beziehung auf dem Hintergrund aller vorangegangenen Beziehungserfahrungen auf beiden Seiten. Hier besteht die Gefahr, dass - je größer die Not auf der Seite der Familie geworden ist - die Erwartung an den Fachmann zunimmt und das Vertrauen in eigene Lösungsmöglichkeiten schwindet. Die Frage der Schuld gewinnt dabei vor allem an Bedeutung: jede Vermutung von möglichen psychodynamischen Verflechtungen wird unter diesen Aspekten zum Problem: bei der Familie oft auf dem Hintergrund vorangegangener Schuldzuweisungen, bei den Professionellen aus der Sorge heraus, das Bündnis mit der Familie schon im Vorfeld zu gefährden. Nicht selten entsteht daraus eine letztlich auf Angst gegründete Allianz zwischen Professionellen und Betroffenen, besonders den in Selbsthilfegruppen organisierten. Die Tabuisierung von psychodynamischen Zusammenhängen aus Angst vor der Schuld-Falle schafft eine wechselseitige Abhängigkeit, die auf beiden Seiten wertvolle Ressourcen blockiert. Die immanenten Kenntnisse der Familien über Zusammenhänge, die sich bis weit in die biographischen Verflechtungen verfolgen ließen, bleiben auf der Strecke. Hier könnte es Aufgabe der Professionellen sein, Familien aus dem Dilemma der Schuldgefühle herauszuhelfen, anstatt sie durch ständige "Absolution" immer mehr in Abhängigkeit und Unmündigkeit zu fixieren (Niedecken 1989). Dies alles liegt noch im Vorfeld von Interventionen. Diese beginnen bei dem Problem der Not, des Leidens von Familien und der Not-Wendigkeit von Hilfe. Steuert dieses Leiden der Katastrophe zu - etwa dem drohenden Schulverweis, der sich zuspitzenden sozialen Isolierung, der Suizidgefahr - geht es erst einmal um unmittelbar wirksame Hilfe. Die Aufdeckung von Hintergründen ist dabei nachrangig. Hier hat die medikamentöse Therapie ihren Stellenwert, wenn sie nach den Richtlinien praktiziert wird, die Döpfner (2001) und die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie empfehlen. Dies wird nicht überall so praktiziert - die fatalen Folgen einer Vorstellung von "Stoffwechselstörungen", der Analogie zur Brille und zum Insulin. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass es nicht in jedem Fall eine Kopplung der beobachtbaren Wirksamkeit von Methylphenidat mit meßbaren Stoffwechselparametern gibt: Matochik et al. (1994) wiederum aus dem Zametkin-Team - fanden nur bei zwei von 60 Versuchspersonen nach sechswöchiger Stimulanzientherapie Veränderungen in den Stoffwechselparametern, während das Verhalten sich bei allen veränderte (weniger Unruhe, bessere Aufmerksamkeit). Auch Ernst et al. (1994) konnten nach Stimulanzienzufuhr durch eine intravenöse Infusion keine Veränderung im Hirnstoffwechsel feststellen, die mit dem Verhalten korrelierbar gewesen wären. Lediglich Lou beobachtete nach Methylphenidat bei den als hyperkinetisch klassifizierten Versuchspersonen eine Zunahme der vorher verminderten Durchblutung (Lou 1990). Über Langzeitergebnisse der medikamentösen Behandlung liegen nach wie vor keine verläßlichen Erkenntnisse vor (Döpfner 2001) Zur Suchtgefahr ist zu fragen, ob diese Diskussion die Problematik zu sehr an der pharmakologischen Substanz fixiert. Bisher wurde eine sicher durch Methylphenidat ausgelöste Sucht nicht bekannt. Besteht die Suchtgefahr nicht vor allem dann, wenn einem Leiden nicht mit adäquater Hilfe begegnet wird ? Damit wird die medikamentöse Therapie - in deren Wirksamkeit immer auch die Beziehung zum Behandelnden eingeht - ein Teil der gesamten je nach aktueller Situation unterschiedlichen Intervention. Beispielhaft für eine solche Strategie ist immer noch die konkrete Schilderung von Wirtz (Voß & Wirtz 2000). Wie hier dürfte sich bei vielen Kindern/Jugendlichen und deren Familien im Anschluss an eine hilfreiche medikamentöse Behandlung der Wunsch nach anderen Möglichkeiten sich entwickeln - sei es aus einem wachsenden Widerstand dagegen, in seinem Verhalten, seinen Fähigkeiten ständig von einer "Pille" abhängig zu sein, sei es wegen der Nebenwirkungen (s. Döpfner 2001) oder deshalb, weil die Familien die witzigen, kreativen, verleugnete Schwächen der Erwachsenen treffsicher aufgreifenden Seiten des Kindes vermissen. Hier stellt sich die Frage, inwieweit die Professionellen bereit und in der Lage sind, als Ansprechpartner und mit Hilfen bei solchen Prozessen zur Verfügung zu stehen. Dabei kommt der Stellenwert des unbequemen, nicht angepaßten kreativen Menschen zum Tragen: für den einzelnen und innerhalb der Gesellschaft. An Modelle und Erfahrungen dazu findet sich ein breites Spektrum in der Literatur (u. a. für die Schule: Voß 2000, für Interventionskonzepte: Passolt 2001). Alle Hilfen sind untrennbar mit - oft nicht ausdrücklich diskutierten - Zielvorstellungen verbunden, mit dem Menschenbild und der Entwicklung von Identität (von Lüpke 2000). Die Kompetenz von Pädagogen hat hier einen zentralen Stellenwert. Manchem mag dies zu ungenau, zu wenig entschieden vorkommen. "Für oder gegen Medikamente": geht es dabei nicht um Schein-Genauigkeit ? Erfordert es nicht sehr viel mehr Genauigkeit, in der spezifischen Situation die Hilfen zu finden, die jetzt angebracht sind - und gegebenenfalls die professionelle Kooperation zu suchen (von Lüpke & Voß 2000) ? Ein Vergleich mit Musik sei erlaubt: nicht ein bestimmtes Instrument, nicht eine Tonfolge oder ein Klang sind gut oder schlecht. Es kommt darauf an, sie an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit und im richtigen Kontext einzusetzen. Literatur Barkley, R.A. (1999) Hyperaktive Kinder, Spektrum der Wissenschaft März 1999, 30--36 Birbaumer, N., Schmidt, R.F. (1996) Biologische Psychologie. 3. Aufl. , Berlin/Heidelberg/New York Deneke, F.-W. (1999) Psychische Struktur und Gehirn. Die Gestaltung subjektiver Wirklichkeiten, Stuttgart/New York Döpfner, M., Frölich, J., Lehmkuhl, G. (2000) Hyperkinetische Störungen, Göttingen Döpfner, M. (2001) Pillen für den Störenfried?, Pädagogik 1, 24-26 Droll, W. (1998) Aufmerksamkeits/Hyperaktivitätsstörung. Ein weithin verkanntes Störungsbild bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, NeuroTransmitter 34, 19--26 Ernst, M. , Zametkin, A. J. , Matochik, J. A. , Liebenauer, L. , Fitzgerald, G. A. , Cohen, R. M. (1994) Effects of intravenous dextroamphetamine on brain metabolism in adults with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). Preliminary findings, Psychopharmacology Bulletin 30, 219--225 Frankfurter Rundschau (2001) Schon erwartete Besserung lindert Parkinson. 184, 35 Haibach, S., Janus, L. (1997) Seelisches Erleben vor und während der Geburt, Neu Isenburg Janus, L. (1993) Wie die Seele entsteht, München Kanders, J. (2001) Lehrer sollten nicht in die Therapie der Kinder- und Jugendärzte eingreifen, Kinder- und Jugendarzt 32, 7, 549-551 Kühle, H.-J. (1998) Tagungsbericht vom ADS-Symposium in Gießen, der kinderarzt 29, 1347-1353 Lüpke, von., H. (2000) Das Spiel mit der Identität als lebenslanger Entwicklungsprozess. In: Lüpke, von, H. & Voß, R. (Hrsg.): Entwicklung im Netzwerk. Systemisches Denken und professionsübergreifendes Handeln in der Entwicklungsförderung, 3. überarbeitete Auflage, Neuwied, S. 84-95 Lüpke, von, H. & Voß, R. (Hrsg.) (2000) Entwicklung im Netzwerk. Systemisches Denken und professionsübergreifendes Handeln in der Entwicklungsförderung, 3. überarbeitete Auflage, Neuwied Lüpke, von, H.: Hyperaktivität zwischen "Stoffwechselstörung" und Psychodynamik. In: Passolt, M. (Hrsg.) (2001) Hyperaktivität zwischen Psychoanalyse, Neurobiologie und Systemtheorie, München, S. 111-130 Lou, H. C. , Henriksen, L. , Bruhn, P. (1984) Focal cerebral hypoperfusion in children with dysphasia and/or attention deficit disorder, Archives of Neurology 41, 825--829 Lou, H.C. (1990) Methylphenidate reversibel hypoperfusion of striatal regions in ADHD. In : Connors, K., Kindsbourne, M. (eds) : Attention Deficit Hyperactivity Disorder, München, 137--148 Matochik, J. A. , Liebenauer, L. L. , King, A. C. , Szymanski, H. V. , Cohen, R. M. , Zametkin, A. J. (1994) Cerebral glucose metabolism in adults with attention deficit hyperactivity disorder after chronic stimulant treatment, American Journal of Psychiatry 151, 658--664 Niedecken, D. (1989) Namenlos. Geistig Behinderte verstehen. Piper, München Overmeyer, S. & Taylor E. (2001) Neuroimaging in hyperkinetic children and adults: an overview, Pediatric Rehabilitation 4, 57-70 Passolt, M. (Hrsg.) (2001) Hyperaktivität zwischen Psychoanalyse, Neurobiologie und Systemtheorie, München, S. 111-130 Perry, B. (1996) Incubated in terror: Neurodevelopmental factors in the "cycle of violence 2. In: Osofsky, D. (rd.): Children, Youth and violence: Searching for Solutions, New York Roth, G. (1999a) Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen, 3. überarbeitete Aufl., Frankfurt/M. Roth, G. (1999b) Entstehen und Funktion von Bewußtsein, Deutsches Ärzteblatt 96, A-1957--A-1961 Shore, R. (1997) Rethinking the Brain. New Insights into Early Development, New York Singer, W. (2001) nach: Der geheimnisvolle Sound der "grauen Substanz", Frankfurter Rundschau 145, 29 Stern, D. N. (1992) Die Lebenserfahrung des Säuglings, Stuttgart. Original (1985) The Interpersonal World of the Infant, New York Voß, R. (Hrsg.) (2000) Verhaltensauffällige Kinder in Schule und Familie, Neuwied Voß, R. & Wirtz, R. (2000) Keine Pillen für den Zappelphilipp, Reibek bei Hamburg Zametkin, A. J. , Nordahl, T. E. , Gross, M. , King, A. C. , Semple, W. E. , Rumsey, J. , Hamburger, S. , Cohen, R. M. (1990) Cerebral glucose metabolism in adults with attention deficit hyperactivity of childhood onset, New England Journal of Medicine 323, 1361--1366 Übersetzung der fremdsprachlichen Texte vom Autor.