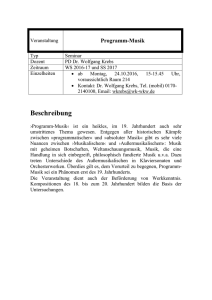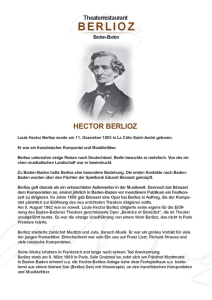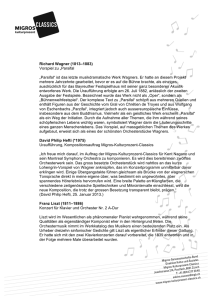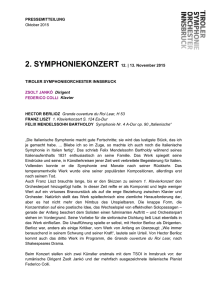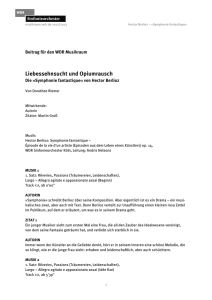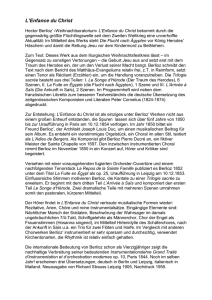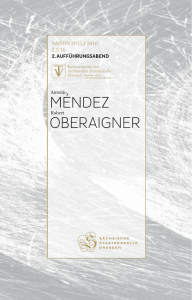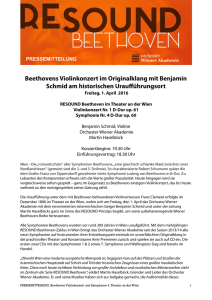Programmheft herunterladen
Werbung

DEBUSSY »Prélude à ›L’après midi d’un faune‹« BERLIOZ Auszüge aus »Roméo et Juliette« BEETHOVEN 7. Symphonie Mittwoch 11_01_2017 20 Uhr Motiv: DANIELA IBLER GERGIEV, Dirigent Die ersten Veröffentlichungen unseres neuen MPHIL Labels Valery Gergiev dirigiert Bruckner 4 & Mahler 2 zusammen mit den Münchner Philharmonikern mphil.de CLAUDE DEBUSSY »Prélude à ›L’Après-midi d’un Faune‹« HECTOR BERLIOZ Fünf Orchesterstücke aus »Roméo et Juliette« 1. »Introduction« 2. »Roméo seul: Tristesse – Bruit lointain de bal et de concert – Grande fête chez Capulet« 3. »Scène d’amour« 4. »Scherzo: La Reine Mab ou la Fée des songes« 5. »Roméo au tombeau des Capulets« LUDWIG VAN BEETHOVEN Symphonie Nr. 7 A-Dur op. 92 1. Poco sostenuto – Vivace 2. Allegretto 3. Presto – Assai meno presto 4. Allegro con brio VALERY GERGIEV, Dirigent 118. Spielzeit seit der Gründung 1893 VALERY GERGIEV, Chefdirigent ZUBIN MEHTA, Ehrendirigent PAUL MÜLLER, Intendant 2 Der Traum in der Flöte des Fauns PETER JOST CLAUDE DEBUSSY (1862–1918) »Prélude à ›L’Après-midi d’un Faune‹« (Vorspiel zu »Der Nachmittag eines Fauns«) LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN Geboren am 22. August 1862 in SaintGermain-en-Laye (Département Yvelines / Region Paris); gestorben am 25. März 1918 in Paris. ENTSTEHUNG Debussys Komposition ist der Versuch einer musikalischen Annäherung an die 1876 publizierte, 110 Alexandriner umfassende Ekloge »L’Après-midi d’un Faune« (Der Nachmittag eines Fauns) des französischen Symbolisten Stéphane Mallarmé (1842–1898). Ursprünglich war die um 1891 begonnene Komposition als symphonisches Triptychon geplant und wurde noch im Frühjahr 1894 als »Prélude, Interlude et Paraphrase pour ›L’Après-midi d’un Faune‹« angekündigt. Zur Ausführung gelangte aber nur der erste Teil, das im September 1894 beendete »Prélude«. WIDMUNG Im Druck widmete Debussy das Werk dem Komponisten Raymond Bonheur (1861– 1939), seinem Freund und ehemaligen Mitschüler am Pariser Conservatoire National de Musique. Das handschriftliche Particell widmete er Gabrielle (»Gaby«) Dupont (1866–1945), seiner Lebensgefährtin von 1890 bis 1898, im gleichen Monat, in dem er seine erste Frau Rosalie (»Lilly«) Texier heiratete: »À ma chère et très bonne petite Gaby la sûre affection de son dévoué Claude Debussy / Octobre 1899« (Meiner lieben und vortrefflichen kleinen Gaby ihr in aufrichtiger Zuneigung ergebener Claude Debussy / Oktober 1899). URAUFFÜHRUNG Am 22. Dezember 1894 in Paris in der Salle d’Harcourt (Orchester der »Société Nationale de Musique« unter Leitung von Gustave Doret). Claude Debussy: »Prélude à ›L’Après-midi d’un Faune‹« 3 Marcel Baschet: Claude Debussy (1884) Claude Debussy: »Prélude à ›L’Après-midi d’un Faune‹« 4 ÄSTHETISCHE WAHLVERWANDTSCHAFT 1884 gewann Claude Debussy den begehrten Rom-Preis als krönenden Studien­ abschluss am Pariser Conservatoire, brach aber den sich anschließenden Aufenthalt in der »Ewigen Stadt« bereits im März 1887 vorzeitig ab, um nach Paris zurückzukehren. Er wandte sich in den folgenden Jahren verstärkt den literarischen Zirkeln der französischen Hauptstadt zu und kam im Herbst 1890 in Kontakt mit Stéphane Mallarmé, der ihn für die Mitarbeit an einer szenischen Fassung von »L’Après-midi d’un Faune« gewinnen wollte – ein Projekt, das zwar nicht verwirklicht wurde, aber letztlich Debussy die Anregung zu seinem gleichnamigen Orchesterwerk gab. Offenbar begegneten sich hier zwei Künstler mit ähnlichen Vorstellungen von künstlerischer Ästhetik – ein von Musik inspirierter Dichter und ein literarisch aufgeschlossener Musiker, die zahlreiche gemeinsame Vorlieben hatten und sich gegenseitig zu schätzen wussten. Mallarmé, der sich in der Regel über musikalische Werke, die seine Gedichte als Vorlagen benutzten, sehr zurückhaltend äußerte, war von Debussys kompositorischer Umsetzung tief beeindruckt und notierte in sein Druckexemplar des »Prélude« die folgenden synästhetischen Verse: »Sylvain d’haleine première, / Si ta flûte a réussi, / Ouïs toute la lumière / Qu’y soufflera Debussy !« (Waldgott, wenn schon mit dem ersten Atem / Deine Flöte erfolgreich war / Höre all das Licht, / das Debussy ihr noch einhauchen wird !). »POÉSIE PURE« Mallarmés Dichtung lehnt sich vordergründig noch an die Schäfer-Szenerien der klassizistischen Parnasse-Lyrik an: eine idyllische Landschaft auf Sizilien an einem Sommernachmittag mit einem Faun, der träumend die Vorstellung eines ihn verlockenden Nymphenpaars und die blühende Natur um ihn herum beschwört. Aber der Durchbruch zu einer völlig neuen literarischen Richtung, zur »poésie pure« des Symbolismus, zeigt sich in der Durchführung des Themas wie auch in der Form. Die künstlerische Gestaltung ist nicht mehr an die Nachahmung der Natur gebunden, sondern schafft sich im Traum ihre eigene Welt; das Dichten selbst wird jenseits der Abbildung von Realität zum Thema der Dichtung, wobei quasi »musikalische« Mittel wie suggestive Klangbezüge, wohl kalkulierte Rhythmen, kunstvolle Pausen zum Einsatz gelangen. Mallarmé war vor allem deshalb so angetan von Debussys Musik, weil er zunächst befürchtet hatte, der Komponist versuche eine illustrative »Übertragung« seiner Verse. Aber gerade das vermied Debussy: Im »Prélude« geht es um die Umsetzung der Stimmung des Gedichts, nicht seiner Handlungsmotive, um vage Andeutungen, nicht um konkrete Beschreibungen. Die von Mallarmé beschworene Szene, die einschläfernde Hitze des Sommernachmittags und die schwül-laszive Sphäre der Begierden und Empfindungen werden durch eine traumverlorene, oszillierende Musik vermittelt. Auf die Nachfrage eines Musikkritikers äußerte Debussy: »Ist mein Prélude à ›L’Après-midi d’un Faune‹ nicht vielleicht das, was in der Flöte des Fauns von seinem Claude Debussy: »Prélude à ›L’Après-midi d’un Faune‹« 5 Léon Bakst: Figurine für Vaslav Nijinsky, der in Sergej Diaghilews Ballett-Version des »Prélude« den Faun tanzte (1912) Claude Debussy: »Prélude à ›L’Après-midi d’un Faune‹« 6 Traum zurückgeblieben ist ? Genauer gesagt: es ist der ›allgemeine‹ Eindruck der Dichtung !« MAGISCHE SCHWEBEZUSTÄNDE Die Wahl der Soloflöte als Träger des Hauptgedankens, mit dem das Stück beginnt, ergibt sich aus dem traditionellen Attribut der Faune, der Söhne des römischen Waldgottes Faunus, den man später mit dem griechischen Hirtengott Pan gleichsetzte. Dieser Hauptgedanke – von einem Thema mag man angesichts der lockeren, unsymmetrischen Fügung kaum reden – besteht aus einer wiederholten, chromatisch ab- und aufsteigenden Bewegung sowie einer nachfolgenden diatonischen Wendung und enthält damit keimhaft das komplette motivische Material des ganzen Stücks. Zunächst unbegleitet exponiert, kehrt der Komplex in zehn Varianten wieder, dabei jedes Mal auf andere Weise harmonisiert. Die Anlage als Variationswerk wird jedoch durch andere Formmodelle überlagert: durch die Sonatensatzform aufgrund einiger durchführungsartiger Abschnitte sowie durch die Bogenform, die sich durch den stark kontrastierenden Mittelteil ergibt. de«, das trotz aller Vorbehalte gegenüber Schlagworten immer wieder als »Geburtsstunde des musikalischen Impressionismus« bezeichnet wurde, konnte sich auch das Publikum der Uraufführung nicht entziehen. Die Begeisterung war so groß, dass das Stück unmittelbar wiederholt werden musste. Daraus resultiert unter formalem Aspekt ein eigenartiger Schwebezustand, der durch Rhythmik und Harmonik, vor allem aber durch besondere Instrumentation noch zusätzlich bekräftigt wird. Letztere ist betont transparent und leicht gehalten; bezeichnenderweise sieht die Besetzung zwei Harfen und ein reichhaltiges Holzbläserensemble vor, verzichtet aber auf Trompeten, Posaunen, Tuben und Pauken. Der ganz neuartigen Klanglichkeit des »Prélu- Claude Debussy: »Prélude à ›L’Après-midi d’un Faune‹« 7 »Unter Shakespeares Liebessonne« PETER JOST LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN HECTOR BERLIOZ (1803–1869) Fünf Orchesterstücke aus »Roméo et Juliette« »Symphonie dramatique« für Solostimmen, zwei gemischte Chöre und Orchester op. 17 1. »Introduction« 2. » Roméo seul: Tristesse – Bruit lointain de bal et de concert – Grande fête chez Capulet« 3. »Scène d’amour« 4. » Scherzo: La Reine Mab ou la Fée des songes« 5. »Roméo au tombeau des Capulets« Geboren am 11. Dezember 1803 in La CôteSaint-André (Département Isère / Frankreich); gestorben am 8. März 1869 in Paris. TEXTVORLAGE Die Gesangstexte verfasste Émile Des­ champs (1791–1871) nach einem eigenhändigen Prosaentwurf des Komponisten, der sich auf die altenglische Tragödie »Romeo and Juliet« von William Shakespeare (1564–1616) in der 1776 erstmals erschienenen französischen Übersetzung von Pierre Letourneur stützte. ENTSTEHUNG »Roméo et Juliette« entstand vom 24. Januar bis 8. September 1839 in Paris. Eine revidierte, zweite Fassung der Partitur gelangte 1847 zum Druck; Berlioz’ Änderungen bestanden vor allem in Kürzungen der Vokalpartien. Nach weiteren Änderungen zwischen 1854 und 1857 erschien 1858 eine »2me édition corrigée«. Hector Berlioz: »Roméo et Juliette« 8 WIDMUNG Berlioz widmete sein Werk Niccolò Paganini (1782–1840), der ihm nach einem Konzert im Dezember 1838 ein Geldgeschenk von 20.000 Francs gemacht hatte, womit der Komponist seinen Lebensunterhalt für die Zeit der Komposition von »Roméo et Juliette« weitgehend absichern konnte. URAUFFÜHRUNG Am 24. November 1839 in Paris (Chor und Orchester des »Conservatoire National de Musique« unter Leitung von Hector Berlioz; Solisten: Madame Widemann, Alt; Alexis Dupont, Tenor; Adolphe Alizard, Bass). BEGEISTERUNG FÜR SHAKESPEARE Wie schon für die Künstler der »Sturm und Drang«-Epoche wurde Shakespeare auch für die Romantiker zum Leitstern wahrer Dramatik. Berlioz’ Schlüsselerlebnis waren seine Besuche der Vorstellungen einer englischen Theatertruppe in Paris im September 1827. Er verliebte sich nicht nur spontan in die Darstellerin der Ophelia und Julia, die irische Schauspielerin Harriet Smithson, die er 1833 heiraten sollte. Vielmehr empfand er die Aufführungen von »Hamlet« und »Romeo und Julia« in der Bearbeitung des englischen Schauspielers David Garrick (1716–1779) als ideale Interpretationen. Seine Begeisterung entzündete sich also weniger am originalen Text (oder dessen französischer Übersetzung) als am Erlebnis der Bühnendarstellung. Diese Shakes­ peare-Begeisterung schlug sich in der Folgezeit einerseits in der zeitweise sehr starken Identifikation mit entsprechenden Bühnenfiguren nieder, wie seine Briefe und Memoiren belegen, andererseits aber auch in konkreten Kompositionen über Shakes­ peare-Sujets: von der »Fantaisie sur ›La Tempête‹ de Shakespeare« (1830) über die Konzertouvertüre »Le roi Lear« (1831) bis hin zur Oper »Béatrice et Bénédict« (1862) nach der Komödie »Much Adoe about Nothing« (Viel Lärm um nichts). Die Erinnerung an die Aufführung von »Romeo und Julia« von 1827 bewahrte Berlioz offenbar über viele Jahre hinweg, in denen gelegentlich Pläne zur Vertonung des Stoffs anklingen, bis er sie 1839 tatsächlich umsetzen konnte. Denn er folgte der Bearbeitung Garricks – auf der im übrigen Hector Berlioz: »Roméo et Juliette« 9 Mphil_18_Piollet_Z0.indd 11 04.03.2008 Pierre Paul Emmanuel de Pommayrac: Auf Elfenbein gemaltes Miniaturportrait von Hector Berlioz (1839) Hector Berlioz: »Roméo et Juliette« 8:33:24 Uhr 10 auch die von Berlioz benutzte französische Übersetzung von Letourneur fußt – nicht nur in der Konzentration des Dramas auf die Liebestragödie, sondern auch in konkreten, vom Original abweichenden Handlungselementen: Romeo ist, anders als bei Shakespeare, von Anfang an in Julia verliebt, die scheintote Julia wird in einer Prozession zu Grabe getragen, und die Liebenden können für kurze Zeit in der Gruft ihr Wiedersehen feiern, bevor das eingenommene Gift bei Romeo wirkt. Dagegen geht die von Berlioz breit ausgeführte Versöhnung der Familien im »Final« über die Garrick-Version hinaus und entspricht wieder stärker der Originalfassung Shakespeares, ohne ihr allerdings genau zu entsprechen. Nicht vergessen werden sollte aber auch, dass Berlioz sich die Freiheit nahm, Handlungsteile frei zu erfinden oder auszuspinnen. So wird aus einer an sich belanglosen kurzen Passage, in der Mercutio seinen Freund Romeo damit aufzieht, dessen Liebeskummer sei wohl die Folge eines Besuchs der Traumfee Mab, ein ganzer Symphoniesatz. »SYMPHONIE DRAMATIQUE« Der Komponist selbst bezeichnete »Roméo et Juliette« stets als »Symphonie« und stellte im Vorwort zur Druckausgabe klar: »Zu welcher Gattung dieses Werk gehört, unterliegt sicherlich keinem Zweifel. Obwohl oft Singstimmen verwendet werden, ist es weder eine Konzertoper noch eine Kantate, sondern eine Symphonie mit Chören.« Damit rückte Berlioz sein Opus 17 in die Nähe von Beethovens 9. Symphonie, die mit ihrem neuartigen Chorfinale zahlreiche Komponisten von Mendelssohn über Liszt bis hin zu Mahler zu ähnlich gearteten ei- genen Werken inspirieren sollte. So deutlich die Anspielung auch ausfällt – »Symphonie avec choeurs« (Symphonie mit Chören) war die damals in Frankreich übliche Bezeichnung für Beethovens »Neunte« –, so augenfällig sind doch die Unterschiede beider Kompositionen. Bei Beethoven, für den sich die Botschaft des Werks nur mit vokalen Mitteln ausdrücken ließ, diente der Schlusschor als apotheotische Steigerung der vorangegangenen Instrumentalsätze. Berlioz konnte und wollte zwar auf den krönenden Abschluss mit Chören nicht verzichten, jedoch sparte er den Gesang ja keineswegs für dieses »Final« auf, sondern ließ ihn durchgängig mit instrumentalen Teilen abwechseln. Sein Verfahren erläuterte er selbst wie folgt: »Wenn nahezu von Anfang an der Gesang mitwirkt, dann zu dem Zweck, den Geist des Hörers auf die dramatischen Szenen einzustimmen, deren Gefühlsgehalt und Leidenschaftlichkeit durch das Orchester ausgedrückt werden sollen.« Hier scheint also gerade die gegenteilige Funktion der Vokalteile durch: Der Chor bzw. die Soli und Rezitative dienen nicht der Steigerung des instrumentalen Ausdrucks wie bei Beethoven, sondern leiten vielmehr zu den nachfolgenden Instrumentalsätzen hin, die die »eigentlichen« dramatischen Szenen umsetzen. So erklärt sich auch die zunächst verblüffende Maßnahme, in einer Symphonie mit Chören und Soli auf eigene Gesangspartien für die Protagonisten Romeo und Julia zu verzichten: »Die Erhabenheit dieser Liebe machte ihre Schilderung für den Musiker so gefährlich, dass er seiner Phantasie einen Spielraum gönnen [...] und zur instrumentalen Sprache seine Zuflucht nehmen musste, einer Hector Berlioz: »Roméo et Juliette« 11 reicheren, mannigfaltigeren, weniger fixierten Sprache, und gerade dadurch in einem solchen Fall durch ihre Unbestimmtheit unvergleichlich wirkungsvolleren.« Berlioz präsentiert sich in der Umkehrung des klassischen Verhältnisses zwischen Instrumental- und Vokalmusik als Prototyp eines Romantikers, und die Nähe zur Musik­ anschauung eines E. T. A. Hoffmann ist mit Händen zu greifen. Sieht man vom Finale ab, das Berlioz selbst als einzige Szene empfand, »die in den Rahmen der Oper oder des Oratoriums gehört«, zielt folglich der Untertitel des Werks »Symphonie dramatique« im Kern auf die Instrumentalteile ab. »Dramatisch« ist also weniger als Gattungsbegriff gemeint, sondern als davon metaphorisch abgeleitetes Charakteristikum, das dementsprechend auch von den Instrumentalsätzen in Anspruch genommen werden kann. Sie gelten dann als »dramatisch«, wenn sie die Leidenschaften und Gefühle eines Dramas bzw. einer bestimmten Szene wahrhaft, d. h. ausdrucksstark und lebendig, wiedergeben können. AUFBAU UND FORM Das besondere Verständnis des Dramatischen spiegelt sich unmittelbar im Aufbau von »Roméo et Juliette«. Während die Vokalpartien, vom großen »Final« abgesehen, überwiegend Berichte oder Kommentare geben (»Prologue«, »Strophes«, »Scherzetto«), sind zentrale Szenen der Handlung instrumental behandelt. Da es sich in deren Abfolge um ein Allegro mit langsamer Einleitung handelt (»Roméo seul: Tristesse – Bruit lointain de bal et de concert – Grande fête chez Capulet«), um ein Adagio (»Scène d’amour«), ein Scherzo (»La Reine Mab ou la Fée des songes«) sowie um ein weiteres Allegro (»Roméo au tombeau des Capulets«), ergibt sich als Gerüst eine viersätzige Symphonie, deren Sätze allerdings starke Unterschiede zu den üblichen Formschemata zeigen und die durch weitere Teile bzw. Sätze beträchtlich erweitert wird. Dennoch sollte das Gewicht dieser Erweiterungen nicht überschätzt werden. Von einer gleichberechtigten Mischung zwischen Symphonie und Oper kann keine Rede sein. Es kam Berlioz nicht auf eine dramaturgisch geschlossene Szenenfolge wie in einem wirklichen Bühnenwerk an, sondern er setzte die Kenntnis von Shakespeares Drama beim Publikum voraus, um auf dieser Basis den Kern seines Werks, nämlich die rein symphonischen Sätze, auszubreiten. Darauf ging Berlioz in einer Anmerkung zu Beginn des Satzes ausdrücklich ein, der im Orchester die Gruft-Szene mit den emotional so stark kontrastierenden Momenten überschäumender Freude und tiefster Verzweiflung zu vermitteln hat: »Die folgende Instrumentalszene sollte weggelassen werden, wenn man diese Symphonie nicht vor einem gebildeten Publikum mit einem ausgeprägten Gefühl für Poesie spielt, das den fünften Akt des Shakespeare-Dramas und die Version von Garrick sehr gut kennt.« Die vokalen Teile waren für eine wirkliche Vertonung des Stoffes sicherlich unverzichtbar, wobei natürlich auch die besondere Wirkung von Orchester- und Chorgesang für Berlioz eine gewisse Rolle gespielt hat: Über die Versöhnung der verfeindeten Familien am Ende sagte er, die Szene »sei zu schön, zu musikalisch und eine zu gute Krönung eines Werkes dieser Art, als dass der Komponist hätte erwägen können, sie anders zu behandeln«. Aber sie sind gleichsam nur ein notwendiges Hilfs- Hector Berlioz: »Roméo et Juliette« 12 mittel und stehen keineswegs im Zentrum der Werkkonzeption. Insofern dürfte die originale Benennung als »Symphonie dramatique avec choeurs, solos de chant et prologue en récitatif choral« tatsächlich die angemessenste Beschreibung dieser eigenartigen Mischung verschiedener Gattungen sein. THEMEN UND ZYKLUSCHARAKTER Das Zyklus-Problem für mehrsätzige symphonische Werke stellte sich für eine Komposition wie »Roméo et Juliette« mit stark kontrastierenden Sätzen und Teilen in einer Ausdehnung von mehr als anderthalb Stunden in besonders zugespitzter Form. Die Erfindung eines durchgängigen Leitthemas, wie Berlioz es in seinen früheren Symphonien erfolgreich praktiziert hatte (»Idée fixe« in der »Symphonie fantastique«, »Harold«-Thema in »Harold en Italie«), schloss sich von vornherein aus. Hier lag kein Stoff vor, der sich auf eine einzige Hauptperson, gleichsam ein musikalisch-dramatisches »Ich«, das in allen Sätzen vorkommt, hätte konzentrieren lassen. Anders als in den genannten Vorgänger-Werken gab Berlioz seinem neuen Werk das zugrunde liegende Programm daher nicht als Beilegezettel (»Symphonie fantastique«) oder in Form von komprimierten Satz-Überschriften (»Harold en Italie«) bei, sondern machte es selbst zum Gegenstand der Komposition – denn der »Prologue« stellt letztlich nichts anderes dar als die Vertonung des »Programms«, der inhaltlichen Grundlage des ganzen Werks. Insofern ist die Gestalt der dramatischen Symphonie »Roméo et Juliette« eine unmittelbare Konsequenz des komplexen Stoffs. Entsprechend nutzt Berlioz den Prolog-Teil als eine Art musikalische Klammer für die nachfolgenden Sätze. Nacheinander erklingen in den Episoden zwischen den Textdeklamationen des erzählenden kleinen Chors die Hauptthemen der nachfolgenden Instrumentalsätze sowie des Trauermarschs. Dadurch sichert der Komponist nicht nur den Zykluscharakter auf einfache, aber effektive Weise ab, sondern er hilft auch dem Hörer beim Verständnis der Symphonie, indem er die Zitate mit entsprechenden Textstellen des Prologs verbindet und ihn so auf ideale Weise musikalisch vorbereitet. Davon ausgeschlossen ist jedoch die vorangestellte »Introduction«, mit der die Symphonie beginnt. Obwohl sie die Anfangsszene des Shakespeare-Dramas umzusetzen hat, wird die Erläuterung dazu erst nachträglich, zu Beginn des »Prologue«, geliefert. Dies hätte Berlioz nur umgehen können, wenn er dem Beispiel des Dichters folgend den Prolog an den Anfang gesetzt hätte, was aber wiederum unvereinbar mit dem Kern der »Symphonie«-Idee gewesen wäre. So versuchte er – wie im übrigen auch bei den späteren reinen In­ strumentalsätzen – durch Inhaltsstichworte wie »Combats – Tumulte – Intervention du Prince«, aber auch durch plastische Themengestalten und -einsätze dem Hörer eine Art Leitfaden beim Verfolgen des dramatischen Geschehens zu liefern. Den Tumult zwischen den verfeindeten Familien der Mantagus und der Capulets zu Beginn gestaltete Berlioz durch ein Fugato-­ Thema, das bezeichnenderweise an der Stelle im Finale wiedererscheint, wo der alte Familienstreit von Neuem auszubrechen droht (»Mais notre sang rougit leur glaive«). Hector Berlioz: »Roméo et Juliette« 13 Konzertankündigung zur Uraufführung von Berlioz’ »Roméo et Juliette« 1839 in Paris Hector Berlioz: »Roméo et Juliette« 14 So ist überaus sinnfällig die Vorstellung von Fliehen und Verfolgen, Vor- und Zurückdrängen musikalisch umgesetzt, wobei sich durch immer kürzere Einsätze der verschiedenen Instrumente der Eindruck einer Zuspitzung ergibt. Um so deutlicher setzt sich nun das neue Thema in den Posaunen ab, das nach den Vorgaben des Dramas nichts anderes als das Einschreiten des Fürsten ausdrücken kann – zumal Violinen und Oboen das Fugato-Thema nun als Kontrapunkt intonieren, also unmittelbar veranschaulichen, worauf sich die Intervention bezieht. Auch die Themen der folgenden Sätze heben sich durch charakteristische Gestaltung ab, die unmittelbar auf die ausformulierten Satzerläuterungen beziehbar bleibt. Dies gilt für das tänzerische »Fest«-Thema genauso wie für das expressive »Liebes«-Thema in der »Scène d’amour« oder auch die schmerzliche, chromatisch auf- und absteigende Melodie der »Invocation« Romeos in der Gruft der Capulets. REZEPTION Die ersten Aufführungen des Werks im November und Dezember 1839 hatten einen überwältigenden Erfolg, den Berlioz als gerechte Belohnung empfand für die anstrengende monatelange Arbeit »unter den heißen Strahlen der Liebessonne Shakes­ peares« – wie er es später in seinen Lebenserinnerungen formulierte. Das Presse­ echo war dagegen zwiespältig, aber selbst ablehnende Kritiker mussten die Neuartigkeit der Konzeption und die meisterhafte Beherrschung des Orchesters anerkennen. Von besonderer Wirkung erwies sich das »Mab«-Scherzo, das – wie der Kritiker der »Revue et Gazette musicale« schrieb – »mit einhelliger Billigung aufgenommen« wurde. Der scharfe Kontrast zwischen den bewegt dahinhuschenden Prestissimo-­ Rahmenteilen, in dem gegen Ende die neu ins Orchester-Instrumentarium eingeführten antiken Zimbeln (stimmbare kleine Becken) erklingen, und den statischen, extrem hohen Klängen des Mittelteils mit Flageolett-Tönen von Violinen und Harfen geht in der Tat weit über das hinaus, was bis dahin im Konzertsaal an charakteristischen Scherzo-Klängen zu hören war. Dennoch konnte Berlioz das Werk später nur noch wenige Male vollständig aufführen – aufgrund des äußeren Aufwands, aber auch des hohen technischen Anspruchs an die Ausführenden. Nach Berlioz’ Tod fiel das Werk gegenüber den anderen Programmsymphonien in der Gunst des Publikums etwas zurück. Neben der nun als heikel beurteilten Mischung von konzertanten und szenischen Elementen störte vor allem die stilistische Heterogenität des Werks – ein Aspekt, der dazu führte, dass die reinen Orchestersätze ausgekoppelt aus Berlioz' dramatischen Gesamtplan ebenso oft auf den Konzertprogrammen erscheinen wie die vollständige Fassung. Hector Berlioz: »Roméo et Juliette« 15 Über »Romeo und Julie« von Hector Berlioz RICHARD WAGNER »In jenem Winter (1839–1840) führte Berlioz in drei verschiedenen Aufführungen, von denen ich einer beiwohnen konnte, zum ersten Male seine »Romeo und Julie«-­ Symphonie auf. Dies war mir allerdings eine neue Welt, in welcher ich mich, ganz den empfangenen Eindrücken gemäß, mit voller Unbefangenheit zurechtzufinden suchte. Zunächst hatte die Gewalt der nie zuvor von mir geahnten Virtuosität des Orchester-­ Vortrages auf mich geradezu betäubend gewirkt. Die phantastische Kühnheit und scharfe Präzision, mit welcher hier die gewagtesten Kombinationen wie mit den Händen greifbar auf mich eindrangen, trieben mein eignes musikalisch-poetisches Empfinden mit schonungslosem Ungestüm scheu in mein Inneres zurück. Ich war ganz nur Ohr für Dinge, von denen ich bisher gar keinen Begriff hatte und welche ich mir nun zu erklären suchen musste. In »Romeo und Julie« hatte ich allerdings häufig und andauernd Leeren und Nichtigkeiten empfunden, was mich um so mehr peinigte, als ich andrerseits von den mannigfaltigen hinreißenden Momenten in diesem, durch seine Ausdehnung und Zusammenstellung in Wahrheit dennoch verunglückten Kunstwerke mich bis zur Vernichtung jeder Möglichkeit eines Widerspruchs überwältigt fand.« Aus Richard Wagners Autobiographie »Mein Leben« Wagner über »Roméo et Juliette« 16 »Apotheose des Tanzes« oder »Musik eines Irren« ? IRINA PALADI LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) Symphonie Nr. 7 A-Dur op. 92 1. Poco sostenuto – Vivace 2. Allegretto 3. Presto – Assai meno presto 4. Allegro con brio LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN Geburtsdatum unbekannt: geboren am 15. oder 16. Dezember 1770 in Bonn, dort Eintragung ins Taufregister am 17. Dezember 1770; gestorben am 26. März 1827 in Wien. ENTSTEHUNG Beethovens 7. Symphonie entstand in zeitlicher Nähe und zum Teil parallel zur 8. Symphonie F-Dur op. 93 und zu Kammermusikwerken wie dem f-Moll-Streichquartett op. 95 und dem B-Dur-Klaviertrio op. 97. Skizzen, soweit erhalten, reichen bis in die Jahre 1805 und 1806 zurück, darunter »Variations« betitelte Aufzeichnungen zum später so populär gewordenen Hauptthema des 2. Satzes. Konkrete Vorarbeiten sind ab 1809 datierbar; die endgültige Ausarbeitung erfolgte von Herbst 1811 bis Frühjahr 1812 in Wien (Abschlussdatum in Beethovens Autograph: 13. April 1812). Anfang November 1816 erschienen Partitur und Stimmenmaterial bei S. A. Steiner & Co. in Wien. Ludwig van Beethoven: 7. Symphonie A-Dur 17 Louis Letronne: Ludwig van Beethoven (um 1814) Mphil_Thielemann6_Z0 .indd 31 28.03.2008 15:33:36 Uhr Ludwig van Beethoven: 7. Symphonie A-Dur 18 WIDMUNG POLITISCHER HINTERSINN Beethoven widmete seine 7. Symphonie dem Reichsgrafen Moritz von Fries (1776– 1826); der auch von Goethe hochgeschätzte Kunstsammler und Mitinhaber des angesehenen Wiener Bankhauses Fries, das den weltweiten Handel mit dem sog. Maria-­ Theresien-Taler betrieb, entstammte einer jüdischen Patrizier- und Bankiersfamilie aus der Schweiz und zählte in Wien zu Beet­ hovens und Schuberts wichtigsten Förderern. Von Richard Wagner als »Apotheose des Tanzes« gerühmt, von Carl Maria von Weber als »Musik eines Irren« bezeichnet, hat Ludwig van Beethovens 7. Symphonie bei Kennern und Musikliebhabern schon immer gleichermaßen für Aufregung gesorgt. Allzu verständlich, dass man das Werk von allen Seiten zu beleuchten versuchte und dabei gerne nach Inhalt, Programm, ja nach einem geheimen Sinn suchte. Für derartige Auslegungen reichten rein musikalische Mittel freilich nicht aus. Beethovens Zeitgenossen interessierten sich vor allem für die politischen Implikationen des Werks, d. h. für seine unmittelbare Verknüpfung mit dem Phänomen Napoleon. URAUFFÜHRUNG Am 8. Dezember 1813 in Wien in der Großen Aula der neuen Wiener Universität im Rahmen einer »Akademie«, die Beethoven zusammen mit seinem Freund Johann Nepomuk Mälzel veranstaltete, dem »rühmlichst bekannten K. und K. Hofmechaniker« und Erfinder des »Mälzel’schen Metronoms«. Im Orchester, dem Beethovens Freund Ignaz Schuppanzigh als Konzertmeister vorstand, wirkten u. a. die Komponisten Johann Nepomuk Hummel, Giacomo Meyerbeer, Ignaz Moscheles, Antonio Salieri und Louis Spohr mit; der 2. Satz musste auf Verlangen des Publikums sofort wiederholt werden. Im selben Wohltätigkeitskonzert zugunsten der in der Schlacht bei Hanau (1813) »invalide gewordenen österreichischen und bayerischen Krieger« dirigierte Beethoven die Uraufführung seines musikalischen Schlachtengemäldes »Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vittoria« op. 91. Zusammen mit den Ouvertüren »Coriolan« und »Egmont«, der Programmsymphonie »Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vittoria« gehört die »Siebte« nämlich zu Beethovens sog. »anti-napoleonischen« Werken. Sie alle entstanden in der Zeit ab 1806, als die erste Begeisterung für den »grand’ uomo« aus Korsika schon längst in Hass umgeschlagen war – hatte sich doch Napoleon vom Völkerbefreier zum Unterdrücker und Tyrannen entwickelt. Spätestens seit Napoleons Kaiserkrönung im Jahr 1804 betrachtete Beethoven ihn als seinen »persönlichen Feind«. In höchster Erregung soll er damals die Titelseite des fertigen Manuskripts seiner 3. Symphonie, der »Eroica«, die ursprünglich Napoleon Bonaparte gewidmet war, zerrissen haben: »Ist der auch nicht anders wie ein gewöhnlicher Mensch ! Nun wird er auch alle Menschenrechte mit Füßen treten, nur seinem Ehrgeize frönen, er wird sich nun höher wie alle andern stellen, ein Tyrann werden !« Ludwig van Beethoven: 7. Symphonie A-Dur 19 ZEITGESCHICHTLICHE FUNKTION Zusammen mit dem musikalischen Schlachtengemälde »Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vittoria« gelangte die 7. Symphonie im Rahmen einer »Großen Akademie« zugunsten der Invaliden der Napoleonischen Kriege – über 5000 Zuhörer sollen dem Konzert beigewohnt haben – unter Beethovens Leitung am 8. Dezember 1813 in Wien zur Aufführung. Genau zwei Monate zuvor hatte die Völkerschlacht bei Leipzig stattgefunden, deren Gemetzel über 100.000 Tote und Verwundete forderte. Dennoch führte die Schlacht letztendlich zum Zusammenbruch des napoleonischen Systems. Vor diesem historischen Hintergrund wird der triumphale Erfolg, den Beethoven mit seinen neuen Werken am 8. Dezember 1813 hatte, besser verständlich. »Wellingtons Sieg« und die 7. Symphonie wurden sofort als Einheit von »Kampf und Sieg« aufgefasst; die Symphonie wurde umgehend zum Liebling des Publikums. Auch die zahlreichen Zeitungsbesprechungen fielen überaus positiv aus. Die »Leipziger Musikalische Zeitung« brachte überschwänglichste Lobeshymnen auf den Komponisten. Der Rezensent hielt das Werk »für die melodiereichste, gefälligste und fasslichste unter allen Beethovenschen Symphonien«. »ORGIE DES RHYTHMUS« Doch nur wenig später erhoben sich auch kritische Stimmen. Mit seiner Aussage, Beethoven solle für seine 7. Symphonie »ins Irrenhaus« geschickt werden, schloss sich Carl Maria von Weber einer damals verbreiteten Meinung an. Moniert wurde vor allem der Mangel an Poesie und Kantabili- tät – für den »lyrisch« veranlagten Weber ein kapitaler Fehler. In Beethovens Todesjahr 1827 erschien in der Frankfurter »Allgemeinen Musikzeitung zur Beförderung der theoretischen und praktischen Tonkunst, für Musiker und Freunde der Musik überhaupt« eine Rezension, die als exem­ plarisch für Webers Position bezeichnet werden kann: »Die Symphonie aus A # – deren Komponist zweifellos einmal ein außerordentliches Talent oder Genie besaß, dann freilich in eine Art von Verrücktheit geriet – ist ein wahres Quodlibet von tragischen, komischen, ernsten und trivialen Ideen, welche ohne allen Zusammenhang vom hundertsten in das tausendste springen, sich zum Überdruss wiederholen, und durch den unmäßigen Lärm das Trommelfell fast sprengen. Wie ist es möglich, an einer solchen Rhapsodie Vergnügen zu finden ?« Was macht dennoch das Besondere dieser Musik aus ? Romain Rolland, der vorzügliche Beethoven-Kenner, hat es poetisch als »Orgie des Rhythmus« bezeichnet. Prosaisch würde das heißen: der Rhythmus als dominierendes Element stellt alles andere in den Schatten, ein obsessiv repetitives Moment bestimmt das ganze Werk, und doch ist Beethovens Spiel mit dem rhythmischen Urmuster in jedem der vier Sätze von erstaunlichster Raffinesse: Höchste Variationskunst bei einem zyklisch konzipierten Werk und höchster Genuss beim Auskosten kompliziertester rhythmischer Metamorphosen werden hier geboten. 1. SATZ: POCO SOSTENUTO – VIVACE In geheimnisvoller Aura präsentiert sich der Beginn des 1. Satzes. Es ist die längste langsame Einleitung, die Beethoven für Ludwig van Beethoven: 7. Symphonie A-Dur 20 eine seiner Symphonien schrieb. Breit angelegt, von geradezu betörender Schönheit, mutet dieses ungewöhnliche »Vorspiel« wie ein echter Symphoniesatz oder eine feierliche Ouvertüre an. Zwei selbstständig geführte Themen und eine große Vielfalt an musikalischen Ideen prägen diese absolut »unklassische« Einleitung. Vorsichtig, ja beinahe schüchtern stellen die Bläser (Oboen, Klarinetten, Hörner und Fagotte) nacheinander das erste Motiv vor, das nur wenige Takte später im vollen Glanz des Orchesters großartig gesteigert wird. Liedhaft schlicht (»dolce«) ertönt anschließend in der Oboe das zweite Thema. Eine schwärmerische, fast frühromantische Grundhaltung prägt diesen Beginn. Das rhythmische Moment bleibt paradoxerweise ausgespart, so dass man die folgende »Orgie« noch nicht vermuten kann. Die obsessive Wiederholung des Tons e durch die Flöte leitet in den Vivace-Teil über. Hier entfesselt sich ein wilder, ungezähmter Tanz, der in hüpfendem 6/8-Takt den ganzen Satz bestimmt. Für ein zweites, kontrastierendes Thema gibt es kaum noch Entfaltungsmöglichkeiten. Bei aller Freiheit der Form unterliegt der sozusagen monothematische 1. Satz dennoch einer streng symphonischen Gestaltung. In der Coda gerät der tänzerische Wirbel im strahlenden A-Dur buchstäblich aus den Fugen: Das Insistieren des ganzen Orchesters auf dem Ton e (wie bereits in der Überleitung zum Vivace-Teil in der Flöte) geht hier bis an die Grenzen des musikalisch Möglichen. 2. SATZ: ALLEGRETTO Die freudige Siegesstimmung wird jedoch gleich zu Beginn des folgenden Satzes in Frage gestellt. Unvermittelt erklingt ein trauriger Bläserakkord in a-Moll und wirkt befremdend nach dem triumphalen Schluss des 1. Satzes. Mit dem schwebenden, quasi »unentschlossenen« Klang – die Hörner als tiefste Stimme spielen nicht, wie erwartet, den Fundament-Ton a, und der Klang bleibt deshalb sozusagen »offen« – setzt Beethoven ein Ausrufezeichen, eine Art Mahnung: Nach der Siegesvision des 1. Satzes trauert der Komponist hier um die von Napoleons Truppen zerstörte »Welt«. Wie in der »Eroica« kam dazu nur ein stilisierter Trauermarsch in Frage: diesmal nicht zum Begräbnis eines Helden, sondern zum Gedenken an alle im Kampf Gefallenen. Das zunächst ruhig dahinschreitende Thema erinnert an mittelalterliche Gesänge, die man zu Wallfahrten oder Prozessionen sang: Ein zweitaktiger Ostinato-Rhythmus, von den tiefen Streichern »bis zum Umfallen« wiederholt, bildet das Fundament und gleichzeitig Thema dieses mittelalterlichen »Conductus«. Kanonartig setzen die übrigen Instrumente ein. Der zunächst »sotto voce« vorgetragene Klagegesang wird im Verlauf des Satzes immer mächtiger und bedrohlicher, der »Conductus« einem komplizierten kontrapunktischen Verfahren unterzogen. Der Steigerungseffekt wird einerseits durch Veränderungen der Dynamik erreicht, andererseits aber – und das ist das Faszinierende an diesem Satz – durch das komplizierte rhythmische Gerüst, das Beethoven dem Ganzen unterlegt. Tempoänderungen schreibt er nicht vor, und doch scheint das Klagelied immer unruhiger und schneller zu werden. Der Satz war ursprünglich mit »Andante« überschrieben: schrittweise, jedoch nicht langsam, sollte sich der »Conductus« fortbewegen. Doch bald entschied sich Beethoven für die »Allegretto«-Version; er mach- Ludwig van Beethoven: 7. Symphonie A-Dur 21 François Gérard: Reichsgraf Moritz von Fries, der Widmungsträger der 7. Symphonie, mit seiner Familie (1804) Ludwig van Beethoven: 7. Symphonie A-Dur 22 te damit deutlich, dass der Satz keineswegs schleppend vorzutragen sei. Der Trauermarsch lichtet sich für einen Augenblick mit einem »Maggiore«-Teil in A-Dur auf: eine Idylle im pastoralen Ton, ein Hoffnungsschimmer, der wie eine Vision vorbeizieht. Bei dieser ländlichen »Gesangsszene« fungiert die Klarinette als Schalmei; der traurige, zweitaktige Grundrhythmus wird zu einer freundlichen, dudelsackähnlichen Begleitung. Nach dieser Episode kehrt der Trauermarsch leicht abgewandelt zurück. Bei der Uraufführung am 8. Dezember 1813 löste der 2. Satz eine solche Begeisterung aus, dass er sofort wiederholt werden musste. 3. SATZ: PRESTO – ASSAI MENO PRESTO Mit neuer Kraft kehrt der Rhythmus als Urelement im 3. Satz, einem typischen Scherzo, wieder, ja bricht mit geradezu elementarer Gewalt ein. Eine rhythmische Pointe, die das Thema verschleiert und den Zuhörer verunsichert, steht am Anfang: Mit der Betonung des Auftakts verstößt Beethoven gegen alle Regeln der Komposition, das Gefühl für den schlichten Dreier-­ Takt geht zunächst völlig verloren. Für diese Art musikalischer Witze hatte Beet­ hoven bekanntlich eine Vorliebe. Die eigenwillige Metrik, die krassen dynamischen Schwankungen und nicht zuletzt die kühne Harmonik lassen das Scherzo als wild und ungezähmt erscheinen. Erst im Trio – Beethoven schreibt hier ausdrücklich ein langsameres Tempo vor – beruhigt sich der Wirbel. Beethoven sprengt hier übrigens das traditionelle Schema A-B-A, indem er wider Erwarten das Trio ein zweites Mal aufklingen lässt, was zu einer ungewöhnlichen Ausdehnung des Scherzos führt. Melodisch basiert das Trio auf einem alten niederösterreichischen Wallfahrtslied. In Beethovens Verarbeitung wird der ehemals verhaltene Mönchsgesang zu einem wunderbar »entgrenzten« lyrischen Moment. Sanft schwebend beginnen die Bläser mit der volkstümlich anmutenden Melodie, während die Violinen mit dem Halte-Ton a nach Art eines Bordun-­ Basses das harmonische Fundament bilden. Die Spannung steigt unaufhörlich bis hin zum Fortissimo: Im vollen Orchesterklang entfaltet sich das fröhliche Lied zur jubelnden Hymne. Ob hier Beethoven seinen politischen Wunschtraum – den Sieg über Napoleon – vor Augen hatte ? 4. SATZ: ALLEGRO CON BRIO Im Finale schließlich gerät der omnipräsente, obsessiv wirkende Rhythmus zu einem regelrecht mänadisch-dionysischen Tanz­ taumel. Zwei Tutti-Akkorde im Fortissimo, gefolgt von einer Generalpause, bereiten den wirbelnden Sturm vor. Das thematische Material ist auf ein Minimum reduziert. Von Themen-Führung im Sinne der Wiener Klassik kann hier keine Rede mehr sein, denn die einzelnen Motive werden in unzählige Partikel regelrecht »pulverisiert«. Ähnlich wie im Scherzo spielt Beet­ hoven hier mit Dynamik und Metrik: Die Betonung der schwachen Taktteile lässt den Rhythmus eigenartig schwankend erscheinen; dahinter verbirgt sich ein nach französischem Muster angelegter »Geschwindmarsch«. Etwas Ähnliches hatte Beethoven kurz zuvor in seiner Schauspielmusik zu Goethes Trauerspiel »Egmont« unternommen: Der Schlussteil der so genannten »Siegessym- Ludwig van Beethoven: 7. Symphonie A-Dur 23 phonie«, deren Thema auch in der »Egmont«-­ Ouvertüre zitiert, ja vorweggenommen wird, weist denselben musikalischen Gestus auf wie der »Fanfaren«-Teil des Schlusssatzes der »Siebten«. Angesichts der Tatsache, dass Beethoven die Symphonie 1812 fertig stellte, also bevor Napoleon endgültig besiegt wurde, bekommt die musikalische Vorwegnahme des Siegs über den verhassten »tyrannos« einen geradezu prophetischen Aspekt. Mit höchster Begeisterung reagierten bereits die Zuhörer der Uraufführung auf diesen Taumel, diese Ekstase. Nur wenige lehnten sie als »Ausgeburt eines Tollhäuslers« ab. Ludwig van Beethoven: 7. Symphonie A-Dur 24 Valery Gergiev DIRIGENT wichtigsten Pflegestätten der russischen Opernkultur aufgestiegen ist. In Moskau geboren, studierte Valery Gergiev zunächst Dirigieren bei Ilya Musin am Leningrader Konservatorium. Bereits als Student war er Preisträger des Herbert-von-Karajan Dirigierwettbewerbs in Berlin. 1978 wurde Valery Gergiev 24-jährig Assistent von Yuri Temirkanov am Mariinsky Opernhaus, wo er mit Prokofjews Tolstoi-Vertonung »Krieg und Frieden« debütierte. Seit mehr als zwei Jahrzehnten leitet er nun das legendäre Mariinsky Theater in St. Petersburg, das in dieser Zeit zu einer der Mit den Münchner Philharmonikern verbindet Valery Gergiev seit der Saison 2011/12 eine intensivere Zusammenarbeit. So hat er in München mit den Philharmonikern und dem Mariinsky Orchester alle Symphonien von Dmitrij Schostakowitsch und einen Zyklus von Werken Igor Strawinskys aufgeführt. Seit der Spielzeit 2015/16 ist Valery Gergiev Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Als »Maestro der Stadt« wendet er sich seitdem mit Abo- und Jugendkonzerten, Öffentlichen Generalproben, »Klassik am Odeonsplatz« und dem Festival MPHIL 360° sowohl an die Münchner Konzertbesucher als auch mit regelmäßigen Livestream- und Fernseh­ übertragungen aus der Philharmonie im Gasteig an das internationale Publikum. Seit September 2016 liegen die ersten CD-Aufnahmen des orchestereigenen Labels MPHIL vor, die seine Arbeit mit den Münchner Philharmonikern dokumentieren. Weitere Aufnahmen, bei denen besonders die Symphonien von Anton Bruckner einen Schwerpunkt bilden, sind in Vorbereitung. Reisen führten die Münchner Philharmoniker mit Valery Gergiev bereits in zahlreiche europäische Städte sowie nach Japan, China, Korea und Taiwan. Künstlerbiographie 25 »In der Musik liegt die Wahrheit« Ein Gedenkblatt für »Celi« GABRIELE E. MEYER Als Sergiu Celibidache, Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, am 14. August 1996 in der Nähe von Paris starb, schien die musikalische Welt einen Augenblick inne­zuhalten. Das Gedenkkonzert unter Zubin Mehtas Leitung fand – nur wenige Wochen später – am 9. September statt. Auf dem Programm stand Anton Bruckners unvollendete »Neunte« – also die Symphonie, die in der oberösterreichischen Stiftskirche St. Florian zu dirigieren Celibidache nicht mehr vergönnt war. Selten haben die Philharmoniker mit so viel Anteilnahme, ja Inbrunst gespielt wie an jenem Abend. Am Ende erhoben sich die Zuhörer und warteten tief bewegt, bis der letzte Musiker vom Podium gegangen war. 17 Jahre lang hatte dieser »schwierige, aber ganz außerordentliche Mann« (Albrecht Roeseler) mit »seinem« Orchester gearbeitet. Unerbittlich fing der nur in Ausnahmefällen zu Zugeständnissen neigende Charismatiker dort an zu proben, wo andere aufhören. In harter Arbeit lernte jeder Musiker, ganz bewusst auf den anderen zu hören, seine eigene Stimme zwar wichtig zu nehmen, in gleicher Weise sich aber auch dem Gesamtverlauf einzufügen. Celibidache bestand auf einer klanglichen Ausgeglichenheit, die mühelos von kammermusikalischer Intimität zu orchestraler Fülle wechseln konnte. Und er ließ sich auch entgegen vielfach geäußerter Skepsis nicht von seiner grundsätzlichen Maxime abbringen, dass sich das Tempo nach der Komplexität des kompositorischen Ablaufs zu richten habe. Egal, um welches Werk seines durchaus weit gefächerten Repertoires der deutschen, französischen und russischen Musik es in all den Jahren bei den Münchner Philharmonikern ging: Jedes wurde einer radikalen Prüfung unterzogen und neu erarbeitet. »Musik ist nicht schön«, meinte Celibidache einmal. »Sie ist auch schön, aber die Schönheit ist nur der Köder. Musik ist wahr.« Das Orchester der Stadt ließ sich auf das Abenteuer ein und entwickelte sich in der Folge zu einem der weltweit besten Klangkörper. Celibidaches Vorliebe, insbesondere in seinen letzten Lebensjahren, galt dem gewaltigen symphonischen Kosmos Anton Bruckners. Seit jenem denkwürdigen Konzert vom 15. Oktober 1979 mit Bruckners 8. Symphonie in der Münchner Lukas-Kirche kam es im In- und Ausland immer wieder zu Sergiu Celibidache zum 20. Todestag 26 Aufführungen, die sich tief in das musikalische Gedächtnis von Musikern und Zuhörern eingegraben haben. Ihnen bleibt die Aura des Ereignisses als Sonderfall. Doch ebenso erinnerungswürdig ist Celibidaches Umgang mit französischen Komponisten. Diesem Repertoireausschnitt sei das heutige Gedenkblatt zum 20. Todestag des Maestros gewidmet. Schon wenige Monate nach Celibidaches Einstand im Februar 1979 waren die Musiker mit der französischen Orchesterkultur vertraut. Auch später faszinierte diese neu erworbene Spielweise, die trotz aller Eleganz und klanglichem Raffinement nie außer Acht ließ, dass Musik eben mehr als nur »schön« ist. Ravels »La Valse«, die wie in einem Zerrspiegel geraffte Zusammenfassung des Wiener Walzers, ausgehend vom Wiener Kongress über Restauration, Biedermeier und Gründerzeit bis hin zur Katastrophe des 1. Weltkriegs, geriet unter Celibidaches Händen zum überwältigenden Publikumserfolg. Im »Boléro« wurden, wie Klaus Weiler zurückblickend ausführte, »Crescendo und Rhythmus unter der strikten Beibehaltung des Metrums zum elementaren Ereignis«. In »Daphnis et Chloé« und der »Rapsodie espagnole«, in der »Alborada del Gracioso« und in »Ma Mère l’Oye« triumphierte der Klangmagier. Auch die für die Ravel’sche Musik typischen metrischen Finessen entfalteten unter den subtil agierenden Händen des »südländischen Hexers« oder »Pulttänzers« – wie der Dirigent in früheren Jahren oft genannt wurde – ihren schier unwiderstehlichen Charme. Bei »Ibéria«, Debussys musikalischer Beschwörung Spaniens hingegen, machte der Maestro geradezu kongenial auf die Diver- genz zwischen scheinbar statischer Klangfläche und strengster motivischer Konzentration aufmerksam. Mit dieser Wiedergabe traf der Dirigent genau ins Zentrum der Debussy’schen Konzeption – nämlich auf jegliche Tonmalerei zugunsten motivischer Arbeit zu verzichten. Ähnliche Wunder an Gleichzeitigkeit komplexer Verläufe und Farbentwicklungen waren auch in »La Mer« und dem »Prélude à ›L’Après-Midi d’un Faune‹« zu hören. Die ruhige Gelassenheit von Gabriel Faurés »Messe de Requiem«, ja der fast heitere Zauber der Fauré’schen Sichtweise auf die »Letzten Dinge« und den Weg ins Paradies erfreuten sich hierzulande nie besonderer Zuneigung. Aber schon die Sorgfalt, mit der Celibidache während der Proben in den Chorpartien auf die französische Diktion des lateinischen Textes achtete, verhieß eine ganz neue Sichtweise auf das Werk. Celibidache musizierte die »Berçeuse des Todes« bar jeglichen äußeren Effektes in so zarten Valeurs, als wolle er in der vom Komponisten selbst erweiterten, heute allgemein gebräuchlichen Orchestrierung auf die ursprünglichere, kammermusikalisch besetzte verweisen. Genauestens ausbalanciert waren die »mystische Sanftheit, manchmal Lieblichkeit« gegen die sparsam gesetzten majestätischen Akzente, überstrahlt von dem beinahe überirdisch leuch­ tenden Sopransolo »Pie Jesu«. Beglückt und gerührt bedankte sich der Maestro zunächst bei Margret Price, dann bei allen anderen Mitwirkenden für das für ihn schönste Geburtstagsgeschenk zu seinem bevorstehenden 70. Geburtstag am 11. Juli (28. Juni) 1982. Zwei Tage nach dem Tod des großen Dirigenten resümierte Wolfgang Schreiber in Sergiu Celibidache zum 20. Todestag 27 der »Süddeutschen Zeitung«: »Sergiu Celibidache war der gewiss interessanteste Außenseiter des kommerziellen Musiklebens, das er gnadenlos kritisierte – eine Figur wie aus Granit, der die Musik und ihre Würde kompromisslos verteidigte. Ein Glücksfall für München.« Aus heutiger Sicht darf man getrost hinzufügen: Für unzählige Musikbegeisterte in aller Welt. Sergiu Celibidache zum 20. Todestag 28 Münchner Klangbilder TITELGESTALTUNG ZUM HEUTIGEN KONZERTPROGRAMM »Das sinfonische Stück ›Prélude à l’Après-midi d’un Faune‹ von Claude Debussy gilt als eines der Hauptwerke des Impressionismus. Es ist eine musikalische Umsetzung des gleichnamigen Gedichtes von Mallarmé. Debussys Werk erzählt die verschiedenen Stimmungen eines Fauns zwischen Begierde, Traum, Sorgen und Lust. Die Umsetzung meiner Titelgestaltung soll diese Stimmungen wiedergeben. Das leitende Motiv ist ein Märchenwald bei Dämmerung. Mit leuchtenden, großzügig aufgetragenen Farben wird die Impressionistische Kunst angedeutet. Der Waldboden, in einem tiefen blau, ist in der Mitte senkrecht gespiegelt und scheint dadurch nicht real, sondern wie in einer Traumwelt. Der farbliche Kontrast zum Logo wird durch die Spiegelung ebenfalls verstärkt. Der Betrachter soll das eigentliche Motiv nicht auf den ersten Blick erkennen, sondern zur eigenen Fantasie angeregt werden.« (Daniela Ibler, 2016) DIE KÜNSTLERIN Mein Name ist Daniela Ibler und ich bin 1995 in der Nähe von München geboren. Im Stadtteil Laim bin ich aufgewachsen. München ist für mich mein Geburtsort, meine Heimat und meine Zukunft. Seit 2015 studiere ich Medien Design an der Mediadesign Hochschule. Mit der Stadt München verbinden mich viele schöne Erlebnisse und daher fühle ich mich mit ihr sehr verbunden. Hier kann ich meinen Interessen an Kunst, Musik und Sport jederzeit, umgeben von einem vielseitigen Angebot, nachgehen. München besitzt einen einzigartigen Flair, welcher sich stets durch seine Bewohner und seine Kultur neu erleben lässt. DIE HOCHSCHULE Die Mediadesign Hochschule (MD.H) hat es sich an insgesamt drei Standorten zur Aufgabe gemacht, innerhalb der Kreativbranche den hochqualifizierten Nachwuchs von morgen auszubilden. Dabei bilden die Bachelor- und Masterstudiengänge Media Design, Modedesign, Game Design und Digital Film Design das Lehrangebot im schöpferisch-gestalterischen Bereich, während Modemanagement und Medienund Kommunikationsmanagement den betriebswirtschaftlichen Blickpunkt des Handelns in den Vordergrund rücken. Der Fachbereich Media Design kombiniert im Curriculum die klassischen Grundlagen mit den Ansprüchen und Gegebenheiten der neuen Medien und überführt die Tradition hiermit bedacht in die Moderne. Daniela Ibler 29 Sonntag 22_01_2017 11 Uhr 4. KAMMERKONZERT Münchner Künstlerhaus am Lenbachplatz CONSTANZE LINDNER, »Willi Vanilli« BENJAMIN SCHOBEL, »Mark Tomate« CHARLOTTE I. THOMPSON, »Heidi Hühnchen« ANNA VEIT, »Nina Nudel« ALEXANDER WIPPRECHT, »Renato Gelato« »MEISTERWERKE IV« WOLFGANG AMADEUS MOZART Streichquartett Nr. 15 d-Moll KV 421 RALPH VAUGHAN WILLIAMS Streichquartett Nr. 1 g-Moll LUDWIG VAN BEETHOVEN Streichquartett Nr. 12 Es-Dur op. 127 JULIAN SHEVLIN, Violine SIMON FORDHAM, Violine VALENTIN EICHLER, Viola DAVID HAUSDORF, Violoncello Sonntag 29_01_2017 11 Uhr Sonntag 29_01_2017 15 Uhr Montag 30_01_2017 10 Uhr Donnerstag 02_02_2017 Freitag 03_02_2017 Samstag 04_02_2017 Sonntag 05_02_2017 10 Uhr ÖGP 20 Uhr c 19 Uhr d 11 Uhrm BRUNO MANTOVANI »Le Cycle des gris« ÉDOUARD LALO Konzert für Violine und Orchester Nr. 2 d-Moll op. 21 »Symphonie espagnole« MAURICE RAVEL »Daphnis et Chloé«, Suiten Nr. 1 & 2 ALAN GILBERT, Dirigent AUGUSTIN HADELICH, Violine RISTORANTE ALLEGRO Das philharmonische Musical LUDWIG WICKI, Dirigent MARGIT SARHOLZ UND WERNER MEIER, Buch, Musik, Realisation RUTH-CLAIRE LEDERLE, Regisseurin RAINER BARTESCH, Arrangeur und Co-Komponist CHRISTOF WESSLING, Bühnenbildner SIGRID WENTER, Kostümbildnerin BJÖRN B. BUGIEL, Choreograph HANSI ANZENBERGER, »Peter Silie« JANA NAGY, »Lilli Lecker« CAROLINE HETÉNYI, »Sabine Rosine« Vorschau 30 Die Münchner Philharmoniker CHEFDIRIGENT VALERY GERGIEV EHRENDIRIGENT ZUBIN MEHTA 1. VIOLINEN Sreten Krstič, Konzertmeister Lorenz Nasturica-Herschcowici, Konzertmeister Julian Shevlin, Konzertmeister Odette Couch, stv. Konzertmeisterin Claudia Sutil Philip Middleman Nenad Daleore Peter Becher Regina Matthes Wolfram Lohschütz Martin Manz Céline Vaudé Yusi Chen Iason Keramidis Florentine Lenz Vladimir Tolpygo Georg Pfirsch Bernhard Metz Namiko Fuse Qi Zhou Clément Courtin Traudel Reich Asami Yamada BRATSCHEN Jano Lisboa, Solo Burkhard Sigl, stv. Solo Max Spenger Herbert Stoiber Wolfgang Stingl Gunter Pretzel Wolfgang Berg Beate Springorum Konstantin Sellheim Julio López Valentin Eichler 2. VIOLINEN VIOLONCELLI Simon Fordham, Stimmführer Alexander Möck, Stimmführer IIona Cudek, stv. Stimmführerin Matthias Löhlein, Vorspieler Katharina Reichstaller Nils Schad Clara Bergius-Bühl Esther Merz Katharina Schmitz Ana Vladanovic-Lebedinski Michael Hell, Konzertmeister Floris Mijnders, Solo Stephan Haack, stv. Solo Thomas Ruge, stv. Solo Herbert Heim Veit Wenk-Wolff Sissy Schmidhuber Elke Funk-Hoever Manuel von der Nahmer Isolde Hayer Das Orchester 31 Sven Faulian David Hausdorf Joachim Wohlgemuth KONTRABÄSSE Sławomir Grenda, Solo Fora Baltacigil, Solo Alexander Preuß, stv. Solo Holger Herrmann Stepan Kratochvil Shengni Guo Emilio Yepes Martinez Ulrich Zeller Ulrich Haider, stv. Solo Maria Teiwes, stv. Solo Robert Ross Alois Schlemer Hubert Pilstl Mia Aselmeyer TROMPETEN Guido Segers, Solo Bernhard Peschl, stv. Solo Franz Unterrainer Markus Rainer Florian Klingler FLÖTEN POSAUNEN Michael Martin Kofler, Solo Herman van Kogelenberg, Solo Burkhard Jäckle, stv. Solo Martin Belič Gabriele Krötz, Piccoloflöte Dany Bonvin, Solo Matthias Fischer, stv. Solo Quirin Willert Benjamin Appel, Bassposaune OBOEN Stefan Gagelmann, Solo Guido Rückel, Solo Ulrich Becker, Solo Marie-Luise Modersohn, Solo Lisa Outred Bernhard Berwanger Kai Rapsch, Englischhorn KLARINETTEN Alexandra Gruber, Solo László Kuti, Solo Annette Maucher, stv. Solo Matthias Ambrosius Albert Osterhammer, Bassklarinette FAGOTTE Raffaele Giannotti, Solo Jürgen Popp Johannes Hofbauer Jörg Urbach, Kontrafagott PAUKEN SCHLAGZEUG Sebastian Förschl, 1. Schlagzeuger Jörg Hannabach Michael Leopold HARFE Teresa Zimmermann, Solo ORCHESTERVORSTAND Stephan Haack Matthias Ambrosius Konstantin Sellheim INTENDANT Paul Müller HÖRNER Jörg Brückner, Solo Matias Piñeira, Solo Das Orchester 32 IMPRESSUM TEXTNACHWEISE BILDNACHWEISE Herausgeber: Direktion der Münchner Philharmoniker Paul Müller, Intendant Kellerstraße 4 81667 München Lektorat: Christine Möller Corporate Design: HEYE GmbH München Graphik: dm druckmedien gmbh München Druck: Gebr. Geiselberger GmbH Martin-Moser-Straße 23 84503 Altötting Peter Jost, Irina Paladi und Gabriele E. Meyer schrieben ihre Texte als Originalbeiträge für die Programmhefte der Münchner Philharmoniker. Stephan Kohler verfasste die lexikalischen Werkangaben und Kurzkommentare zu den aufgeführten Werken. Künstlerbiographie: nach Agenturvorlage. Alle Rechte bei den Autorinnen und Autoren; jeder Nachdruck ist seitens der Urheber genehmigungs- und kostenpflichtig. Abbildungen zu Claude Debussy: Michael Raeburn and Alan Kendall (Hrsg.), Heritage of Music, Volume IV (Music in the Twentieth Century), Oxford 1989; François Lesure, Claude Debussy (Iconographie musicale IV), Genève 1975. Abbildungen zu Hector Berlioz: Gunther Braam, The Portraits of Hector Berlioz (Hector Berlioz – New Edition of the Complete Works, Vol. 26), Kassel 2003; wikimedia commons. Abbildungen zu Ludwig van Beethoven: H. C. Robbins Landon, Beethoven – A documentary study, New York / Toronto 1970. Abbildung zu Sergiu Celibidache: Archiv der Münchner Philharmoniker. Künstlerphotographie Gergiev: Marco Borggreve. Gedruckt auf holzfreiem und FSC-Mix zertifiziertem Papier der Sorte LuxoArt Samt Impressum HAUPTSPONSOR UNTERSTÜTZT OPEN AIR KONZERTE SONNTAG, 16. JULI 2017, 20.00 UHR VA L E RY G E R G I E V D I R I G E N T Y U J A WA N G K L A V I E R MÜNCHNER PHILHARMONIKER BRAHMS: KONZERT FÜR KLAVIER UND ORCHESTER NR.1 D - MOLL OP.15 MUSSORGSKIJ: „BILDER EINER AUSSTELLUNG” (INSTRUMENTIERUNG: MAURICE RAVEL) KARTEN: MÜNCHEN TICKET 089/54 81 81 81 UND BEKANNTE VVK-STELLEN WWW.KLASSIK−AM−ODEONSPLATZ.DE ’16 ’17 DAS ORCHESTER DER STADT