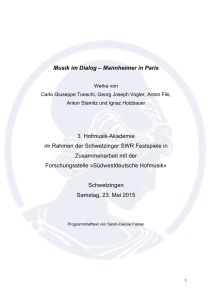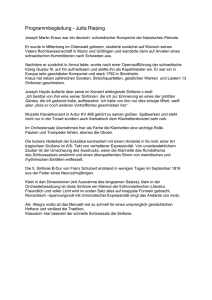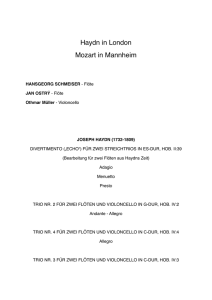Wien – Paris - L`Orfeo Barockorchester
Werbung

LEITUNG: MICHI GAIGG LINZ • AUSTRIA www.lorfeo.com • [email protected] Mannheim – Paris Johann Stamitz (1717-1757) Sinfonie Es-Dur op. 11 Nr. 5 (1754/55) aus: VI Sinfonie a piu istrumenti intitolate La Melodia Germanica (Paris, Venier 1758) für 2 Klarinetten, (2 Oboen od. 2 Flöten,) 2 Hörner, Streicher und B.c. Fastoso1 allegro – Andante – Menuetto – Gigue. Presto assai Ignaz Holzbauer (1711-1783) Konzert für Oboe und Streicher d-moll (um 1770?) Allegro – Largo andante - Allegro --Jean-Philippe Rameau (1683-1764) Suite aus Hippolyte et Aricie (1733/1742/1757) für 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Fagotte, 2 Hörner, Perkussion, Streicher und B.c. Carin van Heerden, Oboe L’Orfeo Barockorchester Leitung: Michi Gaigg Änderungen vorbehalten! Das enorme Ansehen, welches das Ensemble der Mannheimer Kapelle ab Mitte des 18. Jahrhunderts genießen durfte, war nicht nur ein Verdienst jener Musikschriftsteller und -gelehrten von Charles Burney über Leopold Mozart bis hin zu Christian Friedrich Daniel Schubart, die in geradezu überschwänglicher Weise ihrem Umfeld bzw. der Nachwelt von der Qualität berichterstatteten mit der am Hofe des pfälzischen Kurfürsten Carl Theoder musiziert wurde. Vielmehr war es zunächst die Reise eines Mannes an die Ufer der Seine, die ihm und seinen Mitstreitern Tor und Tür im internationalen Musikleben und -geschäft öffneten: Im Sommer 1754 gewährte der Fürst seinem Instrumental-Music-Director Johann Stamitz einen längeren Urlaub, den dieser dazu nutzte, seine bisherigen Kontakte in Paris auszubauen und daselbst als Violinvirtuose und Orchesterleiter mit eigenen Kompositionen zu glänzen. Bereits 1751 war in den Concerts spirituel, einer weit über die Grenzen Frankreichs hinaus berühmten Konzertreihe die in den Tuilerien abgehalten wurde, eine seiner Sinfonien aufgeführt worden, der nun – dreieinhalb Jahre später – eine ganze Reihe begeisternder Auftritte folgenden sollten. Neben den Concerts spirituel verfügte Stamitz zu Paris auch über ein festes musikalische Standbein, hatte ihn doch kurzerhand der Generalsteuerpächter und einflussreiche Musikmäzen Alexandre Jean-Joseph le Riche de la Pouplinière zum Leiter seines Privatorchesters gemacht, dem bis ein Jahr zuvor noch kein geringerer als Jean-Philippe Rameau vorgestanden war. Offenbar hielt La Pouplinière zu jener Zeit zwei Klarinettisten in seinen Diensten und Stamitz dazu anregten, die damals noch recht neuartigen Instrumente (nachträglich) einigen seiner für bzw. in Paris geschriebenen Sinfonien hinzuzufügen. 1 fastoso (ital.) = prunkvoll Erschienen die Werke eines Johann Stamitz infolge seines frühen Todes zumeist posthum im Druck, war dies, die Sinfonien eines Anton Fils betreffend – er gehörte bereits der sogenannten zweiten Generation der Mannheimer Hofkapelle an und erlebte gerade einmal 26 Lenze – ausschließlich der Fall. Tatsächlich scheint Fils, den Schubart später „für den besten Symphonienschreiber, der jehmals gelebt hat“ halten sollte, nichts zur Verbreitung seines Oeuvre beigetragen zu haben. So war es Elisabeth Fils, die sich anschickte, den von Johann Stamitz geebneten Weg zu beschreiten und die ersten Partituren ihres Mannes, wenige Monate nach dessen Ableben, an den Pariser Verleger Louis-Balthazard de la Chevardière zu verkaufen. Ignaz Holzbauer stammte aus Wien, hatte daselbst, in Italien und Mähren gewirkt und befand sich gerade in Diensten des württembergischen Herzogs zu Stuttgart, als er 1753 im neueröffneten Schwetzinger Hoftheater für den begeisterten pfälzischen Kurfürsten Carl Theodor eine Oper zur Aufführung brachte. Wenig später wurde er zum Leiter der Mannheimer Hofoper ernannt und blieb über 25 Jahre in dieser höchst angesehenen Position. Die in Regensburg erhaltene Quelle des virtuos gestalteten Konzerts in d-moll stammt aus der Zeit um 1770, was vermuten lässt, dass es für den Oboisten Friedrich Ramm bzw. seinen jüngeren Kollegen Ludwig August Lebrun geschrieben wurde. Stilistisch greift Holzbauer in diesem einzigen seiner Feder entstammenden Oboenkonzert jedoch auf ältere, italienische Vorbilder zurück, wie man es vor allem aus den Werken seiner Wiener bzw. Stuttgarter Jahre kennt. Ein Moment zum Genießen: Die an Vivaldis L’inverno erinnernde, sehnsuchtsvolle Oboencantilene über leise dahintröpfelnden Streicherrhythmen im Largo andante. Wenn Jean-Philippe Rameau, der große Neuerer der französischen Oper nach JeanBaptiste Lully, ein Bühnenwerk schuf, hielt er sich stets an zwei Grundregeln: Die erste besagt, dass die Handlung sich in der Musik wiederfinden muss – machte er sich einmal daran mit dem Komponieren zu beginnen, hatte er schon eine klare Vorstellung vom dramatischen Geschehen des Werkes. Auf diese Weise konnte er sich schon in der Ouvertüre auf den Verlauf und auf den Schluss der Geschichte beziehen. Während des 18. Jahrhunderts bot die „Affektenlehre“, ein allen Komponisten vertrautes Hilfsmittel, hervorragende Möglichkeiten, den Text in der Musik nachzuahmen. Darin sind unter anderem die Tonarten beschrieben, die verwendet werden können, um die Gefühle darzustellen. Mit anderen Worten gesagt, handelte es sich also um standardisierte Metaphern der Angst, der Wut oder der Traurigkeit. Rameau befriedigte es jedoch nicht, sich beim Komponieren ausschließlich dieser stereotypen Werkzeuge zu bedienen. Er zog vielmehr eine psychologische Interpretation der Akteure einer konventionalisierten Behandlung der Darstellung vor, damit – Regel Nummer zwei – die Musik den Zuhörer niemals langweile. Rameau erreichte die gelungensten Verwirklichungen seiner Ideen in jenen Werken, in denen er mit dem Librettisten Louis de Cahusac zusammenarbeitete. Die Freiheiten, welche ihm der Librettist bei der Komposition der instrumentalen Balletteinlagen ließ, inspirierte Rameau zur Erschaffung von Stücken von bis dahin nicht gekannter dramatischer Ausdruckskraft. De Cahusac wiederum konnte dank der Genialität des Komponisten die Tanzsätze, die ehemals als zusammenhanglose, isolierte Stücke in Erscheinung getreten waren, in das Drama integrieren. Zu den gelungensten Kooperationen unserer beiden Herren darf die Oper Zaïs, geschrieben in Form eines ballet héroïque in vier Akten und einem Prolog, gezählt werden: Zaïs, ein Genius oder guter Geist, verkleidet sich als Schäfer um die Liebe der Schäferin Zélide zu gewinnen. Nach einer Reihe schwerer Prüfungen, in denen Zaïs unter Beweis stellt, dass er bereit wäre seine Zauberkunst zugunsten der Liebe aufzugeben, verleiht Orasmases, König der Genii, Zélide Unsterblichkeit, sodass das Paar schließlich Hochzeit feiern darf. Besondere Aufmerksamkeit verdient gewiss die Ouvertüre, ein absolutes Meisterstück an Klangfarben und Instrumentalbehandlung welche die Entstehung der vier Elemente, Feuer, Wasser, Erde und Luft aus dem Chaos darstellt und somit den Faden, der einst bei JeanFéry Rebel mit Les Élémens begann und in Haydns Schöpfung sein Ziel erreichte, weiterspinnen sollte. Doch damit wären sie noch lange nicht ausgefüllt, die Felder dieses einzigartigen Tongemäldes: Es warten u.a. ein friedlich beschwingtes Menuett, eine Air (mouvement en chaconne) von geradezu entrückter Schönheit, der heiter-neckende Auftritt der Elementarwesen sowie zu guter Letzt ein fröhlich ausgelassener Contredanse. Zaïs, das seine Uraufführung am 29. Februar 1748 in der Pariser Opéra erleben durfte, war eines der ersten Werke, welches im Zuge der Wiederentdeckung Jean-Philippe Rameaus durch die historische Aufführungspraxis seinen Weg zurück auf die Bühne gefunden hatte. Dies ist nun mehr als 30 Jahre her und niemand hat es dem Trio Leonhardt, Kuijken und Herreweghe bislang gleich getan ... Zeit für eine zweite Renaissance – seien sie herzlich eingeladen! Christian Moritz-Bauer