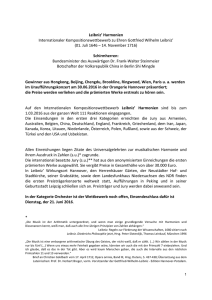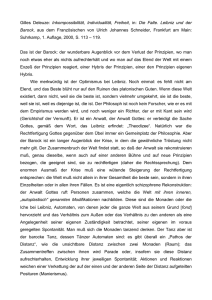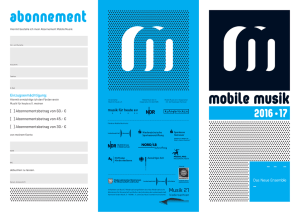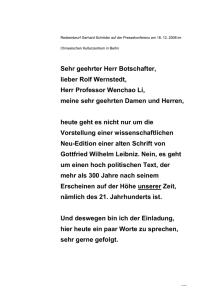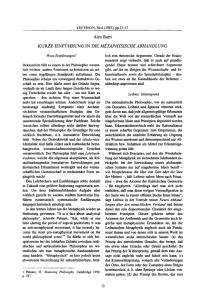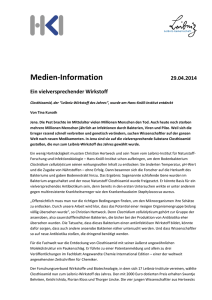Der neuzeitliche Begriff des Begriffs (BuB II)
Werbung

1. Der neuzeitliche Begriff des Begriffs Rückblick: Entfaltung und Preisgabe menschlicher Eigenständigkeit Die Entwicklung der neuen, “philosophischen” Kunst des Begründens war in der klassischen Zeit der Antike von der Hoffnung vorangetrieben worden, daß die Menschen fähig seien, sich des Zwangs undurchschauter, sachunangemessener Einflüsse zu entledigen, um so, neben anderem, zu einer eigenverantwortlichen Einstellung gegenüber den Kriterien für die Beurteilung der Geltung von Behauptungen zu gelangen. Am Ende der Philosophie der Spätantike hingegen, und nochmals dann am Ende der Philosophie des Mittelalters, schien alles dafür zu sprechen, daß jene Hoffnung getrogen hatte. Die Gründe dafür sind, so haben wir gesehen, zunächst einmal erkenntniskritischer Art gewesen (so in der Philosophie der Spätantike), und hingen dann (im Spätmittelalter) mit theologischen Motiven zusammen. Für die Entwicklung der Philosophie der Spätantike waren insbesondere zwei Schritte wichtig. Der erste von ihnen bestand aus einer bestimmten Generalisierung: man generalisierte die Auffassung, daß die Erkenntnisbemühungen der Menschen von der Beschaffenheit der kognitiven Mittel abhängig seien, über welche die Menschen, in einer gewissen Unabhängigkeit von den Gegenständen der Erkenntnis, verfügen. Selbst die Bemühungen, die darauf zielen, Einsichten über die Bezugspunkte für die Überprüfung der Geltung prädikativer Aussagen zu gewinnen, sind, so meinte man von nun an, auf den Gebrauch von Sinnes“werkzeugen” und anderen psychischen “Medien” angewiesen. Der zweite Schritt dann, der speziell von Sextus Empiricus vollzogen wurde, bestand aus einer Reflexivierung: Sextus reflexivierte die Kritik an der Leistungsfähigkeit der menschlichen Erkenntnisorgane, das heißt er bezog diese Kritik auch auf die Tätigkeit dessen zurück, der diese Kritik ausübt. Wer sich die Position eines Richters anmaßt, der gleichsam von außen her zu beurteilen versucht, ob es bei dem einen oder anderen Gebrauch der menschlichen Erkenntnisorgane dazu kommt, daß die Dinge, wie sie wirklich sind, verzerrt wahrgenommen werden, der zeigt nach der nunmehr gewonnenen Einsicht nur, daß er sich noch nicht darüber im klaren ist, in welchem Ausmaß auch er selbst von ihm vorgegebenen Filtern der Welterkenntnis abhängt. Das Ergebnis dieser Entwicklung war die Überzeugung, daß die Menschen grundsätzlich unfähig seien, zwischen den Eigenschaften zu unterscheiden, die Gegenständen der äußeren Welt – einschließlich der Ideen, Wesenheiten, usw. – “objektiv” zukommen, und den Eigenschaften, die ihnen lediglich aufgrund dessen zukommen, was den Menschen infolge der Eigenheiten ihrer Erkenntnisorgane vorgetäuscht wird. Ob man beispielsweise von einer Idee (und damit von einem als Maßstab, als Kriterium für die Überprüfung der Geltung von Aussagen einsetzbaren Gegenstand) etwas sagt, was in Wirklichkeit nur von den subjektiven Bedingungen des Zugangs zu dieser Idee, nicht aber von dieser Idee selbst abhängt, das, so meinte man jetzt, ist grundsätzlich unentscheidbar. Und damit war das klassische antike Konzept des philosophischen Begründens von 1 (prädikativen) Behauptungen zusammengebrochen. Auch für die Entwicklung der für unseren Zusammenhang wichtigen Teile der Philosophie des Mittelalters waren – wenn wir von Augustinus für einen Moment absehen – insbesondere zwei Schritte bedeutsam. Der eine wurde bereits verhältnismäßig früh, von mittel- und neuplatonischen Autoren, vollzogen. Er lief darauf hinaus, daß man die zunächst noch im Sinne Sokrates’ beziehungsweise Platons verstandenen Ideen theologisch mentalisierte: man ließ sich nicht mehr von der Überzeugung leiten, daß es die Ideen gleichsam seit jeher gegeben habe, daß sie sogar dem (im einzelnen wie auch immer zu verstehenden) Schöpfer der Welt vorgegeben gewesen seien. Sondern man nahm an, daß Gott die Ideen zunächst einmal selbst ersonnen habe, um sie sodann als Muster für die Erzeugung der konkreten Gegenstände zu benutzen, aus denen die von ihm geschaffene Welt sich zusammensetzt. Der zweite hier vollzogene Schritt dann lag darin, daß man den theologischen Gedanken der Allmacht Gottes immer mehr radikalisierte. Hatte man im frühen und hohen Mittelalter (unter Nutzung platonischer und aristotelischer Traditionsbruchstücke) noch gehofft, die Menschen seien imstande, aus der Untersuchung konkreter Gegenstände die Ideen ermitteln zu können, nach denen Gott diese Gegenstände geschaffen hat, so glaubte man jetzt, diese Hoffnung fahren lassen zu müssen. Denn wenn Gott wirklich allmächtig ist, dann, so meinte man, mußte eine solche Hoffnung irrig sein – lief sie doch darauf hinaus, Gott in seinen in Wirklichkeit jederzeit wirksam werdenden Einflußmöglichkeiten auf die Menschen zu beschränken. Auch hier war das Ergebnis dieser Entwicklung die Auffassung, Menschen seien grundsätzlich nicht in der Lage, zwischen dem zu unterscheiden, was der einen oder anderen Idee, Wesenheit, usw., wirklich zukommt, und dem, was die Menschen der betreffenden Idee lediglich infolge des Einflusses ihres kognitiven “Apparats” zuschreiben. Nur fußt diese Auffassung jetzt, wie gesagt, auf einer Radikalisierung der Theologie, während sie sich bei Sextus sozusagen einer Radikalisierung der mit rational-systematischem Anspruch vorgetragenen Methodologie verdankte. Augustinus Aber Augustinus? Fand sich bei ihm nicht ein Ansatz, der über den spätantiken Skeptizismus hinauswies? — Bis zu einem gewissen Grade, so wissen wir, durchaus. Denn Augustinus verschränkt zwei wichtige spätantike Motive: die theologisch verstandene Mentalisierung der Ideen; und die – vor dem Hintergrund der Einsicht in die Besonderheiten selbstbezüglicher psychologischer Äußerungen gewonnene – Entdeckung der Gegenstände der psychischen Innenwelt des Menschen, der Gegenstände des Selbstbewußtseins. Und das eröffnet in der Tat ganz andere Perspektiven als sie den Autoren des Neuplatonismus oder einem Skeptiker wie Sextus Empiricus zugänglich waren. Man konnte, auf der Basis dieses Schrittes, von einer ganz neuen Überlegung ausgehen: von der Überlegung, daß die Menschen sich zunächst einmal von der Betrachtung der Gegenstände der äußeren Welt distanzieren müßten – zugunsten der Betrachtung ihres eigenen Innen; wobei sie dann dort, wie man meinte, im Prinzip auf jene 2 Schicht der eigenen Seele würden stoßen können, in die Gott die Ideen, die Muster der Dinge, eingepflanzt hat, derer er sich bei der Erschaffung der Welt bediente. Nun war dies freilich nur ein erster Schritt auf dem Wege des Versuchs, dem spätantiken Skeptizismus eine Alternative entgegenzustellen. Um diesen Schritt wirklich systematisch fruchtbar zu machen, hätte man noch einiges mehr tun müssen. Insbesondere hätte man zeigen müssen, welche Konsequenzen sich aus ihm in Hinsicht auf die Frage nach den Möglichkeiten für die Überprüfung der Geltung von Aussagen – auch, und insbesondere, von Aussagen über Ideen – ziehen lassen würden. Doch derartige Überlegungen hat Augustinus nicht mehr vorgetragen. Etwas anderes, wichtiges, kommt noch hinzu. Augustinus mochte einen, im einzelnen wie auch immer fortzuführenden Schritt zur Auflösung der spätantiken Skepsis getan haben. Aber welches Bild ergibt sich, sobald man seine Position neben den spätmittelalterlichen Skeptizismus, die Position eines Ockham etwa, hält? Wir haben bereits davon gesprochen, daß die Entdeckung der psychischen Innenwelt – als einer Welt von Gegenständen, die dem Menschen ohne den Gebrauch des Mediums seiner Sinneswerkzeuge zugänglich ist – in den Schriften von früh- und hochmittelalterlichen Autoren wie zum Beispiel Thomas von Aquin keine Rolle gespielt hat. Bemerkenswerterweise hat sich diese Sachlage bei Ockham indes geändert. Im “Prolog” seines Kommentars zu den Sentenzen Petrus Lombardus’ zum Beispiel schreibt Ockham: die “Denkakte, Gemütserregungen, Freuden und Trauerempfindungen sind (...) in keiner Weise mit den Sinnen erfaßbar”. Und: “Jeder macht bei sich selbst die Erfahrung, daß er denkt, liebt, sich freut, traurig ist.”1 Überdies verweist er wenig später ausdrücklich auf jene oben (Bd. I, S. 246) wiedergegebene Passage aus Augustinus’ De Trinitate, die auf die Eigenarten der – später so genannten – Selbstreflexion aufmerksam macht. Doch es ist wichtig, sich darüber im klaren zu sein, daß dieses von Augustinus übernommene Motiv für Ockham nicht mehr dieselbe Funktion hat wie für Augustinus. Denn Augustinus konnte, vor dem Hintergrund seiner theologischen Grundannahmen, glauben, durch die Introspektion Einsichten zu gewinnen, die zugleich Einsichten über das Wesen der Gegenstände der äußeren Welt darstellen. Ockham hingegen kann dies nicht. Für Ockham gilt ja: ganz gleich, was man in der Selbstreflexion zutage fördert; ganz gleich, ob man dabei auf Universalien stößt, die Gott, wenn er dies denn je gewollt haben sollte, in die Menschen hineingelegt hat: einen sicheren Grund dafür, daß die so gewonnenen Überzeugungen etwas mit dem zu tun haben, wie Gott die Welt geschaffen hat, gibt es nicht. Denn wenn Gott wirklich allmächtig ist – und wäre es nicht Frevel, ihm dieses Prädikat zu verweigern? –, dann muß es nicht so sein, daß die Universalien, die Menschen vielleicht in sich selber finden, dem Wesen der von Gott erzeugten Gegenstände entsprechen. Und was sollen dem 1 “(...) intellectiones, affectiones, delectationes, tristitiae et huiusmodi sunt intelligibiles et nullo modo sensibiles”; “(...) quilibet experitur in se, quod intelligit, diligit, delectatur, tristatur”. Wilhelm von Ockham, Ordinatio sive Scriptum in librum primum Sententiarum, I.1,12-13 (Imbach, S. 140f.). 3 Menschen Gewißheiten über sein eigenes Innen allein, da er doch, um in dieser Welt leben zu können, darauf angewiesen ist, sich zum Zweck seiner Auseinandersetzung mit der ihn umgebenden äußeren Natur, den anderen Menschen nach Orientierungspunkten, nach Möglichkeiten der rationalen Konfliktbehebung umzutun? 1.1 DIE RATIONALISTISCH VERSTANDENE MENTALISIERUNG DER IDEEN UND DER NEUZEITLICHE BEGRIFF DES BEGRIFFS Platon hatte an einer zentralen Stelle seines Dialogs Parmenides ausdrücklich auf den von ihm angenommenen Zusammenhang zwischen dem Begriff der Idee und der Möglichkeit des rationalen Begründens von Behauptungen hingewiesen: wer die Rede von Ideen nicht zulasse, der werde, so läßt er Parmenides dort sagen, “nichts haben, wohin er seinen Verstand wende”, der werde “das Vermögen der Untersuchung gänzlich aufheben”.2 Und genau dies nun charakterisiert, wie es scheint, die Situation am Ausgang der Antike wie auch, in verschärfter Weise, am Ausgang des Mittelalters. Eine ausweglose Situation? — Nicht ganz. Denn in der Entdeckung der psychischen Innenwelt (als einer Welt von Gegenständen, die von der der Gegenstände der Außenwelt durch die Art, zu ihr Zugang gewinnen zu können, scharf unterschieden ist) steckte, wie sich zeigen sollte, ein bis zu jener Zeit noch nicht genutztes Entwicklungspotential. Und es ist die Nutzung dieses Potentials, die zu Lockes “new way of ideas”, und ganz allgemein zur neuzeitlichen Konzeption von (allgemeinen beziehungsweise abstrakten) “Ideen”, von (allgemeinen) “Vorstellungen”, von “Begriffen”, usw., führen sollte. Freilich reichten die Veränderungen, denen der antike Begriff der Idee, – beziehungsweise die antiken Begriffe der Wesenheit, der Prolepsis, der Ennoia, usw. – zu diesem Zweck unterworfen werden mußten, außerordentlich weit. Sie reichten so weit, daß sich schließlich das gesamte System von Überzeugungen, welches für das antike Verständnis von den Möglichkeiten des Begründens prädikativer Aussagen kennzeichnend gewesen ist, in seiner Struktur wandeln wird: mit der Philosophie der Neuzeit setzt eine strukturell neue Phase in der Geschichte des (Begriffs) philosophisch vermittelten Begründens von Behauptungen ein. Schauen wir uns diese Vorgänge etwas genauer an! In ihrem Zentrum steht, wie gesagt, der neuzeitliche Begriff des Begriffs. Und den Prozeß, der zu diesem Begriff führt, können wir als den der “rationalistisch verstandenen Mentalisierung der Ideen” bezeichnen. 1.1.1 Begriffe sind unmittelbar zugängliche Gegenstände des Selbstbewußtseins Notieren wir zunächst noch einmal, der Vollständigkeit halber, daß die neuzeitlichen Autoren Begriffe als eine Teilklasse der Klasse der psychischen Phänomene auffassen, und daß die psychischen Phänomene für sie aus einem ganz bestimmten Grund im Mittelpunkt ihres Interesses stehen: weil es sich hier – wie der jederzeit mögliche Blick auf die Besonderheiten selbstbezügli2 Platon, Parmenides, 135b-c. 4 cher psychologischer Äußerungen zu belegen scheint – um Gegenstände handelt, zu denen jeder Mensch in seinem eigenen Innen einen unmittelbaren, das heißt nicht auf den Gebrauch seines Sinnes“apparats” angewiesenen Zugang besitzt. Das war der Hintergrund für jene Bemerkung Lockes aus dem Essay Concerning Human Understanding, die wir oben (Bd. I, S. 200) bereits kurz betrachtet haben, und die ich hier noch einmal zitieren möchte: “Alles, was der Geist in sich selbst wahrnimmt oder was unmittelbares Objekt der Wahrneh3 mung, des Denkens oder des Verstandes ist, das nenne ich Idee.” Das Wort “idea” wird von Locke hier freilich, wie wir ebenfalls bereits notiert hatten, in einer doppelt ungewöhnlichen Weise verwendet. Nicht nur, daß er es, ganz im Gegensatz zu Platons Sprachgebrauch, für ein psychisches Phänomen benutzt. Er verwendet es darüber hinaus auch noch in einem so weiten Sinne, daß es schlechthin für alle psychischen Phänomene, für alle “Bewußtseinsphänomene”, wie man auch sagen kann, steht. Locke ist nicht der erste, der dies tut. Er schließt sich hier – wie in zahlreichen anderen Punkten auch – Descartes an. Descartes nämlich schreibt zum Beispiel in einer seiner Erläuterungen zu den 1641 erstmals erschienenen Meditationes de prima philosophia: 4 “Unter einer Idee fasse ich alles das, was unmittelbar vom Geiste wahrgenommen wird.” Und in einem Brief an Mersennes, vom Juli desselben Jahres 1641, erläutert Descartes: “Ich bezeichne mit dem Wort Idee generell all das, was sich in unserem Geiste befindet, wenn 5 wir uns einer Sache bewußt sind, ganz gleich, auf welche Weise wir uns ihrer bewußt sind.” Von daher erklärt sich also, warum einige Autoren, wie zum Beispiel Locke, sich genötigt sehen, eigens von “allgemeinen” oder “abstrakten” Ideen zu sprechen, sobald sie das im Auge haben, was für sie das Analogon zu den Ideen im Sinne Platons abgeben soll. Im übrigen fehlt es aber natürlich auch nicht an Belegen, in denen speziell im Hinblick auf die allgemeinen Ideen, die Begriffe, betont wird, daß sie etwas seien, für deren Untersuchung die Menschen nicht auf den Gebrauch ihrer Sinnesorgane angewiesen sind. Leibniz etwa – um nur eines von zahlreichen Beispielen zu erwähnen – bemerkt beiläufig, als sei es bereits selbstverständlich, in seinen 1686 verfaßten Generales Inquisitiones de Analysi Notionum et Veritatum: die Analyse der Begriffe finde grundsätzlich “im Geiste, ohne Erfahrungsgegebenheit” statt, wenn man einmal von der selbstbezüglichen “Erfahrung” absehe.6 3 “Whatsoever the mind perceives in itself, or is the immediate object of perception, thought, or understanding, that i call idea.” Locke, Essay, II.viii.8. 4 “ostendo me nomen ideae sumere pro omni eo quod immediate a mente percipitur.” Descartes, Antwort auf den fünften Einwand innerhalb des Komplexes der dritten Einwände gegen die Meditationes de prima philosophia (A.T., Bd. VII, S. 181). 5 “i’appelle generalement du nom d’idée tout ce qui est dans nostre esprit, lors que nous conceuons une chose, de quelque maniere que nous la conceuions.” (A.T., Bd. III, S. 392f.). 6 Resolutio conceptuum fit “in mente sine experimento (nisi reflexivo quod ita concipiamus).” Leibniz, Generales Inquisitiones, § 131, vgl. auch ebd., § 69. 5 Ein Blick auf die Sekundärliteratur Ich habe bereits mehrfach betont, daß man das Entstehen der neuzeitlichen Philosophie in einem engen Zusammenhang mit dem Rückgriff auf jene Entdeckung sehen sollte, die bereits für Augustinus eine so wichtige Rolle gespielt hatte: die Entdeckung der Besonderheiten selbstbezüglicher psychologischer Äußerungen, und die vor diesem Hintergrund zu sehende Entdeckung der Gegenstände der psychischen Innenwelt. Das geschah nicht ohne Grund. Denn es fällt ja wirklich auf, daß hier, wie schon bei Sokrates (beziehungsweise, wenn man so will, beim Beginn der antiken Philosophie überhaupt) ein entscheidender Schritt in der Geschichte des Begründens daraus besteht, daß man zu dem Glauben gelangt, eine neue Art von Gegenständen ausfindig gemacht zu haben, und daß dieser Glaube einen großen Teil seiner Plausibilität ausgesprochener- oder auch unausgesprochenerweise einem ganz bestimmten Umstand verdankt: dem Umstand, daß er anscheinend ohne sonderliche Mühe durch einen Hinweis auf Teile des alltäglichen Sprachgebrauchs bekräftigt werden kann. Auffällig ist allerdings auch noch etwas anderes: auffällig ist, daß man diesen Umstand in der neueren historischen Darstellung des Entstehens der neuzeitlichen Philosophie so gut wie gar nicht in Rechnung zu stellen pflegt. Er spielt zwar, wie wir noch sehen werden, in der Auseinandersetzung mit der neuzeitlichen Philosophie eine zentrale Rolle, die den späten Wittgenstein zu einem wiederum neuen Begriff des Begriffs führen wird. Aber die bisherige Philosophiegeschichtsschreibung hat ihn so gut wie gar nicht bemerkt. In der Regel begnügt man sich damit, zu notieren, daß es für Begriffe wie den des Selbstbewußtseins, sowie für nunmehr entstehende begriffliche Probleme, wie zum Beispiel das des Verhältnisses zwischen Körperlichem und Geistigem, in der antiken Philosophie keine Äquivalente gibt. Warum dies so ist; ob es für diese begrifflichen Neuerungen nicht vielleicht – abgesehen von allen soziohistorischen, individualpsychologischen und weiteren externen Faktoren – Gründe gegeben haben mag, die zumindest aus der Perspektive der damaligen Autoren höchst einleuchtend scheinen mußten: darauf weiß man keine Antwort. Descartes’ Unterscheidung zwischen Körperlichem und Geistigem beispielsweise erscheint in den Augen dieser Autoren lediglich als ein, je nach eigenem Standpunkt, entweder begrüßenswerter oder sonderlicher Einfall mit – erfreulicheroder auch kurioserweise – höchst folgenreichen Konsequenzen für die nächsten dreihundert Jahre Philosophiegeschichte. Zahlreiche Beispiele für diese unbefriedigende Sicht der Dinge vermitteln die Hinweise auf die Literatur, die R. Rorty im Kapitel 1.4 seines Buchs Philosophy and the Mirror of Nature anführt. Was Rorty selbst betrifft, so verweist er zwar darauf, daß die Unbezweifelbarkeit des “Wissens” von den je-eigenen, momentanen psychischen Regungen und Zuständen für Descartes eine besondere Bedeutung besessen hat (und welcher Leser der Meditationes de prima philosophia könnte dies auch übersehen?). In welchem Zusammenhang dies aber mit Augustinus steht (dessen Schriften Descartes natürlich gut gekannt hat), in welchem Zusammenhang es folglich mit dem Bemühen steht, dem durch die spätantike Reflexivierung der Erkenntniskritik entstehenden 6 Skeptizismus etwas entgegenstellen zu können – davon ist bei Rorty kein Wort zu finden. Ebensowenig, wie er sich der Eigenart und der Motive jenes Schritts bewußt ist, der Descartes’ Absetzbewegung vom spätmittelalterlichen Skeptizismus eines Ockham zugrunde liegt. Daß Rorty aufgrund einer so kargen Berücksichtigung philosophiehistorischer Verbindungsstränge zu der Auffassung gelangt, das Auftreten der neuzeitlichen Bewußtseinsphilosophie stelle einen durch keinerlei nennenswerte Kontinuitäten gemilderten abrupten Bruch mit der voraufgegangenen Tradition dar, einen Paradigmawechsel im Sinne T. S. Kuhns, kann daher nicht verwundern 1.1.2 Begriffe sind vom menschlichen Verstand autonom geschaffene, unmittelbar zugängliche Gegenstände des Selbstbewußtseins Eine neue Art Bescheidenheit Doch zurück zu den Problemen, die die Autoren des 17., und dann auch noch des 18. Jahrhunderts wirklich zu lösen versucht haben. Wir wissen bereits: daß man auf die Besonderheiten der Gegenstände des menschlichen Innenlebens aufmerksam wird – dies allein eröffnet keineswegs schon Alternativen gegenüber dem Skeptizismus der Spätantike, und es eröffnet erst recht keine Alternativen gegenüber dem Skeptizismus des Spätmittelalters. Und zwar gilt dies zumindest so lange, wie es nicht gelingt, etwas ganz Bestimmtes systematisch plausibel zu machen: solange es nicht gelingt, zu zeigen, daß das, was jeder Mensch in seinem eigenen Innen zu finden .vermag, auch für die Überprüfung der Geltung prädikativer Aussagen über Gegenstände der Außenwelt eine wichtige Rolle spielt. Behalten wir diese Überlegung im Auge, und schauen wir uns jetzt eine weitere der Bemerkungen Lockes aus seinem Essay an! In dem in vielerlei Hinsicht besonders aufschlußreichen dritten Kapitel des dritten Buchs dieses Werks schreibt Locke, neben anderem: “(...) die Annahme von Wesenheiten, die wir nicht erkennen können, die aber trotzdem für die Unterscheidung der Arten der Dinge ausschlaggebend sein sollen, ist derartig nutzlos und unserer Erkenntnis in keiner Hinsicht dienlich, daß das allein schon ausreichte, um uns zu veranlassen, sie beiseite zu legen und uns mit denjenigen Wesenheiten der Klassen oder Arten der Dinge zu begnügen, die in den Bereich unserer Erkenntnis fallen. Bei genauerer Prüfung wird sich (...) herausstellen, daß diese nichts anderes sind als jene abstrakten komplexen Ideen, de7 nen wir besondere allgemeine Namen beigelegt haben. ” 7 “(...) the supposition of essences that cannot be known; and the making of them, nevertheless, to be that which distinguishes the species of things, is so wholly useless and unserviceable to any part of our knowledge, that that alone were sufficient to make us lay it by, and content ourselves with such essences of the sorts or species of things as come within the reach of our knowledge: which, when seriously considered, will be found, as I have said, to be nothing else but, those abstract complex ideas to which we have annexed distinct general names.” Locke, Essay, III.iii.17. — Man ziehe auch noch einmal das oben, Bd. I, S. 200, wiedergegebene Zitat (c) aus dem Essay heran! 7 Wahrlich eine Schlüsselstelle! Denn wofür plädiert Locke hier? — Kurz gesagt: dafür, daß die Menschen sich in einem bestimmten Sinne bescheiden möchten. Wenn man sich schon nicht sicher sein kann, daß die (abstrakten) Ideen, die man in sich selber findet, den Ideen entsprechen, die Gott bei der Erschaffung der Welt benutzt hat; wenn man sich schon nicht sicher sein kann, daß jene Ideen den Wesen der Dinge – den “realen Wesenheiten”, wie Locke, unter Verwendung eines uns bereits bekannten Ausdrucks, sagt – entsprechen: warum dann nicht auf dieses Konzept der Ideen beziehungsweise Wesenheiten gänzlich verzichten? Warum es nicht aufgeben, und sich mit dem begnügen, was für uns Menschen, für unsere Zwekke, nun einmal unentbehrlich ist: mit einem Begriff von (abstrakten) Ideen, der so beschaffen ist, daß er den Menschen sehr wohl die Möglichkeit läßt, Gegenstände einer solchen Art zu erkennen?8 Ein neuer Schritt der Entfaltung menschlicher Eigenständigkeit Locke ist nicht der erste neuzeitliche Autor, der sich für diese neue Art von Bescheidenheit ausspricht. Schon bei Galilei finden sich derartige Äußerungen, so zum Beispiel, wenn er in seinem dritten Brief an Markus Welser bemerkt, “entweder wollen wir spekulativ versuchen, das wahre und innere Wesen der natürlichen Substanzen zu durchdringen, oder wir wollen uns mit der Kenntnis einiger ihrer Erscheinungen begnügen. In das Wesen einzudringen, halte ich ebenso für ein unmögliches Unterfangen wie 9 eine leere Mühe”, und wenn er dem hinzufügt: “Solche Erkenntnis zu gewinnen, ist für den Zustand der Seligkeit aufgespart und nicht vorher möglich. Wenn wir uns aber bescheiden wollen mit der Erfassung irgendwelcher Eigenschaften, so glaube ich, daran auch bei den von uns entferntesten Körpern nicht stärker zweifeln zu 10 müssen als bei den nächstgelegenen.” Und Vergleichbares liest man auch bei I. Newton. Gleichwohl gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen Galilei und Newton auf der einen Seite und Locke auf der anderen. Während jene es im Grunde dabei belassen, auf den alten Begriff der 8 H. Blumenberg zufolge macht es ganz allgemein einen “Grundzug der neuzeitlichen Vernunft (...), der nicht überschätzt werden kann” aus, daß man zu der “vielleicht nicht einmal sehr deutlichen Einsicht (gelangt), daß Gewinne an Wahrheit und Genauigkeit nur durch Verzichte erreichbar seien, daß man nicht alle Fragen geltend machen kann, wenn man stichhaltige Antworten auf wenigstens einige bekommen will.” (H. Blumenberg, Die Genesis der kopernikanischen Welt, Bd. 2, S. 358). Ein besonders deutliches Beispiel dafür ist, so erläutert Blumenberg, der Verzicht auf Fragen nach den Zweckursachen, wie er in besonders prononcierter Weise von Descartes gefordert wird. Und ein weiteres Beispiel sieht Blumenberg in Newtons berühmtem Satz “hypotheses non fingo” angedeutet. Auf Lockes, von uns hier betrachtete Ausführungen verweist Blumenberg aber eigentümlicherweise nicht. 9 “(...) o noi vogliamo specolando tentar di penetrar l’essenza vera ed intrinseca delle sustanze naturali; o noi vogliamo contentarci di venir in notizia d’alcune loro affezioni. Il tentar l’essenza, l’ho per impresa (...) e per fatica (...) vana (...).” Galilei, 3. Brief an Markus Weiser (Marco Velseri), vom 1. 12. 1612 (Opere, hrsg. von F. Flora, S. 949). 10 “questa è quella cognizione che ci vien riservata da intendersi nello stato di beatitudine, e non prima. Ma se vorremo fermarci nell’appressione di alcune affezioni, non mi par che sia da desperar di poter conseguirle anco ne i corpi lontanissimi da noi, non meno che ne i prossimi (...).” Ebd. 8 “in” den Dingen liegenden Wesenheiten zu verzichten, hat Locke mehr im Auge. Er möchte zeigen, daß jener Verzicht sich durchaus mit dem Interesse daran verträgt, weiterhin über ein bestimmtes Konzept von Bezugspunkten für die Überprüfung der Geltung von prädikativen Aussagen – beziehungsweise, wie es in unserem Textauszug angedeutet ist, über ein Konzept von Bezugspunkten für die Anwendung und Überprüfung von Unterscheidungen – zu verfügen. Doch wie soll dies angehen? — Nun, ganz einfach. Und Locke deutet es in den bereits zitierten Passagen auch schon an. Zunächst einmal muß man den Unterschied zwischen der Perspektive Gottes und der der Menschen besonders betonen, muß man, um noch eine weitere der einschlägigen Äußerungen Lockes, diesmal aus einem Brief an den Bischof Stillingfleet, heranzuziehen, sich zu einer solchen Auffassung bereit finden: “Die realen Beschaffenheiten oder Wesenheiten der einzelnen Dinge, die es gibt, hängen nicht von den Ideen der Menschen sondern vom Willen des Schöpfers ab; aber daß sie, unter diesem und diesem Namen, in Klassen eingeordnet werden, das hängt – und zwar zur Gänze – von 11 den Ideen der Menschen ab.” Und darüber hinaus sollte man, um wirklich jeden Versuch einer doch noch irgendwie erträumten Übereinstimmung zwischen den Ideen Gottes beziehungsweise den (“realen”) Wesenheiten der Dinge zum einen und den Ideen der Menschen zum anderen gleich im Ansatz zu vermeiden, betonen, daß die Ideen ein eigenständiges Erzeugnis des menschlichen Verstands sind – so, wie Locke es, erneut unter Aufnahme einer Formulierung Descartes’12, in der uns bereits vertrauten Passage aus dem Essay tut, in der es heißt: “(...) die Wesenheiten der Arten der Dinge und folglich auch die Klassifizierung der Dinge 13 sind das Werk des Verstandes, der abstrahiert und jene allgemeinen Ideen schafft.” Man sieht, mit welch außerordentlichen Unterschieden wir es zu tun haben, sobald man Lockes Position mit der sokratisch-platonischen Konzeption der Ideen, oder auch der aristotelischen Konzeption der Wesenheiten, vergleicht. Zwar war auch die in der Philosophie der Antike entwickelte Auffassung gleichbedeutend damit gewesen, daß die Menschen sich ein erheblich größeres Maß an Autonomie zuschrieben als je zuvor. Anders als bislang war jedermann nunmehr allein von seinen eigenen Anstrengungen abhängig, wenn er sich über die Beschaffenheit des einen oder anderen Bezugspunkts für die Überprüfung der Geltung prädikativer Aussagen orientieren wollte. Aber dabei galt doch, daß er diesen Bezugspunkt selbst als etwas ihm Vorgegebenes interpretierte. Jetzt hingegen löst sich diese Überzeugung auf. Jetzt sind die Vergleichsobjekte, derer man sich bei der Überprüfung der Geltung prädikativer Aussagen bedienen möchte (ganz gleich, wie man sie sich im Detail vorstellt), nicht mehr etwas dem Menschen Vorgegebenes, sondern etwas vom menschlichen Verstand Ge11 “The real constitutions or essences of particular things existing do not depend on the ideas of men but on the will of the Creator; but their being ranked into sorts, under such and such names, does depend, and wholly depend, upon the ideas of men.” (Zitiert nach A. C. Fraser, in der von ihm herausgegebenen Ausgabe des Essay, Bd. 2, S. 25, Anm. 2). 12 “Jede Idee ist ein Werk des Verstands (toute idée (est) un ouvrage de l’esprit)”. Descartes, Meditationes, 111.14. 9 machtes. Der neuzeitliche Begriff des Begriffs markiert zugleich eine neue Phase der Entfaltung menschlicher Eigenständigkeit. Was also ist ein im neuzeitlichen Sinne verstandener “Begriff’? Der Leser wird sich noch daran erinnern, daß wir beim Vergleich zwischen dem spätantiken Konzept der Prolepsis und Lockes für die Philosophie der Neuzeit paradigmatischem Konzept der abstrakten Idee auf insbesondere drei Unterschiede gestoßen waren: Locke betont, daß abstrakte Ideen psychische Phänomene seien, derer die Menschen sich bei der Reflexion über ihr eigenes Innen unmittelbar bewußt werden können. Er spricht davon, daß die abstrakten Ideen ein Werk des menschlichen Verstands (und nicht etwa Abbildungen von in den Dingen liegenden Gemeinsamkeiten, oder Vergleichbares) sind. Und er unterscheidet zwischen realen und nominalen Ideen beziehungsweise Wesenheiten. Wobei dies alles in einem starken Gegensatz zu dem epikuräischen oder auch stoischen Verständnis des Konzepts der Prolepsis steht. Ich denke, wir sind jetzt in der Lage, zu verstehen, wodurch sich diese Unterschiede erklären lassen: sie alle sind Folgen des Versuchs, sich des spätantiken beziehungsweise spätmittelalterlichen Skeptizismus’ zu erwehren. Daß die abstrakten Ideen als psychische Phänomene konzipiert werden, zu denen die Menschen einen unmittelbaren Zugang besitzen, dient dem Zweck, der Reflexivierung der Erkenntniskritik, wie Sextus Empiricus sie vollzogen hatte, die Spitze zu nehmen. Daß die abstrakten Ideen als etwas aufgefaßt werden, was der menschliche Verstand, und nicht etwa Gott, geschaffen hat, geschieht aus der Absicht heraus, die Unterordnung des menschlichen Lebens in dieser Welt unter die Ziele einer radikalisierten Theologie zu vermeiden. Und daß Locke zwischen nominalen und realen Ideen beziehungsweise Wesenheiten unterscheidet, entspringt dem Wunsch, darauf aufmerksam zu machen, daß nunmehr die in einem neuen Sinne verstanden (abstrakten) Ideen als Bezugspunkte für die Überprüfung der Geltung von prädikativen Aussagen genommen werden sollen. Will man zu einer generellen Umschreibung dessen kommen, was neuzeitliche Autoren mit Wörtern wie “abstract” (oder “general”) “idea”, “concept”, “notion”, “allgemeine Vorstellung”, “Begriff”, usw.,14 im Auge haben, sollte man also – bis auf weitere, später noch darzustellende Präzisierungen – eine Formulierung wie zum Beispiel diese wählen: 13 “(...) the essences of the sorts of things, and consequently, the sorting of things, is the workmanship of the understanding that abstracts and makes those general ideas.” Locke, Essay, III.iii.12. 14 Diese Aufzählung ist selbstverständlich nicht vollständig. Descartes beispielsweise verwendet statt des lateinischen Worts “idea” (oder des französischen “idée”) gelegentlich auch “figura” (so in den Regulae ad directionem ingenii, XII.8) oder “ratio formalis”, beziehungsweise, im Französischen, “raison formelle” (so in seinen Antworten auf die dritten Einwände gegen die Meditationes, speziell in seiner Antwort auf den zweiten dieses Bündels von Einwänden (A.T., Bd. IX, S. 136, dt. S. 159). Gebräuchlich ist zu jener Zeit auch, sowohl bei Descartes wie bei Lokke und Leibniz, das Wort “forma”, usw. 10 (I) Das Wort “Begriff”, beziehungsweise das eine oder andere der damit äquivalent verwendeten Wörter, steht innerhalb der Philosophie der Neuzeit für ein vom menschlichen Verstand eigenständig (“frei”, “autonom”, “spontan”, usw.) geschaffenes, im Innern des Menschen unmittelbar zugängliches psychisches Phänomen, das die Menschen dazu befähigen soll, die Geltung prädikativer Aussagen überprüfen zu können. Natürlich ist eine solche Formulierung in vielerlei Punkten noch klärungsbedürftig. Insbesondere bedarf es einer Erläuterung dessen, was für eine Art von “psychischem Phänomen” hier gemeint ist. Doch Geduld! Darauf kommen wir gleich. Aber bevor wir uns diesem Punkt zuwenden, sollten wir uns noch mit einem anderen Zug dieser Umschreibung etwas genauer befassen. 1.1.3 Begriffe sind von einzelnen, historischen Menschen nach gegebenen Regeln zu erzeugende, unmittelbar zugängliche Gegenstände des Selbstbewußtseins Begriffe im neuzeitlichen Sinne dieses Worts sind vom Verstand des Menschen frei geschaffene Gegenstände des Selbstbewußtseins, usw. – warum eigentlich, so könnte man fragen, dieser Bezug auf ein bestimmtes menschliches “Vermögen”, wie den Verstand (oder, wie es bei anderen Autoren heißt, die “Seele”, die “Vernunft”, usw.)? Warum nicht einfach sagen: es sind wir, die einzelnen, historischen Menschen, die im Laufe der kulturellen Entwicklung der Gesellschaft, in der wir leben, die Begriffe hervorbringen? Nun, daß ich soeben jene Formulierung gewählt habe, und nicht die letztere, hängt natürlich, zunächst einmal jedenfalls, damit zusammen, daß nur sie den Darlegungen entspricht, die man bei neuzeitlichen Autoren wie zum Beispiel Locke findet. Denn Locke sagt ja ausdrücklich, die “Wesenheiten der Dinge” seien “das Werk des Verstandes” (the workmanship of the understanding), und nicht das Werk einzelner historischer Menschen. Aber ist das, so wird der Leser womöglich zu bedenken geben, nicht eine bloße Redeweise, die ohne Bedeutungsunterschied gegen uns heute weniger fremd scheinende Wendungen ausgetauscht werden kann? — So könnte man meinen. Doch in Wirklichkeit verhält es sich durchaus nicht so. Und es ist für das Verständnis der Schriften neuzeitlicher Autoren sogar eminent wichtig, sich klar zu machen, warum es sich nicht so verhält. Notieren wir zunächst einmal, daß Ausführungen über die verschiedenen “Gemütskräfte” des Menschen innerhalb dieser Schriften außerordentlich häufig anzutreffen sind. Beispiele dafür finden sich bereits bei Descartes. In seinem frühen, zu seinen Lebzeiten allerdings nicht veröffentlichtem Werk Regulae ad directionem ingenii15 etwa finden sich, neben anderem, Gleichartigem, Bemerkungen wie diese: man müsse “diejenige Kraft (vis), mit der wir die Dinge im eigentlichen Sinne erkennen”, nach ihren verschiedenen Funktionen differenzieren, und dann heiße sie 15 Descartes hat die Regulae wahrscheinlich im Herbst des Jahres 1628 abgeschlossen. Der lateinische Originaltext wurde aber erst im Jahre 1701 publiziert. 11 “einmal reiner Verstand, einmal Einbildungskraft, einmal Gedächtnis, einmal Sinn. Im eigentlichen Sinne aber heißt sie ‘ingenium’, wenn sie bald neue Ideen in der Phantasie zeichnet, 16 bald sich mit den bereits gezeichneten beschäftigt.” Nicht die einzelnen Menschen, sondern ein in ihnen liegendes Vermögen also erzeugt die Ideen. Hier ist es der reine Verstand (intellectus purus) beziehungsweise das Ingenium, später, in der französischen Fassung der Meditationes de prima philosophia, wird Descartes, wie bereits zitiert, sagen, jede Idee sei ein “Werk des Geistes (ouvrage de l’esprit)”.17 Und noch Kant wird den “Verstand” ausdrücklich definieren als “das Vermögen, Vorstellungen selbst hervorzubringen”.18 Doch was steht hinter solchen eigentümlichen Ausdrucksweisen? Erneut: das Protagoras-Problem In Descartes’ Meditationes de prima philosophia begegnet man einer Passage, die eine wichtige Hilfe bei dem Versuch ist, die soeben genannte Frage zu beantworten. Sie lautet: es verdiene “die höchste Beachtung, daß ich bei mir unzählige Ideen finde von gewissen Dingen, von denen man, wenngleich sie vielleicht nirgendwo außer mir existieren, dennoch nicht sagen kann, sie seien nichts. Und wenngleich ich sie gewissermaßen willkürlich denke, so erfinde ich sie dennoch nicht, vielmehr haben sie ihre wahrhaften und unveränderlichen Naturen. Wenn ich mir z. B. ein Dreieck bildlich vorstelle, so mag vielleicht eine solche Figur nirgend in der Welt außer meinem Bewußtsein existieren, noch je existiert haben, dennoch hat sie fürwahr eine bestimmte Natur oder Wesenheit oder Form, die unveränderlich und ewig ist, die weder von mir ausgedacht ist, noch von meinem Denken abhängt, wie daraus hervorgeht, daß sich von diesem Dreieck mancherlei Eigenschaften beweisen lassen, wie daß seine drei Winkel gleich zwei rechten sind, daß bei ihm dem größten Winkel die größte Seite gegenüber liegt und dergleichen, was ich jetzt klar erkenne, ich mag wollen oder nicht, wenngleich ich vorher keineswegs an diese Eigenschaften gedacht habe, als ich mir das Dreieck bildlich vorstellte, und ich 19 sie also auch nicht ausgedacht haben kann.” Zunächst einmal ist dies freilich eine Passage, die etliches von dem, was wir bisher in Erfahrung gebracht haben, in Frage zu stellen scheint. Denn hier sagt Descartes ja von sich selbst, und nicht von seinem Verstand, daß er die Ideen erdenke. Zudem koppelt er dies mit so platonisch klingenden Formulierungen wie der, daß die “Wesenheiten” von Gegenständen, die “Wesenheit” eines Dreiecks zum Beispiel, sich nie veränderten und von ihm auch nicht ausgedacht würden. 16 “vel intellectus purus, vel imaginatio, vel memoria, vel sensu; proprie autem ingenium appellatur, cum modo ideas in phantasia novas format, modo jam factis incumbit.” Descartes, Regulae, XII.10. 17 Descartes, Meditationes, III.14. 18 Kant, KrV, B 75/A 51. 19 “Quodque hic maxime considerandum puto, invenio apud me innumeras ideas quarumdam rerum, quae etiamsi extra me fortasse nullibi existant, non tamen dici possunt nihil esse; et quamvis a me quodammodo ad arbitrium cogitentur, non tamen a me finguntur, sed suas habent veras et immutabiles naturas: ut cum, exempli causa, triangulum imaginor, etsi fortasse talis figura nullibi gentium extra cogitationem meam existat, nec unquam extiterit, est tamen profecto determinata quaedam ejus natura, sive essentia, sive forma, immutabilis et aeterna, qua a me non efficta est, ne a mente mea dependet, ut patet ex eo quod demonstrari possint variae proprietates de isto triangulo, nempe quod eius tres anguli sint aequales duobus rectis; quod maximo ejus angulo maximum latus subtendatur, et similes, quas velim nolim dare nunc agnosco, etiamsi de iis nullo modo antea cogitaverim, cum triangulum imaginatus sum, nec proinde a me fuerint effictae.” Descartes, Meditationes de prima philosophia, V.5. 12 In Wirklichkeit haben wir es hier jedoch mit einer Bemerkung zu tun, welche einen Schlüssel zum Verständnis weiter Teile der Philosophie von Descartes bis hin zu Leibniz und Kant liefern kann. Was ist das Problem, auf das Descartes hier zu reagieren versucht? — Die Antwort auf diese Frage liegt auf der Hand: es ist eine neue Variante des uns bereits wohlbekannten ProtagorasProblems (s.o., Bd. I, S. 208f.). Erinnern wir uns: Protagoras hatte, ganz im Sinne jener ersten Phase europäischer Aufklärung, darauf insistiert, daß es die Menschen seien, welche die Maßstäbe für die Geltung von Behauptungen abgeben. Und der Schluß, den man anscheinend aus dieser, doch so plausiblen Bemerkung ziehen mußte, war: es gibt keinen von der je-individuellen Perspektive einzelner Menschen unabhängigen Bezugspunkt, relativ zu dem sich Behauptungen in einer intersubjektiv verbindlichen Weise begründen lassen könnten. Platon zwar hatte, wie wir wissen, dieses Problem durch den Hinweis auf sein Konzept der allen Menschen in gleicher Weise, “objektiv”, vorgegebenen Ideen beheben wollen. Doch dieser Versuch, so fruchtbar er sich zunächst auch erweisen sollte, hatte der Erkenntniskritik durch die hellenistisch-römische Philosophie und deren Reflexivierung nicht standgehalten. Erst die Mentalisierung der Ideen im Neuplatonismus schien hier einen gewissen Ausweg zu bieten, speziell wenn man sie, wie Augustinus es getan hatte, mit der Entdeckung der Besonderheiten der psychischen Innenwelt des Menschen verknüpft. Aber die Neuplatonisten hatten die Mentalisierung der Ideen in einem theologischen Sinne verstanden, und das ließ sich nun, nach der Radikalisierung der Theologie am Ausgang des Mittelalters, nicht mehr für die Zwecke der Weiterentwicklung der Kunst des Begründens von Behauptungen verwenden. Die mit der Mentalisierung der Ideen erzielbaren Vorteile ließen sich jetzt, so schien es jedenfalls, nur noch bewahren, wenn man nicht Gott, sondern die Menschen als Erzeuger der Ideen interpretierte. Und eben dies führt indes zu der Schwierigkeit, die in der soeben zitierten Darlegung Descartes’ zum Ausdruck kommt: Wenn die Menschen es sind, welche die Ideen – und damit die Vergleichspunkte zur Überprüfung der Geltung prädikativer Aussagen – frei erzeugen: wodurch soll dann gewährleistet sein, daß nicht jeder willkürlich seine eigenen Ideen hervorbringt? Wodurch ist dann gesichert, daß über die Ideen etwas mit Anspruch auf Objektivität gesagt werden kann, das heißt etwas, was in seiner Geltung nicht einfach von dem abhängt, was jeder nach seinem eigenen Gutdünken in die jeweilige Idee rasch hineindenkt? Es ist offenkundig: die platonischen Anklänge in Descartes’ Formulierungen entspringen dem Bemühen, trotz dieser Schwierigkeit nicht zu skeptischen Schlußfolgerungen genötigt zu sein. Aber in Wirklichkeit ist der Weg Platons für Descartes natürlich nicht mehr frei. Und so beruht der Gedankengang, den Descartes – und mit ihm die neuzeitlichen Autoren insgesamt – entwickelt, um zu einer Lösung jenes Problems zu kommen, denn auch auf etwas ganz anderem. Er beruht auf der Annahme, daß in diesem Zusammenhang zwischen zwei grundsätzlich verschiedenen Arten von Subjekten unterschieden werden sollte: den einzelnen Subjekten, 13 die in der Welt des alltäglichen Lebens miteinander reden, handeln, usw.; und den “in” diesen einzelnen Subjekten, in einer überpersönlichen Weise, zu findenden, Objektivität verbürgenden “Gemütskräften”, wie zum Beispiel dem Verstand, der Vernunft, usw. Dies ist, jedenfalls zunächst einmal, die Pointe, die hinter der Rede vom “Verstand”, vom “Geist”, der “Vernunft”, usw. usw., liegt, die für neuzeitliche Autoren so charakteristisch ist. Es muß also keineswegs jede von Menschen erzeugte (abstrakte) Idee, keineswegs jede Meinung über eine solche Idee als verbindlich hingenommen werden. Verbindlich sind nur die Ideen und Meinungen über Ideen, die dem vom Verstand, der Vernunft, usw., Geschaffenen entsprechen. Noch Lichtenberg zum Beispiel wird, am Ausgang des 18. Jahrhunderts, dies als den systematischen Kern der Philosophie seiner Zeit verstehen: “Die Menschenklasse, durch die die Vernunft so oft in Inquisition genommen ward, sieht sich nun endlich, umgekehrt, mit ihrem erbärmlichen Prozeß vor das Inquisitions-Gericht der Vernunft gezogen. Ketten und finstere Kerker werden freilich am Ende ihre Strafe da nicht sein, 20 aber dafür immer ein für sie lästiges Stück Arbeit – die Pflicht weiser zu werden.” Der Verstand als “Abbild Gottes” Indes, ist dies denn wirklich ein hilfreicher Schritt zur Behebung des Protagoras-Problems, so wie dieses sich unter den neuzeitlichen Grundannahmen stellt? Ist es denn nicht schlicht eine bloße, durch keine weitere Begründung zu deckende Unterstellung, daß es in jedem einzelnen Menschen eine solche überpersönliche Instanz gibt? Und selbst wenn man dies annehmen dürfte – mit welcher Berechtigung ließe sich von ihr sagen, daß sie Objektivität zu verbürgen imstande sei? Um zu verstehen, was neuzeitliche Autoren auf diese und verwandte Fragen geantwortet haben (oder was sie aller Wahrscheinlichkeit nach als Antwort gegeben hätten), empfiehlt es sich, in möglichst kleinen Schritten vorzugehen. Zu fremd ist uns vieles von dem geworden, was man damals geglaubt hat, als daß man es heute in einem unmittelbaren Zugriff nachvollziehen könnte. Beginnen wir mit der Feststellung, daß zumindest einige neuzeitliche Autoren die Objektivität stiftende Funktion des Bezugs auf den “Verstand”, die “Vernunft”, die “Seele”, usw., offensichtlich deswegen für gewährleistet halten, weil jene “Gemütskräfte” für sie gleichsam die Statthalter Gottes im Menschen sind. Besonders deutlich zeigt sich diese Auffassung in den Schriften Leibnizs. Im Paragraphen 28 seines aus dem Jahre 1686 stammenden Discours de Métaphysique beispielsweise schreibt er: “Auch haben wir in unsrer Seele die Ideen aller Dinge nur kraft der immerwährenden Einwirkung Gottes auf uns, das heißt nur darum, weil jede Wirkung ihre Ursache ausdrückt und die Wesenheit unsrer Seele mithin ein gewisser Ausdruck, eine Nachahmung und ein Abbild des göttlichen Wesens, Gedankens und Willens und aller der darin enthaltenen Ideen ist. Man 20 G. Ch. Lichtenberg, Nicolaus Copernikus, S.184 (zit. nach: ders., Schriften und Briefe, hrsg. von W. Promies, Bd. 3). 14 21 kann also sagen, daß Gott allein das unmittelbare äußere Objekt unsrer Gedanken ist (...).” Eine besondere Rolle hat im übrigen innerhalb dieses Zusammenhangs für die damalige Diskussion der Begriff der angeborenen Ideen gespielt. Der Leser wird sich erinnern: ein damit in einer gewissen Hinsicht vergleichbarer Begriff stand bereits im Mittelpunkt von Platons Versuch, zu erklären, wie es dazu kommt, daß Menschen fähig sind, konkrete Gegenstände als Gegenstände einer bestimmten Art – als ein Stück Holz, einen Stein, usw. – identifizieren zu können (s. Bd. I, S. 178). Nur waren es bei Platon natürlich nicht die Ideen, die dem Menschen angeboren sind, sondern die Kenntnisse von den – in der Außenwelt vorgegebenen – Ideen. Für die neuzeitlichen Autoren hingegen hat sich hier etwas gewandelt: es sind die (allgemeinen) Ideen selbst, nebst den Beziehungen zwischen den in diesem Sinne verstandenen Ideen, die in einem gewissen Sinne im Innern des Menschen vorgegeben sind: als Ausdruck des Einflusses Gottes auf das menschliche Innen. Descartes zum Beispiel schreibt am 15. April des Jahres 1630 in einem Brief an seinen langjährigen Gesprächspartner Mersennes: “(...) die mathematischen Wahrheiten (das heißt die tatsächlich zwischen mathematischen Ideen existierenden Beziehungen, A. R.), die Sie ewig genannt haben, sind von Gott eingerichtet worden. (...) Und es gibt keine einzelne unter ihnen, die wir nicht verstehen könnten, wenn unser Geist sich daran macht, sie zu betrachten; auch sind sie alle unserem Geiste eingeboren, so, wie ein König seine Gesetze in die Herzen aller seiner Untertanen einprägen würde, wenn 22 er die Macht dazu hätte.” Rückkehr zu Augustinus? Letztlich ist es also doch, so scheint es, der im Innern der Menschen, bei genügender Vertiefung in das eigene Selbst, sichtbar werdende Gott, und nicht der Mensch, der in der Philosophie der Neuzeit als Garant dafür herangezogen wird, daß die Ideen, die Begriffe, so, wie man sie hier versteht, als nicht-willkürliche Vergleichsobjekte für die Überprüfung der Geltung prädikativer Aussagen verstanden werden dürfen. Letztlich sind es, so muß man nach der Lektüre des soeben Zitierten ja wohl annehmen, theologische Grundannahmen, welche die Wahrheit von Aussagen über Beziehungen zwischen Ideen sichern helfen sollen – so, wie es sich in einer besonders aufschlußreichen Weise noch in der folgenden Bemerkung des renommierten Mathematikers J. H. Lambert aus seiner 1771 erschienenen Anlage zur Architectonic oder Theorie des Einfachen und des Ersten zeigt: 21 “Aussi n’avons nous dans nostre ame les idées de toutes choses, qu’en vertu de l’action continuelle de Dieu sur nous, c’est à dire parce que tout effect exprime sa cause, et qu’ainsi l’essence de nostre ame est une certaine expression ou imitation ou image de l’essence, pensée et volonté divine et de toutes les idées qui y sont comprises. On peut donc dire, que Dieu seul est nostre object immediat hors de nous, (...).” Leibniz, Discours de Métaphysique, § 28. 22 “(...) les verités mathematiques, lesquelles vous nommés eternelles, ont esté establies de Dieu (...). Or il n’y en a aucune en particulier que nous ne puissions comprendre si nostre esprit se parte a la considerer, & elles sont toutes mentibus nostris ingenitae ainsi qu’un Roy imprimeroit ses lois dans le coeur de tous ses sujets, s’il en auoit assy bien le pouuoir.” Descartes, Brief an Mersennes vom 15. 4. 1630 (A.T., Bd. I, S.145). — In einer Stelle der Meditationes de prima philosophia (III.38) spricht Descartes davon, daß dem Menschen die Idee Gottes eingepflanzt worden sei, “damit sie gleichsam das Zeichen sei, mit dem der Künstler sein Werk signiert (ut esset tanquam nota artificis operi suo impressa).” 15 “So z. E. ist die Gedenkbarkeit nichts (...) daferne nicht ein denkendes Wesen existiert, welches das Gedenkbare wirklich denke. Das Reich der logischen Wahrheit wäre ohne die metaphysische Wahrheit (...) ein leerer Traum, und ohne ein existierendes Suppositum intelligens würde es auch nicht einmal ein Traum, sondern vollends gar nichts seyn. Man kann demnach sagen, daß das Reich der logischen Wahrheit eine gedoppelte Basin oder Grund, worauf es beruhen könne, haben müsse. Einmal ein denkendes Wesen, damit sie in der That gedacht werde; und sodann die Sache selbst, die der Gegenstand des Gedenkbaren ist. Ersteres ist der subjective, letztere der objective Grund, wodurch die logische Wahrheit in die metaphysische verwandelt wird. Wenn wir daher von ewigen, unveränderlichen, absolute nothwendigen Wahrheiten reden, und sagen, daß diese Wahrheiten bleiben würden, wenn auch weder Gott, noch Welt, noch nichts wäre; so stoßen wir durch diese letztere Bedingung die erstere Aussage um, weil wir dadurch sowohl den subjectiven, als den objectiven realen Grund solcher Wahrheiten 23 wegnehmen (...).” Wir begegnen hier also allem Anschein nach einer Konzeption wieder, die schon von Augustinus vorgetragen worden war: Gott hat die Ideen erdacht, und damit zugleich die Orientierungshilfen, derer er sich anschließend bei der Erschaffung der Welt bedient hat. Und da ein Teil des menschlichen Innen unmittelbar von Gott stammt, und das, was den Menschen von Gott verliehen worden ist, speziell jene Ideen sind, haben Menschen, indem sie sich im Zuge der Selbstreflexion gleichsam über ihr eigenes Innen beugen, die Möglichkeit, das Wesen der Dinge zu erkennen. Es ist also offensichtlich kein Zufall, daß Leibniz sich mehrfach auf Augustinus beruft, um seine eigene Position zu erläutern. In einer Stelle seiner Nouveaux Essais sur l’Entendement Humain beispielsweise fragt er zunächst rhetorisch: “Wo wären diese Ideen, wenn es keinen Geist gäbe, und was würde alsdann aus der realen Grundlage dieser Gewißheit der ewigen Wahrheiten werden?”, um anschließend fortzufahren: “Dies führt uns endlich zur letzten Grundlage der Wahrheiten, nämlich jenen höchsten und allgemeinen Geist, dessen Dasein notwendig und dessen Verstand in der Tat der Ort der ewigen Wahrheiten ist – wie St. Augustin es erkannt und auf eine sehr lebendige Weise dargestellt 24 hat.” Tatsächlich wird noch Kant – in diesem Punkt ebenfalls ganz auf den Spuren des mehrere Schichten unterscheidenden Seelenbegriffs Augustinus’ – zwischen zwei Arten des Selbstbewußtseins unterscheiden: der “empirischen Apperzeption” auf der einen Seite und der “reinen”, “transzendentalen Apperzeption” auf der anderen. Und der Kern dieser Unterscheidung soll sein: das empirische Selbstbewußtsein zeigt sich dort, wo man sich zum Beispiel vergegenwärtigt, daß man etwas wahrnimmt, etwas empfindet, etwas möchte, usw.; das reine Selbstbewußtsein hingegen zeigt sich, wo man sich die Bestimmung eines Begriffs, beziehungsweise, mit einer für Kant charakteristischen und von uns noch ausführlich zu behandelnden Hinzufügung, die “Möglichkeit” eines so und so bestimmten Begriffs vergegenwärtigt.25 23 J. H. Lambert, Anlage zur Architectonic ..., § 299. Leibniz, Nouveaux Essais, IV.xi.14. 25 Kant, KrV, A 107. Vgl. auch ders., GMS, BA 106f., sowie Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, § 4, Schlußbemerkung (Werke, ed. W. Weischedel, Bd. XII, S. 416f.). — Diesen zwei beziehungsweise drei Arten des Selbstbewußtseins – dem empirischen und den beiden “reinen” – entsprechend unterscheidet Kant auch zwischen drei Ar24 16 Leibnizs rationalistisch verstandener Gott Indes: zwischen Augustinus und den Autoren der Neuzeit liegt doch die Entwicklung der mittelalterlichen Philosophie, liegt, wie wir gesehen haben, die Radikalisierung des Gedankens, Gott sei allmächtig, und der dadurch hervorgerufene spätmittelalterliche Skeptizismus. Wie verträgt sich dies mit einem solchen Versuch, die Position Augustinus’ zu beleben? Nun, der entscheidende Punkt ist hier, daß speziell Leibniz (und vor ihm, in einem gewissen Sinne jedenfalls, auch schon Descartes) den Gottesbegriff mit etwas ausstattet, was bei Augustinus noch kein Gegenstand ausführlicherer Überlegungen gewesen und von Theologen-Philosophen wie Ockham gerade bestritten worden war: entscheidend ist, daß Leibniz den Begriff Gottes gewissermaßen als Begriff einer die Rationalität selbst verkörpernden Instanz konzipiert. Aus der heutigen Perspektive betrachtet nimmt sich dies natürlich geradezu wie ein Paradebeispiel für jene Fälle aus, in denen der Wunsch der Vater einer bestimmten Überzeugung, hier also eines bestimmten Gottesbegriffs, ist. H. Blumenberg schreibt denn auch, am Ende des Mittelalters seien für das Verlangen nach menschlicher “Selbstbehauptung” gegenüber den Ansprüchen einer extremistisch verstandenen Theologie nur noch zwei – faktisch dann auch realisierte – Möglichkeiten geblieben: “der hypothetische Atheismus, der die Frage nach den Möglichkeiten des Menschen unter die Bedingung ihrer Gültigkeit ‘auch wenn es keinen Gott gäbe’ stellt, und der rationale Deismus, der das ‘vollkommene Wesen’ in den Dienst der Garantie jener menschlichen Möglichkeiten selbst nimmt, das von Descartes zum Deduktionsprinzip der Zuverlässigkeit der Welt und ihrer Erkenntnis funktionalisiert wird.”26 Doch schauen wir uns selbst einige der für diesen Motivkomplex wichtigen Passagen aus Leibnizs Schriften, speziell aus seinen Nouveaux Essais sur l’Entendement Humain, an. Bereits in dem Vorwort zu dieser umfangreichen Auseinandersetzung mit Lockes Essay bemerkt Leibniz: was die natürliche Ordnung der Dinge betreffe, so hänge es nicht “von Gottes Willkür ab, den Substanzen diese oder jene Beschaffenheit beliebig zu verleihen, und er wird ihnen stets nur solche verleihen, die ihnen natürlich sind, das heißt, die aus ihrer Natur als erklärliche Modifikationen hergeleitet werden können. So muß man annehmen, daß die Materie (...) nicht von selbst in krummer Linie sich bewegen wird, weil es nicht möglich ist zu begreifen, wie das geschehen sollte, das heißt es auf mechanischem Wege zu erklären, während das, was natürlich ist, sich deutlich muß begreifen lassen können, wenn man in die 27 verborgenen Tiefen der Dinge Zugang erhielte.” ten des Verfahrens, über sich selbst nachzudenken, das heißt zwischen drei Arten der (Selbst-)Reflexion. Dabei bezeichnet er die beiden “reinen” Arten der Reflexion als “logisch” beziehungsweise als “transzendental”. Vgl. dazu KrV, A 262f./B 319f., sowie die Darstellung bei H. Schnädelbach, Reflexion und Diskurs, S. 87-102. 26 H. Blumenberg, Säkularisierung und Selbstbehauptung, S. 211. 27 “il n’est pas arbitraire à Dieu de donner indifferemment aux substances telles ou telles qualités, et il ne leur en donnera jamais que celle qui leur seront naturelles, c’est à dire qui pourront estre derivées de leur nature comme des modifications explicables. Ainsi on peut juger que la matiere (...) n’ira pas d’elle même en ligne courbe, parce qu’il n’est pas possible de concevoir comment cela s’y fait, c’est à dire de l’expliquer mechaniquement, au lieu que ce qui est naturel, doit pouvoir devenir concevable distinctement si l’on estoit admis dans les secrets des choses.” Leibniz, Nouveaux Essais, Vorwort (GP, Bd. V, S. 59, Kursivsetzung im deutschen Text hinzugefügt). 17 Ginge man von einer solchen Voraussetzung nicht aus, so hieße das, “der Philosophie und Vernunft absagen, indem man der Unwissenheit und Trägheit durch ein dunkles System eine Freistätte eröffnete: ein System, das nicht nur Eigenschaften zuläßt, die uns nicht verständlich sind (denn deren gibt es nur allzu viele), sondern auch Eigenschaften, die der größte Geist, selbst wenn Gott alle mögliche Erleuchtung gäbe, nicht zu begreifen 28 vermöchte, das heißt die entweder wunderbar oder ungereimt sein würden.” Und etwas später wird Theophilus, das heißt also: der Sprecher Leibnizs in den Nouveaux Essais, mit einer deutlichen Spitze gegen Ockhams Konzeption des Verhältnisses zwischen primären und sekundären Ursachen bemerken: “Man darf sich nicht einbilden, daß Ideen, wie die der Farbe oder des Schmerzes, willkürlich und ohne Beziehung oder natürliche Verbindung mit ihren Ursachen sind; mit so wenig Ord29 nung und Vernunft zu handeln, ist nicht Gottes Gewohnheit.” Leibnizs Rede von einer “Ausdrucks-Beziehung” Sonderlich zufrieden wird man freilich, zumindest als heutiger Leser, mit solchen Auskünften nicht sein können. Erweckt das Ganze doch allzusehr den Eindruck, als werde hier, um einigen der in Wirklichkeit doch wohl immer nur menschlichen Erzeugnisse den Anschein von Willkür nehmen zu können, lediglich in willkürlicher Weise mit dem Gottesbegriff umgesprungen – nur daß man diese Tatsache vor sich selbst und den Anderen möglichst im Halbdunkel des Unausgesprochenen zu lassen versucht. Und dabei ist dies ja noch nicht einmal das einzige Bedenken, das sich aufdrängt. Denn selbst wenn wir uns, der bloßen Überlegung wegen, mit dieser gesamten Konstruktion eines rationalistischen Gottes, und der Auffassung vom menschlichen Verstand als einer Art Abbild Gottes, einverstanden erklären, scheint so arg viel immer noch nicht gewonnen. Angenommen nämlich, es komme Einer beim Nachdenken über sein eigenes Innen zu einer bestimmten begrifflichen Überzeugung, komme zu dem Glauben, daß dem Begriff sowieso die Beschaffenheit sowieso eigen sei. Und angenommen, ein Anderer komme beim Nachdenken über denselben Begriff zu einer gegenteiligen Auffassung. Bietet das, was wir bisher von der Grundeinstellung neuzeitlicher Autoren in Erfahrung gebracht haben, bereits eine Möglichkeit, Situationen einer solchen Art in einer nicht-willkürlichen Weise zu beenden? — Offensichtlich nicht. 28 “on renonceroit en cela à la philosophie et à la raison, en ouvrant des asyles de l’ignorance et de la paresse, par un systeme sourd qui admet non seulement qu’il y a des qualités que nous n’entendons pas dont il n’y en a que trop, mais aussi qu’il y en a que le plus grand esprit, si Dieu luy donnoit toute l’ouverture possible, ne pourroit point comprendre, c’est à dire qui seroient ou miraculeuses ou sans rime et sans raison (...). Leibniz, Nouveaux Essais, Vorwort (GP, Bd. V, S.59). 29 “Il ne faut point s’imaginer, que ces idées comme de la couleur ou de la douleur soyent arbitraires et sans rapport ou connexion naturelle avec leurs causes: ce n’est pas l’usage de Dieu d’agir avec si peu d’ordre et de raison.” Leibniz, Nouveaux Essais, II.viii.13, vgl. auch ebd., II.xxx.2. — Nach Leibnizs eigener Einschätzung ist es im übrigen der Gegensatz zwischen dem spätmittelalterlichen (zum Beispiel von Ockham propagierten) Gottesbegriff und dem von ihm, Leibniz, vertretenen rationalistischen Gottesbegriff, der seiner berühmten Auseinandersetzung mit Samuel Clarke zugrunde lag. Vgl. dazu die Paragraphen 16f. von Leibnizs drittem Schreiben an Clarke (GP, Bd. VII, S. 366f.) sowie den Paragraphen 107 von Leibnizs fünftem Schreiben (GP, Bd. VII, S. 416). 18 Gewiß, die Zweifel, die Sextus Empiricus, von den antiken Grundannahmen ausgehend, an einer vergleichbaren Stelle heraufbeschworen hatte, sind hier gegenstandslos. Man glaubt ja, daß der Einfluß der Sinnesorgane beim Nachdenken über Ideen, über Begriffe, keine Rolle spielen könne. Aber es bleibt doch das Problem, daß es eines Kriteriums bedürfte, anhand dessen sich feststellen ließe, ob dieser, von dem einen historischen Menschen in der und der Weise aufgefaßte oder gar selbst geschaffene Begriff dem zugehörigen, vom göttlich-menschlichen Verstand geschaffenen Begriff entspricht, ihn “ausdrückt (exprimer)”, wie es bei Leibniz in diesem Zusammenhang häufig heißt. Und von einem solchen Kriterium wissen wir ja bisher noch nichts. Anders, historisch bezogen formuliert: wenn schon der Rückgriff auf Augustinus, dann aber bitte mit einem brauchbaren Vorschlag dafür, wie es sich unter den jetzt angenommenen Voraussetzungen mit dem Wahrheitsbegriff verhalten soll. Denn solange es an einem solchen Vorschlag fehlt, lassen sich Situationen nicht vermeiden, in denen mehrere Sprecher gleichermaßen vorgeben, ihre – miteinander unverträglichen – jeweiligen Positionen ließen sich bei gründlicher Anschauung des menschlichen Innen als berechtigt einsehen. Nun ist Leibniz sich dieses Problems freilich sehr wohl bewußt gewesen. Nicht umsonst betont er, daß man die vom Verstand geschaffenen Ideen, beziehungsweise die Beziehungen zwischen ihnen – die “ewigen Vernunftgesetze (eternelles loix de la raison)”, wie Leibniz sagt – selbstverständlich nicht “in der Seele wie in einem offenen Buche lesen könne”. Man müsse sich vielmehr darum bemühen, sie “mittels aufmerksamer Betrachtung in sich zu entdecken”.30 Doch auch dies hilft ersichtlich, jedenfalls zunächst, nicht weiter. Denn wann darf man sagen, daß man wirklich in diesem Sinne eine “Entdeckung” getan habe, und nicht einem Irrtum erlegen sei? Wann gilt, daß es zu jener “Ausdrucks-Beziehung” kommt, von der Leibniz, wie gesagt, des öfteren spricht? In einem Brief an A. Arnauld vom September 1687 hat Leibniz einmal das, was er mit der Rede von einer Ausdrucks-Beziehung meinte, so charakterisiert: “Eine Sache ‘drückt’ – nach meinem Sprachgebrauch – ‘eine andre aus’, wenn eine beständige und geregelte Beziehung zwischen dem besteht, was sich von der einen und von der andren aussagen 31 läßt. So drückt eine perspektivische Projektion ihr zugehöriges geometrisches Gebilde aus.” Und in der kleinen Schrift “Quid sit Idea” finden sich noch weitere Beispiele für die von Leibniz gemeinte Ausdrucks-Beziehung: das Modell einer Maschine drücke (sc.: im Idealfall) diese Maschine aus; eine Rede drücke Überzeugungen, Ziffern Zahlen, eine algebraische Gleichung einen Kreis oder irgendeine andere Figur aus.32 30 “Il est vray qu’il ne faut point s’imaginer qu’on peut lire dans l’ame ces eternelles loix de la raison a livre ouvert (...); mais c’est assez qu’on les peut decouvrir en nous à force d’attention”. Leibniz, Nouveaux Essais, Vorwort (GP, Bd. V, S. 43). Vgl. auch ebd., I.i.23 (man müsse die eingeborenen Ideen und Wahrheiten “kennen lernen (apprendre))”, sowie III.i.5 (die historisch gegebenen Sprachen des Menschen spiegelten nicht die “natürliche Ordnung der Ideen”, sondern lediglich gewissermaßen “die Geschichte unserer Entdeckungen”). 31 “Une chose exprime une autre (dans mon langage) lorsqu’il y a une rapport constant et reglé entre ce qui se peut dire de l’une et de l’autre. C’est ainsi qu’une projection de perspective exprime son geometral.” Leibniz, GP, Bd. II, S. 112. 32 Leibniz, “Quid sit Idea”, GP, Bd. VII, S. 263. 19 Angewandt auf die Relation zwischen einem von einem historischen Menschen erzeugten Begriff und der vom göttlich-menschlichen Verstand erzeugten Idee bedeutet dies also: es müsse eine “beständige und geregelte Beziehung” zwischen beiden vorliegen, um sagen zu dürfen, erstere drücke letztere aus. Doch was soll dies nun wiederum heißen? Wie soll man das Vorliegen einer solchen Beziehung feststellen können? Leibniz betont in “Quid sit Idea”, daß diese Beziehung sich nicht auf Ähnlichkeiten zu stützen brauche. Und das würde sich mit den Beispielen, die er für diese Beziehung gibt, ja in der Tat auch nicht vereinbaren lassen. Denn in welcher Weise kann man schon sagen, daß eine algebraische Gleichung dem geometrischen Gebilde – einer Kurve beispielsweise –, das sie “ausdrückt”, ähnelt? Aber damit ist unsere Frage natürlich noch nicht beantwortet. Auch das algebraische Beispiel hilft letztlich nicht viel weiter. Denn daß eine algebraische Gleichung eine bestimmte gezeichnete Kurve “ausdrückt”, das läßt sich ermitteln, indem man diese Kurve in ein Koordinatensystem einfügt, und prüft, ob die einzelnen möglichen Werte der Gleichung den Werten, welche die Kurve in jenem System erfüllt, entsprechen. Wie aber soll ein analoges Vorgehen im Fall der uns interessierenden Beziehung aussehen? Ein neuer Wahrheitsbegriff Gibt es für dieses Problem innerhalb von Leibnizs Werk aber überhaupt eine Lösung? — Doch, die gibt es. Und sie ist sogar für das Verständnis von Leibnizs gesamtem Werk, und damit zugleich für das Verständnis des Werks eines paradigmatisch neuzeitlichen Autors, zentral. Wieder ist ein Satz aus “Quid sit Idea” hilfreich, um dem, worauf Leibniz hinausmöchte, näher zu kommen. Was all jenen “Ausdrücken” für etwas, die er zuvor der Veranschaulichung wegen aufgezählt hatte, gemeinsam sei, das, so Leibniz, liege in Folgendem: es liege darin, “daß wir aus der bloßen Betrachtung der Züge des ausdrückenden Gegenstands zur Erkenntnis 33 der Eigenschaften des entsprechenden auszudrückenden Gegenstands gelangen können.” Lassen wir einmal beiseite, was dies im Hinblick auf alle jene Fälle besagt, in denen Ausdrucksrelationen zwischen Gegenständen betroffen sind, welche nicht aus Ideen beziehungsweise Begriffen bestehen. Was die uns interessierende Beziehung angeht, so kann mit jener Formulierung nur dies gemeint sein: Die Rede von einer Ausdrucks-Beziehung suggeriert zwar, daß man die “Wahrheit” eines von einem historischen Menschen geschaffenen Begriffs durch einen Vergleich zwischen diesem Begriff und einer vom göttlich-menschlichen Verstand geschaffenen Idee zu überprüfen hätte. Aber in Wirklichkeit ist dies nicht gemeint. In Wirklichkeit verhält es sich vielmehr so: Daß ein von einem historischen Menschen hervorgebrachter Begriff eine von dem göttlich33 “et quod expressionibus istis commune est, ex sola contemplatione habitudinum exprimentis possumus venire in cognitionem proprietatum respondentium rei exprimendae.” Leibniz, “Quid sit Idea”, GP, Bd. VII, S. 263f. 20 menschlichen Verstand geschaffene Idee “ausdrückt”, ist im wesentlichen eine Eigenschaft des Begriffs allein. Diese Eigenschaft mag man dann zwar in einem anschließenden, zusätzlichen Schritt mit den Worten umschreiben, daß besagte Ausdrucksrelation vorliege. Aber das ist dann im Grunde genommen gar nicht mehr entscheidend (und kann, wie man als heutiger Leser versucht sein möchte hinzuzufügen, auch unterbleiben). Doch werden die Dinge jetzt nicht noch rätselhafter? Was für eine sonderbare Eigenschaft soll dies sein, die, in diesem Sinne, einen “wahren” Begriff von einem “falschen” zu unterscheiden erlaubt? Wie hat man es zu verstehen, wenn Leibniz schreibt, die Wahrheit gründe sich “stets auf der Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung der Ideen”34, wenn er in einem Brief an Des Bosses vom 16. Juni 1712 bemerkt, zur Feststellung der Wahrheit sei es “nicht erforderlich, etwas außerhalb der Seelen der Menschen heranzuziehen”35? Nun, im Grunde ist die Sache so schwierig nicht. Man muß sich lediglich noch einmal vergegenwärtigen, daß Begriffe im neuzeitlichen Sinne etwas frei Geschaffenes sind, im Gegensatz zur Prolepsis oder zur Vorstellung (phantasia) der Epikuräer und Stoiker, ganz zu schweigen von den Ideen im Sinne Platons. Denn wenn dies gilt, bietet es sich da nicht an, den Unterschied zwischen einem “wahren” und einem “falschen” Begriff so zu fassen, daß man sagt: ein Begriff ist dann wahr, wenn er sich in einer einwandfreien Weise erzeugen läßt, und dann falsch, wenn dies nicht zutrifft? Genau dies jedenfalls ist die systematische Pointe, auf die Leibnizs Ausführungen, ebenso wie die der anderen für unseren gegenwärtigen Zusammenhang interessanten neuzeitlichen Autoren hinauslaufen. Der Leser erkennt vermutlich bereits, wie sehr sich dies von dem antiken Verständnis des Wahrheitsbegriffs unterscheidet. Denken wir nur an das stoische Konzept der Wahrheit einer Vorstellung: eine Vorstellung ist, so hatte es geheißen, wahr, wenn sie “durch einen existierenden Gegenstand hervorgerufen und im Subjekt in Übereinstimmung mit der Beschaffenheit jenes Gegenstands eingeprägt und gespeichert worden ist” (s.o., Bd. I, S. 225). Davon kann jetzt, jedenfalls was die Begriffe angeht, nicht mehr die Rede sein. Und wie sollte es auch? Die These von der autonomen Erzeugung von Begriffen schließt aus, daß die Wahrheit eines Begriffs an die gelingende Abbildung eines in den Dingen liegenden “Gemeinsamen”, eines in ihnen liegenden Musters oder dergleichen, gebunden wird. Und der Versuch, die Wahrheit eines Begriffs davon abhängig zu machen, ob der betreffende Begriff eine Art Kopie einer vom göttlich-menschlichen Verstand geschaffenen Idee ist, scheitert daran, daß man nicht unmittelbar wissen kann, wann man einer solchen Idee habhaft geworden ist. Statt dessen bietet sich eine andere Möglichkeit, bietet es sich an, die von den historischen Menschen gebildeten Begriffe daran zu messen, ob sie das Produkt eines regelgerechten Herstel34 “je dis qu’il est bien vray que la verité est tousjours fondée dans la convenance ou disconvenance des idées”: Leibniz, Nouveaux Essais, IV.i.2. 35 “Verum est, consentire debere, quae fiunt in anima, cum iis quae extra animam geruntur; sed ad hoc sufficit, ut quae geruntur in una anima respondeant turn inter se, turn iis quae geruntur in quavis alia anima; nec opus est poni aliquid extra omnes Animas vel Monades”. Leibniz, Brief an Des Bosses vom 16. Juni 1712 (GP, Bd. H, S. 451). 21 lungsprozesses sind oder nicht. Das, womit wir es hier zu tun haben, ist also ein neuer Wahrheitsbegriff. Auf eine knappe Formel gebracht, gilt: für die antiken Autoren war die Wahrheit einer Meinung über eine Idee, beziehungsweise die Wahrheit einer Vorstellung, äquivalent mit einer bestimmten Eigenschaft der Beziehung zwischen jener Meinung (Vorstellung) und deren Gegenstand. Für die neuzeitlichen Autoren hingegen gilt: die Wahrheit eines Begriffs ist äquivalent mit einer bestimmten Eigenschaft des Verfahrens zur Erzeugung dieses Begriffs. “Die Grundsätze der Modalität”, so wird Kant diese Auffassung in einer zentralen Stelle der Kritik der reinen Vernunft auf den Punkt zu bringen versuchen, “sagen von einem Begriffe nichts anders, als die Handlung des Erkenntnisvermögens, dadurch er erzeugt wird.”36 Noch eine Umschreibung für den neuzeitlichen Begriff des Begriffs Einen kleinen Schritt noch, und wir sind dort, wo wir für den Augenblick hin wollen (später werden wir uns ausführlicher mit dem neuen Wahrheitsbegriff befassen). Ein Punkt nämlich muß, zumindest ansatzweise, noch geklärt werden: die Frage, wann ein Begriff der neuzeitlichen Auffassung zufolge als ein einwandfrei erzeugbarer Begriff gilt. Die Antwort auf diese Frage lautet, pauschal gesprochen (ich habe sie durch eine meiner vorigen Formulierungen bereits vorweggenommen): diese Bedingung ist dann erfüllt, wenn das Verfahren, das man zur Bildung des betreffenden Begriffs heranziehen kann, regelgerecht ist, das heißt also: wenn es den generellen Regeln für die Bildung von Begriffen entspricht. “Den” Regeln? Welche Regeln sind denn da gemeint? — Zunächst einmal, jedenfalls bei Leibniz, die formalen logischen Regeln, das heißt die Regeln, die sich unter anderem im Gebrauch der sogenannten logischen Partikel – Wörtern wie “und”, “oder”, “wenn ... dann” und “nicht” – zeigen. (Wobei Leibniz freilich, wie wir sehen werden, auch noch andere Regeln im Auge hat, und für Kant zum Beispiel sogar ein ganzes Bündel von nicht-formallogischen Regeln eine besonders große Bedeutung besitzt37) Aber ist denn diese Auskunft (selbst wenn man sich einmal auf den Fall der formallogischen Regeln beschränkt) hinreichend? Ist es denn nicht so, daß es mehrere Systeme formallogischer Re36 Kant, KrV, B 287/ A 234. Was Locke betrifft, so unterscheidet er im Essay (II.xii.1) zwischen drei Arten von nach solchen Regeln ablaufenden begriffserzeugenden Aktivitäten, von “Operationen des Geistes (operations of the mind)”, wie er sie nennt: jenen, die mit Hilfe der Konjunktion komplexe(re) Begriffe entstehen lassen (wie in dem Fall, in dem man den Begriff des Junggesellen aus der additiven Verknüpfung der Begriffe des Männlichen, Erwachsenen und Unverheirateten gewinnt); jenen Aktivitäten, die zu relationalen Begriffen (wie zum Beispiel zum Begriff des aus etwas gebürtig Seins, dem Begriff des mit jemandem verwandt Seins, usw.), führen; und jenen, die, unter Gebrauch der Negation, den Prozeß des Übergangs von Einzelideen zu allgemeinen Ideen bewerkstelligen sollen, ein Prozeß, für den Locke das Wort “Abstraktion” benutzt. Von diesen drei Arten von logischen Operationen werfen freilich zumindest die beiden zuletzt genannten Schwierigkeiten auf, die Locke nicht mehr bewältigt hat. Den Übergang zu relationalen Begriffen hat er denn auch an keiner Stelle seines Werks weiter erörtert. Auf die Probleme seines Abstraktionsbegriffs gehe ich weiter unten (S. 84–89) noch ausführlicher ein. 37 22 geln gibt; eines beispielsweise, das sogenannte “klassische”, innerhalb dessen der Satz vom ausgeschlossenen Dritten gilt, ein anderes (das sogenannte “intuitionistische”), für das jener Satz nicht, oder jedenfalls nicht ohne weiteres, gilt, usw.? — Nun, das ist, vom Standpunkt des heutigen Lesers aus gesehen, eine zwar berechtigte, gleichwohl aber anachronistische Frage. Denn für die Autoren des 17. und 18. Jahrhunderts gibt es nur eine einzige Logik.38 Und das ist nicht etwa ein historisch-zufälliger Umstand. Sondern es ist zugleich die entscheidende Voraussetzung dafür, daß die neuzeitlichen Autoren glauben konnten, sich des unter ihren Grundannahmen in einer neuen Variante auftretenden Protagoras-Problems erwehren zu können (jedenfalls, soweit es die Wahrheit oder Falschheit von Begriffen angeht). Denn diese Autoren sind davon überzeugt, daß die einzelnen Begriffe zwar etwas vom Menschen frei Erzeugtes sind. Aber das impliziert für sie deswegen nicht notwendigerweise, daß Begriffe prinzipiell willkürlich sind, weil sie unterstellen, daß die Regeln für die Hervorbringung von Begriffen keineswegs etwas sind, was die Menschen machen – weil sie unterstellen, daß diese Regeln den Menschen vorgegeben sind und von ihnen auch in einer definitive Gewißheit verbürgenden Weise erkannt werden können. Es ist durchaus typisch für die damalige Sicht der Dinge, wenn Kant von der formalen Logik schreibt, für sie gelte, “daß sich alle ihre einfache Handlungen völlig und systematisch aufzählen lassen”39, daß sie – wie die angebliche Konstanz der Logik seit Aristoteles belege – “allen Ansehen nach geschlossen und vollendet zu sein scheint.”40 Das Konzept, von dem man in den begriffstheoretischen Schriften dieser Zeit ausgeht, ist mithin in etwa dieses: da gibt es zunächst einmal den menschlichen Verstand, die Vernunft, die Seele, usw. Diese Gemütskräfte kann man, so wie zum Beispiel Leibniz es tut, als Statthalter Gottes im Menschen verstehen. Doch muß man dies im Grunde nicht (andere Autoren, Hume etwa, halten sich denn auch mit solchen theologischen Spekulationen merklich zurück). Entscheidend ist allein, daß man den überpersönlichen menschlichen Verstand als eine im Prinzip in allen Menschen wohnende Instanz interpretiert, die im Besitz “der” Regeln zur Erzeugung von Begriffen ist. Abgesehen vom Verstand gibt es dann noch die einzelnen historischen Menschen. Auch diese sind fähig, Begriffe zu erzeugen. Im Gegensatz zum Verstand sind die einzelnen Menschen bei derartigen Tätigkeiten jedoch fehlbar. Das heißt, sie wissen zwar “irgendwie” schon von “den” Regeln zur Erzeugung von Begriffen. Aber mangelnde Schulung, Nachlässigkeit, Trägheit oder auch andere Ursachen bringen sie gelegentlich dazu, jene Regeln zu mißachten. Und dann kommt 38 Zu Recht schreibt daher bereits I. Pape, im Hinblick auf Leibniz: “Es gibt also nicht – und damit kommen wir auf ein heutiges Mißverständnis zu sprechen – es gibt nicht beliebige mögliche mathematische Axiomensysteme, die neben dem einen realisierten, d. h. in der Existenz konkretisierten, im göttlichen Verstand ‘bestehen’, – nicht beliebig ausdenkbare Raumstrukturen, die neben der einen euklidischen, den Anschauungsraum beherrschenden, ein ideales ‘Sein’ als Möglichkeit besäßen. Und es ist auch nach Leibniz nicht – wie ihm irrtümlicherweise von der heutigen Logistik unterstellt wird – eine sinnvolle Aufgabe der Philosophie als Wissenschaft, solche ‘possibilitates’ variierend und kombinierend zu entwerfen. Was die Logik, Mathematik und Metaphysik betrifft, so ist der Bestand ihrer Grundwahrheiten eine absolut unumstößliche Struktur jeder möglichen Welt, eine Struktur, die darum keine Abweichung duldet, weil sie identisch ist mit dem göttlichen Verstand selbst.” (I. Pape, Tradition und Transformation der Modalität, S. 130). 39 Kant, KrV, A XIV. 40 Kant, KrV, B VIII. 23 es zur Bildung von falschen Begriffen – was man feststellen kann, indem man den Prozeß der Erzeugung eines solchen Begriffs unter peinlich genauer Beachtung “der” jeweils relevanten Regeln nochmals durchzuführen versucht. Wobei man ein solches Unterfangen auch damit umschreiben kann, daß man sagt: man bringe die Aktivitäten der Menschen vor den “Gerichtshof” des Verstands (oder der “Vernunft”, usw.). Wir sehen also: neben der oben (S. 11) vorgetragenen Umschreibung (I) für den im neuzeitlichen Sinne verstandenen Begriff des Begriffs bedarf es eigentlich noch einer zweiten – einer Umschreibung, die diesmal nicht auf die Tätigkeiten des überpersönlichen menschlichen Verstands, sondern auf die Tätigkeiten einzelner historischer Menschen bezogen ist, und sich so formulieren läßt: (II) Das Wort “Begriff’, beziehungsweise das eine oder andere der damit äquivalent verwendeten Wörter, steht innerhalb der Philosophie der Neuzeit dann, wenn es nicht im Sinne der oben (S. 11) wiedergegebenen Formulierung (I) zu verstehen ist, für ein von einzelnen historischen Menschen nach gegebenen Regeln zu erzeugendes, im Inneren des Menschen unmittelbar zugängliches psychisches Phänomen, welches die Menschen dazu befähigen soll, die Geltung prädikativer Aussagen überprüfen zu können. Sind Begriffe unvergänglich? Einer derjenigen neuzeitlichen Autoren, die unsere Unterscheidung zwischen Begriffen im auf S. 11 erläuterten Sinne (I) und Begriffen im soeben erläuterten Sinne (II) ausdrücklich vortragen, ist Leibniz. Er benutzt diese Unterscheidung überdies dazu, um einen Vorschlag für die terminologische Differenzierung zwischen “Idee” und “Begriff’ zu gewinnen. Im Discours de Métaphysique schreibt er: “So könnte man die Ausdrücke, die in unserer Seele sind – mag man sie nun bewußt erfassen oder nicht –, Ideen nennen, hingegen kann man diejenigen, die man erfaßt oder bildet, Begriffe 41 nennen. ” Allerdings muß man sagen, daß Leibniz sich nicht immer an diesen seinen eigenen Vorschlag gehalten hat.42 41 “Ainsi ces expressions qui sont dans nostre ame, soit qu’on les conçoive ou non, peuvent estre appellées idées, mais celles qu’on conçoit ou forme se peuvent dire notions, conceptus.” Leibniz, Discours de Métaphysique, § 27. 42 Des öfteren verwendet Leibniz das Wort “idée” in einem weiteren Sinne, und gelegentlich verfährt er auch sogar beim Gebrauch des Ausdrucks “notion” in dieser Weise. In einer Stelle der Nouveaux Essais zum Beispiel heißt es, ein Satz wie “Jeder Mensch hat einen Begriff von Gott” sei doppeldeutig. Werde “Begriff’ im Sinne von “Idee” (“Begriff I” nach unserer Terminologie, “Idee” nach dem Vorschlag Leibnizs aus dem Discours) verstanden, “so ist das ein Vernunftsatz (...). Denn nach meiner Ansicht ist die Idee von Gott allen Menschen eingeboren.” Werde “Begriff’ hingegen im Sinne einer Idee verstanden, “welche im wirklichen Denken tatsächlich vorkommt” (“Begriff II”, beziehungsweise “Begriff” im Sinne des Discours-Vorschlags), “so ist es ein faktischer Satz, der von der Geschichte des Menschengeschlechts abhängt.” (“Pour ce qui est de cette proposition, que tout homme a une notion de Dieu, elle est de la Raison, quand Notion signifie idée. Car l’idée de Dieu selon moy est inée dans tous les hommes: mais si cette Notion signifie une idée où l’on pense actuellement, c’est une proposition de fait, qui depend de I’Histoire du Genre Humain.”) Leibniz, Nouveaux Essais, IV.viii.5. 24 Doch ganz unabhängig davon, ob jene Unterscheidung von einem neuzeitlichen Autor so ausdrücklich formuliert wird oder nicht: bei der Lektüre der Schriften jener Zeit ist es immer wieder hilfreich, sich im Falle einer Interpretationsschwierigkeit zu fragen, ob diese Schwierigkeit sich nicht auflösen läßt, wenn man jene Unterscheidung in Rechnung stellt. Ein Beispiel dafür kennen wir bereits. Es hängt mit Formulierungen zusammen, die uns weiter oben (S. 12f.) bei der Betrachtung einer Passage aus der fünften Meditation Descartes’ aufgefallen waren: jenen Formulierungen nämlich, in denen davon gesprochen wird, daß ein Dreieck (so, wie andere Gegenstände auch) eine “Natur oder Wesenheit oder Form” habe, die “unveränderlich und ewig ist”. Descartes ist nicht der einzige, der sich so ausdrückt. Auch bei Locke findet sich derartiges. Die “abstrakten Ideen”, so behauptet er an einer Stelle des Essay, “sind alle unerzeugbar und unvergänglich”.43 Und Leibniz stimmt dieser Bemerkung an der entsprechenden Stelle seiner Nouveaux Essais sogleich zu.44 Es ist klar, auf den ersten Blick scheint dies unverständlich. Denn schließlich haben alle diese Autoren mehrfach herausgestellt, daß Begriffe für sie etwas sind, was Menschen eigenständig zu erzeugen vermögen. Aber diese Schwierigkeit klärt sich auf, sobald man sich bewußt macht, daß hier offensichtlich an Begriffe im Sinne unserer Umschreibung (I) gedacht ist. Zwar gilt auch dann noch, daß Begriffe etwas sind, was erzeugt werden kann. Nur ist es hier eben der Verstand, der dies tut. Und dessen Aktivitäten darf man ja nicht mit den historischen Aktivitäten der einzelnen Menschen verwechseln. Schließlich agiert der Verstand gewissermaßen in einem außerweltlichen, und damit auch außerzeitlichen, Raum (oder wie immer man sich hier ausdrücken möchte). Und um diesen Sachverhalt zu betonen, verwenden Descartes, Locke und Leibniz eben jene, auf den ersten Blick so wenig zu ihren restlichen Ausführungen passenden Formulierungen. 1.2 BEGRIFFE UND DIE KOGNITIVEN PSYCHISCHEN MITTEL DES MENSCHEN Psychische Aktivitäten nicht mehr medial, sondern sachlich bedeutsam Wir haben uns bereits weiter oben (Bd. I, S.252f.) klar gemacht, daß Platons Begriff der Idee sich durch die vom Mittel- und Neuplatonismus vollzogene theologisch zu verstehende Mentalisierung der Ideen in einem ganz bestimmten Sinne strukturell wandelt. Für Platon galt, daß die kognitiven psychischen Mittel weder des die Welt erschaffenden Demiurgen noch die der Menschen in die Definition dessen eingehen, was eine Idee ist. Es handelt sich bei ihnen um “Medien” des Zugangs zu Ideen; eine sachliche Bedeutung haben sie für die Ideen nicht. Die mittel- und neuplatonischen Autoren hingegen – Philon von Alexandrien, Plotin, Attikos, Calcidius, usw., – weichen in genau diesem Punkt von Platon ab. Das, was für Platon eines der Mittel des Zugangs zu den Ideen war, rückt in den Schriften dieser Philosophen in die Defini43 44 “abstract ideas, with names to them (...), are all ingenerable and incorruptible.” Locke, Essay, III.iii.19. Leibniz, Nouveaux Essais, III.iii.19. 25 tion dessen, was man von jetzt an “Idee” nennt, und erhält dadurch für den Begriff der Idee eine nicht mehr allein mediale sondern auch sachliche Bedeutung. Die Philosophie der Neuzeit, so hat sich uns in den letzten Kapiteln gezeigt, geht den damit eingeschlagenen Pfad noch weiter. Während der Mittel- und Neuplatonismus sich im Zuge seiner kosmogonischen Spekulationen darauf beschränkt hatte, die Ideen als Erzeugnisse der mentalen Anstrengungen Gottes zu konzipieren, wandelt sich diese Überzeugung jetzt so, daß die Ideen als Produkte der Aktivitäten des menschlichen Verstands, oder auch gar der mentalen Aktivitäten einzelner historischer Menschen verstanden werden. Besonders aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang, daß man mit jenen psychischen Aktivitäten zunächst Gottes und dann des Menschen etwas meint, mit dem Bezugspunkte für die Überprüfung der Geltung prädikativer Aussagen bis zu einem gewissen Grade frei geschaffen und nicht etwa durch einen Akt der Reproduktion lediglich psychisch abgebildet werden. Denn wenn man vom Abbilden spricht, schließt man ja ein, daß es etwas gibt, was abgebildet wird, und was sich durch den Akt. des Abbildens nicht wesentlich verändert. Wollte man die psychischen Aktivitäten, die in die Definition des neuen Begriffs der Idee hineingenommen werden, auf diese Weise interpretieren, wäre also gar nichts sonderlich Neues gewonnen. Vor allem besäße man dann nichts mehr, um den skeptischen Implikationen von Sextus Empiricus’ Reflexivierung der Erkenntniskritik entgehen zu können. Wir wissen ja: wenn der Begriff der Idee einerseits als der Begriff eines Gegenstands interpretiert wird, der im Prinzip unabhängig vom menschlichen Bemühen, ihn abzubilden, gegeben ist; und wenn man andererseits davon überzeugt ist, daß Menschen nur durch den abbildenden Gebrauch ihrer Sinnesorgane beziehungsweise ihres Verstands – unter Gebrauch gewisser psychischer Medien also – einen Erkenntnisse ermöglichenden Zugang zu den Ideen gewinnen: dann sind skeptische Folgerungen gar nicht mehr zu umgehen. Eine grundsätzlich andere Sachlage ergibt sich hingegen dann, wenn man den Begriff der Idee als den Begriff eines Gegenstands konzipiert, den es nur als ein Produkt gewisser schöpferischer psychischer Anstrengungen Gottes oder der Menschen geben kann. Denn unter dieser Voraussetzung stellt der Begriff der Idee schließlich nichts mehr dar, was unabhängig von den Tätigkeiten Gottes beziehungsweise der Menschen gegeben ist. Er stellt vielmehr einen bestimmten Aspekt, ein bestimmtes Teilmoment des umfassenderen Begriffs einer gewissen psychischen Aktivität dar. Und wenn man überdies von der Überzeugung ausgehen darf, daß es für Menschen zu psychischen Phänomenen einen medial ungebrochenen Zugang geben kann – wozu man, wie gezeigt, nach neuzeitlicher Überzeugung dann berechtigt ist, wenn es sich um die eigenen psychischen Phänomene handelt –, dann lösen sich die von Sextus aufgedeckten Aporien zumindest in den uns hier interessierenden Fällen auf. (Der Leser möge allerdings nicht aus den Augen verlieren, daß wir immer nur von allgemeinen Ideen gesprochen haben. Wie es sich mit den Einzel-Ideen verhält, das heißt mit Bewußtseins26 phänomenen wie denen, daß ein bestimmtes einzelnes Subjekt in einer bestimmten Situation etwas wahrnimmt, empfindet, will, usw., das haben wir hier nicht erörtert. Tatsächlich wird man innerhalb der neuzeitlichen Philosophie – bis hin zu F. Brentanos Konzept der “Intentionalität” psychischer Gebilde – lange damit zu tun haben, auch im Hinblick auf derartiges die Klippen abbildtheoretischer Ansätze zu umschiffen.45 Francis Bacons Vergleich des menschlichen Bewußtseins mit einem Spiegel, der die konkreten äußeren Gegenstände verzerrt abbildet46, wird für die neuzeitliche Philosophie noch eine geraume Zeit bedeutsam bleiben.) Eine spezielle Art von Strukturwandel Bleiben wir noch einen Augenblick bei dem strukturellen Unterschied zwischen der antiken und der neuzeitlichen Philosophie, und versuchen wir, uns etwas genauer darüber klar zu werden, was für eine Art von Strukturwandel es eigentlich ist, der sich mit der Transformation von Platons Begriff der Idee in den neuzeitlichen Begriff des Begriffs vollzogen hat. Stellen wir uns der Veranschaulichung halber vor, wir nähmen Platons Begriff der Idee; nähmen außerdem den Begriff eines Subjekts, welches eine Einsicht über eine Idee im Sinne Platons gewonnen hat, wobei wir dies so verstehen wollen, als sei die betreffende Idee psychisch abgebildet worden; und würden nun auf dieser Basis einen neuen Begriff einführen, einen Begriff, den wir als den der “S-Idee” bezeichnen: “Eine S-Idee liegt dann, und nur dann, vor, wenn eine Idee im Sinne Platons von einem Subjekt erkannt, das heißt psychisch abgebildet worden ist.” Hätten wir damit einen gegenüber Platons Begriff der Idee strukturell neuen Begriff gewonnen? — In einem gewissen Sinne schon. Unser Begriff der S-Idee enthält ja eine Komponente mehr als Platons Begriff der Idee. Aber natürlich ist das nicht die Art von Strukturwandel, die uns im Augenblick interessiert. Denn in jener Definition haben wir es nur mit einer additiven Verknüpfung von Begriffen zu tun, das heißt mit einer Kombination von Begriffen, durch die deren Grundmerkmale sich nicht verändern. Hier die Idee; dort, als die Idee nicht tangierende Zutat, das Abbilden der Idee; und das Agglomerat dieser beiden Begriffe macht den Begriff der S-Idee aus. Platon war daher ja auch völlig im Recht, als er im Parmenides darauf hinwies, daß mit der Rede vom “noema”, dem Gedanken an eine Idee, die systematischen Probleme der Ideenlehre nicht behoben werden. Denn dieses Konzept (ähnlich wie der spätere epikuräisch-stoische Begriff der 45 Vgl. dazu, was das 17. Jahrhundert betrifft, R. McRae, “‘Idea’ as a philosophical term in the seventeenth century”. “(...) alle Wahrnehmungen, sowohl sinnliche als geistige, sind der Beschaffenheit des Beobachters, nicht dem Weltall analog; und der menschliche Verstand gleicht einem unebnen Spiegel zur Auffassung der Gegenstände, welcher ihrem Wesen das seinige beimischt und so jedes verdreht und verfälscht (... omnes perceptiones tarn sensus quam mentis sunt ex analogia hominis, non ex analogia universi. Estque intellectus humanus instar speculi inaequalis ad radios rerum, qni suam naturam naturae rerum immiseet, eamque distorquet et inficit.)” F. Bacon, Novum Organon Scientiarum, § 41. — Man beachte, wie weit Bacon mit solchen Äußerungen vom Reflexionsniveau Sextus Empiricus’ entfernt ist! 46 27 Prolepsis) kommt auf eine Weise zustande, wie ich es soeben für unseren Begriff der S-Idee vorgeführt habe, und dabei bleibt der ursprüngliche Begriff der Idee, samt aller für ihn charakteristischen Aporien, eben erhalten. Ganz anders also der Strukturwandel, der zum neuzeitlichen Begriff der allgemeinen beziehungsweise abstrakten Idee führt. Zwar wäre es selbstverständlich falsch, zu behaupten, daß es zwischen Platons Begriff der Idee und diesem neuen Konzept gar keine verwandtschaftlichen Beziehungen gäbe. In einem gewissen Sinne kann man durchaus sagen, die neuzeitlich verstandene allgemeine Idee sei in etwa die vom menschlichen Verstand geschaffene “abstrakte Gestalt”, die als “paradeigma” einsetzbare Idee Platons. Wenn Locke beispielsweise davon spricht, daß die vom Menschen geschaffene abstrakte Idee der Tapferkeit – die nach ihrer Erzeugung als “Standard zur Beurteilung und Benennung von Handlungen (standard to measure and denominate actions)” benutzt werde – die Rolle eines “Musters (pattern)” spiele, so ist dies natürlich alles andere als ein wortgeschichtlicher Zufall.47 Nur ist eben bei solchen Formulierungen, auf der anderen Seite, auch Vorsicht geboten. Sie helfen, sich vor Augen zu führen, daß es zwischen der antiken und neuzeitlichen Philosophie keine Kluft, sondern zahlreiche, durch kleine Zwischenstufen vermittelte Übergänge gibt. Aber man muß, wenn man so redet, im Auge behalten, daß dies nur annäherungsweise korrekte Darstellungen des tatsächlichen Sachverhalts sind. Denn genauer besehen verändert sich Platons Begriff der Idee dadurch, daß er in den neuzeitlichen Begriff des Begriffs eingebunden wird. Schließlich ist es ein alles andere als nebenrangiger Punkt, wenn die Ideen nunmehr (von speziellen Kontexten, wie den auf S. 25f. erwähnten, einmal abgesehen) als etwas gelten, was sich erzeugen läßt. Man erkennt dies unter anderem daran, daß die Ideen unter dieser Voraussetzung eigentlich, selbst wenn sie als “abstrakt” oder “allgemein” bezeichnet werden, Konkreta und nicht mehr Abstrakta sein müßten. Denn schließlich läßt sich nur von Konkreta sagen, daß sie entstehen und vergehen oder gar gemacht werden können. Und in der Tat heißt es denn auch bei Locke, aus seinen Darlegungen im Essay ergebe sich “deutlich, daß das Allgemeine und das Universale nicht zur realen Existenz von Dingen gehören (...). Universalität kommt nicht den Dingen selbst zu; denn die Dinge sind in ihrer Existenz sämtlich einzeln; selbst diejenigen Wörter und Ideen sind es, die ihrer Bedeutung nach allge48 mein sind.” Von einer bloß additiven Zusammenstellung invariant bleibender Begriffe zur Erzeugung eines neuen Begriffs kann also beim Übergang von Platons Begriff der Idee zum neuzeitlichen Begriff des Begriffs nicht die Rede sein. Wir haben es hier vielmehr mit einem Prozeß zu tun, im Laufe dessen ein zunächst selbständig auftretender Begriff – Platons Begriff der Idee – sich in einen 47 Locke, Essay, II.xxxi.3 – Locke grenzt diese Art von “patterns” in demselben Paragraphen ab von den “realen Archetypen oder gegebenen Mustern, die sich irgendwo aufhalten (real archetypes, or standing patterns, existing anywhere ).” 48 “it is plain, by what has been said, that general and universal belong not to the real existence of things (...); universality belongs not to things themselves, which are all of them particular in their existence, even those words and ideas which in their signification are general.” Locke, Essay, III.iii.11. 28 Teilbegriff eines umfassenderen Begriffs – des neuzeitlichen Begriffs des Begriffs – wandelt, und dabei in erheblichem Maße transformiert wird.49 1.3 BEGRIFFE UND DIE SPRACHLICHEN MITTEL DES MENSCHEN Allgemeine Ideen, Begriffe im neuzeitlichen Sinne dieses Worts sind etwas Psychisches – hier hat sich also, vergleicht man dies mit dem antiken Begriff der Idee, eine ganz neue Auffassung vom Verhältnis zwischen Ideen und den psychischen Mitteln des Menschen herausgebildet. Das legt die Frage nahe, wie es den Autoren des 17. und 18. Jahrhunderts zufolge mit dem zweiten Medium bestellt ist, welches bereits der antiken Überzeugung nach für die Darstellung und Untersuchung von Ideen wichtig ist: den sprachlichen Mitteln des Menschen. Sind Begriffe womöglich nicht nur etwas Psychisches, sondern auch etwas Sprachliches? Um diese Frage beantworten zu können, muß man sich zunächst in Erinnerung rufen, daß es in der Philosophie des Mittelalters üblich war, zwischen zwei Arten von “Sprachen” zu unterscheiden: der Sprache im normalen Sinne dieses Worts, und der “inneren”, “mentalen” Sprache. Einem Beispiel für eine solche Auffassung sind wir oben (Bd. I, S. 269) bei der Lektüre einer Passage aus Ockhams Summa logicae begegnet. Für die christlichen Philosophen des Mittelalters bot sich diese Unterscheidung aus systematischen, aber auch aus theologischen Gründen an. Was den systematischen Grund angeht, so kennen wir ihn bereits – er ergab sich aus dem Versuch, die Eines-Viele-Beziehung unter Vergleich mit der Situation aufzuhellen, die beim Gebrauch sprachlicher Mittel, speziell genereller Ausdrücke (der öffentlichen Sprache) vorliegt. Und der theologische Grund nun hängt damit zusammen, daß jene Unterscheidung es zu ermöglichen schien, ein zentrales Motiv der Schöpfungslehre aufzunehmen: den Glauben nämlich, daß Gott den Menschen die von ihm ersonnenen Ideen dadurch eingeprägt habe, daß er zu ihnen gesprochen hat, und daß die Wörter, die er dabei benutzte, dem Menschen im Herzen geblieben sind.50 Die folgende, von den mittelalterlichen Autoren häufig zitierte Passage aus Augustinus’ De Trinitate mag zur weiteren Veranschaulichung jener Unterscheidung zwischen der inneren “Sprache des Herzens” und der äußeren, im normalen Sinne dieses Wortes gemeinten Sprache dienen: “Wenn wir sagen, was wahr ist – das heißt sagen, was wir wissen – läßt das Wissen, das wir in der Erinnerung bewahren, notwendig ein Wort entstehen, welches von derselben Art ist wie das Wissen, aus dem es entstanden ist. Denn der Gedanke, der von dem geformt ist, was wir wissen, ist ein im Herzen gesprochenes Wort, das weder griechisch noch lateinisch ist, noch irgendeiner anderen Sprache entstammt. Aber da es notwendig ist, es denen zur Kenntnis zu 51 bringen, mit denen wir sprechen, wird ein Zeichen benutzt, mit dem es bezeichnet wird.” 49 Man vergleiche damit die oben (Bd. I, S.275ff.) vorgetragene Kritik an W. Stegmüllers Begriff des Konzeptualismus. 50 Vgl. zum Beispiel Paulus, Brief an die Römer, K 2, V.15. 51 “Necesse est enim cum verum loquimur, id est, quod scimus loquimur, ex ipsa scientia quam memoria tenemus, nascatur verbum quod ejusmodi sit omnino, cujusmodi est illa scientia de qua nascitur. Formata quippe cogitatio ab ea re quam scimus verbum est quod in corde dicimus quod nec graecum est, nec latinum, nec linguae alicujus alteri- 29 Unter den neuzeitlichen Philosophen ist es insbesondere Locke, der diese Unterscheidung zwischen der “mentalen” und der “gesprochenen” Sprache aufgegriffen hat. “Zeichen”, so bemerkt er beispielsweise einmal, “sind entweder Ideen oder Wörter”.52 Und am Ende des Essay spricht er davon, daß es gelte, eine eigene wissenschaftliche Disziplin einzurichten: die Semiotik, das heißt die Zeichenlehre; und die soll sich sowohl mit der Natur der Wörter wie der der Ideen befassen.53 Was nun die Beziehungen zwischen der mentalen Sprache, der “Szenerie der Ideen”, wie Locke sich auch ausdruckt, und den Begriffen angeht, so ist klar: Begriffe sind eine Teilklasse dieser “Sprache”. Wobei man freilich, wie wir bereits gesehen haben, seine Zweifel daran hegen kann, ob es wirklich von systematischem Nutzen ist, jene psychischen Phänomene nach dem Vorbild sprachlicher Phänomene verstehen zu wollen. Aber wie verhält es sich mit der Sprache im üblichen Sinne dieses Worts, mit der gesprochenen Sprache also; in welcher Beziehung steht sie, der damaligen Auffassung nach, zu dem, was man hier unter Begriffen versteht? — Auch hier ist die Antwort nicht minder klar, nur fällt sie, sieht man von einigen Spezialfällen einmal ab, gegenteilig aus: die gesprochene Sprache hat mit dem neuzeitlichen Begriff des Begriffs in sachlicher Hinsicht nichts zu tun. In diesem Sinne verstandene sprachliche Ausdrucke sind für neuzeitliche Autoren grundsätzlich etwas, was man in einem nachträglichen Akt bereits vorhandenen Begriffen gleichsam anheftet. Sehen wir uns einige Belege für diese Auffassung etwas genauer an! 1.3.1 Warum Begriffe im neuzeitlichen Sinne nichts Sprachliches sind In einer Stelle seiner Elements of Philosophy schreibt Th. Hobbes zwar: “Dieses Wort ‘Universale’ ist niemals ein Name irgendeines in der Natur existierenden Dings; und es ist auch nicht der Name einer im Geist gebildeten Idee oder sonstigen Erscheinung. 54 Vielmehr ist es der Name eines Worts oder eines Namens.” Aber Hobbes ist hier, so wie in so mancher anderen Hinsicht auch, ein Außenseiter. Weder bei Descartes noch bei Locke oder bei Leibniz, um nur drei Autoren des 17. Jahrhunderts zu nennen, hat er mit dieser Auffassung Zustimmung gefunden. Die wichtigste Voraussetzung der Einwände, die man ihm entgegenhält, kennen wir bereits aus der Kritik Platons am Versuch, Ideen in seinem Sinne und sprachliche Mittel in einen sachlichen Zusammenhang miteinander zu rücken: sprachliche Ausdrücke sind Gegenstände, die in einer bestimmten Beziehung zu anderen “Gegenständen” – zu den “Gegenständen”, die sie “bedeuten” – stehen. Und um die Natur dieser Beziehung begreifen zu können, muß man sich zunächst einus; sed cum id opus est in eorum quibus loquimur perferre notitiam, aliquod signum quo significetur assumitur.” Augustinus, De Trinitate, XV.10.19 (J.-P. Migne, Hrsg., Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, Bd. XLII, col. 1071). 52 Locke, Essay, II.xxxii.19. 53 Locke, Essay, IV.xxi.4. 54 “this word universal is never the name of any thing existent in nature, nor of any idea or phantasm formed in the mind, but always the name of some word or name.” Hobbes, Elements of Philosophy. First Section, Concerning Body, I.ii.9. 30 mal mit diesen letzteren Gegenständen, und zwar unabhängig von ihrer eventuellen Verknüpfung mit sprachlichen “Etiketten”, befassen. Doch was rechtfertigt eigentlich die Annahme, daß die Gegenstände, die als Bedeutung genereller sprachlicher Ausdrücke fungieren können, den Menschen grundsätzlich unabhängig von ihrer Verbindung mit solchen Ausdrücken gegeben sind? — Nach neuzeitlicher Auffassung sind es vor allem zwei Argumente (die beide, in analoger Form, auch schon in der Antike begegnen), welche für jene Annahme sprechen: 1. Wenn zwischen einem generellen Ausdruck und dem, was er bedeutet, eine sachliche Beziehung bestünde, müßte ein Wechsel des Ausdrucks in jedem Fall auch einen Wechsel der mit ihm bezeichneten Sache einschließen. In Wirklichkeit ist dies aber nicht der Fall: verschiedene generelle Ausdrücke können nämlich dasselbe bedeuten. In einer seiner Antworten auf Hobbes’ Kritik an den Meditationes de prima philosophia hat Descartes dieses Argument benutzt. Hobbes hatte aus seiner These von der sprachlichen Natur der Universalien geschlossen, daß die sogenannten “Vernunfterwägungen” – das heißt die Erörterungen über die Beziehungen zwischen Universalien, zwischen Begriffen – gar nichts über die “Natur der Dinge” zutage fördern könnten (wie doch in der voraufgegangenen Tradition immer behauptet worden war); sie seien nur geeignet, etwas über deren Bezeichnungen zu ermitteln (wobei diese im übrigen in ihrem Gebrauch durch eine willkürliche Übereinkunft festgelegt worden seien): “Vernunfterwägungen” sind, so meint er, vermutlich nichts anderes als Überlegungen darüber, “ob wir die Namen der Dinge gemäß den Vereinbarungen verknüpfen oder nicht.”55 Und Descartes nun erwidert darauf: “Bei der Vernunfterwägung (...) handelt es sich um eine Verknüpfung nicht der Namen, sondern der durch die Namen bezeichneten Gegenstände, und ich wundere mich, wie einem das Gegenteil überhaupt in den Sinn kommen kann. Denn wer wird daran zweifeln, daß ein Franzose und ein Deutscher, wenn ein und derselbe Gegenstand vorliegt, genau dasselbe urteilen können, wenngleich sie ihn dabei unter ganz verschiedenen Worten denken? Und sollte nicht auch Hobbes sich selbst verurteilen, wenn er von Vereinbarungen spricht, die wir betreffs der Bedeutungen der Worte getroffen haben? Gibt er nämlich zu, daß die Worte etwas bedeuten, warum sollen dann nicht unsere Vernunft-Urteile von diesem Etwas, was sie bedeuten, eher 56 gelten, als von den Worten allein?” 2. Hobbes behauptet, der Gebrauch der Wörter als Bezeichnungen für etwas verdanke sich einer 55 “Quid jam dicimus, si forte ratiocinatio nihil aliud sit quam copulatio & concathenatio nominum sive appellationum, per verbum hoc est? unde colligimus ratione nihil omnino de natura rerum, sed de earum appellationibus, nimirum utrum copulemus rerum nomina secundum pacta (quae arbitrio nostro fecimus circa ipsarum significationes) vel non.” Hobbes, Vierter Einwand innerhalb der Dritten Einwände gegen Descartes’ Meditationes de prima philosophia, abgedruckt in Descartes, A.T., Bd. VII, S. 178. 56 “Est autem in ratiocinatione copulatio, non nominum, sed rerum nominibus significatarum. Mororque alicui contrarium venire posse in mentem. Quis enim dubitat quin Gallus & Germanus eadem plane iisdem de rebus possint ratiocinari, cum tamen verba concipiant plane diversa? Et nunquid Philosophus seipsum condemnat, cum loquitur de pactis quae arbitrio nostro fecimus circa verborum significationes? Si enim admittit aliquid verbis significari, quare non vult ratiocinationes nostras esse de hoc aliquid quod significatur, potius quam de solis verbis?” Descartes, Meditationes de prima philosophia, S. 178f. Vgl. auch Leibnizs Vorrede zur Ausgabe von M. Niziolius’ Schrift De veris principis, GP, Bd. IV, S. 158. 31 willkürlichen Vereinbarung. Aber wenn dies wirklich so ist, dann muß doch wohl angenommen werden, daß die Menschen, welche derartige Konventionen festgelegt haben, das, was sich mit den in Frage kommenden Laut-(oder Schrift-)gebilden bezeichnen lassen sollte, bereits im vorhinein gekannt haben. Sprachentstehung – und auch eine eventuell erforderlich werdende Spracherweiterung – sind nicht anders erklärbar, als daß man zunächst einmal allgemeine Ideen, Begriffe, usw., erwirbt, und sich dann daran macht, festzulegen, welche Gebilde als Zeichen für diese Universalien stehen sollen. In einer gewissen Hinsicht also ähnlich wie bereits Sokrates in Platons Dialog Kratylos äußert daher zum Beispiel Locke in seinem Essay: “Ich gebe zu, daß es bei der Entstehung der Sprachen notwendig war, die Idee zu besitzen, ehe man ihr den Namen gab. Ebenso ist es, wenn jemand, der eine neue komplexe Idee bildet, 57 auch ein neues Wort schafft, indem er ihr einen neuen Namen beilegt.” 1.3.2 Sprachliche Ausdrücke als Mittel der Darstellung von Begriffen Sprachkritik Sprachliche Ausdrücke – im üblichen, auch heute gebräuchlichen Sinne dieses Worts – haben also für den neuzeitlichen Begriff des Begriffs, ebenso wie bereits für den antiken Begriff der Idee, keine sachliche Bedeutung, sondern nur eine Bedeutung als Mittel der Darstellung und Untersuchung von Begriffen. Werfen wir daher einen Blick darauf, wie man speziell im 17. Jahrhundert die Leistungsfähigkeit der Sprache im Hinsicht auf das Erfüllen dieser Funktionen beurteilt. Die Grundeinstellung ist äußerst kritisch. Das beginnt bereits bei Francis Bacon. Wir Menschen glauben zwar, so schreibt er, daß wir unsere Wörter beherrschen; in Wirklichkeit sei es jedoch häufig so, daß dieses – doch von uns selbst geschaffene – Instrument sich gegen uns richtet und die Urteilsfähigkeit sogar des Klügsten durcheinander bringt. Insbesondere die Philosophie und die übrigen Wissenschaften hätten darunter zu leiden; der nachteilige Einfluß der Sprache habe sie zu “unnützer Sophisterei” verkommen lassen58 – einer Auffassung, der Descartes sich mit der These anschließt, “daß fast alle Kontroversen der Philosophen verschwinden würden, wenn sie sich nur über die Wortbedeutungen einig würden.”59 57 “I confess that, in the beginning of languages, it was necessary to have the idea before one gave it the name: and so it is still, where, making a new complex idea, one also, by giving it a new name, makes a new word.” Locke, Essay, III.v.15. Vgl. auch A. Arnauld und P. Nicole, Logique, Teil I, Kap. I. Zur Interpretation von Leibnizs Einstellung in dieser Frage ist ein von ihm im Abschnitt II.xxix.5 der Nouveaux Essais gegebenes Beispiel für eine Idee wichtig, die noch keine Bezeichnung trägt. 58 “credunt enim homines rationem suam verbis imperare; sed fit etiam ut verba vim suam super intellectum retorqueant et reflectant; quod philosophiam et scientias reddidit sophisticas et inactivas.” F. Bacon, Novum Organum, § 59. 59 Descartes, Regulae ad directionem ingenii, XIII.5. 32 Dieselbe kritische Einstellung gegenüber der Leistungsfähigkeit der tradierten Sprache veranlaßt Hobbes dazu, sie mit einem Spinnengewebe zu vergleichen, “in dem schwächliche Geister sich verfangen”.60 Seiner Überzeugung nach hat dies im übrigen nicht nur für die Wissenschaften nachteilige Folgen. Der negative Einfluß der Sprache mache sich vielmehr auch in den jeindividuellen Lebensentwürfen der Menschen bemerkbar: “Um Hoffnungen zu erwecken”, so bemerkt er, “genügen die gewichtslosesten Gründe, und noch Dinge, die der Verstand nicht zu begreifen vermag, können Ziele der Hoffnung werden, wenn sie nur ausgesprochen werden können.”61 Und Locke schließlich weist zusätzlich darauf hin, daß sprachbedingte Ursachen auch in moralischen Auseinandersetzungen häufig eine vernünftige Einigung verhindern.62 Kein Wunder also, daß ein Autor wie Berkeley schließlich dazu auffordert, man möge doch den “Vorhang der Wörter” einfach beiseite schieben, um sich endlich eine unverstellte Einsicht in die Ideen der Menschen zu verschaffen: “Es wäre zu wünschen, daß jeder sich aufs äußerste bemühte, einen klaren Blick auf die von ihm zu untersuchenden Ideen zu gewinnen, daß er sie insbesondere von allen jenen Verkleidungen und Überlagerungen durch die Wörter befreit, welche so sehr dazu beitragen, das Urteil blind und die Aufmerksamkeit zerstreut werden zu lassen. (...) wir müssen nur den Vorhang aus Wörtern beiseiteziehen, um den herrlichsten Zweig des Wissens zu erlangen, dessen 63 Früchte köstlich sind, und der sich in der Reichweite unseres Herzens befindet.” Gründe für die Sprachkritik Die Gründe für alle diese Bedenken ähneln, zunächst einmal, denen, welche bereits in der Philosophie der Antike zu sprachkritischen Reflexionen geführt hatten: Die Bedeutung vieler sprachlicher Zeichen ist zu verworren und unbestimmt, als daß sie die Zwecke erfüllen könnten, deretwegen man sie benutzt.64 Es gibt Wörter, die wir zu verstehen glauben, und die daher suggerieren, sie stünden für etwas, was es wirklich gibt, während dies in Wirklichkeit durchaus nicht zutrifft – Francis Bacon zufolge zählen dazu beispielsweise Wörter wie “erster Beweger”, “Planetenkreise”, “Element Feuer”, “Zufall”, usw.65 Und außerdem verleitet die syntaktische Struktur der Sätze der üblichen Sprache dazu, alles, was an die Stelle des Subjekts dieser Sätze gestellt werden kann (um es so als Objekt der Aufmerksamkeit des Men60 “(...) speech has something in it like to a spider’s web (...) for by contexture of words tender and delicate wits are ensnared and stopped.” Hobbes, Elements of Philosophy. First Section, Concerning Body, I.iii.8. 61 “ad spem sufficiunt (...) levissima argumenta. Imo res, quae ne animo quidem concipi potest, sperari tamen potest, si dici potest.” Hobbes, Elementarum philosophiae. Sectio secunda, De homine, XII.4. 62 Locke, Essay, III.x.4. 63 “It were, therefore, to be wished that every one would use his utmost endeavours to obtain a clear view of the ideas he would consider, separating from them all that dress and incumbrance of words which so much contribute to blind the Judgment and divide the attention. (...) we need only draw the curtain of words, to behold the fairest tree of knowledge, whose fruit is excellent, and within the reach of our heart.” Berkeley, Principles of Human Knowledge, Einleitung, § 24, vgl. auch ebd., § 21-23. 64 F. Bacon, Novum Organum, § 60, und viele andere Autoren. 65 F. Bacon, Novum Organum, § 60. 33 schen hervorzuheben), als eine Substanz, das heißt als einen nicht weiter hinterfragbaren Grundbestandteil der Welt, zu interpretieren – während man es in Wirklichkeit häufig mit einem bloßen Produkt der Einbildungskraft der Menschen zu tun hat. In einer berühmten Passage seiner Meditationes de prima philosophia hat Descartes speziell diesen letzteren Punkt an einem Beispiel erläutert: “Indessen wundere ich mich, wie sehr doch mein Denken zu Irrtümern neigt; denn auch wenn ich das bisher von uns Erörterte schweigend und ohne zu reden. bei mir erwäge, bleibe ich doch an den Worten hängen und lasse mich beinahe durch den Sprachgebrauch beirren. Sagen wir doch: wir sehen das Wachs selbst, wenn es da ist, und nicht: wir urteilen nach der Farbe und der Gestalt, daß es da sei. Und daraus möchte ich am liebsten gleich schließen, daß man 66 also das Wachs mit der Sehkraft der Augen und nicht mit Verstandeseinsicht allein erkennt.” Nun sind dies alles zwar gewiß bedenkenswerte Gründe zugunsten eines reflektierten Umgangs mit der Sprache als Mittel der Darstellung und Untersuchung von Begriffen. Aber erklären sie auch schon die Heftigkeit, mit der diese Autoren ihre Sprachkritik vortragen? Erinnern wir uns, daß Platon, trotz aller Bedenken gegenüber dem, was die Erscheinungsweise von sprachlichen Mitteln an Irrtümern hinsichtlich des mit jenen Mitteln Bezeichneten nahelegen mag, eine sehr viel ausgeglichenere Auffassung befürwortet hatte (wenn man einmal von dem radikalen Sprachskeptizismus des 7. Briefs absieht): die materielle Beschaffenheit eines Worts, seine Etymologie, oder auch die in der alltäglichen Sprache angelegte Aufteilung von Einzelwörtern – all dies kann, so hatte er gemeint, zumindest in Einzelfällen durchaus wichtige heuristische Hilfe liefern. Vergleichbares findet sich bei den bisher genannten Autoren des 17. Jahrhunderts hingegen nicht. Eine so radikale, von so vielen Philosophen derselben Epoche geteilte sprachkritische Einstellung ist neu (und wird sich auch allenfalls zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch einmal einstellen). Tatsächlich wird man die Gründe für jenen so heftigen sprachkritischen Impuls der Schriften des 17. Jahrhunderts in Motiven suchen müssen, die über die bisher genannten Überlegungen hinausreichen: in jener Bewegung nämlich, mit der sich die neuzeitliche Philosophie gegen den theologisch veranlaßten Skeptizismus des Spätmittelalters wendet. Auf die Sprachspekulationen des frühen und hohen Mittelalters hatte jene Stelle der Genesis sich entscheidend ausgewirkt, in der es heißt: “Da bildete Gott der Herr aus Erde alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zum Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde; und ganz wie der Mensch sie nennen würde, so sollten sie heißen. Und der Mensch gab allem Vieh und allen Vögeln des 67 Himmels und allen Tieren des Feldes Namen.” Zudem war die Überzeugung, daß Gott die Ideen erdacht habe, um sich Orientierungshilfen für 66 “Miror vero interim quam prona sit mea mens in errores, nam quamvis haec apud me tacitus, et sine voce considerem, haereo tamen in verbis ipsis, et fere decipior ab ipso usu loquendi: dicimus enim nos videre ceram ipsammet si adsit, non ex colore, vel figura eam adesse judicare. Unde concluderem statim, ceram ergo visione oculi, non solius mentis inspectione cognosci (...).” Descartes, Meditationes de prima philosophia, II.13. 67 Genesis, Kap. 2, Vers 19f. 34 die Erschaffung der Welt bereitzustellen, des öfteren mit einer weiteren Überlegung verknüpft worden: mit der Überlegung, daß Gott sich jene mentalen Muster in einem Zuge mit der Artikulation von – “mentalen” – Wörtern für diese Muster erdacht haben müsse.68 Und das alles legte den Glauben nahe, die Sprachen der Menschen stünden im Prinzip mit der Sprache Gottes in einer direkten Beziehung, seien das im wesentlichen adäquate Mittel zur Darstellung des von Gott Hervorgebrachten. Daß man dies den einzelnen Sprachen nicht immer sogleich ansehen kann, war zwar nicht zu bestreiten – Sündenfall und Babel hatten schließlich ihre Folgen gehabt –; aber die alte “Sprache Adams” würde sich, wie man glaubte, im Prinzip durchaus, mit Hilfe geeigneter etymologischer Untersuchungen etwa, rekonstruieren lassen. Der Radikalisierung theologischer Absichten am Ende des Mittelalters konnten derartige Überzeugungen freilich nicht standhalten – ebensowenig, wie sich der Glaube hatte aufrecht halten lassen, daß die menschlichen Sinnesorgane ein grundsätzlich unproblematisches Mittel seien, um Einsicht in das Wesen der von Gott hervorgebrachten Welt zu gewinnen. Denn genau so, wie Gott es veranlassen kann, daß die Menschen sinnlich zu erfassen glauben, was es in Wirklichkeit gar nicht gibt, kann er die Menschen auch mit einer Sprache ausstatten, die ihnen eine Realität vorgaukelt, welche sich mit der von ihm tatsächlich geschaffenen Welt nicht deckt.69 Es ist daher durchaus kein Zufall, daß Hobbes, in deutlich zu spürendem, provokativem Gegensatz zu jener Stelle aus der Genesis, schreibt, die Einführung der ersten Namen der Sprache sei ein willkürlicher Akt der Sprachschöpfer gewesen.70 Und ebensowenig ist es ein Zufall, daß er sich ausdrücklich gegen den Glauben wendet, in den tradierten Sprachen seien noch Relikte der Sprache Adams enthalten.71 Denn im Kontext der damaligen sprachtheoretischen Reflexionen hatten derartige Bemerkungen, ebenso wie die so betont vorgetragene Sprachkritik, eine wichtige Aufgabe zu erfüllen: sie sollten ein für allemal von der wie auch immer noch konservierten Hoffnung kurieren, man könne sich dem fernen Gott in irgendeiner Weise nähern. Und sie sollten vor allem die Bahn dafür frei machen, daß man sich auch beim Umgang mit diesem Medium auf das 68 Vgl. zum Beispiel die folgende Passage aus dem Monologion (Kap. X) von Anselm von Canterbury: “Was anders nun ist jene Gestalt der Dinge, die im schöpferischen Geiste vor den zu schaffenden Dingen da ist, als eine Art von Aussprache der Dinge im Innern dieses Geistes, so wie wenn der Werkmann, der irgendein Werk seines Berufes herstellen will, dieses zuvor vermöge der Vorstellungen des Geistes in seinem Innern ausspricht? (Illa autem rerum forma, quae in eius ratione res creandas praecedebat: quid alius est quam rerum quaedam in ipsa ratione locutio, veluti cum faber facturus aliquod suae artis opus prius illud intra se dicit mentis conceptione?)”. 69 Daß das Motiv der “adamitischen Sprache”, von der her alle anderen Sprachen sich angeblich entwickelt haben, bei Leibniz wieder auftritt (vgl. zum Beispiel Nouveaux Essais, III.ii.1), widerspricht dem nicht. Denn bei Leibniz steht dieses Motiv bereits in einem anderen, eben neuzeitlichen Kontext. Leibniz argumentiert ja vor dem Hintergrund der Annahme, daß nichts, was Gott geschaffen hat, ohne zureichenden und den Menschen im wesentlichen auch zugänglichen Grund so ist, wie es ist. Und diesem Grundsatz folgt Leibniz auch bei seinen sprachtheoretischen Reflexionen. Er kann daher sogar behaupten, wenn man die sprachlichen Erscheinungen erst einmal hinreichend geordnet habe, werde sich zeigen, “daß die Sprachen der beste Spiegel des menschlichen Geistes sind und daß eine genaue Analyse der Wortbedeutungen besser als alles andere die Verrichtungen des Verstandes erkennen lassen würde.” (Nouveaux Essais, III.vii.6.) Vgl. auch ders., “Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die Ausübung und Verbesserung der teutschen Sprache”, § 1 (In: G. W. Leibniz, Deutsche Schriften, hrsg. von G. E. Guhrauer, Bd. I, S. 449). — Zu Leibnizs sprachtheoretischen Auffassungen insgesamt s. den materialreichen Artikel von A. Heinekamp, “Sprache und Wirklichkeit nach Leibniz”. 70 Hobbes, Elements of Philosophy. First Section, Concerning Body, I.iii.8. Vgl. auch das Zitat oben, S. 32, Anm. 55. 35 besinnt, was die Menschen, unabhängig von theologischen Forderungen, wollen, und wie sie ihre persönlichen Ziele am besten verwirklichen können. Mit anderen Worten: wenn Hobbes den willkürlichen Charakter der überlieferten sprachlichen Mittel betont, so heißt dies gleichzeitig: die Menschen der Gegenwart sind ohne weiteres berechtigt, und im Grunde sogar dazu aufgefordert, sich dieses Medium nach ihren eigenen Bedürfnissen zurechtzuschneiden. Die intensive Sprachkritik des 17. Jahrhunderts ist ein Aspekt der damaligen Einstellung gegenüber der Sprache als Mittel der Darstellung und Untersuchung von Begriffen; und mit ihm ist, als zweiter Aspekt derselben Einstellung, der Wunsch nach einer grundlegenden Neukonstruktion der Sprache eng verbunden. Sprachkonstruktion “Das beste Mittel zur Vermeidung der Verwirrung der Wörter”, so schreiben A. Arnauld und P. Nicole in ihrer 1662 erstmals publizierten Logique ou l’Art de penser – einer Schrift, die häufig auch unter dem Titel Logik von Port-Royal zitiert wird72 – “ist die Schaffung einer neuen Sprache und neuer Wörter, die nur mit den Ideen verbunden sind, die sie repräsentieren sollen.”73 Arnauld und Nicole stehen mit dieser Auffassung nicht allein. Eine viel kommentierte Anspielung auf eine solche künstlich zu schaffende neue Sprache findet sich bereits bei Descartes. In einem Brief an Mersennes vom 20. November 1629 bemerkt er: “Ich wage für demnächst eine universelle Sprache zu erhoffen, die sehr leicht zu lernen, auszusprechen und zu schreiben sein wird, und die – was am wichtigsten ist – dem Urteil helfen wird. Denn sie wird alle Dinge in deutlich geschiedener Weise darstellen, so daß es fast unmöglich sein wird, sich zu täuschen – während die, über die wir verfügen, ganz im Gegenteil dazu fast nur verworrene Bedeutungen besitzt.”74 Allerdings, so fügt Descartes hinzu, hänge die Durchführung eines solchen Programms von einer wichtigen Voraussetzung ab: man müsse bereits über die “wahre Philosophie (vraie philosophie)” verfügen, die nämlich zuvor “alle Ideen (pensées) der Menschen aufzählen und sie in eine Ordnung bringen müßte.”75 71 Hobbes, Leviathan, 104. — Vgl. zu dem gesamten Motiv M. de Grazia, “The Secularization of Language in the Seventeenth Century”. 72 Arnauld und Nicole waren Mitglieder der Jansenisten, das heißt einer christlichen Sekte, die zwar innerhalb der katholischen Kirche blieb, aber in einem recht gespannten Verhältnis zum Papst stand. Die Schrift wurde deswegen ursprünglich anonym veröffentlicht. Da man aber wußte, daß sie das Ergebnis von Unterrichtsstunden war, die im Kloster von Port-Royal erteilt worden waren, erhielt sie jenen Titel. — Die Logique war im übrigen außerordentlich erfolgreich. Noch zu Lebzeiten ihrer Autoren wurde sie mehr als zehn mal neu aufgelegt. Zudem blieb sie bis ins 19. Jahrhundert hinein an vielen europäischen Universitäten der Text, auf dem der Logikunterricht fußte. 73 “Le meilleur moyen pour éviter la confusion des mots qui se rencontrent dans les langues ordinaires, est de faire une nouvelle langue, & de nouveaux mots qui ne soient attachés qu’aux idées que nous voulons qu’ils ‘représentent.” Arnauld und Nicole, Logique, Teil I, Kap. XIV (S. 86). 74 “j’ oserais espérer ensuite une langue universelle fort aisée à apprendre, à prononcer & à écrire, et ce qui est le principal, qui aiderait au jugement, lui représentant si distinctemment toutes choses qu’il lui serait presque impossible de se tromper; au lieu que, tout au rebours, les mots que nous avons n’ont quasi que des significations confuses.” Descartes, Brief an Mersennes vom 20. November 1629 (A.T., Bd. I, S. 81). 75 Descartes, Brief an Mersennes vom 20. November 1629 (A.T., Bd. I, S. 81). 36 Zu einem methodisch durchdachten Programm verdichtet sich diese von vielen weiteren Autoren des 17. Jahrhunderts ebenfalls gehegte Hoffnung freilich erst bei Leibniz. Leibnizs Projekt der “characteristica universalis” Das generelle Ziel, das Leibniz immer wieder, in verschiedenen Anläufen, mit seinen Schriften verfolgt hat, ist der Aufbau einer “allgemeinen Wissenschaft (scientia generalis, Science Generale)”,76 die im Vergleich zur bisherigen Wissenschaftspraxis eine völlig neue Methode des Gewinns (inventio) und des Beweisens (demonstratio) solcher Thesen praktizieren soll. Und bei der Realisierung dieses Ziels spielt, Leibnizs Darlegungen zufolge, die Konstruktion einer künstlichen Sprache eine wichtige Rolle. Leibniz unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen einer 1) “ars combinatoria”, das heißt einer Lehre von den Grundbegriffen des Menschen und deren Verknüpfungsmöglichkeiten; 2) einer “characteristica universalis”, das heißt einer Menge von – primär in ihren materiellen Eigenschaften betrachteten – Zeichen, mit denen alle einfachen und zusammengesetzten Begriffe so repräsentiert werden können, daß jedem Begriff ein Zeichen und jedem Zeichen ein Begriff entspricht, und daß man dem jeweiligen Zeichen bereits den Aufbau des Begriffs ansehen kann, für den es steht; sowie 3) einem “calculus ratiocinator” oder “calculus rationis”, das heißt einer gewissen Menge von Regeln zur gleichsam mechanischen Operation mit den Zeichenmarken, den “Charakteren”, wie es bei Leibniz heißt. Und die Pointe dieser Unterscheidungen ist dabei die folgende: angenommen, es gelingt wirklich, mit Hilfe der “characteristica universalis” Zeichen zur Verfügung zu stellen, mit denen wichtige Grundbegriffe der Menschen in eindeutiger Weise repräsentiert sind. Angenommen auch, der “calculus ratiocinator” entspreche in seinen Vorschriften zum Operieren mit den Zeichenmarken genau den Regeln für die Verknüpfung jener Grundbegriffe, die mit der “characteristica universalis” dargestellt werden. Dann müßte es möglich sein; in einer wesentlich einfacheren Weise als bisher zu neuen Einsichten über jenes Begriffssystem zu kommen. Man bräuchte ja lediglich mit den Zeichenmarken auf dem Papier (oder wo auch immer) gleichsam mechanisch zu operieren: wenn man dabei dem “calculus ratiocinator” korrekt folgt, müßte man zu Gebilden kommen, die sich bei Bedarf als Zeichen für bestimmte, womöglich bisher noch nicht bekannte Möglichkeiten jenes Begriffssystems lesen lassen.77 76 Vgl. dazu zum Beispiel Leibnizs “Discours touchant la methode de la certitude et l’art d’inventer” (GP, Bd. VII, S. 174-183). — Sprachkritische Überlegungen trägt Leibniz zum Beispiel im Abschnitt II.xxix.9 der Nouveaux Essais vor. 77 Zur Bedeutung von “ars combinatoria” und “characteristica universalis” vgl. Leibnizs kleine, ohne Überschrift erhaltene Abhandlung, die E. Cassirer in dem ersten Band der von ihm herausgegebenen Hauptschriften Leibnizs auf den S. 30-38 wiedergegeben hat (der lateinische Originaltext findet sich in GP, Bd. VII, S.I84-189). Zum “calculus 37 Man sieht: Leibniz nimmt hier Überlegungen vorweg, die in unserer Zeit zum Bau von Computern geführt haben.78 Welch große Hoffnungen Leibniz auf die Möglichkeit gesetzt hat, eine “Art Alphabet der menschlichen Gedanken zu ersinnen und durch die Verknüpfung seiner Buchstaben und die Analysis der Worte, die sich aus ihnen zusammensetzen, alles andere zu entdecken und beurteilen”79 geht besonders deutlich aus einem Brief hervor, den Leibniz im Jahre 1671 an den Herzog Johann Friedrich von Hannover geschrieben hat. “In Philosophie”, so heißt es dort, “habe ich ein mittel funden, das jenige was Cartesius und andere per Algebram et Analysin in Arithmetica et Geometria gethan, in allen scientien zuwege zu bringen per Artem Combinatoriam, welche Lullius und P. Kircher zwar excolirt, bey weiten aber in solche deren intima nicht gesehen. Dadurch alle Notiones compositae der ganzen Welt, in wenig simplices als deren Alphabet reduciret, und aus solches alphabets combination wiederumb alle dinge, samt ihre theorematibus, und was nur von ihnen zu inventiren müglich ordinata methodo mit der zeit zu finden ein weg gebahnet wird. Welche invention, dafern sie wils Gott zu Werck gerichtet, als mater aller inventionen von mir vor das importanteste gehalten wird, ob sie gleich das ansehen noch zur zeit nicht haben mag: Ich habe dadurch alles was erzehlet werden soll, gefunden und hoffe noch ein mehrers zu wege zu bringen.”80 Eine nicht gesehene Schwierigkeit Eine neue, bessere Sprache also. Doch wie hat man sich die Einführung der Zeichen, aus denen diese neue Sprache bestehen soll, eigentlich im einzelnen vorzustellen? — Eine entscheidende Hilfe dabei ist, den Auffassungen der damaligen Autoren zufolge, die Definition (genauer gesagt: eine bestimmte Art von Definition. Denn neben dieser, auf die Festsetzung des Gebrauchs neuer Zeichen zielenden Definition kennt man auch noch andere Definitionstypen). Nun werden im Deratiocinatur” vgl. zum Beispiel GM, Bd. IV, S. 462, sowie, in den von L. Couturat herausgegebenen Opuseules et fragments inédits Leibnizs, die Ausführungen auf der S. 327. Gesamtdarstellungen dieses Teils von Leibnizs Werk finden sich zum Beispiel bei L. Couturat, La logique de Leibniz, S. 81-118; G. Martin, Leibniz, S. 25-34 und S.63-68; H. W. Arndt, Methodo scientifica pertractatum, S. 110118. Eine gute Übersicht über die im weiteren Sinne begriffstheoretischen Arbeiten Leibnizs und die neuere Literatur zu diesem Thema liefert der Kommentar F. Schupps zur von ihm besorgten Ausgabe von Leibnizs Generales Inquisitiones de Analysi Notionum et Veritatum. — Die ersten Ansätze zur Konzeption einer Universalsprache sind im übrigen bereits im Zusammenhang mit der Überlieferung der Geschichte des Turmbaus von Babel nachweisbar. Die “ars combinatoria” hat ihre Vorläufer in der, noch von kabbalistischen Motiven gespeisten, Ars magna et ultima des Raymundus Lullus (1235-1316). Und der Entwurf eines “calculus ratiocinator” ist wesentlich durch die Herauslösung der Algebra, als eines nur mit Buchstaben rechnenden; schematischen Verfahrens, aus der Arithmetik durch Franz Vieta (1540-1603) begünstigt worden. Reichhaltiges Material dazu hat W. Risse in seinem Aufsatz über “Mathematik und Kombinatorik in der Logik der Renaissance” zusammengestellt. 78 Als frühester Beleg für den Entwurf einer Rechenmaschine gilt ein Brief des Tübinger Gelehrten Wilhelm Schikkard (1592-1635) an seinen Freund Johannes Kepler. Zahlreiche weitere Entwürfe – von denen einige auch realisiert worden sind – stammen von Blaise Pascal. Leibniz hat sich mit einem eigenen Konzept einer solchen Maschine um die Aufnahme in die 1662 gegründet Londoner Royal Society beworben (mit Erfolg, obwohl eine nach seinen Plänen hergestellte Maschine nicht funktionsfähig gewesen sein soll). 79 “(...) quod scilicet excogitari posset quoddam Alphabetum cogitationum humanarum, et quod literarum hujus Alphabeti combinatione et vocabulorum ex ipsis factorum analysi omnia et inveniri et dijudicari possent.” Leibniz, ohne Überschrift erhaltenes Textstück, GP, Bd. VII, S. 185 (dt. in: E. Cassirer, Hrsg., Hauptschriften, Bd. I, S. 32). 80 Leibniz, Brief an Johann Friedrich von Hannover, aus dem Jahre 1671 (GP, Bd. VI, S. 227). Vgl. auch die “Introductio ad Encyclopaediam arcanam”, abgedruckt in Leibniz, Opuseules et fragments inédits, hrsg. von L. Couturat, S. 511-515. 38 finiens einer Definition ja aber bereits Zeichen gebraucht. Und woher sollen diese Zeichen genommen werden? Aus weiteren Definitionen? — Das ist nicht beliebig wiederholbar. Soll man also doch irgendwann auf die Wörter der überlieferten Sprachen zurückgreifen? Aber diesen steht man doch mit kritischen Reserven gegenüber! Hier, im Verhältnis zwischen der jeweils historisch vorgegebenen Sprache und der neu zu schaffenden Sprache scheint also ein dorniges Problem zu liegen. Auffallenderweise hat man diesem Problem zu jener Zeit jedoch keine sonderlich große Aufmerksamkeit gewidmet – obwohl man sich selbstverständlich bewußt war, daß die Definitionen, an die man im Zusammenhang mit der Einführung der künstlichen Sprache dachte, auf den Gebrauch weiterer Zeichen angewiesen sind. Bei genauerem Nachdenken läßt sich jedoch durchaus verstehen, warum dies so ist: man glaubte ja, die eigenen Ideen seien jedem Menschen prinzipiell in einer sprachlich unvermittelten Weise zugänglich. Um noch einmal Berkeley zu zitieren, der sich in dieser Hinsicht besonders deutlich äußert: damit ich nicht dem Einfluß der Wörter auf den Verstand erliege, werde ich, so schreibt er in der “Einleitung” zu seinen Principles of Human Knowledge, “mich bemühen, alle von mir untersuchten Ideen nackt und bloß in den Blick zu bekommen; und dabei werde ich jene Namen, mit denen sie ein langer und konstanter Gebrauch so eng verknüpft hat, so gut ich kann aus meinen Gedanken heraushalten. (...) Ich sehe nämlich nicht, wie ich mich noch leicht täuschen können soll, so lange ich meine Gedanken auf meine eigenen, von den Wörtern entblößten Ideen beschränke. Die Gegenstände, die ich solcherart untersuche, kenne ich klar und in adäquater Weise. Ich kann nicht so betrogen werden, daß ich glaube, eine Idee zu haben, die ich nicht habe. Es ist für mich nicht möglich, zu glauben, daß meine eigenen Ideen einander ähneln oder nicht ähneln, während dies in Wirklichkeit nicht zutrifft. Um die zwischen meinen Ideen existierenden Verträglichkeiten und Unverträglichkeiten zu erkennen, um zu sehen, welche Ideen in einer zusammengesetzten Idee enthalten sind und welche nicht, ist nichts weiter erforderlich als aufmerksames Wahrnehmen dessen, was in meinem eigenen Verstand geschieht.”81 Gewiß, andere Autoren, Leibniz zum Beispiel, hätten Berkeley gegenüber wohl eingewandt, daß er zu Unrecht aus der Unmittelbarkeit des Zugangs zu den Ideen ableite, sich über ihre Eigenschaften nicht täuschen zu können. Aber unabhängig von diesem Dissens wird hier doch deutlich, warum man zu jener Zeit nicht glaubt, die Verwendung von Zeichen der historisch gegebenen Sprachen bei der Einführung einer künstlichen Sprache werfe ein besonders schwieriges Problem auf: man ist eben davon überzeugt, die historisch gegebenen sprachlichen Zeichen notfalls in ihrer Gesamtheit durch einen Blick auf die eigenen Ideen überprüfen zu können. 81 “Since therefore words are so apt to impose on the understanding, whatever ideas I consider, I shall endeavour to take them bare and naked into my view, keeping out of my thoughts, so far as I am able, those names which long and constant use hath so strictly united with them. (...) so long as I confine my thoughts to my own ideas divested of words, I do not see how I can easily be mistaken. The objects I consider, I clearly and adequately know. I cannot be deceived in thinking I have an idea which I have not. It is not possible for me to imagine that any of my own ideas are alike or unlike that are not truly so. To discern the agreements or disagreements there are between my ideas, to see what ideas are included in any compound idea and what not, there is nothing more requisite than an attentive perception of what passes in my own understanding.” Berkeley, Principles of Human Knowledge, Einleitung, § 21f. 39 1.3.3 Begriffe, Bedeutungen und das Verstehen genereller Ausdrücke Der Leser wird sich noch daran erinnern, daß wir anläßlich unserer Lektüre von Platons Dialog Kratylos sowie einiger Passagen aus Aristoteles’ Schrift De interpretatione auf eine eigentümliche Implikation von Platons Begriff der Idee beziehungsweise Aristoteles’ Begriff der Wesenheit gestoßen waren (s.o., Bd. I, S. 74-78). Gezeigt hatte sich diese Implikation im Zuge des folgenden Gedankengangs: (1) Bei den antiken Autoren gibt es zumindest eine starke Neigung dazu, zu sagen, die Bedeutung eines generellen Ausdrucks liege in der Idee beziehungsweise der Wesenheit, für die dieser Ausdruck steht. (2) Daraus folgt, daß man von einem Menschen sagen kann, er habe einen generellen Ausdruck “verstanden”, wenn der Betreffende weiß, welche Idee beziehungsweise Wesenheit jener Ausdruck repräsentiert (denn wir sagen ja, daß das, was wir verstehen, wenn wir einen generellen Ausdruck verstehen, seine “Bedeutung” sei). (3) Daraus folgt allerdings auch, daß man, konfrontiert mit generellen Ausdrücken für Negatives (“Leere”, “Nicht-Mensch”), Fiktives (“Einhorn”, “Bockhirsch”) oder Widersprüchliches (“Kreisviereck”, “Mensch-und-Pferd”), vor einem Rätsel steht. Denn zumindest wir Heutige würden sagen, daß wir auch diese Ausdrücke sehr wohl “verstehen”. Nur ist dies von den genannten Voraussetzungen der antiken Position her betrachtet eigentlich unberechtigt. Daß es Ideen beziehungsweise Wesenheiten von Negativem, Fiktivem oder gar Widersprüchlichem geben kann, das lassen jene antiken Begriffe nämlich streng genommen nicht zu. Zwar hatte zumindest Aristoteles die sich von dieser Überlegung her aufdrängende radikale Schlußfolgerung, daß negative, fiktive und widersprüchliche Ausdrücke eigentlich bedeutungslos, unverständlich und womöglich auch gar keine Wörter seien, nicht zur Gänze gezogen, sondern diese Konsequenz auf Ausdrücke der zuletzt genannten Art beschränkt. Aber er hatte eigentümlicherweise von den negativen Ausdrücken gemeint, sie hätten eine unbestimmte (und nicht etwa, wie wir heute sagen würden, eine im Prinzip sehr wohl bestimmte, wenngleich meist recht weite) Bedeutung. Zudem hatte sich jene Lesart seiner Ausführungen als recht problematisch erwiesen, derzufolge die fiktiven Ausdrücke deswegen für ihn eine Bedeutung besitzen können, weil diese Bedeutung in einem solchen Fall nicht aus einer Wesenheit, sondern aus einer Vorstellung bestehe. Denn das hatte nur zu der Frage geführt, worauf sich die hier gemeinte Vorstellung richten solle, wenn nicht auf eine Wesenheit. Dies zur Rekapitulation. Wie verhält man sich nun innerhalb der neuzeitlichen Philosophie gegenüber der Frage nach den Beziehungen zwischen den Begriffen des Begriffs, der Bedeutung eines generellen Ausdrucks und des Verstehens eines solchen Ausdrucks, oder, genauer gesagt, wie kann man sich, auf der Basis der eigenen Voraussetzungen, gegenüber dieser Frage verhalten? Notieren wir zunächst einmal, daß sich in einer Hinsicht wenig geändert hat: auch innerhalb der neuzeitlichen Philosophie wird die Frage, was es mit der “Bedeutung” von Wörtern auf sich habe, immer nur am Rande diskutiert – ähnlich wie bereits in der Antike, und im Gegensatz zu der 40 Rolle, welche diese Frage in der Philosophie der Moderne spielen wird. I. Hacking hat darauf zu Recht hingewiesen.82 In einem weiteren Punkt gibt es überdies zumindest eine deutliche Parallele zur antiken Position: die Bedeutung eines generellen Ausdruck ist, so meint man durchweg, die allgemeine Idee, die jener Ausdruck repräsentiert. Arnauld und Nicole beispielsweise umschreiben den Akt, mit Hilfe dessen einem – der Sprachkonstruktion wegen eingeführten – neuen Wort eine allgemeine Idee zugeordnet wird, als “Verleihen einer Bedeutung” (donner signification).83 Und Locke erläutert ausdrücklich: “Die Funktion (...) von Wörtern besteht darin, sinnliche Marken von Ideen zu sein; und die Ideen, für die sie stehen, machen ihre eigentliche und unmittelbare Bedeutung aus.”84 Aber eine allgemeine Idee im neuzeitlichen Sinne ist ja etwas anderes als eine Idee im Sinne Platons oder eine Wesenheit im Sinne Aristoteles’. Und muß sich dies nicht auch auf die neuzeitliche Einstellung gegenüber der Frage nach der Bedeutung und dem Verstehen von Ausdrücken für Negatives, Fiktives und Widersprüchliches in einer bestimmten Weise auswirken? — Das muß es in der Tat. Zudem läßt sich ohne weiteres zeigen, daß dies den neuzeitlichen Autoren mehr oder weniger deutlich bewußt gewesen ist. Generelle Ausdrücke für Negatives und Fiktives Besonderes Interesse haben zu jener Zeit vor allem die generellen Ausdrücke auf sich gezogen, die für etwas Negatives stehen. Descartes spricht dieses Thema bereits in den Regulae ad directionem ingenii – in der Regel XII.15 – an, und bei Locke findet sich die folgende Bemerkung: “Außer diesen Namen, die für Ideen eintreten, gibt es noch andere Wörter, die man nicht verwendet, um eine Idee zu bezeichnen, sondern um das Fehlen oder die Abwesenheit bestimmter einfacher oder komplexer Ideen oder aller Ideen überhaupt auszudrücken. Dazu gehören zum Beispiel nihil im Lateinischen, Unwissenheit und Geistesleere im Englischen. Von all diesen negativen oder privativen Wörtern kann man eigentlich nicht sagen, daß sie keiner Idee zugehörten oder keine Idee bezeichneten; denn sonst wären sie völlig bedeutungslose Laute. Sie 82 I. Hacking, Why Does Language Matter to Philosophy?, Abschnitt A. — Ich kann daher H. Schnädelbach nicht folgen, wenn er schreibt, für Descartes wie für die neuzeitlichen Autoren überhaupt sei “die Ideenanalyse nur Vehikel der Bedeutungsanalyse von Begriffen (gemeint ist: ‘Ausdrücken’, A. R.)” (H. Schnädelbach, Reflexion und Diskurs, S. 119). Für einen neuzeitlichen Autor stellt sich das Verhältnis in Wirklichkeit gerade umgekehrt dar. Das heißt, die Analyse der Bedeutung von Ausdrücken ist für ihn ein Mittel, um zur Beschreibung von Ideen, Begriffen, usw., zu gelangen – sofern er nicht von vornherein von der für ihn kennzeichnenden Überzeugung Gebrauch macht, daß Menschen über einen direkten, durch sprachliche Zeichen nicht vermittelten Zugang zu jenen Gegenständen verfügen. 83 Arnauld und Nicole, Logique, Teil I, Kap. XIV (S. 86). Man beachte auch die folgende Bemerkung Descartes’ aus seinem Brief an Mersennes vom Juli 1641: “(...) nous ne saurions rien exprimer par nos paroles, lors que nous entendons ce que nous disons, que de cela mesme il ne soit certain que nous avons en nous l’idée de la chose qui est signifiée par nos paroles.” (A.T., Bd. III, S. 393) – eine Bemerkung, die man wohl am besten so übersetzt: “(...) wir wären nicht fähig, etwas mit unseren Wörtern so auszudrücken, daß wir verstehen, was wir sagen, wenn dabei nicht sicher wäre, daß wir in uns die Idee der Sache haben, welche durch unsere Wörter bedeutet wird.” 84 “The use (...) of words is to be sensible marks of ideas; and the ideas they stand for are their proper and immediate signification.” Locke, Essay, III.ii.l. 41 beziehen sich jedoch auf positive Ideen und bezeichnen deren Abwesenheit.”85 Das liest sich allerdings noch, als wäre es von den Grundannahmen Aristoteles’ her geschrieben: eine Idee muß anscheinend immer etwas Positives sein (so, wie eine Wesenheit im Sinne Aristoteles’), und wo ein Wort die Abwesenheit einer Idee bezeichnen soll, bedarf es einer besonderen Anstrengung, um erklären zu können, warum es gleichwohl eine Bedeutung besitzt. Daß sich inzwischen gegenüber Aristoteles wirklich etwas geändert hat, wird daher, was die negativen Ausdrücke betrifft, so richtig erst bei Leibniz erkennbar. Denn in der entsprechenden Stelle seiner Nouveaux Essais hält er Locke entgegen: “Ich sehe nicht, warum man nicht sagen könnte, daß es privative Ideen gibt, wie es auch negative Wahrheiten gibt, denn die Tätigkeit des Verneinens selbst ist positiv.”86 Doch in Wirklichkeit ist natürlich auch Locke bereits von Aristoteles (und Platon) recht weit entfernt. Man erkennt dies deutlich an seiner Haltung gegenüber Ausdrücken für fiktive Gegenstände. Wir wissen: für Aristoteles kann es keine Wesenheiten fiktiver Gegenstände geben, und deswegen ist die Bedeutung entsprechender genereller Ausdrücke für ihn – auch wenn er selber sich nicht so ausdrückt – zumindest ein Problem. Bei Locke hingegen liest man: “Nehmen wir an, daß es in der Natur kein Tier wie das Einhorn und keinen Fisch wie die Seejungfrau gäbe oder gegeben hätte. So ist doch (...) das Wesen der Seejungfrau (sc. und damit die Bedeutung des entsprechenden generellen Ausdrucks, A. R.) ebenso verständlich wie das eines Menschen (...).”87 Es ist nicht schwer, zu erkennen, woher diese Unterschiede zwischen den neuzeitlichen und den antiken Autoren rühren: für Locke und Leibniz sind (allgemeine) Ideen ja das Erzeugnis der schöpferischen Eigentätigkeit des menschlichen Verstands, das heißt sie sind das Erzeugnis einer Aktivität, die nicht darauf angewiesen ist, daß die Natur ihr Vorbilder für das liefert, was sie hervorbringen soll. Und folglich kann der Verstand auch “Bedeutungen” für generelle Ausdrücke bereitstellen, die zur Bezeichnung fiktiver Gegenstände dienen. Von der Position Platons und Aristoteles’ her gesehen bot es sich zumindest an, zu sagen: wenn wir einen bestimmten generellen Ausdruck verstehen können, dann folgt daraus, daß es wenigstens einen konkreten Gegenstand gibt oder gegeben hat, dem sich dieser Ausdruck zusprechen läßt beziehungsweise zusprechen ließ. Denn generelle Ausdrücke bedeuten Ideen (Wesenheiten), 85 “Besides these names which stand for ideas, there be other words which men make use of, not to signify any idea, but the want or absence of some ideas, simple or complex, or all ideas together; such as are nihil in Latin, and in English, ignorance and barrenness. All which negative or privative words cannot be said properly to belong to, or signify no ideas: for then they would be perfectly insignificant sounds; but they relate to positive ideas, and signify their absence.” Locke, Essay, III.i.4; vgl. auch ebd., II.viii.2. 86 “Je ne voy point pourquoy on ne pourroit dire qu’il y a des idées privatives, comme il y a des verités negatives, car l’acte de nier est positif.” Leibniz, Nouveaux Essais, III.i.4; vgl. auch ebd., II.viii.2. Zu Leibnizs Position insgesamt s. a. A. Ros, “‘Bedeutung’, ‘Idee’ und ‘Begriff’. Zur Behandlung einiger bedeutungstheoretischer Paradoxien durch Leibniz”. 87 “And though there neither were nor had been in nature such a beast as an unicorn, or such a fish as a mermaid; yet (...) the essence of a mermaid is as intelligible as that of man (...).” Locke, Essay, III.iii.19. 42 und Ideen (Wesenheiten) von etwas, das nicht existiert, kann es nicht geben. Von der neuzeitlichen Position aus betrachtet, wäre ein analoger Schluß indes unberechtigt. Die Verständlichkeit eines generellen Ausdrucks impliziert hier nicht, daß es einen konkreten Gegenstand gibt oder gegeben hat, der in den Anwendungsbereich jenes Ausdrucks gehört. Denn man sagt zwar ebenfalls, daß die Bedeutung genereller Ausdrücke aus einer (allgemeinen) Idee bestehe. Aber diese Ideen lassen sich, ganz anders als die Ideen im Sinne Platons (beziehungsweise die Wesenheiten im Sinne Aristoteles’), vom menschlichen Verstand eigenständig herstellen. Und so kann es auch dort Ideen, und damit Verständlichkeit genereller Ausdrücke geben, wo nichts existiert beziehungsweise existiert hat, worauf sich einer dieser Ausdrücke anwenden ließe. Unmittelbar vor der soeben zitierten Stelle aus dem Essay schreibt Locke denn auch: “Stellen wir uns vor, es würde in diesem Augenblick nirgends in der Welt ein Kreis existieren (wie diese Figur vielleicht wirklich nirgends in vollkommener Form existiert), so würde gleichwohl die Idee, die mit diesem N amen verbunden ist, nicht aufhören, das zu sein, was sie ist. Sie bliebe gleichsam ein Muster, nach dem wir bestimmen könnten, welche von den einzelnen Figuren, die uns vorkommen, auf den Namen Kreis ein Anrecht haben und welche nicht. Sie würde uns zeigen, welche von ihnen, weil sie die Wesenheit besitzen, der betreffenden Art angehören. “88 Daß Locke und Leibniz sich, bei aller Gemeinsamkeit gegenüber der antiken Position, in ihrer Interpretation negativer Ausdrücke unterscheiden, liegt daran, daß Locke die konstruktiven Komponenten des Begriffs der Idee noch nicht in dem Ausmaß betont wie Leibniz. Tatsächlich neigt Locke, wie wir noch sehen werden, dazu, allgemeine Ideen in die Nähe von mentalen Bildern zu rücken – und von einem Bild zum Beispiel eines Nicht-Menschen zu reden, ist ja wirklich etwas sonderbar. Doch das ist eine Eigenheit speziell Lockes. Aus den generellen, systematisch entscheidenden Prämissen der neuzeitlichen Theorie des Begriffs folgt sie nicht. 89 Generelle Ausdrücke für einfache Begriffe Die Verständlichkeit eines generellen Ausdrucks – der Umstand, daß es einen Begriff gibt, für den er steht – schließt innerhalb des Systems neuzeitlicher Grundannahmen also nicht ein, daß es einen konkreten Gegenstand geben muß, der unter jenen Begriff fällt. Von diesem Grundsatz gibt es allerdings eine wichtige Ausnahme. Sie betrifft jene generellen Ausdrücke, die für sogenannte einfache Begriffe stehen. Zwar wird diese Ausnahme von den neuzeitlichen Autoren, so weit mir bekannt ist, nicht ausdrücklich als solche behandelt. Aber bei genauerem Hinschauen ist unschwer zu sehen, daß sie in der Tat in den neuzeitlichen Grundan88 “(...) were there now no circle existing anywhere in the world, (as perhaps that figure exists not anywhere exactly marked out,) yet the idea annexed to that name would not cease to be what it is; nor cease to be as a pattern to determine which of the particular figures we meet with have or have not a right to the name circle, and so to show which of them, by having that essence, was of that species.” Locke, Essay, III.iii.19. 89 Ich erinnere in diesem Zusammenhang nochmals an die bereits in der “Einleitung” (oben, Bd. I, S. 7) erwähnte Tatsache, daß der Begriff der negativen Zahlen in der Mathematik der Antike unbekannt war und erstmals in der oberitalienischen Renaissance begegnet. 43 nahmen enthalten ist. Betrachten wir beispielsweise die folgende Notiz Lockes aus dem zweiten Buch seines Essay: “Ich meine, es ist offensichtlich”, so schreibt Locke dort, “daß keine unserer einfachen Ideen in Hinsicht auf die Dinge, die außerhalb von uns existieren, falsch sein kann. (...) Blau und gelb, bitter und süß, können niemals falsche Ideen sein.”90 Um genauer verstehen zu können, was dies bedeutet, muß man allerdings zunächst einmal wissen, was Locke hier mit der Wahrheit beziehungsweise Falschheit einer Idee meint. Denn eigentlich, so gesteht Locke selbst zu, ist das eine etwas problematische Formulierung. Von “Wahrheit” oder “Falschheit” könne man nämlich im Grunde nur sprechen, wenn beabsichtigt ist, ein Urteil über Aussagen, und nicht über Ideen, zu fällen. Daß Äußerungen wie die soeben zitierte gleichwohl brauchbar seien, ergebe sich allein daraus, daß mit ihnen stillschweigend auf eine Aussage über die jeweils gemeinte Idee angespielt werde.91 Doch welcher Art sind die Aussagen über eine Idee, die Lockes Meinung nach in dieser indirekten Weise vollzogen werden? — Locke schlägt vor, in diesem Zusammenhang zwischen drei Arten von Aussagen zu unterscheiden. Wer sagt, daß eine bestimmte Idee “wahr” sei, der könne damit zum Ausdruck bringen, 1) daß die betreffende Idee unter derselben generellen Bezeichnung nicht nur im Geist des Sprechers der betreffenden Äußerung, sondern auch im Geist anderer Menschen existiert; 2) daß der Idee mindestens ein unter sie fallender, existierender konkreter Gegenstand entspricht (“(that the idea) is conformable to some real existence”); oder 3) daß die Idee sich auf die “reale Konstitution und Wesenheit eines Gegenstands bezieht, von dem alle seine Eigenschaften abhängen.”92 Für das, was uns im Augenblick interessiert, ist also der Fall 2) entscheidend. Und man sieht: interpretiert man unser Zitat mit seiner Hilfe, so gilt: Lockes Überzeugung nach muß es für jede einfache Idee mindestens einen konkreten Gegenstand geben, der unter sie fällt. Überdies können wir zusätzlich schließen: da einen generellen Ausdruck verstehen heißt: wissen, welche generelle Idee er bedeutet, muß die Verständlichkeit eines Ausdrucks für eine einfache allgemeine Idee in der Tat, wie vorhin behauptet, die Existenz zumindest einer Instanz einschließen, auf die sich jener Ausdruck anwenden läßt. Genauer betrachtet ist dies nun freilich eine Position, die zu gewissen, sagen wir: Wunderlichkeiten führt. Angenommen nämlich, wir fassen, ebenso wie Locke, ein Farbwort wie “gelb” als ein Wort für eine einfache (allgemeine) Idee auf. Und angenommen, wir formulieren eine Aussage mit einem Satz wie (1) “Gelbes existiert” 90 “I think it evident that our simple ideas can none of them be false in respect of things existing without us. (...) Blue and yellow, bitter or sweet, can never be false ideas.” Locke, Essay, II.xxxii.16. 91 Locke, Essay, II.xxxii.1. 92 Locke, Essay, II.xxxii.4-5. 44 Dann folgt hier aus der bloßen Verständlichkeit der Aussage auch schon ihre Wahrheit. Und das entspricht dem Verhältnis, in dem wir die Wörter “Verständlichkeit” und “Wahrheit” sonst zueinander zu sehen gewohnt sind, natürlich ganz und gar nicht Dabei ist dies noch nicht einmal alles. Denn stellen wir uns beispielsweise vor, wir formulieren eine Aussage, in der ein Satz wie (1) in negierter Weise verwendet wird, so nämlich: (2) “Gelbes existiert nicht” Dann ergibt sich das eigentümliche Resultat, daß im Falle der Wahrheit dieser Aussage geschlossen werden müßte, wir könnten sie nicht verstehen. Und das wäre wiederum eine Situation, in der sich das Verhältnis zwischen Wahrheit und Verständlichkeit einer Aussage ganz anders darstellt, als wir es zu erwarten gewohnt sind. Denn wir würden ja normalerweise sagen, daß nur eine verständliche Aussage eine wahre Aussage sein kann. Wobei darüber hinaus, um nochmals auf das Absonderliche des Falls (1) zurückzukommen, für uns normalerweise gilt, daß wir die Verständlichkeit einer Aussage lediglich als eine notwendige, nicht aber auch schon als eine hinreichende Bedingung für ihre Wahrheit auffassen. Gründe für das neuzeitliche Verständnis genereller Ausdrücke für Einfaches Doch wozu überhaupt diese Ausnahme von dem sonst befolgten Grundsatz, daß die Verständlichkeit eines generellen Ausdrucks die jetzige oder auch frühere Existenz einer mit diesem Ausdruck charakterisierbaren Instanz nicht einschließt? — Um dies begreifen zu können, braucht man sich lediglich vor Augen zu führen, daß die einfachen Begriffe beziehungsweise Ideen für die neuzeitlichen Autoren gewissermaßen die nicht mehr weiter zerlegbaren Bausteine abgeben, aus denen die komplexen Begriffe zusammengesetzt werden können. Denn was wäre, angesichts dieses Umstands, die Folge, wenn es nichts gäbe, was unter die einfachen Begriffe fällt? — Das hätte zur Konsequenz, daß kein einziger Begriff in der Lage wäre, die Funktion zu erfüllen, deretwegen Begriffe der neuzeitlichen Auffassung nach doch gerade erzeugt werden, einfach, weil derartige Begriffe dann in jedem Fall gewissermaßen ins Leere greifen ließen. Die einfachen Begriffe hätten diesen Defekt, und ebenso alle komplexen Begriffe, da diese sich ja aus jenen zusammensetzen sollen. Dieser Sachverhalt gewinnt noch zusätzlich an Gewicht, wenn man ihn vor dem philosophiehistorischen Hintergrund der Ausführungen der Autoren des 17. Jahrhunderts sieht, vor dem Hintergrund der Bemühungen also, sich vom spätmittelalterlichen Skeptizismus zu distanzieren. Hätte man zugestanden, daß aus der Verständlichkeit von Ausdrücken für einfache Begriffe die Existenz entsprechender Instanzen nicht notwendig folgt, hätte man ja genau den Akt wieder zurückgenommen, mit dem man gegen die Position aufbegehrt hatte, die zum Beispiel von Ockham entwickelt worden war. Denn für jemanden wie Ockham war es durchaus denkbar, daß der allmächtige Gott die Menschen mit Begriffen versehen hat, welche ihnen die Sicht auf die von Gott geschaffene Welt gänzlich verwehren. Aber wegen der damit verbundenen, theologisch vielleicht erwünschten, für das 45 das Leben der Menschen in dieser Welt aber sich katastrophal auswirkenden Folgen hatte man schließlich gerade den “new way of ideas” zu bahnen versucht. Der Begriff der einfachen allgemeinen Ideen, der einfachen Begriffe, markiert also einen für den Übergang von der mittelalterlichen Philosophie zur neuzeitlichen besonders neuralgischen Punkt. Kein Wunder daher, daß sich in den Texten jener Zeit zahlreiche Hinweise auf diesen Zusammenhang finden. So schreibt zum Beispiel Descartes zwar in einer Stelle seiner Meditationes de prima philosophia zunächst: auch wenn ein Maler Fabelwesen darstellt, könne er dies doch nur, indem er dabei Farben benutze, die “wahr” sind. Und “aus demselben Grunde muß man, auch wenn sogar dies Allgemeine: Augen, Haupt, Hände und dergleichen nur eingebildet sein könnte, doch notwendig gestehen, daß wenigstens gewisse andere, noch einfachere und allgemeinere Dinge wahr sind, mit denen als den wahren Farben alle jene wahren oder falschen Bilder von Dingen in unserem Bewußtsein gemalt sind. “93 Aber in seinem Bemühen, den Gottesbegriff, dessen Auflösung er letztlich anstrebt, vor seiner Destruktion besonders deutlich auszumalen, fährt Descartes fort: “Es ist indessen in meinem Denken eine alte Überzeugung verwurzelt, daß es einen Gott gebe, der alles vermag, und von dem ich so, wie ich bin, geschaffen wurde. Woher weiß ich aber, ob er nicht bewirkt hat, daß es überhaupt keine Erde, keinen Himmel, kein ausgedehntes Ding, keine Gestalt, keine Größe, keinen Ort gibt und daß dennoch dies alles genau so, wie es mir jetzt vorkommt, bloß da zu sein scheint; ja sogar auch, so wie ich überzeugt bin, daß andere sich bisweilen in dem irren, was sie vollkommen zu wissen meinen, ebenso könnte ich mich täuschen, sooft ich 2 und 3 addiere oder die Seiten des Quadrats zähle, oder was man sich noch leichteres denken mag.”94 Und erst der weitere Fortgang der Meditationes zeigt dann, jedenfalls Descartes’ Absichten nach, daß derartige Bedenken entkräftet werden können. Was Locke angeht, so ist die Abkehr von diesem Gottesbegriff für ihn bereits eine vollzogene Sache. Und so zögert er denn auch nicht, dem von ihm noch unterstellten Gott allerhand Aktivitäten zuzuschreiben, welche dem Menschen gerade im Hinblick auf seine einfachen allgemeinen Ideen dienlich sind: “Unsere einfachen Ideen sind lediglich solche Wahrnehmungen, zu deren Empfang uns Gott ausgerüstet hat. Den äußeren Objekten aber hat er die Kraft verliehen, diese Wahrnehmungen nach feststehenden Gesetzen und auf bestimmten Wegen, die uns zwar unbegreiflich, dennoch 93 “Nec dispari ratione, quamvis etiam generalia haec, oculi, caput, manus, et similia, imaginaria esse possent, necessario tamen saltem alia quaedam adhuc magis simplicia, et universalia vera esse fatendum est, ex quibus tanquam coloribus veris omnes istae seu verae seu falsae, quae in cogitatione nostra sunt, rerum imagines effinguntur.” Descartes, Meditationes de prima philosophia, 1.6. 94 “Verumtamen infixa quaedam est mea menti vetus opinio, Deum esse qui potest omnia, et a quo talis, qualis existo, sum creatus: unde autem scio illum non fecisse ut nulla plane sit terra, nullum caelum, nulla res extensa, nulla figura, nulla magnitudo, nullus locus, et tamen haec omnia non aliter quam nunc mihi videantur existere? Imo etiam quemadmodum judico interdum alios errare circa ea, quae se perfectissime scire arbitrantur, ita ego ut fallar quoties duo et tria simul addo, vel numero quadrati latera, vel si quid aliud facilius fingi potest?” Descartes, Meditationes de prima philosophia, 1.9. 46 aber seiner Weisheit und Güte angemessen sind, in uns zu erzeugen. Ihre Wahrheit besteht daher in nichts anderem als in den Erscheinungen, die in uns erzeugt werden; diese aber müssen den Kräften entsprechen, die Gott in die äußeren Objekte gelegt hat, denn sonst könnten sie nicht in uns erzeugt werden. Indem sie so diesen Kräften entsprechen, sind sie, was sie sein sollen, nämlich wahre Ideen. “95 Lediglich Leibniz scheint, überraschenderweise, an einigen Stellen seiner Darlegungen von der auf solchen Gedanken fußenden Auffassung über die Beziehungen zwischen einfachen allgemeinen Ideen, der Bedeutung und dem Verstehen entsprechender genereller Ausdrücke, sowie der Existenz von konkreten Gegenständen einer bestimmten Art abzuweichen.96 Aber Leibnizs Ausführungen über den Begriff der einfachen Idee werfen so zahlreiche spezielle Probleme auf, daß es sich für uns empfiehlt, sie innerhalb des bloßen Überblicksversuchs, wie wir ihn hier verfolgen, beiseite zu lassen. Generelle Ausdrücke für Widersprüchliches Bleibt noch die Frage, wie es sich von den Grundannahmen der neuzeitlichen Philosophie aus betrachtet mit der Beziehung zwischen Begriffen, der Bedeutung eines generellen Ausdrucks und dem Verstehen eines solchen Ausdrucks verhält, sobald dieser Ausdruck für etwas Widersprüchliches steht – wie im Fall des Worts “Kreisviereck” also. Als ich vorhin (S. 44) Lockes Bemerkung zitiert habe, in der er von der Möglichkeit spricht, die allgemeinen Ideen (und damit die entsprechenden generellen Ausdrücke) des Einhorns oder auch der Seejungfrau zu verstehen, habe ich einen bestimmten Zusatz Lockes ausgelassen. Locke schränkt seine These nämlich in Wirklichkeit etwas ein. Er sagt: diese Ideen könne man unter der Bedingung verstehen, daß ihre Namen komplexe abstrakte Ideen repräsentieren, welche keinen Widerspruch in sich enthalten (supposing those names to stand for complex abstract ideas that contained no inconsistency in them). Betrachten wir, bevor wie diesen Zusatz auszuwerten versuchen, noch eine weitere Äußerung, diesmal von Leibniz. In seiner kurzen Abhandlung mit dem Titel “Meditationes de Cognitione, Veritate et Ideis” – die 1684 zum ersten mal gedruckt wurde – schreibt er: “Es kommt freilich häufig vor, daß wir irrtümlich glauben, Ideen von Gegenständen in unserer Seele zu haben, indem wir fälschlich annehmen, wir hätten gewisse Bezeichnungen, die wir anwenden, bereits erklärt. Falsch nämlich, oder doch nicht ohne Zweideutigkeit, ist die Behauptung, wir könnten nicht – mit Verständnis dessen, was wir sagen – über einen 95 “(...) our simple ideas, being barely such perceptions as God has fitted us to receive, and given power to external objects to produce in us by established laws and ways, suitable to his wisdom and goodness, though incomprehensible to us, their truth consists in nothing else but in such appearances as are produced in us, and must be suitable to those powers he has placed in external objects or else they could not be produced in us: and thus answering those powers, they are what they should be, true ideas.” Locke, Essay, II.xxxii.13. 96 In den Nouveaux Essais (III.iv.2) bemerkt Theophilus, der Sprecher Leibnizs, gegenüber der Auffassung, daß eine einfache Idee für zumindest einen existierenden konkreten Gegenstand stehen müsse: “Ich sehe nicht ein, daß dies notwendig ist. Gott besitzt die Ideen dieser Art, bevor er die Gegenstände dieser Ideen geschaffen hat, und nichts hindert, daß er verständigen Kreaturen solche Ideen auch mitteilen könne; ja es gibt nicht einmal einen bündigen Beweis dafür, daß die Gegenstände unserer Sinne und der einfachen Ideen, die die Sinne uns vergegenwärtigen, außer uns vorhanden sind.” 47 hauptung, wir könnten nicht – mit Verständnis dessen, was wir sagen – über einen Gegenstand sprechen, von dem wir keine Idee besitzen. Denn oft verstehen wir zwar die einzelnen Worte, oder erinnern uns, sie früher einmal verstanden zu haben; da. wir uns jedoch mit dieser blinden Erkenntnis begnügen und die Auflösung der Begriffe nicht weit genug treiben, kommt es vor, daß uns ein Widerspruch verborgen bleibt, der womöglich in dem zusammengesetzten Begriff enthalten ist.”97 Wie soll man diese Äußerungen interpretieren? Locke hält es offensichtlich für sinnvoll, zu sagen, daß eine komplexe abstrakte Idee einen Widerspruch in sich bergen könne, meint aber zusätzlich, diese Idee lasse sich dann nicht verstehen. Das Wort “Kreisviereck” zum Beispiel wäre also, so müßte man daraus ableiten, für Locke etwas, was eine bestimmte Bedeutung hat (es steht ja für eine abstrakte, wenn auch widersprüchliche Idee); nur könnte man diese Bedeutung nicht verstehen – zweifellos ein Indiz dafür, daß Locke an dieser Stelle seine Schwierigkeiten hat. Und Leibnizs Bemerkung? Im Gegensatz zu Locke möchte er, wie man dem Text entnehmen kann, vermeiden, zu sagen, daß Ideen einen Widerspruch in sich bergen können. Auf der anderen Seite hält er es aber auch für zulässig, davon zu sprechen, daß man verstehen könne, was man sagt, wenn man von etwas Widersprüchlichem redet.98 Und das drängt natürlich die Frage auf, was man denn in einem solchen Fall Leibnizs Meinung nach versteht, da es doch keine Idee sein kann. Sieht man genauer zu, so zeigt sich, daß die Antwort auf diese Frage in unserem Text bereits enthalten ist: das, was ein genereller Ausdruck für etwas Widersprüchliches bedeutet, ist keine Idee, sondern ein Begriff. Und Begriffe können, so ergibt sich aus Leibnizs Darlegungen, im Gegensatz zu Ideen offensichtlich widersprüchlich sein. 97 “Et sane contingit, ut nos saepe falso creamus haberein animo ideas rerum, cum falso supponimus aliquos terminos, quibus utimur, jam a nobis fuisse explicatos: nec verum aut certe ambiguitati obnoxium est, quod ajunt aliqui, non posse nos de re aliqua dicere, intelligendo quod dicimus, quin ejus habeamus ideam. Saepe enim vocabula ista singula utcunque intelligimus, aut nos antea intellexisse meminimus, quia tamen hac cogitatione caeca contenti sumus et resolutionem notionum non satis prosequimur, fit ut lateat nos contradictio, quam forte notio composita involvit.” Leibniz, “Meditationes de Cognitione, Veritate et Ideis” (GP, Bd. IV, S. 424). Leibniz dürfte sich hier gegen die Cartesianer Arnauld und Nicole wenden, die in ihrer Logique behaupten, es gelte, “daß wir (wenn wir verstehen, was wir sagen) nichts durch unsre Worte ausdrücken können, ohne daß dabei zugleich die Gewißheit besteht, daß wir in unserem Inneren im Besitz der Idee des Dinges, die wir durch unsere Worte bezeichnen, sind, obwohl diese Idee bald klarer und deutlicher, bald dunkler und verworrener sein kann, wie wir es weiter unten erklären werden. Es würde sonst nämlich ein Widerspruch sich ergeben zwischen der Behauptung, daß ich das, was ich beim Aussprechen eines Wortes sage, verstehe, und der These, daß ich trotzdem beim Aussprechen des Wortes auf nichts anderes ausgerichtet bin als den reinen Schall des Wortes. (... que nous ne pouvons rien exprimer par nos paroles lorsque nous entendons ce que nous disons, que de cela même il ne soit certain que nous avons en nous l’idée de la chose que nous signifions par nos paroles, quoy que cette idée soit quelquefois plus claire & plus distincte, & quelquefois plus obscure & plus confuse, comme nous expliquerons plus bas. Car il y auroit de la contradiction entre dire que je sçay ce que je dis ein prononçant un mot, & que neanmoins je ne conçois rien en le prononçant que le son même du mot.)” A. Arnauld, P. Nicole, Logique, S.39 (dt. S. 29). 98 So auch ausdrücklich in einem Brief Leibnizs an Eckhard: “(...) diejenigen, die von der absolut größten Geschwindigkeit sprechen, reden nicht wie die Papageien, auch wenn sie von etwas sprechen, dem kein möglicher Begriff zugrunde liegt. (... qui dicunt Maximam velocitatem, non loquuntur ut psittaci, etsi aliquid dicant, cui nulla subest notio possibilis.)” Leibniz, GP, Bd. I, S. 268. Und in den “Meditationes de Cognitione” (GP, Bd. IV, S.424) kommentiert Leibniz dasselbe Beispiel mit den Worten: “Wir verstehen nämlich das, was wir (sc. mit solchen Formulierungen) sagen, obwohl wir keine Idee unmöglicher Dinge haben. (Intelligimus enim utique quid dicamus, et tamen nullam utique habemus ideam rerum impossibilium.)” 48 Aber haben wir die Wörter “(allgemeine) Idee” und “Begriff’ bisher bei unserer Interpretation der Schriften neuzeitlicher Autoren nicht immer als im wesentlichen äquivalent behandelt? — Bis zu einem gewissen Grade schon. Doch erinnern wir uns daran, daß wir uns weiter oben (S. 11 und S. 25) genötigt gesehen haben, zwischen zwei Bedeutungen von “Begriff” zu unterscheiden, und daß dieser Unterschied bei Leibniz in seinem Vorschlag zum Ausdruck kam, man möge doch zwischen “Ideen” und “Begriffen” differenzieren (s.o., S. 25). Behält man dies im Auge, so ist, meine ich, unser Deutungsproblem gelöst. Denn Begriffe sind in diesem Zusammenhang für Leibniz, im Gegensatz zu den von der menschlichen Seele beziehungsweise Gott hervorgebrachten Ideen, das, was die einzelnen, historischen Menschen erzeugen. Die Menschen aber können natürlich, anders als Gott bei der Erschaffung von Ideen, Fehler begehen. Und ein solches fehlerhaftes, das heißt in diesem Zusammenhang: widersprüchlich gebildetes Produkt ist es, worauf man nach Leibnizs Auffassung kommt, wenn man einen generellen Ausdruck für Widersprüchliches versteht. Widersprüchlichkeit schließt mithin für Leibniz nicht aus, daß man den Weg rekonstruieren kann, der zur Erzeugung des betreffenden Widerspruchs führt. Und wer dies kann, der ist auch in der Lage, die Bedeutung eines generellen Ausdrucks zu verstehen, der etwas Widersprüchliches repräsentiert. In der Literatur zu Leibniz ist die Pointe seiner Unterscheidung zwischen Idee und Begriff, soweit sie für das Konzept der Verstehbarkeit genereller Ausdrücke für Widersprüchliches relevant ist, bisher nicht immer richtig gesehen worden. G. Martin zum Beispiel behauptet, für Leibniz sei das Wort “Dekaeder” – das heißt also, ein Wort für einen Körper, der von zehn regelmäßigen Vielecken begrenzt ist – aufgrund der Widersprüchlichkeit dessen, worauf es anspielt, ein “bloßer Klang ohne Sinn und Bedeutung”.99 Aber das läßt sich nun einmal nicht damit vereinbaren, daß Leibniz wiederholt sagt, derartige Wörter könne man durchaus verstehen. Und selbst A. Gurwitsch schreibt in seinem sonst sehr hilfreichen Werk über Leibniz, Wörtern für Widersprüchliches könnten dessen Überzeugung nach “keine Ideen oder Begriffe entsprechen, wie Leibniz diese Termini versteht”100 – ohne zu beachten, daß und in welcher Weise Leibniz zwischen Ideen und Begriffen unterscheidet. Dabei hätte doch eigentlich schon der Umstand, daß Leibniz gar keine Bedenken hat, von “unmöglichen Begriffen” – aber eben nicht: “unmöglichen Ideen” – zu sprechen, aufmerken lassen müssen.101 Im übrigen ist noch zu berücksichtigen, daß Leibniz von generellen Ausdrücken für Widersprüchliches jene Wörter unterscheidet, die schlicht sinnlos sind, Wörter wie das aus Diskussionen der Scholastik zu diesem Fragenkomplex bekannte “Blitiri” zum Beispiel.102 99 G. Martin, Leibniz, S. 86 (mit Bezug auf die Nouveaux Essais, III.vi.28). A. Gurwitsch, Leibniz, S. 59. 101 Zum Beleg für “notio impossibilis” bei Leibniz vgl. zum Beispiel, neben zahlreichen anderen Stellen, den § 66 von Leibnizs Generales Inquisitiones sowie den § 25 des Discours de Metaphysique. 102 Vgl. dazu die “Introductio ad Encyclopaediam arcanam”, abgedr. in Leibniz, Opuseules et fragments inedits, hrsg. von L. Couturat, S. 512. 100 49 Kant über generelle Ausdrücke für Widersprüchliches Schließen wir dieses Kapitel ab mit einem Hinweis auf eine bemerkenswerte Passage aus einer Schrift, die 1766, also gut achtzig Jahre nach Leibnizs “Meditationes de Cognitione, Veritate et Ideis”, in Königsberg erschienen ist: eine Passage aus Kants Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik. Ausgangspunkt dieser Schrift ist Kants Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Begriffs des Geistes, so, wie dieser in der damaligen akademischen Philosophie benutzt wurde. Und daß dieser Zweifel sich auch darauf richtet, was das entsprechende Wort bedeutet, das ist ein Zusammenhang, auf den Kant gleich zu Beginn seiner Ausführungen aufmerksam macht: “Das methodische Geschwätz der hohen Schulen”, so meint er, “ist oftmals nur ein Einverständnis, durch veränderliche Wortbedeutungen einer schwer zu lösenden Frage auszuweichen, weil das bequeme und mehrenteils vernünftige: Ich weiß nicht, auf Akademien nicht leichtlich gehöret wird.”103 Trotz aller Widersprüchlichkeit, die dem Begriff des Geistes anhafte, sei eines nun allerdings, so fährt Kant fort, nicht zu bestreiten: “Da ich (sc. dieses Wort) indessen oft selbst gebraucht oder andere habe brauchen hören, so muß doch etwas darunter verstanden werden, es mag nun dieses Etwas ein Hirngespinst oder was Wirkliches sein.”104 Doch was mag das sein, was man in einem solchen Falle versteht? — Kants Antwort auf diese Frage lautet zunächst: ein (widersprüchlicher) Begriff. Das ist also noch ganz wie bei Leibniz. Bei seinem Versuch, das aufzudecken, woher solche mißratenen Begriffe stammen, gelangt Kant dann indes zu der folgenden Überlegung: “viele Begriffe entspringen durch geheime und dunkle Schlüsse bei Gelegenheit der Erfahrung, und pflanzen sich nachher auf andere fort ohne Bewußtsein der Erfahrung selbst oder des Schlusses, welcher den Begriff über dieselbe errichtet hat. Solche Begriffe kann man erschlichene nennen. Dergleichen sind viele, die zum Teil nichts als ein Wahn der Einbildung, zum Teil auch wahr sein, indem auch dunkele Schlüsse nicht immer irren. Der Redegebrauch und die Verbindung eines Ausdrucks mit verschiedenen Erzählungen, in denen jederzeit einerlei Hauptmerkmal anzutreffen ist, geben ihm eine bestimmte Bedeutung, welche folglich nur dadurch kann entfaltet werden, daß man diesen versteckten Sinn durch eine Vergleichung mit allerlei Fällen der Anwendung, die ihm einstimmig sein oder ihm widerstreiten, aus seiner Dunkelheit hervorzieht. “105 Wir haben bisher gesehen, daß sprachliche Ausdrücke innerhalb der neuzeitlichen Philosophie immer nur in medialer und nicht in sachlicher Hinsicht für den Begriff des Begriffs wichtig sind. Kant hingegen nähert sich hier einer anderen Auffassung an: bei den “erschlichenen” Begriffen zumindest – und folglich auch bei den Bedeutungen der entsprechenden generellen Ausdrücke –, sieht es so aus, als sei der “Redegebrauch” etwas, was den jeweiligen Begriff nicht allein mehr oder minder gut darstellen hilft, sondern ihn mitbestimmt. Freilich ist es innerhalb des Gesamtwerks Kants bei einer solchen vereinzelten, und hinsichtlich ihrer Folgen wohl auch kaum weiter bedachten Abweichung vom üblichen neuzeitlichen Verständnis der Beziehung zwischen Begriffen und sprachlichen Mitteln geblieben. 103 Kant, Träume eines Geistersehers, in: Kant, Werke, hrsg. von W. Weischedel, Bd. 11, S. 925. Kant, Träume eines Geistersehers, in: Kant, Werke, hrsg. von W. Weischedel, Bd. 11, S. 926. 105 Kant, Träume eines Geistersehers (Werke, hrsg. von W. Weischedel, Bd. 11, S. 926). 104 50 Auszug aus: Arno Ros: Begründung und Begriff. Wandlungen des Verständnisses begrifflicher Argumentationen. Bd. II: Neuzeit. Hamburg: Meiner, 1990. (S. 1–53) 51