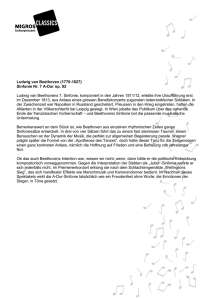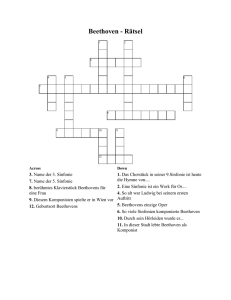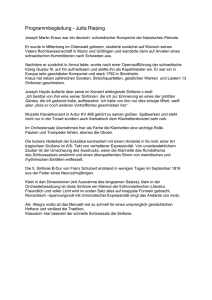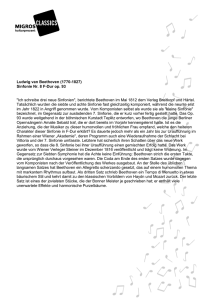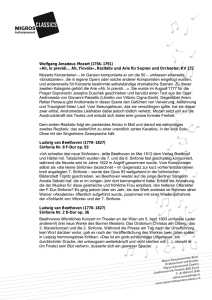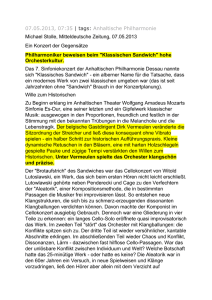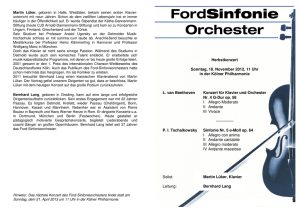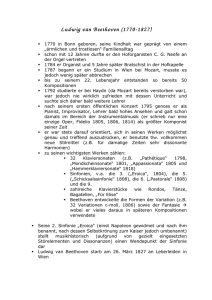Kluges zum Programm!
Werbung

Römische Geschichte in Tönen Ludwi g v an B eet hov en: O uv er t ür e zu „C or i ol an“ Es gibt musikalische Gattungen, die scheinen, wie einst ein Getränkehersteller für seine verwendeten Flaschen warb, „unkaputtbar“. Spitzenreiter: die Oper. Seit über 400 Jahren geschrieben, komponiert und aufgeführt, und trotz aller Wandlungen im Ausdruck und im Sujet, trotz veränderter sozialer und politischer Umstände nie gefährdet. Andere Gattungen existierten dagegen vergleichsweise kurz: das Madrigal der Renaissance, das Gruppenkonzert des Barock oder die Sinfonia concertante der Wiener Klassik. Zu diesen kurzlebigen Gattungen gehört außerdem die Schauspielmusik. Dabei wurde ein Theaterstück mit einzelnen Musiknummern angereichert: mit Zwischenaktmusiken, einzelnen Arien oder Chorstücken. Manche dieser Schauspielmusiken sind in Teilen bis heute populär, wenn auch meist nicht mehr unter diesem Gattungsbegriff. Dazu gehören Peer Gynt von Edvard Grieg (1843–1907) sowie Ein Sommernachtstraum von Felix Mendelssohn (1809– 1847). Kennt bei Letzterem noch mancher den Tanz von Rüpeln und nahezu jeder den Hochzeitsmarsch, bleibt bei den meisten anderen Schauspielmusiken nur das eröffnende Orchesterstück in Erinnerung: die Ouvertüre, und dabei insbesondere jene aus Beethovens (1770–1827) Feder. Neben den Ruinen von Athen und König Stephan (beide 1811) hat sich vor allem diejenige zu Egmont (1810) einen festen Platz im Konzertsaal erobert. Und die Coriolan-Ouvertüre? Dahinter verbirgt sich eine weitere Besonderheit: Eine Ouvertüre für ein Schauspiel, ohne dass es weitere Musik dazu gegeben hätte. Der römische Patrizier Gaius Marcius Coriolanus, kurz Coriolan (vor -527 bis -488) ist Hauptfigur eines Schauspiels des heute weitgehend vergessenen Schriftstellers Heinrich Joseph von Collin (1771–1811). Coriolan, dem mit Coriolanus auch Shakespeare eine Tragödie widmete, wird trotz zahlreicher Verdienste um seine Vaterstadt nach einem Machtwechsel aus Rom verbannt. Aus Rache verbündet er sich mit Feinden Roms, um seine eigene Stadt anzugreifen. Als die Bevölkerung ihre Niederlage kommen sieht, macht sich eine Delegation auf, Coriolan zur Umkehr zu bewegen, darunter neben seiner Ehefrau auch seine Mutter. Es ist insbesondere das Verhältnis zwischen Coriolan und seiner Mutter, das Beethoven zur musikalischen Ausformung seiner Ouvertüre heranzieht. Beginnend mit einem Unisono-C zeigt sich mit herrischer Strenge die eine Seite des Coriolan, aufgewühlt und zweifelnd mit dem eigentlichen ersten Thema die andere Seite. Das zweite, sanfte Thema gehört dagegen der Mutter, die ihn zunächst anfleht, später dann an seine Pflichten als Patrizier erinnert und ihn davon überzeugt, von seinem Plan Abstand zu nehmen. Während Coriolan bei Shakespeare ermordet wird, begeht er bei Collin Selbstmord, hin- und hergerissen zwischen seinen Pflichten gegenüber seinen Verbündeten, den Angreifern und jenen gegenüber seinem Volk und seiner Familie. Beethovens Musik endet entsprechend weder mit einer Freudenfeier noch mit einer Siegessinfonie, sondern im absoluten Pianissimo. Beethovens Ouvertüre erlebte ihre Uraufführung 1807 gemeinsam mit der vierten Sinfonie und dem vierten Klavierkonzert in einem Privatkonzert bei Fürst Franz Joseph Maximilian Lobkowitz (1772– 1816), einem der großen Gönner Beethovens. Ob sie je in Zusammenhang mit dem Schauspiel erklang (was machen die Musiker den Rest des Abends?), ist nicht bekannt. Vermutlich war dies auch nie beabsichtigt. Als Beethoven die Ouvertüre schrieb, war das fünf Jahre alte Schauspiel längst von den Spielplänen verschwunden und vergessen. Beethoven schuf aber so etwas wie eine neue Gattung: Die in sich geschlossene Konzertouvertüre, die sich auch unabhängig von einem möglichen Inhalt hören lässt. In Mendelssohn und vielen anderen fand er begeisterte Nachahmer. | Nic olas Furc hert Spektakuläre Solisten: Marimba und Percussion K e i k o A b é : T H E W A V E I mp r e s s i o n s S p e zi al - V e r s i o n f ü r S c h l a g ze u g e n s e mb l e u n d O r c h e s t e r Das Konzert mit einem einzelnen Solisten ist etwa 100 Jahre jünger als die Oper und entwickelte sich in Italien. Das 1698 durch Giuseppe Torelli erste veröffentlichte Violinkonzert überlebte zwar nur als musikhistorische Fußnote. Doch schon bald erreichte das Solokonzert durch Antonio Vivaldi (1678– 1741) einen ersten Höhepunkt. Vivaldi komponierte dabei neben den berühmten Vier Jahreszeiten nicht nur über 200 weitere Violinkonzerte, sondern auch Konzerte für Fagott, Flöte, Oboe, Cello und Viola d’amore. Während sich die Komponisten im 19. Jahrhundert fast ausschließlich auf die Violine und das Klavier als Soloinstrumente konzentrierten, erhielten im 20. Jahrhundert auch zahlreiche andere eine Chance. Im Zuge der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten am Ende der Romantik, der Emanzipation des Schlagzeugs und dem aufkommenden Jazz waren plötzlich nicht mehr nur klassische Instrumente gefragt. Zu diesen neuen Instrumenten gehört auch das Marimbafon, kurz Marimba. Im Gegensatz zum bekannteren Xylofon produzieren seine dünneren und weicheren Klangstäbe einen dunkleren und kräftigeren Klang. (Marimba und Xylofon wiederum unterscheiden sich vom Vibrafon mit aus Metall gefertigten Klangstäben.) Unter den Klangstäben sind Resonanzrohre angebracht, die dem Instrument deutlich mehr Volumen verleihen, als es mancher vom kleinen Xylofon aus Kindertagen gewohnt ist. Das früheste Konzert für Marimba stammt von Paul Creston und entstand 1940. Ist es in dieser Zeit noch oft das Moment des Exotischen, mit dem diese Werke für sich werben konnten, entstand erst nach 1980 eine größere Anzahl, darunter auch THE WAVE der bekanntesten japanischen Marimbaspielerin Keiko Abé (geb. 1937). Bereits im Alter von 13 Jahren trat sie als Solistin im Radio auf, gründete 1962 das Xebec Marimba Trio, mit dem sie Arrangements von Pop- und Volksmusik aufführte, und moderierte eigene Sendungen im japanischen Radio und Fernsehen. Bis heute ist sie gefragte Expertin für den Bau von Marimbas, deren Tonumfang in den 1970er-Jahren von vier auf fünf Oktaven erweitert wurde, heute Standard für Solisten. Als erste Frau wurde sie 1993 in die Percussive Arts Society Hall of Fame eingeführt. THE WAVE Impressions (Die Welle oder Woge – Impressionen) aus dem Jahr 2002 ist ursprünglich für Marimba-Ensemble und zwei Schlagzeuger geschrieben, doch existiert inzwischen auch eine Fassung für Marimba und Orchester sowie die heute Abend gespielte für Schlagzeugensemble und Orchester. Das Werk ist deutlich erkennbar gegliedert. Der Einleitung mit freien Rhythmen und an japanische Volkslieder erinnernde Melodik folgt ein lebhafter Teil, dessen Ausdruck sich zunehmend steigert. Die anschließende Episode bleibt weitgehend ruhig, fast meditativ. Eine Solokadenz beendet diesen Teil. Den Abschluss des Werks bildet eine lebhafte Passage mit vielen Taktwechseln. THE WAVE steht mit seinen einerseits nahtlos ineinander übergehenden, andererseits gut zu unterscheidenden Teilen zwischen der traditionellen, bereits bei Vivaldi ausgeprägten dreisätzigen Konzertform und dem einsätzigen Konzertstück. Nicht nur das Soloinstrument, sondern auch die verwendeten Harmonien und unregelmäßigen Takte verleihen ihm eine exotische Färbung. Zusammen mit der gemäßigt modernen Tonsprache erinnern sie an einen großen französischen Komponisten, der mit ebenso exotischem Kolorit seine Begeisterung für fernöstliche Kultur zum Ausdruck brachte: Claude Debussy (1862–1918). Er war es auch, der für ein thematisch ganz ähnliches Werk, La Mer (Das Meer), den Holzschnitt eines japanischen Künstlers für das Deckblatt einer Notenausgabe verwendete: Katsushika Hokusais Die große Woge (ca. 1830). | Nic olas Furc hert Die Klangwelt eines Exzentrikers A l e x a n d e r S k r j a b i n : S i n f o n i e N r . 2 c- M ol l Ginge es nach Richard Wagner (1813–86), hätte es die Gattung Sinfonie nur rund 80 Jahre gegeben. Entstanden aus der italienischen Opernouvertüre, der Sinfonia, entwickelte sie sich Mitte des 18. Jahrhunderts zum bedeutendsten rein instrumentalen Werk in zunächst drei, später immer häufiger vier Sätzen. Auch wenn der rasante Aufschwung dieser Gattung viele Zeitgenossen überforderte – Berichte voller Unverständnis sind dafür ebenso Zeugen wie durch Arien unterbrochene oder gleich auf nur einen Satz zusammengestrichene Aufführungen –, stand die Sinfonie seit Beethoven (1770– 1827) als repräsentative Gattung gleichberechtigt neben der Oper. Für Wagner ist insbesondere Beethovens Neunte (1824) mit dem großen Chorfinale allerdings nicht nur Höhe-, sondern gleichzeitig Endpunkt der Gattung. Es lag nicht nur, aber auch an Wagners Großspurigkeit und Einfluss, dass sich insbesondere in Deutschland Komponisten schwer taten, die Form der Sinfonie nach Beethoven weiterzuentwickeln. Wagner selbst sah darin keinen Sinn und konzentrierte sich auf die Oper. Die „übliche“ Form einer Sinfonie hatte sich dabei mehr oder weniger „von selbst“ ergeben und wurde erst um 1840 – über zehn Jahre nach Beethovens Tod – erstmals theoretisch festgehalten. Danach steht am Beginn ein sogenannter Sonatensatz mit zwei kontrastierenden Themen. Es folgt ein langsamer Satz, oft mit abweichendem Mittelteil. An dritter Stelle steht ein tänzerischer Satz in gemäßigtem Tempo (Menuett), seit Beethoven auch oftmals in schnellem Tempo (Scherzo). Der vierte Satz, meist wie der erste schnell und mit kontrastierenden Themen, bildet das Finale und damit den Abschluss. Dieser hier stark vereinfacht dargestellte Aufbau einer Sinfonie wäre einigermaßen vorhersehbar und vielleicht auch irgendwann langweilig, würde der schematische Ablauf nicht immer wieder auf Neue infrage gestellt, verändert und/oder erweitert. In dieser Tradition steht auch der russische Komponist Alexander Skrjabin (1872–1915). Als herausragender Pianist feierte er – stets mit seinen eigenen Werken – international Triumphe. Als Farb-Synästhet erlebte er jeden Klang in Verbindung mit einer bestimmten Farbe verbunden. Für sein Werk Prométhée – Le Poème du feu (Prometheus – Das Gedicht des Feuers, 1910) forderte er ein Farbenklavier, das sich damals jedoch nicht adäquat umsetzen ließ. Beeinflusst von Wagners versuchter Einheit aus Musik, Text, Bühnenbild und Licht, die heute meist als „Gesamtkunstwerk“ bezeichnet wird, plante Skrjabin zuletzt ein „Mysterium“. Danach sollte in den Ausläufern des Himalaja ein Werk aus Text, Musik, Farbe, Duft, Berührungen, Tanz und bewegter Architektur mindestens sieben Tage wiederholt werden, bis Zuschauer wie Ausführende in kollektive Ekstase versetzt worden wären und so – während um sie herum die Welt untergeht – in eine höhere Bewusstseinsebene eintreten. Als Pianist in der Mitte sah Skrjabin zunächst sich selbst, nahm von diesem Plan jedoch wieder Abstand. Ob er sich in diesem Zusammenhang wirklich als eine Art Messias verstand, insbesondere aufgrund seines Geburtstages (nach dem in Russland noch geltenden julianischen Kalender) am ersten Weihnachtstag, sei dahingestellt. 1915 beendete eine Blutvergiftung nicht nur seine Mysteriums-Pläne, sondern kurz darauf auch sein Leben. Er wurde nur 43 Jahre alt. Jenseits des Gedankens um ein Gesamtkunstwerk zeigt sich Wagners Einfluss auf Skrjabin aber auch in früheren Werken. Keineswegs bei der Wahl der Gattungen: Skrjabin schrieb ausschließlich Klavier- und Orchesterwerke. Die erweiterte Harmonik Wagners hingegen, die das traditionelle DurMoll-Gefüge praktisch sprengt, faszinierte ihn umso mehr. Auch in der zweiten Sinfonie von 1901 gibt es jenseits des Finales kaum eine Passage, in der man – harmonisch betrachtet – festen Boden unter den Füßen hätte, manchmal nicht einmal innerhalb eines einzigen Taktes. Das Andante wird eröffnet von einem Motiv in den Holzbläsern, das sich später als stets wiederkehrendes Leitmotiv herausstellt. Ansonsten steht der gesamte Satz irgendwo zwischen der bereits bei Haydn (1732–1809) dem ersten Satz gern vorangestellten langsamen Einleitung und der Selbstständigkeit, die sich am breiten Ausdrucksspektrum, aber auch in der Spieldauer von rund sieben Minuten zeigt. Die eher düstere Stimmung wird zwischenzeitlich von Solovioline und Flöte aufgehellt, die aber harsch von gestopften Hörnen unterbrochen wird. Ein kurzer Allegroteil führt zurück ins Andante, bevor dieses nach wenigen Takten nahtlos in den zweiten Satz übergeht. In diesem Allegro stellt Skrjabin zwei Themenbereiche gegenüber: vorwärts drängende Motorik der Streicher auf der einen Seite, ruhige Holzbläsermelodien als zweites Thema auf der anderen Seite. Doch auch innerhalb des zweiten Themenbereichs sorgen die Blechbläser immer wieder für bedrohliche Momente. Der dritte Satz, ein teils elegisches Andante, wirkt schlicht, zurückhaltend und erinnert mit solistischen Passagen von Flöte und Geige an eine ländliche Szene. Nur selten steigert sich die Musik innerhalb der rund 15 Minuten Spielzeit ins Forte. Der vierte Satz trägt nicht umsonst die Spielanweisung tempestoso (stürmisch). Er besteht fast durchgehend aus einem unruhigen Vorwärtsdrängen, das nur zweimal von einer lyrischen Passage unterbrochen wird. Am Ende wird überraschend der Allegroteil des ersten Satzes wieder aufgenommen, der nun direkt ins Finale führt. Das Leitmotiv aus dem ersten Satz erklingt nun majestätisch in den Blechbläsern „im Tonfall von Wagners Meistersingern“, wie ein Konzertführer konstatiert. Nach harmonisch etwas schlichterem Verlauf klingt das Werk in strahlendem C-Dur aus. Die formale Vermischung von Sonatensatz und Rondo, insbesondere im Finale, die dichte, spannungsgeladene Harmonik, der Aufbau mit einem Leitthema, dafür aber in fünf Sätzen, die offene Funktion des ersten Satzes, das mittlere Andante und die Sturmmusik, die eine programmatische Deutung zumindest nahelegen, sowie das Fehlen eines echten Scherzos (an dessen Stelle steht die Sturmmusik) haben bei den Zeitgenossen einen gespaltenen Eindruck hinterlassen. „Je mehr die einen tobten, desto stärker klatschen die anderen Beifall“, berichtet Skrjabins Tante Ljubow Alexandrowna von der Moskauer Erstaufführung. Bis heute wird das Werk vergleichsweise selten gespielt, dabei würde es gerade durch häufigeres Hören vermutlich an Zustimmung gewinnen. | Nic olas Furc hert