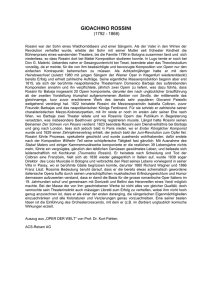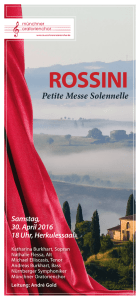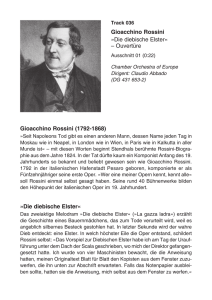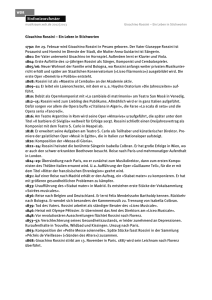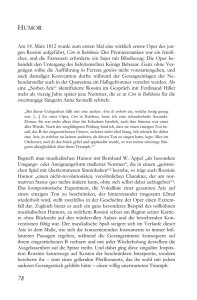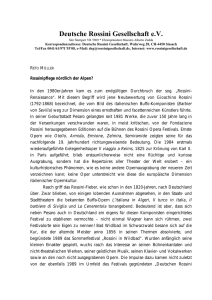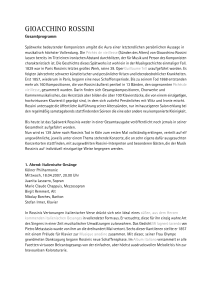Zu den Werken des Konzerts
Werbung
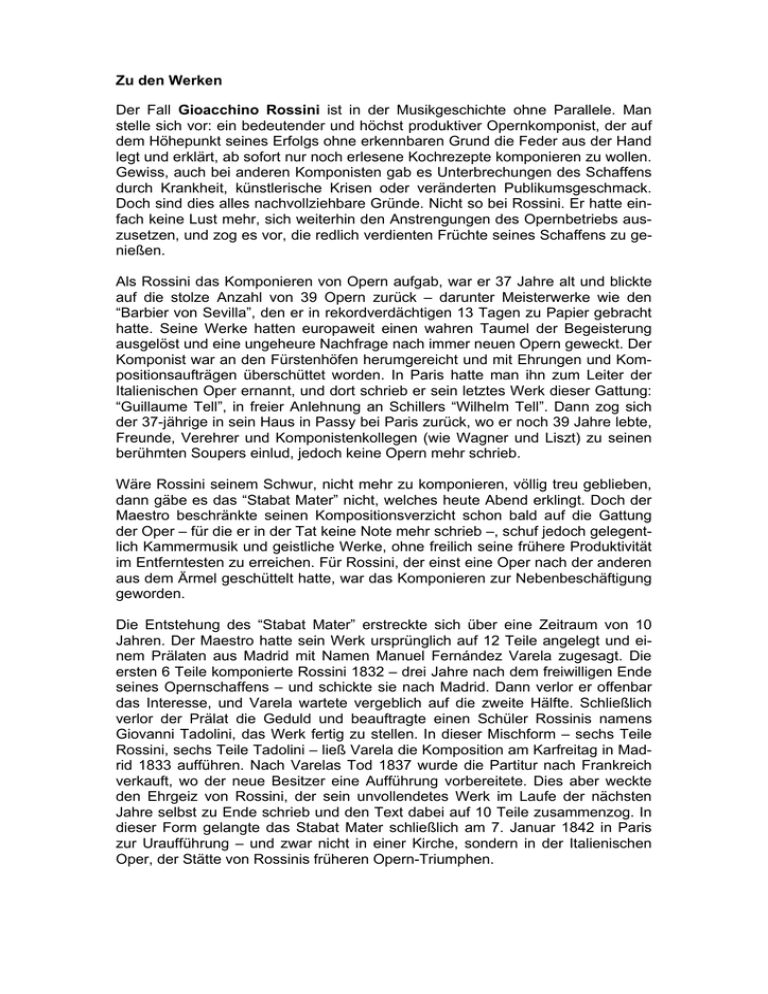
Zu den Werken Der Fall Gioacchino Rossini ist in der Musikgeschichte ohne Parallele. Man stelle sich vor: ein bedeutender und höchst produktiver Opernkomponist, der auf dem Höhepunkt seines Erfolgs ohne erkennbaren Grund die Feder aus der Hand legt und erklärt, ab sofort nur noch erlesene Kochrezepte komponieren zu wollen. Gewiss, auch bei anderen Komponisten gab es Unterbrechungen des Schaffens durch Krankheit, künstlerische Krisen oder veränderten Publikumsgeschmack. Doch sind dies alles nachvollziehbare Gründe. Nicht so bei Rossini. Er hatte einfach keine Lust mehr, sich weiterhin den Anstrengungen des Opernbetriebs auszusetzen, und zog es vor, die redlich verdienten Früchte seines Schaffens zu genießen. Als Rossini das Komponieren von Opern aufgab, war er 37 Jahre alt und blickte auf die stolze Anzahl von 39 Opern zurück – darunter Meisterwerke wie den “Barbier von Sevilla”, den er in rekordverdächtigen 13 Tagen zu Papier gebracht hatte. Seine Werke hatten europaweit einen wahren Taumel der Begeisterung ausgelöst und eine ungeheure Nachfrage nach immer neuen Opern geweckt. Der Komponist war an den Fürstenhöfen herumgereicht und mit Ehrungen und Kompositionsaufträgen überschüttet worden. In Paris hatte man ihn zum Leiter der Italienischen Oper ernannt, und dort schrieb er sein letztes Werk dieser Gattung: “Guillaume Tell”, in freier Anlehnung an Schillers “Wilhelm Tell”. Dann zog sich der 37-jährige in sein Haus in Passy bei Paris zurück, wo er noch 39 Jahre lebte, Freunde, Verehrer und Komponistenkollegen (wie Wagner und Liszt) zu seinen berühmten Soupers einlud, jedoch keine Opern mehr schrieb. Wäre Rossini seinem Schwur, nicht mehr zu komponieren, völlig treu geblieben, dann gäbe es das “Stabat Mater” nicht, welches heute Abend erklingt. Doch der Maestro beschränkte seinen Kompositionsverzicht schon bald auf die Gattung der Oper – für die er in der Tat keine Note mehr schrieb –, schuf jedoch gelegentlich Kammermusik und geistliche Werke, ohne freilich seine frühere Produktivität im Entferntesten zu erreichen. Für Rossini, der einst eine Oper nach der anderen aus dem Ärmel geschüttelt hatte, war das Komponieren zur Nebenbeschäftigung geworden. Die Entstehung des “Stabat Mater” erstreckte sich über eine Zeitraum von 10 Jahren. Der Maestro hatte sein Werk ursprünglich auf 12 Teile angelegt und einem Prälaten aus Madrid mit Namen Manuel Fernández Varela zugesagt. Die ersten 6 Teile komponierte Rossini 1832 – drei Jahre nach dem freiwilligen Ende seines Opernschaffens – und schickte sie nach Madrid. Dann verlor er offenbar das Interesse, und Varela wartete vergeblich auf die zweite Hälfte. Schließlich verlor der Prälat die Geduld und beauftragte einen Schüler Rossinis namens Giovanni Tadolini, das Werk fertig zu stellen. In dieser Mischform – sechs Teile Rossini, sechs Teile Tadolini – ließ Varela die Komposition am Karfreitag in Madrid 1833 aufführen. Nach Varelas Tod 1837 wurde die Partitur nach Frankreich verkauft, wo der neue Besitzer eine Aufführung vorbereitete. Dies aber weckte den Ehrgeiz von Rossini, der sein unvollendetes Werk im Laufe der nächsten Jahre selbst zu Ende schrieb und den Text dabei auf 10 Teile zusammenzog. In dieser Form gelangte das Stabat Mater schließlich am 7. Januar 1842 in Paris zur Uraufführung – und zwar nicht in einer Kirche, sondern in der Italienischen Oper, der Stätte von Rossinis früheren Opern-Triumphen. Der Aufführungsort war gut gewählt, und das “Stabat Mater” löste keine geringeren Begeisterungsstürme aus als Rossinis große Opernerfolge Jahre zuvor. Mehrere Teile mussten wegen des anhaltenden Applauses wiederholt werden, und die Zuhörer verließen schließlich tief bewegt das Theater. Auch Heinrich Heine, der eine der folgenden Aufführungen miterlebte, äußerte sich in seiner Kritik, die er an die “Allgemeine Zeitung Augsburg” schickte, sehr lobend über das Werk. Für eine Würdigung von Rossinis Musik gelte es, so Heine, “sich frei zu machen von der Vorstellung eines angeblich allein gültigen kirchlichen Tonfalls”. Heine verglich die Komposition mit der “glutvollen Malerei der italienischen und spanischen Schule” und fuhr fort: “Das ungeheure erhabene Martyrium wurde hier dargestellt, aber in den naivsten Jugendlauten, die furchtbaren Klagen der Mater dolorosa ertönten, aber wie aus unschuldig kleiner Mädchenkehle, neben dem Flor der schwärzesten Trauer rauschten die Flügel aller Amoretten der Anmut, die Schrecknisse des Kreuztodes waren gemildert wie von tändelndem Schäferspiel, und das Gefühl der Unendlichkeit umwogte und umschloss das Ganze wie der blaue Himmel, der auf die Prozession herableuchtete wie das blaue Meer, an dessen Ufern sie singend und klingend dahinzog.” Das Werk beginnt und endet in g-Moll. Nach einem kurzen Vorspiel des Orchesters, das sich vom geheimnisvollen Pianissimo zum leidenschaftlichen Fortissimo erhebt und wieder zurücksinkt, setzt der Chor in tiefer Lage mit dem Hauptmotiv ein. Die Solisten treten als Quartett hinzu und gestalten im Wechsel mit dem Chor einen bewegenden Klagegesang. Das chromatische Kreuzmotiv (abwärts – aufwärts – abwärts) zieht sich durch alle Stimmen und nimmt gelegentlich sogar die Form B–A–C–H an. Zufall, oder eine Hommage Rossinis an den großen Johann Sebastian? Nach dieser eindrucksvollen Einleitung folgen Satztypen unterschiedlichster Art. Die Solisten werden mit dankbaren Arien und Duetten bedacht, welche die Herkunft von der großen Oper nicht verleugnen und oft sogar in veritablen Kadenzen kulminieren. Der Chor hingegen ist für die besinnlicheren Stimmungen zuständig. In der vorletzten Nummer schreibt Rossini einen a-capella-Chorsatz von unglaublicher Farbigkeit, Dichte und Ausdruckskraft. Noch im Jahr der Uraufführung erlebte das “Stabat Mater” 29 Aufführungen in ganz Europa, und das Werk zählt bis heute zu den beliebtesten Schöpfungen des Maestros. Es soll freilich auch nicht verschwiegen werden, dass die Komposition von Anfang an nicht unumstritten war und ist. Hector Berlioz – sicher keiner von Rossinis Freunden – blieb zeitlebens bei der Behauptung, die große Schlussfuge “In sempiterna saecula” stamme von dem erwähnten Giovanni Tadolini. Darüber hinaus haben etliche Musiker und Kirchenvertreter Bedenken gegen die von Heine gelobten “naivsten Jugendlaute” geäußert und die deutlich erkennbare Herkunft von der Oper, die Rossini nie verleugnet hat, getadelt. Der Hörer möge sich in unserer Aufführung selbst ein Urteil bilden! Mit 37 Jahren gab Gioacchino Rossini die Opernkomposition auf. In eben diesem Alter fing ein anderer Komponist erst an. Gemeint ist Anton Bruckner, dessen “Ave Maria” für siebenstimmigen Chor a capella den Beginn seiner künstlerischen Reife markiert. Auch er stellt einen Sonderfall der Musikgeschichte dar: es gibt keinen anderen bedeutenden Komponisten, der so spät begann und seine ersten gültigen Werke erst als Enddreißiger vorlegte. Wäre er im gleichen Alter gestorben wie Mozart oder gar Schubert, sein Name wäre heute vergessen! Natürlich hatte Bruckner schon früher komponiert: Orgelwerke, Messen, ein Requiem, ein Magnificat. Doch waren dies tastende Versuche, die keinem Vergleich mit den späteren Meisterwerken standhalten. Bruckner wusste um diese Unzulänglichkeiten und war unablässig bemüht, seine Kompositionstechnik durch Studien beim Wiener Kontrapunktlehrer Simon Sechter weiterzubilden. Daneben war er als ausübender Musiker tätig: in Linz hatte er das Amt des Domorganisten inne und leitete den dortigen Männerchor “Frohsinn”. Als dieser Chor sein Gründungsjubiläum am 12. Mai 1861 mit einer feierlichen Messe im Linzer Dom beging, sah sich Bruckner als Organist und Chorleiter natürlich doppelt gefordert. Er bündelte wie nie zuvor seine schöpferische Phantasie und das bei Sechter Gelernte, und es gelang ihm der erste große Wurf in kleiner Form: das “Ave Maria”, welches bei dieser Messe zum ersten Mal erklang. Das Werk beginnt mit einem dreistimmigen Knaben- oder Frauenchor, wie er wohl als Kirchenchor im Dom zur Verfügung stand. Diesen hohen Stimmen stellt Bruckner wirkungsvoll den vierstimmigen Männerchorklang seiner Liedertafel – stellenweise zur Fünfstimmigkeit erweitert – gegenüber. Die beiden Chöre, am Anfang getrennt behandelt, verschmelzen im Laufe des Stückes immer mehr zu einer Einheit. Hier, im kleinsten Rahmen, bricht sich der persönliche Stil des Komponisten erstmalig Bahn. Der freie, wie selbstverständlich gehandhabte Kontrapunkt, die farbigen Harmonien und der registerartige Lagenwechsel sind ganz unverkennbar Bruckner. Aber – auch dies typisch Bruckner – schon kurz nach der Vollendung des “Ave Maria” wurde der Meister wieder zum Schüler und studierte Formenlehre und Orchesterbehandlung bei einem Linzer Kapellmeister. Fast hätte man meinen können, Giuseppe Verdi habe nach seiner “Aida” 1869 – ähnlich wie zuvor Rossini – der Opernkomposition abgeschworen, weil er 12 Jahre lang keine Oper mehr vorlegte und statt dessen Kammermusik und geistliche Werke schrieb (das Streichquartett und das Requiem erschienen beide 1873). Dann aber, 1881, nahm der Meister sein Opernschaffen mit “Simone Boccanegra” wieder auf, und die 12 Jahre erwiesen sich als schöpferische Pause, die der Suche nach neuen musikdramatischen Ausdrucksformen diente. In diese zwölfjährige Opernpause fällt auch die Komposition eines der wenigen Werke Verdis für Chor a capella, des fünfstimmigen “Pater Noster”, welches 1880 in der Mailänder Scala uraufgeführt wurde. Das wichtigste christliche Gebet, das Vaterunser, wurde nur selten in Musik gesetzt, und auch Verdi verwendete für sein Werk weder den lateinischen Urtext noch eine kirchlich sanktionierte italienische Fassung. Vielmehr ist Verdis Textvorlage eine Nachdichtung des Vaterunsers in fünffüßigen Jamben, die zu Terzinen gereimt sind: O padre nostro, che ne’ cieli stai, Santificato sia sempre il tuo nome, e laude e grazia di ciò che ci fai …. Diese Umdichtung des Vaterunsers wird Dante Alighieri zugeschrieben, und in der Tat findet sich die erste Textzeile (O padre nostro, che ne’ cieli stai) wörtlich in der “Divina Commedia“, und zwar im 11. Gesang des mittleren Teils “Purgatorio”. Der vollständige Text, den Verdi vertont hat, ist unter den gesicherten Werken Dantes allerdings nicht nachzuweisen. Es ist daher anzunehmen, dass ein unbekannter Dichter die Zeile Dantes (die ja inhaltlich dem Beginn des Vaterunsers entspricht) zu einer vollständigen Vaterunser-Dichtung erweitert hat, wobei er sich der bevorzugten Form Dantes (Terzinen aus fünffüßigen Jamben) bediente. Gehörten Rossini, Bruckner und Verdi der römisch-katholischen Kirche an, so war Felix Mendelssohn Bartholdy im Protestantismus verwurzelt. Aus einer jüdischen Familie stammend, wurde er schon als Siebenjähriger getauft und blieb der evangelisch-lutherischen Kirche sein Leben lang eng verbunden, ohne seine jüdischen Wurzeln zu verleugnen. In einer Zeit, in der die Juden die volle rechtliche Gleichstellung erlangten, wollte Mendelssohn mit seiner Musik seinen Beitrag zu einem Brückenschlag zwischen jüdischer und christlicher Kultur leisten. Eine lebenslange Bestrebung Mendelssohns war es, der evangelischen Kirchenmusik neue Impulse zu geben. Daher komponierte er neben seinen großen Schöpfungen auch eine Vielzahl kleinerer Orgel- und Chorwerke, die im Gottesdienst erklingen konnten. Die lange vergessene Form der Chormotette (mit oder ohne Instrumentalbegleitung) griff er wieder auf und belebte sie aus dem Geist der Romantik neu. Es entstanden Kompositionen von höchstem musikalischen Niveau, die dennoch den liturgischen Rahmen niemals sprengten. Am 26. Juli 1844 verübte der ehemalige Bürgermeister von Storkow, Heinrich Ludwig Tschech, ein Attentat auf den preußischen König Friedrich Wilhelm IV, indem er im Berliner Schlosshof auf ihn schoss. Der Anschlag schlug fehl, und der König blieb unverletzt. Als Mendelssohn, der den König sehr verehrte, von diesem Attentatsversuch erfuhr, inspirierte ihn dies zu einer seiner reifsten Chormotetten: “Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir” für achtstimmigen Doppelchor a capella. Mendelssohn schickte die fertige Partitur an den König mit den Worten: “Seit ich auf der Reise zum Musikfest in Zweibrücken jene Nachricht erfuhr, schwebten mir einige Verse vor, an die ich immer von neuem denken musste, und sobald ich hier wieder zur Ruhe kam, musste ich sie in Musik setzen. Die sind es nun, die ich als meinen Glückwunsch zu den Füßen Eurer Majestät zu legen wage.” Den Text hat der Meister dem 91. Psalm entnommen – natürlich, wie es sich für einen guten Protestanten gehörte, in der Lutherschen Übersetzung. Im darauf folgenden Jahr schrieb Mendelssohn sein Oratorium “Elias” und griff dabei auf seine doppelchörige Motette zurück, die er – jetzt eingebettet in einen Orchestersatz aus Streichern und Holzbläsern – mit leichten Veränderungen in sein Oratorium aufnahm. Diese Version ist so bekannt geworden, dass sie die Urfassung fast verdrängt hat. Wir geben unseren Zuhörern heute die Gelegenheit, einmal die Originalversion a capella zu hören. Der amerikanische Dirigent Leopold Stokowski spielte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine ähnliche Rolle wie Leonard Bernstein in der zweiten. Diesen beiden Musikern gelang es wie kaum jemand sonst, die klassische Musik von der Aura des Elitären zu befreien und einem großen Publikum nahe zu bringen, wobei beide in der Wahl ihrer Mittel nicht immer zimperlich waren. Insbesondere Stokowski nutzte jede Gelegenheit, in die Schlagzeilen zu kommen. Er war durch seine Affäre mit Greta Garbo oder durch seinen Handschlag mit Mickey Mouse (in dem Walt-Disney-Film “Fantasia”) fast bekannter als durch seine Musik – wobei seine musikalische Kompetenz stets über jeden Zweifel erhaben war. Stokowski hatte seine musikalische Laufbahn als Organist begonnen, und als er zur Orchesterleitung wechselte, wollte er sein gewohntes und geliebtes Orgelrepertoire auch in Zukunft nicht missen. Daher transkribierte er eine Vielzahl von Orgelwerken – insbesondere solche von Johann Sebastian Bach – für großes Orchester. Wer über diese Bearbeitungen heute die Nase rümpft, sollte bedenken, dass Bach selbst ein großer Bearbeiter eigener und fremder Werke war, stets bereit, das musikalische Material dem verfügbaren Instrumentarium anzupassen. Und gerade bei Bach spielt die musikalische Idee eine größere Rolle als der Klangeffekt. Eine lange Reihe von Bach-Bearbeitungen bis in unsere Tage hat immer wieder gezeigt, wie sehr Bachs Musik auch in einem neuen instrumentalen Gewand zu überzeugen vermag, wenn die Transkription gekonnt und geschmackvoll ist. Leopold Stokowski ging bei seinen Bearbeitungen so vor, dass er eine Ausgabe des Originalwerks nahm und dort direkt die neue Instrumentation detailliert eintrug. Damit ging er zu seinem Notensetzer, der nach den Eintragungen Stokowskis die Partitur erstellte. Das ist zweifellos ein sehr ökonomisches Verfahren, und es erklärt, wie Stokowski immer wieder in kürzester Zeit umfangreiche und komplexe Meisterwerke für sein Orchester transkribieren konnte. In unserem Konzert erklingt Stokowskis Orchesterfassung von Bachs Passacaglia und Fuge in c-Moll. Bei einer Passacaglia wird ein vier- oder achttaktiger Bass (Basso ostinato) konstant wiederholt; in den Oberstimmen erklingen dazu Variationen. Eine solche Form entspricht natürlich ganz besonders den Möglichkeiten der Orgel, und die alten Orgelmeister pflegten den Basso ostinato auf dem Pedal zu spielen und die Oberstimmen auf den Manualen zu improvisieren. Zu Bachs Zeiten galt diese Form schon als ein ehrwürdiges Zeugnis der musikalischen Vergangenheit, und so hat Bach nur ein einziges Mal – eben mit diesem Orgelwerk – eine Passacaglia geschaffen. Man darf gespannt sein, wie dieses so orgeltypische, orgelgerechte Werk im Gewand des großen Orchesters klingt, zumal wenn die Transkription von einem solchen Klangmagier wie Leopold Stokowski stammt. Reinhard Szyszka