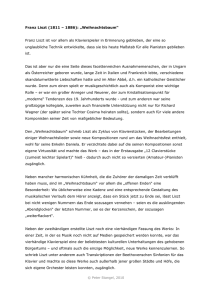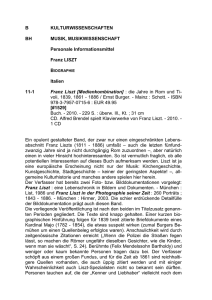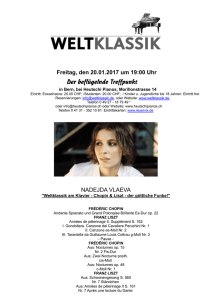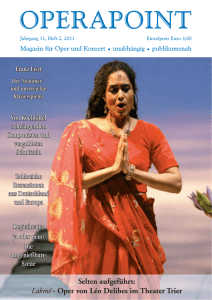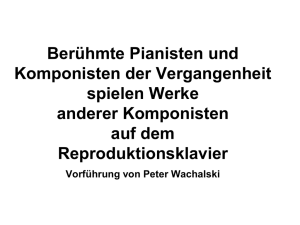Für mich ist die Musik ein Kontinuum
Werbung

Für mich ist die Musik ein Kontinuum Konzertchef Markus Hinterhäuser im Gespräch mit Daniel Ender Das Konzert hat eine lange Geschichte und wurzelt im 19. Jahrhundert. Ist es damit nicht eine überkommene Veranstaltungsform? Markus Hinterhäuser: Das Konzert ist überhaupt nicht überkommen. Die Alternative wäre, dass man zu Hause sitzt und sich Aufnahmen anhört. Man kann sicherlich über gewisse Ritualisierungen diskutieren, aber das Konzert an sich, die Möglichkeit, unmittelbar mit Musik, mit der Ausstrahlung von Musikern, von Interpreten in Kontakt zu kommen: noch einmal, daran ist gar nichts überkommen. Außerdem ist es ja ein sehr interessantes Phänomen, dass viele hundert oder tausend Menschen zusammenkommen, um einer Musik zuzuhören. Da entsteht manchmal eine große Intensität gemeinsamen Erlebens, gemeinsamen Glücks. Das Konzert an sich – vielleicht nicht immer die Form, aber ganz gewiss dieses Ereignis – ist etwas sehr Gültiges und etwas sehr Wesentliches. Und es ist sicher wesentlicher als dieses quasi synthetische Produkt einer Aufnahme, das in keiner Weise eine Situation wieder hörbar macht, die man unmittelbar erleben kann. Entscheidend ist ja, dass im Konzert genau das geschieht, was ganz charakteristisch ist für den Klang und für alles, was mit Musik zu tun hat: es ist vergänglich und nicht wiederholbar. Es beginnt, es findet statt, es endet, und es wird nie wieder so stattfinden. Insofern halte ich es sowohl für gültig als auch für sehr erforderlich zum Verständnis und für die Erfahrbarkeit von Musik. Festspiele haben ihre eigenen Rituale entwickelt, und zumindest Teile des Publikums kommen dorthin,um bestimmte Erfahrungen zu wiederholen. Markus Hinterhäuser: Unser ganzes Leben besteht doch aus ritualisierten Situationen, aus ritualisierten Wiederholungen. Das ist etwas, was ich in gar keiner Weise abfällig oder kritisch sehe. Man kann auch, wie Peter Handke einmal diesen schönen Titel gebraucht hat, „Phantasien der Wiederholung“ haben. Es gibt auch da nie wieder den gleichen erlebten Moment, es sind immer Nuancen, die man unterscheiden kann, Nuancen einer neuen Wahrnehmung. Gerade die Salzburger Festspiele haben eine sehr starke Identität entwickelt, die auf Wiedererkennbarkeit beruht. Wenn es darum geht, zu einer neuen Wahrnehmung zu gelangen, müssen sich dannFestspiele eigentlich nicht immer neu erfinden? Markus Hinterhäuser: Natürlich muss man sich immer neu erfinden, natürlich muss man immer auf der Hut sein, dass man sich nicht selbst so genügt, wie man ist, sich selbst nie in Frage stellt, weil etwas vermeintlich funktioniert. Diese Diskussion ist lebensnotwendig, sie ist von vitalstem Interesse. Wir versuchen immer wieder, in dieser „Landkarte Festspiele“ neue Gebiete zu finden, ohne gleich das ganze System in Frage zu stellen. Grundsätzlich geht es ja darum, diese „Landkarte“ zu erstellen, in der sich die Menschen, die wir einladen, in irgendeiner Weise wiederfinden können. Es sind in fünf Wochen etwa 120 Veranstaltungen. Das muss in ein bestimmtes Raster gefasst sein, sonst ist es nicht zu machen. Ungefähr die Hälfte der Veranstaltungen wird vom Konzertprogramm getragen, bei dem Sie bereits mit den Programmen der letzten beiden Jahre eine ganz klare Handschrift entwickelt und ein Profil geprägt haben. Wenn man beim Bild der Landkarte bleibt, gibt es immer zwei „Inseln“, an denen man sich orientieren kann – die „Szenen“, die bisher einem Komponisten aus dem 19. Jahrhundert gewidmet waren, und die „Kontinente“, wo eine Figur aus der Moderne im Mittelpunkt steht. Wo sind Möglichkeiten der Kontinuität und der Weiterentwicklung? Markus Hinterhäuser: Ich sehe für eine gewisse Zeitspanne kein Problem, auch Kontinuität sichtbar zu machen. Dinge brauchen ihre Zeit, um sich ihr Leben zu verschaffen. Das Problem ist, dass man (aus: MAGAZIN DER FREUNDE DER SALZBURGER FESTSPIELE, Herbst und Winter 2008) sehr oft in diese Erwartungshaltung gedrängt wird, etwas Neues zu bieten, ständig das Rad neu zu erfinden. Das ist nicht leicht zu bewältigen und auch inhaltlich nicht unproblematisch. Ich bin sehr für einen gewissen Rahmen, in dem man auch Kontinuität schaffen kann. Innerhalb dessen kann dann etwas eine neue Beleuchtung erfahren, und hier wird es auch in der Zukunft die eine oder andere Veränderung geben. Wenn man aber definierte programmatische Situationen geschaffen hat, braucht es Zeit, bis sich diese etabliert haben – etabliert nicht im Sinne des ständig Wiederholten, sondern im Sinne der Erkennbarkeit, der Akzeptanz, der Resonanz. Neben den bereits genannten „Inseln“ unternehmen Sie auch den Versuch, das Neue im übrigen Programm unterzubringen, zeitgenössische Werke in den „normalen“ Konzerten zu etablieren. Markus Hinterhäuser: Ich habe schon oft gesagt, dass es für mich völlig normal und selbstverständlich ist, sogenannte zeitgenössische Werke in den Konzertprogrammen „unterzubringen“, und zwar nicht nur in irgendwelchen Spezialserien. Für mich ist die Musik und die Entwicklung der Musik ein Kontinuum, es entsteht ja nichts aus dem Nichts heraus. Auch das Neue oder Zeitgenössische – wie immer man das nennen will – entsteht aus dem, was vorher war. Bei den „Kontinent“-Veranstaltungen zu Edgard Varèse gibt es – wie in den letzten Jahren bei Giacinto Scelsi und Salvatore Sciarrino – auch nicht nur Werke dieses Komponisten, sondern man kann den Weg von Monteverdi über Liszt, Richard Strauss, Schönberg, Strawinsky, Varèse selber bis hin zu Xenakis und Olga Neuwirth hörend nachvollziehen. Dieses Kontinuum ist auch erklärbar, aber mich interessiert hier keine musikwissenschaftliche Darstellung, sondern die Positionierung von Musik innerhalb dieses Kontinuums, wie man Musik in diesem fortlaufenden Entwicklungsprozess erleben kann. Varèse war ja in einer Zeit als Dirigent, als Gründer von Orchestern und von Chören tätig, in der es noch nicht selbstverständlich war, sich mit Musik von Monteverdi, Schütz oder Gabrieli zu befassen. Varèse hat das getan, und das war ein wesentlicher Bezugspunkt für ihn, auch wenn man das in seinen wichtigsten Kompositionen, die in Amerika entstanden, nicht hört. Aber es war ein ganz starker Anker seines Denkens und Empfindens. Sein erstes großes Orchesterstück „Bourgogne“ wurde in Berlin uraufgeführt, weil das von Richard Strauss ermöglicht wurde. Diese Musik, die es nicht mehr gibt, weil sie verbrannt ist, wäre ohne diesen engen Kontakt zu Strauss völlig undenkbar. Es gab auch eine unvollendete Oper mit dem Titel „Ödipus und die Sphinx“, die in intensiver Zusammenarbeit mit Hofmannsthal entstanden ist. Da gab es eine ganz starke Beziehung, die ja auch im Zusammenhang mit den Salzburger Festspielen nicht ohne einen gewissen Charme ist. Später gibt es dann einen ganz anderen Varèse, aber niemand wird einen Teil seines Lebens völlig ausblenden können, und ich bin überzeugt, dass die großen Orchesterwerke von Varèse „Amériques“ und „Arcana“ mit dem zu tun haben, was man Symphonische Dichtung nennt. Strauss‘ Modell der Symphonischen Dichtung ist, obwohl die Musik natürlich völlig anders klingt, auch beim amerikanischen Varèse immer noch irgendwo da: die Bewältigung eines riesigen Orchesterapparates und eine Ebene der Musik, die bisweilen durchaus einen deskriptiven Charakter hat. Für die Symphonische Dichtung von Strauss hatte wiederum ein anderer die Vorgabe gegeben, Franz Liszt. Bei diesem Komponisten stehen sehr populäre neben fast völlig unbekannten Werken. Markus Hinterhäuser: Liszt ist eine der faszinierendsten und verrücktesten Erscheinungen des 19. Jahrhunderts. Nicht nur als Pianist, als der er einen 20 Quantensprung im Klavierspiel formuliert und auch selber erfüllt hat. Liszt war ja der erste, der Beethovens „Hammerklaviersonate“ gespielt hat, Liszt hat sämtliche Beethoven-Symphonien transkribiert. Das ist auch eine Form des Demokratisierens, die ganz außerordentlich ist. Liszt war jemand, der in seinem ganzen Wesen von einer unglaublichen Großzügigkeit war, auch anderen Komponisten gegenüber, im Erkennen der Qualität dieser anderen Komponisten und auch im Fördern dieser Qualität. Liszt ist jemand, der alleine mit der „h-Moll-Sonate“ einen so ungeheuren Schritt getan hat: Das hat es nie zuvor gegeben, dass jemand aus einem einzigen thematischen Material vier Sätze in einem großen Satz zusammenfasst. (aus: MAGAZIN DER FREUNDE DER SALZBURGER FESTSPIELE, Herbst und Winter 2008) In Schuberts „Wandererfantasie“ gibt es dazu deutliche Ansätze. Markus Hinterhäuser: Ja und nein, immerhin wurde ja die „Wandererfantasie“ von Liszt auch für Klavier und Orchester bearbeitet. Das mag man mögen oder nicht, aber es ist interessant, dass Liszt sich wirklich mit Schubert auseinandergesetzt hat. Das ist nicht einfach an ihm vorbeigerauscht. Wenn man bedenkt, dass Rachmaninow von der Existenz der Klaviersonaten von Schubert eigentlich nichts wahrgenommen hat – Liszt wusste ganz genau um die Qualität und die Größe dieser Musik. Der späte Liszt ist dann von einer wahrhaft verstörenden Großartigkeit – auch hier im Sinne des Kontinuums. Man kann wirklich von der Gregorianik bis zu Liszt selbst gehen und dann alle Türen, die er öffnet: Schönberg, Béla Bartók, György Ligeti, Galina Ustwolskaja… Das ist eine Perspektive, die sich sozusagen im Rückspiegel öffnet. Ich weiß zwar nicht, wie viele Komponisten heute Liszt als wichtigen Einfluss nennen, aber das ist gar nicht so wichtig. Bartók war ein Komponist, der sich sehr auf Liszt berufen hat, Bruckner war ein großer Bewunderer von Liszts „Faust-Symphonie“, Hugo Wolf war geradezu verrückt nach Liszt, wenn man das so sagen darf, und vieles von Richard Wagner wäre ohne Liszt überhaupt nicht denkbar. Arnold Schönberg schreibt über Liszts „Klaviersonate“ als Modell in Bezug auf sein eigenes „Erstes Streichquartett“. Die fantastischen Klavieretüden von Ligeti sind eigentlich die „Transzendentalen Etüden“ des 20. Jahrhunderts. Der Quantensprung wurde aber von Liszt im19. Jahrhunderts mit seinen „Transzendentalen Etüden“ vorgenommen. Da gibt es außerordentlich faszinierende Möglichkeiten, mit der Figur Franz Liszt umzugehen. Welche Rolle spielt Haydn im Programm 2009? Markus Hinterhäuser: Josef Haydn, der in der Rezeption bestimmt nicht die Bedeutung hat, die ihm zustehen würde, ist mit einem großen Dreiteiler mit Marc Minkowski und Les Musiciens du Louvre vertreten. Und es gibt immer wieder Einblendungen mit Haydnscher Musik, auch in Zusammenhang mit Schostakowitsch. So stehen gegen Ende der Festspiele zwei Konzerte des Emerson String Quartets mit Haydn- und mit Schostakowitsch-Streichquartetten auf dem Programm, und auch ein Konzert des Concertgebouw-Orchesters Amsterdam mit Mariss Jansons wird diese Konstellation aufgreifen und weiterführen. Dann gibt es seit langem wieder einen Zyklus der neun Beethoven-Symphonien mit der Kammerphilharmonie Bremen und Paavo Järvi. Das ist eine Lesart der Beethoven-Symphonien, die im Moment für mich absolut unvergleichlich ist, die es wirklich in sich hat und die ich so phänomenal finde, dass ich sie in Salzburg zur Diskussion stellen möchte. Das hat auch mit dem Haydn-Jahr zu tun, denn es gibt nur einen Komponisten, der ohne Haydn nicht denkbar ist, und das ist Beethoven. Mozart ist absolut denkbar ohne Haydn, aber als Beethoven angefangen hat, zu komponieren – ob das seine frühen Klaviersonaten sind, seine frühen Streichquartette, die ersten Symphonien – ist Haydn immer präsent. Auch deswegen finde ich es interessant, Beethovens Symphonien wieder einmal zyklisch zu erleben. Das ist eines dieser Projekte, die mich freuen und das sich in die „Landkarte“ der Festspiele 2009 wunderbar einfügt. Auch für Liszt war die Auseinandersetzung mit Beethoven wesentlich. Das hat auch mit diesem Kontinuum zu tun, das mir wichtig ist. (aus: MAGAZIN DER FREUNDE DER SALZBURGER FESTSPIELE, Herbst und Winter 2008)