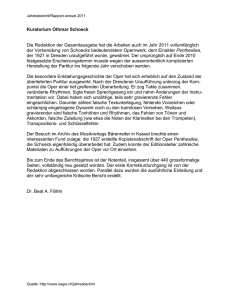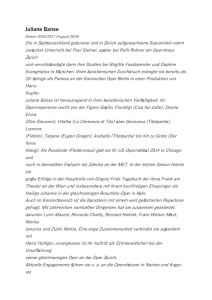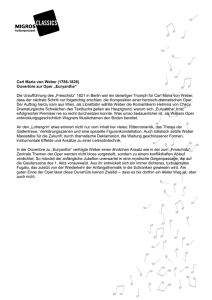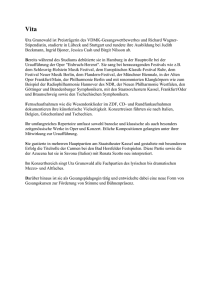Grau ist das Feld und der Himmel so leer
Werbung

Feuilleton SEI TE 1 4 · DI EN S TAG , 25 . APR IL 2 017 · N R . 96 F R ANKF URT ER A LLGEM EIN E ZE IT UN G Achtung, Privatbesitz Gehüstelt: „Tschechow in Jalta“ am Wiener Theater Scala WIEN, 24. April Anton Pawlowitsch Tschechow war offenbar wirklich felsenfest davon überzeugt, dass er Komödien fürs Theater schrieb. „Onkel Wanja“ etwa, uraufgeführt 1899, davor umgearbeitet aus einer früheren, beim Publikum gnadenlos durchgefallenen Version („Der Waldschrat“/„Leschij“), so kann man Tschechows Korrespondenz entnehmen, hielt er beinahe für ein Vaudeville-Stück. Er war von der eher schwermütigen Inszenierung im „Moskauer Künstlertheater“ durch Konstantin Sergejewitsch Stanislawski, der im Übrigen mit seinem Haus ab 1898 eine völlig neue, ungewohnt „naturalistische“ Theatertradition begründete, wenig begeistert. Dieser Konflikt, neben sehr vielen Details aus den diversen Privatleben der Charaktere, wird auch in „Tschechow in Jalta“ abgehandelt. Das Stück entstand in Zusammenarbeit von John Driver und Jeffrey Haddow, zwei im deutschsprachigen Raum hinlänglich unbekannten, wenn auch seit langem mündigen amerikanischen Theater- und Filmemachern in der Broadway-Saison 1980/81 und erhielt damals einige Preise, darunter den „Los Angeles Drama Critics Circle Award“. Driver, 70, Schauspieler und Regisseur, spielt heute noch in der Polizeiserie „Law & Order“, Haddow, 69, kennt man, wenn überhaupt, für seine Mitwirkung in der Off-Broadway-Revue „Scrambled Feet“ aus dem Jahre 1983 und eben für „Chekhov in Yalta“. Das „Theater zum Fürchten“, in Mödling bei Wien („Stadttheater Mödling“) und Wien („Scala“) beheimatet, nimmt sich immer wieder auch in Vergessenheit geratener Dramen an, im Besonderen der Werke von Shakespeares Zeitgenossen, aber eben auch neuerer und neuester Stücke. Bisweilen kann die Kleinbühne sogar mit einer Erstaufführung das Interesse auf sich ziehen. Nun setzt Rüdiger Hentzschel, seit etwa einem Jahrzehnt dem TzF eng verbunden, in eigenem, aufwendig realistischem Bühnenbild und in zeitgenössischen Kostümen von Alexandra Fitzinger „Tschechow in Jalta“ als österreichische Erstaufführung in Szene. Den beiden Amerikanern kann man zugute halten, dass sie für den Zweiakter offenbar penibel recherchiert haben, sich durch Tagebuchaufzeichnungen und Korrespondenz Tschechows und seines Umfeldes gearbeitet, man möchte mutmaßen: gewühlt, haben. Hentzschel wiederum muss man Achtung dafür zollen, die knapp zwei Stunden Spieldauer von allzu vielen Kleinigkeiten, die Driver und Haddow in die dünne Handlung gestopft hatten, befreit zu haben. Es geht um eine historisch belegte Episode aus dem Jahr 1900. Tschechow, von seiner Tuberkuloseerkrankung bereits schwer gezeichnet – ein gefühltes Sechstel des Abends verstreicht mit Hustenanfällen –, verbringt in der Obhut seiner Schwester Martha mit seinen Freunden Maxim Gorki und dem späteren, heute längst vergessenen, Literaturnobelpreisträger Iwan Bunin Zeit in seiner Villa in Jalta, dem Bade- und Luftkurort der Haute volee des Zarenreiches. Für eine Woche überfällt das komplette „Moskauer Künstlertheater“ Tschechows Haushalt. Es kommt zu allerlei, auch erotischen, Verstrickungen, und am Ende der Woche reisen die Ko-Direktoren Stanislawski und Wladimir Nemirowitsch-Dantschenko mit ihrer Truppe und dem neuen Stück „Drei Schwestern“ „nach Moskau, nach Moskau“ zurück. Den Schauspielern, allen voran Dirk Warme als schwindsüchtiger, boshafter, von sich selbst gelangweilter, aber an Olga Knipper höchst interessierter Tschechow, Monica Anna Cammerlander als ebenjene Knipper, die ihren Anton Pawlowitsch liebt und ihm gerade deswegen ein Ultimatum – Zusammenleben, am liebsten Ehe, oder Ende der Beziehung – stellt und Rainer Doppler als gutmütig-gelassener, intelligenter und geschäftstüchtiger Nemirowitsch-Dantschenko, der ganz nebenbei Stanislawski zum Hahnrei macht, während Gorki off-scene von zaristischen Geheimpolizisten verprügelt wird, ist es am wenigsten anzulasten, dass diese vorgebliche Komödie nicht zündet. Zu sehr erinnert das ganze Stück an ein nicht geglücktes Woody-Allen-Drehbuch à la „Sommernachts-Sexkomödie“. Zu „Onkel Wanja“, der unlängst vom „Theater zum Fürchten“ gezeigt wurde, ist diese schlichte Parodie eines Tschechow-Stückes aber zumindest ein netter Versuch einer Fortsetzung mit postdramatischen Mitteln. MARTIN LHOTZKY Drei Schwestern auf der Suche nach ihrem verlorenen Bruder: Samantha Steppan, Sonja Kreibich und Birgit Linauer (von links nach rechts) Foto Theater Scala In Mackes Sinn Preis für die Bildhauerin Inge Schmidt René Magritte, Les Mémoires d’un saint, 1960, © VG Bild-Kunst, Bonn 2017 Die in Köln lebende Bildhauerin Inge Schmidt, 1944 in Bonn geboren und Absolventin der Frankfurter Städelschule, wird im kommenden Jahr die August-Macke-Medaille ihrer Geburtsstadt erhal- ten. Die Auszeichnung, die von 1989 bis 2005 stets jährlich vergeben wurde und seit 2008 nur noch alle zwei Jahre an einen Künstler aus der Region verliehen wird, ist mit einer Ausstellung im Künstlerforum Bonn verbunden. Die letzten drei Preisträger waren die Graphiker Karl-Theo Stammer und Hans Delfosse sowie die Bildhauerin Petra Siering. aro. Nehmen Sie jetzt an unserem Gewinnspiel im Rahmen der Ausstellung „René Magritte. Der Verrat der Bilder“ teil und versenden Sie eine E-Card mit dem Motiv Ihrer Wahl. Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Samsung Virtual Reality Package! IN KOOPERATION MIT: JETZT ONLINE TEILNEHMEN: www.faz-schirn.de/gewinnspiel Die Frauen Karen Vourc’h, Noa Frenkel und Kai Rüütel leiden mit den Männern Vincenzo Neri und Roy Aernouts (jeweils von rechts nach links). Foto Annemie Augustijns Grau ist das Feld und der Himmel so leer Unter strengstem Nostalgieverbot: Chaya Czernowins Weltkriegsmusiktheater „Infinite Now“ als Uraufführung in Flandern. GENT, im April enn man in der Stadt Jan van Eycks durch die Gassen läuft, vorbei an Klöstern, Kirchen, Kaufmannshäusern, und dann den Weg in die schmucke alte Oper findet, ist die Versuchung groß, die Rückschau der Augen mit den Ohren fortzusetzen. Die begehbare Vergangenheit fordert uns in ihrer prachtvollen Präsenz geradezu auf, fortwährend festlich begangen zu werden. Doch Aviel Cahn, der künstlerische Leiter der Flandrischen Oper, die Gent und Antwerpen bespielt, will uns den Weg zurück nicht gönnen. Ihn ärgert es geradezu, dass es jetzt – am Opernhaus Lyon etwa oder bei den Salzburger Osterfestspielen – Mode geworden ist, alte Inszenierungen wieder auszugraben, ihnen überzeitlichen Werkcharakter zuzusprechen und sie neu auszustellen. „Wir schauen nach vorn und freuen uns darauf“, sagt er. Und die israelische Komponistin Chaya Czernowin, deren neues Stück „Infinite Now“ hier uraufgeführt wird, pflichtet ihm bei: „Meine Oper hat W nichts mit Nostalgie zu tun. Wer meine Arbeit kennt, weiß, dass mir Sentimentalität fremd ist.“ Nostalgie als Zeichen intellektueller Schwäche zu begreifen hat in der Musik seit Pierre Boulez Tradition. Zurück schaut nur, wer irritierbar ist. Das wollten die Anhänger des Neuen, verstanden als Fortschritt von Technologie und Material, nie sein. So war auch für Czernowin klar, als sie den Auftrag der Opera Vlaanderen, des Nationaltheaters Mannheim und des Ircam Paris erhielt, dass sie keine Oper mehr im traditionellen Sinn, mit Figuren, konkreter Erzählung, musikalischer Dramaturgie und gesanglichen Linien, schreiben würde. Das hat sie nun auch nicht getan. Das Stück „Front“ von Luk Perceval, das 2014 zum Gedenken an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs Feldpostbriefe von Soldaten kombinierte mit Passagen aus Erich Maria Remarques Roman „Im Westen nichts Neues“, war ihr nicht genug. Czernowin kontrastiert dieses Material mit Fragmenten aus dem Roman „Heimkehr“ der Chinesin Can Xue. Was beide Textgruppen verbindet, ist die Erfahrung des Ausgesetztseins in einer Welt, wo auf bisherige Erfahrungen kein Verlass mehr ist. Diese Beschreibung des radikal Neuen im Existentiellen rührt zugleich – eher unfreiwillig wohl – an den Nexus von Kunst und Krieg in der Moderne. Sechs Schauspieler mit wunderbar nuancierten Sprechstimmen, alle verstärkt, tragen die Texte der Soldaten und der Krankenschwester vor. Sechs Sängerinnen und Sänger, von allen Figuren entkoppelt, bewegen sich zwischen dem chi- nesischen Roman und den Weltkriegszeugnissen hin und her. Czernowin wahrt in diesem, ihrem dritten Musiktheaterstück die Bedeutungseinheiten der Worte zwar, zerstückelt aber die Prosodie der Sätze durch kleinteilige Wechsel zwischen Singen, Flüstern, Hauchen. Immer wieder entstehen tonale Säulen durch das Herausfiltern harmonischer Obertöne. Und selbst vor der samtenen Erhabenheit einiger Sept- und Septnonakkorde, die an Richard Wagner erinnern, schreckt Czernowin nicht zurück. Gänzlich unvertraut ist die Welt also nicht, die sie da entwirft. Die sechs Akte des zweieinhalbstündigen Stücks werden jeweils durch metallisch-dumpfe Schläge des Orchesters eingeleitet, das ebenfalls ständig elektronisch verfremdet und verstärkt wird. Der hochsensible und zugleich entschlossene Dirigent Titus Engel holt mit dem Symphonischen Orchester der Oper Flandern eine in der Spannung nie nachlassende Expressivität aus der Musik. Doch auch er kann nicht verhindern, dass der klangliche Eindruck der Partitur vergleichsweise grob ausfällt. Der Informationswert all der Flatter-, Schleif-, Knister- und Schabgeräusche geht nach etwa siebzig Minuten gegen null. Die Redundanz danach besitzt gleichwohl einen eigenen Erlebniswert: Sie ähnelt jener quälenden Stagnation des Stellungskriegs, die auch die Soldaten auf Flanderns Feldern erfahren haben – vier Jahre lang im Westen nichts Neues. Der Titel „Infinite Now“ ist für dieses endlose Jetzt gut gewählt. Luk Perceval, der selbst Regie führt, hat für diese Zustandsbeschreibung, die eher lyrische als dramatische Züge trägt, den Sängern und Schauspielern extrem langsame Bewegungen abverlangt: Ringkämpfe, Angstschreie, Todesstürze, die sich über Minuten hinweg dehnen. Der schwarze Bühnenhintergrund öffnet sich erst schlitzweise, dann gänzlich auf einen grauen Himmel der Aussichtslosigkeit. Das ist mit großem Geschick, mit Geschmack und Einfühlungsvermögen gemacht und steigert die Ausdrucksfülle der Musik. Eine Oper aber ist das nicht; eher eine Klangcollage oder ein Hörspiel, das weitaus stärker wirken würde, wenn es nur halb so lang wäre. Das Stück gehört eher ins Radio als auf die Bühne, obwohl Percevals episch gebremste Visualisierung zu fesseln vermag. Die Flucht ins Postdramatische, denn um eine solche handelt es sich hier, kann beim Libretto und bei der Komposition nicht ausschließlich als Zeichen der Stärke gelten: Es ist handwerklich schwer, Figuren zu erfinden, die handeln und für dieses Handeln äußere und innere Motive brauchen, die im Gesang zur Erscheinung gelangen. In Roman und Film fasziniert das Erzählen bis heute. Dass sich die Oper dieser Faszination durch ein allzu strenges Nostalgieverbot selbst beraubt, erscheint, solange sie noch adressierte Kunst sein will, geradezu fahrlässig. Nach der Uraufführungsserie in Gent ist „Infinite Now“ bis zum 6. Mai in Antwerpen zu erleben, vom 26. Mai an JAN BRACHMANN in Mannheim. Erinnerungen und Rückblenden, kuschelweich in Pastell War all das nun Pop-Art? Howard Kanovitz, der Pionier des Fotorealismus, im Ludwig Museum Koblenz Einer der Ersten, die seine Methode erfassten, protestierte sofort dagegen. Es war der Künstlerkollege Barnett Newman. Der New Yorker Malerphilosoph, ohnehin ein notorischer Leserbriefschreiber, erkannte sich beim Palaver auf einer Vernissage wieder – das es so nie gegeben hatte: in dem Riesenbild „The Opening“ von Howard Kanovitz aus dem Jahr 1967. Kanovitz war damals mit der Kamera unterwegs, mischte sich unter Museumsleute, Sammler, Kritiker, Künstler und nahm sie auf, um sie nach eigenem Gusto vor monochromem Hintergrund zusammenzubringen. Auch sich selbst schleuste er gern in solche Gruppen von Kunst-Vips ein und machte sich dadurch ein bisschen wichtig. Zugleich mokierte er sich darüber. Was heute mit entsprechendem Programm am Bildschirm arrangiert wird, collagierte der Maler mit Schere und Kleber, bevor er es in Breitformaten auf die Leinwand brachte – und damit die High Society der New Yorker Kunstwelt provozierte. Newman verbat sich jedenfalls, warum auch immer, im fiktiven Plausch mit der Kuratorin Dorothy Miller vom Museum of Modern Art und mit Kanovitz selbst abgebildet zu werden. Auf die Fotografie als Medium seines künstlerischen Interesses war Howard Kanovitz auf biographischem Weg aufmerksam geworden, als sein Vater gestorben war und der Künstler in Familienalben stöberte. Damals entdeckte er den Wert des Fotos für die Erinnerung; 1965 malte er „Die Eltern des Künstlers“. Zwar hatte der 1929 in Fall River, Massachusetts, als Sohn litauischer Juden geborene Maler in den fünfziger Jahren, als Assistent von Franz Kline, im Stil der New York School begonnen und sich damit dem Mainstream angeschlossen. Kanovitz stand seinerzeit auch noch eine Zukunft als Jazz-Posaunist offen, er spielte eine Zeitlang in der Band des Schlagzeugers Gene Krupa. Dann aber brachte ihn ein befreundeter Musiker auf die Malerei. Während einer ausgedehnten Europa-Reise nach Frankreich, Italien, Spanien und Marokko begann Kanovitz in Florenz nach der Natur zu zeichnen und entwickelte ein tieferes Verständnis für die Frührenaissance, er begeisterte sich für Masaccio, Donatello und Andrea del Castagno. Davon sollte er später profitieren, vor allem in der Auffassung vom Raum: Das bezeugt jetzt seine Ausstel- lung „Visible Difference“ im Ludwig Museum Koblenz. Der zweimalige Documenta-Teilnehmer von 1972 und 1977 kombinierte den gemalten Bildraum und den realen Raum, als er 1968 seine mit zahlreichen Trompe-l’Œil-Effekten versehene Atelierwand – mit der Spritzpistole – abmalte, davor jedoch einen echten kleinen Waschzuber stellte. Stühle, Telefone, Tische fanden sich schon zu Anfang der Sechziger in Arbeiten von Tom Wesselmann. Allerdings räkeln sich bei Howard Kanovitz keine Akte lasziv im Badezimmer oder auf dem Bett, bei ihm geht es um hochtheoretische Fragen nach dem Verhältnis von Malerei, Fotografie und Film. Kanovitz stellt lebensgroße Figuren als „Cutouts“ in den Raum und vereint Malerei, Skulptur und Installation in einer Werkgruppe über das Begräbnis eines schwarzen Musikers in New Orleans. Solche Buchstäblichkeit von Raum war in jenen Jahren eigentlich die Domäne der Minimal Art. Bei Kanovitz tritt sie in naturalistischem Gewand auf. Später sampelt Kanovitz dann nicht mehr einzelne Figuren der Kunstwelt, sondern Erinnerungen und Augenblicke, die er, Rückblenden gleich, kuschelweich in Pastell festhält, malt symbolistische Fensterausblicke bei Vollmond, oder er imitiert den fotografisch-malerischen Stil des Piktorialismus aus der Zeit der Jahrhundertwende. In den Bildern mit doppelbödiger Realität lässt wiederholt René Magritte grüßen. Manche damaligen Bildcollagen sind aus der Zeit gefallen, ein Bild wie „Hund am See“ mit dem Mönch aus Caspar David Friedrichs berühmter Parabel der Erhabenheit hätte freilich dreißig Jahre früher, noch zu Lebzeiten von Rothko & Co., provokanter gewirkt als 1998. War all das nun Pop-Art? Dazu war dieses Werk zu erzählerisch, zu anekdotisch, auch zu autobiographisch. Also doch eher Fotorealismus? Jedenfalls wurde der Begriff 1966 in der Folge von Kanovitz’ erster Museumsschau im New Yorker Jewish Museum geprägt. Kanovitz, er starb 2009 in New York, war zweifellos interessanter als manche seiner Kollegen, die Fotografie in betörender Manier abkupferten, und schreckte in seinen späteren Jahren, darin bisweilen an Sigmar Polke erinnernd, auch vor schlechtem Geschmack nicht zurück. GEORG IMDAHL „Howard Kanovitz. Visible Difference“. Im Ludwig Atelierwand mit Trompe-l’Œil-Effekten und Waschzuber, 1968 ©VG Bild-Kunst, Bonn 2017 Museum Koblenz; bis zum 28. Mai. Der Katalog (Silvana Editoriale) kostet 28 Euro.