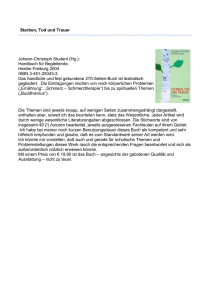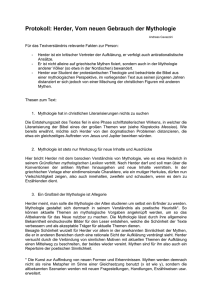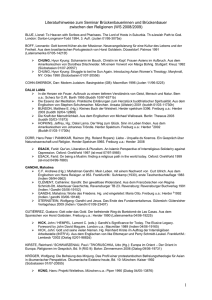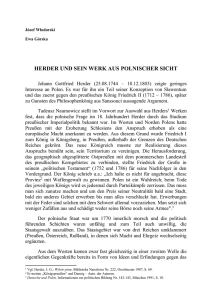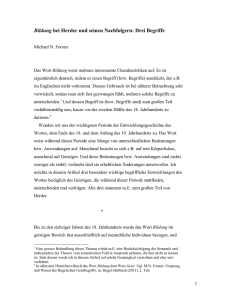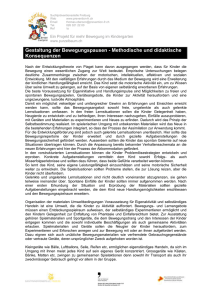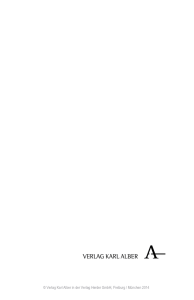4_Herder (S 17
Werbung

Strom der Empfindung, vom Maß des Auges begrenzt. Herders Anthropologie der Musik und ihr ästhetischer Kontext „Klarheit des Auges hasset oft tiefe Innigkeit des Ohrs [...], die beyden Rosse sind also ungleich, die zunächst am Wagen der Psyche ziehen. Die drei größten epischen Dichter in aller Welt, Homer, Ossian und Milton waren blind, als ob diese stille Dunkelheit dazu gehörte, daß alle Bilder, die sie gesehen und erfasset hatten, nun Schall, Wort, süsse Melodie werden könnten.“ (Johann Gottfried Herder)1 Am 5. November 1774 übersandte Johann Gottfried Herder dem Komponisten Christoph Willibald Gluck ein von ihm verfaßtes Opernlibretto mit dem Titel Brutus, in der Hoffnung, den berühmten Adressaten für eine Zusammenarbeit gewinnen zu können. Dies ist insofern bemerkenswert, als der Brutus bereits durch Johann Christoph Friedrich Bach vertont worden war und erst wenige Monate zuvor, am 27. Februar 1774, seine Uraufführung im Bückeburger Hoftheater erlebt hatte. Da Bachs Partitur als verschollen gilt, läßt sich über die Beweggründe Herders heute nur noch spekulieren, doch darf angenommen werden, daß die Komposition seiner Idealvorstellung nicht entsprach und er damit rechnete, beim Schöpfer der ,Reformoper‘ größeres Verständnis zu finden. Tatsächlich gibt das Begleitschreiben an Gluck mehrere Hinweise darauf, daß Herder eine neue Gattung des ,musikalischen Dramas‘ im Blick hatte, die sich von den Konventionen der zeitgenössischen Oper grundlegend unterscheiden sollte, nicht nur in bezug auf das Verhältnis von Poesie und Musik, sondern auch hinsichtlich der Auffassung von Musik und musikalischer Form überhaupt. Sein Libretto erhebe keineswegs den Anspruch, als autonomer Lesetext bestehen zu können, so Herder, sondern sei lediglich, „was die Unterschrift am Gemälde oder Bildsäule ist, Erklärung, Leitung des Stroms der Musik, durch dazwischen gestreute Worte“. Deshalb käme für die Vertonung kein Komponist in Betracht, „dem das alte Hauptgesetz der Musik, alles rund zu machen, Lehn- u. Schlafstuhl ist, in dem er sich periodisch wieget“.2 1 2 Johann Gottfried Herder: Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele. Bemerkungen und Träume (1778), in: Sämmtliche Werke, Bd. 8, S. 188. Johann Gottfried Herder: Briefe. Gesamtausgabe 1763–1803. Unter Leitung von Karl-Heinz Hahn hrsg. von den Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar (Goethe- und Schiller-Archiv), bearbeitet von Wilhelm Dobbek und Günter Arnold, Weimar 1977–1996, Bd. 3, S. 125. 17 Die Frage, welches Verständnis von Musik bzw. Musiktheater sich hinter diesen beiden Aussagen verbirgt, ist kaum eindeutig zu beantworten, zumal Gluck auf die Übersendung des Brutus nicht reagierte und somit auch hier keine Möglichkeit besteht, Herders Intention anhand einer kompositorischen Umsetzung zu rekonstruieren. Erste Hinweise liefert freilich die Gestalt des Librettos selbst. Jörg Krämer und Laurenz Lütteken konnten den Nachweis erbringen, daß Herders Brutus zwar einerseits dem Formenkanon der metastasianischen Opera seria verpflichtet ist, andererseits aber die Grenze zwischen Rezitativ und Arie verschwimmen läßt, um den musikalischen Nachvollzug einer durchgehenden Affektbewegung „voller unmerklicher Übergänge“ zu ermöglichen.3 Es scheint, so Lütteken, „als ob Herder ein großes Kontinuum im Blick gehabt hätte, in dem die Arie nur eine fester strukturierte Insel ist“.4 Damit in Zusammenhang steht die Reduktion der äußeren Handlung zugunsten einer Fokussierung auf das Innere der Figuren, letztlich die Tendenz zum „lyrischen Monolog“.5 Aufschlußreich sind vor allem die vereinzelten Randnotizen Herders in der ältesten kompletten Reinschrift des Textes vom Mai 1772, die sich zu einer Art Leitfaden für die Vertonung ergänzen. So heißt es beispielsweise über die vier Szenen des ersten Aktes, sie müßten musikalisch als „ein Ganzes“ aufgefaßt werden, „wo die Tonmischung Stuffenweise abnimmt und ins Stille geht.“6 „Die ganze erste Handlung endet sich also vom höchsten Affekt zur vestesten stillen Entschließung durch alle Grade herabgedämpft!“7 Auch wenn heute nicht mehr ermittelt werden kann, inwieweit Bach auf diese Vorgaben einging, so ist die Ansicht Jörg Krämers zweifellos berechtigt, Herder sei im Brutus „zu Ergebnissen [gelangt], die mit den um 1770 verfügbaren musikalischen Mitteln kaum einzulösen waren“.8 Und man mag es als symptomatisch ansehen, daß sogar Wilhelm Heinse, dessen Musikästhetik manche Ähnlichkeit mit derjenigen Herders offenbart,9 aus seiner Irritation keinen Hehl machte, als er 1774 an Johann Wilhelm Ludwig Gleim schrieb: 3 4 5 6 7 8 9 18 Jörg Krämer: Deutschsprachiges Musiktheater im späten 18. Jahrhundert. Typologie, Dramaturgie und Anthropologie einer populären Gattung, 2 Bde., Tübingen 1998 (Studien zur deutschen Literatur 149/150), Bd. 1, S. 261–292, hier S. 276. Laurenz Lütteken: Das Monologische als Denkform in der Musik zwischen 1760 und 1785, Tübingen 1998 (Wolfenbütteler Studien zur Aufklärung 24), S. 260–266, hier S. 263. Jörg Krämer: Deutschsprachiges Musiktheater im späten 18. Jahrhundert, Bd. 1, S. 272. Johann Gottfried Herder: Brutus. Ein Drama zur Musik (Älteste Fassung von 1772), in: Sämmtliche Werke, Bd. 28, S. 16. Zum Problem der verschiedenen Fassungen und Editionen des Brutus vgl. Jörg Krämer: Deutschsprachiges Musiktheater im späten 18. Jahrhundert, Bd. 1, S. 261 f. (Fußnote 1), sowie Laurenz Lütteken: Das Monologische als Denkform in der Musik zwischen 1760 und 1785, S. 260 f. Johann Gottfried Herder: Brutus. Ein Drama zur Musik (Älteste Fassung von 1772), in: Sämmtliche Werke, Bd. 28, S. 18. Jörg Krämer: Deutschsprachiges Musiktheater im späten 18. Jahrhundert, Bd. 1, S. 292; auch Laurenz Lütteken sieht in Herders Brutus nichts weniger als den utopischen Versuch, „durch bewußte Negierung der konventionellen Grenzen ein ganz neues Theater zu schaffen“ (Das Monologische als Denkform in der Musik zwischen 1760 und 1785, S. 264). Vgl. hierzu S. 83–94 der vorliegenden Studie. „Von Herdern hab’ ich hier ein Singspiel – Brutus – gelesen, welches das Unsinnigste Ding ist, was mir noch je vor die Augen gekommen. Es ist kein Menschenverstand heraus zu denken.“10 Die beiden oben angeführten Zitate aus dem Brief an Gluck sind indessen nicht nur für Herders eigenwillige Opernkonzeption von Interesse, sondern lassen sich auch als Dokumente einer Musikanschauung lesen, die vom damaligen ästhetischen Konsens in manchen Punkten weit entfernt war. Bedeutungsvoll ist dabei zum einen die metaphorische Beschreibung der Musik als ,Strom‘, geleitet nur von den ,dazwischen gestreuten‘ Worten des Librettos, und zum anderen der spöttische Hinweis, das ,alte Hauptgesetz der Musik, alles rund zu machen‘, sei manchem Komponisten ,Lehn- und Schlafstuhl‘ geworden, in dem er sich ,periodisch wieget‘. Nicht unbegründet scheint die Vermutung, Herder habe mit diesen Äußerungen auf den „inkorporierte[n] common sense des späten 18. Jahrhunderts“ anspielen wollen,11 auf Johann George Sulzer und seine Allgemeine Theorie der schönen Künste, denn dort findet sich im Artikel „Melodie“ der warnende Hinweis, es wäre „allemal ein Fehler“, wenn „der ganze Gesang, ohne merkliche Einschnitte, wie ein ununterbrochener Strom wegflöße“ oder aber „die Einschnitte so weit gedähnt wären, daß sie unvernehmlich würden“.12 Unter „Einschnitten“ verstehen Sulzer und sein musikalischer Mitarbeiter Johann Philipp Kirnberger13 – wie es in dem entsprechenden Artikel heißt – die „kleinern Glieder“ einer Periode, „deren jedes insgemein ein Rhythmus genennt wird [...]. Die von vier Takten sind die gewöhnlichsten und besten“, und sofern man „blos auf den Wolklang des Gesanges siehet“, müßten sich „Einschnitte von gleicher Länge durch die ganze Melodie“ ziehen.14 Zwar sei es möglich, im Interesse eines besonderen Ausdrucks gelegentlich kürzere oder längere Einschnitte anzubringen, doch dürfe das „Ebenmaaß der Glieder“ nicht soweit darunter leiden, daß die Melodie jede Faßlichkeit einbüße.15 10 11 12 13 14 15 Brief Wilhelm Heinses an Johann Wilhelm Ludwig Gleim vom 17. Mai 1774, in: Wilhelm Heinse: Sämmtliche Werke, hrsg. von Carl Schüddekopf, Bd. 9: Briefe. Erster Band. Bis zur italiänischen Reise, Leipzig 1904, S. 213. Carl Dahlhaus: Die Idee der absoluten Musik, Kassel u. a. 1978, S. 83. Johann George Sulzer: Allgemeine Theorie der schönen Künste (1771/1774), Leipzig 21792–1794. Nachdruck Hildesheim u. a. 1994, Bd. 3, S. 378. Herders Reaktion auf das Erscheinen von Sulzers Kompendium läßt sich am besten aus einem Brief an Johann Heinrich Merck vom 16. November 1771 ablesen: „Alle literarisch-kritische Artikel taugen nichts; die meisten mechanischen nichts; die psychologischen sind die einzigen und auch in denen das langwierigste darbendste Geschwätze, sowie auch Landsmannschaft und Partheilichkeit aus dem ganzen Werke leuchtet“ (Johann Gottfried Herder: Briefe, Bd. 2, S. 106). Zur Frage der Autorschaft vgl. Anselm Gerhard: „Man hat noch kein System von der Theorie der Musik“. Die Bedeutung von Johann George Sulzers „Allgemeiner Theorie der Schönen Künste“ für die Musikästhetik des ausgehenden 18. Jahrhunderts, in: Schweizer im Berlin des 18. Jahrhunderts, hrsg. von Martin Fontius und Helmut Holzhey, Berlin 1996 (Aufklärung und Europa. Beiträge zum 18. Jahrhundert 1), S. 341–353, bes. S. 346–348. Johann George Sulzer: Allgemeine Theorie der schönen Künste, Bd. 2, S. 35 f. Ebd., Bd. 3, S. 378. 19 Wird an diesem Punkt bereits erkennbar, daß Herder sich mit seiner Auffassung der Musik als ,Strom‘ sozusagen wörtlich von Sulzers Ästhetik absetzt, so liefert die folgende Passage des Artikels „Rhythmus“ aus der Allgemeinen Theorie der schönen Künste hierfür eine nachdrückliche Bestätigung: „Hat nun der Rhythmus außer seiner richtigen Abmessung der Zeit noch etwas charakteristisches; ist er fröhlich, zärtlich, ernsthaft: so wird auch auf jede periodische Wiederkunft desselben Gliedes, der Eindruk derselben Empfindung wiederholt“ und „das Gemüth in dieser Empfindung gleichsam eingewieget.“16 Offenbar scheinen Herder und Sulzer zwei unterschiedliche Konzepte von Rhythmus und Melodie, letztlich von Musik überhaupt zu vertreten, auch wenn die Äußerungen Herders in dem Brief an Gluck zu aphoristisch sind, um eindeutige Schlußfolgerungen zuzulassen. Jedenfalls ist nicht zu leugnen, daß die Bemerkung, es sei das ,alte Hauptgesetz der Musik, alles rund zu machen‘, sich mit der von Sulzer favorisierten Gliederung des melodischen Verlaufs in ,ebenmäßige‘ Viertakt-Phrasen zusammendenken läßt, wie auch der Hinweis auf das ,periodische Wiegen‘ im ,Lehn- und Schlafstuhl‘ einförmiger Melodien als ironisch verbrämtes Zitat aus dem Rhythmus-Artikel gelesen werden kann. Versucht man, der Differenz zwischen den ästhetischen Entwürfen Herders und Sulzers genauer nachzugehen, so bietet sich als Ausgangspunkt die axiomatische Feststellung Sulzers an, es liege im Wesen der Musik, eine „Aeußerung der Leidenschaft [...] durch Töne“ nachzuahmen, „die einzeln völlig gleichgültig sind, und nichts von Empfindung anzeigen“. Denn: „Es wird Niemand sagen können, daß er bey Anschlagung eines einzelen [sic!] Tones der Orgel, oder des Clavieres etwas Leidenschaftliches empfinde.“17 Ein schärferer Gegensatz zu Herders anthropologisch fundierter Betrachtungsweise ist kaum denkbar, denn besonders im Vierten Kritischen Wäldchen wird die affektive Wirkungsqualität des einzelnen Tones, unabhängig von allen melodischen und harmonischen Relationen, zum archimedischen Punkt dessen erklärt, was Herder selbst eine „Musikalische Monadologie“ nennt und als unumgängliche Voraussetzung für die „Philosophie des Tonartig Schönen“ begreift: „Laßet einen Ton, den verfeinerten und gleichsam einfach gemachten Stoß der Luftwelle zu ihm [dem Ohr] dringen; was fühlt es ihn ihm für Verhältniße? Keine! Und doch fühlet es im ersten Momente, abstrahirt von allen Folgetönen, die ursprüngliche einfache Macht einer einzelnen unmittelbaren Sensation. Und doch kann ein solcher Ton, ohne Verbindung und Folge, uns so tief erschüttern, so innig rühren, so gewaltsam bewegen, das dies Eine Erste Moment der Empfindung, dieser einfache Accent der 16 17 20 Ebd., Bd. 4, S. 99. Ebd., Bd. 3, S. 370. Musik an innerer Maße mehr ist, als das Produkt aller Empfindungen, aus allen Verhältnißen, allen Harmonien eines großen langen Stücks?“18 Die Unmittelbarkeit der Tonempfindung In seiner 1772 erstmals gedruckten Abhandlung über den Ursprung der Sprache führt Herder aus, daß die durch das Ohr auf die Seele einwirkenden Empfindungslaute aller lebenden Wesen für Mensch und Tier nicht nur unmittelbar verständlich seien, sondern auch sympathetisch mitempfunden würden, und um diese „Mechanik fühlender Körper“ zu erläutern, greift er – keineswegs zufällig – auf ein genuin musikalisches Phänomen zurück, nämlich das der gleichschwingenden Saiten: „Je harmonischer das empfindsame Saitenspiel selbst bei Thieren mit andern Thieren gewebt ist: desto mehr fühlen selbst diese mit einander; ihre Nerven kommen in eine gleichmäßige Spannung, ihre Seele in einen gleichmäßigen Ton, sie leiden würklich Mechanisch mit.“19 Hier wird ein Erklärungsmodell etabliert, das auch im Vierten Kritischen Wäldchen dazu dient, die affektive Wirkung der Musik auf physiologische Ursachen – auf eine „innere Physik des Geistes“20 – zurückzuführen.21 Herder nimmt an, daß sich im Innern des Ohres ein „Saitenspiel von Gehörfibern“ befindet, welches durch die Schallwellen des erklingenden Tones erschüttert wird und solchermaßen ein „widriges“ oder „angenehmes“ Gefühl hervorbringt, je nachdem, ob die „Gehörfibern“ in eine „ungleichartige“ oder „homogene“ Bewegung geraten.22 Im letzteren Fall erzeugt die Schwingung des Klanges entweder eine Anspannung oder eine Erschlaffung der Nervenstränge, und hieraus ergibt sich wiederum die „Haupteintheilung der Musik in harte und weiche Schälle, Töne und Tonarten“.23 Daß dieser Vorgang tatsächlich als rein mechanischer zu begreifen ist und alle höheren Seelentätigkeiten zunächst ausgespart bleiben, macht Herder auf drastische Weise deutlich, wenn er in einem späteren Text den griechischen Gott Apollon zur Muse der Tonkunst sagen läßt: 18 19 20 21 22 23 Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 114, 91, 94. Johann Gottfried Herder: Abhandlung über den Ursprung der Sprache (1772), in: Sämmtliche Werke, Bd. 5, S. 5, 15. Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 97. Zu der folgenden Darstellung vgl. auch Ulrike Zeuch: „Ton und Farbe, Auge und Ohr, wer kann sie commensurieren?“, bes. S. 235–241 und 249–257, sowie Friedhelm Solms: Disciplina aesthetica, S. 213– 241. Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 102 f. Ebd., S. 103. 21 „Ja, als man den grausamen Versuch machte, lebendigen Geschöpfen das Gehirn zu öfnen, und durch gewiße Druckungen bei ihnen bald Schmerz, bald Freude erregte; mochten diese Empfindungen, auf eine grobe Weise bewirkt, etwas anders seyn, als was du auf eine unendlich feinere Weise bewirkest?“24 Mag das Beispiel der Vivisektion an dieser Stelle einerseits irritieren, so nimmt Herder mit seiner „Gleichschaltung von Nervenfiber und Saite“ andererseits vorweg,25 was Hermann von Helmholtz 1863 in der Lehre von den Tonempfindungen systematisch entwickeln sollte, nämlich die Resonanztheorie des Hörens.26 Herders These, die „Ursache von der verschiednen Empfindbarkeit der Töne“ müsse in Analogie dazu erklärt werden, daß „beim Wiederschalle eines Klaviers nur immer der Ton antwortet, der gefragt wird“,27 findet sich bei Helmholtz knapp hundert Jahre später in fast wörtlicher Übereinstimmung wieder: „Denken wir uns den Dämpfer eines Claviers gehoben, und lassen irgend einen Klang kräftig gegen den Resonanzboden wirken, so bringen wir eine Reihe von Saiten in Mitschwingung, nämlich alle die Saiten und nur die Saiten, welche den einfachen Tönen entsprechen, die in dem angegebenen Klange enthalten sind. Hier tritt also auf rein mechanischem Wege eine ähnliche Trennung der Luftwellen ein wie durch das Ohr, indem die an sich einfache Luftwelle eine gewisse Anzahl von Saiten in Mitschwingung bringt, und indem das Mitschwingen dieser Saiten von demselben Gesetze abhängt, wie die Empfindung der harmonischen Obertöne im Ohre. [...] Könnten wir nun jede Saite eines Claviers mit einer Nervenfaser so verbinden, dass die Nervenfaser erregt würde und empfände, so oft die Saite in Bewegung geriethe: so würde in der That genau so, wie es im Ohre wirklich der Fall ist, jeder Klang, der das Instrument trifft, eine Reihe von Empfindungen erregen, genau entsprechend den pendelartigen Schwingungen, in welche die ursprüngliche Luftbewegung zu zerlegen wäre [...].“28 Durch die enorme Breitenwirkung und über Jahrzehnte anerkannte Gültigkeit der Lehre von den Tonempfindungen wurde im späteren 19. Jahrhundert auch Herders Ansatz wieder virulent, ohne daß Helmholtz und seine Zeitgenossen sich diese historische Analogie freilich bewußt gemacht hätten.29 Herders Überlegungen zur Funktionsweise des Ohres und zu der Art und Weise, wie durch Töne Empfindungen ausgelöst werden, standen ihrerseits freilich in einer langen Tradition. Bereits 1650 hatte Athanasius Kircher in seiner Musurgia universalis die Analogie von musi24 25 26 27 28 29 22 Johann Gottfried Herder: Ob Malerei oder Tonkunst eine größere Wirkung gewähre? Ein Göttergespräch (1785), in: Sämmtliche Werke, Bd. 15, S. 231 f. Wolfgang Scherer: Klavier-Spiele. Die Psychotechnik der Klaviere im 18. und 19. Jahrhundert, München 1989 (Materialität der Zeichen), S. 105. Zur Parallelität der Theorien von Herder und Helmholtz vgl. ausführlich Friedhelm Solms: Disciplina aesthetica, S. 234–238. Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Schriften, Bd. 4, S. 102. Hermann [von] Helmholtz: Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik (1863), Braunschweig 31870, S. 197. Siehe unten, S. 179–181. kalischer und seelischer Bewegung mit der ,sympathia‘ zweier Saiten verglichen, die in gleiche Schwingung geraten, sobald eine von ihnen angeschlagen wird.30 War dabei noch die Vorstellung des ,spiritus animalis‘ maßgebend, einer quasi immateriellen Substanz, die Galenus von Pergamon (129–199 n. Chr.) im Gehirn zu lokalisieren glaubte und von der man bis ins 17. Jahrhundert annahm, daß sie sich wie feiner Dunst durch das Nervensystem im ganzen Körper verteile, so kam mit der 1680/1681 posthum veröffentlichten Schrift De motu animalium des Mathematikers und Physikers Giovanni Alfonso Borelli erstmals die Theorie auf, das Wirkungsprinzip der Nerven sei als Erschütterung elastischer Fasern zu begreifen.31 Wesentliche Impulse erhielt diese Auffassung durch Isaac Newton, der die Reizübertragung zwischen äußeren Sinnesorganen, Gehirn und Muskeln – „according to the laws which [...] serves to account all the motions of the celestial bodies“ – auf einen „electric and elastic spirit“ zurückführte: „And now we might add something concerning a certain most subtle spirit which pervades and lies hid in all gross bodies; by the force and action of which spirit [...] all sensation is excited, and the members of animal bodies move at the command of the will, namely, by the vibrations of this spirit, mutually propagated along the solid filaments of the nerves, from the outward organs of sense to the brain, and from the brain into the muscles.“32 Wie stark Herder von dieser Ansicht geprägt war, zeigt die Tatsache, daß er 1775 in der zweiten Fassung des Essays Vom Erkennen und Empfinden die „Elasticität“ als „wunderbare Erscheinung“ bezeichnete, als Voraussetzung des „große[n] Schauspiel[s] würkender Kräfte“ in der Natur („Schwere, Stoß, Fall, Bewegung, Ruhe, Kraft, Trägheit“), das dem Menschen ein getreues Spiegelbild der Mechanik seines eigenen Fühlens liefere: „Der empfindende Mensch fühlt in allem nur seine Empfindung, und je mehr er sie in allem was sich regt fühlet, desto reicher wird er auch für seine Empfindung, für die in ihm sich regende Natur, an Ähn- 30 31 32 Athanasius Kircher: Musurgia Universalis, Rom 1650. Nachdruck Hildesheim u. a. 21999. Mit einem Vorwort, Personen-, Orts- und Sachregister von Ulf Scharlau, Bd. 1, S. 552 (vgl. hierzu Rolf Dammann: Der Musikbegriff im deutschen Barock, Köln 1967, S. 248 f.). Die hier gegebene Darstellung stützt sich auf Astrid Gesche: Johann Gottfried Herder. Sprache und die Natur des Menschen, Würzburg 1993 (Epistemata. Würzburger Wissenschaftliche Schriften. Reihe Literaturwissenschaft 97), S. 33–42, sowie Manfred Wenzel: Vorstellungen über Gehirn, Nerven und Seele in der Geschichte der Medizin, in: Samuel Thomas Soemmerring: Werke. Begründet von Gunter Mann, hrsg. von Jost Benedum und Werner Friedrich Kümmel. Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Bd. 9, Basel 1999, S. 19–52. Isaac Newton: Philosophiae naturalis principia mathematica (1686–1687). Translated into English by Andrew Motte in 1729. The Translations Revised, and Supplied with an Historical and Explanatory Appendix, by Florian Cajori, Berkeley/Cal. 1947, S. 547. 23 lichkeit, Bildern, Sprache. So ward Newton in seinem Weltgebäude wider Willen ein Dichter [...].“33 Im Anmerkungsapparat des zweiten Bandes seiner Herder-Ausgabe weist Wolfgang Proß nach, daß Herder sich hier – wie auch im Vierten Kritischen Wäldchen – vor allem auf einen ungenannt bleibenden Autor stützte, nämlich Johann Gottlob Krüger, dessen vierbändige Naturlehre sukzessiv ab 1740 erschienen war und bis in die 1770er Jahre hinein immer wieder neu aufgelegt wurde.34 Anders als Albrecht von Haller, den Herder mehrfach namentlich erwähnt und der daher für die Forschung lange Zeit als sein eigentlicher Gewährsmann auf medizinischem Gebiete galt,35 war Krüger ein Anhänger der These, daß die zugleich gespannten und elastischen Nervenstränge durch Außenreize buchstäblich in Schwingung geraten, was ihn zu jenem Vergleich mit den Saiten eines Instrumentes brachte, der bei Herder immer wieder den angestrebten Konnex zwischen Physiologie und Ästhetik verbürgt: „Wenn eine gespannte Saite angestossen wird, so geräth sie in eine zitternde Bewegung, wie wir solches nicht nur mit Augen sehen, sondern auch gar leicht aus den Gesetzen der Elasticität erweisen können. Wenn nun die Nervenhäute nicht anders anzusehen sind, als wenn sie aus lauter solchen gespannten Saiten zusammengesetzt wären [...]: so müssen sie ebenfals in eine zitternde Bewegung gerathen, wenn ein anderer Cörper mit zureichender Kraft an sie anstößt. [...] Ich weis es wol, mein Einfall wird vielen thöricht vorkommen, und vielleicht ist er es auch. Mein GOtt [sic!], wird man sprechen, was will man noch aus dem Leibe der Menschen machen? Sehr lange hat man ihn für einen Bratenwender gehalten, und nun soll er gar eine Violine seyn. [...] Aber im rechten Ernste, die Vergleichung des menschlichen Leibes mit einem musicalischen Instrumente gefällt mir sehr wohl.“36 Die Frage, wie sich eine Vibration der Nerven in Empfindung transformiert, war freilich mit dieser Theorie noch nicht beantwortet und stand auch außerhalb der Erkenntnismöglichkeiten damaliger Physiologie. Charles Bonnet beispielsweise, der Herder mit seinem wichtigen Essai analytique sur les facultés de l’âme (1760) nachweislich beeinflußte,37 hielt es für unhinterfragbar, daß die Korrespondenzbeziehung zwischen den Nerven und der anatomisch letztlich 33 34 35 36 37 24 Johann Gottfried Herder: Vom Erkennen und Empfinden, den zwo Hauptkräften der Menschlichen Seele (1775), in: Sämmtliche Werke, Bd. 8, S. 271 f. Vgl. Wolfgang Proß: [Kommentar und Anmerkungen zu „Vom Erkennen und Empfinden“], in: Johann Gottfried Herder: Werke, hrsg. von Wolfgang Proß, Bd. 2: Herder und die Anthropologie der Aufklärung, München und Wien 1987, S. 1005–1026, hier S. 1007 f., 1015 f. Vgl. Astrid Gesche: Johann Gottfried Herder. Sprache und die Natur des Menschen, S. 35–40, sowie Friedhelm Solms: Disciplina aesthetica, S. 195–197, 202 f., 210, 232. Johann Gottlob Krüger: Naturlehre, Theil 2: Physiologie, Halle 21748, S. 586 f., 645. Zitiert nach: Wolfgang Proß: [Kommentar und Anmerkungen zu „Vom Erkennen und Empfinden“], S. 1015 f., 1008. Vgl. Ralph Häfner: „L’âme est une neurologie en miniature“. Herder und die Neurophysiologie Charles Bonnets, in: Der ganze Mensch. Anthropologie und Literatur im 18. Jahrhundert. DFG-Symposion 1992, hrsg. von Hans-Jürgen Schings, Stuttgart und Weimar 1994 (Germanistische Symposien. Berichtsbände 15), S. 390–409. nicht zu lokalisierenden Seele von Gott gestiftet sei,38 und Herder selbst schränkt die Saitenmetaphorik am Beginn seiner Abhandlung über den Ursprung der Sprache mit der Bemerkung ein: „Ich muß mich dieses Gleichnißes bedienen, weil ich für die Mechanik fühlender Körper kein beßeres weiß!“39 Nicht zu bezweifeln war für Herder indessen, daß die allgemeinen Wirkungsgesetze der Natur, wie sie vor allem Newton beschrieben hatte, auch das dynamische Kräftespiel der Gemütsbewegungen lenken, da die ,Mechanik fühlender Körper‘ in der Mechanik des Kosmos ihr Gegenbild finde.40 „So wie sich Planetenkörper im Universum durch die Anziehungs- und Zurückstoßungskraft gebildet: so auch unsre Seele den Körper: und so Gott die Welt.“41 Folglich mußte es darum gehen, das Seelenleben des Menschen und die Art und Weise, wie es durch ästhetische Wahrnehmung beeinflußt werden kann, auf jene Grundprinzipien zurückzuführen, die sich auch bei physikalischen Phänomenen beobachten lassen: „Wie der Magnet das Eisen ziehet, wie der Ton einer Saite die andre regt, wie jede Bewegung, Leidenschaft, Empfindung sich fortpflanzet und mittheilt, wo sie nicht Widerstand finden; so ist auch die Würkung der Sprache der Sinne allgemein und im höchsten Grade natürlich.“42 Und das entscheidende Bindeglied zwischen Physik und Psychologie fand Herder bei Edmund Burke, dessen empirische Ästhetik noch in Kalligone mit einer emphatischen Lobrede bedacht und gegen Immanuel Kants Transzendentalphilosophie ausgespielt wird: „Burke war ein Talent- und Einsichtsvoller, ein beredter, und wo ihn Vorurtheile nicht blendeten, ein sehr verständiger Mann. [...] Sein Erhabnes und Schönes setzt er in zwei Tendenzen der menschlichen Seele, fast ähnlich den beiden Grundkräften des Universum nach Newton, Anziehung und Zurückstoßung. [...] Vermöge dieser zwei Kräfte gravitirt und erhält sich das moralische Weltall, wie das physische durch jene zwei ähnliche Kräfte Newtons. Unser Herz ist der Brennpunkt beider.“43 38 39 40 41 42 43 Vgl. Astrid Gesche: Johann Gottfried Herder. Sprache und die Natur des Menschen, S. 40 (Fußnote 73), sowie Manfred Wenzel: Vorstellungen über Gehirn, Nerven und Seele in der Geschichte der Medizin, S. 29 f. Johann Gottfried Herder: Abhandlung über den Ursprung der Sprache, in: Sämmtliche Werke, Bd. 5, S. 5. Joachim Gessinger spricht in diesem Zusammenhang von „Herders Versuch, die Metaphysik auf die Physik zu reduzieren“ (Auge und Ohr, S. 75–79, hier S. 77). Doch muß bedacht werden, daß Herder alle „neurophysiologische[n] Phänomene [...] nur als ,Anwendungen‘ jenes ehernen kosmischen Gesetzes von Kontraktion und Expansion“ erscheinen, „dessen metaphysische Dignität puren Materialismus oder Physikalismus“ ausschließt (Friedhelm Solms: Disciplina aesthetica, S. 200); vgl. auch Walter D. Wetzels: Herders Organismusbegriff und Newtons Allgemeine Mechanik, in: Johann Gottfried Herder (1744–1803), S. 177– 185, bes. S. 181 f. Johann Gottfried Herder: Grundsätze der Philosophie (um 1769), in: Sämmtliche Werke, Bd. 32, S. 229. Johann Gottfried Herder: Ueber die Würkung der Dichtkunst auf die Sitten der Völker in alten und neuen Zeiten. Eine Preisschrift (1778), in: Sämmtliche Werke, Bd. 8, S. 339. Johann Gottfried Herder: Kalligone (1800), in: Sämmtliche Schriften, Bd. 22, S. 230. 25 Auch im Vierten Kritischen Wäldchen beruft sich Herder bei seinen Erörterungen zur Funktionsweise des Ohres auf Burke, genauer gesagt auf dessen These, daß Gefühle des Schönen mit einer Erschlaffung, solche des Erhabenen mit einer Anspannung des Nervensystems verbunden seien – ein streng mechanistisches Prinzip, das Herder zu der Annahme bewegt, die Empfindungsqualität musikalischer Töne sei nicht anders zu erklären als durch die Wechselwirkung zwischen der jeweiligen Luftschwingung und dem analogen Vibrieren der ,Gehörfibern‘, das sich über die Nervenstränge des Körpers bis in das Gemüt fortpflanze und dort eine entsprechende Affektreaktion auslöse. Dahinter steht die von der sensualistischen Philosophie vorgezeichnete Grundüberzeugung, daß – mit den Worten Burkes – „natural objects affect us, by the laws of that connexion, which Providence has established between certain motions and configurations of bodies, and certain consequent feelings in our minds“, indem nämlich „certain affections of the mind [...] cause certain changes in the body“, wie umgekehrt „certain powers and properties in bodies [...] work a change in the mind“.44 In scharfen Gegensatz tritt Herder allerdings zu einem anderen Denker des 18. Jahrhunderts, nämlich Jean-Jacques Rousseau, was um so bemerkenswerter ist, als die philosophischen Entwürfe beider Autoren auf anderen Gebieten – etwa hinsichtlich ihrer Theorie des Sprachursprungs45 – deutliche Berührungspunkte zeigen.46 Für Rousseau steht fest, daß man „les vrais principes de la musique et de son pouvoir sur les cœurs“ nicht erklären könne, „tant qu’on ne voudra considérer les sons que par l’ébranlement qu’ils excitent dans nos nerfs“.47 „Mais dans ce siécle où l’on s’efforce de matérialiser toutes les opérations de l’ame et d’ôter toute moralité aux sentimens humains, je suis trompé si la nouvelle philosophie ne devient aussi funeste au bon goût qu’à la vertu.“48 „Les couleurs et les sons peuvent beaucoup comme réprésentations et signes, peu de chose comme simples objets des sens“, woraus folgt, daß es nicht die Töne selbst sind, die das Gemüt des Menschen in Bewegung versetzen, sondern allein dasjenige, was durch ihre melo44 45 46 47 48 26 Edmund Burke: A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757), hrsg. von James T. Boulton, London 1958, S. 163, 130. Herder lernte Rousseaus bereits 1755 skizzierten, aber erst 1781 posthum veröffentlichten Essai sur l’origine des langues zehn Jahre nach seiner eigenen Abhandlung über den Ursprung der Sprache kennen und kommentierte die Lektüre in einem Brief an Johann Georg Hamann vom 11. Juli 1782 mit den Worten: „Unter seinen [Rousseaus] Oeuvres posthumes ist ein Aufsatz sur l’Origine des langues, den ich zu lesen bitte; es sind freilich bekannte Sachen, aber doch stark u. hübsch gesagt“ (Johann Gottfried Herder: Briefe, Bd. 4, S. 226). Zur „Diskrepanz, welche den Horizont der beiden Autoren grundsätzlich unterscheidet“, vgl. auch Pierre Pénisson: „Tönen“ bei Rousseau und Herder, in: Johann Gottfried Herder (1744–1803), S. 186–193, hier S. 186. Jean-Jacques Rousseau: Essai sur l’origine des langues où il est parlé de la mélodie et de l’imitation musicale (1755), in: Œuvres complètes, Bd. 5: Écrits sur la musique, la langue et le théâtre, hrsg. von Bernard Gagnebin u. a., Paris 1995 (Bibliothèque de la Pléiade 416), S. 371–429, hier S. 417. Ebd., S. 419. dische Folge nachgeahmt bzw. repräsentiert werden kann: „les accens des langues, et les tours affectés dans chaque idiome à certains mouvemens de l’ame“.49 Während für Herder jeder einzelne Ton durch die Wechselwirkung mit dem ,Saitenspiel der Gehörfibern‘ – also durch seine materielle Qualität an sich – bereits Empfindungen auszulösen vermag, tritt das Klangliche bei Rousseau hinter die Notwendigkeit zurück, der Melodie durch Nachahmung des Tonfalls der jeweiligen Landessprache erst eine affektive Bedeutung einzuschreiben, die sich wiederum nur demjenigen erschließt, der dieser Sprache kundig ist: „Comme les sentimens qu’excite en nous la peinture ne viennent point des couleurs, l’empire que la musique a sur nos ames n’est point l’ouvrage des sons. [...] C’est le dessein, c’est l’imitation qui donne à ces couleurs de la vie et de l’ame, ce sont les passions qu’elles expriment qui viennent émouvoir les nôtres, ce sont les objets qu’elles réprésentent qui viennent nous affecter. [...] Il faut à l’Italien des airs italiens, au Turc il faudroit des airs Turcs. Chacun n’est affecté que des accens qui lui sont familiers; ses nerfs ne s’y prêtent qu’autant que son esprit les y dispose: il faut qu’il entende la langue qu’on lui parle pour que ce qu’on lui dit puisse le mettre en mouvement.“50 Wenn Pierre Pénisson bemerkt, Rousseau habe in seinem Essai sur l’origine des langues – anders als Herder – „die Sprache unter die Herrschaft des Bildes“ gestellt und der „Analogie zwischen Ton und Bild“ eine tragende Funktion zugewiesen,51 so gilt dies nicht zuletzt für das beharrlich repetierte Argument, der unmittelbar auf die Sinne einwirkende Klang sei ebensowenig für die Erregung von Leidenschaften durch Musik verantwortlich zu machen wie in der Malerei die bloße Farbe. Ein Gemälde fügt sich für Rousseau erst dann dem grundlegenden Prinzip der ‚imitation‘, wenn es mittels zeichnerischer Konturen bestimmte Gegenstände vorgibt, an denen sich die Rezeption zu entzünden vermag, und in der Musik müsse folgerichtig die auf den Sprachtonfall bezogene Melodie als ,dessein‘ hinzutreten, „pour [...] affecter l’esprit de diverses images“.52 Herder hingegen brandmarkt die Analogisierung von Musik und Bild, von Farbe und Ton, als grundsätzliches Mißverständnis, zumindest hinsichtlich ihrer Wirkungsqualität, wobei er zwar – unter Berufung auf Newton und Euler – konzediert, daß sich Licht und Schall physikalisch gleichermaßen als Schwingung begreifen lassen, jedoch eine weitergehende Vergleichbarkeit in Abrede stellt: „Licht und Farben sprechen durchs Auge für unsern Verstand, zeichnend und zierend; Töne reden dem Herzen und Gefühl. [...] Denn möge das Licht auch durch Schwingungen auf Körper wirken, im Körper schwingt sich dadurch nichts als etwa die Fasern des 49 50 51 52 Ebd., S. 418 f., 416. Ebd., S. 412 f., 418. Pierre Pénisson: „Tönen“ bei Rousseau und Herder, S. 186, 192. Jean-Jacques Rousseau: [Artikel] Mélodie, in: ders.: Dictionnaire de musique, Genf 1767. Zitiert nach: Œuvres complètes, Bd. 5: Écrits sur la musique, la langue et le théâtre, S. 603–1154, hier S. 885. 27 Sehnervs; seine andern Wirkungen gehen, verbunden mit der Wärme, auf ein wesentlicheres Wohlseyn, auf Leben, Genuß, Wachsthum, Nahrung, Gedanken. Dem Organ, das Empfindungen erregen soll, war ein bei weitem nicht so feines Medium nöthig, der Schall. Harmonisch mit dem geschwungenen klingenden Körper klingt in uns ein geistiges Clavichord und tönet ihm nach [...]; ein unsichtbarer, weckender Geist spricht mit unserm fühlenden Ich in Succession. Umkehren hieße es die Natur, wenn man die Folge zur bleibenden Gegenwart, diese zur hinschwindenden Folge, das Aeußere zum Innern, das Innere zum Aeußern, Gestalt zu Ton und Wort, diese zur stummen Gestalt machen wollte: bleibe jedem Organ das Universum und das Mittel der Wirkung, das ihm gebühret.“53 In diesem späten Fragment bringt Herder nicht nur die Resonanztheorie des Hörens zur Sprache, sondern auch jenen Gegensatz, der seine Musikästhetik – wie noch zu zeigen sein wird – von den frühesten bis zu den letzten Schriften als roter Faden durchzieht und die bei Rousseau hervorgehobene Parallelität von Farbe und Ton bzw. von Zeichnung und Melodie obsolet erscheinen läßt, nämlich den Gegensatz zwischen Auge und Ohr, zwischen optischer und akustischer Wahrnehmung, zwischen Gestalt und Sukzession. Wo jedoch die Schwingungszahlen ausschließlich zur physikalischen oder mathematischen Erklärung musikalischer Phänomene dienen, bleibt Herder skeptisch, denn auf diese Weise könnten nur quantitative Verhältnisse erfaßt werden. Über die ästhetische Wirkung von Musik hingegen sei nichts gesagt, wenn man die Intervalle auf numerisch bestimmbare Proportionen zurückführe, da das Ohr – im Gegensatz zum Auge – keine Verhältnisse wahrnehme, weshalb es sich als fruchtlos erweisen müsse, den Ton „wie eine Farbe [zu] zergliedern“.54 Jeder Ton stellt für Herder gleichsam eine ,Monade‘ dar,55 d. h. er bildet nicht nur ein unteilbares Ganzes, sondern ist auch „seinem Wesen nach (so fern es der Franzose timbre nennet)“ einzigartig, also hinsichtlich der durch ihn ausgelösten Empfindungen von allen anderen Tönen bzw. ,Ton-Monaden‘ unterschieden.56 Die qualitative Eigenart des Tones könne nicht in dessen Stärke oder Schwäche bzw. Höhe oder Tiefe begründet sein, denn da es sich hierbei um relative Werte handelt, würde eine solche Bestimmung wiederum nur von Verhältnissen ausgehen und zu neuen Verhältnissen führen, was der Beschaffenheit des Ohres widerspräche. Folglich sei die Verschiedenheit der Töne nicht anders zu erklären als durch ihre Wechselwirkung mit den unterschiedlichen ,Gehörfibern‘, dergestalt, daß gewissermaßen jeder Ton „seine Saite im Spiele des Gehörs“ trifft und sie in eine „homogene“ oder „ungleichartige“ 53 54 55 56 28 Johann Gottfried Herder: Fragment über Licht und Farben, und Schall (um 1801–1803), in: Sämmtliche Werke, Bd. 24, S. 440. Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 90. Zu Herders Bezugnahme auf die von Gottfried Wilhelm Leibniz entworfene Theorie der ,Monade‘ vgl. Ursula Schmitz: Dichtung und Musik in Herders theoretischen Schriften, S. 58 f. Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 95. Schwingung versetzt, woraus dann die jeweilige Empfindung resultiert.57 Bei diesem eigenwilligen Versuch einer ,musikalischen Monadologie‘ geht Herder letztlich so weit, daß er sogar die natürlichen Obertöne als bloße „Nachklänge“ betrachtet, die vom „hörbare[n] Punkt“ der eigentlichen ,Ton-Monade‘ zu trennen seien.58 Jean-Philippe Rameaus theoretische Begründung der Harmonie kann für ihn daher niemals zu einem tragfähigen Axiom musikalischer Ästhetik werden, denn selbst der aus den „harmonischen Töne[n]“ (Grundton, Terz und Quinte) gebildete Dreiklang, so argumentiert Herder, bleibt immer ein zusammengesetzter „Schall“, nach mathematisch-physikalischen Gesetzen proportioniert und deshalb „schön und Verhältnißmäßig für den Geist, aber grob und kalt für das Ohr“.59 „Der Akkord besteht aus dreien Tönen, die, da sie harmonisch sind, sich leichter zusammen hören lassen, als andre; die eben durch dies Zusammenhören einen Begrif von Proportion, und also Vergnügen erregen; kann dies Vergnügen aber Grundvergnügen der Musik seyn? Es ist das Resultat einer Composition, und also ein trockner Begrif des Geistes [...]. Akkord ist nur Schall, und alle Harmonieen von Akkorden nur Schälle; Schall ist nur Zusammensetzung, aus der also nichts weiter, als wieder Zusammensetzung und das Abstraktum derselben, Verhältniß folgt.“60 Um Herders fast obsessive Fixierung auf den einzelnen Ton und seine damit einhergehende Abneigung gegen jede Art von Zusammenklang verstehen zu können, muß man sich die geschichtsphilosophische Grundthese des Vierten Kritischen Wäldchens vergegenwärtigen, die Überzeugung nämlich, daß das Wesen von Musik und Sprache nur zu bestimmen sei, indem man ihren gemeinsamen Ursprung am Beginn der Menschheitsgeschichte aufsucht, während alle späteren historischen Entwicklungen – zumindest tendenziell – als Verfallsprozeß außer acht gelassen werden könnten.61 Die genetische Identität von Sprache und Gesang, festgehalten im antiken Begriff der mousikē, ist für Herder eine solch unumstößliche Tatsache, daß jede ästhetische Reflexion dort ihren Ausgang zu nehmen hat. Manche Passagen im Vierten Kritischen Wäldchen beschwören aus dieser Perspektive das Bild eines ,paradiesischen‘ Urzustandes herauf, in dem der natürliche „Sprachgesang“, wie ihn etwa noch die Griechen kannten, von allen Menschen auf die gleiche Weise ausgesandt und unmittelbar verstanden wurde, da ihr Gehör wesentlich sensibler war für die Nuancen der 57 58 59 60 61 Ebd., S. 103. Ebd., S. 94, 92. Ebd., S. 94, 113 (vgl. hierzu Rudolf Bockholdt: „Von unten herauf“, nicht „von oben herab“. Zu Herders Betrachtungen über Kunst und Musik, in: Musiktheorie 15 [2000], S. 247–254, bes. S. 252–254). Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 112 f. Rudolf Bockholdt („Von unten herauf“, nicht „von oben herab“, S. 253 f.) sieht in dieser Gleichsetzung von ,Ursprung‘ und ,Wesen‘ der Musik den Grund dafür, daß Herder im Vierten Kritischen Wäldchen die kompositorischen Entwicklungen seiner eigenen Zeit geflissentlich ignoriert. 29 klingenden Sprachlaute und sie „im Grundgefühl eines Tons tiefer empfanden als wir“.62 Aber nicht nur die Menschen, sondern alle Wesen waren Teil des übergreifenden Resonanzgewebes der Natur, in dem jede ,Ton-Monade‘ ihren bestimmten Platz hatte und, zum Klingen gebracht, sich eines ,mitfühlenden‘ Echos sicher sein konnte. Voller Emphase beschreibt Herder den „Sohn der Natur“, der „als Knabe schon Toneinfalt lieben, und sie in den unharmonischen Melodien der Nachtigall und aller himmlischen Sänger mitempfinden, und sie in den unharmonischen Accenten aller Leidenschaft der Natur mit jeder neuen holden Biegung und Verschiedenheit, wie eine gleichgestimmte zarte Saite, innig erkennen, und sympathetisch wiederholen, und auf ewig in sich einbeben, und mit jedem Momente eines Tons ein fühlbareres Geschöpf werden“ wird.63 Im Laufe der Zivilisationsgeschichte ging diese glückliche ,Toneinfalt‘ jedoch mehr und mehr verloren, so Herder, und mit ihr die naturgegebene Fähigkeit des Menschen, jeden Ton in seiner Einzigartigkeit wahrzunehmen und auf die hervorgerufene Erschütterung ,sympathetisch‘ zu antworten. Herders Insistieren auf der Qualität des einzelnen Tones hat freilich zur Konsequenz, daß er Melodie und Rhythmus im Vierten Kritischen Wäldchen nur am Rande erörtert, ohne deren Prinzipien näher zu beleuchten. Die musikalische Affektwirkung liegt für ihn „im ersten Moment der Sensation“ beschlossen, und er folgert hieraus, daß „die ganze Kraft der Musik nur eigentlich aus lauter solchen einzelnen, ersten Momenten bestehen kann“.64 Nimmt man diese Aussage beim Wort, so stellt sich die Frage, inwieweit das Ohr, von dem Herder sagt, es fühle „so wenig ein Verhältniß, als das Auge eine Entfernung unmittelbar siehet“, überhaupt in der Lage ist, melodisch-rhythmische Konfigurationen zu erfassen.65 Anders formuliert: Wenn das Verhältnis gleichzeitig erklingender Töne zueinander, also die numerisch bestimmte Proportion eines Intervalls oder Dreiklangs, das ästhetische Vergnügen beim Hören von Musik nicht erklären kann, wie steht es dann mit den Proportionen innerhalb des horizontal ausgebreiteten Formgefüges, sofern es sich – im Sinne Sulzers – aus ,ebenmäßigen‘ Gliedern bzw. ,Einschnitten‘ zusammensetzt?66 Tatsächlich entpuppt sich der in Überblicksdarstellungen immer wieder geäußerte Allgemeinplatz, Herder habe wie Rousseau die unbedingte Priorität der Melodie gegenüber dem Akkord festschreiben wollen, als eine Vereinfachung, die das Vierte Kritische Wäldchen seiner entscheidenden – und zwei62 63 64 65 66 30 Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 115, 107. Ebd., S. 109. Ebd., S. 96. Ebd., S. 93. Vgl. Wilhelm Seidel: [Artikel] Rhythmus, Metrum, Takt, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Zweite, neubearbeitete Ausgabe, hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd. 8, Kassel u. a. 1998, Sp. 257–317, hier Sp. 265: „Seit der Antike bestimmt man die rhythmischen Verhältnisse wie die musikalischen Intervalle numeral.“ fellos irritierend radikalen67 – Pointe beraubt, der Pointe nämlich, daß die „Beziehung zwischen den [...] Tönen“ auch in ihrer melodischen Sukzession letztlich „gleichgültig“ ist, denn „nicht das Intervall, sondern der einzelne Ton“ bestimmt nach Herders Darlegung den Ausdruck der Musik.68 Denkt man diese Argumentation weiter, so kommt man – wie Ursula Schmitz – unweigerlich zu dem Ergebnis, daß Herder eine Melodie im Grunde nur als „lose Aneinanderreihung innerlich unzusammenhängender Töne“ begreifen kann, von denen jeder seine eigene ästhetische Qualität besitzt und sie „nicht erst aus dem Zusammenhang mit anderen Tönen erhält“: „Intervalle sind Verhältnisse von Tönen zueinander, sei es zeitlich mitoder nacheinander. Verhältnisse gehören aber für Herder in die Akustik und nicht in eine Ästhetik.“69 Daß sich Töne „durch das Band der Folge, in ihrer Annehmlichkeit aufs Ohr, in ihrer Würksamkeit auf die Seele“ zu Melodien verbinden, stellt Herder zwar nicht in Frage, meint hierin sogar das „grosse Hauptfeld“ einer zukünftigen Philosophie der Musik zu erkennen.70 Doch ist es eine zwangsläufige Konsequenz seiner ,musikalischen Monadologie‘, daß er im Vierten Kritischen Wäldchen mit keinem Wort auf das Problem der syntaktischen Gliederung des Melos eingeht, denn sofern letzteres nach anderen Kriterien als denen der fließenden Empfindung strukturiert wird, etwa nach Maßgabe der symmetrischen Anordnung korrespondierender Phrasen, kommt für Herder die ästhetische Instanz des Auges zum Tragen, nicht aber diejenige des Ohrs, da das Ohr von den Relationen zwischen einzelnen Abschnitten der Melodie ebensowenig angesprochen wird wie von den Verhältnissen der Töne innerhalb des Dreiklangs. Dementsprechend betont Herder, daß Kategorien wie Ebenmaß oder Symmetrie zuallererst für die Baukunst von Bedeutung sind. Der „Eindruck von Schönheit“, den diese hervorrufe, sei auf „Zusammenfügung ihrer Glieder“ gegründet, auf das „Verhältniß derselben zur Proportion des Ganzen“, auf „gegenseitiges symmetrisches Entsprechen“.71 Wo aber die Musik den Gesetzen von Symmetrie, Anordnung und Verhältnis folgt, leugnet sie ihr ursprüngliches 67 68 69 70 71 Dieser Radikalität mag es auch zuzuschreiben sein, daß Wilhelm Dobbek das Vierte Kritische Wäldchen als einen „noch reichlich unreifen Versuch“ bewertet und sogar davon abrät, aus ihm die Grundsätze von Herders Musikästhetik ableiten zu wollen, während es doch gerade die Forciertheit der dort geäußerten Ansichten ist, die den exzeptionellen Status des Textes begründet (J. G. Herders Musikalität, S. 196). Ursula Schmitz: Dichtung und Musik in Herders theoretischen Schriften, S. 15. Ebd., S. 52, 39. Ursula Schmitz sieht in Herders Melodiebegriff eine logische Folge des Versuchs, den „einzelnen, unartikulierten Schrei“ der Empfindung hypothetisch an den Beginn von Sprache und Musik zu setzen: „Wenn die Musik wie auch die Sprache aus dem einzelnen Schrei entsprang, dann ist der einzelne Ton – als verfeinerter Schrei – Träger des musikalischen Ausdrucks“ (S. 61, 15). Vgl. auch Friedhelm Solms: Disciplina aesthetica, S. 223 f.: „Die Phänomenalität [...] eines musikalischen Tons ,als Ton‘, als musikalische Monade sozusagen, ergibt sich weder aus dem Kontext seiner musikalischen Verwendung innerhalb einer Komposition, noch erschließt sie sich im messenden Vergleich mit einem anderen Ton.“ Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 114. Ebd., S. 155. 31 Wesen, denn sie „borgt [...] von andern Künsten, in denen diese Begriffe original erscheinen: da ist sie Schuldnerin“.72 Mit der zugespitzten These, daß weder formale Proportionen innerhalb des melodischen Ablaufs, etwa korrespondierende Viertakt-Phrasen, noch die in Zahlenverhältnissen darstellbare Intervallik und Harmonik das Wirkungsprinzip der Musik ausmachen, wendet sich Herder nicht nur gegen Rameau, sondern – wie ein kurzer Seitenhieb im Vierten Kritischen Wäldchen erkennen läßt73 – auch gegen Diderot, der 1748 den Grundsatz aufgestellt hatte, „que le plaisir musical consiste dans la perception des rapports des sons“, und zwar mit der Begründung, dies gelte für alle schönen Künste und Wissenschaften: „Le plaisir, en général, consiste dans la perception des rapports. Ce principe a lieu en poésie, en peinture, en architecture, en morale, dans tous les arts et dans toutes les sciences. Une belle machine, un beau tableau, un beau portique ne nous plaisent que par les rapports que nous y remarquons [...]“.74 Dort, wo das ästhetische Wohlgefallen allein aus der Wahrnehmung von Beziehungen resultiert, aus Diderots ‚perception des rapports‘, sei es in bezug auf das melodische Nacheinander der Töne oder hinsichtlich ihres simultanen Erklingens als Akkord, ist für Herder das Auge am Werk, nicht aber das Ohr, liegt ein von der Architektur abgeleiteter Schönheitsbegriff zugrunde, der im Bereich der Musik keine Gültigkeit besitzt. Um so weniger konnte es Herder entgehen, daß Diderot ausgerechnet die Baukunst heranzieht, um seine Behauptung zu illustrieren, in der Musik würden „les rapports les plus simples“ das größte Wohlgefallen erregen, also konsonante Intervalle mit ihren einfachen Zahlenverhältnissen, die daher nur äußerst sorgsam und vorsichtig durch Dissonanzen ergänzt werden dürften: „Or, de tous les rapports, le plus simple, c’est celui d’égalité: il était donc naturel que l’esprit humain cherchât à l’introduire partout où il pouvait avoir lieu; aussi cela est-il arrivé: c’est par cette raison qu’on fait les ailes d’un bâtiment égales et les côtés d’une fenêtre parallèles. Si la raison d’utilité demande qu’on s’en écarte, on lui obéit, mais c’est comme à regret, et l’artiste ne manque jamais de revenir au rapport d’égalité dont il s’était écarté. [...] Si l’esprit [...] s’accommode volontiers des rapports simples [...], on est quelquefois forcé d’user de rapports composés [...], et c’est de là que naît en musique l’emploi que nous faisons de la dissonance [...]: mais la dissonance, selon les musiciens, veut ordinairement être préparée et sauvée; ce qui, bien entendu, ne signifie rien autre chose que, si l’on a de bonnes raisons d’abandonner les rapports simples pour en présenter à l’oreille de composés, il faut revenir sur-le-champ à l’emploi des premiers.“75 72 73 74 75 32 Ebd., S. 161. Vgl. ebd., S. 90. Denis Diderot: Principes généraux d’acoustique (1748), in: Œuvres complètes, hrsg. von Jean Assézat und Maurice Tourneux, Paris 1875–1877, Bd. 9, S. 83–131, hier S. 104. Ebd., S. 104 f., 105 f. Daß Herder – anders als Diderot – die Musik nicht nur aus ihrer engen Bindung an die Architektur entläßt, sondern Ton- und Baukunst sogar in das Verhältnis einer ästhetischen Antinomie bringt, was wiederum Konsequenzen für den musikalischen Formbegriff nach sich zieht, entspricht seinem generellen Vorbehalt gegen jeden Versuch, die Wirkung klanglicher Phänomene auf Zahlenproportionen zurückzuführen. Denn seit Pythagoras war es gerade die „für Musik und Architektur gleichermaßen gültige Formkraft der Zahl“, die beide Künste im Denken der Antike, des Mittelalters und der Renaissance miteinander verschmelzen ließ, dergestalt, daß ein Gebäude als Abbild kosmischer Harmonie betrachtet wurde, wenn seine Maßverhältnisse die numerische Ordnung des Tonsystems widerspiegelten.76 Die Idee, daß musikalische wie architektonische Schönheit vor diesem Hintergrund als quantifizierbare Größe aufzufassen sei, hatte freilich schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ihre Gültigkeit teilweise eingebüßt, etwa bei Johann Mattheson, der 1739 festhielt, daß „in der Rechenkunst kein Schein des musikalischen Fundaments stecket“, da die Musik „aus dem Brunnen der Natur ihr Wasser schöpffet; und nicht aus den Pfützen der Arithmetik“. „Die unendliche, unbegreiffliche, unermeßliche Mischung; die gescheute und geübte Anwendung; die ungenannte angebohrne und nie zu erlernende Anmuth; das ich weiß nicht was; die innerlichen, natürlichen und moralischen Verhältnisse, samt derselben hertzrührendem Gebrauch, enthalten die wahren Kräffte melodischer und harmonischer Wirckungen, zur Erregung des empfindlichsten Wohlgefallens.“77 War Matthesons Lehre von der „singende[n] und sprechende[n] Beredtsamkeit“ also einerseits dem Grundsatz verpflichtet, daß „kein Cirkel, kein Linial, kein Maasstab“ den Eindruck melodischer Gänge auf das Gemüt erklären könne, so verglich er andererseits die „nette Anordnung aller Theile und Umstände in der Melodie“ mit der „Art, wie man ein Gebäude einrichtet und abzeichnet“.78 Daran wird – bei allen Gemeinsamkeiten79 – der Abstand zwischen seinem Melodiebegriff und demjenigen Herders sichtbar. Das Vierte Kritische Wäldchen deutet darauf hin, daß Herder die Melodie letztlich von jeder syntaktischen Gliederung und prädisponierten Formgestaltung befreien will, denn beides setzt voraus, was ihm als alleinige Domäne des Auges erscheint: die Fähigkeit, an der Wahrnehmung von Relationen – einer ,netten Anordnung‘ im Sinne Matthesons – ästhetischen Gefallen zu finden. 76 77 78 79 Paul von Naredi-Rainer: Musiktheorie und Architektur, in: Ideen zu einer Geschichte der Musiktheorie. Einleitung in das Gesamtwerk, hrsg. von Frieder Zaminer, Darmstadt 1985 (Geschichte der Musiktheorie 1), S. 149–176, hier S. 172. Johann Mattheson: Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739. Nachdruck, hrsg. von Margarete Reimann, Kassel und Basel 1954 (Documenta Musicologica. Erste Reihe: Druckschriften-Faksimiles 5), S. XIX, XX [römische Zahlen hier auf die Paginierung der Vorrede bezogen]. Ebd., S. XVII, 235. Vgl. Ulrike Zeuch: „Ton und Farbe, Auge und Ohr, wer kann sie commensurieren?“, S. 249 f. 33 ,Wohllaut‘ statt ,Schönheit‘: Gegen die Kolonialisierung der Musik durch das Auge Wenn Herder die Melodie als eine „jeglicher logischen Syntax enthobene, nur vom Affekt diktierte Folge von Tönen“ begreift, so mag man hierin – mit Laurenz Lütteken – den Ausfluß zivilisationskritischer Denkmuster erkennen, nach denen alles, was das Stigma „musikalische[r] Kultur“ an sich trägt, auf seinen nicht mehr historisch, sondern nur noch anthropologisch faßbaren Ursprung zurückgeführt werden soll.80 Doch ebenso entscheidend ist Herders Bemühung, die physiologische Verschiedenheit von Auge und Ohr zum Ausgangspunkt einer ästhetischen Differenzierung zu machen,81 wobei die Baukunst dem Auge, die Musik hingegen dem Ohr zugerechnet wird. Das Auge sei „der kälteste unter den Sinnen“, da die von ihm erfaßten Gegenstände „mehr vor und nicht so tief in uns sind“; sie treffen „uns nur durch die feinen Stäbe der Lichtstralen [...], ohne uns näher und inniger zu berühren“.82 Eben aus diesem Grund ist dem Gesichtssinn aber auch eine besondere Klarheit eigen. Anders als der verklingende Ton entzieht sich das Erschaute dem Betrachter nicht, sondern bleibt in der Distanz unverändert bestehen, bis alle Einzelheiten deutlich voneinander unterschieden und zueinander in Relation gesetzt werden können: „[Das Auge] würkt nicht anders, als durch unabläßiges Vergleichen, Meßen, und Schließen: es muß uns also, auch in dem es würkt, zu allen diesen feinen Seelebeschäftigungen, Kälte und Muße lassen [...].“83 Hieraus ergibt sich wiederum die Möglichkeit zur Reflexion und begrifflichen Zergliederung, und „aus allen diesen Ursachen hat man sich der Sprache des Gesichts bemächtigt, um durch sie die Beziehung alles deßen, was wohlgefällig auf die ganze Seele würkt, zu bezeichnen“.84 Damit aber ist jeder normativen Kunstphilosophie für Herder eine Vorherrschaft des Auges eingeschrieben, die nicht zuletzt im „Hauptwort aller Aesthetik“ ihre Spuren hinterlassen hat: „Da ist der Begrif des Worts ,Schön, Schönheit!‘ Er ist hier seiner Abstammung nach: denn schauen, Schein, Schön, Schönheit sind verwandte Sprößlinge der Sprache: er ist hier, wenn wir recht Acht geben auf seine eigenthümliche Anwendung, da er sich bei Allem, was sich dem Auge wohlgefällig darbietet, am ursprünglichsten findet.“85 Im Hinblick auf die Wirkungsweise der Musik will Herder den Begriff „Schönheit“, der gewöhnlich „für alle feinen Künste des Wohlgefallens und Vergnügens“ ohne Unterschied 80 81 82 83 84 85 34 Vgl. Laurenz Lütteken: Das Monologische als Denkform in der Musik zwischen 1760 und 1785, S. 240–248, hier S. 247. Vgl. Bruno Markwardt: Herders Kritische Wälder, S. 172–174. Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 45. Ebd. Ebd. Ebd., S. 46, 44. angewandt werde, daher nicht gelten lassen und durch „Wohllaut“ ersetzt wissen, denn „Gehör und Gesicht“ seien „auf gewiße Art Feinde“, weshalb die „Aesthetik des Gehörs“ und die „Philosophie des Sichtbarschönen“ so wenig miteinander zu tun hätten wie „Auge und Ohr, Ton und Farbe, Raum und Zeit“.86 (Noch in der dreißig Jahre später verfaßten Kalligone wird Herder auf diesen zentralen Gedanken zurückkommen und mit einer pointierten Formulierung schreiben: „Sehr uneigentlich nennt man z. B. die Musik schön“.87) Während die „Gegenstände des Gesichts“ ruhig vor dem Betrachter liegen und sich in ihren Konturen, Verhältnissen und Proportionen klar überschauen lassen, trifft der flüchtige Ton den Menschen in seinem Innern; „die Wollust der Tonkunst liegt tief in uns verborgen: sie würkt in der Berauschung“.88 Denn: „Das Gehör allein, ist der Innigste, der Tiefste der Sinne. Nicht so deutlich, wie das Auge ist es auch nicht so kalt [...]; aber es ist [...] der Empfindung am nächsten, wie das Auge den Ideen“.89 Töne seien daher „das unmittelbarste Instrument auf die Seele [...]. Wogegen [...] der Ausdruck der anschaulichen Kunst nichts als Oberfläche war, wird hier inniges Wesen“.90 Mit Vehemenz schreibt Herder solchermaßen gegen den von rationalistischer Seite erhobenen Vorwurf an, die fehlende ,Deutlichkeit‘ der Musik müsse als ästhetisches Defizit aufgefaßt werden, denn nach seiner Ansicht trifft das genaue Gegenteil zu: Gerade der Umstand, daß in ihr „kein Schatte von Anschauung“ zu finden sei, befähige die Musik dazu, „sympathetische Wahrheit in Tönen“ zu verkünden, während die ,schönen‘, also dem Auge verpflichteten Künste an der sichtbaren ,Oberfläche‘ der Dinge haften blieben und nur ein „liebliches Blendwerk“ erzeugen könnten.91 Entschieden wendet sich Herder damit auch gegen Diderots Auffassung in der Lettre sur les aveugles, daß die „privation de la vue“ bei Blinden denselben Effekt erzeuge wie „la distance ou la petitesse des objets“ im Fall von Sehenden, nämlich ein deutliches Nachlassen des Mitgefühls, weshalb Blinde sich gegenüber einem leidenden Pferd so gleichgültig verhielten wie Sehende, die ohne Rührung eine Ameise zertreten.92 Während Diderot den Blinden „inhumanité“ unterstellt,93 schreibt Herder, es müsse ganz im Gegenteil jedem „Geschöpf“, das „ganz Auge“ sei, unendlich schwierig werden, das „kalte Gesicht mit dem wärmern Gefühl“ zu verbinden.94 Für ihn liegt die Fähigkeit zur ,Sympathie‘ nicht nur 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Ebd., S. 45 f., 48, 47, 90. Johann Gottfried Herder: Kalligone, in: Sämmtliche Werke, Bd. 22, S. 308. Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 44, 90. Ebd., S. 111. Ebd., S. 161. Ebd., S. 162, 161, 44. Denis Diderot: Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient (1749), in: Œuvres complètes, Bd. 1, S. 275–342, hier S. 289. Ebd. Johann Gottfried Herder: Abhandlung über den Ursprung der Sprache, in: Sämmtliche Werke, Bd. 5, S. 68. 35 primär im Hören, sondern wird sogar durch den optischen Sinn eher beeinträchtigt als verstärkt: „Freilich ist ihm [dem Blinden] das ganze rührende Schauspiel dieses elenden, zuckenden Geschöpfs verhüllet; allein alle Beispiele sagen, daß eben durch diese Verhüllung das Gehör weniger zerstreut, horchender und mächtig eindringender werde. Da lauschet er also im Finstern, in der Stille seiner ewigen Nacht, und jeder Klageton geht ihm, um so inniger und schärfer, wie ein Pfeil zum Herzen!“95 Die Metapher des Pfeils ist auch im Vierten Kritischen Wäldchen von zentraler Bedeutung für Herders Musikphilosophie, denn mit ihr bezeichnet er den grundsätzlichen Unterschied zwischen „Schall“ und „Ton“. Der „Schall“ – gewissermaßen ein „Bund Silberpfeile“ – wird dabei als grober, zusammengesetzter „Körper“ imaginiert, der an den „äußerlichen Organe[n] des Gehörs“ hängenbleibt und nicht jene „feine[n] Nerve[n]“ im Innern des Ohres erreicht, deren Vibration sich in Empfindung zu transformieren vermag.96 Die Töne hingegen seien einzelnen „silbernen Pfeilen“ vergleichbar und träfen daher „die Seele [...] wie durch einfache Punkte“.97 In diesem Sinne ist der Ton tatsächlich eine Verfeinerung des Schalles, und man mag Wilhelm Seidel bei der Überlegung folgen, daß sich der tierische Empfindungslaut hier zur menschlichen Tonkunst kultiviert, Besonnenheit und Reflexion den rauh hervorgestoßenen Schrei zum präzisen Ausdrucksmittel schärfen.98 Indessen betont Herder gerade umgekehrt, daß die Menschen, als sie sich von der Natur entfernten, die „Töne [...] in Schälle verwandelte[n]“, nämlich in Harmonien und Akkorde, und dabei vergaßen, wie „würksamer [...] jeder Mutterton wäre, wenn er in seiner zarten Kraft nicht vom regelmäßigen Geräusch erstickt würde“.99 Und der Widerspruch gegen Diderot zeigt, daß selbst das Geschrei eines verwundeten Tieres für Herder einem akustischen ,Pfeil‘ gleichkommt, sofern die ,Kälte‘ des Auges nicht auf das Ohr übergegriffen und letzteres dazu gebracht hat, von Höreindrücken bloß eine „todte Folge todter Regelmäßigkeiten“, mathematische Proportionen und ausbalancierte Symmetrien zu erwarten.100 Jener „Horror vor den Abstraktionen“, den Max Becker als Grundbefindlichkeit der empfindsamen Kulturepoche herausschält, das Bestreben also, die unverstellte, ungekünstelte Natur aus der vermeintlichen Leblosigkeit berechnender Rationa95 96 97 98 99 100 36 Ebd., S. 15. Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 109 f. Ebd., S. 107. Vgl. Wilhelm Seidel: Leidenschaft und Besonnenheit. Herders Akademieschrift, ihre Bedeutung für seine und die romantische Musikästhetik, in: Akademie und Musik. Erscheinungsweisen und Wirkungen des Akademiegedankens in Kultur- und Musikgeschichte: Institutionen, Veranstaltungen, Schriften. Festschrift für Werner Braun zum 65. Geburtstag, hrsg. von Wolf Frobenius u. a., Saarbrücken 1993 (Saarbrücker Studien zur Musikwissenschaft. Neue Folge 7), S. 301–316, bes. S. 308 f. Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 109, 113. Ebd., S. 113. lität zu bergen, knüpft sich bei Herder unmittelbar an die Prävalenz des Hörens gegenüber dem emotionslosen, unbeteiligten Schauen.101 Dadurch, daß die Musik sich mit allen anderen Künsten dem vom Auge abgeleiteten Schönheitsbegriff beugen mußte, wurde sie nach Herders Urteil zu einer bloßen „Kunst der Verhältniße und Gelehrsamkeit“ herabgewürdigt, insbesondere bei den nordischen Völkern, die sich vorrangig der harmonischen Vertikale widmeten und über „Tonwißenschaft, Setzkunst und Fingerwerk“ die melodische Horizontale ignorierten, bis sie jedes Gespür für die Wirkungsqualität des einzelnen Tones verloren hatten: „Sie hören nicht Töne, sie hören nur Schälle: sie fühlen nicht Accente, sie denken sich also Gothische schwere Harmonieen und gelehrte Verhältniße.“102 Lediglich im einstimmigen Volkslied fand Herder zu seiner Zeit noch Reste des ursprünglichen ,Sprachgesanges‘ aufbewahrt, Relikte einer längst vergangenen Epoche, in der die Menschen nicht „durch Abstraktionen und tausend andre Dinge am Gefühl“ geschwächt und „von Jugend auf lieber tiefern Eindrücken, als überhinrauschenden Bildern offen“ waren.103 Wenn Herder die Abstumpfung des inneren ,Tongefühls‘ mit der Gewöhnung an ,überhinrauschende Bilder‘ begründet, so heißt dies nichts anderes, als daß die Dominanz des Auges über das Ohr – und damit die Vorherrschaft der Abstraktion über die Empfindung, des ,schönen Scheins‘ über die ,sympathetische Wahrheit‘ – zugleich für den Verfall der Musik verantwortlich gemacht wird, insofern sich die zunehmende Neigung zur ,Gelehrsamkeit‘ in einer übermäßigen Betonung des Harmonischen bzw. einer Vernachlässigung des Melodischen niederschlägt. Die unmittelbare Gefühlsverständlichkeit der Töne, ihre ,sympathetische Wahrheit‘, an der alle Lebewesen partizipieren, erklärt sich Herder – wie oben bereits angedeutet – aus dem Resonanzprinzip, der naturnotwendigen Wechselwirkung gleichschwingender Saiten. In seinem allegorischen Göttergespräch läßt er die Tonkunst zur Malerei sagen: „Ich gebe also mit wenigem viel; durch einige unsichtbare Wellen umringe ich das Herz unmittelbar, dringe zu ihm und reisse es fort: denn alle Saiten der Empfindung sind meine Saiten“.104 Für Herder folgt hieraus, daß die Töne und Tonfolgen der Musik einen dynamischen Empfindungsverlauf nicht etwa nachahmen, wie Sulzer und Rousseau glauben, sondern mit ihm identisch sind, 101 102 103 104 Vgl. das Kapitel „Der Horror vor den Abstraktionen“ in: Max Becker: Narkotikum und Utopie. MusikKonzepte in Empfindsamkeit und Romantik, Kassel u. a. 1996 (Musiksoziologie 1), S. 72–82. Sehr einleuchtend wird hier mit dem Beispiel der Gartenkunst argumentiert, nämlich mit der Ablösung geometrisch angelegter Parkanlagen und ihrer „großräumige[n] Regelmäßigkeit“ durch das Ideal des englischen Landschaftsgartens, dessen primäre Eigenschaft darin besteht, den Schein „natürliche[r] Unregelmäßigkeit“ hervorzubringen (S. 74). Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 120, 108. Ebd., S. 107. Johann Gottfried Herder: Ob Malerei oder Tonkunst eine größere Wirkung gewähre? Ein Göttergespräch, in: Sämmtliche Werke, Bd. 15, S. 224. 37 wodurch die Differenz zwischen Zeichen und Bezeichnetem letztlich zur Aufhebung gebracht wird: „Klang und Gang und Rhythmus [der Töne] bedeuten nicht nur, sondern sind Schwingungen des Mediums sowohl als unsrer Empfindungen; daher ihre innigere Wahrheit, ihre tiefere Wirkung.“105 Indem sich die ,Schwingungen des Mediums‘ auf das ,Saitenspiel‘ der ,Gehörfibern‘ übertragen, versetzen sie mit dem Körper und dessen Nervensträngen auch das Gemüt in eine entsprechende Bewegung,106 und dieser Mechanismus ist es, der die unmittelbare Affektwirkung der Musik begründet: „Das Leidenschaftliche in uns (το θυµικον) hebet sich und sinkt, es hüpft oder schleicht und schreitet langsam. Jetzt wird es andringend-, jetzt zurückweichend-, jetzt schwächer-, jetzt stärker gerührt; seine eigne Bewegung, sein Tritt verändert sich mit jeder Modulation, mit jedem treffenden Accent, geschweige mit einer veränderten Tonart. Die Musik spielt in uns ein Clavichord, das unsre eigne innigste Natur ist.“107 Psychophysische Wechselwirkung und Resonanztheorie Die „Überwindung der musikalischen Nachahmungsästhetik“ – so Rafael Köhler108 – ist freilich keine exklusive Leistung Herders, sondern steht im Kontext eines umfassenden Diskurses, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts, von verschiedenen Autoren genährt, zur Herausbildung völlig neuer Kategorien auf dem Gebiet der psychologisch fundierten Kunstbetrachtung führt.109 Am besonderen Wert „brittische[r] Kritik“ für die „Philosophie des Schönen“ läßt Herder in diesem Zusammenhang keinen Zweifel, wobei er unter anderem die Namen Shaftesbury, Webb, Harris, Home, Smith und Beattie nennt.110 Von größtem Einfluß dürfte darüber hinaus Edmund Burkes 1757 formulierte Feststellung gewesen sein, daß „poetry and rhetoric [...] affect rather by sympathy than imitation“, weshalb „poetry“ – anders als „painting“ – überhaupt nicht im strengen Sinne als „imitative art“ bezeichnet werden könne.111 Indem Burke die Gefühlswirkung poetischer Sprache vor allem im „sound“ der 105 106 107 108 109 110 111 38 Johann Gottfried Herder: Kalligone, in: Sämmtliche Werke, Bd. 22, S. 326. Im Vierten Kritischen Wäldchen spricht Herder von der „Analogie des ganzen allgemeinen Gefühls in Körper und Seele, so wie sich in ihm alle Neigungen und Leidenschaften offenbaren“ (Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 103). Johann Gottfried Herder: Kalligone, in: Sämtliche Werke, Bd. 22, S. 68 (vgl. Rafael Köhler: Natur und Geist, S. 26–32). Rafael Köhler: Johann Gottfried Herder und die Überwindung der musikalischen Nachahmungsästhetik, in: Archiv für Musikwissenschaft 52 (1995), S. 205–219. Vgl. hierzu etwa John Neubauer: The Emancipation of Music from Language. Departure from Mimesis in Eighteenth-Century Aesthetics, New Haven und London 1986. Johann Gottfried Herder: Kalligone, in: Sämmtliche Werke, Bd. 22, S. 95. Edmund Burke: A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, S. 172. Es zeugt von besonders intensiver Beschäftigung Herders mit Burke, daß er bereits Mitte der 1760er Jahre einige Exzerpte aus dem englischen Original dieser Schrift anfertigte; vgl. Hans Dietrich Irmscher und Emil Wörter lokalisiert und nicht etwa in den „pictures of the several things they would represent in the imagination“,112 stößt er einen ästhetischen Umwälzungsprozeß an, der sich bei Herder nochmals forcieren wird: die Gewichtsverlagerung vom Auge zum Ohr, von der „clearness“ bildlicher Darstellung und sprachlicher Repräsentation zur „obscurity“ einer zwar undeutlichen, aber emotional sehr viel eindringlicheren Tonempfindung. „And so far is a clearness of imagery from being absolutely necessary to an influence upon the passions, that they may be considerably operated upon without presenting any image at all, by certain sounds adapted to that purpose; of which we have a sufficient proof in the acknowledged and powerful effects of instrumental music. In reality a great clearness helps but little towards affecting the passions, as it is in some sort an enemy to all enthusiasms whatsoever.“113 In dem Maße, wie Burke die Abbildungsfunktion von Musik und Poesie aus dem Modus ihrer Rezeption ausscheidet, entwirft er das Modell einer mechanistischen Wirkungsweise, die auf jenem „psychophysische[n] Parallelismus“ beruht, den der Begründer der englischen Assoziationspsychologie, David Hartley, 1749 in seinen Observations on Man, His Frame, His Duty and His Expectations beschrieben hatte.114 Die von Hartley vertretene Theorie einer grundsätzlichen Korrespondenz zwischen körperlicher und seelischer Bewegung legt Burke dahingehend aus, daß etwa Schmerz und Furcht „a tension, contraction, or violent emotion of the nerves“ verursachen, aber ebenso der Körper „will of itself excite something very like that passion in the mind“, wenn sein Nervensystem durch äußere Reize in Erregung – oder besser: in Schwingung – gebracht wird.115 Zu plausibel ließ sich Burkes Theorie auf das Resonanzprinzip zurückführen, als daß sie nicht von der Musikästhetik hätte aufgegriffen werden sollen. Schon 1762 konstatierte James Beattie, daß Musik „is pleasing, not because it is imitative, but because certain melodies and harmonies have an aptitude to raise certain passions, affections, and sentiments in the soul. And, consequently, the pleasures we derive from melody and harmony are seldom or never resolvable into that delight which the human mind receives from the imitation of nature.“116 112 113 114 115 116 Adler: Der handschriftliche Nachlaß Johann Gottfried Herders, Wiesbaden 1979 (Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz. Kataloge der Handschriftenabteilung. Zweite Reihe: Nachlässe 1), S. 229 (Kapsel XXVI 5:86) sowie S. 243 (Kapsel XXVIII 2:71r). Edmund Burke: A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, S. 167. Ebd., S. 60. Vgl. Christian G. Allesch: Geschichte der psychologischen Ästhetik. Untersuchungen zur historischen Entwicklung eines psychologischen Verständnisses ästhetischer Phänomene, Göttingen u. a. 1987, S. 144– 146, hier S. 145. Edmund Burke: A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, S. 132. James Beattie: Essays: On Poetry and Music, as They Affect the Mind; on Laughter, and Ludicrous Composition; on the Usefulness of Classical Learning (1776), London 31779. Nachdruck Ann Arbor/Mich. 1997, S. 136. 39 Und seine Begründung hierfür liegt genau auf der von Hartley und Burke vorgegebenen Linie: „Does not part of the pleasure, both of melody and of harmony, arise from the very nature of the notes that compose it? Certain inarticulate sounds, especially when continued, produce very pleasing effects on the mind. [...] Nor is it absurd to suppose, that the human body may be mechanically affected by them [...]; if one string vibrates of its own accord when another is sounded near it of equal length, tension, and thickness; if a person who sneezes, or speaks loud, in the neighbourhood of a harpsichord, often hears the strings of the instrument murmur in the same tone; we need not wonder, that some of the finer fibres of the human frame should be put in a tremulous motion, when they happen to be in unison with any notes proceeding from external objects.“117 Parallel zu Herders Viertem Kritischen Wäldchen – im selben Jahr 1769 – führte Daniel Webb diese Theorie mit der Bemerkung weiter, daß Musik „independently of any possible association of ideas“ wirke, nämlich allein durch die „coincidence of movements“ zwischen „passion“ und „musical sounds“.118 Da die „mechanical operations of the passions“ analoge „vibrations in the nerves“ auslösen, müsse angenommen werden, daß dieser Vorgang sich auch umkehren lasse, was die Wirkung der Musik rein physiologisch erklärbar machen würde: „I shall suppose, that it is in the nature of music to excite similar vibrations, to communicate similar movements to the nerves and spirits. [...] When, therefore, musical sounds produce in us the same sensations which accompany the impressions of any one particular passion, then the music is said to be in unison with that passion; and the mind must, from a similitude in their effects, have a lively feeling of an affinity in their operations.“119 Zwar schließt Webb die Musik deshalb nicht von den nachahmenden Künsten aus, doch er betont, daß sie – anders als Malerei und Bildhauerkunst, die nur durch Nachahmung zu wirken vermögen – „acts in the double character of an art of impression as well as of imitation“.120 Wie einflußreich und weitverbreitet das aus der Annahme einer psychophysischen Wechselwirkung hergeleitete Musikverständnis war, hat Hans Heinrich Eggebrecht exemplarisch an Christian Friedrich Daniel Schubarts Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst aufgezeigt, wo das „Herz“ bezeichnenderweise als ein mit „zarten Saiten“ bespannter „Resonanzboden“ imagi- 117 118 119 120 40 Ebd., S. 138 f. Daniel Webb: Observations on the Correspondence between Poetry and Music, London 1769. Nachdruck Bristol 1998 (Aesthetics: Sources in the Eighteenth Century 7), S. 3, 6 f. Ebd., S. 4, 6, 7 f. Ebd., S. 28. niert wird.121 „Zwischen Musik und Seele“, so faßt Eggebrecht die Anschauungen Schubarts und seiner Zeitgenossen zusammen, „besteht ein durch den Begriff der Resonanz begründeter Konnex derart, daß stets und unmittelbar eines das andere bedeuten kann.“122 Belege dafür, daß es sich hier tatsächlich um einen ästhetischen Konsens handelt, an dem Herders Theorie wesentlich partizipiert,123 liefert nicht nur der Artikel „Musik“ in Johann George Sulzers Allgemeiner Theorie der schönen Künste,124 sondern auch Johann Jakob Engels kurzer Traktat Über die musikalische Malerei, der 1780 als offener Brief an Johann Friedrich Reichardt adressiert wurde. Dort stellt Engel fest, daß „der Musiker immer lieber Empfindungen, als Gegenstände von Empfindungen malen soll; immer lieber den Zustand, worin die Seele und mit ihr der Körper durch Betrachtung einer gewissen Sache und Begebenheit versetzt wird, als diese Sache und Begebenheit selbst.“125 Die Fähigkeit der Musik, seelische Empfindungen zu ,malen‘, liege aber in der Korrespondenz von Gemütsbewegung und körperlichem Ausdruck begründet: „Alle leidenschaftlichen Vorstellungen der Seele sind mit gewissen entsprechenden Bewegungen im Nervensystem unzertrennlich verbunden [...]. Aber nicht allein entstehn im Körper diese entsprechenden Nervenerschütterungen, wenn vorher in der Seele die leidenschaftlichen Vorstellungen erweckt worden; sondern auch in der Seele entstehn die leidenschaftlichen Vorstellungen, wenn man vorher im Körper die verwandten Erschütterungen verursacht.“126 Jene ,leidenschaftlichen Vorstellungen‘, die entsprechende ,Nervenerschütterungen‘ im Körper hervorrufen, aber umgekehrt – dem Resonanzprinzip zufolge – auch von letzteren erzeugt werden können, unterscheiden sich nicht etwa durch konkrete Inhalte, sondern durch ihre abstrakte Bewegungsform, „durch die langsamere oder schnellere Folge der Vorstellungen auf einander; durch die engern oder weitern Schritte [...]; durch die grössere oder geringere Gleichförmigkeit des Fortgangs“.127 Damit liefert Engel dem Komponisten gewissermaßen 121 122 123 124 125 126 127 Christian Friedrich Daniel Schubart: Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst, hrsg. von Ludwig Schubart, Wien 1806. Nachdruck, hrsg. von Fritz und Margrit Kaiser, Hildesheim u. a. 21990, S. 368, 369. Hans Heinrich Eggebrecht: Das Ausdrucks-Prinzip im musikalischen Sturm und Drang, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 29 (1955), S. 323–349, hier S. 339. Vgl. ebd., S. 340. Vgl. Johann George Sulzer: Allgemeine Theorie der schönen Künste, Bd. 3, S. 433: „Man weiß, daß die Lebhaftigkeit der Empfindungen von dem Spiel der Nerven, und dem schnellen Laufe des Geblütes herkommet; daß die Musik würklich auf beyde würke, kann gar nicht geläugnet werden. Da sie mit einer Bewegung der Luft verbunden ist, welche die höchst reizbaren Nerven des Gehörs angreift, so würket sie auch auf den Körper; und wie sollte sie dieses nicht thun, da sie selbst die unbelebte Materie, nicht blos dünne Fenster, sondern sogar feste Mauern erschüttert? Warum sollte man also daran zweifeln, daß sie auf empfindliche Nerven eine Würkung mache, die keine andere Kunst zu thun vermag [...]?“ Johann Jakob Engel: Über die musikalische Malerei. An den königl. Capellmeister Herrn Reichardt (1780), in: Schriften, Berlin 1801–1806. Nachdruck Frankfurt am Main 1971, Bd. 4, S. 297–342, hier S. 319 f. Ebd., S. 312 f. Ebd., S. 314 f. 41 das Objekt der Nachahmung, denn die Musik – so lautet seine These – kann jede Gangart oder Bewegung, die einen Affekt bzw. Affektverlauf widerspiegelt, per analogiam ausdrücken, indem sie „der Harmonie mehr oder weniger Reichthum oder Armuth, Leichtigkeit oder Schwierigkeit giebt, die Melodie durch nähere oder entferntere Verhältnisse fortschreiten lässt, die Bewegung schneller oder langsamer, gleichförmiger oder ungleichförmiger macht“.128 Auch wenn Engel der Nachahmungsästhetik noch in weiten Teilen verhaftet bleibt, und sei es durch die Verwendung des Verbs ,malen‘, enthält sein Text – wie Volker Kalisch gezeigt hat – wichtige Argumente „für eine im philosophischen Sinne anthropologische Betrachtungsweise der Musik“, die sich von der cartesianischen Affektenlehre in Richtung auf das Postulat unmittelbarer Gefühlsverständlichkeit absetzt.129 Durch einen Vergleich mit Johann Kuhnaus Vorrede zu der Musicalischen Vorstellung Einiger Biblischer Historien (1700) gelingt Kalisch der Nachweis, daß Musik und Affekt bei Engel nicht mehr in einer kodifizierten Zeichenrelation stehen, die dem Komponisten ein Arsenal „distinkte[r] musikalische[r] Wendungen“ zur Verfügung stellt, um „klassifizierbare emotive Zustände ab- und im Hörer wachzurufen“, sondern die Musik vielmehr als dynamische „Verlaufsform“ begriffen wird, der „unsere ebenfalls als Verläufe vorgestellte[n] Wahrnehmungs- und Empfindungsweisen individuell korrelieren“.130 Tatsächlich zeichnet sich in Engels Traktat – wie zuvor auch bei Burke, Beattie, Webb und Herder – eine völlig neue Auffassung vom Wesen psychischer Prozesse und seelischer Befindlichkeiten ab. Im Barockzeitalter galt der Affekt – mit den Worten Rolf Dammanns – als ein „in deutlichen Umrißlinien fixierter Gegenstand“, als „Typus“, der von der Musik „in stilisierter und überhöhter Pose [...] darzustellen“ sei: „Die Musikwirklichkeit des Barock kennt einen festen, präzisen Affektbegriff. Sie rechnet mit scharf konturierten, übergangslosen, nicht zerfließenden, typischen GrundAffekten [...]. Dem Musiker stehen zu deren Darstellung bestimmte [...] Strukturvorlagen modellartig zur Verfügung [...]. Das musikalische Darstellen der Affekte erfolgt [...] rational, objektiv und typisch, – nicht etwa irrational, subjektiv, empfindsam, undeutlich [...] oder gar als ,Ausdruck der Empfindungen‘, wobei die Musik ,rühren‘ soll.“131 128 129 130 131 42 Ebd., S. 317 f. Volker Kalisch: Zeichentheoretischer Diskurs und unbestimmte Sprache. Johann Jakob Engel und der musikästhetische Wandel im 18. Jahrhundert, in: Musiktheorie 13 (1998), S. 195–205, hier S. 200. Angesichts der zeitlich vorgelagerten Texte von Burke, Beattie und Webb, aber auch angesichts von Herders Viertem Kritischen Wäldchen, muß Kalischs zugespitzte These, Engel habe den „Grundstein“ für das anthropologische Musikverständnis gelegt (ebd.), freilich entschieden relativiert werden. Ebd., S. 197, 204 f. Rolf Dammann: Der Musikbegriff im deutschen Barock, S. 222, 234. Gleiches gilt nach Erika Fischer-Lichte für den ,künstlichen‘ Darstellungscode barocken Theaters, in dem die Geste des Schauspielers einen Affekt nach vorbestimmten Regeln quasi allegorisch repräsentiert, ohne sich den Anschein unwillkürlichen oder spontanen Verhaltens geben zu wollen.132 Hatte René Descartes 1649 in seinem Traktat Les passions de l’âme die „farbenreiche Welt der individuellen Gefühle“ auf ein System von sechs Grundaffekten (Bewunderung, Liebe, Hass, Verlangen, Freude, Trauer) samt vielfacher Kombinationsmöglichkeiten zurückgeführt,133 so beginnen die Konturen dieser Affekte unter den Vorzeichen der anthropologischen ,Erfahrungsseelenkunde‘ des 18. Jahrhunderts mehr und mehr zu zerfließen. Sie lösen sich auf in einen Strom unendlich abgestufter Empfindungsnuancen, dem mit klassifizierender Sprache nicht mehr beizukommen ist, da alle Seelenregungen, die jenseits der Schwelle des Bewußtseins ablaufen, im Moment des Fühlens für begriffliche Reflexion unerreichbar bleiben.134 Das Innere des Menschen gleicht für Herder einem „Meer von Tiefen, wo Welle über Welle sich regen, und wo alle Abstraktionen von Aehnlichkeit, Klasse, allgemeiner Ordnung nur bretterne Wände des Bedürfnisses oder bunte Kartenhäuser zum Spiel sind“.135 Und wenn Johann Jakob Engel schreibt, es liege im „Eigenthümlichen der dramatischen Gattung, [...] alles als werdend“ zu zeigen und „eben daher keine entschiedne bleibende Stimmung der Seele, kein Verweilen bei einerlei Empfindung, kein müssiges Ausbilden der Gedanken und Leidenschaften“ zuzulassen, so offenbart sich darin auch das Problem, distinkte Begriffe für etwas zu finden, das in seiner permanenten Metamorphose jeder Semantisierung entgleitet: „Die Ausdrücke die wir noch haben, bezeichnen nur sehr allgemeine Classen für die äusserste Nothdurft; die Unterarten, die Abarten, erwarten noch erst von irgend einem sprachschöpferischen Beobachter ihre Benennungen.“136 Die Sprache gerät sogar in Verdacht, durch Ansammlung leerer Formeln und Phrasen einen „dichte[n] Vorhang“ über die wahren Emotionen des Menschen zu breiten, „welchen am Ende der Blick des bildenden Beobachters und des beobachtenden Bilders der Herzen [...] nicht mehr durchdringen kann“; „wenn die Zunge noch lallet“ – also im Kindesalter – „sind die Worte schon 132 133 134 135 136 Vgl. Erika Fischer-Lichte: Vom „künstlichen“ zum „natürlichen“ Zeichen. Theater des Barock und der Aufklärung, Tübingen 1983 (Semiotik des Theaters 2), S. 10–61, bes. S. 20–28. Dénes Zoltai: Ethos und Affekt. Geschichte der philosophischen Musikästhetik von den Anfängen bis zu Hegel, Budapest und Berlin 1970, S. 155. Vgl. Ulrike Zeuch: Der Affekt: Tyrann des Ichs oder Befreier zum wahren Selbst? Zur Affektenlehre im Drama und in der Dramentheorie nach 1750, in: Theater im Kulturwandel des 18. Jahrhunderts, S. 69–89, bes. S. 74–76, sowie dies.: Umkehr der Sinneshierarchie, S. 150: „Zum einen untersuche die Vernunft [laut Herder] einzelne Seelenregungen isoliert und trenne, was eigentlich zusammengehöre [...]. Zum anderen abstrahiere sie im Prozeß der Begriffsbildung von dem unablässigen Gewoge im Innern des Menschen, seinem individuellen Seelenleben.“ Johann Gottfried Herder: Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele. Bemerkungen und Träume, in: Sämmtliche Werke, Bd. 8, S. 180 f. Johann Jakob Engel: Ideen zu einer Mimik (1785–1786), in: Schriften, Bde. 7 und 8, hier Bd. 8, S. 258; Bd. 7, S. 77. 43 gekünstelt, und hören auf, natürlicher Ausdruck der Empfindung zu sein.“137 Karl Philipp Moritz, der diese Diagnose 1782 in seinen Aussichten zu einer Experimentalseelenlehre publik macht, formuliert zwar einerseits die Möglichkeit, den „Schleier der Verstellung“ zu lüften, nämlich durch genaues Studium jener unabsichtlichen Verhaltensweisen, die rationaler Selbstkontrolle entzogen sind und sich etwa in „kleinsten körperlichen Bewegungen [...] bis zum Mienenspiele [...] verfolgen“ lassen,138 doch weist er andererseits auf die damit verbundenen Schwierigkeiten hin: „Wer sich zum eigentlichen Beobachter des Menschen bilden wollte, der müßte von sich selber ausgehen: [...] die Ebbe und Flut bemerken, welche den ganzen Tag über in seiner Seele herrscht, und die Verschiedenheit eines Augenblicks von dem andern; [...] ohne alle heftige Leidenschaften müßte er nicht sein, und doch die Kunst verstehn, in manchen Augenblicken seines Lebens sich plötzlich aus dem Wirbel seiner Begierden herauszuziehen, um eine Zeitlang den kalten Beobachter zu spielen, ohne sich im mindesten für sich selber zu interessieren. Von dem Leben der Menschen, deren Geschichte beschrieben ist, kennen wir nur die Oberfläche. Wir sehen wohl, wie der Zeiger an der Uhr sich drehet, aber wir kennen nicht das innre Triebwerk, das ihn bewegt. Wir sehen nicht, wie die ersten Keime von den Handlungen des Menschen sich im Innersten seiner Seele entwickeln.“139 Ähnlich schreibt auch Herder, es würde „uns sehr schwer [...], zu denken, und zugleich jeden unsrer Gedanken zu belauschen, in den Körper hineinzuempfinden, und zugleich auf jeden Eindruck zu merken, den diese Empfindung im Körper annimmt, also zugleich in und außer uns zu seyn“.140 Mehr noch: „Unsre[r] arme[n] Denkerin“, der Vernunft, entfiele das „Steuer“, wenn sie wirklich fähig wäre, „jeden Reiz, das Samenkorn jeglicher Empfindung, in seinen ersten Bestandtheilen zu fassen“ und ein „rauschendes Weltmeer so dunkler Wogen laut zu hören“, wie es im Innern des Menschen unablässig wogt. „Die mütterliche Natur entfernte also von ihr, was von ihrem klaren Bewußtseyn nicht abhangen konnte, wog jeden Eindruck ab, den sie davon bekam und sparte jeden Kanal aus, der zu ihr führte.“ Die „tiefste Tiefe unsrer Seele“ sei „mit Nacht bedeckt“, undurchdringlich für die Reflexion und damit unerreichbar für Sprache und Begriff.141 In dem Maße, wie die vormals statisch gefaßten, dafür aber klar etikettierbaren Affekte einer Dynamisierung unterliegen, drohen sie sich auch zu verflüchtigen, da es kaum möglich ist, die Veränderungen jedes Augenblicks zu registrieren und in der ,Ebbe und Flut‘ wogender 137 138 139 140 141 44 Karl Philipp Moritz: Aussichten zu einer Experimentalseelenlehre (1782), in: Werke, hrsg. von Horst Günther, Bd. 3: Erfahrung – Sprache – Denken, Frankfurt am Main 1981, S. 85–99, hier S. 88, 87. Ebd., S. 99, 98. Ebd., S. 92. Johann Gottfried Herder: Plastik (1770), in: Sämmtliche Werke, Bd. 8, S. 152. Johann Gottfried Herder: Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele. Bemerkungen und Träume, in: Sämmtliche Schriften, Bd. 8, S. 185. Gefühle einzelne Umrisse festzuhalten. Wo dies geschieht, beginnt der Mensch zwar erst damit, überhaupt Sprache zu entwickeln, indem die „Kraft seiner Seele so frei würket, daß sie in dem ganzen Ocean von Empfindungen [...] Eine Welle [...] absondern, sie anhalten, die Aufmerksamkeit auf sie richten“ kann, so Herder,142 doch sind die durch Reflexion gefundenen Begriffe gerade deshalb nicht imstande, dem Strom der Leidenschaften in seinem verschlungenen Lauf zu folgen, weil sie ihre Entstehung der Isolation einzelner Momente verdanken: „Eine schwätzende Empfindung wird unerträglich, indem dies Geschwätz sie eben ersetzen will und damit als unwahr zeiget. Töne dürfen sich verfolgen und überjagen, einander widersprechen und wiederholen; das Fliehen und Wiederkommen dieser zauberischen Luftgeister ist eben das Wesen der Kunst, die durch Schwingung wirket.“143 Während ,Geschwätz‘ nichts anderes leisten kann, als die Empfindung auf inadäquate Weise durch Worte zu ,ersetzen‘, fallen Musik und Empfindung zusammen. Was sich in der Seele vollzieht, wird ohne den Zwischenschritt einer zeichenhaften Repräsentation, deren Code bekannt sein müßte, im Medium des Klanges realisiert und somit ohne Umwege über Begriffe von allen Menschen verstanden.144 Das Resonanzprinzip tut seine Wirkung, und es ist kein Zufall, daß Herder die ,eigne innigste Natur‘ des Menschen explizit als ,Clavichord‘ bezeichnet,145 avanciert doch gerade dieses Instrument in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zum Symbol der neuen, ,empfindsamen‘ Musikauffassung bzw. – mit den Worten Wolfgang Scherers – zum „konstruktive[n] Element einer Psychophysik“, die von der „äußere[n] Welt [...] der Mechanik in die innere der Einbildungs- und Ideenkräfte“ vorzurücken sucht.146 Gegenüber Cembalo und Hammerklavier besitzt das Clavichord die Eigentümlichkeit, daß der angeschlagene Ton mit jeder Veränderung des Tastendrucks wie durch ein Vibrato belebt und variiert werden kann,147 was es in optimaler Weise ermöglicht, die als Schwingung vorgestellte Gefühlsdynamik den Saiten des Instrumentes ,einzubeben‘ und sie von dort auf den Zuhörer zu übertragen, indem dessen Nerven und ,Gehörfibern‘ das empfangene Bewegungsmoment wiederum an die ,Saiten der Empfindung‘ weiterleiten. Pointiert ausgedrückt: 142 143 144 145 146 147 Johann Gottfried Herder: Abhandlung über den Ursprung der Sprache, in: Sämmtliche Werke, Bd. 5, S. 34 f. Johann Gottfried Herder: Kalligone, in: Sämmtliche Werke, Bd. 22, S. 185. Insofern gilt auch für Herder, was Volker Kalisch in bezug auf Johann Jakob Engel äußert, daß nämlich dessen anthropologische Ästhetik prinzipiell allen Menschen attestiert, Musik in gleicher Weise sinnlich zu erfahren, und nicht etwa „einen Musikhörer voraus[setzt], der sich [...] erst einmal die Kenntnis eines bestimmten Zeichenvorrats aneignen muß, um hörend-verstehend an der Musik überhaupt partizipieren zu können“ (Zeichentheoretischer Diskurs und unbestimmte Sprache, S. 200). Siehe oben, S. 38. Wolfgang Scherer: Klavier-Spiele, S. 89. Vgl. Peter Rummenhöller: Die musikalische Vorklassik. Kulturhistorische und musikgeschichtliche Grundrisse zur Musik im 18. Jahrhundert zwischen Barock und Klassik, Kassel u. a. 1983, S. 166. 45 Der Idealzustand musikalischer Unmittelbarkeit ist erreicht, wenn das in ,Schwingung‘ geratene Seelenleben des Spielers durch den Klang der resonierenden Clavichord-Saiten auf die Nerven des Zuhörers übergreift, sie förmlich mit der Empfindung infiziert. Nicht von ungefähr hat Erika Fischer-Lichte darauf hingewiesen, daß in der Theaterästhetik des 18. Jahrhunderts, unter anderem bei Johann Jakob Engel, die Art und Weise, wie eine Affektgebärde des Bühnendarstellers auf den Zuschauer wirkt, metaphorisch als ,Ansteckung‘ beschrieben wurde – als Ansteckung nämlich mit jener Leidenschaft, die in der Gebärde unmittelbar zum Ausdruck kommt.148 Wenn etwa Engel das „Ansteckende eines fremden Gebehrdenspiels“ hervorhebt,149 so läßt sich der solchermaßen skizzierte Rezeptionsmodus ohne weiteres auf die Musik übertragen, beendet derselbe Autor sein Traktat Über die musikalische Malerei doch ausdrücklich mit der Bemerkung, man könne „die herausgebrachten Regeln auch noch auf Declamation und Pantomime anwenden. Denn in der That gelten sie für alle energischen Künste.“150 Entsprechend heißt es in den fünf Jahre später verfaßten Ideen zu einer Mimik, das Gebärdenspiel sei „gleichsam Musik für das Auge, so wie diese gleichsam Tanz für das Ohr“, denn beiden Künsten – wie auch dem „mechanischen Theil“ der Poesie, nämlich Versbau und Rhythmus – lägen „einerlei Hauptbegriffe und Regeln zum Grunde“.151 Derselbe Gedanke findet sich auch bei Johann Gottfried Herder, wiederum durch das Prinzip der psychophysischen Wechselwirkung einerseits sowie durch die Resonanztheorie andererseits begründet. Im Vierten Kritischen Wäldchen referiert Herder zunächst die Beobachtung, daß seelische und physiologische Vorgänge, also innere und äußere Bewegung des Menschen, miteinander korrespondieren, weshalb man „nach einer alten Erfahrung in einen gewißen, selbst gewaltsamen Ton der Seele kommt, wenn man sich in die Geberden desselben körperlich setzt“.152 Aus diesem Phänomen leitet er – nicht anders als Engel – die Parallelität von 148 149 150 151 152 46 Vgl. Erika Fischer-Lichte: Der Körper als Zeichen und als Erfahrung. Über die Wirkung von Theateraufführungen, in: Theater im Kulturwandel des 18. Jahrhunderts, S. 53–68, bes. S. 63 f. Johann Jakob Engel: Ideen zu einer Mimik, Bd. 7, S. 100. Johann Jakob Engel: Über die musikalische Malerei, S. 342 (zum Begriff des ,Energischen‘ siehe unten, S. 49 f. und 72 f.) Johann Jakob Engel: Ideen zu einer Mimik, Bd. 8, S. 172 f., 132, 137. Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 121. Herder greift hier auf einen Topos anthropologischer Schauspieltheorie zurück, den auch Gotthold Ephraim Lessing in seiner Hamburgischen Dramaturgie von 1767/68 formuliert (Werke und Briefe in zwölf Bänden, hrsg. von Wilfried Barner u. a., Bd. 6, Frankfurt am Main 1985, S. 181–694, hier S. 198 f.): „Und ich sage; wenn er [der Akteur] nur die allergröbsten Äußerungen des Zornes [...] getreu nachzumachen weiß – den hastigen Gang, den stampfenden Fuß, den rauhen bald kreischenden bald verbissenen Ton, das Spiel der Augenbraunen [sic!], die zitternde Lippe, das Knirschen der Zähne u. s. w. – wenn er, sage ich, nur diese Dinge, die sich nachmachen lassen, sobald man will, gut nachmacht: so wird dadurch unfehlbar seine Seele ein dunkles Gefühl von Zorn befallen, welches wiederum in den Körper zurückwirkt, und da auch diejenigen Veränderungen hervorbringt, die nicht bloß von unserm Willen abhangen; sein Gesicht wird glühen, seine Augen werden blitzen, seine Muskeln werden schwellen; kurz, er wird ein wahrer Zorniger zu sein scheinen, ohne es zu sein, ohne im geringsten zu begreifen, warum er es sein sollte.“ Zu dieser Wechselwirkung von ,influxus corporis‘ und ,influxus animae‘ vgl. Alexander Košenina: Anthropologie und Schauspielkunst. Studien zur musikalischem und tänzerischem bzw. schauspielerischem Ausdruck ab. Wie die Musik durch Schallwellen das innere ,Clavichord‘ der ‚Gehörfibern‘ mitschwingen läßt, so realisieren Gebärde und Tanz den Verlauf seelischer Empfindungen im Medium des Körpers und sorgen auf diese Weise für eine ,sympathetische‘ Affektübertragung, die per analogiam durch das Resonanzprinzip zu erklären ist: „Die Töne sind eben das, was einem andern Sinn die Gebehrden sind, Ausdruck der beweglichen Natur, elastische Schwingungen, eine unmittelbare Herzenssprache.“153 „Durch und durch sind wir elastische Wesen“, so Herder, und dies bedeutet, daß der Mensch auf den Außenreiz jedes musikalischen, expressiv-gestischen oder tänzerischen Bewegungsimpulses „wie eine gleichgestimmte zarte Saite“ reagiert.154 Die gemeinsame Fundierung von Musik und Affektgebärde im Mechanismus einer sowohl physischen wie seelischen ,Ansteckung‘ qua Resonanz, deren Unmittelbarkeit weit über das arbiträre Zeichensystem der Wortsprache hinausreicht, legt es nahe, Körper und Klang in gemeinsamer Bewegung zusammenzuführen, um den Effekt auf das Publikum zu potenzieren. Es entspricht daher dem anthropologischen Programm, daß Carl Philipp Emanuel Bach jedem „Musickus“ rät, auch den Körper einzusetzen, um „sich der Gemüther seiner Zuhörer“ zu „bemeistern“: „So unanständig und schädlich heßliche Gebährden sind: so nützlich sind die guten, indem sie unsern Absichten bey den Zuhörern zu Hülfe kommen“, was nur „derjenige [...] läugnen“ könne, „welcher durch seine Unempfindlichkeit genöthigt ist, wie ein geschnitztes Bild vor dem Instrumente zu sitzen.“155 Auf welch faszinierende Weise sich dieses Postulat in Bachs eigenem Spiel niederschlug, hat Charles Burney anschaulich festgehalten: „After dinner [...] I prevailed upon him to sit down again to a clavichord, and he played, with little intermission, till near eleven o’clock at night. During this time, he grew so animated and possessed, that he not only played, but looked like one inspired. His eyes were fixed, his under lip fell, and drops of effervescence distilled from his countenance.“156 Insofern musikalischer und körperlicher Ausdruck einem identischen Wirkungsmodus unterliegen, verwundert es nicht, daß Herder die Tanzkunst als „sichtbar gemachte Musik“ 153 154 155 156 ,eloquentia corporis‘ im 18. Jahrhundert, Tübingen 1995 (Theatron. Studien zur Geschichte und Theorie der dramatischen Künste 11), S. 85–116, bes. S. 86 f. Johann Gottfried Herder: Adrastea (II. Band, 4. Stück) (1802), in: Sämmtliche Werke, Bd. 23, S. 331. Johann Gottfried Herder: Kalligone, in: Sämmtliche Werke, Bd. 22, S. 68; Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 109. Carl Philipp Emanuel Bach: Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen, Berlin 1753/1762. Nachdruck, hrsg. von Lothar Hoffmann-Erbrecht, Leipzig 21969, Teil 1, S. 122 f. Charles Burney: The Present State of Music in Germany, the Netherlands, and United Provinces. Or, the Journal of a Tour through Those Countries, Undertaken to Collect Materials for a General History of Music (1773), London 21775. Nachdruck New York 1969 (Monuments of Music and Music Literature in Facsimile. Second Series: Music Literature 117), Bd. 2, S. 270. 47 begreift, „denn da die Töne [...] Zeitmäßige Schwingungen sind, so regen sie, wie die Empfindung sie maaß, hob, senkte, den Körper; der Rhythmus ihres Ausdrucks drückt sich aus durch seinen Rhythmus. Daher auch die mit der Musik verbundene Gebehrdung.“157 Obwohl der Tanz sich an das Auge richtet, muß er folglich unter jenen ästhetischen Prämissen beurteilt werden, die eigentlich dem Sinn des Gehörs entsprechen. Das Verhältnis „zwischen Linien der Bewegung“ ist für seine affektive Intensität also ebensowenig verantwortlich wie in der Musik das „blosse Verhältniß zwischen Tönen“,158 und wenn Herder über die Ballettkunst seiner eigenen Epoche klagt: „Sie zirkelt [...] in künstlichen Linien der Bewegung und Stellungen, wie die neuere Tonkunst in Tönen und Akkorden“,159 so fühlt man sich an die Bemerkung erinnert, das ,alte Hauptgesetz der Musik, alles rund zu machen‘, sei manchem Komponisten ,Lehn- und Schlafstuhl‘ geworden, in dem er sich ,periodisch wieget‘. Offenbar spielt Herder darauf an, daß Musik und Tanzkunst unter dem Primat eines vom Auge abstrahierten Schönheitsbegriffes ihrer eigentlichen Natur entfremdet worden wären, indem sie sich architektonischen Kategorien wie Symmetrie, Ebenmaß und Proportion hätten unterwerfen müssen. Denn dasjenige, was Herder ,Rhythmus des Ausdrucks‘ nennt, ist offenbar nicht – im Sinne Sulzers – als faßliche Gliederung eines melodischen oder tänzerischen Bewegungsablaufs zu verstehen, sondern als unmittelbares Korrelat fluktuierender Leidenschaften, einzig dem Gesetz der Gefühlsdynamik verpflichtet. Die Melodie wird bei Herder dementsprechend zur „Schwunglinie“, und von der lyrischen Poesie der Griechen heißt es, sie sei „Schwung der Empfindung durch mancherlei Töne“ gewesen.160 Da aber die Empfindungen nicht einzeln festgehalten werden können und nur als permanente Metamorphose wahrzunehmen sind, ist das transitorische Wesen der Musik kein ästhetischer Mangel, wie Kant in der Kritik der Urteilskraft argumentiert hatte,161 sondern im Gegenteil Voraussetzung und Garant dessen, was Herder als ,sympathetische Wahrheit‘ bezeichnet: „Vorübergehend also ist jeder Augenblick dieser Kunst und muß es seyn: denn eben das kürzer und länger, stärker und schwächer, höher und tiefer, mehr und minder ist seine Bedeutung, sein Eindruck. Im Kommen und Fliehen, im Werden und Gewesenseyn liegt die Siegskraft des Tons und der Empfindung. Wie jener und diese sich mit mehreren verschmelzen, sich heben, sinken, untergehn und am gespannten Seil der Harmonie nach ewigen, unauflösbaren Gesetzen wieder emporkommen und neu wirken, so mein Gemüth, mein Muth, meine Liebe und Hoffnung.“162 157 158 159 160 161 162 48 Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 121; Kalligone, in: Sämmtliche Werke, Bd. 22, S. 181. Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 121. Ebd., S. 122. Johann Gottfried Herder: Kalligone, in: Sämmtliche Werke, Bd. 22, S. 179; Adrastea (III. Band, 2. Stück) (1802), in: Sämmtliche Werke, Bd. 23, S. 563. Siehe unten, S. 56 f. Johann Gottfried Herder: Kalligone, in: Sämmtliche Werke, Bd. 22, S. 187. Um diesen Sachverhalt ästhetisch fassen zu können, greift Herder auf die von Aristoteles geprägte Unterscheidung zwischen ergon und energeia bzw. – wie es im Ersten Kritischen Wäldchen heißt163 – „zwischen Werk und Energie“ zurück: „Bei allen vorübergehenden Künsten sind seine [des Künstlers] Produkte Wirkungen (ενεργειαι), nicht Werke; dagegen, wo ein bleibendes Werk (opus) sein Ziel ist, seine Energie solange unvollendet ist, als er wirket.“164 Töricht wäre es daher, von der Musik zu fordern, sie solle „stehende Formen“ hervorbringen, denn das hieße, „ohne Theilnahme [...] die Hammerschläge einen Bau erschaffen“ hören, „der nie ganz vor uns steht, bei dem wir der Muse danken, wenn der letzte Hammerschlag austönet“.165 Abermals führt Herder an dieser Stelle den Gegensatz zwischen Ton- und Baukunst ins Feld und damit – im Sinne seiner anthropologischen Ästhetik – zugleich die grundlegend verschiedene Rezeptionsweise von Ohr und Auge: „Von festen Umrissen und Formen, wie sie das Auge zeigt, kann bei Empfindungen, sogar bei Gestalten, die durchs Gehör zu uns kommen, [...] nicht die Rede seyn, da das Ohr eigentlich nie fest gestaltet. Könnten aber auch Töne Formen oder Theile der Form bilden; sie dauren alle nur Momente; jeder nimmt seine Form mit sich und begräbt sie. Eine böse Kunst wäre es, die durch lauter Zerstückungen wirkte, d. i. in einem Endlosen Maasse anlegte, die nichts mäßen und kein Maas wären, die fliessendes Wasser oder zerrinnenden Sand mit Tantalus und Sisyphus Mühe zu nicht-bestehenden Massen formte.“166 Wenn die Musik hier mit ,fließendem Wasser‘ verglichen wird, das keine ,Zerstückung‘ in abgemessene Formteile zuläßt und sich nicht zu einer ,Masse‘ verfestigen kann, so liegt es nahe, diese Äußerung auf das im Brief an Gluck verwendete Bild des Stromes zu beziehen. Auch ergeben sich – wie etwa Rudolf Bockholdt dargestellt hat167 – weitreichende Konsequenzen für den musikalischen Werkbegriff. Die Niederschrift einer ,energischen‘ Progression versteht Herder offenbar als bloßes Substrat des tönenden Ereignisses, und es ließe sich durchaus folgern, daß die überlieferte Textgestalt der ,Energie‘ nur einen Zustand ihrer flüchtigen Existenz fixiert, keinesfalls aber ein ,opus perfectum et absolutum‘ im emphatischen Sinne darstellt, das – gleich einem Werk der bildenden Kunst – für alle Zeiten unverändert bestehen müßte. Walter Wiora hat darauf hingewiesen, daß Herder gerade die Veränderlich163 164 165 166 167 Johann Gottfried Herder: Erstes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 3, S. 82. Johann Gottfried Herder: Kalligone, in: Sämmtliche Werke, Bd. 22, S. 125 (vgl. auch Roland Krebs: Herder, Goethe und die ästhetische Diskussion um 1770. Zu den Begriffen „énergie“ und „Kraft“ in der französischen und deutschen Poetik, in: Goethe-Jahrbuch 112 [1995], S. 83–96). Johann Gottfried Herder: Kalligone, in: Sämmtliche Werke, Bd. 22, S. 273. Ebd., S. 270. Vgl. Rudolf Bockholdt: „Von unten herauf“, nicht „von oben herab“, S. 251 f. 49 keit des Volksliedes als Zeichen von dessen ursprünglicher Lebenskraft ansah, als Gegensatz zum bloßen Repetieren auswendig gelernter Verse und Melodien, in denen sich die musikalisch-poetische ,Energie‘ wider ihre Natur zum ,Werk‘ verhärtet und damit erstarrt.168 Herder und Schiller: ,Strom‘ versus ,Gestalt‘ Noch klarer zeichnet sich die Intention von Herders Gedankengang freilich vor dem Hintergrund der vielzitierten Forderung Schillers ab, daß „Musik in ihrer höchsten Veredlung [...] Gestalt werden und mit der ruhigen Macht der Antike auf uns wirken“ müsse.169 Während Herder die emotionale Unmittelbarkeit der Töne durchweg positiv bewertet, erscheint sie aus der Perspektive idealistischer Kunstbetrachtung als Gefahr für die sittlich-moralische Freiheit, was der von Abscheu und Ekel getragenen Beschreibung ergriffener Konzertbesucher in Schillers Aufsatz Über das Pathetische nur zu deutlich abgelesen werden kann: „Alles Schmelzende wird [...] vorgezogen, und wenn noch so großer Lärm in einem Konzertsaal ist, so wird plötzlich alles Ohr, wenn eine schmelzende Passage vorgetragen wird. Ein bis ins Tierische gehender Ausdruck der Sinnlichkeit erscheint dann gewöhnlich auf allen Gesichtern, die trunkenen Augen schwimmen, der offene Mund ist ganz Begierde, ein wollüstiges Zittern ergreift den ganzen Körper, der Atem ist schnell und schwach, kurz alle Symptome der Berauschung stellen sich ein: zum deutlichen Beweise, daß die Sinne schwelgen, der Geist aber oder das Prinzip der Freiheit im Menschen der Gewalt des sinnlichen Eindrucks zum Raube wird. Alle diese Rührungen, sage ich, sind durch einen edeln und männlichen Geschmack von der Kunst ausgeschlossen, weil sie bloß allein dem Sinne gefallen, mit dem die Kunst nichts zu verkehren hat.“170 Das Projekt der Briefe Über die ästhetische Erziehung besteht zwar gerade darin, die gefährliche Naturferne einer auf Rationalität und Abstraktion gegründeten Aufklärung zu überwinden und letztere wieder an die „Sinnenwelt“ zu vermitteln, damit in der „Totalität des Charakters“ Empfindung und Vernunft, Instinkt und Moral harmonisch zusammenwirken, anstatt sich gegenseitig die Herrschaft über den Menschen streitig zu machen.171 Doch ist es bezeichnend, daß Schiller jenen kritisch beäugten „Trieb“, den er als „sinnlichen“ qualifiziert, weil durch ihn der Mensch auf das „physische Dasein“ zurückgeworfen, gewissermaßen in 168 169 170 171 50 Vgl. Walter Wiora: Herders Ideen zur Geschichte der Musik, S. 114. Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (1795), in: Sämtliche Werke, hrsg. von Gerhard Fricke und Herbert G. Göpfert, Bd. 5: Erzählungen. Theoretische Schriften, München 91993, S. 570–669, hier S. 639. Friedrich Schiller: Über das Pathetische (1793), in: Sämtliche Werke, Bd. 5: Erzählungen. Theoretische Schriften, S. 512–537, hier S. 516. Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, S. 585, 579. eine bloße Folge von Empfindungsmomenten aufgelöst werde, mit dem Beispiel der Musik veranschaulicht: „Da alles, was in der Zeit ist, nacheinander ist, so wird dadurch, daß etwas ist, alles andere ausgeschlossen. Indem man auf einem Instrument einen Ton greift, ist unter allen Tönen, die es möglicherweise angeben kann, nur dieser einzige wirklich; indem der Mensch das Gegenwärtige empfindet, ist die ganze unendliche Möglichkeit seiner Bestimmungen auf diese einzige Art des Daseins beschränkt [...]; der Mensch ist in diesem Zustande nichts als eine Größeneinheit, ein erfüllter Moment der Zeit – oder vielmehr er ist nicht, denn seine Persönlichkeit ist solange aufgehoben, als ihn die Empfindung beherrscht und die Zeit mit sich fortreißt.“172 Dort aber, wo sich die ,Persönlichkeit‘ des Menschen, seine „absolute Existenz“ jenseits aller Beschränkungen, die ihm von der Natur auferlegt werden, Geltung verschafft, das Einheitliche in der Mannigfaltigkeit wechselnder Gemütszustände, sieht Schiller einen anderen, entgegengesetzten Trieb am Werk, den „Formtrieb“.173 Bestrebt, im Fluß der Zeit, im Wandel der Gefühle ein Unveränderliches festzuhalten, richtet sich der ,Formtrieb‘ auf etwas, das Schiller „Gestalt“ nennt, und zwar „sowohl in uneigentlicher als in eigentlicher Bedeutung“.174 Den Gegenpol zur ,Gestalt‘ bildet die amorphe Reihe der Empfindungen, denn solange wir das „Leben bloß fühlen, ist es gestaltlos, bloße Impression“.175 Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß Schiller den Begriff der ,Gestalt‘ auf ästhetischer Seite primär mit einem „Bildwerk“ assoziiert, das „durch die Bestimmtheit seines Begriffs an die ernste Wissenschaft grenzt“, wie die ,Gestalt‘ generell durch „alle formalen Beschaffenheiten der Dinge und alle Beziehungen derselben auf die Denkkräfte“ definiert ist.176 Die Musik stellt in diesem Sinne das genaue Gegenteil einer ,Gestalt‘ dar, denn weder vermag sie den ,Denkkräften‘ bestimmte Begriffe zu vermitteln, noch ist es ihr möglich, sich aus der Zeit herauszuheben. Daß dabei – im Hinblick auf die musikalische Rezeption – eine grundlegende Skepsis gegenüber dem Ohr zum Tragen kommt, hat Schiller zwar kaum systematisch ausgeführt, doch formulierte Christian Friedrich Michaelis 1795 in seiner an Kant und Schiller orientierten Studie Ueber den Geist der Tonkunst um so deutlicher den fundamentalen Gegensatz zwischen ,Anschauung‘ (Auge) und ,Empfindung‘ (Ohr): „Bei dem sichtbaren Gegenstande hat der Geist Anschauungen vor sich, bei dem hörbaren aber Empfindungen in sich, und keine eigentlichen Anschauungen; hier rührt ihn mehr der Sinnenreiz, wenn ihn dort die Form der Schönheit beschäftiget. [...] Die bloße 172 173 174 175 176 Ebd., S. 604. Ebd., S. 612, 605. Ebd., S. 614. Ebd. Ebd., S. 639, 614. 51 Gestalt aber an den anschaulichen Objekten der bildenden Kunst läßt sich in einem hohen Grade von allem Sinnenreiz trennen, rein darstellen und wahrnehmen. Hier ist also freies Wohlgefallen an der schönen Form des Gegenstandes weit eher möglich, als in der Musik, welche immer zu nahe Beziehungen auf unser Herz hat, als daß wir so leicht ein uninteressirtes, freies und daher allgemeingültiges Geschmacksurtheil über ihre Schönheit fällen könnten.“177 Das Gebiet der Musik bleibt – mit Daniel Webb zu sprechen178 – die ,impression‘, was Schiller sehr wohl eingestand, als er sich der Metapher des Stromes bediente, um die zugleich faszinierende und bedrohliche „Macht des Gesanges“ in dem gleichnamigen Gedicht zu beschreiben: „Ein Regenstrom aus Felsenrissen, Er kommt mit Donners Ungestüm, Bergtrümmer folgen seinen Güssen, Und Eichen stürzen unter ihm; Erstaunt, mit wollustvollem Grausen, Hört ihn der Wanderer und lauscht, Er hört die Flut vom Felsen brausen, Doch weiß er nicht, woher sie rauscht; So strömen des Gesanges Wellen Hervor aus nie entdeckten Quellen.“179 Das von Schiller gezeichnete Bild ruft die Topoi des Erhabenen ab, aus denen sich im 18. Jahrhundert, paradigmatisch bei Edmund Burke,180 eine Gegenwelt zur Kategorie des Schönen formiert hatte.181 Wenn dabei von ,wollustvollem Grausen‘ die Rede ist, so kommt jene „erotische Schwingung der Angstlust“ ins Spiel, die Hans-Thies Lehmann als geheimes Zentrum aus der Beschreibung des Erhabenen bei Immanuel Kant herausschält, jene Furcht vor „,Überschwemmung‘ der rationalen Ich-Funktionen“, vor dem „mimetischen Hinüberfließen des Bewußtseins zur [...] widervernünftigen Natur“, die alle idealistisch geprägten „Theorien des Erhabenen“ letztlich als „Figuren seiner Verdrängung“ erscheinen läßt.182 177 178 179 180 181 182 52 Christian Friedrich Michaelis: Ueber den Geist der Tonkunst. Mit Rücksicht auf Kants Kritik der ästhetischen Urtheilskraft. Ein ästhetischer Versuch (1795), in: ders.: Ueber den Geist der Tonkunst und andere Schriften, ausgewählt, hrsg. und kommentiert von Lothar Schmidt, Chemnitz 1997 (Musikästhetische Schriften nach Kant 2), S. 1–70, hier S. 15, 16 f. Siehe oben, S. 40. Friedrich Schiller: Die Macht des Gesanges (1796), in: Sämtliche Werke, Bd. 1: Gedichte. Dramen I, München 81987, S. 209. Vgl. Edmund Burke: A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, S. 82: „The noise of vast cataracts, raging storms, thunder, or artillery, awakes a great and aweful sensation in the mind, though we can observe no nicety or artifice in those sorts of music.“ Vgl. Carsten Zelle: „Angenehmes Grauen“. Literaturhistorische Beiträge zur Ästhetik des Schrecklichen im achtzehnten Jahrhundert, Hamburg 1987 (Studien zum achtzehnten Jahrhundert 10), S. 186–202. Hans-Thies Lehmann: Das Erhabene ist das Unheimliche. Zur Theorie einer Kunst des Ereignisses, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken 43 (1989), S. 751–764, hier S. 753, 758, 755, 758. Auch am Beginn von Schillers Wilhelm Tell, in der ersten Strophe des „Kuhreihens“, den Fischerknabe, Hirt und Alpenjäger anstimmen, wird die verhängnisvolle Magie der Musik ins poetische Bild des Ertrinkens gebracht. Was dem besungenen Schläfer ein himmlischer Klang zu sein scheint, erweist sich – mit den Worten Hans Schultes – als „voice of a demonic ,Es‘ from the deep“.183 Der erträumte Engelschor mutiert in einen lockenden Sirenengesang, und nicht das Paradies öffnet sich, sondern die Wogen des Sees schlagen über dem Hilflosen zusammen: „Es lächelt der See, er ladet zum Bade, Der Knabe schlief ein am grünen Gestade, Da hört er ein Klingen, Wie Flöten so süß, Wie Stimmen der Engel Im Paradies. Und wie er erwachet in seliger Lust, Da spülen die Wasser ihm um die Brust, Und es ruft aus den Tiefen: Lieb Knabe, bist mein! Ich locke den Schläfer, Ich zieh ihn herein.“184 Wie nicht zuletzt die opernhafte Anlage des Wilhelm Tell verrät, aber auch der programmatische Gebrauch des Chores im Trauerspiel Die Braut von Messina,185 konnte Schiller sich den Anfechtungen durch die Musik keineswegs entziehen. Namentlich sein Frühwerk trägt sogar alle Zeichen des Bestrebens, Lyrik und Drama zu musikalisieren und im Rhythmus dichterischer Verse jenen „gestic song-and-dance mode of a sentimentive ecstasy“ zu verwirklichen, der – auch von Herder – als Merkmal des antiken Dithyrambus angesehen wurde.186 Noch 1794, nach der Hinwendung zu einer klassizistischen Ästhetik unter dem Einfluß der Philosophie Immanuel Kants, lobte Schiller das Gedicht Abendlandschaft von Friedrich von Matthisson ausdrücklich dafür, daß der Leser „etwas dem Eindruck Analoges“ erhalte, „den etwa eine schöne Sonate auf ihn machen würde“.187 Und in bezug auf sein eigenes Schaffen äußerte er sowohl gegenüber Goethe als auch gegenüber Christian Gottfried Körner, daß ihm 183 184 185 186 187 Hans Schulte: Work and Music. Schiller’s „Reich des Klanges“, in: The Romantic Tradition. German Literature and Music in the Nineteenth Century, hrsg. von Gerald Chapple u. a., Lanham u. a. 1992 (The McMaster Colloquium on German Studies 4), S. 133–164, hier S. 148. Friedrich Schiller: Wilhelm Tell. Schauspiel (1804), in: Sämtliche Werke, Bd. 2: Dramen II, München 1981, S. 913–1029, hier S. 917. Vgl. Hermann Fähnrich: Schillers Musikalität und Musikanschauung, Hildesheim 1977, S. 167–186. Hans Schulte: Work and Music, S. 143. Friedrich Schiller: Über Matthissons Gedichte (1794), in: Sämtliche Werke, Bd. 5: Erzählungen. Theoretische Schriften, S. 992–1011, hier S. 1004. 53 das „Musikalische eines Gedichts [...] weit öfter vor der Seele“ schwebe, „als der klare Begriff von Inhalt“.188 „Bei mir ist die Empfindung anfangs ohne bestimmten und klaren Gegenstand; dieser bildet sich erst später. Eine gewisse musikalische Gemütsstimmung geht vorher, und auf diese folgt bei mir erst die poetische Idee.“189 Angesichts dieser Berichte aus Schillers poetischer Werkstatt mag man sich kaum vorstellen, daß der Dichter einen solchen Abscheu gegen Musik empfunden haben soll, wie der Aufsatz Über das Pathetische vermuten läßt. Doch bekennt er seinem Freund Körner: „Oft widerfährt es mir, daß ich mich der Entstehungsart meiner Produkte, auch der gelungensten, schäme.“190 Offenbar löste Musik bei Schiller genau dasjenige aus, was er in seinem Gedicht Die Macht des Gesanges als ,wollustvolles Grausen‘ apostrophiert hat: ein Gefühl der Überwältigung und rauschhaften Begeisterung, das produktive Kräfte freizusetzen vermag, aber zugleich dem bewußten Ich damit droht, es – im wahrsten Sinne des Wortes – außer Fassung zu bringen. Zu verstörend war diese ,Angstlust‘, zu bedrohlich für die moralische Freiheit, als daß sie nicht hätte gebändigt werden müssen: „Ohne Form würde [die Musik] über uns blind gebieten; ihre Form rettet unsre Freiheit.“191 Und dies bedeutete für Schiller zweierlei: Zum einen belehrte er Matthisson darüber, daß es notwendig sei, in die „Musik seiner Sprache einen tiefen Sinn einzukleiden“, also der Einbildungskraft des Lesers konkrete Ideen vorzuzeichnen, um dessen Empfindungen auf einen rationalisierbaren Gegenstand zu fokussieren;192 zum anderen aber – und hierfür sollte die Theorie der ,Gestalt‘ einstehen – mußte Musik dort, wo sich ihr Inhalt nicht durch Worte erklärt, einem ,Bildwerk‘ ähnlich gemacht, das Hören somit in imaginäres Schauen verwandelt werden, denn nur so war zu gewährleisten, daß sich der Hörer im betrachtenden Nachvollzug klar konturierter Formen seiner selbst bewußt bleibt und nicht wie Don Carlos durch das Lautenspiel der Prinzessin von Eboli beinahe allen Verstand verliert, weil er buchstäblich ,ganz Ohr‘ ist (2. Akt, 8. Auftritt): 188 189 190 191 192 54 Brief Friedrich Schillers an Christian Gottfried Körner vom 25. Mai 1792, in: Briefwechsel zwischen Schiller und Körner, hrsg., ausgewählt und kommentiert von Klaus L. Berghahn, München 1973, S. 148. Brief Friedrich Schillers an Johann Wolfgang von Goethe vom 18. März 1796, in: Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, hrsg. von Paul Stapf, Berlin u. a. 1960, S. 141. Brief Friedrich Schillers an Christian Gottfried Körner vom 25. Mai 1792, in: Briefwechsel zwischen Schiller und Körner, S. 147. Friedrich Schiller: Zu Gottfried Körners Aufsatz über Charakterdarstellung in der Musik (1795), in: Sämtliche Werke, Bd. 5: Erzählungen. Theoretische Schriften, S. 1044–1046, hier S. 1046 (vgl. Wilhelm Seidel: Zwischen Immanuel Kant und der musikalischen Klassik, S. 74 f.). Friedrich Schiller: Über Matthissons Gedichte, S. 1011. „Und Laute – das weiß Gott im Himmel! – Laute, Die lieb ich bis zur Raserei. Ich bin Ganz Ohr, ich weiß nichts von mir selber [...].“193 ,Ganz Ohr‘ zu sein, heißt für Schiller, nichts mehr von sich selbst zu wissen, in eine ,Raserei‘ zu verfallen, die alle ,Persönlichkeit‘ aufhebt und sie der verabsolutierten Empfindung zum Opfer bringt, wie umgekehrt – so läßt sich ohne weiteres schließen – das Auge und die von ihm wahrgenommene Form als ,Gestalt‘ das Reflexionsvermögen des Menschen zum Widerstand gegen die ,blinde‘ Macht der Gefühle aufrufen. Hinter der „Hochstilisierung des Auges“ wird – nach Diagnose von Peter Utz194 – die „niedergekämpfte Triebnatur“ sichtbar, die sich freilich nur allzu leicht wieder aus den Ketten der Vernunft loszureißen vermag, wenn das Ohr die Herrschaft über den Menschen gewinnt. Das ,Betrachten‘ oder ,Blicken‘ erweist sich bei Schiller folgerichtig als Mittel zur Beherrschung aller inneren und äußeren Natur, als einzige Möglichkeit, den Schrecken des Erhabenen – auch des Musikalisch-Erhabenen – durch Distanzierung zu bannen: „Solange der Mensch, in seinem ersten physischen Zustande, die Sinnenwelt bloß leidend in sich aufnimmt, bloß empfindet, ist er auch noch völlig eins mit derselben, und eben weil er selbst bloß Welt ist, so ist für ihn noch keine Welt. Erst wenn er in seinem ästhetischen Stande sie außer sich stellt oder betrachtet, sondert sich seine Persönlichkeit von ihr ab, und es erscheint ihm eine Welt, weil er aufgehört hat, mit derselben eins auszumachen. [...] Aus einem Sklaven der Natur, solang er sie bloß empfindet, wird der Mensch ihr Gesetzgeber, sobald er sie denkt. Die ihn vordem nur als Macht beherrschte, steht jetzt als Objekt vor seinem richtenden Blick. Was ihm Objekt ist, hat keine Gewalt über ihn, denn um Objekt zu sein, muß es die seinige erfahren. Soweit er der Materie Form gibt, und solange er sie gibt, ist er ihren Wirkungen unverletzlich; denn einen Geist kann nichts verletzen, als was ihm die Freiheit raubt, und er beweist ja die seinige, indem er das Formlose bildet. Nur wo die Masse schwer und gestaltlos herrscht und zwischen unsichern Grenzen die trüben Umrisse wanken, hat die Furcht ihren Sitz; jedem Schrecknis der Natur ist der Mensch überlegen, sobald er ihm Form zu geben und es in sein Objekt zu verwandeln weiß.“195 In dem Maße also, wie die ,brausende Flut‘ des Klanges durch die Form gleichsam eingedämmt und damit ,Gestalt‘ wird, gerinnt sie nach Schillers Überzeugung zu einem ebenso festen wie konturierten ,Objekt‘, das den Werken der bildenden Kunst an die Seite zu stellen ist.196 Denn während Herder in seinen Schriften dafür streitet, die Rezeptionsweisen von Auge und Ohr nicht einer generalisierenden Ästhetik zu unterwerfen, der sich alle Hervorbringun193 194 195 196 Friedrich Schiller: Don Carlos, Infant von Spanien. Ein dramatisches Gedicht (1787), in: Sämtliche Werke, Bd. 2: Dramen II, S. 7–219, hier S. 65. Peter Utz: Das Auge und das Ohr im Text, S. 25. Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, S. 651, 652. Vgl. Wilhelm Seidel: Zwischen Immanuel Kant und der musikalischen Klassik, S. 75. 55 gen von Musik, Poesie, Malerei und Bildhauerei ohne Ausnahme zu fügen hätten, postuliert Schiller ganz im Gegenteil, daß die „verschiedenen Künste in ihrer Wirkung auf das Gemüt einander immer ähnlicher werden“ sollten.197 Als Zielpunkt steht ihm dabei die ideale Balance von Denken und Empfinden vor Augen, eine „mittlere Stimmung [...], in welcher Sinnlichkeit und Vernunft zugleich tätig sind, eben deswegen aber ihre bestimmende Gewalt gegenseitig aufheben und durch eine Entgegensetzung eine Negation bewirken“.198 Ein Überhang an Sinnlichkeit sei aber unvermeidlich, wenn – wie ganz besonders bei der Musik, aber auch bei einem Drama mit aufwühlendem Sujet – „der Stoff [...] mit seiner Wirkung sich vordrängt, oder [...] der Betrachter geneigt ist, sich unmittelbar mit dem Stoff einzulassen“, und dies wiederum bedeute, daß in einem „wahrhaft schönen Kunstwerk [...] der Inhalt nichts, die Form aber alles tun“ müsse, denn „nur von der Form ist wahre ästhetische Freiheit zu erwarten. Darin also besteht das eigentliche Kunstgeheimnis des Meisters, daß er den Stoff durch die Form vertilgt.“199 Das Unbehagen an der Musik konnte durch solche Überlegungen freilich nicht ganz beseitigt werden. Die ,Vertilgung‘ des Klanges durch die Form blieb ein prekäres Unterfangen, da Schiller sehr wohl erkannte, daß die „Macht der Musik“ – aller Formgebung zum Trotz – „auf ihrem körperlichen materiellen Teil“ beruht,200 also auf dem affektiven Eigenwert der Töne, weshalb „auch die geistreichste Musik durch ihre Materie noch immer in einer größern Affinität zu den Sinnen steht, als die wahre ästhetische Freiheit duldet“.201 Bereits Immanuel Kant hatte argumentiert, daß die Musik zwar gemäß einer „mathematischen Form“ proportioniert sei, diese ,mathematische Form‘ aber an ihrer emotionalen Kraft, welche allein den Tönen und Klängen zugeschrieben werden müsse, „nicht den mindesten Anteil“ habe.202 Da nun – so Kant – „in aller schönen Kunst [...] das Wesentliche in der Form“ besteht, nicht aber „in der Materie der Empfindung [...], wo es bloß auf Genuß angelegt ist, [...] hat Musik unter den schönen Künsten sofern den untersten [...] Platz, weil sie bloß mit Empfindungen spielt“.203 Zugleich macht Kant die wirkungsästhetische Prävalenz des Stoffes dafür verantwortlich, daß die Musik – im Unterschied zur bildenden Kunst – nur transitorische Eindrücke vermittelt; „diese aber erlöschen entweder gänzlich, oder, wenn sie unwillkürlich von der Einbildungs- 197 198 199 200 201 202 203 56 Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, S. 639. Ebd., S. 633. Ebd., S. 639 f., 639. Friedrich Schiller: Zu Gottfried Körners Aufsatz über Charakterdarstellung in der Musik, S. 1046. Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, S. 639. Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft (1790), in: Werke in zehn Bänden. Sonderausgabe, hrsg. von Wilhelm Weischedel, Darmstadt 1983, Bd. 8: Kritik der Urteilskraft und Schriften zur Naturphilosophie, S. 233–620, hier S. 432 f. Ebd., S. 428, 433. kraft wiederholt werden, sind sie uns eher lästig als angenehm“.204 Alles, was auf den Geltungsbereich der Zeit, auf eine bloße Folge von Zuständen beschränkt ist, gibt nach Kants Darlegung „keine Gestalt“205 und dementsprechend keine „Form, welche für die Beobachtung [...] zweckmäßig ist“206 – eine Apologie des Auges als maßgeblichem Organ ästhetischer Rezeption, die Schillers Skepsis gegenüber der Musik nachhaltig prägen wird. Während für Kant und Schiller der Klang erst dadurch, daß er ,Gestalt‘ wird, überhaupt ästhetische Relevanz erlangt, verzeichnet Herder es als positiven Umstand, daß beim Hören von Musik Bilder und Formen „verschweben [...]: denn das Unnennbare, Herzerfassende der Stimme hat keine Gestalt“.207 Schärfer könnte der Einspruch gegen Schillers Diktum nicht formuliert werden. Auch die Verabsolutierung der Form bei Immanuel Kant erscheint Herder suspekt, und erst recht dessen Vorbehalt gegen das transitorische Wesen der Musik. Kants Formel der „Zweckmäßigkeit [...] ohne Zweck“ ist für Herder bloß ein „leeres Gedankenspiel“, dem zu folgen nichts als „leere Werke“ hervorbringen würde.208 Voller Ironie läßt er in Kalligone die fiktiven Kant-Anhänger ausrufen: „Diese Leerheit heißt uns reine Form“,209 denn nach seiner Auffassung kommt es einer ästhetischen Bankrotterklärung gleich, die Form als ,reine‘, gewissermaßen abstrakte Größe zu begreifen. Dasjenige, was Form heißt, müsse bei jeder Kunst neu definiert werden, und zwar aus den „andern Bedingungen ihrer Exsistenz“ heraus: „Materie, wirkende Ursache, Zweck“.210 Christian Gottfried Körner hat in seinem 1795 publizierten Aufsatz Über Charakterdarstellung in der Musik bekanntlich den Versuch unternommen, auf der Basis von Schillers Ästhetik eine Musiktheorie zu entwickeln, die um den Gegensatz zwischen ,Ethos‘ und ,Pathos‘ kreist und deren Beweisführung darauf abzielt, das klingende Ereignis vom Ruch des Transitorischen zu befreien und es in den Rang eines ,schönen‘ Kunstwerks zu erheben. Körner kommt dabei zu dem Resultat, daß die Affektgebärden der Melodie eine Folge von situativen Empfindungen ausdrücken, dieses wechselnde Pathos jedoch stets bezogen sei auf ein Moment des Beharrlichen, nämlich den konstanten Rhythmus. „Das Regelmäßige in der Abwechslung von Tonlängen – Rhythmus – bezeichnet die Selbstständigkeit [sic!] der Bewegung. Was wir in dieser Regel wahrnehmen, ist das 204 205 206 207 208 209 210 Ebd., S. 433. Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft (1781), in: Werke in zehn Bänden. Sonderausgabe, Bde. 3 und 4, hier Bd. 3, S. 81. Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, S. 428. Johann Gottfried Herder: Kalligone, in: Sämmtliche Werke, Bd. 22, S. 271. Ebd., S. 101, 102. Ebd., S. 102. Ebd. 57 Beharrliche in dem lebenden Wesen, das bei allen äußern Veränderungen seine Unabhängigkeit behauptet.“211 Carl Dahlhaus hat darauf hingewiesen, daß die simple Konfrontation von Rhythmus und Melodie als „Darstellung eines Ethos und Ausdruck eines Pathos“ nur durch Schillers Begriff der „Gestalt“ zu erklären sei.212 Der Rhythmus als konstitutives Prinzip musikalischer Form wird von Körner offenbar mit der Idee des Plastischen assoziiert, da er die flüchtigen Tonbewegungen in das „Maß des [...] Taktes und die daraus entstehenden größeren Formationen“ einbindet.213 Eine solche Deutung des eher skizzenhaft anmutenden Textes gewinnt an Plausibilität, wenn man bedenkt, daß wenige Jahre später auch Friedrich Schelling den Rhythmus und die von ihm geordnete Melodie als das „Plastische“ der Musik gegen die „bloß natürlichen Rührungen“ ausspielen wird, „die etwa in Tönen an und für sich liegen“, und zwar im Sinne einer zusammenfassenden Gliederung auf allen formalen Ebenen vom einzelnen Takt über Taktgruppen und Perioden „bis zu dem Punkt, wo diese ganze Ordnung und Zusammensetzung für den inneren Sinn noch übersehbar bleibt“.214 Daß Schelling hier explizit die ,Übersehbarkeit‘ eines nur akustisch wahrnehmbaren Geschehens einfordert, verweist zurück auf Körners Zielvorgabe, mit seiner Musikästhetik den „allgemeinen Bedingungen der Anschauung“ Genüge zu tun, wodurch unausgesprochen die bildende Kunst in den Rang des eigentlichen Paradigmas erhoben wird. Denn „Anschauung“ setzt voraus, so Körner, daß das Subjekt sich bewußt „von allen äußern Objekten“ seiner Wahrnehmung abgrenzt, sie gleichsam in sichere Distanz rückt, um nicht dem „Totaleindruck“ des sinnlichen „Stoffs“ zu erliegen, sondern sich die Umrisse beschränkter Formgestalten klar vor Augen führen zu können. „Im Zustande der Nichtanschauung verhalte ich mich leidend gegen die ganze auf mich einwirkende Masse des vorstellbaren Stoffs [...]. Ich verbinde einen Teil dieses Stoffs und hebe ihn aus der übrigen Masse heraus – Anschauung. Dieses Herausheben – das wesentliche Erfordernis der Anschauung, geschieht durch Wahrnehmung der Schran- 211 212 213 214 58 Christian Gottfried Körner: Über Charakterdarstellung in der Musik, in: Die Horen 1 (1795). Zitiert nach dem Wiederabdruck in: Wolfgang Seifert: Christian Gottfried Körner. Ein Musikästhetiker der deutschen Klassik, Regensburg 1960 (Forschungsbeiträge zur Musikwissenschaft 9), S. 147–158, hier S. 157. Carl Dahlhaus: Ethos und Pathos in Glucks „Iphigenie auf Tauris“, in: Die Musikforschung 27 (1974), S. 289–300, hier S. 293 (Wiederabdruck in: Carl Dahlhaus: Klassische und romantische Musikästhetik, S. 55–65, hier S. 59); vgl. auch Wilhelm Seidel: Werk und Werkbegriff in der Musikgeschichte, Darmstadt 1987 (Erträge der Forschung 246), S. 17: „Körner glaubt wie alle seine ästhetisierenden Zeitgenossen, daß sich die Akzente der Leidenschaft in zeitlosen melodischen Gebärden ausdrücken [...]. Als das wichtigste Mittel ihrer ethischen Erfassung sah er den Rhythmus an, vielleicht darf man verallgemeinern: den Takt, die Periode und letztlich die Form.“ Wilhelm Seidel: Werk und Werkbegriff in der Musikgeschichte, S. 17. Friedrich Wilhelm Joseph [von] Schelling: Philosophie der Kunst (1802–1803). Nachdruck der aus dem handschriftlichen Nachlaß herausgegebenen Ausgabe von 1859, Darmstadt 1966, S. 140, 136, 138. ken, wodurch das angeschaute Objekt sich von dem übrigen vorstellbaren Stoffe absondert.“215 Obwohl der Terminus ,Anschauung‘ vorgibt, „als Summe empirischer Erfahrung [...] die anderen Sinne“ einzuschließen, so „bezeugt er [...] erst recht die Dominanz des Auges“,216 denn auf ihm liegt – wie Hans-Georg Gadamer mit Bezug auf Kant formuliert – die „Erblast des Platonismus“217 und insofern das unangefochtene Gesetz, daß die Erkenntnis der Ideenwelt immer an optische Wahrnehmungsformen und deren Affektlosigkeit gekoppelt bleibt:218 „Was wir durch das Auge sehen, ist von dem verschieden, was wir empfinden; denn der Verstand springt über das Licht hinaus zu den Gegenständen.“219 Daß die in einer Pyramidenform auf das Auge zulaufende Sinneshierarchie gerade durch den philosophischen Gebrauch des Wortes ,Anschauung‘ zementiert wird, belegt nichts deutlicher als folgende Passage aus Kants Anthropologie von 1798: „Der Sinn des Gesichts ist, wenn gleich nicht unentbehrlicher als der des Gehörs, doch der edelste; weil er sich unter allen am meisten von dem der Betastung, als der eingeschränktesten Bedingung der Wahrnehmungen, entfernt, und nicht allein die größte Sphäre derselben im Raume enthält, sondern auch sein Organ am wenigsten affiziert fühlt (weil es sonst nicht bloßes Sehen sein würde), hiemit also einer reinen Anschauung (der unmittelbaren Vorstellung des gegebenen Objekts ohne beigemischte merkliche Empfindung) näher kommt.“220 Um so erstaunlicher mutet es an, daß Körners Gedanke bei Christian Friedrich Michaelis zum Angelpunkt einer klassizistischen Formtheorie avanciert, die letztlich ebenfalls auf Schillers Begriff der ,Gestalt‘ bezogen ist oder zumindest dort ihren Ausgang nimmt.221 „Aesthetisch im engern Sinn heißen die Künste als schöne Künste, welche ein uninteressirtes Wohlgefallen an der Darstellung vermittelst der Anschauung bewirken“, so definiert Michaelis gleich am Beginn seiner Schrift Ueber den Geist der Tonkunst von 1795,222 und hieraus leitet sich für ihn die Folgerung ab, daß Schönheit in der Musik vor allem auf solchen melodischen Bildun215 216 217 218 219 220 221 222 Brief Christian Gottfried Körners an Friedrich Schiller vom 15. Februar 1793, in: Briefwechsel zwischen Schiller und Körner, S. 165. Peter Utz: Das Auge und das Ohr im Text, S. 8. Hans-Georg Gadamer: Anschauung und Anschaulichkeit, in: Anschauung als ästhetische Kategorie, S. 1–13, hier S. 3. Siehe oben, S. 3 f. Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, S. 657. Immanuel Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798), in: Werke in zehn Bänden. Sonderausgabe, Bd. 10: Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik. Zweiter Teil, S. 395–690, hier S. 449. Vgl. Lothar Schmidt: Organische Form in der Musik. Stationen eines Begriffs 1795–1850, Kassel u. a. 1990 (Marburger Beiträge zur Musikwissenschaft 6), S. 15–83, sowie ders.: Arabeske. Zu einigen Voraussetzungen und Konsequenzen von Eduard Hanslicks musikalischem Formbegriff, in: Archiv für Musikwissenschaft 46 (1989), S. 91–120. Christian Friedrich Michaelis: Ueber den Geist der Tonkunst, S. 6. 59 gen und syntaktisch-formalen Konstellationen gründet, die sich dem Hörer als ein Ganzes, als fest umrissenes, klar eingegrenztes und somit ,überschaubares‘ Gebilde präsentieren. Obwohl „Vergleichungen der verschiedenen Künste [...] immer mangelhaft“ seien, zumal unter dem Gesichtspunkt, daß Musik sich in der Zeit entfalte, die Plastik dagegen den Wirkungsbereich des Raumes beanspruche,223 sieht Michaelis hinsichtlich der Wahrnehmungsform keine grundlegende Differenz: „Die Gehörsempfindungen, die Töne, geben uns in ihrer musikalischen Verbindung eben sowohl etwas Objektives für die ästhetische Reflexion, als die Gesichtsvorstellungen, die Gestalten in der bildenden Kunst; nur mit dem Unterschiede, dass hier im Raume, dort in der blossen Zeit angeschaut wird. Wir betrachten die musikalische Komposition als ein Kunstwerk für den innern Sinn, das zwar unsichtbar, aber doch objektiv ist, indem wir es von uns selbst und unserm zufälligen Gedankenspiel unterscheiden, mit Aufmerksamkeit seine Organisation verfolgen, und mittelst der Einbildungskraft sein Ganzes aus seinen Gliedern zusammenfassen. Das Medium, wodurch wir die Musik empfangen, macht in Rücksicht ihres ästhetischen Werths keinen Unterschied.“224 Es liegt freilich auf der Hand, daß Michaelis dabei eine musikalische Komposition voraussetzt, die dem „Zusammenfassungs-Vermögen“ des Hörers durch plastische Fügung ihrer Themengestalten entgegenkommt: „Durch successive Verbindung der Töne der Composition erlangt die Seele die ästhetische Vorstellung des Ganzen in ihrer Klarheit. Sie vermag auch diese ästhetische Anschauung zu reproduciren. Die Composition muß aber, um als schön zu gefallen, so angelegt seyn, daß wir ihre Theile leicht und schnell mit einander verbinden, durch Reproduktion auf Einmal als Ganzes zusammenfassen können. [...] Die Harmonie macht die Musik reich und kraftvoll; die Melodie aber für ihren beabsichtigten Ausdruck faßlich. Die letztere bildet gleichsam die Umrisse des Ganzen, giebt der Musik Rundung, eine umgränzende geschlossene Sphäre, und entspricht der Zeichnung, den Formen und Gruppirungen in der Mahlerei.“225 Michaelis argumentiert an dieser Stelle primär wahrnehmungspsychologisch, indem er dem Hörer die Fähigkeit zuspricht, sich eine Sukzession von Tönen als ,Gestalt‘ buchstäblich vor Augen führen und dadurch objektivieren zu können, was allerdings die Melodik auf syntaktisches Ebenmaß und klare Periodenbildung festlegt, denn daran, daß das „schöne Objekt [...] 223 224 225 60 Christian Friedrich Michaelis: Vermischte Bemerkungen über Musik (1805), in: ders.: Ueber den Geist der Tonkunst und andere Schriften, S. 204–211, hier S. 208 (Fußnote). Christian Friedrich Michaelis: Ein Versuch, das innere Wesen der Tonkunst zu entwickeln (1806), in: ders.: Ueber den Geist der Tonkunst und andere Schriften, S. 249–259, hier S. 253. Christian Friedrich Michaelis: Vermischte Bemerkungen über Musik, S. 206, 207, 208. wohl proportionirt seyn“ müsse und der „Auffassung und Zusammenfassung des Mannichfaltigen in Ein Ganzes“ keine Schwierigkeiten bereiten dürfe, steht für ihn außer Zweifel.226 Insofern Michaelis die ,Anschaulichkeit‘ eines Musikstücks von der ,Rundung‘ des melodischen Verlaufs abhängig macht, von jener ,wohl proportionierten‘ Zusammenfügung einzelner Phrasen und Melodieglieder, die Richard Wagner später als „Quadratur“ bezeichnen sollte,227 rekurriert er auf eine Grundüberlegung zu Fragen musikalischer Form, die sich bis zu René Descartes zurückverfolgen läßt und an deren Beginn nicht zufällig die Analogie zwischen optischer und akustischer Wahrnehmung steht.228 In seinem 1618 geschriebenen, aber erst 1650 posthum veröffentlichten Musicae Compendium geht Descartes von der Beobachtung aus, daß die arithmetische Teilung einer Linie in gleich lange Abschnitte das Auge dazu befähigt, die Verhältnisse sofort zu überblicken und somit das graphische Gebilde mühelos als ein Ganzes aufzufassen. Hieraus zieht er den Schluß: „Ein Gegenstand wird vom Sinn leichter erfaßt, je geringer die Verschiedenheit der Teile ist.“ („Illud objectum facilius sensu percipitur, in quo minor est differentia partium.“)229 Da dieser Grundsatz auch für das Ohr gelte, sei die Kommensurabilität einer „cantilena“ am ehesten gewährleistet, wenn sich ihre Glieder („membra“) als wiederkehrende Einheiten von gleicher Länge stets zu Formationen verbinden, die im Verhältnis 1:2 fortschreiten, also gemäß der Zahlenreihe 2, 4, 8, 16, 32, 64 usw.230 Nachdem wir beim Hören das erste, symmetrisch gebaute Gliederpaar aufgrund seiner einfachen Relationen als Ganzes wahrgenommen haben, sei unser Rezeptionsvermögen in der Lage, die korrespondierenden Glieder drei und vier dergestalt mit den beiden vorhergehenden zu verknüpfen, „daß wir alle vier Glieder so gut als eines auffassen“ („ut instar unius illa quatuor concipiamus simul“).231 „Und so geht unsere Einbildungskraft fort bis zum Schluß, wo schließlich die ganze Melodie als eine aus mehreren Gliedern zusammengesetzte Einheit aufgenommen wird.“ („Et sic ad finem usque nostra imaginatio procedit, ubi tandem omnem cantilenam, ut unum quid ex multis aequalibus membris conflatum, concipit.“)232 Daß Descartes explizit von ,imaginatio‘ spricht und somit – laut Adolf Nowak233 – die Idee der 226 227 228 229 230 231 232 233 Christian Friedrich Michaelis: Ueber das Schöne in objektiver Hinsicht (1803), in: ders.: Ueber den Geist der Tonkunst und andere Schriften, S. 183–187, hier S. 185, 184. Richard Wagner: Über die Bestimmung der Oper (1871), in: Sämtliche Schriften und Dichtungen. VolksAusgabe, Leipzig [1911–1914], Bd. 9, S. 149. Daß sich bei Descartes jenes „aktiv-synthetische Hören“ ankündigt, das „mit der Klassik [...] seinen Gipfel erreicht“, hat erstmals Heinrich Besseler dargestellt, ohne allerdings die Möglichkeit einer quasi optischen Determinierung in Betracht zu ziehen (Das musikalische Hören der Neuzeit, S. 29–31, 38–40 und 48, hier S. 60). Renatus [René] Descartes: Musicae Compendium/Leitfaden der Musik (1618), hrsg., ins Deutsche übertragen und mit Anmerkungen versehen von Johannes Brockt, Darmstadt 1978 (Texte zur Forschung 28), S. 4/5. Ebd., S. 6/7. Ebd. Ebd. Adolf Nowak: Anschauung als musikalische Kategorie, S. 107. 61 „Bildanschauung“ auf die Musik überträgt, macht ihn gleichsam zum Ahnherrn einer vom Auge her gedachten musikalischen Formkonzeption, die sich in Schillers Begriff der ,Gestalt‘ konkretisiert und bei Michaelis zum ästhetischen System ausgefaltet wird, um dann die Theorie der Syntax in allen wichtigen Kompositionslehren des 19. Jahrhunderts nachhaltig zu prägen. Wenn Johann Christian Lobe und Adolf Bernhard Marx die Periode als symmetrische Fügung von 4 + 4 Takten definieren,234 so stehen alle Lizenzen zur Ausweitung und Modifikation dieses Grundmodells – wie schon bei Sulzer235 – bezeichnenderweise unter dem Vorbehalt, daß das „Ebenmaass zwischen Vorder- und Nachsatz durch (ungefähr) gleiche Länge und (ziemlich) gleiche Abschnitte“ in jedem Fall zu wahren sei.236 Die Faßlichkeit, im wörtlichen Sinne verstanden als ,Anschaulichkeit‘, bleibt oberstes Prinzip selbst dort, wo sich „für leidenschaftlichen Ausdruck [...] ein unregelmässiger Rhythmus“, also eine Addition von Phrasen mit unterschiedlicher Ausdehnung als sinnvoll erweisen könne, denn: „Für Auffassung und Darstellung eines Tonstücks ist es höchst förderlich, seine ganze Einrichtung und Ordnung klar zu überschaun.“237 Bei Lobe heißt es dementsprechend, daß die Großform etwa eines Sonatensatzes nicht anders entstehe als durch „zusammengesetzte Perioden oder Periodengruppen“,238 wobei das Bild des ‚Zusammensetzens‘ unwillkürlich die Vorstellung eines in der Zeit ausgebreiteten Nebeneinanders von Bauelementen evoziert. Noch deutlicher wird 1853 Moritz Hauptmann, wenn er feststellt, daß die „Fasslichkeit metrischer Verhältnisse“ an die „Grenzen einer übersichtlichen [...] Einheit“ gebunden sei, weshalb die „Musik [...] in ihrem rhythmisch bewegten Fortgange des metrisch geregelten Haltes gar nicht entbehren“ könne.239 Nicht mehr das Vorbild sprachlicher Interpunktion konstituiert die musikalische Periode, wie Heinrich Christoph Koch 1802 in seinem Musikalischen Lexikon ausgeführt hatte,240 sondern die Vorstellung einer „architectonische[n] Formation“ oder „flüssige[n] Architectur“, und zwar unter der Prämisse, daß Zeitliches und Räumliches durch den 234 235 236 237 238 239 240 62 Vgl. Johann Christian Lobe: Compositions-Lehre oder umfassende Theorie von der thematischen Arbeit und den modernen Instrumentalformen, Weimar 1844. Nachdruck Hildesheim u. a. 1988, S. 4. Siehe oben, S. 19. Adolf Bernhard Marx: Allgemeine Musiklehre. Ein Hülfsbuch für Lehrer und Lernende in jedem Zweige musikalischer Unterweisung (1839), Leipzig 91875, S. 207. Ebd., S. 211, 208. Johann Christian Lobe: Katechismus der Musik (1851), Leipzig 91866, S. 93. Moritz Hauptmann: Die Natur der Harmonik und der Metrik. Zur Theorie der Musik, Leipzig 1853, S. 309, 310, 312. Vgl. Heinrich Christoph Koch: Musikalisches Lexikon, Frankfurt [am Main] 1802. Nachdruck Hildesheim 1964, Sp. 1149 f., sowie Carl Dahlhaus: Die Musiktheorie im 18. und 19. Jahrhundert. Zweiter Teil: Deutschland, hrsg. von Ruth E. Müller, Darmstadt 1989 (Geschichte der Musiktheorie 11), S. 189 f. Dahlhaus stellt dem ,interpunktischen‘ Periodenbegriff Kochs einen ,metrischen‘ gegenüber, doch könnte man im Hinblick auf Hauptmanns Theorie ebensogut von einem ,architektonischen‘ sprechen. gemeinsamen „Begriff der Symmetrie“ verbunden seien.241 Das „Ungehörige [...] in metrischen Satzverhältnissen“ lasse sich zwar aufgrund des ständigen Fortganges der Musik leichter verbergen als das „Schiefe, das Unsymmetrische und Verhältnisswidrige in sichtbaren Gegenständen“, würde jedoch ebenso stören, wenn der „Ueberblick eines grösseren Zeitganzen in seiner Gliederung nicht an sich schon eine schwerere Aufgabe wäre als die, ein räumlich Gegliedertes in seinen Verhältnissen zu überschauen“.242 Nicht prinzipiell unterscheidet sich also für Hauptmann die Wahrnehmung einer tönenden Architektur von der eines sichtbaren Gebäudes, sondern nur durch den Grad an Schwierigkeit, die Proportionen und Verhältnisse buchstäblich in den Blick zu nehmen, was wiederum für die Musik bedeutet, erst recht alles „Unübersehbare, Unfassliche“ zu vermeiden, da sie sich an das Ohr wie an ein gleichsam defizientes Auge richtet.243 „Es ist aber in der Musik eine solche Architectonik, die hauptsächlich in der regelmässig metrischen und modulatorischen Beschaffenheit des Tonstückes besteht, ein so wesentliches Erforderniss, dass eine musikalische Composition uns als Kunst überhaupt ohne sie gar nicht ansprechen kann. Für die erste Wirkung scheinen diese Bedingungen weniger von bestimmendem Einflusse zu sein, indem wir auch gestaltlose, phrasenhafte Productionen, ohne verständigen Periodenbau, ohne organische Einheit des Mannigfaltigen, nicht selten einen glänzenden Success erringen sehen. In einer dauernden Gunst haben aber immer nur solche Werke sich erhalten können, die, abgesehen von characteristischen Eigenthümlichkeiten, von melodischem und harmonischem Reize, eine rhythmisch-metrische und modulatorische Ordnung bewahren; d. h. solche, die ihre Schönheiten in der Schönheit des Ganzen, in der Wahrheit und vernünftigen Gesetzmässigkeit der an sich künstlerisch gültigen Form tragen.“244 Auch wenn Herder in bezug auf die Musik keine genauere Definition von Rhythmus, Syntax und Form liefert, sind die Unterschiede zu den Theorien eines Körner, Michaelis oder Hauptmann signifikant genug, um – gewissermaßen ex negativo – einige Rückschlüsse zuzulassen. Der Rhythmus ist bei Herder weder mit dem Gedanken verknüpft, daß Musik ,Gestalt‘ werden müsse, um sich als Kunstwerk ausweisen zu können, noch steht er im Dienste der Formbildung bzw. regelmäßigen Periodisierung des melodischen Flusses. Im Gegenteil: Da die Musik eine ,energische‘ Progression in Tönen darstellt und als solche dem Verlauf menschlicher Empfindungen unmittelbar entspricht, widerstrebt es ihr, feste Konturen anzunehmen oder sich gar zum Werk zu verhärten. Das Auge sucht – etwa in der Baukunst – nach wohlgefälligen Proportionen, nicht aber das Gehör, weshalb das ,alte Hauptgesetz der Musik, alles rund zu machen‘, letztlich einer falschen ästhetischen Prämisse geschuldet ist. Ganz bei 241 242 243 244 Moritz Hauptmann: Die Natur der Harmonik und der Metrik, S. 333, 313 f. Ebd., S. 200. Ebd., S. 309. Ebd., S. 200 f. 63 sich kann die Musik nur dann sein, wenn sie dem ,Schwung der Empfindung‘ rückhaltlos folgt, ohne die ,Einschnitte‘ ihrer Melodie – im Sinne Sulzers – symmetrisch abzuzirkeln, denn dies würde bedeuten, das Maß des Auges dort anzulegen, wo allein dem Ohr die Herrschaft gebührt. Insofern erweist sich die von Herder verwendete Metapher des Stromes als Plädoyer dafür, daß die Musik nicht in das Prokrustesbett eines syntaktischen Ebenmaßes gezwängt werden sollte, da sie dem Werden und Vergehen der Gefühle unmittelbaren Ausdruck verleiht. Mehr noch: Während Schiller mit seinem Begriff der ‚Gestalt‘ gerade darauf abzielt, in der Folge bloßer ,Impressionen‘ und Gefühlsmomente die Konturen einer unwandelbaren ,Persönlichkeit‘ zu sichern, was für die Musik bedeutet, das Transitorische bewegter Klänge durch formale Plastizität auszubalancieren, sieht Herder es als wesentlich an, daß die „Seele, [...] ergriffen vom Strom des Gesangs sich selbst vergißt, sich selbst verlieret“.245 Anders als Schiller ortet er das Wesen nicht nur der Musik, sondern des Lebens selbst in der Haltlosigkeit permanenter Veränderung, die keinen Stillstand kennt, sondern nur ein unausgesetztes Forttreiben im Fluß der Zeit. Dort, wo melodische Verläufe sich frei entfalten und nicht zu abgemessenen Formkomplexen gerinnen, wo lebendige Mannigfaltigkeit statt abstrakte Einheit herrscht, liefert die Musik ein akustisches Analogon zum menschlichen Dasein, da „alles in der Welt [...] an den Flügel der Zeit gebunden, und Bewegung, Abwechselung, Wirkung [...] die Seele der Natur“ ist.246 Dem Strom als „Sinnbild des rhythmisch pulsierenden Lebens“ wächst damit bei Herder eine ontologische Qualität zu, die weit über Fragen musikalischer Form und Syntax hinausreicht:247 „Fließe, des Lebens Strom! Du gehst in Wellen vorüber, Wo mit wechselnder Höh’ Eine die andre begräbt. Mühe folget der Mühe; doch, kenn’ ich süßere Freuden, Als besiegte Gefahr, oder vollendete Müh? Leben ist Lebens Lohn; Gefühl sein ewiger Kampfpreis. Fließe, wogiger Strom! nirgend ein stehender Sumpf.“248 Daß für Herder „das ,transmusikalische Urphänomen‘ der Bewegung [...] die hervorragende Stellung der Musik als Bewegungskunst im Kanon der Künste begründet“, hat Rafael Köhler ausführlich erörtert,249 nicht aber, daß damit wiederum eine antinomische Konfrontation von Auge und Ohr verbunden ist. Denn im Ersten Kritischen Wäldchen, einer Auseinandersetzung 245 246 247 248 249 64 Johann Gottfried Herder: Ob Malerei oder Tonkunst eine größere Wirkung gewähre? Ein Göttergespräch, in: Sämmtliche Werke, Bd. 15, S. 233. Johann Gottfried Herder: Erstes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 3, S. 75. Werner Kopp: Musik und Bewegung in der Gedankenwelt Johann Gottfried Herders, in: Deutsche Tonkünstler-Zeitung 33 (1937), S. 259–261, hier S. 259. Johann Gottfried Herder: Der Strom des Lebens (1796), in: Sämmtliche Werke, Bd. 29, S. 156. Vgl. Rafael Köhler: Natur und Geist, bes. S. 51–53, hier S. 52. mit Lessings Laokoon, betont Herder, daß es Gegenstände der Natur gebe, die dem Auge als bleibend und dauerhaft erscheinen, „so abwechselnd ihre Zeitfolgen und Zustände auch seyn mögen“, nämlich „alle Körper, und zwar so fern sie Körper sind [...]; so schnell auch jeder Augenblick ihres Seyns sie ändere: so geht er doch nicht unsern Augen vorüber; für diese kann also der [bildende] Künstler Erscheinungen liefern: er schildere Körper, er ahme nach die bleibende Natur“.250 Hier deutet sich bereits an, was Herder im Vierten Kritischen Wäldchen systematisch entwickeln sollte: Nach seiner Auffassung erzeugt das Auge den Eindruck von Dauerhaftigkeit und Statik selbst dort, wo eigentlich Veränderung stattfindet, und wenn ein Werk der bildenden Kunst das Gemüt zu affizieren vermag, dann nur dadurch, daß es der Einbildungskraft genug Spielraum läßt, um die erstarrte Bewegung der Skulptur oder des Gemäldes imaginativ fortzusetzen, sie gewissermaßen zu dynamisieren,251 ansonsten wäre die „bleibende [...] auch zugleich todte Natur“.252 Indem aber die bildende Kunst solchermaßen den „Begriff der Zeitfolge“ in uns erweckt, so tut sie dies „blos durch ein Blendwerk“, das „nie zu ihrer Hauptsache“ werden kann.253 Wesentlich bleibt, daß ihr „höchste[s] Gesetz“ – die „Schönheit“ – „auf dem Anblicke des Coexsistirenden [...] beruhet“, auf dem proportionalen Gefüge nebeneinander angeordneter Teile, in das sich der Betrachter mit Muße versenkt, wie umgekehrt der „Grund des Wohlklanges“ bei der Musik allein daran festzumachen ist, daß sie „ganz durch Zeitfolge wirkt“.254 Unter der Prämisse, daß Herder die Vorstellung von ,Leben‘ generell mit Bewegung und Sukzession assoziiert, eben mit der Metapher des Stromes, kann man aus diesen Überlegungen folgern, daß die bildende Kunst – als ,schöne‘ Kunst – nur den ,Schein‘ des Lebens hervorbringt, die Musik hingegen – als Kunst transitorischen ,Wohlklanges‘ – das Prinzip allen Daseins unmittelbar für das Ohr realisiert. Das Gesetz der Schönheit auf die Musik zu übertragen, hieße daher, sie dem ,Blendwerk‘ einer quasi optischen Wahrnehmung auszuliefern und aus dem ,Strom‘ eine ,Gestalt‘ zu machen, ein imaginäres Nebeneinander von Tönen und Phrasen nach Maßgabe ,anschaulicher‘ Proportionen, als würde man „Gegenstände des Raums Musikalisch [...] schildern“, was laut Herder nur „unerfahrne Stümper thun“.255 250 251 252 253 254 255 Johann Gottfried Herder: Erstes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 3, S. 75. Vgl. ebd., S. 81. Ebd., S. 75. Ebd., S. 136. Ebd., S. 81, 136. Ebd., S. 136. 65 Musikalische und poetische Syntax bei Herder: Das notwendige Augenmaß In den Briefen zu Beförderung der Humanität findet sich jedoch eine Passage, die fast als Widerruf dessen erscheint, was Herder an anderen Stellen über Musik ausführt, als habe der „aufklärerische Siegeszug des Auges“ am Ende tatsächlich selbst den „Wortführer des Ohrs“ unterworfen:256 „Erinnern Sie sich in Drydens Ode am Cäcilientage, wohin die Gewalt der Musik den Alexander reißt? Der Halbgott sinkt der Buhlerinn in den Arm, er schwingt die Fackel zu Persepolis Brande. Auf gleiche Weise kann durch eine geistliche und, wenn man will, eine himmlische Musik die Seele dergestalt aus sich gesetzt werden, daß sie sich, unbrauchbar und stumpf gemacht für dies irrdische [sic!] Leben, in gestaltlosen Worten und Tönen selbst verlieret. [...] Das Auge ist, wenn man will, der kälteste, der äußerlichste und oberflächlichste Sinn unter allen; er ist aber auch der schnellste, der umfaßendste, der helleste Sinn; er umschreibt, theilt, bezirkt und übt die Meßkunst für alle seine Brüder. Das Ohr dagegen ist ein zwar tiefdringender, mächtigerschütternder, aber auch ein sehr abergläubiger Sinn. In seinen Schwingungen ist etwas Unabzählbares, Unermäßliches, das die Seele in eine süße Verrückung setzt, in welcher sie kein Ende findet. Behüte uns also die Muse vor einer bloßen Poesie des Ohrs ohne Berichtigung der Gestalten und ihres Maasses durchs Auge.“257 Zwar können diese Sätze einfach als rationalistisches Plädoyer für die Vokalmusik bzw. für eine gleichberechtigte Verbindung von Text und Ton gelesen werden, warnt Herder doch ausdrücklich davor, daß „Gefühle [...] im Strom oder in der Fluth künstlicher Töne ohne Worte keinen Wegweiser und Leiter finden“.258 Indessen hat Herder in seinen späteren Schriften nie einen Zweifel an der ästhetischen Daseinsberechtigung reiner Instrumentalmusik aufkommen lassen. Im Gegenteil: Dort, wo die Musik den Menschen zur „Andacht“ erheben wolle, müsse sie sich zwingend „von allem Fremden, vom Anblick, Tanz, Gebehrden, selbst von der begleitenden Stimme“ – und damit auch vom Wort – absondern. „Die Andacht will nicht sehen, wer singt; vom Himmel kommen ihr die Töne; sie singt im Herzen; das Herz selbst singet und spielet.“259 Spricht dieser Panegyrikus auf die ,absolute Musik‘ bereits dagegen, den oben zitierten Brief zu Beförderung der Humanität allein als Plädoyer für Textgebundenheit zu deuten,260 so sollte es erst recht stutzig machen, daß Herder nicht nur von 256 257 258 259 260 66 Peter Utz: Das Auge und das Ohr im Text, S. 24. Johann Gottfried Herder: Briefe zu Beförderung der Humanität (83. Brief) (1796), in: Sämmtliche Werke, Bd. 18, S. 27. Ebd. Johann Gottfried Herder: Kalligone, in: Sämmtliche Schriften, Bd. 22, S. 186. Zur Verknüpfung des kunstreligiösen Begriffes ,Andacht‘ mit der Vorstellung einer ,absoluten Musik‘ bei Herder vgl. Carl Dahlhaus: Die Idee der absoluten Musik, S. 81–83, sowie Wilhelm Seidel: Absolute Musik und Kunstreligion um 1800, in: Musik und Religion, hrsg. von Helga de la Motte-Haber, Laaber 1995, S. 89– 114, hier S. 92–95. ,gestaltlosen Tönen‘, sondern auch von ,gestaltlosen Worten‘ handelt, also die notwendige Korrektur der ‚Poesie des Ohrs‘ durch das ‚Maß des Auges‘ zugleich für die Dichtkunst einfordert. Falsch wäre es daher, die betreffende Passage auf ein Postulat semantischer Klarheit und Eindeutigkeit zu reduzieren. Vielmehr liegt es nahe, das Gebot des ,Augenmaßes‘ als Kommentar zu zentralen Fragen von Syntax und Form aufzufassen: Während Herder ansonsten das Transitorische der Musik – als Voraussetzung ihrer unmittelbaren Gefühlsverständlichkeit – gegen die Kolonialisierung durch einen vom Gesichtssinn entlehnten Formbegriff verteidigt, geht er hier den genau umgekehrten Weg und plädiert dafür, den melodischen Strom durch die ,Meßkunst‘ des Auges zu begrenzen, ihn gleichsam ,überschaubar‘ zu machen, also dort faßliche Proportionen herzustellen, wo das Ohr sich im Unermeßlichen zu verlieren droht. Der Widerspruch gerade zu den ästhetischen Reflexionen des Vierten Kritischen Wäldchens ist freilich nicht so tiefgreifend, wie er zunächst scheinen mag, denn bereits dort hatte Herder den Plan zu einer allgemeinen „Theorie des Schönen“ skizziert, die von der Baukunst ihren Ausgang nehmen soll, und zwar deshalb, weil der Sinn des Menschen für „Simplicität“, „Wohlordnung“ und „Symmetrie“ sich bei Betrachtung eines Gebäudes am leichtesten ausbilden könne.261 Diese „Vernunftlehre des Schönen“ wird von Herder sozusagen als Grundstein aller Ästhetik begriffen,262 und es stellt sich die Frage, inwieweit damit auch die Musik – zumindest bis zu einem gewissen Grad – in den Einzugsbereich jener Normen und Axiome gerät, die paradigmatisch von der Baukunst abzulesen sind. Um die These zu illustrieren, Herders Forderung nach ,Augenmaß‘ verdanke sich einer an der Architektur geschulten Theorie von Syntax und Form, sei im folgenden der Frage nachgegangen, ob auch in seinen zahlreichen Bemerkungen zur lyrischen Poesie von den Gesetzmäßigkeiten der Baukunst als formalem Korrektiv dynamischer Empfindungsprozesse die Rede ist. Der Vorteil dieser Strategie resultiert aus dem Umstand, daß Herder sich einerseits zu Fragen der Lyrik wesentlich klarer, präziser und – in technischem Sinne – konkreter geäußert hat als zu jenen der Musik, es aber andererseits möglich ist, von den Erörterungen zur Dichtkunst auf die Musik zurückzuschließen. Denn beide zeichnet für Herder aus, daß sie durch eine im Zeitkontinuum entfaltete ,Energie‘ wirken, anstatt dauerhafte Werke hervorzubringen, was ihre Prinzipien und Funktionsweisen miteinander vergleichbar macht. Wie oben bereits erwähnt, gehört es zu den Axiomen von Herders Geschichtsanthropologie, daß Sprache und Musik am Beginn ihrer Entwicklung identisch waren. Der Mensch artikulierte seine Gefühle und Leidenschaften zunächst in einem elementaren „Sprachgesang“, aus 261 262 Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 154, 155. Ebd., S. 156. 67 dem dann jene „natürliche Poesie“ hervorging, die im Begriff der antiken mousikē festgehalten ist und von der Herder sagt: „Sobald ein Wesen sang, folgte es dem Strom der Empfindung. [...] Ungebundenheit scheint also die erste Bedingung der Gesangessprache zu seyn; und doch, was bindet vester als die Harmonie?“263 Kein festes Metrum oder Versmaß bestimmte also die ursprüngliche ,Schwunglinie‘ des ,Sprachgesangs‘, sondern – wie Herder überraschend feststellt – nur das Gesetz der Harmonie. Unter diesem Begriff ist freilich nicht die auf Terzschichtung beruhende Dreiklangsharmonik im Sinne Rameaus zu verstehen, sondern vielmehr dasjenige, was Herder an anderer Stelle als ewigen, von der Natur harmonisch geordneten „Tonkreis“ beschreibt, in dem „unzählige Melodieen, d. i. Schwingungen und Gänge der Leidenschaft [...] gegeben“ sind.264 Wenn aber metrische ,Ungebundenheit‘ innerhalb des vorgezeichneten ,Tonkreises‘ die erste Bedingung der ,Gesangessprache‘ war, so folgt hieraus, daß deren temporale Struktur keinem anderen Puls als eben dem ,Strom der Empfindung‘ zu gehorchen hatte, und man darf Herders Formulierung in dem kurzen Aufsatz Die Lyra ohne weiteres beim Wort nehmen: „Diese Folge von Empfindungen giebt der Seele das Maas der Zeit“.265 Im Laufe der Menschheitsgeschichte trennte sich die Sprache vom Gesang, wodurch sie zwar „verfeinert, civilisirt und humanisirt“ wurde, gewissermaßen von der Empfindung zur Vernunft überwechselte, dadurch jedoch an emotionaler Unmittelbarkeit und poetischer Kraft verlor.266 Gleichwohl betont Herder, daß die ursprünglichen „Naturtöne“ nicht völlig verschwunden seien,267 die Sprache also in jedem Stadium ihrer Entwicklung noch immer als „Laut der Empfindung“ verstanden werden könne, denn: „Wie einst Interjectionen zu Worten wurden; so formen sich die Worte nach dem Accent, dem Rhythmus, dem Intervall der Empfindung. Dieses Wort steigt; jenes sinket. Dies tritt in mehreren starken Sylben einher; jenes verändert die Töne.“268 263 264 265 266 267 268 68 Ebd., S. 115, 118; Adrastea (III. Band, 2. Stück), in: Sämmtliche Werke, Bd. 23, S. 560 f. (vgl. Christine Zimmermann: Unmittelbarkeit. Theorien über den Ursprung der Musik und der Sprache in der Ästhetik des 18. Jahrhunderts, Frankfurt am Main u. a. 1995 [Europäische Hochschulschriften. Reihe 1: Deutsche Sprache und Literatur 1521], S. 15–18). Johann Gottfried Herder: Kalligone, in: Sämmtliche Werke, Bd. 22, S. 70. Johann Gottfried Herder: Die Lyra. Von der Natur und Wirkung der lyrischen Dichtkunst (1795), in: Sämmtliche Werke, Bd. 27, S. 164. Johann Gottfried Herder: Abhandlung über den Ursprung der Sprache, in: Sämmtliche Werke, Bd. 5, S. 9. Ebd. Johann Gottfried Herder: Die Lyra. Von der Natur und Wirkung der lyrischen Dichtkunst, in: Sämmtliche Werke, Bd. 27, S. 167 f. Von der Poesie seiner eigenen Zeit fordert Herder daher, sie müsse das UrsprünglichMusikalische „in den tiefsten Fundgruben der Sprache“ aufsuchen, den „lebende[n] Wohllaut“, der stärker wirke „als alle todte Proportion der Buchstaben, und alle künstliche Struktur der Sylbenmaaße“. Verfehlt wäre es hingegen, wenn der Dichter die „Tonfarben“ der Worte in ein metrisches Korsett „einzwingen“ wollte: „Wohl den Schriftstellern unter uns, die da schreiben, als ob sie hören, die da dichten, als ob sie sängen.“269 Schon die Verwendung des Begriffes ,Wohllaut‘ läßt keinen Zweifel daran, daß Herder die Poesie als eine Kunst des Ohres auffaßt und sie damit – wie die Musik – von der Usurpation durch ein aus der bildenden Kunst gewonnenes, vom Auge abstrahiertes Schönheitsideal zu befreien sucht.270 Dem Ursprung der ,Gesangessprache‘ am nächsten sind für ihn die Volkslieder der verschiedenen Nationen, und es kommt nicht von ungefähr, daß er im Vorwort zum zweiten Teil seiner Volkslied-Sammlung ausdrücklich bemerkt: „Das Wesen des Liedes ist Gesang, nicht Gemälde: seine Vollkommenheit liegt im melodischen Gange der Leidenschaft oder Empfindung, den man mit dem alten treffenden Ausdruck: Weise nennen könnte. [...] Lied muß gehört werden, nicht gesehen; gehört mit dem Ohr der Seele, das nicht einzelne Sylben allein zählt und mißt und wäget, sondern auf Fortklang horcht und in ihm fortschwimmet.“271 Herders Aussage, das ,Ohr der Seele‘ müsse auf ,Fortklang‘ horchen und in ihm ,fortschwimmen‘, anstatt Silben zu zählen und zu messen, fügt sich präzise in das immer wieder neu variierte Bild des ,Stromes der Empfindung‘ ein. Nicht auf dem ,periodischen Wiegen‘ eines abgezirkelten Versmaßes beruht also die Wirkung der Dichtkunst, sondern einzig und allein auf der tönenden ,Schwunglinie‘, den Akzenten, Modulationen und Lautbewegungen einer musikalisch verfaßten Sprache.272 An den lyrischen Produkten seiner Zeitgenossen kritisiert Herder denn auch das Unmusikalische, Akademische und Künstlich-Mechanische: „Wir zirkeln uns kalte Plane nach Regeln ab, um künstlich trunken in ihnen zu kindern. Auf die Naturdichter folgten Kunstpoeten, und wißenschaftliche Reimer beschließen die Zahl.“273 Dieses Verdikt betrifft vor allem das „Mühlengeklapper“ eines „mechanischen Rhythmus“, bei dem Skansion und Deklamation 269 270 271 272 273 Johann Gottfried Herder: Ueber die neuere Deutsche Litteratur. Fragmente. Erste Sammlung. Zweite völlig umgearbeitete Ausgabe (1768), in: Sämmtliche Werke, Bd. 2, S. 39 f. Siehe oben, S. 34 f. Johann Gottfried Herder: Volkslieder. Nebst untermischten andern Stücken. Zweiter Theil (Vorrede) (1779), in: Sämmtliche Werke, Bd. 25, S. 332 f. Bruno Markwardt (Herders Kritische Wälder, bes. S. 258–268) erörtert anhand zahlreicher Beispiele, wie Herder auch in der Prosa seiner essayistischen Schriften gegen das „abgemeßne und schön regelmäßig verwickelte Wortgeschleppe“ jener kunstvollen Satzperioden opponiert, die ihm als Ausdruck einer leblosen Schriftsprache erscheinen (Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 140). Johann Gottfried Herder: Fragmente einer Abhandlung über die Ode (um 1764–1765), in: Sämmtliche Werke, Bd. 32, S. 73. 69 auseinanderfallen und das lebendige „Wort- und Empfindungsgemälde“ dem unbarmherzig pulsierenden Metrum zum Opfer gebracht wird.274 Denn: „Die Gemälde der Einbildungskraft können ein gefesseltes Sylbenmaaß nicht ertragen, ohne daß sie, oder das Sylbenmaaß leidet.“275 Ebenso macht Herder einen ausdrücklichen Unterschied zwischen „lyrischer“ und „schildernder“ Poesie: Während die lyrische Poesie „sich lediglich an den Faden und Gang der Empfindung“ hält und dadurch ein musikalisches Wesen offenbart, mangelt es der schildernden Poesie gerade umgekehrt am „Geist der Musik“, an „Bewegung“ und „Rhythmus der Leidenschaft“.276 Denn nur „Bewegung des menschlichen Herzens“ kann für Herder adäquater Gegenstand einer Kunst sein, die sich als ,energische‘ Progression in der Zeit entfaltet.277 Nimmt man die verschiedenen Äußerungen Herders zusammen, so scheint es, daß ihm jede Art von metrischer Gebundenheit zuwider ist, weil er darin ein unmusikalisches Moment zu erkennen glaubt, das den ,Strom der Empfindung‘ in seinem natürlichen Fluß hemmt und behindert. Tatsächlich aber ist Herder sich darüber im klaren, daß man ab einem gewissen Punkt der Sprachentwicklung zur „unskandirten Barbarei nicht mehr zurückkehren“ könne.278 Als Lösung erscheinen ihm die freien Rhythmen mancher Odendichtungen Friedrich Gottlieb Klopstocks, und zwar deshalb, weil dort Skansion und Deklamation übereinstimmen, sich in einer musikalischen Bewegung treffen.279 Mehr noch: Indem die Sprache „geradezu musikalisch aufgelöst“ wird und ihre Bedeutung – nach Klopstocks eigener Dichtungstheorie – mehr „von den parasprachlichen Mitteln des Klangs und des Rhythmus“ bezieht als von der zeichenhaften Abbildungsfunktion einzelner Wörter,280 kehrt sie für Herder ein Wirkungsmoment hervor, das die Intensität der ursprünglichen Empfindungslaute jenseits aller rationalisierten Verstandesbegriffe fühlbar werden läßt.281 Das in der Saitenmetaphorik gespiegelte „Naturgesetz einer empfindsamen Maschiene“ behauptet sich gegen die Abstraktion, gegen „Kunst und kalte Ueberzeugung“.282 Mit den Worten Karl-Heinz Götterts: „Töne [...] sind nicht mehr bloße Repräsentationen eines ,eigentlich‘ Gemeinten [...], sondern dieses 274 275 276 277 278 279 280 281 282 70 Johann Gottfried Herder: Zerstreute Blätter. Fünfte Sammlung (1793), in: Sämmtliche Werke, Bd. 16, S. 250. Johann Gottfried Herder: Ueber die neuere Deutsche Litteratur. Eine Beilage zu den Briefen, die neueste Litteratur betreffend. Erste Sammlung (1766), in: Sämmtliche Werke, Bd. 1, S. 209. Johann Gottfried Herder: Adrastea (III. Band, 2. Stück), in: Sämmtliche Werke, Bd. 23, S. 568 f. Ebd., S. 567. Johann Gottfried Herder: Zerstreute Blätter. Fünfte Sammlung, in: Sämmtliche Werke, Bd. 16, S. 251. Vgl. Dieter Lohmeier: Herder und Klopstock. Herders Auseinandersetzung mit der Persönlichkeit und dem Werk Klopstocks, Bad Homburg u. a. 1968 (Ars poetica. Texte und Studien zur Dichtungslehre und Dichtkunst. Studien 4), bes. S. 170–174, 180–187 und 193–197. Karl-Heinz Göttert: Geschichte der Stimme, München 1998, S. 381. Zur Verschränkung von Herders Odentheorie mit seiner Musikästhetik vgl. auch Laurenz Lütteken: Das Monologische als Denkform in der Musik zwischen 1760 und 1785, S. 319–321. Johann Gottfried Herder: Abhandlung über den Ursprung der Sprache, in: Sämmtliche Werke, Bd. 5, S. 17, 16. ,eigentlich‘ Gemeinte selbst löst sich auf, um nur noch als Ausdruck wirklich existent zu sein.“283 „Das Wort ist weg, und der Ton der Empfindung tönet. Dunkles Gefühl übermannet uns [...]. Kein Bedacht, keine Ueberlegung, das bloße Naturgesetz lag zum Grunde: ,Ton der Empfindung soll das sympathetische Geschöpf in denselben Ton versetzen!‘“284 Gegenüber Friedrich Nicolai äußert Herder, das Silbenmaß müsse bei Klopstock als „Eine Melodie, als Eine Succeßion von Bewegungen“ betrachtet werden.285 Keine „Mechanische Musik des Substantiven- u. Verbenklangs“ sei darin zu finden, sondern „wahre fortgehende Melodie der Worte zur Empfindung, zur Bewegung des Verses“.286 Entsprechend begrüßt Herder die erste, 1771 publizierte Sammlung der Oden Klopstocks mit Worten von kaum zu überbietender Emphase: „Ode! sie wird wieder, was sie war! Gefühl ganzer Situation des Lebens! Gespräch Menschlichen Herzens – mit Gott! mit sich! mit der ganzen Natur. Wohlklang! er wird, was er war. Kein aufgezähltes Harmonienkunststück! Bewegung! Melodie des Herzens! Tanz!“287 An dieser Apologie wird bereits deutlich, daß Klopstocks Oden für Herder zu den Anfängen der Dichtkunst zurückführen; die „neue glückliche Versart“ der freien Rhythmen erscheint ihm letztlich als Archaismus, nämlich als die „natürlichste und ursprünglichste Poesie“.288 Dahinter steht die Annahme, daß die Gattung der Ode überhaupt das „erstgeborne Kind der Empfindung“ gewesen sei, ein unmittelbarer Gefühlsausdruck in Tönen und klingenden Worten, bei dem sich das Silbenmaß variabel am Gang der Leidenschaften orientiert habe, anstatt ihm das Korsett einer metrischen Gleichförmigkeit aufzuzwingen und syntaktische Logik an die Stelle der einzig gültigen „Logik des Affekts“ zu setzen.289 Oden sind „Ströme der Empfindung“, die „auf mancherlei Art ihren Lauf nehmen“, so heißt es an anderer Stelle,290 und dies bedeutet, daß sie sich – wie Herder in einem Brief an Nicolai 283 284 285 286 287 288 289 290 Karl-Heinz Göttert: Geschichte der Stimme, S. 383. Johann Gottfried Herder: Abhandlung über den Ursprung der Sprache, in: Sämmtliche Werke, Bd. 5, S. 17. Brief Johann Gottfried Herders an Christoph Friedrich Nicolai vom 23. November 1772, in: Johann Gottfried Herder: Briefe, Bd. 2, S. 267. Brief Johann Gottfried Herders an Christoph Friedrich Nicolai vom 2. Juli 1772, in: Johann Gottfried Herder: Briefe, Bd. 2, S. 187. Johann Gottfried Herder: Von Deutscher Art und Kunst. Einige fliegende Blätter. Teil I: Auszug aus einem Briefwechsel über Oßian und die Lieder alter Völker (1773), in: Sämmtliche Werke, Bd. 5, S. 206. Johann Gottfried Herder: Ueber die neuere Deutsche Litteratur. Eine Beilage zu den Briefen, die neueste Litteratur betreffend. Erste Sammlung, in: Sämmtliche Werke, Bd. 1, S. 208. Johann Gottfried Herder: Fragmente einer Abhandlung über die Ode, in: Sämmtliche Werke, Bd. 32, S. 62, 73. Johann Gottfried Herder: Die Lyra. Von der Natur und Wirkung der lyrischen Dichtkunst, in: Sämmtliche Werke, Bd. 27, S. 170. 71 formuliert – nicht „nach Regeln der bloßen Convention“ gestalten und beurteilen lassen.291 Der niedergeschriebene und gedruckte Text stellt gleichsam nur das Substrat einer tönenden, an den Moment ihrer psychischen Existenz gebundenen Affektbewegung dar, für die kein verbindliches „Regelnlineal“ angemessen ist: „Singt Nachtigall und Lerche immer gleich? gleich lang? und nach Einer Melodie?“292 Jedes Gedicht hat daher „seine Regel schon in sich“, wie auch jedes „Sylbenmaas, jede Hora desselben [...] ihr eigenes Saitenspiel in den Händen“ trägt: „Energie heißt die Regel, fortwährende, wachsende Wirkung von Anfange des Stücks bis zu dessen Ende.“293 Wenn Herder die Dichtkunst einzig und allein dem Gesetz der ,Energie‘ verpflichtet, so befreit er sie – nicht anders als die Musik – von dem Zwang, ,stehende Formen‘ zu generieren oder gar eine dauerhafte Werkgestalt ausbilden zu müssen. Im Gegenteil: „Das Gedicht, als ein dargestelltes vollendetes Werk, als ein gelesener oder geschriebner Codex ist Nichts, die Reihe von Empfindungen während der Würkung ist Alles [...].“294 Keineswegs fegt Herder damit die schriftlich überlieferten Dichtungen vergangener Epochen als ,totes Papier‘ vom Tisch, aber er verweist darauf, daß sie nur in einer lebendigen Verwirklichung jene Realität zurückgewinnen, die ihnen ursprünglich eigen war, denn nicht für die stumme Lektüre oder gar für die trockene Auslegung ihrer Formgesetze wurden sie geschaffen, sondern für den emotional bewegten und bewegenden Vortrag, was Herder sogar zu der Diagnose veranlaßt, die „Buchdruckerei“ habe „viel Gutes gestiftet“, der „Dichtkunst“ aber „viel von ihrer lebendigen Würkung geraubet“. „Jetzt schrieb der Dichter, voraus sang er [...]. Endlich schrieb er jetzt gar für das liebe klassische Werk [...], für die papierne Ewigkeit; da der vorige Sänger und Rhapsode nur für den jetzigen Augenblick sang, in demselben aber eine Würkung machte, daß Herz und Gedächtniß die Stelle der Bücherkammer auf Jahrhunderte hin vertraten.“295 Über seine eigene Art, Homer im griechischen Original zu lesen und dabei eine „geheime Gedankenübersetzung“ ins Deutsche vorzunehmen, schreibt Herder: „Nur denn erst lese ich, als hörte ich ihn, wenn ich mir ihn übersetze: er singet mir Griechisch vor, und eben so schnell, so Harmonisch, so edel suchen ihm meine Deut291 292 293 294 295 72 Brief Johann Gottfried Herders an Christoph Friedrich Nicolai vom 2. Juli 1772, in: Johann Gottfried Herder: Briefe, Bd. 2, S. 187. Johann Gottfried Herder: Oden (von Klopstock) [Rezension für die Allgemeine Deutsche Bibliothek, 1773], in: Sämmtliche Werke, Bd. 5, S. 354 f. Johann Gottfried Herder: Die Lyra. Von der Natur und Wirkung der lyrischen Dichtkunst, in: Sämmtliche Werke, Bd. 27, S. 175. Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 130. Johann Gottfried Herder: Ueber die Würkung der Dichtkunst auf die Sitten der Völker in alten und neuen Zeiten. Eine Preisschrift, in: Sämmtliche Werke, Bd. 8, S. 411, 412. schen Gedanken nachzufliegen: alsdenn und alsdenn nur vermag ich mir und andern von Homer lebendige bestimmte Rechenschaft zu geben, und ihn mit ganzer Seele zu fühlen. In jedem andern Falle, glaube ich, lieset man ihn als Commentator, als Scholiast, als Schulgelehrter, oder Sprachlehrling, und dies Lesen ist unbestimmt oder todt.“296 Daß die Formulierung ,er singet mir griechisch vor‘ durchaus wörtlich zu nehmen ist und Herder Ilias und Odyssee als Zeugnisse der antiken mousikē, mithin als ,Sprachgesang‘ begreift, wird spätestens bei der Beschreibung von „Homers Manier“ deutlich, die unmittelbar an einen musikalischen Verlauf denken läßt.297 Herder glaubt die besondere Eigenheit von Homer darin zu erkennen, daß dieser den Fluß seiner dichterisch entworfenen Bilder nicht etwa durch eine äußere Form zusammenhält, was dem ,energischen‘ Wesen der Poesie widerspräche, sondern durch stetiges „Wiederkommen auf einen Hauptzug, der schon da war“.298 Gemeint ist damit, daß Homer den fortschreitenden Gang des Geschehens durch permanente Rückbezüge strukturiert, indem jedes neue Bild, das er vor dem inneren Auge des Lesers (bzw. Zuhörers) entfaltet, einen bestimmten Zug des vorhergehenden aufnimmt, wiederholt und weiterentwickelt. Um es mit der plastischen Formulierung Herders auszudrücken, die das dynamische Kräftespiel der dichterisch-musikalischen ,Energie‘ präzise auf den Punkt bringt: „Das Bild rollet zirkelnd weiter“, so daß kein Handlungsmotiv durch das nachfolgende einfach ausgelöscht wird, sondern sich bei der (variierten) Wiederholung um so stärker im Kopf des Lesers oder Hörers festsetzt.299 „Jedes Bild Homers ist eine Musikalische Malerei: der gegebene Ton zittert noch eine Weile in unserm Ohre: will er ersterben; so tönt dieselbe Saite, der vorige Ton kommt verstärkt wieder; alle vereinigen sich zum Vollstimmigen des Bildes. So überwindet Homer das Hinderniß seiner Kunst, daß ihre Wirkung gleichsam jeden Augenblick verschwindet; so macht er jeden Zug seines Bildes daurend.“300 Es hätte dieser Übertragung in eine musikalische Metaphorik kaum bedurft, um zu erkennen, daß die von Herder beschriebene Bewegung des ,zirkelnden Rollens‘ dem Verlauf eines Musikstücks ähnelt, das sukzessiv von Augenblick zu Augenblick fortschreitet, sich aber durch die Wiederholung und variative Weiterentwicklung einzelner Themen und Motive dennoch zu einem imaginären Ganzen zusammenfügt. „Aus der Tonkunst könnte diese Energie [von Homers] Manier am besten erläutert werden.“301 296 297 298 299 300 301 Johann Gottfried Herder: Erstes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 3, S. 126 f. Ebd., S. 129. Ebd., S. 130. Ebd., S. 131. Ebd., S. 133. Ebd. 73 Indem Herder das musikalische Moment der Dichtkunst zum entscheidenden Merkmal ihrer Wirkungsqualität erhebt, stellt er sich abermals gegen Schiller, wobei die Konstellation der Standpunkte den musikästhetischen Diskurs exakt widerspiegelt. Schiller fordert in den Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen: „Die Poesie in ihrer vollkommensten Ausbildung muß uns, wie die Tonkunst, mächtig fassen, zugleich aber, wie die Plastik, mit ruhiger Klarheit umgeben.“302 Erneut wird damit die Idee des Plastischen und Gestalthaften gegenüber dem Musikalischen betont, das Ohr gewissermaßen der Vorherrschaft des Auges unterworfen. So jedenfalls dürfte Herder die betreffende Passage verstanden haben, zumal er in Schillers Abhandlung Über naive und sentimentalische Dichtung lesen konnte, die Poesie sei musikalisch zu nennen, sofern sie „bloß einen bestimmten Zustand des Gemüts“ hervorbringe, hingegen plastisch, wenn sie – wie die bildende Kunst – „einen bestimmten Gegenstand“ nachahme.303 In diesem Sinne ist Klopstock auch für Schiller das Paradebeispiel eines musikalischen Dichters, weshalb seine Werke allerdings in „plastisch poetischer“ Hinsicht zu wünschen übrig ließen, also dort Mängel hätten, wo man „für die Anschauung bestimmte Formen erwartet“.304 Während Herder die Poesie dezidiert als eine ,energische‘ Kunst auffaßt, die sich allein im simultanen Mitvollzug fließender und damit gestaltloser Empfindungsverläufe zu bewähren hat, verordnet Schiller ihr – wie auch der Musik – das Gegenmittel der Anschaulichkeit, um dem drohenden Formverlust durch ein plastisches Moment entgegenzuwirken. Wenn man Herder vor diesem Hintergrund – etwas zugespitzt – als Verfechter einer ,unendlichen Versmelodie‘ bezeichnet, hätte ihn dann von seiten Schillers jener Vorwurf treffen können, den Eduard Hanslick später gegenüber Wagner äußerte, daß nämlich seine Ästhetik nichts anderes sei als die „zum Princip erhobene Formlosigkeit“?305 Hier ist Vorsicht geboten, denn in einem Brief an Nicolai schränkt Herder seine Bewunderung für Klopstock mit dem Votum ein, daß manche der von dem Dichter neu erfundenen Silbenmaße – im Gegensatz zu den freien Rhythmen – „wenig taugen“ würden: „Sie sind ohne Proportion u. Ründe vors Ohr, stoßen sich hier u. da u. s. w. Ich glaube mir hierüber viel Zeit genommen zu haben, u. – – hier trift nun, Hochgeschätzter Freund, Ihre Bemerkung hin, daß es hier, so wie in der Baukunst, gewiße Formen, 302 303 304 305 74 Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, S. 639. Friedrich Schiller: Über naive und sentimentalische Dichtung (1795–1796), in: Sämtliche Werke, Bd. 5: Erzählungen. Theoretische Schriften, S. 694–780, hier S. 735. Ebd. Eduard Hanslick: Vom Musikalisch-Schönen, S. 17 (Vorwort zur dritten Auflage, Leipzig 1865). Verhältniße u. Regelmäßigkeiten gebe, über die sich nicht gehen laße. Dies würde sich hier sehr beweisen.“306 In seiner Rezension der ersten Odensammlung Klopstocks führt Herder diesen Gedanken noch weiter aus: „Den Rec. dünkt, daß in Sachen, wo es blos auf sinnliches Verhältniß ankommt, keine neue Erfindungen ins Unendliche möglich sind. Gewisse Formen des Schönen müssen in der Sculptur, wie Proportionen in der Baukunst wieder kommen, oder die Kunst wird wieder Gothisch d. i. es werden da Glieder angebracht, wo keine seyn dürfen, Glieder verwickelt, wo der Fortgang des Auges eine gelinde Succeßion foderte: auf eine oder die andre Weise erliegt das Ganze unter seinen Theilen. Ein Versuch über die Sylbenmaasse, wo selbige ohne Anwendung auf Sprache und Worte, blos als Tanz, als Folge von Tönen zu einer Melodie betrachtet würden, dürfte vielleicht dasselbe zeigen.“307 Die Übereinstimmung mit der oben zitierten Passage aus den Briefen zu Beförderung der Humanität ist evident.308 In beiden Fällen scheint der Gedanke wirksam zu sein, daß die ,Poesie des Ohrs‘ einer Korrektur durch das ,Maß des Auges‘ bedarf, wenn sie nicht jede Faßlichkeit einbüßen soll: „Sich irgend eine Kunst oder Empfindung der menschlichen Natur Maas- und Grenzenlos denken, zerstört alle Kunst, wie alle Empfindung, geschweige die Ton- und Dichtkunst, deren Wesen das Maas ist, wie alle ihre Benennungen (metrum, modi, Modulation, Rhythmus, µελος, δραµα, u. f.) sagen.“309 Herder setzt also die ,Schwunglinie‘ der Melodie oder des Verses nicht völlig frei, sondern unterstellt sie einer dialektischen Wechselwirkung von Sukzession und Kohäsion, von fluktuierender Empfindungsdynamik und formaler Einfassung im Sinne jener Schönheitsgesetze, die ihre paradigmatische Ausprägung in der „Säulenlehre“ finden.310 Nur so ist es zu erklären, daß auf die Poesie – als einer Kunst des Ohres – plötzlich Kategorien wie ,Ründe‘ oder ,Proportion‘ angewandt werden, denn „wo es auf das kälteste Verhältniß der Anordnung ankommt, [...] vom kleinen Satz, Gegensatz, Beispiel, bis zur grossen Rede, bis zum einfachen Plan des grossen Gedichts“, gelte das „Vorbild der Baukunst“.311 „So fern der Taumel nicht blind seyn soll“, wie es in der Schrift über den Sprachursprung heißt, müssen Poesie und Musik die haltlose, rein mechanisch durch Töne erzeugte Mitempfindung an ein Moment von 306 307 308 309 310 311 Brief Johann Gottfried Herders an Christoph Friedrich Nicolai vom 2. Juli 1772, in: Johann Gottfried Herder: Briefe, Bd. 2, S. 187. Johann Gottfried Herder: Oden (von Klopstock) [Rezension für die Allgemeine Deutsche Bibliothek, 1773], in: Sämmtliche Werke, Bd. 5, S. 359. Siehe oben, S. 66. Johann Gottfried Herder: Kalligone, in: Sämmtliche Werke, Bd. 22, S. 272. Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 164. Ebd., S. 165. 75 Anschaulichkeit knüpfen, da der Mensch ansonsten auf das reduziert würde, was er „mit den Thieren gemein“ hat.312 Für Herder entsteht Kunst im emphatischen Sinne erst dort, wo das Auge sich zum Ohr gesellt wie die Besonnenheit zum Gefühl313 und das Maß gestalteter Form zur Unbegrenztheit des Klanges. Es wäre indessen verfehlt, hieraus den Schluß zu ziehen, daß Herder sich am Ende dem Diktat eines vom Auge abstrahierten Formbegriffes beugen würde,314 denn letzterer bleibt für ihn, anders als für Schiller, im Bereich akustischer Wahrnehmung immer sekundär – kein konstitutives ästhetisches Prinzip, sondern bloßes Regulativ, das die Priorität des Ohres und der strömenden ,Energie‘ des Melos keineswegs beeinträchtigt: „Blosse Verhältniße [...] liebt die Dichtkunst nicht allein: sie sind zu ihrem Hauptzwecke zu kalt, zu trocken, zu gleichförmig.“315 Was Herder vorschwebt, ist offenbar ein melodischer Verlauf, der zwar nicht jeder metrisch-formalen Kontur entsagen, aber doch wesentlich freier, weiträumiger und flexibler gehalten sein soll als jene Ton- und Versfolgen, die sich in das Korsett geschlossener Perioden und mechanisch abgespulter Rhythmen einschnüren lassen. Anhand eines konkreten Beispiels sei diese Hypothese näher erläutert. In der zweiten, 1768 veröffentlichten Ausgabe der Fragmente Ueber die neuere Deutsche Litteratur kontrastiert Herder den als monoton gescholtenen Alexandriner mit der Beweglichkeit des englischen Blankverses, wie ihn Milton in Paradise Lost verwendet hatte. Er gelangt dabei zu der Feststellung, das „brittische“ Silbenmaß könne auch in der deutschen Sprache „ein hohes Ziel der Deklamation“ werden, wenn man es flexibel handhabt, also mit „freie[n] Sprünge[n] und Cadenzen“ anreichert, anstatt bloß einförmige Zäsuren zu setzen: „so wird es von selbst dem [...] Klopstockischen Sylbenmaaße an Freiheit und Vortheilen nahe kommen, doch aber, daß die Zügellosigkeit desselben in einigen Schranken gehet.“316 Folgt man dieser Argumentation, so realisiert sich im Blankvers, dem ungereimten jambischen Fünfheber, Herders Ideal einer metrisch geformten, vom ,Maß des Auges‘ konturierten Poesie, die gleichwohl dem ,Strom der Empfindung‘ angeschmiegt ist und deren Fluß nicht durch die Ausbalancierung symmetrisch abgezirkelter Perioden zum Stocken kommt. 312 313 314 315 316 76 Johann Gottfried Herder: Abhandlung über den Ursprung der Sprache, in: Sämmtliche Werke, Bd. 5, S. 16, 7. Vgl. Wilhelm Seidel: Leidenschaft und Besonnenheit, S. 307–309. Dieter Lohmeier (Herder und Klopstock, S. 183) spricht in diesem Zusammenhang sogar von einem „Rückfall Herders in die Regelpoetik“. Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 165. Johann Gottfried Herder: Ueber die neuere Deutsche Litteratur. Fragmente. Erste Sammlung. Zweite völlig umgearbeitete Ausgabe, in: Sämmtliche Werke, Bd. 2, S. 38. Mehr als dreißig Jahre später, 1802, macht Herder gewissermaßen die Probe aufs Exempel und legt mit Ariadne-Libera317 einen für die Vertonung konzipierten Theatertext vor, der zum größten Teil aus Blankversen besteht, keine Gliederung in Rezitative, Arien und Ensembles erkennen läßt und sich damit von den Konventionen der zeitgenössischen Librettistik noch weiter entfernt als zuvor Brutus.318 Bereits der programmatische Untertitel „Ein Melodrama“ bezeugt Herders Intention, mit seinem Werk den ,Sprachgesang‘ der griechischen Tragödie zu erneuern,319 und zwar in scharfer Abgrenzung von der Opernpraxis des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts, über die im zweiten Band der Adrastea ein vernichtendes Urteil gefällt wird: „Bei den Griechen war die ganze Sprache Gesang (µελος); in die kleinsten Theile und Wortfügungen derselben, in die verschlungensten Gänge der poetischen Erzählung erstreckte sich die eben so verschlungene Kunst des Rhythmus und der Metrik. Leset Pindar, Aeschylus, ja alle tragische und komische Chöre. Wer Eurer getrauet sich, verschlungene Erzählungen solcher Art mit Wirkung zu componiren? Die Griechen thatens, und mit großer Wirkung. Euch müßen die Empfindungen abgerupft und ausgepflückt in die sanftesten Perioden verfaßt oder gar in einzelnen Worten als Interjectionen aufgetragen werden.“320 Den kurzatmigen Libretto-Floskeln, die in ihrem abgerundeten Versmaß auf dasjenige berechnet sind, was Wagner später als „enge Form der Opernmelodie“ bezeichnen sollte,321 stellt Herder in Ariadne-Libera ein Textmodell entgegen, dessen Vertonung nur dann realisierbar erscheint, wenn sich die Melodik tatsächlich zu einer ausgreifenden ,Schwunglinie‘ weitet und von jeder kleinteiligen periodischen Gliederung löst. Schwer vorstellbar jedenfalls, daß die folgende Replik Ariadnes – zumal mit ihren häufigen Enjambements – in ein ,ebenmäßiges‘ melodisches Schema gepreßt werden könnte: „Ja, ich verließ die Eltern, denen ich Ihr Ein und Alles war, den gütigen, Den stets gerechten Vater, der in Kreta Das lebend ist, was sein ehrwürdger Urahn’ 317 318 319 320 321 Johann Gottfried Herder: Ariadne-Libera. Ein Melodrama (1802), in: Sämmtliche Werke, Bd. 28, S. 306– 328. Vgl. Frank E. Kirby: Herder and Opera, in: Journal of the American Musicological Society 15 (1962), S. 316–329, bes. S. 326–328. Vgl. Johann Gottfried Herder: Adrastea (II. Band, 4. Stück), in: Sämmtliche Werke, Bd. 23, S. 346: „Jahrhunderte vor der Geburt der Italiänischen und Französischen Oper gab es ein Volk, das dem Melodrama eine hohe Gestalt gegeben hatte, die Griechen. Ihr [...] theatralisches Heldenspiel war ganz Melodrama. Blos aus diesem Grundsatz läßt sich wie sein Ursprung, so seine Einrichtung und Wirkung erklären.“ Adrastea (VI. Band, 1. Stück) (1804), in: Sämmtliche Werke, Bd. 24, S. 369: „Das griechische Theater war Gesang. Dazu war alles eingerichtet, und wer Dies nicht vernommen hat, der hat vom griechischen Theater nichts gehöret.“ Johann Gottfried Herder: Adrastea (II. Band, 4. Stück), in: Sämmtliche Werke, Bd. 23, S. 337. Richard Wagner: „Zukunftsmusik“ (1860), in: Sämtliche Schriften und Dichtungen, Bd. 7, S. 129. 77 Im Reich der Schatten, ein gerechter Richter. Ich kniee vor dir, Minos! Sei mir nicht Mehr Vater; sei mir, was dein Urahn’ ist, Der Todten Richter. Sprich! Verdamme mich! – Du blickst mich gütig an? O blicke grausam! Dein milder Blick durchbohrt mein Innerstes. Sprich! – – Meine Thränen sind versieget. – Sprich! – Nein, schweige! Deine Stimme, die ich einst In jugendlicher Unschuld froh vernahm, Sie, die mich lallen lehrte, zu sich rief, Aufs Knie mich hob, an deine Vaterbrust Mich drückte, meiner Kindheit Fehle mir Liebreich verzieh – die süße Stimme bin ich Zu hören nicht mehr werth. Verwandle sie In Fluch mir und Verwünschung. – In Verwünschung? Nein! Minos fluchet nicht; er straft. So strafe Mich dann, o Richter! – Hört’ ich nicht im Traum Das Urtheil schon, das mir gebührte: ,Die Verlasserinn, sie muß verlassen werden.‘“322 Vergegenwärtigt man sich den Stand der musikalischen Grammatik um 1800, so liegt es auf der Hand, daß Herder den Komponisten seiner Zeit eine nahezu unlösbare Aufgabe antrug. Die Irritation, mit der Johann Friedrich Hugo von Dalberg auf das zugesandte Textbuch reagierte, spricht in diesem Zusammenhang für sich: „Ist Ihre Absicht, daß das Melodrama etwan [...] mit abwechselnder Deklamation und Chören, oder durchaus musikalisch sein soll? Dann gestehe ich freilich, ist der Jambus der Dialoge für Musik sehr beschwerlich, für unsere Sprache wenigstens, in der die singende Deklamation der Griechen ganz unmöglich ist. Einige Arien wünschte ich dann hinzugesetzt, wozu die Fabel und der Gang der Empfindung gewiß reichen Stoff darbeut.“323 Eine Antwort Herders ist nicht überliefert, so daß, wie schon beim Brutus, letztlich im Dunkeln bleibt, welche Art von Musik er sich vorgestellt haben mag. Doch führt es terminologisch auf jeden Fall in die Irre, dem Spätwerk – mit Jörg Krämer – eine „klassizistische Wendung“ zu attestieren.324 Auf der Grundlage seiner anthropologischen Ästhetik gelangt Herder zu Formulierungen, die der musikalischen Praxis um 1800 enteilen und vorwegnehmen, was erst im späteren 19. Jahrhundert klingende Realität werden sollte: die Dynamisierung des Melos und seine Ausweitung zu einem frei fluktuierenden Strom, der über den vorgestanzten Grundriß von Metrum, Takt und Periode hinwegflutet. 322 323 324 78 Johann Gottfried Herder: Ariadne-Libera. Ein Melodrama, in: Sämmtliche Werke, Bd. 28, S. 321. Brief Johann Friedrich Hugo von Dalbergs an Johann Gottfried Herder vom 14. Dezember 1802. Zitiert nach: Amand Treutler: Herders dramatische Dichtungen. Mit Benutzung ungedruckter Quellen, Stuttgart 1915 (Breslauer Beiträge zur Literaturgeschichte. Neuere Folge 45), S. 126 f. Jörg Krämer: Deutschsprachiges Musiktheater im späten 18. Jahrhundert, Bd. 2, S. 750. Herder und die frühromantische Musikästhetik Versucht man indessen zu rekonstruieren, welche Autoren des 19. Jahrhunderts von Herder beeinflußt waren und seine musikästhetischen Überlegungen weiterverfolgten, so stößt man auf beinahe unüberwindliche Schwierigkeiten.325 Bevor in den 1860er Jahren in Deutschland zögerlich eine Herder-Renaissance ihren Anfang nahm, die 1877 mit dem Erscheinen des ersten Bandes der von Bernhard Suphan herausgegebenen Gesamtausgabe zusätzlichen Schwung erhielt und 1894 in zahlreichen Beiträgen zum 150. Geburtstag Herders kulminierte, war der Antipode Schillers und Kants – trotz gelegentlicher Würdigungen wie etwa anläßlich der großen Weimarer Herder-Feste 1844 und 1850326 – eine mehr oder weniger unbekannte Größe, weshalb man für den Zeitraum zwischen 1800 und 1860 prinzipiell von einer „,Anonymität‘ der Wirkungsgeschichte“ sprechen muß.327 Besonders prekär gestaltet sich dabei die Frage nach dem Verhältnis zwischen Herder und der Generation romantischer Autoren. Das in der Sekundärliteratur anzutreffende Spektrum an Einschätzungen reicht von der These, die „Romantiker“ seien „Nachfahren und Vollender Herders“ gewesen, bis zu der gegenteiligen Auffassung, Herders Werk wäre in der Romantik „mit eisigem Schweigen bedacht“ worden.328 In der Musikwissenschaft hat sich seit Rudolf Schäfke die Ansicht etabliert, Herder müsse einerseits mit seinem Vierten Kritischen Wäldchen als Wegbereiter romantischen Denkens betrachtet werden, doch sei andererseits in seinen späten Schriften „bereits rückwirkender Einfluß der Romantiker“ zu vermuten.329 Noch Carl Dahlhaus sah es als wahrscheinlich an, daß Herder sich in der 1800 verfaßten Kalligone „von Wackenroder beeinflussen ließ“,330 obwohl die erhaltenen Quellen – etwa Herders handschriftlicher Nachlaß mit zahlreichen Exzerpten,331 der gedruckte Versteigerungskatalog von Herders Privat- 325 326 327 328 329 330 331 Vgl. Rafael Köhler: Johann Gottfried Herder und die Überwindung der musikalischen Nachahmungsästhetik, S. 219: „Die Wirkungsgeschichte von Herders Gedanken über Musik ist bisweilen dunkel und unübersichtlich.“ Vgl. Helmut Loos: Herder-Feste im deutschen Musikleben bis 1903, in: Ideen und Ideale, S. 209–226, bes. S. 212–219. Bernhard Becker: Phasen der Herder-Rezeption 1871–1945, S. 424. Für den engeren Bereich des „Musikleben[s]“ allerdings hat Helmut Loos einen „gegenläufige[n] Trend“ festgestellt: „In der ersten Jahrhunderthälfte scheint Herder im Bewußtsein der Musiker noch relativ präsent gewesen zu sein, während er in der zweiten Jahrhunderthälfte anscheinend aus dem Blickfeld geraten bzw. [...] in einer gewissen Anonymität verschwunden ist“ (Herder-Feste im deutschen Musikleben bis 1903, S. 223). Paul Kluckhohn: Persönlichkeit und Gemeinschaft. Studien zur Staatsauffassung der deutschen Romantik, Halle 1925, S. 11; Claus Träger: Geschichte und Literaturgeschichte. Johann Gottfried Herder und die Krise des historischen Denkens, Habil. Greifswald 1964, S. 72. Beide Schriften zitiert nach Bernhard Becker: Phasen der Herder-Rezeption 1871–1945, S. 424. Rudolf Schäfke: Geschichte der Musikästhetik in Umrissen, Berlin-Schöneberg 1934, S. 325. Carl Dahlhaus: Die Idee der absoluten Musik, S. 83. Siehe Anm. 111. 79 bibliothek332 oder die Zusammenstellung jener Bücher, die Herder zwischen 1778 und 1803 aus der Weimarer Herzoglichen Bibliothek entlieh333 – keinerlei Beweise für eine Lektüre der Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders (1797) oder der Phantasien über die Kunst (1799) liefern. Einzig der Brief an Goethe vom 11. Januar 1797 enthält ein beiläufiges Indiz dafür, daß Herder zumindest die Herzensergießungen kannte. Goethe hatte um Rückgabe jenes Exemplars gebeten, das von August Wilhelm Schlegel nach Weimar mitgebracht worden und – scheinbar versehentlich – in Herders Besitz gelangt war, und empfing daraufhin folgende knappe Notiz: „Ich weiß nicht, wie der fatale Klosterbruder zu mir gekommen ist. Ich wollte ihn an Schlegel beschämt zurückschicken, weil ich ihn deßen glaubte. Gut, daß ichs nicht darf.“334 Ob Herder das Buch überhaupt gelesen und sich eine Meinung dazu gebildet hat, geht aus diesen lakonischen Zeilen nicht hervor, noch weniger läßt sich die These von Schäfke und Dahlhaus durch sie abstützen. Umgekehrt gilt es in der Forschung jedoch als erwiesen, daß Wackenroder sich zumindest bei einem Kapitel der Herzensergießungen – Einige Worte über Allgemeinheit, Toleranz und Menschenliebe in der Kunst – an Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit orientierte,335 was Silvio Vietta zu der Annahme bewegt, auch „Herders Gedanken zur Musik“ hätten „mit großer Wahrscheinlichkeit nachdrücklich auf Wackenroder eingewirkt“, wenngleich es an direkten Zeugnissen hierfür mangelt.336 Das entscheidende Bindeglied dürfte in der Person Johann Friedrich Reichardts zu suchen sein, der einerseits gut mit Herder bekannt war, ihn sogar explizit zu den „Musikheiligen“ rechnete337 und beiden Bänden seines Musikalischen Kunstmagazins nicht zufällig ein Gedicht aus Herders Feder als Motto voranstellte,338 andererseits für den jungen Wackenroder – wie für Ludwig Tieck – die Rolle eines 332 333 334 335 336 337 338 80 Bibliotheca Herderiana, Vimariae [Weimar] 1804. Nachdruck Leipzig 1980. Bärbel Schneider: Herders Entleihungen aus der Weimarer Bibliothek. Eine Bibliographie, Wien 1999. Brief Johann Gottfried Herders an Johann Wolfgang von Goethe vom 11. Januar 1797, in: Johann Gottfried Herder: Briefe, Bd. 7, S. 286 (vgl. auch die editorischen Anmerkungen, ebd., S. 549). Vgl. Silvio Vietta: Kommentar, in: Wilhelm Heinrich Wackenroder: Sämtliche Werke und Briefe. Historischkritische Ausgabe, hrsg. von Silvio Vietta und Richard Littlejohns, Bd. 1: Werke, hrsg. von Silvio Vietta, Heidelberg 1991, S. 253–398, hier S. 300. Ebd. Johann Friedrich Reichardt: Musikalischer Almanach, Berlin 1796. Zitiert nach: Walter Salmen: Herder und Reichardt, in: Herder-Studien, hrsg. von Walter Wiora unter Mitwirkung von Hans Dietrich Irmscher, Würzburg 1960 (Marburger Ostforschungen 10), S. 95–108, hier S. 100. Salmen weist auch darauf hin, daß Reichardt „in seiner umfangreichen Bibliothek sämtliche bedeutsamen Schriften Herders [besaß], deren Inhalt er sich verständnisbereit aneignete und überdies häufig in seinen eigenen Publikationen popularisierend benutzte“ (ebd.). Vgl. Johann Friedrich Reichardt: Musikalisches Kunstmagazin, Berlin 1782/1791. Nachdruck Hildesheim 1969, hier Bd. 1 (1782), Titelseite [unpaginiert]; Bd. 2 (1791), S. 1–4. Am Beginn des ersten Bandes steht das aus Herders Volkslied-Sammlung entnommene Gedicht Gewalt der Tonkunst (Sämmtliche Werke, Bd. 25, S. 377), am Beginn des zweiten Bandes eine Rhapsodie mit dem Titel Die Tonkunst (Sämmtliche Werke, Bd. 16, S. 268–272). Mentors und väterlichen Ratgebers übernahm.339 „Wenn auch Herder selbst kaum eine spontane Wirkung mit seinen Schriften und Sammlungen zu erzielen vermochte, so verhalf ihm Reichardt auf dem Wege der vermittelnden Weitergabe an junge Freunde zu einer umso fruchttragenderen Ausstrahlung seiner Ideen.“340 Wie auch immer die Nähe zwischen Herder und Wackenroder biographisch oder rezeptionsgeschichtlich zu erklären sein mag – daß sie vorhanden ist, kann schlechterdings nicht geleugnet werden, findet sich doch in den Phantasien über die Kunst folgende Passage, die gleich mehrere Axiome von Herders Musikauffassung zu einer Synthese verbindet: „Ein fließender Strom soll mir zum Bilde dienen. Keine menschliche Kunst vermag das Fließen eines mannigfaltigen Stroms, nach allen den tausend einzelnen, glatten und bergigten, stürzenden und schäumenden Wellen, mit Worten für’s Auge hinzuzeichnen, – die Sprache kann die Veränderungen nur dürftig zählen und nennen, nicht die an einanderhängenden Verwandlungen der Tropfen uns sichtbar vorbilden. Und eben so ist es mit dem geheimnißvollen Strome in den Tiefen des menschlichen Gemüthes beschaffen. Die Sprache zählt und nennt und beschreibt seine Verwandlungen, in fremdem Stoff; – die Tonkunst strömt ihn uns selber vor. Sie greift beherzt in die geheimnißvolle Harfe, schlägt in der dunkeln Welt bestimmte, dunkle Wunderzeichen in bestimmter Folge an, – und die Saiten unsres Herzens erklingen, und wir verstehen ihren Klang. [...] Aber in diesen Wellen strömt recht eigentlich nur das reine, formlose Wesen, der Gang und die Farbe, und auch vornehmlich der tausendfältige Übergang der Empfindungen [...].“341 Hier ist nahezu alles vorhanden, was Herders Musikästhetik ausmacht: Die Identität von Empfindung und Musik im Modus dynamischer Bewegung, eingefangen durch die Metapher des Stromes;342 das Unvermögen der Wortsprache, den Verlauf dieses Stromes mittels begrifflicher oder bildhafter Repräsentation zu artikulieren; die damit verbundene Gefühlsferne des Auges; das Resonanzprinzip (Mitklingen der ,Saiten unseres Herzens‘) als Modell 339 340 341 342 Zum Einfluß Reichardts auf Wackenroder und Tieck vgl. Walter Salmen: Johann Friedrich Reichardt. Komponist, Schriftsteller, Kapellmeister und Verwaltungsbeamter der Goethezeit, Freiburg im Breisgau und Zürich 1963, S. 73 f.; Rose Kahnt: Die Bedeutung der bildenden Kunst und der Musik bei W. H. Wackenroder, Marburg 1969 (Marburger Beiträge zur Germanistik 28), S. 26–28; Alexandra Kertz-Welzel: Die Transzendenz der Gefühle. Beziehungen zwischen Musik und Gefühl bei Wackenroder/Tieck und die Musikästhetik der Romantik, St. Ingbert 2001 (Saarbrücker Beiträge zur Literaturwissenschaft 71), S. 62–82. Walter Salmen: Herder und Reichardt, S. 105. Wilhelm Heinrich Wackenroder: Das eigenthümliche innere Wesen der Tonkunst, und die Seelenlehre der heutigen Instrumentalmusik, in: Phantasien über die Kunst, für Freunde der Kunst, hrsg. von Ludwig Tieck, Hamburg 1799. Zitiert nach dem Wiederabdruck in: Wilhelm Heinrich Wackenroder: Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 1: Werke, S. 216–223, hier S. 219 f. Zum „Musikstrom“ als einem Ideal der Romantik vgl. auch Heinrich Besseler: Das musikalische Hören der Neuzeit, S. 68–75, hier S. 74. Heike Stumpf weist durch Auswertung einschlägiger Fachzeitschriften nach, daß die Strom- und Wassermetaphorik in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts sogar zu einem Topos der Musikpublizistik avanciert, ohne überhaupt noch „als uneigentlich empfunden“ zu werden („...wollet mir jetzt durch die phantastisch verschlungenen Kreuzgänge folgen!“ Metaphorisches Sprechen in der Musikkritik der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Frankfurt am Main u. a. 1996 [Bonner Schriften zur Musikwissenschaft 2], S. 91–104, hier S. 93). 81 musikalischer Wahrnehmung; zuletzt die notwendige Formlosigkeit einer Musik, deren Wesen darin besteht, den ‚tausendfältigen Übergang‘, das Transitorische der Empfindungen mitzuvollziehen. Wenn Herder – gegen Sulzer und Rousseau343 – immer wieder betont, daß die Macht der Musik im „Wohllaut Eines Tons“ versammelt sei,344 daß daher ein „einzelner Ton“, der „Klang eines Horns“ etwa, „mit Wenigem Viel“ gebe, aber auf eine „dem Auge verborgne, geistige Weise“,345 so ähnelt dies bis ins Detail der analogen Formulierung Ludwig Tiecks, „ein einziger Ton, ein Klang“ strecke sich dem Menschen „mit tausend Engelsarmen“ entgegen, weshalb die Seele durch nichts stärker berührt werde als durch ein „aus der Ferne“ herüberklingendes Horn, das „nur wenige Akkorde“ anschlägt346 – der Topos romantischer Musik schlechthin, greifbar noch in den ersten Takten von Carl Maria von Webers OberonOuvertüre. Aber nicht nur das: Wie Herder in einer dialektischen Denkbewegung die Formlosigkeit der Musik bis zu einem gewissen Grad kompensieren will, indem er fordert, das Auge müsse gleichsam dem Ohr zu Hilfe kommen und die ungegliederte Sukzession von Tönen begrenzen, ohne ihre ,Energie‘ zum ,Werk‘ gerinnen zu lassen, so ist auch bei Wackenroder und Tieck mehrfach von einer solchen Ergänzung akustischer durch imaginäre optische Eindrücke die Rede. „Die Musiktöne gleichen oft einem feinen flüssigen Elemente, einem klaren, spiegelhellen Bache, wo das Auge sogar oft in den schimmernden Tönen wahrzunehmen glaubt, wie sich reizende, ätherische und erhabene Gestalten eben zusammenfügen wollen, wie sie sich von unten auf emporarbeiten, und klarer und immer klarer in den fließenden Tönen werden. Aber die Musik hat eben daran ihre rechte Freude, daß sie nichts zur wahren Wirklichkeit gelangen läßt, denn mit einem hellen Klange zerspringt dann alles wieder, und neue Schöpfungen sind in der Zubereitung.“347 An anderer Stelle der Phantasien über die Kunst schreibt Wackenroder, daß „Heerschaaren der Phantasie [...] die Töne mit magischen Bildern bevölkern, und die formlosen Regungen in bestimmte Gestalten menschlicher Affekten verwandeln“.348 Das den Rezeptionsprozeß konstituierende Zusammenspiel von Ohr und Auge ist also nicht nur im Sinne einer Erzeugung synästhetischer Phänomene aufzufassen, sondern auch dahingehend, daß die jeder Anschau343 344 345 346 347 348 82 Siehe oben, S. 20 f. und 26–28. Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 106. Johann Gottfried Herder: Kalligone, in: Sämmtliche Werke, Bd. 22, S. 270 f. Ludwig Tieck: Die Töne, in: Phantasien über die Kunst, für Freunde der Kunst, hrsg. von Ludwig Tieck, Hamburg 1799. Zitiert nach dem Wiederabdruck in: Wilhelm Heinrich Wackenroder: Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 1: Werke, S. 233–239, hier S. 237. Ebd. Wilhelm Heinrich Wackenroder: Das eigenthümliche innere Wesen der Tonkunst, S. 220 f. ung enthobene ,sympathetische Wahrheit‘ des Klanges durch optische Assoziationen in den individuellen Erfahrungsbereich des Hörers zurückgeholt wird, die formlosen, aber gerade deshalb unmittelbar auf die Empfindung einwirkenden Töne sich an konkrete ,Gestalten‘ knüpfen und damit semantisch fixieren lassen. Nichts anderes meint Robert Schumann, als er 1835 die ‚Gretchenfrage‘ aller Programmusik, wie weit nämlich die „Darstellung von Gedanken und Begebenheiten“ durch Töne „gehen dürfe“, mit dem Hinweis beantwortet: „Unbewußt neben der musikalischen Phantasie wirkt oft eine Idee fort, neben dem Ohre das Auge, und dieses, das immer thätige Organ, hält dann mitten unter den Klängen und Tönen gewisse Umrisse fest, die sich mit der vorrückenden Musik zu deutlichen Gestalten verdichten und ausbilden können.“349 Wenn Schumann hier das Auge als ,tätiges Organ‘ bezeichnet, das in der Lage sei, dem ,Strom‘ der Töne gleichsam Konturen aufzuprägen, also ,Anschaulichkeit‘ zu schaffen, wo das Ohr allein weder ,Umrisse‘ noch ,Gestalten‘ wahrzunehmen vermag, schreibt er implizit die Auffassung Herders vom Zusammenwirken beider Sinne fort. Noch weitgehender sind die Parallelen zwischen Herders Musikästhetik und einem Roman, der – wie in neuerer Forschung übereinstimmend festgestellt wurde350 – „bereits Elemente der frühromantischen Poetik“ enthält und Gedanken Wackenroders und E. T. A. Hoffmanns, sogar Schopenhauers und Richard Wagners vorwegnimmt, nämlich Wilhelm Heinses Hildegard von Hohenthal, erschienen in den Jahren 1795 und 1796.351 Herder kannte dieses Buch nicht nur, sondern war von der Lektüre auch äußerst angetan, schrieb er doch am 8. Januar 1798 an Johann Wilhelm Ludwig Gleim: „Heinse ist in seinem Roman jetzt an Ort u. Stelle, in der Musik. Ich habe ihn mit großem Vergnügen gehört, insbesonderheit die musikalischen Stellen, in denen viel Empfindung, Geschmack u. Kritik ist.“352 349 350 351 352 Robert Schumann: [Rezension der „Symphonie fantastique“ von Hector Berlioz], in: Neue Zeitschrift für Musik 2 (1835). Zitiert nach dem Wiederabdruck in: Robert Schumann: Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, hrsg. von Gustav Jansen, Leipzig 41891, Bd. 1, S. 129–154, hier S. 148. Christiane Lubkoll: Mythos Musik. Poetische Entwürfe des Musikalischen in der Literatur um 1800, Freiburg im Breisgau 1995 (Rombach Wissenschaft. Reihe Litterae 32), S. 114; vgl. auch Werner Keil: Heinses Beitrag zur romantischen Musikästhetik, in: Das Maß des Bacchanten. Wilhelm Heinses Über-Lebenskunst, hrsg. von Gert Theile, München 1998 (Weimarer Editionen), S. 139–158. Ruth E. Müllers Einschätzung, daß Heinses Hildegard von Hohenthal einen „Spätausläufer der rationalistischen Ästhetik“ bilde, kann vor diesem Hintergrund als überholt gelten (Erzählte Töne. Studien zur Musikästhetik im späten 18. Jahrhundert, Stuttgart 1989 [Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft 30], S. 131–150, hier S. 131). Zu den Analogien zwischen Herder und Heinse vgl. auch Walter Wiora: Herders und Heinses Beiträge zum Thema: „Was ist Musik?“, bes. S. 390–394. Brief Johann Gottfried Herders an Johann Wilhelm Ludwig Gleim vom 8. Januar 1796, in: Johann Gottfried Herder: Briefe, Bd. 7, S. 207. 83 Was Herder an Heinses Roman faszinierte, ist nicht schwer zu erraten, denn er mußte darin eine zugespitzte Neuformulierung vieler Ideen erkennen, die ein Vierteljahrhundert zuvor im Vierten Kritischen Wäldchen zur Sprache gebracht worden waren, ohne jedoch an die Öffentlichkeit zu gelangen (das Vierte Kritische Wäldchen erschien erst 1846 im Druck,353 kann also weder auf Wackenroder noch auf Heinse direkten Einfluß ausgeübt haben354). Hatte Herder seinerzeit einen ersten Vorstoß unternommen, die Musik vom Primat des Auges zu befreien und gleichsam dem Ohr zurückzugeben, hatte er – mit anderen Worten – die Sphäre klarer Vorstellungen und begrifflicher Reflexion dem optischen Sinn, das dunkle, aber um so mächtigere Reich des Gefühls hingegen dem akustischen Sinn zugewiesen, so fand er denselben Gedanken nun bei Heinse wieder, und zwar mit anatomischen Argumenten untermauert, die ihm 1769 bei seiner Beschreibung der Funktionsweise des Ohres ebenfalls zustatten gekommen wären: „Das Ohr ist gewiß unser richtigster Sinn; und selbst das Gefühl, welches man bisher für den untrüglichsten gehalten hat, bildet sich nach ihm. [...] Deßwegen sind die Taubgebornen auch um so vieles trauriger und unglücklicher, als die Blinden, weil sie den Hauptsinn des Verstandes, der die andern zur Richtigkeit gewöhnt, nicht haben; und so gibt die Musik unter allen Künsten der Seele den hellsten und frischesten Genuß.“355 In einer Fußnote verweist Heinse auf eine noch unveröffentlichte Publikation des Arztes Samuel Thomas Soemmerring, der das „Organ des Sensorium commune“ in der „Feuchtigkeit der Hirnhöhlen“ lokalisiere, genau dort, wo auch die Hörnerven endeten, was den „physischen Grund“ für die Privilegierung des Ohres liefere.356 Heinse war eng mit dem Professor für Anatomie und Physiologie an der Mainzer Universität befreundet und nahm dessen Theorien dankbar auf, gab ihnen andererseits aber auch wichtige Impulse, so daß man von einer höchst produktiven Wechselbeziehung zwischen Ästhetik und Medizin sprechen kann.357 Einer handschriftlichen Notiz Soemmerrings ist zu entnehmen, daß er sich bei seinen Forschungen nicht zuletzt von jener Intuition leiten ließ, die Heinse bereits am 22. November 353 354 355 356 357 84 Die Erstveröffentlichung erfolgte in: Johann Gottfried von Herders Lebensbild. Sein chronologisch-geordneter Briefwechsel. Verbunden mit den hierhergehörigen Mittheilungen aus seinem ungedr. Nachlasse u. mit den nöthigen Belegen aus seinen und seiner Zeitgenossen Schriften, hrsg. von Emil Gottfried von Herder, Erlangen 1846, Bd. I, 3, 2, S. 217–520. Problematisch ist es daher, daß Alexandra Kertz-Welzel bei ihrer ausführlichen Erörterung der „Parallelen zwischen Wackenroders und Herders Denken“ von der falschen Prämisse ausgeht, das Vierte Kritische Wäldchen sei 1769 veröffentlicht worden (Die Transzendenz der Gefühle, S. 15, 84; vgl. insbesondere das Kapitel über Herders Musikästhetik, S. 82–90). Wilhelm Heinse: Hildegard von Hohenthal (1795–1796), in: ders.: Hildegard von Hohenthal. Musikalische Dialogen. Unter der Mitarbeit von Bettina Petersen hrsg. und kommentiert von Werner Keil, Hildesheim u. a. 2002, S. 7–376, hier S. 42. Ebd., S. 42 f. Vgl. Manfred Wenzel: „Wir beide haben ohne dieß genug Neider!“ Die Freundschaft zwischen Heinse und Soemmerring, in: Das Maß des Bacchanten, S. 159–184. 1780 gegenüber Fritz Jacobi formuliert hatte und deren Kompatibilität mit Herders Ansichten auf den ersten Blick zutage tritt:358 „Keine Kunst trift doch so unmittelbar die Seele, wie die Musik; und es ist, als ob der Ton mit ihr von gleichem Wesen wäre, so augenblicklich und ganz vereinigt er sich mit ihr. Mahlerey, Bilhauerkunst und Baukunst sind todt gegen eine süße Stimme, oder überhaupt schon gegen reinen Klang. Dieser ist das sinnlichste, was der Mensch vom Leben fassen kann.“359 1791 konkretisierte Heinse diesen Aphorismus in einer Notizensammlung mit dem Titel Empfindungen und Gedanken über verschiedne Gegenstände, die Soemmerring vermutlich ebenfalls bekannt war und größtenteils wörtlich in Hildegard von Hohenthal wiederkehrt.360 Heinses Begründung dafür, daß Musik die Seele stärker und unmittelbarer berühre als jede andere Kunst, ist indessen keineswegs neu oder originell, sondern orientiert sich – wie entsprechende Passagen bei Webb, Beattie, Herder oder Engel – am Resonanzprinzip. „Musik wirkt hauptsächlich durch Rührung und Erschütterung des Nervensystems“, so läßt sich Reinhold in Hildegard von Hohenthal vernehmen,361 und Kapellmeister Lockmann sekundiert mit der Bemerkung: „Unser Gefühl selbst ist nichts anders, als eine innre Musik, immerwährende Schwingung der Lebensnerven. [...] Die Musik rührt sie so, daß es ein eignes Spiel, eine ganz besondre Mittheilung ist, die alle Beschreibung von Worten übersteigt. Sie stellt das innre Gefühl von außen in der Luft dar, und drückt aus, was aller Sprache vorhergeht, sie begleitet, oder ihr folgt.“362 „Meßbar und erklärbar wirken die Töne an und für sich durch ihre Höhe und Tiefe, Stärke und Schwäche; und dann durch ihre Dauer, Folge und Verbindung. Man könnte dieß die reine Musik nennen. Sie greift die Nerven und alle Theile des Gehörs an, und verändert dadurch das innre Gefühl außer allen andern Vorstellungen der Phantasie. Schon das Wasser pflanzt den Schall mehr als doppelt stärker und weiter fort, als die Luft; noch besser die festen Theile unsers Körpers. Der ganze Mensch erklingt gleichsam, und es entstehen Empfindungen nach dem Verhältnisse der Töne und der Beschaffenheit der Massen, wodurch sie hervorgebracht werden.“363 Auf den Zusammenhang dieser physikalisch-mechanistischen Erklärungsweise mit entsprechenden Theorien Johann Gottfried Herders und anderer Autoren des späten 18. Jahrhunderts 358 359 360 361 362 363 Vgl. ebd., S. 169. Brief Wilhelm Heinses an Fritz Jacobi vom 22. November 1780, in: Wilhelm Heinse: Sämmtliche Werke, Bd. 10: Briefe. Zweiter Band. Von der italiänischen Reise bis zum Tode, Leipzig 1910, S. 74. Vgl. Manfred Dick: Der Literat und der Naturforscher. Wilhelm Heinse und Samuel Thomas Soemmerring, in: Das Maß des Bacchanten, S. 185–212, hier S. 198–200. Wilhelm Heinse: Hildegard von Hohenthal, S. 160. Ebd., S. 22. Ebd. 85 (Schubart, Sulzer) wurde in der Heinse-Literatur bereits mehrfach hingewiesen,364 ohne daß die Frage der geistigen Urheberschaft letztlich zu beantworten wäre. Im deutschen Sprachraum steht Herder mit seinem Vierten Kritischen Wäldchen chronologisch an erster Stelle, doch da diese Schrift unveröffentlicht blieb, gebührt der „Vortritt“ – wie schon Eduard Hanslick bemerkte365 – tatsächlich dem „Engländer Webb“, dessen Observations on the Correspondence between Poetry and Music 1771 in der Übersetzung von Johann Joachim Eschenburg erschienen waren.366 Gleichwohl fehlt es an Belegen für Wilhelm Seidels Vermutung, daß „Herders Tonphilosophie“ durch „Webbs physikalisch gedachte Fassung der Wirkungsästhetik [...] zutiefst geprägt“ worden sei,367 denn allem Anschein nach lernte Herder die Observations erst 1771 in der deutschen Version kennen, zu einem Zeitpunkt, als das zwischen Januar und Juni 1769 niedergeschriebene Vierte Kritische Wäldchen bereits vorlag.368 Ebensowenig kann man von einer Beeinflussung durch James Beatties 1762 geschriebenen Essay on Poetry and Music ausgehen, wurde dieser doch erst 1776 publiziert und 1779 in deutscher Übersetzung vorgelegt. Wie auch immer die Rezeptionswege von den britischen Inseln nach Deutschland verlaufen sein mögen: Durch den Kult der Empfindsamkeit wurde die Resonanztheorie ohnehin zur allgegenwärtigen Saitenmetaphorik trivialisiert und auf alle literarischen Gattungen verstreut, weshalb sie spätestens in den 1780er Jahren zu einem Topos avancierte, der kaum noch mit bestimmten Autoren exklusiv in Verbindung gebracht werden kann.369 Wenn Herder 1800 in Kalligone schreibt: „Klang und Gang und Rhythmus [der Töne] bedeuten nicht nur, sondern sind Schwingungen des Mediums sowohl als unsrer Empfindungen“,370 so läßt sich dies – im 364 365 366 367 368 369 370 86 Vgl. Christiane Lubkoll: Mythos Musik, S. 108, sowie Charis Goer: Töne, Tyrannen und Titanen – zu Wilhelm Heinses „Hildegard von Hohenthal“, in: „Seelenaccente“ – „Ohrenphysiognomik“. Zur Musikanschauung E. T. A. Hoffmanns, Heinses und Wackenroders, hrsg. von Werner Keil und Charis Goer, Hildesheim u. a. 2000 (Diskordanzen. Studien zur neueren Musikgeschichte 8), S. 141–201, hier S. 176 f. Eduard Hanslick: Vom Musikalisch-Schönen, S. 115. Daniel Webb’s Betrachtungen über die Verwandschaft der Poesie und Musik, nebst einem Auszuge aus eben dieses Verfassers Anmerkungen über die Schönheiten der Poesie. Aus dem Englischen übersetzt von Johann Joachim Eschenburg, Leipzig 1771. Wilhelm Seidel: Leidenschaft und Besonnenheit, S. 305 f. Vgl. Bruno Markwardt: Herders Kritische Wälder, S. 9. Dies würde auch erklären, warum Herder die Schrift Daniel Webbs in seiner Rezension für die Allgemeine Deutsche Bibliothek relativ wortkarg als „fein, obgleich selten neu“ bewertete (Sämmtliche Werke, Bd. 5, S. 311). Vgl. Gerhard Sauder: Die empfindsamen Tendenzen in der Musikkultur nach 1750, in: Carl Philipp Emanuel Bach und die europäische Musikkultur des mittleren 18. Jahrhunderts. Bericht über das Internationale Symposium der Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften Hamburg (29. September – 2. Oktober 1988), hrsg. von Hans Joachim Marx, Göttingen 1990, S. 41–64, bes. S. 48–51. Als Beleg zitiert Sauder etwa folgende Passage aus Christian Friedrich Timmes Der Empfindsame Maurus Pankrazius Ziprianus Kurt, auch Selmar genannt. Ein Moderoman (Erfurt 1782): „Jeder Ton, der bei seinem Erwachen an sein Ohr schlug, rührte auch die empfindsamen Saiten seiner Seele“ (ebd., S. 50). Johann Gottfried Herder: Kalligone, in: Sämmtliche Werke, Bd. 22, S. 326. Hinblick auf die Entstehungschronologie371 – einerseits als Paraphrase der analogen Formulierung Heinses lesen („Unser Gefühl selbst ist nichts anders, als eine innre Musik, immerwährende Schwingung der Lebensnerven“),372 andererseits als logische Konsequenz dessen, was er selbst bereits 1769 im Vierten Kritischen Wäldchen angelegt hatte. Das Geflecht gegenseitiger Einflußnahme zu entwirren und Prioritäten zu rekonstruieren, scheint aus heutiger Perspektive nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Neu bei Heinse ist allerdings, daß ihm eine anatomische Begründung zur Verfügung steht, über die Herder 1769 nur spekulieren konnte, als er behauptete, der Beweis für die größere Intensität akustischer Eindrücke müsse sich „weit klärer [...] in den Gehörfibern machen lassen, als in den Nerven des Auges, die doch auch als Saitenspiele für die Farben betrachtet werden“.373 Was Herder hier hypothetisch formuliert, entspricht letztlich genau Samuel Thomas Soemmerrings Theorie einer „Gemeinschaftliche[n] Empfindungsstelle (Sensorium commune) [...] in der [...] Flüssigkeit der Hirnhöhlen“.374 Soemmerring geht – wie Herders Gewährsmann Johann Gottlob Krüger oder auch Edmund Burke375 – von der Annahme aus, daß Empfindungen sich in Vibrationen des Nervensystems materialisieren, ergänzt diese These aber mit der Beobachtung, daß erstens „jeder Sinn ihm eigene, von denen der übrigen Sinne verschiedene, Schwingungsformen der Feuchtigkeit der Hirnhöhlen mittheilen kann“ und zweitens nicht die Seh- oder Riechnerven, sondern ausschließlich die „Anfänge oder Hirnenden des Hörnervenpaares die Feuchtigkeit der Vierten Hirnhöhle berühren“.376 Hieraus folgert er: „Unmöglich [...] können die Vibrationen oder Oscillationen der Hörnerven, oder die durch die wirkenden Hörnerven erfolgenden Bewegungen, so beschaffen seyn, als diejenigen die die Sehenerven eben der Flüssigkeit der Hirnhöhlen mittheilen, eben weil die Hörnerven [...] theils sich anders beschaffen endigen, theils an einem andern Orte sich endigen, als die Sehenerven.“377 Da nun aber einzig und allein die Enden der Hörnerven direkt mit dem flüssigen ,sensorium commune‘ in Verbindung stehen und ihre Vibrationen ohne Umwege an das Zentrum aller Empfindung weiterleiten, ergibt sich für Soemmerring genau jene Prävalenz des Ohres, auf 371 372 373 374 375 376 377 Für Walter Serauky beispielsweise steht außer Zweifel, daß Herders Kalligone den Einfluß Heinses verrät (Die musikalische Nachahmungsästhetik im Zeitraum von 1700 bis 1850, Münster 1929 [Universitas-Archiv 17], S. 241). Wilhelm Heinse: Hildegard von Hohenthal, S. 22. Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 102. Samuel Thomas Soemmerring: Ueber das Organ der Seele (1796), in: Werke, Bd. 9, S. 155–252, hier S. 193 f. Siehe oben, S. 24 und 39. Samuel Thomas Soemmerring: Ueber das Organ der Seele (1796), S. 208, 181 f. Ebd., S. 208 87 die auch sein Freund Heinse „durch vielfältige Erfahrung und tiefes Nachdenken“ gestoßen sei: „Unter allen Nerven nämlich ist keiner [...], der so unmittelbar, so nackt und bloß mit der Feuchtigkeit der Hirnhöhlen in Berührung steht; folglich auch so unmittelbar das Gemeinsame Sensorium rührt – das ist mit andern Worten: Der Hörnerven [sic!] wirkt am richtigsten, und giebt die hellsten und frischesten Empfindungen.“378 Mit der Lokalisierung des ,sensorium commune‘ in der ,Feuchtigkeit‘ einer bestimmten Hirnregion verbindet Soemmerring weitreichende philosophische Spekulationen, die wiederum auf Heinses materialistischen Naturbegriff verweisen.379 Um „eine Brücke [zu] schlagen zwischen den Philosophen und den Medizinern und das Wirkungsprinzip des Kosmos mit dem anatomisch beschreibbaren Seelenorgan in Einklang [zu] setzen“,380 zitiert er eine Passage aus Heinses Roman Ardinghello, in der darüber reflektiert wird, daß „Thales das Göttliche im Wasser zu finden [glaubte], weil alles Lebendige sich davon nährt und aller Same feucht ist“. „Stellt euch das Chaos vor, das alle Götter, Menschen, Tiere, Metalle und Steine gebar, wie einen unermeßlichen heißen Nebel im unendlichen Raume, worin Sonnen und Planeten noch zerstäubt schwimmen mit den Meeren, Erden und Lüften!“381 Geht es Soemmerring zunächst darum, mit Hilfe dieses Exkurses sowie mit dem Bibelzitat „Und der Geist Gottes schwebte auf den Wassern“ (Gen 1,2)382 die Kühnheit seiner These abzufedern, daß die Seele nicht in körperloser Transzendenz zu suchen sei, sondern ganz konkret in der Substanz einer ,animierten‘ Hirnflüssigkeit, dem anatomischen Äquivalent des ‚unermeßlichen heißen Nebels‘,383 so liefert er Heinse umgekehrt den Anstoß dafür, die Musik als Kunst des Ohres – und damit als eigentliche Kunst des „reine[n] [...] Leben[s] in der Natur und im Menschen“384 – immer wieder mit Wasser, Strom oder Ozean in Verbin378 379 380 381 382 383 384 88 Ebd., S. 210, 211. Vgl. Manfred Dick: Der Literat und der Naturforscher, S. 202 f. Manfred Wenzel: „Wir beide haben ohne dieß genug Neider!“, S. 172. Wilhelm Heinse: Ardinghello und die glückseeligen Inseln. Eine Italiänische Geschichte aus dem sechszehnten Jahrhundert, Lemgo 1787. Zitiert nach der Kritischen Studienausgabe, hrsg. von Max L. Baeumer, Stuttgart 1975 (Universal-Bibliothek 9792), S. 267, 270 (vgl. Samuel Thomas Soemmerring: Ueber das Organ der Seele, S. 201). Samuel Thomas Soemmerring: Ueber das Organ der Seele, S. 200. Vgl. ebd., S. 201, 203: „[Man sieht deutlich], daß dieser tief und doch helldenkende Kopf [Heinses Romanfigur Demetri] einen unermeßlichen heißen Nebel, folglich eine animirte Flüssigkeit, statuirt. [...] Und – da Urleben, Urbewegung, oder Anfang einer Bewegung bei stäten, in Ansehung ihrer Form unveränderlichen, Wesen nicht einmal denkbar ist; sondern dieselben eine Flüssigkeit zu heischen scheinen: so dünkt mich der Satz: ,Daß eine Flüssigkeit animirt seyn könne‘ auch um so wahrscheinlicher.“ Wilhelm Heinse: Erste noch rohe oder für mich auch schon reine Empfindungen und Gedanken über verschiedne Gegenstände, meistens Musik (1791), in: Sämmtliche Werke, Bd. 8, 2: Aphorismen. Von der italienischen Reise. Aus Düsseldorf. Aus Mainz. Aus Düsseldorf, hrsg. von Albert Leitzmann, Leipzig 1925, S. 267–378, hier S. 292. dung zu bringen, mit jenem der vier Elemente also, das nach alter mythologischer Tradition am Ursprung des beseelten Daseins stand.385 Ist an einer Stelle der Hildegard von Hohenthal noch allgemein vom „weiten Ozean der Musik“ die Rede,386 so gewinnt die Wassermetaphorik zusehends an Kontur, als das Miserere von Leonardo Leo zur Sprache kommt: „Das Ganze ist nicht zusammengereiht und geflickt; es ist eine erhabne Einheit, die wie ein Strom von unzählbaren reinen Quellen und Bächen immer mehr anschwillt, und in Wonnefluthen und Strudeln bald die Herzen herumtreibt, woraus Entzücken entsteht und ein neues Leben kommt. [...] Beym fünften [Vers] fängt der Strom schon an zu schwellen, und der zweyte Chor tritt in die Harmonie ein; oder vielmehr zwey Ströme wallen neben einander fort, und vermischen sich bey et vincas und cum judicaris. Der siebente Vers Ecce enim gleicht einem tiefen Genfersee voll Majestät, doch überall noch im Zuge des Stroms, und tausendfach lebendig. [...] Es ist ganz groß, und wie ein prächtiger Triumph; die Seele wird gleichsam untergetaucht, und am Ende kommt sie aus den tiefen Wonnestrudeln hervor, und schwebt still im Schwimmen, und schaut mit entzückten Blicken in den heitern Aether des unendlichen Himmels.“387 Daß Heinse hier einerseits auf Gedanken Herders zurückgreift, andererseits E. T. A. Hoffmanns romantischen Kult um die ,alte Kirchenmusik‘ eines Allegri, Palestrina oder Leo vorwegnimmt, wurde in der Forschung bereits des öfteren vermerkt,388 nicht aber, daß der Beginn der oben angeführten Passage sogar ein kaum verhülltes Herder-Zitat darstellt, heißt es doch in dessen Aufsatz Cäcilia von 1793: „Denn, heilige Cäcilia, mit welchen Wunder- und Herzenstönen hast du deine Lieblinge, einen Leo, Durante, Palestina [sic!], Marcello, Pergolese, Händel, Bach u. f. begeistert! In und aus ihnen tönte die heilige Musik in vollem, reinen Strome; bis sie sich nachher in tausend anmuthige Bäche zertheilt hat.“389 Die Überschneidungen innerhalb des metaphorischen Vokabulars sind nicht nur evident, sondern lassen auch darauf schließen, was Herder, Heinse und später E. T. A. Hoffmann am ‚stile antico‘ faszinierte, nämlich jener „remplissage d’accords“,390 den Jean-Jacques Rousseau noch gar nicht als Musik gelten lassen wollte: die Entfaltung ,reinen Klanges‘,391 dessen uranfängliches, elementares Wesen im mythologisch aufgeladenen Bild des Wassers gespie385 386 387 388 389 390 391 Vgl. Rudolf Treumann: Die Elemente. Feuer, Erde, Luft und Wasser in Mythos und Wissenschaft, München und Wien 1994, S. 40 f., sowie Sibylle Selbmann: Mythos Wasser. Symbolik und Kulturgeschichte, Karlsruhe 1995, S. 9–19. Wilhelm Heinse: Hildegard von Hohenthal, S. 53. Ebd., S. 56 f. Vgl. Peter Rummenhöller: Romantik in der Musik. Analysen, Portraits, Reflexionen, München u. a. 1989, S. 28–33, sowie Werner Keil: Heinses Beitrag zur romantischen Musikästhetik, S. 147–150. Johann Gottfried Herder: Cäcilia (1793), in: Sämmtliche Werke, Bd. 16, S. 260. Jean-Jacques Rousseau: Lettre sur la musique françoise (1753), in: Œuvres complètes, Bd. 5: Écrits sur la musique, la langue et le théâtre, S. 287–328, hier S. 308. Vgl. Heinses oben (S. 85) zitierten Brief an Fritz Jacobi. 89 gelt erscheint.392 Dies wird um so deutlicher, wenn man Wackenroders Beschreibung der „alte[n], choralmäßige[n] Kirchenmusik“ hinzunimmt, von der es heißt, sie klinge „wie ein ewiges ,Miserere mei Domine!‘“ mit „langsame[n], tiefe[n] Töne[n]“, die „gleich sündenbeladenen Pilgrimmen in tiefen Thälern dahinschleichen“. „Ihre bußfertige Muse ruht lange auf denselben Accorden; sie getraut sich nur langsam die benachbarten zu ergreifen; aber jeder neue Wechsel der Accorde, auch der allereinfachste, wälzt in diesem schweren, gewichtigen Fortgange unser ganzes Gemüth um, und die leise-vordringende Gewalt der Töne durchzittert uns mit bangen Schauern, und erschöpft den letzten Athem unsers gespannten Herzens.“393 Wegweisend für die Beschreibung der Musik Palestrinas – nicht nur bei Wackenroder, sondern auch bei Herder und später bei E. T. A. Hoffmann394 – dürfte Johann Friedrich Reichardts Kommentar im zweiten, 1791 erschienenen Band seines Musikalischen Kunstmagazins gewesen sein, der „Hauptcharacter“ des „erhabnen feierlichen Kirchenstil[s]“ liege „in der nachdrücklichen und oft kühnen Folge von größtentheils konsonirenden Accorden [...], deren ganz bestimmter Eindruck weder durch melodische Verzierungen noch durch rythmische [sic!] Mannigfaltigkeit [...] geschwächt“ werde. „Die übergangenen Zwischenaccorde, die wir immer so geflissentlich hören lassen, und als nothwendige kleine Brücken für uns und unser kritisches Gefolge, von einem Arme des Stroms zum andern so sorgfältig hinpflanzen, die geben hier jedem Schritte eine Riesengröße, und lassen die Seele nur dunkel den Weg ahnden, den die Harmonie genommen. Auch überfällt jeder einzelne Accord den Zuhörer mit seiner ganzen Kraft, und trift ihn doppelt stark, da er ihn unvorbereitet trift.“395 Nirgends ist bei Reichardt, Herder, Heinse oder Wackenroder von kontrapunktischen Strukturen die Rede, von einem kunstvollen Geflecht ineinander verschlungener Stimmen, sondern immer von der ,Gewalt‘ langsam fortschreitender Akkordgänge, vom „Zusammenschmelzen und Verfließen der reinen Töne“,396 das durchaus mit jenem feuchten ,Urnebel‘ assoziiert werden kann, der nach Heinses Darlegung in Ardinghello alles Lebende aus sich hervor392 393 394 395 396 90 Noch Heinrich Besseler knüpft an die von Herder und Heinse etablierte Metaphorik an, wenn er das entscheidende „Merkmal der Musik von etwa 1450 bis 1600“ – auch des „Palestrinastil[s]“ – als „Klangstrom“ bezeichnet, im Gegensatz zur architektonisch-gestalthaften Disposition späterer Korrespondenzmelodik als einer „Pfeilerkette mit Bögen“ (Singstil und Instrumentalstil in der europäischen Musik, in: Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongreß Bamberg 1953, hrsg. von Wilfried Brennecke u. a., Kassel und Basel 1954, S. 223–240, hier S. 227, 238). Wilhelm Heinrich Wackenroder: Von den verschiedenen Gattungen in jeder Kunst, und insbesondre von verschiedenen Arten der Kirchenmusik, in: Phantasien über die Kunst, für Freunde der Kunst, hrsg. von Ludwig Tieck, Hamburg 1799. Zitiert nach dem Wiederabdruck in: Wilhelm Heinrich Wackenroder: Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 1: Werke, S. 209–213, hier S. 212 f. Siehe unten, S. 174. Johann Friedrich Reichardt: Musikalisches Kunstmagazin, Bd. 2, S. 55. Wilhelm Heinse: Hildegard von Hohenthal, S. 15. brachte.397 Gerade durch das völlig überdehnte Tempo, mit dem die A-cappella-Musik der Renaissance um 1800 vorgetragen wurde, resultierend aus der falschen Annahme, die Zeitwerte modaler Notation seien wie diejenige der modernen Notenschrift aufzufassen,398 zerrannen etwa die Werke Palestrinas in einem elementaren ,Klangmeer’, das buchstäblich der Zeit enthoben schien. „Dieß [der ,zerschmelzende Eindruck‘ auf den Zuhörer] wird bewirkt [...] auch dadurch, daß meistens bloß die Länge und Kürze der Sylben, und der Sinn der Worte den Takt ausmacht; oder vielmehr, daß man das, was wir Takt nennen, fast gar nicht merkt.“399 Wo aber das Maß des Taktes abhanden kommt, sich im ,reinen Klang‘ verliert, kann auch keine Form entstehen, zumindest nicht im Sinne dessen, was Schiller als ,Gestalt‘ bezeichnet. „Es sind reine, unsichtbare Stimmen, die unmittelbar mit unserm Geist und Herzen reden“, so betont Herder schon 1793 in Cäcilia,400 um denselben Gedanken 1802 wieder aufzunehmen: „Es kommt wie vom Himmel [...], unsichtbar fliessen nach und nach Stimmen und Töne in unsre Seele, vom zartesten Tropfen bis zum vollesten Strom, an keinen Faden gereiht, als an den leisen, aber mächtigen, unzerreißbaren, der Empfindung.“401 Zwar diskutiert Herder hier vorderhand den Gegensatz zwischen dramatischer Musik und Kirchenmusik, doch steht dahinter zweifellos die Vorstellung einer vom Diktat des Auges befreiten, „jedweder körperlichen Referenz und plastischen Form“ enthobenen402 und somit dem Gefühl unmittelbar zugewandten Klangentfaltung: „Dramatische und Kirchenmusik sind von einander beinahe so unterschieden, wie Ohr und Auge.“403 Hatte Herder bereits mit seiner Theorie der Lyrik gegen Schillers Postulat Stellung bezogen, das rein Musikalische einer Dichtung, die Hervorbringung bloßer ,Zustände des Gemüts‘, müsse durch ein ,plastisch poetisches‘ Moment, durch ,für die Anschauung bestimmte Formen‘ austariert werden,404 so bekommt diese Diskussion mit Blick auf den ,stile antico‘ eine geschichtsphilosophische Dynamik von kaum zu überschätzender Tragweite. Daß die 397 398 399 400 401 402 403 404 Siehe oben, S. 88. Vgl. Winfried Kirsch: Zur Vortragsweise der Werke Palestrinas im 19. Jahrhundert, in: Aufführungs- und Bearbeitungspraxis der Werke Palestrinas vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, hrsg. von Friedrich Wilhelm Riedel, Sinzig 1997 (Kirchenmusikalische Studien 3), S. 89–114, bes. S. 104 f., sowie Werner Keil: Die Entdeckung Palestrinas in der Romantik, in: Romantik und Renaissance. Die Rezeption der italienischen Renaissance in der deutschen Romantik, hrsg. von Silvio Vietta, Stuttgart und Weimar 1994, S. 241–252, bes. S. 249–251. Wilhelm Heinse: Hildegard von Hohenthal, S. 14. Johann Gottfried Herder: Cäcilia, in: Sämmtliche Werke, Bd. 16, S. 265. Johann Gottfried Herder: Adrastea (III. Band, 2. Stück), in: Sämmtliche Werke, Bd. 23, S. 560. Wilhelm Seidel: Absolute Musik und Kunstreligion um 1800, S. 94. Johann Gottfried Herder: Cäcilia, in: Sämmtliche Werke, Bd. 16, S. 265. Siehe oben, S. 74. 91 Kirchenmusik als ‚reinste‘ Form von Musik überhaupt aufzufassen sei, liegt für Herder in ihrer völligen Unanschaulichkeit begründet, darin also, daß sie einzig und allein dem ‚unzerreißbaren Faden der Empfindung‘ folgt, an dem das Gemüt zugleich über die Beschränkungen der sichtbaren Welt hinausgeleitet wird. Aus diesen ästhetischen Prämissen formiert sich bei E. T. A. Hoffmann der zentrale Gedanke, daß die in der Antike vorherrschende Tendenz zur „Verleiblichung“ das Ideal des Plastischen aufgerichtet habe, was die Musik „rein rhythmisch“ werden ließ, wie umgekehrt im Christentum alles Körperliche hinter das Geistige zurückgewichen und dementsprechend die Musik an die Stelle der Plastik getreten sei – und mit ihr der „Akkord, der [...] erst im Christentum zum Leben erwachte“.405 „Keine Kunst geht so rein aus der innern Vergeistigung des Menschen hervor, keine Kunst bedarf so nur einzig reingeistiger, ätherischer Mittel, als die Musik. Die Ahnung des Höchsten und Heiligsten, der geistigen Macht, die den Lebensfunken in der ganzen Natur entzündet, spricht sich hörbar aus im Ton, und so wird Musik, Gesang, der Ausdruck der höchsten Fülle des Daseins – Schöpferlob!“406 Man kann die von Hoffmann aufgestellte Antithese ,plastisch-musikalisch‘ mit Carl Dahlhaus in den historischen Kontext der ,Querelle des anciens et des modernes‘ einordnen,407 aber auch als letzte Konsequenz jener Emanzipation des Ohres vom Auge deuten, die mit Herders Viertem Kritischen Wäldchen ihren Anfang nimmt und im Endeffekt zugleich eine Befreiung des Klanges (Ton und Akkord) von der Form (Rhythmus) bewirkt. Das ‚Geistige‘, welches Hoffmann als Charakteristikum einer genuin christlichen Musik beschwört, transzendiert den Klang zwar ins Metaphysische, bleibt aber immer an die unmittelbare Sinnlichkeit akustischer Eindrücke gekoppelt: Die Seele muß – nach den oben zitierten Worten Wilhelm Heinses – erst im ,Strom‘ der Musik ,schwimmen‘ und ,untertauchen‘, um dann ,mit entzückten Blicken in den heitern Aether des unendlichen Himmels‘ zu schauen.408 Welch weitreichende Konsequenzen sich aus dem Primat des Ohres innerhalb der Sinneshierarchie ergaben, kann kaum deutlicher gesagt werden als im ersten Absatz der Hildegard von Hohenthal, einem Gründungsdokument romantischer Nachtmystik, wie sie später bei Novalis und Brentano, vor allem aber in Richard Wagners Tristan und Isolde zur Vollendung gelangen sollte:409 405 406 407 408 409 92 E. T. A. Hoffmann: Alte und neue Kirchenmusik, in: Allgemeine Musikalische Zeitung 16 (1814). Zitiert nach dem Wiederabdruck in: E. T. A. Hoffmann: Schriften zur Musik. Aufsätze und Rezensionen, hrsg. von Friedrich Schnapp, München 1977, S. 209–235, hier S. 213, 215. Ebd., S. 212. Vgl. Carl Dahlhaus: Die Idee der absoluten Musik, S. 47–61. Siehe oben, S. 89. Vgl. hierzu das Kapitel „Welt im sterbenden Licht – ,Tristan‘ und der Mythos der Nacht“ in: Dieter Borchmeyer: Das Theater Richard Wagners. Idee – Dichtung – Wirkung, Stuttgart 1982, S. 261–287. „,Die Sonne löscht alle Freuden der Nacht aus! wie die schönen Sterne, so die süßen Melodien und Harmonien der Phantasie, und die stärksten Gefühle der Vergangenheit und Zukunft. Die Nacht hat etwas Zauberisches, was kein Tag hat; so etwas Grenzenloses, Inniges, Seliges. Das Mechanische der Zeitlichkeit, das einen spannt und festhält, weicht so sanft zurück, und man schwimmt und schwebt, ohne Anstoß, auf Momente im ewigen Leben.‘ Mit diesen Worten erhob sich Lockmann von seinem Lager, und sprang aus dem Bette. Sein Wesen war noch Widerhall der Musik zur Oper Achill in Skyros, von welcher er die Nacht den Plan geträumt, und wachend gegen Morgen ausempfunden hatte.“410 Nicht nur das emphatische „Und es ward Licht“ der biblischen Schöpfungsgeschichte (Gen 1,3) wird hier subversiv ins Gegenteil verkehrt,411 sondern auch der Sonne als dem ikonographischen Symbol der Aufklärung eine scharfe Absage erteilt. Wie provokativ dieser Romanbeginn 1795 wirken mußte, kann man sich durch die Überlegung vergegenwärtigen, daß Daniel Nikolaus Chodowiecki gerade vier Jahre zuvor in seinem berühmten Kupferstich Aufklärung den Sieg der Vernunft ins Bild einer aufgehenden Sonne gebracht hatte – jener Sonne, die nun bei Heinse der Vorwurf trifft, ,alle Freuden der Nacht‘ auszulöschen. Daniel Nikolaus Chodowiecki: Aufklärung (1791), Ausschnitt 410 411 Wilhelm Heinse: Hildegard von Hohenthal, S. 9. Vgl. Charis Goer: Töne, Tyrannen und Titanen, S. 141. 93 Klingt im ersten Satz der Hildegard von Hohenthal bereits eine unterschwellige „Vermengung von Musik und Sexualität“ an,412 die den ganzen Roman prägen wird und Herder dazu veranlaßte, Heinse spöttisch als „musikalische[n] Faunus“ zu bezeichnen,413 so wird auch deutlich, daß Auge und Ohr im Verhältnis gegenseitiger Feindschaft zueinander stehen. Wo visuelle Eindrücke ihre Herrschaft über den Menschen behaupten, schwindet dessen Sensibilität für Töne und Klänge, wie umgekehrt das ‚Zauberische‘ nächtlichen Dunkels die musikalische Empfindungsfähigkeit stimuliert. Diese Denkfigur tritt in der Hildgard von Hohenthal jedoch keineswegs zum ersten Mal auf, sondern bereits 1769 in Herders Viertem Kritischen Wäldchen: „Der Blindgebohrne hat ein ungleich tieferes Gefühl für die ersten Momente des Wohllauts, als der zerstreute Sehende, den tausend äußere Flächenbilder von seinem innern Sinn des Tongefühls abrufen. Jener ist von diesem weggewandt; natürlich und ewig also in der ungestörten Stille, die wir uns in einer Sommernacht erschleichen, um den Wohllaut der Laute oder einer Bendaschen Geige Grundauf zu fühlen. Er, ewig in dieser Stille, so ganz in sein inners fühlendes Ich versammelt, und ohne Unsinn zu sagen, ganz Ohr – was fühlet der Unzerstreuete nicht in dem mächtigen Wohllaut Eines Tons? [...] Er fühlet vielleicht in einem einfachen Antone [sic!] unmittelbar, der ihn bis auf den Grund erschüttert und in Entzückung aus sich reißet, Millionenmal mehr, als wir in der bunten Verwirrung eines ganzen Stücks.“414 Wenn Herder hier die ,Sommernacht‘ als ideale Sphäre für musikalischen ,Wohllaut‘ etabliert, weil sie den Menschen ,ganz Ohr‘ werden läßt und sein inneres ‚Tongefühl‘ von der störenden Konkurrenz durch das Auge befreit, so ist damit der provokatorische Beginn von Heinses Roman vorgezeichnet, deutlicher noch in jenem Stoßseufzer, mit dem Herder beklagt, daß die vom Gesichtssinn dominierte Kultur der Gegenwart den Menschen ‚zerstreut‘ und ihn bei zunehmender Anhäufung toten Wissens der Fähigkeit beraubt habe, seine Existenz auf das eigene Innere zu fokussieren: „Heilige Nacht, Mutter der Götter und Menschen, komme über uns, uns zu erquicken und zu sammeln. Non multa, sed multum.“415 Doch während Herder diesbezüglich nur von der Rezeption handelt, überträgt Heinse dasselbe Phänomen auf die Tätigkeit – oder besser: auf die Inspiration – des Komponisten. Nicht am Tag, sondern in der Nacht, nicht im Wachen, sondern im Traum geht Lockmann der Plan zu seiner Oper Achill in Skyros auf, wird er zum ‚Widerhall‘ einer Musik, die offenbar das Sonnenlicht scheut. 412 413 414 415 94 Werner Keil: Heinses Beitrag zur romantischen Musikästhetik, S. 143. Brief Johann Gottfried Herders an Johann Wilhelm Ludwig Gleim vom 8. Januar 1796, in: Johann Gottfried Herder: Briefe, Bd. 7, S. 207. Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 106 f. Johann Gottfried Herder: Plastik. Einige Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus Pygmalions bildendem Traume (1778), in: Sämmtliche Werke, Bd. 8, S. 61. Ein Vierteljahrhundert später kehrt diese Szene – wie Werner Keil bemerkte416 – in einem anderen Roman wieder, in E. T. A. Hoffmanns Lebensansichten des Katers Murr, doch ist es keine Oper, sondern bezeichnenderweise eine Messe, deren Musik sich dem Kapellmeister Johannes Kreisler, einem Nachfahren Lockmanns, im Traum offenbart: „Im Entzücken hoher Begeisterung erwachte Kreisler und schrieb das Agnus auf, das im seligen Traum ihm aufgegangen. – Und diesen Traum träumte Kreisler nun noch einmal [...], höher und höher schlugen die Wellen des Gesanges, als nun der Chor einfiel: ,Dona nobis pacem‘, er wollte untergehen in dem Meer von tausend seligen Wonnen, das ihn überströmte.“417 Wie die Musik gleich einer Vision im Traum empfangen wurde, so teilt sie sich dem Zuhörer mit: Wackenroder läßt seinen literarischen Doppelgänger Joseph Berglinger erzählen, daß er nach dem Erklingen einer Symphonie „in finsterer Stille noch lange horchend da sitze“, denn ihm sei, als habe er ein „Traumgesicht gehabt von allen mannigfaltigen menschlichen Affekten, wie sie, gestaltlos, zu eigner Lust, einen seltsamen [...] Tanz zusammen feyern“.418 Schon Herder nennt die früheste Kindheit jedes Menschen – und wohl der Menschheit insgesamt419 – nicht zufällig einen „Traum“, in dem „die Seele mit allen Kräften“ wirkt und dasjenige, „was sie erfaßet, scharf, und bis zur innersten Einverleibung in ihr Ich“ zusammenzieht.420 Reflexion, Vernunft und Bewußtsein führen unwiderruflich zum Erwachen aus diesem vorrationalen Zustand eines zwar dunklen, aber desto innigeren Selbstgefühls,421 das nur dann, „wenn wir am tiefsten in uns wohnen“, teilweise zurückerobert werden kann, in seltenen Momenten, die sich „durch leichtsinnige Zerstreuungen“ allzu schnell wieder verflüchtigen.422 Was den Menschen aber ,zerstreut‘, ist für Herder das Auge, weshalb der auf Gehör und Tastsinn angewiesene Blinde den unbewußten, „mit Nacht bedeckt[en]“ Tiefen seiner Seele und damit dem verlorenen Traum zwangsläufig näher zu kommen vermag.423 416 417 418 419 420 421 422 423 Vgl. Werner Keil: Heinses Beitrag zur romantischen Musikästhetik, S. 153 f. E. T. A. Hoffmann: Lebensansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern (1819–1821), in: Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Textrevision und Anmerkungen von Hans-Joachim Kruse, Berlin und Weimar 1994, Bd. 6, S. 303. Wilhelm Heinrich Wackenroder: Das eigenthümliche innere Wesen der Tonkunst, S. 222. Es gehört zu den konstanten Denkfiguren bei Herder, daß sich die Entwicklungsgeschichte der Menschheit in den Lebensaltern jedes Individuums spiegelt; vgl. Ulrike Zeuch: Umkehr der Sinneshierarchie, S. 300: „Um die Vorbewußtheit des anfänglichen Reichtums zu unterstreichen, grenzt Herder das Strömen der Vorstellungen auf bestimmte Fälle ein: im Traum, im Kind, bei den Griechen an der Wiege der Menschheit.“ Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 31. An anderer Stelle schreibt Herder über die „dunkeln Kräfte und Reize [...] auf [...] subalternem Standort“ der Seele, der „Grad ihrer Dunkelheit“ sei „Güte und Weisheit“ (Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele. Bemerkungen und Träume, in: Sämmtliche Schriften, Bd. 8, S. 185). Johann Gottfried Herder: Viertes Kritisches Wäldchen, in: Sämmtliche Werke, Bd. 4, S. 31. Johann Gottfried Herder: Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele. Bemerkungen und Träume, in: Sämmtliche Schriften, Bd. 8, S. 185; vgl. Ulrike Zeuch: Umkehr der Sinneshierarchie, S. 268, 271: „Der Nacht des Blinden korrespondiert der Traum [...]; die Entfaltung der Seele in einzelne Modifikationen bis hin 95 Eine nochmalige Radikalisierung der bei Herder angedeuteten Überlegenheit des Blinden hinsichtlich musikalischer Wahrnehmung und Gefühlstiefe findet sich in der elften der 1804 erschienenen Nachtwachen des mysteriösen Bonaventura.424 Berichtet wird darin von einem blindgeborenen Knaben, der mit seinem Schicksal versöhnt wird, als er den „heilige[n] Boden“ der Musik betritt.425 Er läßt sich von den Liedern eines gleichaltrigen Mädchens namens Maria, das neben ihm als Pflegekind aufgezogen wird, bezaubern, wissend, daß seine Mutter ein Gelübde abgelegt hat, eben jenes Mädchen „dem Himmel zu weihen“, also ins Kloster zu bringen, wenn er jemals das Augenlicht erlangen sollte.426 „Fast mit Gewalt“ muß man ihn daher „dem Arzte entgegenführen“, dessen Operation tatsächlich von Erfolg gekrönt ist.427 Der Knabe erblickt zum ersten Mal einen Sonnenaufgang – doch das „weinende Auge der Mutter“ kündet zugleich davon, daß er Maria und ihren Gesang im selben Moment unwiderruflich verliert.428 Seinem „dunkeln Kerker“, der von Musik erfüllt war, entronnen, bleibt ihm am Ende doch nur ein verzweifelter Wunsch: „O Nacht, Nacht, kehre zurück! Ich ertrage all das Licht und die Liebe nicht länger!“429 Der „Konflikt zwischen Ohr und Auge“ – so die Lesart von Peter Utz430 – wird hier auf eine Weise inszeniert, die Musik und Sonnenlicht gegeneinander ausspielt, wie es zuvor ganz ähnlich bei Herder und Heinse der Fall war, aber auch bei Wackenroder, der den ergriffenen Hörer Joseph Berglinger nicht von ungefähr in der ,finsteren Stille‘ eines unbeleuchteten Konzertsaals über sein ,Traumgesicht‘ nachsinnen ließ. Das Ohr, der gestaltlose Ozean verfließender Töne und Harmonien, die Nacht und das Unbewußte des Traumes431 – sie hängen im romantischen Denken zusammen wie die Plastizität von Rhythmus und Form mit Auge, Tag, Helligkeit und Rationalität. „Das Reich des Romantischen“, so Jean Paul 1825 in der Kleinen Nachschule zur ästhetischen Vorschule, „teilt sich eigentlich in das Morgenreich des Auges und in das Abendreich des Ohrs und gleicht darin 424 425 426 427 428 429 430 431 96 zur Vernunft sieht Herder, obwohl er sie [...] für notwendig hält, doch als Verfälschung an. Eigentlich soll der Mensch ein träumendes Kind bleiben.“ Erst 1987 gelang es Ruth Haag dank eines Quellenfundes, das Pseudonym aufzulösen und Ernst August Friedrich Klingemann (1777–1831) als Autor zu identifizieren; zuvor waren von der Literaturwissenschaft unter anderem die Namen Schelling, Schlegel, E. T. A. Hoffmann und Brentano ins Spiel gebracht worden (vgl. Wolfgang Paulsen: Nachwort, in: Bonaventura [Ernst August Friedrich Klingemann]: Nachtwachen, hrsg. von Wolfgang Paulsen, Stuttgart 2003 [Universal-Bibliothek 8926], S. 167–186). Bonaventura [Ernst August Friedrich Klingemann]: Nachtwachen, in: Journal von neuen deutschen OriginalRomanen 3 (1804). Neuausgabe Stuttgart 2003 (siehe Anm. 425), S. 95. Ebd., S. 96. Ebd. Ebd., S. 98. Ebd., S. 95, 98. Peter Utz: Das Auge und das Ohr im Text, S. 179. Zum Meer als Traumsymbol und Sinnbild des Unbewußten vgl. Sibylle Selbmann: Mythos Wasser, S. 101– 116. seinem Verwandten, dem Traum.“432 Es ist das Verdienst Johann Gottfried Herders, das ,Abendreich des Ohrs‘ für die deutsche Musikästhetik entdeckt und gegen Autoren wie Schiller und Kant verteidigt zu haben. Vieles von dem, was er in seinen Schriften anlegte, wurde bei Wackenroder, Tieck, Heinse und Hoffmann weitergedacht, zum Teil auch radikalisiert und zugespitzt. Doch um ermessen zu können, wie zukunftsweisend Herders Ideen und wie folgenreich ihre Konsequenzen waren, soll nun der Versuch gemacht werden, sie direkt mit einer noch späteren Musikphilosophie in Beziehung zu setzen, deren Spuren wiederum bis in die Moderne reichen: der Musikphilosophie Richard Wagners. 432 Jean Paul: Kleine Nachschule zur ästhetischen Vorschule (1825), in: ders.: Vorschule der Ästhetik. Kleine Nachschule zur ästhetischen Vorschule. Studienausgabe, hrsg. und kommentiert von Norbert Miller, München 21974, S. 457–514, hier S. 467. 97 98