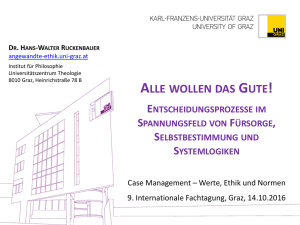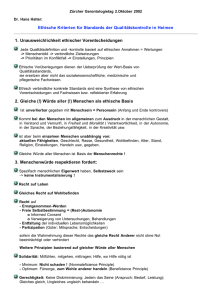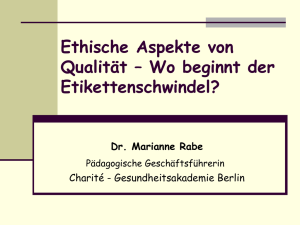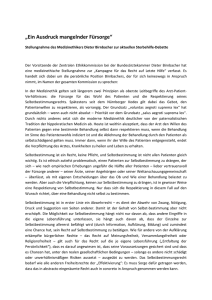Ethik in der Gerontopsychiatrie
Werbung
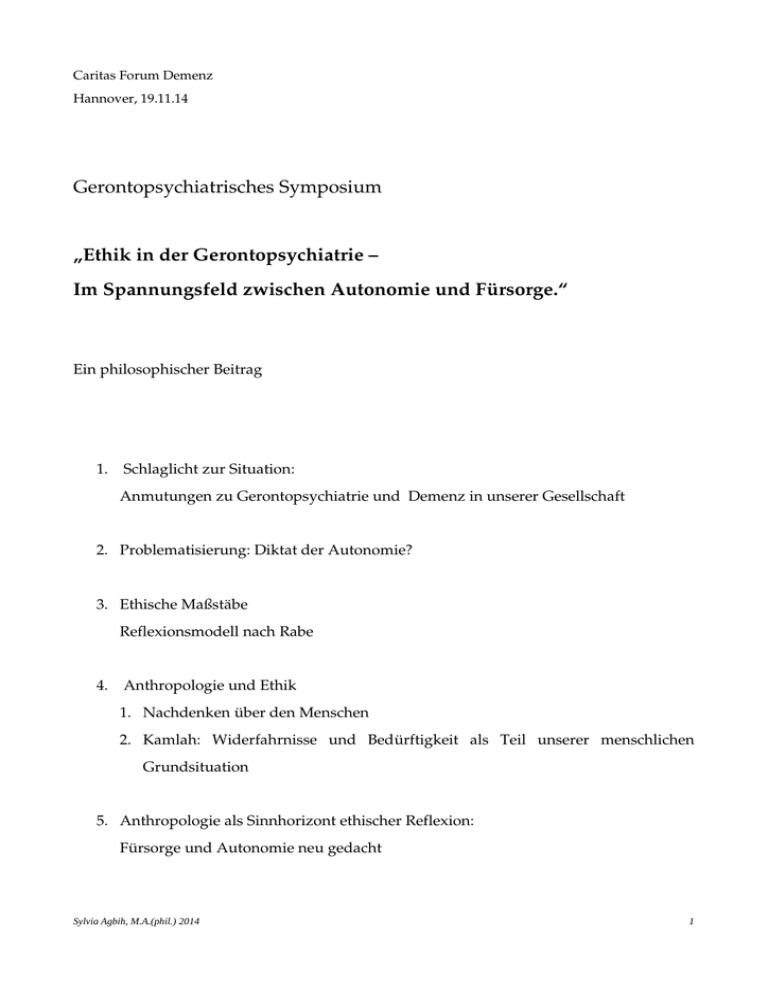
Caritas Forum Demenz Hannover, 19.11.14 Gerontopsychiatrisches Symposium „Ethik in der Gerontopsychiatrie – Im Spannungsfeld zwischen Autonomie und Fürsorge.“ Ein philosophischer Beitrag 1. Schlaglicht zur Situation: Anmutungen zu Gerontopsychiatrie und Demenz in unserer Gesellschaft 2. Problematisierung: Diktat der Autonomie? 3. Ethische Maßstäbe Reflexionsmodell nach Rabe 4. Anthropologie und Ethik 1. Nachdenken über den Menschen 2. Kamlah: Widerfahrnisse und Bedürftigkeit als Teil unserer menschlichen Grundsituation 5. Anthropologie als Sinnhorizont ethischer Reflexion: Fürsorge und Autonomie neu gedacht Sylvia Agbih, M.A.(phil.) 2014 1 1. Situation „Alzheimer ist eine Krankheit, die, wie jeder bedeutende Gegenstand, auch Aussagen über anderes als nur über sich selbst macht. Menschliche Eigenschaften und gesell­ schaftliche Befindlichkeiten spiegeln sich in dieser Krankheit wie in einem Vergröße­ rungsglas.“1 So Arno Geiger in seinem Werk „Der alte König in seinem Exil.“, in dem er die Demenzer­ krankung seines Vaters beschreibt. Welche Eigenschaften und Befindlichkeiten werden uns im Spiegel der Demenz gezeigt? Arno Geiger fähr fort: „Für uns alle ist die Welt verwirrend, und wenn man es nüchtern betrachtet, besteht der Unterschied zwischen einem Gesunden und einem Kranken vor allem im Ausmaß der Fähigkeit, das Verwirrende an der Oberfläche zu kaschieren. Darunter tobt das Chaos.“2 Der Spiegel zeigt uns unseren eigenen Zustand der Unsicherheit. Genau hier liegt wohl das angsteinflößende Potential psychischer Erkankungen überhaupt, die, wie mir scheint, trotz mannigfacher Bemühungen, längst nicht „entstigmatisiert“ sind. Sie berühren unsere eigene Unsicherheit und Angst, denn im Grunde wissen wir, dass die Trennlinie zwischen gesund und krank nicht scharf ist, sondern fließend; auch im als „gesund“ Erachteten rin­ gen wir um Entwirrung, um Verstehen, Orientierung, Sicherheit. Dieses Ringen beschreibt Geiger folgendermaßen: „Gleichzeitig ist Alzheimer ein Sinnbild für den Zustand unserer Gesellschaft. Der Überblick ist verlorengegangen, das verfügbare Wissen nicht mehr überschaubar, pau­ senlose Neuerungen erzeugen Orientierungsprobleme und Zukunftsängste.“3 Das Verstehen der Welt wird nicht leichter in unserer Zeit. Und zugleich leben wir in einer Gesellschaft, die vor allem kognitive Leistung sehr hoch bewertet. Der Mensch verdient sich Anerkennung in starkem Maße als denkender, rationaler, bewusster, aktiver, erfolg­ reich gestaltender, selbstbestimmter und natürlich am besten junger oder zumindest bis ins Alter jung gebliebener und „fitter“. In der Gerontopsychiatrie gesellen sich zum Stig­ ma psychischer Erkrankungen also noch unsere Probleme im Umgang mit Alter, Gebrech­ lichkeit, Bedürftigkeit und Abhängigkeit. 1 2 3 Geiger, Arno. Der alte König in seinem Exil. München 2012, S. 57 Geiger, Arno. Der alte König in seinem Exil. München 2012, S. 57/58 Geiger, Arno. Der alte König in seinem Exil. München 2012, S. 58 Sylvia Agbih, M.A.(phil.) 2014 2 Im Alltag finden sich gepaart mit dem Votum „am wichtigsten ist Gesundheit“ oder „vor allem Gesundheit“ immer wieder Aussagen wie „bloß nicht von anderen abhängig wer­ den“, bloß nicht unsere Selbstbestimmung verlieren! Wir befinden uns in der Gerontopsychiatrie also in einem dunklen Feld, in dem die Übel lauern, vor denen wir uns am meisten fürchten: Verwirrtheit, Unberechenbarkeit, Verfall, Gebrechen, Alter, Hässlichkeit, Verlust von Leistungsfähigkeit und Selbstbestim­ mung. Und im Verlust der Erinnerung, der Verlust unserer Identität. Und dennoch sind so viele hier, sitzen Sie hier! Ganz selbstbestimmt – vermutlich. Nehmen wir Martin Seels Verständnis von „Selbstbestimmung“ , nämlich „Selbstbestimmung heißt also, sich im Licht von Vergangenheit und Gegenwart auf die Zukunft einstellen zu können.“4 dann heißt das, dass wir uns hier gemeinsam auf die Zukunft einstellen, auf zukünftiges Handeln vorbereiten wollen. Wir tun dies, indem wir uns ansehen, was wir in unserem Erfahrungsgepäck mitbringen – an gelungenen ebenso wie an gescheiterten Versuchen mit den Herausforderungen umzugehen, die uns gerontopsychiatrische Erkankungen auferle­ gen. Daß Sie dafür alle hier sind, ist eine Ermutigung und ich freue mich, dass ich dabei sein darf und danke an dieser Stelle für die Einladung. Ich hoffe, mein Beitrag kann ein konstruktiver Teil der gemeinsamen Reflexion sein. Damit sind wir auch schon bei der Ethik: Ethik als Reflexion von Moral ist Praxis, auch indem wir im ethischen Denken Erfah­ rungen reflektieren, um für zukünftige Entscheidungen und Handlungen Orientierung zu gewinnen. 2. Problematisierung: Diktat der Autonomie? Einer der wichtigsten Orientierungsmaßstäbe unserer Zeit ist die Autonomie, die Selbstbestimmung, geworden. Gerade auch in der medizin­ und pflegeethischen Diskussi­ on steht sie an herausragender Stelle. Nachdem wir lange gegen ärztlichen Paternalismus und pflegerischen Maternalismus gekämpft haben – also gegen die zwar wohlmeinende, aber Selbstbestimmung missachtende Haltung eines Vaters bzw. einer Mutter, die genau und am besten wissen, was für die Kinder gut ist (doctor knows best) – beginnt uns eine 4 Seel, Martin: Grenzfälle der Selbstbestimmung. Über die Teilnahme am Leben und Sterben anderer. S. 117. IN: Seel, M.: Paradoxien der Erfüllung. Philosophische Essays. Frankfurt am Main 2006, S. 115-129 Sylvia Agbih, M.A.(phil.) 2014 3 auf den höchsten Sockel erhobene Autonomie an einigen Stellen mulmig zu werden. Zu Recht und aus mehreren Gründen (von denen hier nur einige genannt werden): ­ Ein kranker Mensch befindet sich in einer Ausnahmesituation, oft in einer ernsten Krise. Kann in einer solchen Situation, die oft mit Not, Angst, Schreck, Schmerzen einhergeht ohne Weiteres eine „freie“ Entscheidung getroffen werden? ­ Ist ein Patient autonom im Sinne eines Kunden? ­ Weiß ich als Kranker was ich will? (Das ist schon in gesunden Tagen schwierig!) ­ Ist Autonomie = autonome Entscheidung??!! Wenn Autonomie als Entscheidungsfähig­ keit, verstanden wird, also als überprüfbare Kompetenz (ähnlich wie „Zurechnungsfähig­ keit“), dann haben Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen in den meisten Fällen per Definition keine Autonomie mehr. Ebenso Menschen im Koma oder anderen Zuständen der Bewusstseinsbeeinträchtigung. ­ Können, dürfen, sollen oder müssen wir „autonome“ Entscheidungen, wie z.B. Ablehnen von Essen oder Medikamenten, mit dem Verweis auf „der Patient will es ja so“ akzeptie­ ren, hinnehmen, es dabei belassen? Entwickelt sich hier nicht eine Art Gleichgültigkeit bis hin zur Vernachlässigung? ­ Müssen wir immer „autonom“ sein? Werden Kranke da nicht manchmal allein gelassen, im zurückgeworfen Sein auf die eigene autonome Entscheidung? Im Recht auf Selbstbe­ stimmung liegt auch eine hohe Anforderung, die uns nicht nur im Zustand von Krankheit manchmal überfordert. Unbenommen, das Recht auf Selbstbestimmung ist wesentlich für unsere Men­ schenwürde und soll unbedingt gewahrt werden. Aber wie genau ist Autonomie zu ver­ stehen? Und: Steht sie für sich allein? An dieser Stelle ein kurzer Ausflug zu ethischen Prinzipien in den Heilberufen: 3. Ethische Maßstäbe Die deutsche Pflegeethikerin Marianne Rabe hat in ihrem Reflexionsmodell sechs formale Prinzipien als „kritische Grundorientierung“ 5 für die Pflegepraxis und die Praxis der Heilberufe allgemein gewählt. Formale Prinzipien sind nicht inhaltlich festgelegt, sondern 5 Rabe, Marianne: Ethik in der Pflegeausbildung. Bern 2009, S. 125 Sylvia Agbih, M.A.(phil.) 2014 4 sollen helfen, die Praxis zu reflektieren. Dazu müssen sie in jeder Situation erneut konkret auf die aktuelle Situation bezogen werden; sie liefern kein allgemeines „Rezept“. Im Mit­ telpunkt des Reflexionsmodells steht die Würde als übergeordnetes und unbestimmtestes Prinzip, auf das sich Autonomie, Fürsorge, Verantwortung, Gerechtigkeit und Dialog beziehen. Sie stellen gewissermaßen eine beginnende Konkretisierung und Ausdifferenzierung des Würdebegriffs dar und stehen miteinander in enger Verbindung. Es ist also für jede Ent­ scheidung, die uns ein ethisches Abwägen abverlangt, wichtig, diese Prinzipien in ihrem wesentlichen Zusammenhang zu betrachten. Autonomie steht hier nicht als alleinige oder abgesonderte, übergeordnete Handlungsorientierung. Insbesondere die Fürsorge war (und ist zum Teil noch) ein umstrittenes Prinzip. Der Begriff erinnert an die dienende Aufopferungsbereitschaft, die eine sich professionali­ sierende Pflege überwinden will und muss. Zudem tappt die Fürsorge leicht in die mater­ nalistische Falle: die „Superschwester“, die ihre Patienten bemuttert und dabei leider auch bevormundet... Aber müssen wir das Kind mit dem Badewasser ausschütten? Rabe hat sich ent­ schieden, das Prinzip der Fürsorge explizit mit auf zu nehmen, denn die Balance zwischen Fürsorge und Autonomie ist ein immer wiederkehrendes Thema im Pflegealltag und in der Begleitung und Versorgung Kranker. Zwei umstrittene Prinzipien. Warum brauchen wir sie in der Pflege und Therapie und vielleicht besonders im Feld der Gerontopsychiatrie? Wohl, weil hier schon krank­ heitsbedingt die Möglichkeiten in Würde das eigene Leben zu führen in starkem Maße be­ droht sind. Für die begleitenden Angehörigen wie auch die Fachkräfte, stellt sich immer wieder die schwierige Forderung, die Betroffenen genug zu schützen – auch vor sich selbst – und zugleich möglichst viel den Kranken selber entscheiden und handeln zu las­ sen. Es geht um unser Entscheiden und Handeln als Menschen, lassen Sie uns also, um Orientierung zu finden, zunächst den Menschen betrachten – uns selber. Sylvia Agbih, M.A.(phil.) 2014 5 5. Anthropologie und Ehtik Mit Rabe, Rehbock und einigen anderen, plädiere ich dafür, Ethik – nach Kant die Beschäf­ tigung mit der Frage „Was sollen wir tun?“ ­ zu verankern in der Anthropologie, also im Nachdenken über die Frage (Kant) „Was ist der Mensch?“. Es ist schwer, wenn nicht unmöglich, zu beschreiben, wer oder was wir als Men­ schen sind. Wir können diese Frage nur aus der Vollzugsperspektive stellen und beant­ worten, denn wir stellen sie an uns selber; wir sind Fragende, Betroffene und Antworten­ de. Zugleich ist es unmöglich, sich selber im Ganzen zu sehen. Das bedeutet, dass wir letztlich keine völlig „objektive“, keine ganz neutrale und keine umfassende Antwort ge­ ben können. Diese Grenzen unseres Erkenntnisvermögens gilt es mit zu bedenken, wenn wir uns in ethischen Diskussionen über unser Entscheiden und Handeln Rechenschaft ab­ legen. Auch wenn wir letztlich nicht genau sagen und schon gar nicht festlegen können, wer oder was wir sind, so finden wir doch unhintergehbare Grundbedingungen unseres Da­ seins vor, wenn wir über unser Menschsein nachdenken: Endlichkeit, Geschichtlichkeit, Sprachlichkeit, Gemeinschaft, Bedürftigkeit und Leiblichkeit sind solche Grundbedingun­ gen. Sie gehören zu unserem Menschsein, zu unserer Grundsituation oder conditio humana. Es sind Bedingungen, die wir uns nicht aussuchen, sondern vorfinden. Unter diesen Be­ dingen leben alle Menschen. Der Philosoph Wilhelm Kamlah, hat eine dieser Grundbedingungen in den Mittel­ punkt seiner „Philosophischen Anthropologie“ gestellt: die Bedürftigkeit. Alle Menschen haben Bedürfnisse. Das ist eine jedermann zugängliche Erfahrung. Wir machen diese Er­ fahrung insbesondere durch Widerfahrnisse – die Dinge, die uns geschehen im Leben, die wir uns nicht aussuchen, die wir nicht bewusst herbeiführen, die wir erleiden. Sie treffen uns in unserer Bedürftigkeit. Kamlah meint hier mehr als nur „Bedürfnisse haben“, es geht ihm um das bedürftig sein, um unsere grundsätzliche Bedürftigkeit, in der wir immer auf andere verwiesen sind. Der Mensch ist zutiefst Gemeinschaftswesen und zugleich Indivi­ duum. Sylvia Agbih, M.A.(phil.) 2014 6 Die für jedermann zugängliche Erfahrung der Bedürftigkeit und Angewiesenheit, ist für Kamlah Ausgangspunkt seiner praktische Grundnorm, die uns als Menschen alle angeht. Er folgert aus seiner Beschreibung der menschlichen Verfassung eine praktische, ethische Grundnorm, also ein Prinzip, eine allgemein gültige Handlungsorientierung: „Beachte, daß die Anderen bedürftige Menschen sind wie du selbst und handle demgemäß!“6 Diese Orientierung, scheint mir eine, wenn nicht die wesentliche in unserem menschlichen Miteinander und sie ist insbesondere für jegliche Pflege­ und Betreuungsarbeit von zen­ tralster Bedeutung. Sie gilt nicht nur für den Pflegebedürftigen, sondern auch für die Pfle­ genden! Zudem eröffnet diese Reflexion auf unser Menschsein einen anderen Blick auf Autonomie und Fürsorge. Ethische Prinzipien können allgemein als Reflexionsbegriffe verstanden werden (Rabe, Rehbock). Das heißt, sie strukturieren unser Nachdenken. Die anthropolo­ gische Reflexion, also das Nachdenken über unsere menschliche Grundsituation, gibt uns, mit Rehbock gesagt, einen Sinnhorizont, oder eine Basis für unser Ringen mit ethisch schwierigen Entscheidungen. Im Kontext des Gesundheitswesens können wir die leiten­ den Orientierungen Fürsorge und Autonomie damit neu verstehen. 6. Fazit: Fürsorge und Autonomie – sorgen für die Autonomie Die Schwierigkeiten mit den beiden Prinzipien hat die Philosophin Theda Rehbock folgen­ dermaßen auf den Punkt gebracht, sie spricht von zwei Fehlschlüssen: Paternalistischer Fehlschluss: Solange der Patient krankheitsbedingt nicht entscheidungsfähig ist, ist er nicht autonom und wir dürfen oder sollen sogar fürsorglich sein Leben in die Hand nehmen. Autonomistischer Fehlschluß: Der Patient sagt, was er will – das ist zu befolgen, die Konsequenzen trägt er ja selber, das geht mich nichts an... 6 Kamlah, W.: Philosophische Anthropologie, 1972, S. 95 Sylvia Agbih, M.A.(phil.) 2014 7 Anders formuliert sind die beiden Gegenpole: > Autonomie ohne Fürsorge ­ kann zu Gleichgültigkeit und Vernachlässigung führen.7 (Bsp. „fitter Patient“) > Fürsorge ohne Achtung der Autonomie – führt zu Paternalismus (Bsp. bettlägeriger, kognitiv eingeschränkter Patient) Wir scheinen in einer Art Dilemma zwischen beidem. Machen wir uns unsere grundlegende Situation als Menschen, die bedürftig sind klar, dann zeigt sich aber, dass wir alle, zwar auf verschiedene Weise und in unterschiedlichem Maße, aber dennoch immer wieder Fürsorge brauchen um autonom sein zu können! Es geht also um das Sorgen für die Autonomie des Anderen. Rehbock weist darauf hin, dass etwas „selbst tun“ nicht unbedingt heißt es allein tun! Für das Verhältnis von Autonomie und Fürsorge stellt sie folgende Lösung und zugleich Forderung auf: „Erstens: Die unbedingte Achtung der Würde impliziert sowohl die Achtung der Auto­ nomie als auch die Verpflichtung zur Fürsorge.“ Zweitens: Wer die Autonomie anderer achten will, darf die Verpflichtung zur Fürsorge nicht aus den Augen verlieren. Drittens: Wer für andere sorgt, darf die Verpflichtung zur Achtung ihres Willens nicht außer acht lassen.“8 Fürsorge ist dabei zu denken als elementare Form personaler Beziehung, als eine Grund­ form menschlicher Praxis (so auch Heidegger). Es geht also nicht um Fürsorge oder Autonomie, sondern um Fürsorge UND Autonomie, diese Prinzipien sind zutiefst miteinander verbunden und ergänzen sich, auch wenn sie sich im Alltag manchmal zu widersprechen scheinen. Was uns in der konkreten Situation hilft ist dann die Frage: Was bedeutet Autonomie für genau diesen Menschen, in dieser Si­ tuation jetzt und hier? Wie kann ich für seine Autonomie und damit für seine Würde sor­ 7 8 Vgl. Rehbock, Personsein, 312-335 Rehbock, Theda: Personsein in Grenzsituationen. Zur Kritik der Ethik medizinischen Handelns. Paderborn 2005, S. 326 Sylvia Agbih, M.A.(phil.) 2014 8 gen? Was braucht er, was braucht sie jetzt? Und zwar als ganzer Mensch! Darüber hinaus sind ebenso die ethischen Prinzipien Verantwortung, Gerechtigkeit und Dialog mit zu be­ denken. In unseren fragmentierten Versorgungssystemen mit vielfältigen Akteuren erle­ ben wir aktuell gehäuft Probleme der Verantwortungsdiffusion und (Nicht­)Übernahme von Verantwortung. Eine – wie ich finde sehr schöne – Beschreibung dazu findet sich wiederum bei Martin Seel, in seinen Ausführungen zu Teilhabe und Teilnahme am Leben Anderer: Auf ganz unterschiedliche Weise nehmen wir in unserem eigenen Leben an dem Leben und Sterben anderer Menschen teil. ... Diese unterschiedlichen Formen der Teilnahme können zu unterschiedlichen Formen der Anteilnahme führen – wir sorgen uns um an­ dere, kümmern uns um sie, unterstützen sie, oder lassen sie in Ruhe, wo sie in Ruhe ge­ lassen werden wollen. ... Teilnahme am Leben anderer gilt einem Leben, wie diese an­ deren es aus ihrem eigenen Entwurf und ihrer eigenen Überlegung führen wollen. Sie gilt dem selbst bestimmten Leben des anderen. ... Anders steht es dort, wo die Person, an deren Leben wir teilnehmen, ihr eigenes Leben nicht führen kann – sei es noch nicht, wie bei kleinen Kindern, sei es vorübergehend nicht, wie bei schwer Kranken, sei es nicht mehr, wie im Stadium physischer und psychischer Hinfälligkeit. Hier bedeutet Teilnahme eine teilweise Übernahme der Leitung und Lenkung des Lebens anderer. Aber auch hier ist es das Bestreben der anderen, das die ethische Leitlinie abgibt: Es soll ihr Leben so gefördert und gestaltet werden, dass sie (wieder) in der Lage sein werden, es selbst zu führen, oder dass sie es so weit wie möglich so verbringen können, wie es ihrem eigenen Streben entspricht.9 Das ist in gewisse Weise natürlich leichter gesagt als getan. Wir kennen die Schwierigkei­ ten in der Umsetzung... Mit all unserem Wissen und Nachdenken, unseren Fachkenntnis­ sen und ethischen Überlegungen sind und bleiben wir alle bedürftig und begrenzt, auch die Helfenden. Das sollten und dürfen wir uns eingestehen. Ethik kann keine perfekten Entscheidungen garantieren, Widerfahrnisse und Scheitern bleiben. Zugleich gibt es im­ mer wieder auch kreative Ideen, gute Intuitionen, gelingende Interventionen. In jeder kon­ kreten Situation erneut abzuwägen und dadurch auch an unserer Haltung zu arbeiten, darum kommen wir nicht herum. Gemeinsame ethische Fallbesprechungen sind hier ein zentrales Instrument um zu guten, lebbaren Entscheidungen zu kommen – so gut wir eben können. Darin, im Scheitern wie im Gelingen, im Ringen und gemeinsamen Nachdenken und Bemühen, erleben wir uns als Menschen. 9 Seel, Martin: Grenzfälle der Selbstbestimmung. Über die Teilnahme am Leben und Sterben anderer. IN: Seel, M.: Paradoxien der Erfüllung. Philosophische Essays. Frankfurt am Main 2006, S. 115-129 Sylvia Agbih, M.A.(phil.) 2014 9 Zum Abschluss noch einmal der alte König, der uns so schlicht zu sagen vermag, was er braucht: Was ist Dir das Wichtigste im Leben, Papa? * Das weiß ich nicht. Ich habe schon vieles erlebt. Aber wichtig? Fällt Dir etwas ein? * Wichtig ist, dass man um Dich herum freundlich redet. Dann geht vieles. Und was magst Du weniger? * Wenn ich folgen muss. Ich mag es nicht, wenn man mich herumhetzt. Wer hetzt Dich herum? * Jetzt gerade niemand. Arno Geiger, Der alte König in seinem Exil Sylvia Agbih, M.A.(phil.) 2014 10