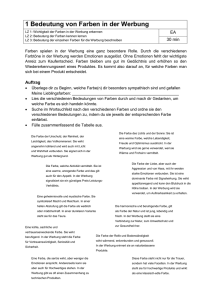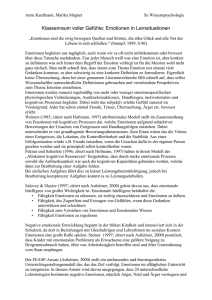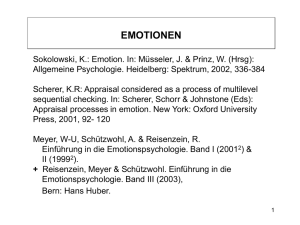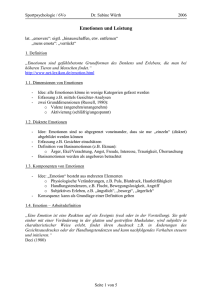Previewartikel - Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft
Werbung

■ Dokumente Juliane Kahl Erkenntnisse der Emotionspsychologie in der Musiktherapie Wahrheit ist emotional gefärbt. Dies ist der Grund, warum Emotionen aus den Wissenschaften lange Zeit verbannt wurden – sie störten die Analyse von Phänomenen und beeinträchtigten den philosophischen Erkenntnisgewinn. Emotionen stehen an der Schnittstelle zwischen Individuum und Umwelt, zwischen Mensch und Löwe genauso wie zwischen Mann und Frau. Sie regeln Begegnungen und bestimmen Gespräche, beeinflussen Motivationen und Handlungen und führen dennoch häufig ein Schattendasein in der Verdrängung. Die Arbeit an emotionalen Vorgängen ist essentieller Bestandteil von Psychotherapien; hierbei kommt der Musiktherapie eine besondere Rolle zu, da ihr Medium prädestiniert zu sein scheint, emotionale Vorgänge zu spiegeln. Musik kann Emotionen kodieren und auslösen, bannen oder verstärken. Die Verbindungen zwischen musikalischem Erleben und emotionalen Vorgängen werden seit einigen Jahren verstärkt von Neurowissenschaftlern untersucht. Die Emotionspsychologie versucht unabhängig davon, emotionale Prozesse zu erklären, bezieht aber in ihre Theorien kaum Erkenntnisse aus Musikpsychologie und Musiktherapie mit ein. Dabei könnte die Beachtung von Studien zum Musikempfinden zu einem besseren Verständnis von Emotionen führen (Wosch 2004). Umgekehrt wird auch in der Musiktherapie wenig von der emotionspsychologischen Theoriebildung wahrgenommen; Wosch verweist darauf, dass Überblickswerke zur Musiktherapie keine separaten Kapitel zu den Grundlagen von Emotionen beinhalten. Die folgenden Ausführungen sollen ein Anstoß sein, Erkenntnisse der Emotionsforschung in die musiktherapeutische Praxis zu integrieren. Was sind Emotionen? Je intensiver man sich mit dem Emotionsbegriff auseinandersetzt, desto schwieriger wird es, ihn zu fassen. Wenn man wüsste, was Emotionen sind, bräuchte man sie nicht mehr zu erforschen, denn eine »exakte Bestimmung würde voraussetzen, dass man das zu untersuchende Phänomen bereits in allen seinen Erscheinungsformen und Ausprägungen genau kennt.« (Otto et al. 2000, S. 1). Die emotionspsychologische Debatte hat, je nach Perspektive der Forschungsrichtung, unterschiedliche Aspekte in den Vordergrund gerückt, um das Phänomen »Emotion« präzise umreißen und definieren zu können. Dabei scheint es einfacher zu sein, konkrete © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2014, ISSN 0172–5505 126 Juliane Kahl Emotionen (wie Freude, Trauer, Angst, Wut) zu beschreiben, als eine stimmige Erklärung für die Kategorie »Emotion« zu formulieren. Auf biologischer Ebene werden Emotionen als »psychophysiologische Zustandsveränderungen« beschrieben, die durch äußere Reize (Sinnesempfindungen), innere Reize (Körperempfindungen) und kognitive Prozesse in Form von Bewertungen, Vorstellungen und Erwartungen ausgelöst werden können (Fröhlich 2005, S. 159). Die Rolle von Kognitionen muss hierbei in zweifacher Hinsicht betrachtet werden: Sie können die Sinnes- bzw. Körperempfindungen als Gedanken oder mentale Muster begleiten, darüber hinaus aber auch selbst alleinige Auslöser für Emotionen sein. Therapeutisch bedeutsam wird dies insbesondere dann, wenn die kognitiven Prozesse im Unbewussten wirken und Emotionen verursachen, deren Ursprung im Unklaren bleibt. Die Emotion selbst wird zunächst wahrgenommen als emotionale Erregung, die aus unterschiedlichsten autonomen physiologischen Veränderungen (nachweisbar in zentralnervöser, peripher-physiologischer, somatischer oder hormoneller Aktivität – vgl. Alpers et al. 2009, S. 413) bestehen kann, welche alle ein gemeinsames, evolutionär geprägtes Ziel haben: Handlungsbereitschaft herzustellen. Je nach Situation bedeutet das, Handlungen zu unterbrechen, zu verändern oder neu zu organisieren. Die Tatsache, dass es sich hierbei um »autonome« Veränderungen handelt, erklärt das subjektive Gefühl des Ausgeliefertseins gegenüber starken emotionalen Zuständen – den ursprünglichen Sinn dieses biologischen Programms zu verstehen kann aber helfen, unerwünschte emotionale Regungen therapeutisch zu bearbeiten. Emotionen sind nicht nur individuell erlebbar, sondern immer auch sozial wirksam, dieser Funktion dient der Emotionsausdruck, welcher sich unmittelbar in Mimik und Gestik und der Stimme niederschlägt. Bereits Darwin konnte 1872 zeigen, dass der Ausdruck von Emotionen sowohl instinktiv angelegt ist, als auch durch Erfahrung modifiziert werden kann. Ekman knüpfte an dessen Forschungen an und untersuchte in unterschiedlichen Kulturen, ob sich Emotionen aus der Mimik einer Person erkennen lassen. Als Ergebnis zahlreicher Studien postulierte er die Existenz der sieben universalen Basisemotionen Angst, Ärger, Ekel, Freude, Trauer, Überraschung und Verachtung. Diese zeigten sich kulturübergreifend in genetisch determinierten mimischen Ausdrucksmustern (Ekman 2010; Merten 2009). Die genauere Kenntnis des mimischen Ausdrucksverhaltens kann für den Musiktherapeuten eine zusätzliche Informationsebene sein, die allerdings im Kontext des jeweiligen therapeutischen Prozesses zu sehen ist. Beobachtete Diskrepanzen zwischen mimischem und musikalischem Ausdruck könnten in bestimmten Situationen kommuniziert und so therapeutisch wirksam gemacht werden. Für das Dekodieren subtilerer Nachrichten, also des minimalen Anflugs einer unwillkürlichen mimischen Regung, bedarf es allerdings aufmerksamer Mikroanalysen, die im therapeutischen Setting kaum zu leisten sind. Für die Musiktherapie sind insbesondere Erkenntnisse über den stimmlichen Ausdruck von Emotionen wertvoll. Auskunft über emotionale Botschaften geben © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2014, ISSN 0172–5505 Erkenntnisse der Emotionspsychologie in der Musiktherapie 127 hier vor allem die Grundfrequenz (Tonhöhe), Amplitude (Intensität der Stimme), Verteilung der Energie im Frequenzspekturm (Timbre), Lage der Formanten (Artikulation) und temporale Phänomene (Sprechgeschwindigkeit, Pausen). Die Erforschung akustischer Profile zur Charakterisierung bestimmter Emotionen erbrachte in verschiedenen Arbeiten relativ übereinstimmende Ergebnisse (Zentner & Scherer 1998). So weisen Freude und Ärger eine Erhöhung der Frequenz, der Intensität und der Energie im Hochfrequenzbereich sowie eine Zunahme der Sprechgeschwindigkeit auf; Trauer hingegen ist durch die Abnahme der Frequenz, Intensität, Energie im Hochfrequenzbereich und Artikulationsrate charakterisiert. Eine eindeutige Unterscheidung von emotionalen Kategorien lässt sich aber mit Hilfe der akustischen Parameter nicht zuverlässig vornehmen, vielmehr offenbaren die stimmlichen Merkmale eine Differenzierung verschiedener Erregungsniveaus. Kategorie oder Dimension? Die grundsätzliche Problematik, wie sich Emotionen voneinander abgrenzen und ordnen lassen, ist auch in aktuellen Theorien nicht allgemeingültig gelöst. Die erste Hemmschwelle bildet diesbezüglich die sprachliche Vermittlung: »Die Verlegenheit, über Gefühle zu sprechen, beginnt beim Wort.« (Schmitz zit. n. Hastedt 2005, S. 12). Wosch (2004) führt die weltweite Benennung von insgesamt 56 Emotionen auf. In der aktuellen Klassifizierungsdiskussion herrschen zwei Modelle vor, die versuchen Emotionen zu ordnen (Schmidt-Atzert 2009). Kategoriale Modelle fassen ähnliche Emotionen in Gruppen zusammen, die aber in ihrer Anzahl und der Auswahl der jeweiligen Emotionen variieren. Viele Autoren grenzen die Basisemotionen Furcht, Ekel, Ärger, Traurigkeit, Freude und Überraschung voneinander ab. Als Beurteilungsgrundlage dient hier neben der Einschätzung von semantischer Ähnlichkeit und der Differenzierung von Gefühlen im Alltag auch der mimische Ausdruck. Der Nachteil dieser Ansätze ist, dass jedwede Liste der ausgewählten Emotionen in Frage gestellt und durch andere Emotions-Begriffe ersetzt werden kann. Dimensionale Modelle gehen auf Wundt zurück und arbeiten mit wenigen Beschreibungsdimensionen, die eine Matrix ergeben, auf der jede Emotion in ihrer Nähe bzw. Distanz zu einer anderen ablesbar ist. Die wichtigsten gebräuchlichen Dimensionen sind Lust – Unlust (Valenz) und Erregung – Ruhe (Aktivierung). Die Emotionen Freude und Wut wären sich danach in der Dimension der Erregung relativ nahe, lägen aber in der Valenz weit voneinander entfernt. Verschiedentlich werden darüber hinaus auch die Dimensionen Lösung – Spannung und Unkontrollierbarkeit – Kontrolle verwendet (Schmidt-Atzert 2009; Alpers et al. 2009; Fröhlich 2005). Für psychotherapeutische Verfahren ist die Klassifizierungsproblematik bezüglich der Beziehung von Sprache und Emotion bedeutsam. Fiedler (2009, S. 731) bemerkt dazu: »Emotion ist nicht nur ereignisabhängig. Emotion kann vielmehr durch Denken und Sprache abgeschwächt und verstärkt werden. Diese Beobach© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2014, ISSN 0172–5505 128 Juliane Kahl tung ist entscheidend für die Psychotherapie, wenn in ihr emotionale Prozesse und emotionale Störungen beim Patienten stimuliert, gehemmt oder anderweitig verändert werden sollen.« Bezieht Musiktherapie die sprachliche Ebene ein, hat der Therapeut die Mehrdeutigkeit verschiedener Übersetzungsmöglichkeiten emotionalen Erlebens zu berücksichtigen: vom subjektiven Gefühl in Musik (bei aktiven Verfahren) oder von Musik in Gefühl (bei rezeptiven Methoden) und von dort jeweils zur sprachlichen Vermittlung des Erlebten. Wo sich Musik und Emotionen begegnen Die Verbindung von Musik und Emotion zeigt sich nicht nur im Ausdrucksverhalten, sondern bereits auf neurobiologischer Ebene. »Musik ist ein ideales Werkzeug zur Erforschung von Emotion, vor allem weil Musik in der Lage ist, starke Emotionen interindividuell konsistent zu evozieren.« Diese Erkenntnis des Geigers und Hirnforschers Stefan Koelsch (2007, S. 132) begründet ein wissenschaftliches Interesse an der Zusammenschau von Emotionen und Musik. In seinen Untersuchungen stellte Koelsch fest, dass beim Hören von Musik Aktivitätsänderungen in den Hirnregionen zu beobachten sind, die eine zentrale Bedeutung für die Entstehung und Verarbeitung von Emotionen haben, insbesondere in limbischen und paralimbischen Strukturen, wie der Amygdala (die Erinnerungen an emotionale Ereignisse steuert), dem Hippocampus, dem Gyrus parahippocampalis und der anterioren Insel. Die Begegnung von Musik und Emotionen in hirnphysiologischen Prozessen scheint somit eine Voraussetzung für ihre psychologische Wechselwirkung zu sein. Im Ausdruck von Emotionen ist ein musikalischer Parameter besonders hervorzuheben: die Tonhöhe. Sie gehört nach Levitin (2009, S. 19) zu den »wichtigsten Werkzeugen, um musikalische Emotionen zu vermitteln… Ein einzelner hoher Ton kann Spannung vermitteln, ein einzelner tiefer Ton Traurigkeit.« Die Tonhöhe ist in der Wahrnehmung so wichtig, dass sie direkt im auditiven Cortex repräsentiert wird. Das Gehirn besitzt eine Art »Tonhöhen- Karte«: unterschiedliche Bereiche reagieren auf verschiedene Tonhöhen. Allein durch Beobachtung der Hirnaktivität kann man die wahrgenommene Tonhöhe feststellen. Diese genaue physiologische Repräsentation könnte mit den Befunden über den stimmlichen Emotionsausdruck in Verbindung gebracht werden: Ärger, Furcht, Traurigkeit und Freude vermitteln sich vor allem über unterschiedliche Nuancen in Tonhöhe und Klangfarbe. Fazit für die Praxis der Musiktherapie Die Emotionspsychologie und -forschung entwickeln unterschiedlichste Perspektiven auf das komplexe Wirken von Emotionen und versuchen diesbezüglich allgemein gültige Aussagen zu treffen, die hier nur unvollständig angerissen werden können. In der Therapie gilt es, subjektive emotionale Wahrheiten anzuerkennen © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2014, ISSN 0172–5505 Erkenntnisse der Emotionspsychologie in der Musiktherapie 129 und jenseits von Kategorisierung und Bewertung zu ergründen, wie eine Emotion sich anfühlt, wozu sie gut ist und ob und wodurch sie sich verändern lässt. Dennoch können einige Erkenntnisse aus der Emotionspsychologie auch Relevanz für die musiktherapeutische Praxis haben. Emotionen haben eine lange Geschichte – sowohl unter phylogenetischer Perspektive, als auch in Bezug auf unser eigenes Leben. Der evolutionäre Blickwinkel könnte auch Patienten Erklärungen für den »Widerfahrnis«-Charakter (Ulich in Wosch 2004, S. 235) von Emotionen liefern: emotionale Reaktionen sind Reaktionen auf bedeutsame Ereignisse in unserer Umwelt (oder in uns selbst), die Handlungen auslösen sollen, welche aus überlebenstaktischen Gründen schnell erfolgen müssen. Angestoßen werden sie durch automatisierte Bewertungsmechanismen, von denen einige in uns angelegt sind, andere aber im Laufe der Entwicklung erlernt werden. Automatisierte Bewertungsprozesse wirken meist im Unbewussten – hier liegt ein wesentlicher Ansatzpunkt für musiktherapeutisches Arbeiten. Zu den unbewussten Inhalten zählen aber nicht nur Bewertungsprozesse, die zu bestimmten Emotionen führen, sondern auch Gefühle selbst, und zwar jene, die dem Ich bedrohlich erschienen und aus diesem Grund verdrängt wurden. Ihr Wirken im Unbewussten kann nur im Zusammenhang mit der individuellen Lebensgeschichte eines Patienten aufgedeckt werden. Hierfür liefert der entwicklungspsychologische Ansatz der Emotionsforschung wichtige Erkenntnisse. Emotionale Prozesse werden als soziale Prozesse charakterisiert; in diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Interaktion mit den Bezugspersonen prägend für die weitere emotionale Entwicklung eines Kindes ist. Die Reaktionen der Bezugspersonen auf emotionale Signale des Säuglings beeinflussen die spätere intrapersonale Emotionsregulation des Kindes. Das emotionale Agieren eines Kindes in einer musikalischen Improvisation kann demnach frühe Interaktionen abbilden und wird damit zu einem wichtigen Ausgangspunkt für therapeutisches Handeln. Im Laufe der Entwicklung lernt das Kind auch, die subjektiven emotionalen Zustände nach außen zu kommunizieren. Während die emotionspsychologische Forschung für den mimischen und stimmlichen Emotionsausdruck universelle Merkmale gefunden hat, sind die sprachliche Begriffszuschreibung und auch der musikalische Ausdruck an die Eigenschaften kultureller Symbolik gebunden. Dieser Tatsache muss vor allem eine interkulturell ausgerichtete Musiktherapie Rechnung tragen. Gerade für die musiktherapeutische Praxis bietet sich aber ohnehin das oben skizzierte dimensionale Modell für die Emotionsbestimmung an. Die hierbei relevanten Kriterien des Erregungsgrades und der Valenz lassen sich gut auf musikalische Sachverhalte übertragen. Dabei gerät die Erlebensqualität einer Emotion in den Vordergrund und begriffliche Abgrenzungsschwierigkeiten verlieren an Bedeutung. Im Spiel können Erregungs- und Spannungszustände, Lust oder Unlust in eine musikalische Symbolsprache übersetzt werden. Die Wahrnehmung für eigene subtile emotionale Prozesse wird angeregt und es kann die Erkenntnis reifen, wie nahe zum Beispiel die subjektive Trauer der Wut ist (und umgekehrt) und welcher Energie eine Veränderung emotionalen Erlebens bedarf. © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2014, ISSN 0172–5505 130 Juliane Kahl Bleibt man bei der Kategorisierung von Emotionen, ließe sich in der musikalischen Darstellung von Affekten das von Plutchik (Euler 2009, S. 407) entworfene Modell eines Emotionskreises aufgreifen, auf dem die Emotionen nach ihrer Ähnlichkeit angeordnet werden, gegensätzliche Emotionen liegen sich in diesem Kreis gegenüber. Es ist zwar von der Theoriebildung wieder verworfen worden, kann aber durchaus für methodische Zwecke in der musiktherapeutischen Arbeit benutzt werden. Durch die Thematisierung von Ähnlichkeiten und Gegensätzen zwischen einzelnen Emotionen wird der Patient angeregt, mit emotionalen Zuständen auf musikalischer Ebene zu spielen, was letztlich zu einem flexibleren Umgang mit Emotionen führen kann. Worin gleichen sich Wut und Angst und worin unterscheiden sie sich? Wie könnten sie sich musikalisch ineinander verwandeln? Und wie sind sie im »richtigen Leben« verwandelbar? Darüber hinaus bietet das Spiel generell die Möglichkeit eines emotionalen Probehandelns: man kann so spielen, dass es wütend, traurig oder fröhlich klingt und gleichzeitig in subjektiver Distanz zum Emotionsausdruck bleiben. Durch die Heraushebung dieser Empfindungen aus dem Alltagsgeschehen und deren Überführung in die musikalische Symbolisierung erfährt der Patient, dass emotionale Zustände keine feststehenden Kategorien sind, sondern ein Kontinuum mit unterschiedlichen Erlebensqualitäten bilden, die er beeinflussen kann. Aus Sicht der Emotionsforschung kann Musiktherapie −− unbewusste, verdrängte Emotionen in die bewusste Wahrnehmung bringen, −− unbewusst ablaufende Bewertungsprozesse aufdecken helfen, −− für emotionale Ausdruckssignale, besonders in der Stimme, sensibilisieren, −− die Beschäftigung mit Emotionen auf einer musikalisch-symbolischen Ebene anregen, welche eine subjektive Distanz zu bedrohlich erlebten Emotionen ermöglicht, −− in musikalischen Improvisationen den spielerischen Ausdruck von Emotionen erlebbar machen und in diesem Spiel fließende Übergänge zwischen einzelnen Emotionskategorien schaffen. Ziele der Arbeit an Emotionen (in Abhängigkeit vom jeweiligen Störungs- oder Krankheitsbild): 1. Wahrnehmung und Differenzierung von Gefühlen 2. Akzeptanz aller, auch unangenehmer Gefühle 3. Integration unbewusster Inhalte 4. Emotionskontrolle 5.Veränderungen emotionalen Verhaltens Abschließend bleibt festzustellen, dass sich aus den Erkenntnissen der Emotionspsychologie auch neue Fragestellungen für die musiktherapeutische Forschung ergeben können, deren Bearbeitung wiederum auf die Praxis der Musiktherapie rückwirken würde. © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2014, ISSN 0172–5505 Erkenntnisse der Emotionspsychologie in der Musiktherapie 131 Literatur Alpers, G. W., Mühlberger, A., Pauli, P. (2009): Psychophysiologie der Emotionen. In: V. Brandstätter, J. H. Otto, (Hg.): Handbuch Emotionspsychologie. S. 412–421. Weinheim: Beltz Damasio, A. (2009): Ich fühle, also bin ich. Berlin: List, 8. Aufl. Darwin (1877): Der Ausdruck der Gemüthsbewegungen bei dem Menschen und den Thieren. Stuttgart: E. Schweizerbart‘sche Verlagshandlung Döring, S. (Hg.) (2009): Philosophie der Gefühle. Frankfurt am Main: Suhrkamp Ekman, P. (2010): Gefühle lesen. Heidelberg: Spektrum, 2. Aufl. Euler, H. A. (2009): Evolutionäre Psychologie. In: V. Brandstätter, J. H. Otto, (Hg.): Handbuch Emotionspsychologie. S. 405–411. Weinheim: Beltz Fiedler, Peter (2009): Psychotherapie und Emotionen. In: V. Brandstätter, J. H. Otto, (Hg.): Handbuch Emotionspsychologie. S. 731–740. Weinheim: Beltz Fröhlich, W. D. (2005): Wörterbuch Psychologie. München: dtv, 25. Aufl. Hastedt, H. (2005): Gefühle. Philosophische Bemerkungen. Stuttgart: Reclam Kahl, J. (2011): Emotionsforschung und Musiktherapie. Diplomarbeit des Studiengangs Musiktherapie der Universität der Künste Berlin Koelsch, S., Fritz, T. (2007): Musik verstehen – Eine neurowissenschaftliche Perspektive. In: A. Becker, M. Vogel, (Hg.): Musikalischer Sinn. Beiträge zu einer Philosophie der Musik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 118–145 Koelsch, S. (2008): Die emotionale Stimme. Musiktherapeutische Umschau 29 (3), 201–208 Krause, R. (2002): Struktur und Affekt. In: G. Rudolf, T. Grande, P. Henningsen (Hg.): Die Struktur der Persönlichkeit. Stuttgart: Schattauer, S. 80–89 Levitin, D. J. (2009): Der Musik-Instinkt. Die Wissenschaft einer menschlichen Leidenschaft. Heidelberg: Spektrum Merten, J. (2009): Ausdruck. In: V. Brandstätter, J. H. Otto, (Hg.): Handbuch Emotionspsychologie. S. 422–428. Weinheim: Beltz Otto, J., Euler, H. A. und Mandl, H. (2000). Begriffsbestimmungen. In: V. Brandstätter, J. H. Otto, (Hg.): Handbuch Emotionspsychologie. S. 11–18. Weinheim: Beltz Schmidt-Atzert, L. (2009): Kategoriale und dimensionale Modelle. In: V. Brandstätter, J. H. Otto, (Hg.): Handbuch Emotionspsychologie. S. 571–576. Weinheim: Beltz Wosch, T. (2004): Emotionspsychologie und ihre Bedeutung bei Regulativer Musiktherapie (RMT) und Guided Imagery and Music nach Helen Bonny (GIM). In: Frohne-Hagemann, I.: Rezeptive Musiktherapie. Theorie und Praxis. Wiesbaden: Reichert, S. 233–251 Zentner, M., Scherer, K. R. (1998): Emotionaler Ausdruck in Musik und Sprache. Deutsches Jahrbuch für Musikpsychologie 13, 8–25 Juliane Kahl, Dipl.-Musiktherapeutin, Lehramt für Musik/ Französisch. Tätig als Lehrerin am Gymnasium und als Musiktherapeutin in freier Praxis. Mommsenstr. 50, 10629 Berlin. e-mail: [email protected] © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2014, ISSN 0172–5505