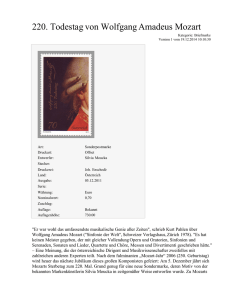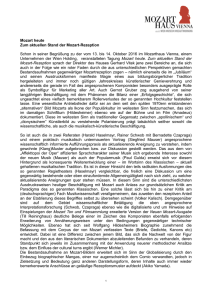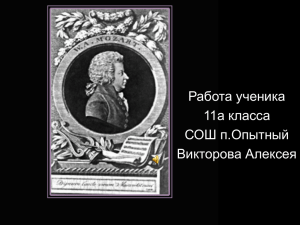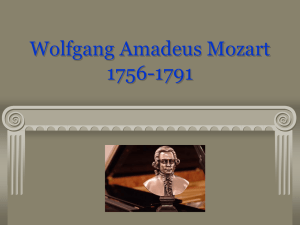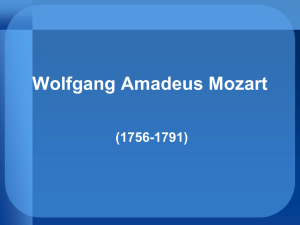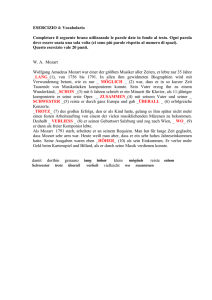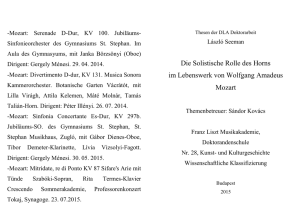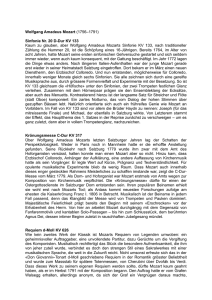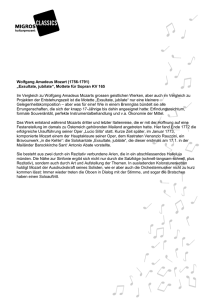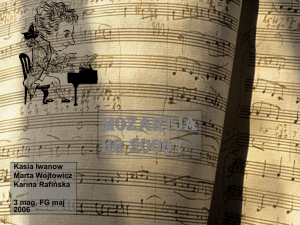Mozart Stadtführer herunterladen
Werbung

Wenn ich seine Neugier versichern könnte, dann mit DBV-Winterthur. Ob klassisch oder modern: Neugier öffnet alle Türen. Verlassen Sie sich auf ein Versicherungsunternehmen, das Klassik und Moderne ideal miteinander verbindet. Über 130 Jahre Erfahrung stecken in unseren modernen Versicherungsprodukten, die alle Lebensbereiche unserer Kunden absichern: Von Altersvorsorge bis Unfallversicherung. Schnell und zuverlässig. Wir beraten Sie gerne. Anruf genügt! DBV-Winterthur Versicherungen Frankfurter Straße 50 65178 Wiesbaden Tel.: 01803 335346* *9 Cent /Minute www.dbv-winterthur.de Drei Generationen Mozart in Frankfurt – Ein Stadtführer Mit freundlicher Unterstützung: DBV-Winterthur Versicherungen Internationale Stiftung Mozarteum Salzburg Cronstett- & Hynspergische Evangelische Stiftung Ernst Max von Grunelius-Stiftung Mozart-Stiftung von 1838 zu Frankfurt am Main Bankhaus Metzler Frankfurt am Main Historisches Museum Frankfurt am Main Degussa AG Casa Sinopoli - Dr. Ulrike Kienzle vividprojects GmbH Kulturothek Frankfurt am Main Freundes- & Förderkreis der Frankfurter Bürgerstiftung bombel.com consulting, Freudenstadt Herausgegeben von: Frankfurter Bürgerstiftung im Holzhausenschlößchen Ausstellungspartner: Historisches Museum Frankfurt am Main Internationale Stiftung Mozarteum Salzburg FRANKFURTER BÜRGERSTIFTUNG I M H O L Z H AU S E N S C H L Ö S S C H E N 1763: Leopold Mozart, Kapellmeister aus Salzburg, trifft mit seiner Familie in Frankfurt ein. Die Konzerte der beiden Wunderkinder Nannerl und Wolfgang bezaubern die Frankfurter. Unter ihnen ist auch eine spätere Berühmtheit: Johann Wolfgang Goethe. 1790: Der inzwischen berühmte Komponist Wolfgang Amadeus Mozart weilt anläßlich der Kaiserkrönung Leopolds II. ein weiteres Mal in Frankfurt. Er trifft viele alte Bekannte, speist in den vornehmsten Häusern der Stadt und gibt ein Konzert. 1820: Mozarts jüngster Sohn Franz Xaver, genannt Wolfgang Amadeus junior, kommt während einer mehrjährigen Konzertreise für vier Wochen nach Frankfurt. Er läßt sich vom Cäcilien-Verein begeistern. Drei Generationen Mozart in Frankfurt: drei Marksteine Frankfurter Musikgeschichte! Drei Generationen Mozart in Frankfurt – Ein Stadtführer Seite 3 Seite 4 GRUSSWORT VORWORT Seite 8 WO MOZARTS WOHNTEN UND WIRKTEN: EIN SPAZIERGANG DURCH FRANKFURT Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite EINLEITUNG 1. ALTE BRÜCKE 2. MAINKAI/FAHRTOR 3. RÖMERBERG 4. BENDERGASSE 3/ SCHIRN 5. «KAISERDOM» ST. BARTHOLOMÄUS 6. GASTHAUS «ZUM GOLDENEN LÖWEN», FAHRGASSE 27 7. SCHÄRFENGÄSSCHEN/ECKE HOLZGRABEN 8. GASTHAUS «ZUM WEISSEN SCHWAN», STEINWEG 12 9. «BACKHAUS», KALBÄCHER GASSE 10 10. RATHENAUPLATZ 11. KATHARINENKIRCHE 12. ZEIL 13. STIFTSTRASSE / ECKE STEPHANSTRASSE 14. ZEIL 15. ALTE MAINZER GASSE / MAINKAI 35 16. AUSBLICK 2006 8 12 14 15 16 17 18 19 22 22 23 24 24 26 26 28 30 © 2005 Herausgeber: Frankfurter Bürgerstiftung, Stiftungsgeschäftsführer Clemens Greve Hintergrund: Nach Frankfurt konnte man entweder auf dem Land- oder auf dem Wasserweg reisen: Ein solches Marktschiff brachte die Familie Mozart 1763 von Mainz nach Frankfurt. Vorne der Gutleuthof, hinten der Dom St. Bartholomäus. Titelbild: Mozart, von Rosen umgeben, den Arm lässig auf die Säule seines ewigen Ruhmes gestützt, flüchtig beschriebene Notenblätter seiner Hand entgleiten lassend – so stellte man sich den Tonsetzer im 19. Jahrhundert vor. Grußwort Mozart-Jahr 2006: Der 250. Geburtstag Wolfgang Amadeus Mozarts im Januar 2006 ist für viele europäische Städte ein willkommener Anlaß, die Spuren des großen Komponisten in den eigenen Straßen und Gebäuden, aber auch im Spiegel der Dokumente von Zeitgenossen und Nachgeborenen zu verfolgen. Deshalb wurde die Initiative «Europäische Mozart-Wege» gegründet und vom Europarat mit der Auszeichnung «Major Cultural Route» versehen: Kulturreisen, innovative Projekte für Kinder und Jugendliche, kulturelle und wissenschaftliche Veranstaltungen rund um Mozart stehen auf dem Programm. Eine Station auf den «Europäischen Mozart-Wegen» ist Frankfurt am Main: Zweimal ist Mozart in unserer Stadt gewesen und hat umjubelte Konzerte gegeben. Die kunstsinnige Frankfurter Bürgerschaft hat Mozarts Musik von Anfang an geliebt; viele seiner Opern wurden bald nach ihrer Uraufführung in Frankfurt nachgespielt. 1838 wurde hier die Mozart-Stiftung zur Förderung junger Komponisten gegründet. Und so ist es ein lohnendes Unterfangen, die Wege, die Mozart in unserer Stadt unternommen hat, einmal nachzugehen. Der vorliegende Stadtführer, herausgegeben von der Frankfurter Bürgerstiftung, die die «Europäischen Mozart-Wege» in unserer Stadt vertritt, gibt dazu Gelegenheit. Auch wenn die Häuser, in denen Mozart gewohnt und musiziert hat, nicht mehr stehen, so lädt dieser Stadtführer doch dazu ein, Frankfurt mit neuen Augen zu entdecken – mit den Augen Mozarts, dessen Musik noch heute in Frankfurt eine wichtige Rolle spielt. Petra Roth OBERBÜRGERMEISTERIN Vorwort Z um Mozartjahr 2006, dem 250. Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart, wird es zahlreiche Veranstaltungen in Frankfurt am Main geben. Auch die Frankfurter Bürgerstiftung wird im Holzhausenschlößchen und an anderen Veranstaltungsorten in Frankfurt Konzerte, Lesungen, Vorträge, Kinderveranstaltungen und eine Ausstellung durchführen. Mozart besuchte Frankfurt zweimal, zu Beginn und am Ende seines Lebens. Alle wichtigen Orte, die er während seiner Aufenthalte in Frankfurt besuchte, sollen in diesem Frankfurter Mozart-Stadtführer in alten und gegenwärtigen Ansichten und anhand des Merian-Stadtplans und in ausführlichen Beschreibungen veranschaulicht werden. Aber auch der einmonatige Aufenthalt des Mozartsohnes und Komponisten Franz Xaver findet in diesem Stadtführer Beachtung. Der Musikwissenschaftlerin Dr. Ulrike Kienzle ist es zu verdanken, daß wir in diesem Stadtführer Näheres über seinen Aufenthalt im Jahr 1820 in Frankfurt erfahren können. In einer im Januar 2006 stattfindenden Ausstellung «Drei Generationen Mozart in Frankfurt» wollen wir u.a. auch diesen Aufenthalt ausführlich untersuchen. Nicht nur erwähnt sei aber auch die Arbeit der 1838 in Frankfurt gegründeten Mozart-Stiftung, die eine der ersten Fördereinrichtungen für junge Komponistinnen und Komponisten ist. U. a. wurden durch diese Stiftung Max Bruch und der Komponist von «Hänsel und Gretel», Engelbert Humperdinck, unterstützt. Aus der Biographie seines Sohnes Wolfram erfahren wir, daß der eigentliche Entschluß, sich dem Musikstudium zu widmen, auf den Rat eines gebürtigen Frankfurters, den «Rheinischen Musikpapst» Ferdinand Hiller, zurückging, der damals das Konservatorium in Köln leitete und den jungen Engelbert Humperdinck in seine Obhut nahm. 4 Rechts: Stadtplan von Frankfurt am Main nach Matthäus Merian um 1761 (Historisches Museum Frankfurt am Main) Doch was hat das alles mit der Frankfurter Mozart-Stiftung von 1838 zu tun? Sehr viel, schließlich war es Hiller, der Humperdinck ein Stipendium der Mozart-Stiftung besorgte, das ihm ein sorgenfreies Studium ermöglichte. Zuvor war Humperdinck schwer erkrankt und mußte sein Studium unterbrechen. Da setzte sich Hiller für die Zusage eines Stipendiums der Mozart-Stiftung ein, das wieder «frohe Stunden ins Elternhaus» brachte. Dieses Stipendium ermöglichte immerhin das Studium für vier weitere Studienjahre, anfangs in Köln und anschließend in München. Weshalb schreibe ich darüber so ausführlich? Die Frankfurter Bürgerstiftung ist seit 2003 Mitglied im Verein «Europäische Mozart-Wege»; als Geschäftsführer der Bürgerstiftung bin ich u.a. auch Mitglied des Verwaltungsrates der in Frankfurt beheimateten Mozart-Stiftung, und so liegt es nahe, daß ich für den wichtigen Mozartort Frankfurt werbe, dies aber nicht nur im Hinblick auf die interessante Vergangenheit, sondern auch mit einem Blick in die Zukunft: was können wir, die Freunde und Förderer der Frankfurter Bürgerstiftung und alle Freunde der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart tun? Wir können dafür sorgen, daß die Mozart-Stiftung unsere Hilfe erfährt, indem wir für deren Arbeit, d. h. die Unterstützung junger hilfsbedürftiger musikalischer Talente bei ihrer Ausbildung in der Kompositionslehre, spenden (s. beiliegenden Überweisungsträger). 1923 ist das Stiftungsvermögen der Mozart-Stiftung von 240000 Goldmark auf 3000 Goldmark zusammengeschrumpft. Durch eine Vielzahl von kleinen Spenden konnte die Stiftung bis zum heutigen Tag ein bescheidenes Stiftungskapital zusammentragen, das gerade für eine kleine regelmäßige Unterstützung dreier Stipendiaten reicht. Fangen wir in der Europastadt Frankfurt an, helfen wir alle mit, die Mozart-Stiftung zu unterstützen, damit im Jahr 2006 vielleicht noch ein weiteres Stipendium ermöglicht und ein interessantes Musikprogramm mit den Werken Wolfgang Amadeus Mozarts und den Werken der Stipendiaten der Mozart-Stiftung zur Aufführung kommt. Ich finde, es ist unsere Aufgabe, der Mozart-Stiftung im Mozart-Jubiläumsjahr neuen, aktuellen Auftrieb zu verleihen, damit ihre wertvolle Arbeit auch auf Dauer weitergeführt werden kann. Das Mozartjahr nehmen wir, die Frankfurter Bürgerstiftung, zum Anlaß, um auf diese kleine wichtige Stiftung aufmerksam zu machen. Frau Dr. Ulrike Kienzle möchte ich sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit bei der Verwirklichung dieses gelungenen Mozart-Stadtführers danken. Und der Frankfurter Mozart-Stiftung, die im Laufe ihrer Geschichte zahlreiche junge Talente gefördert hat, wünsche ich, daß ihr wieder größere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ganz besonders möchte ich den Mitarbeitern des Historischen Museums Frankfurt für ihre partnerschaftliche Zusammenarbeit im Rahmen unserer gemeinsamen, zwischen dem 8. Januar und dem 24. Februar im Holzhausenschlößchen stattfindenden Ausstellung danken, namentlich Herrn Dr. Jan Gerchow, Frau Anja Damaschke und Herrn Oliver Morr. Ihr Clemens Greve STIFTUNGSGESCHÄFTSFÜHRER Links: Geometrischer Grundriß der freien Stadt Frankfurt und Sachsenhausen im Jahr 1822; aufgenommen, gezeichnet und herausgegeben von C. F. Ulrich, Architekt und Mathematiker (Historisches Museum Frankfurt am Main) 7 Wolfgang Amadeus Mozart ist viel in Europa herumgekommen. Die Enge seiner Vaterstadt Salzburg hat er nie lange ausgehalten; auch aus Wien trieb es ihn öfter fort, und so können einige Städte für sich beanspruchen, echte «Mozart-Städte» zu sein: Salzburg und Wien, Mannheim, München und Augsburg, London, Paris und Prag.Wie steht es da um Frankfurt? Mozart war zweimal hier, zu Beginn und am Ende seines Lebens. EIN STADTFÜHRER Text: Ulrike Kienzle 8 Die erste Reise stand ganz im Zeichen des Wunderkindes. Vater Leopold war mit seiner Familie im Juni 1763 in eigener Kutsche aus Salzburg aufgebrochen, um das schier unglaubliche Können seiner beiden Sprößlinge Wolfgang und Nannerl der Welt zu präsentieren. Die Reise führte bis nach London und Paris – und auf dem Weg dahin eben auch nach Frankfurt. Erst im November 1766 kehrte die Familie nach Salzburg zurück. Augsburg hatte Leopold ein «Clavierl», also ein Reiseclavichord, gekauft, auf dem die Kinder unterwegs üben konnten. Man hat nicht den Eindruck, daß die Kinder unglücklich gewesen wären, im Gegenteil: «Der Wolfgang: ist ganz ausserordentlich lustig, aber auch schlimm», schreibt Vater Leopold aus Frankfurt an einen Salzburger Freund. «Schlimm» – das heißt wohl: übermütig, ungezogen, wild – wie Kinder in diesem Alter eben sind. Wenn man bedenkt, daß die Familie Mozart über drei Jahre ununterbrochen auf Reisen war, dann muß man sich fragen: Was haben die Kinder gelernt? Wie haben sie ihre Tage verbracht? Wie hält es ein Siebenjähriger aus, von Freunden und Spielzeugen und der heimatlichen Umgebung so lange getrennt zu sein? Die Familie lebte in der Kutsche und in Gasthäusern. Dort erhielten die Kinder auch Unterricht von ihrem Vater. Beide lernten mühelos: Sprachen, Mathematik, offizielle Umgangsformen – und natürlich Musik. In In seinen Konzertankündigungen sparte Leopold nicht mit vollmundigen Versprechungen: Es galt, «ein Wunder zu verkündigen, welches Gott in Salzburg hat lassen geboren werden». Solche Erwartungen konnten seine Kinder stets mühelos erfüllen, wenn nicht sogar übertreffen. Besonders der putzige Siebenjährige mit dem pausbäckigen Kindergesicht in der altväterischen Galauniform nebst Perücke und Degen wurde überall begeistert beklatscht, umjubelt, beschenkt und geküßt. 1790 kam Wolfgang Amadeus Mozart in eigener Kutsche nach Frankfurt – wahrscheinlich, wie auf diesem zeitgenössischen Kupferstich, von der Sachsenhäuser Seite her. Mozarts zweite Reise nach Frankfurt im Herbst 1790 stand unter einem weniger günstigen Stern. Ein Jahr vor seinem Tod fuhr der von Geldschulden und sozialem Abstieg bedrohte Komponist anläßlich der Kaiserkrönung Leopolds II. in die Stadt am Main. Seine Hoffnung, als Angehöriger der Hofkapelle eingeladen zu werden, hatte sich nicht erfüllt: Dem Kaiser gefielen die Werke Salieris besser, und so mußte Mozart auf eigene Kosten reisen und dafür sein Silber versetzen, um die Reise finanzieren zu können. Immerhin fuhr er standesgemäß im eigenen Reisewagen und in Begleitung seines Schwagers Franz Hofer. Aus demselben Jahr 1790 stammen die immer verzweifelteren Bittbriefe an den Logenbruder Michael Puchberg. In einer Schuldverschreibung, datiert vom 1. Oktober 1790 (Mozart war zu dieser Zeit bereits in Frankfurt) verpfändet er sein gesamtes Mobiliar für ein Darlehen von 1000 Gulden. Offenbar hoffte er, aus Frankfurt eine ansehnliche Summe zur Tilgung nach Hause zu bringen. Mozart spekulierte, wie 27 Jahre zuvor schon sein Vater, auf den Reichtum der Stadt. Aber in dem kunterbunten Rummel rund um die Krönung, in der Fülle musikalischer, militärischer, gesellschaftlicher Vergnügungen ging sein eigenes Konzert förmlich unter. Er wurde zwar von den spärlich erschienenen Zuhörern mit Ehre und Anerkennung bedacht, aber finanziell scheint sich die Unternehmung nicht gelohnt zu haben. Schließlich weilte Mozarts jüngster Sohn Franz Xaver Wolfgang in Frankfurt – er blieb einen Monat lang. Er war, wie sein Vater, Komponist und reisender Virtuose und lebte sein Leben in dessen Schatten. Von seiner Mutter Konstanze wurde er schon früh zum Wunderkind erzogen. Als Fünfjähriger sang er vor geladenen Gästen Papagenos Vogelfänger-Lied aus der «Zauberflöte» und brachte schon bald die Klaviersonaten seines Vaters öffentlich zu Gehör. Er nannte sich «Wolfgang Amadeus Mozart junior» und schrieb gediegene Kompositionen im Stil der Frühromantik. Er war keineswegs unbegabt, aber eben kein Genie. Nach einer Anstellung als Musiklehrer bei einer wohlhabenden Familie ließ er sich in Lemberg nieder und brach von dort im Mai 1819 zu einer großen Konzertreise durch Europa auf. Wir wissen gut über diese Reise Bescheid, denn Franz Xaver Mozart führte ein Brieftagebuch für seine daheim zurückgelassene Geliebte. Am 5. Dezember 1820 war er hier im «Rothen Haus» auf der Zeil Zeuge einer denkwürdigen Aufführung von Mozarts Requiem 9 Drei Generationen Mozart in Frankfurt am Main: Oben: Wolfgang Amadeus (1756 – 1791), Siberstiftzeichnung von Dora Stock Unten links: Vater Leopold (1719 – 1787) Unten rechts: Mozarts Sohn Franz Xaver Wolfgang (1791 – 1844) in zeitgenössischen Darstellungen. Sie erlebten Frankfurt als eine «altväterische» Stadt voller mittelalterlicher Fachwerkhäuser. Inzwischen hat sich das Stadtbild vollkommen verwandelt: Das kleine Bild in der Mitte zeigt die heutige Frankfurter Skyline von der Alten Brücke aus. durch den neu gegründeten Cäcilien-Verein unter der Leitung von Johann Nepomuk Schelble. Franz Xaver knüpfte viele Kontakte zum Frankfurter Musikleben, gab ein vielbeachtetes Konzert und gründete daheim in Lemberg – angeregt durch das Frankfurter Vorbild – seinen eigenen Cäcilien-Verein. Ein weiteres wichtiges Kapitel (auf das wir hier allerdings nicht näher eingehen können) ist die Aufführungsgeschichte von Mozarts Musik in Frankfurt. Schon früh wurden seine Opern hier nachgespielt, meist wenige Monate nach der Uraufführung, und bildeten einen festen Kern im Repertoire. 1838 gründeten kunstsinnige Frankfurter Bürger die «Mozart-Stiftung» – eine der ersten Fördereinrichtungen für junge Komponisten. Ist Frankfurt also eine richtige Mozart-Stadt? Ja und nein. Natürlich kann Frankfurt nicht mit Augsburg oder Mannheim, geschweige denn mit Salzburg oder Wien konkurrieren. Und doch war Frankfurt eine wichtige Stadt in der Familiengeschichte der Mozarts. Leopold hat hier einige seiner originellsten Briefe verfaßt und nach eigenem Bekenntnis so viel erlebt, daß er tagelang davon hätte berichten können. Die beiden Frankfurter Aufenthalte Wolfgang Amadeus Mozarts stehen jeweils an Wendepunkten seiner Biographie: Das umjubelte Wunderkind und der von Sorgen gezeichnete Mann, der um die Gunst der Reichen buhlen muß – das sind starke Kontraste. Sein Sohn wiederum nahm aus Frankfurt viele Anregungen mit. So kann Frankfurt zwar keinen zentralen, aber durchaus einen würdigen Platz in der Reihe der MozartStädte beanspruchen. Die beiden Frankfurter Aufenthalte Wolfgang Amadeus Mozarts stehen jeweils an Wendepunkten seiner Biographie: das umjubelte Wunderkind und der von Sorgen gezeichnete Mann, der um die Gunst der Reichen buhlen muß – das sind starke Kontraste. In diesem kleinen Stadtführer möchten wir Sie anhand von alten und neuen Bildern, Dokumenten und Texten zu den wichtigsten Mozart-Stätten führen – oder besser gesagt: zu dem, was aus ihnen geworden ist. Denn die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges hat dafür gesorgt, daß kein einziges der Häuser, in denen die drei Mozarts sich aufgehalten haben, erhalten ist. Das alte Frankfurt ist untergegangen, aber die Erinnerung daran kann wieder lebendig werden. Deshalb haben wir ganz bewußt die Bilder der originalen Gebäude mit Fotos aus dem modernen Frankfurt konfrontiert. Und wir haben den historischen Stadtplan von Matthäus Merian von 1761 sowie einen Ausschnitt aus einem Plan von 1822 unserem Sonderdruck beigefügt.Wenn Sie sich von unseren Vorschlägen zu einem Spaziergang durch Mozarts Frankfurt anregen lassen, dann wird es Ihnen vielleicht gelingen, anhand der alten Bilder in Ihrer Imagination die verschwundenen Häuser neu erstehen zu lassen. 11 WO MOZARTS WOHNTEN UND WIRKTEN: EIN SPAZIERGANG DURCH FRANKFURT 1. ALTE BRÜCKE 1. ALTE BRÜCKE Die alte Mainbrücke war im 18. und 19. Jahrhundert eine wichtige Verkehrsader. Sie war jahrhundertelang die einzige unmittelbare Verbindung zwischen Sachsenhausen und der Messestadt. Einige Schritte von hier, in der Brückenstraße 26, ist Mozart 1790 im Gasthof «Zu den drei Rindern» für eine Nacht eingekehrt – «zu Tod froh, daß wir ein Zimmer erwischt haben». Auch Schiller hatte hier schon einmal gewohnt. Heute gibt es das Gasthaus nicht mehr; die Brückenstraße ist nur noch einseitig bebaut, und dort, wo Mozart übernachtet hat, tost der Verkehr durch die Walter-Kolb-Straße. 12 Am Tag nach seiner Ankunft 1790 kam Mozart über die Alte Brücke, um sich in der Innenstadt ein passenderes Domizil zu suchen. Auf umgekehrtem Wege hatte die Familie Mozart schon 1763 die Brücke passiert: Auf ihren Ausflügen zum Deutschordenshaus und zum Forsthaus überquerten sie den Main und fuhren dabei durch die imposanten Stadttore zu beiden Seiten der Brücke, die auf dem alten Merianplan abgebildet sind. Die alte Brücke wurde 1926 durch einen Neubau ersetzt. Wenn Sie etwa in der Mitte der Brücke stehen, fällt Ihr Blick zunächst auf die futuristische Skyline des modernen Frankfurt.Wie mag es zu Mozarts Zeit hier ausgesehen haben? Frankfurt war eine verwinkelte, mittelalterliche Stadt mit viel Fachwerk, spitzen Giebeln und 55 Wehrtürmen. Es gab jedoch kaum imposante Kirchtürme, was von vielen Besuchern des 18. Jahrhunderts negativ vermerkt wurde. Den Kern bildete die dicht besiedelte Innenstadt. Sachsenhausen war in den 1390 geschaffenen Mauerring einbezogen, wie sich auf dem alten Merianplan leicht erkennen läßt. 1793 begann die Erweiterung der Stadt über die Mauern hinaus. Die Befestigungsanlagen wurden aufgelassen und in Spazierwege und Gartenanlagen umgewandelt. So lernte Mozarts Sohn Franz Xaver die Stadt kennen. Viele Häuser in der Altstadt hatten Schieferdächer, die im abendlichen Sonnenlicht wunderschön glänzten. Oben: Die alte Mainbrücke zwischen Frankfurt und Sachsenhausen in einer Ansicht von 1747. Rechts und links die imposanten Türme, wie sie auch auf dem alten Merianplan von 1761 zu sehen sind. Das mittelalterliche Bauwerk mit seinen vielen Bögen war nur acht Meter breit; so muß es zu Messezeiten hier recht eng gewesen sein. 1926 wurde die alte Brücke durch einen Neubau ersetzt. Links: Das «Gasthaus zu den drei Rindern» in der Brückenstraße 26, historische Fotografie. Daß Schiller und Mozart hier einmal übernachtet hatten, sollte auch Jahrhunderte später noch Gäste anlocken. Unten: Die Alte Brücke heute – im Hintergrund die Turmspitze des Kaiserdoms St. Bartholomäus, der zur Zeit der Aufnahme eingerüstet war. Franckfurt ist ein altväterischer Ort, und von dem Römer habe ich mir viel andere Vorstellungen gemacht: Es will weder der Platz noch der Römer gar nichts sagen. Es giebt doch einige schöne Gebäude, doch wenige: Hingegen giebt es schöne Kaufmanns Gewölber, und viel 1000 Juden. Leopold Mozart an Lorenz Hagenauer, 13. August 1763 Links: Einer der beiden Kräne am Mainufer, die Leopold Mozart beeindruckten, auf einem Gemälde von Friedrich Wilhelm Hirt (1757). Der erste Kran ist bereits für 1331 bezeugt. Das Tretrad im Innern wurde von Knechten in Gang gehalten; auf diese Weise konnten Schiffe be- und entladen werden. Dafür war eine Gebühr fällig, das sogenannte «Krangeld». Oben: Der Römerberg im 18. Jahrhundert. Früher fanden hier die großen Handelsmessen statt, hier drängten sich Holzstände und Meßläden mit allem, was die Welt zu bieten hatte. Zu den Kaiserkrönungen versammelten sich Frankfurter Bürger und Tausende von Fremden, um den Zug des Kaisers und seines Gefolges vom Römer in den Dom und zurück zu betrachten – und um bei der Ausübung der «Erzämter» ein Stück vom gebratenen Ochsen und ein paar Münzen zu ergattern. 2. MAINKAI / FAHRTOR Um den 10. August 1763 fuhren die Mozarts mit dem Marktschiff von Mainz nach Frankfurt. Sie hatten einen Teil ihres Gepäcks in Mainz zurückgelassen; Frankfurt war eher als ein kleiner Abstecher gedacht. Sie blieben schließlich drei Wochen. Am Mainufer fielen ihnen sofort die gewaltigen Kräne auf, mit denen die Güter von den Schiffen ans Land gehievt wurden – diese «Drohnen» waren Leopold einen Eintrag ins Reisetagebuch wert. Auf dem Merian-Stadtplan von 1761 sind zwei solcher Kräne zu sehen; der Maler Friedrich Wilhelm Hirt hat einen davon auf seiner Ansicht des Mainufers von 1757 festgehalten. In ihrem Innern befand sich ein großes Tretrad, das von Knechten in Gang gehalten wurde. 2. MAINKAI/ F A H R T O R 3. RÖMERBERG 3. RÖMERBERG Welchen Eindruck gewann Leopold Mozart von der Stadt? Kurz nach seiner Ankunft schrieb er den Freunden in Salzburg: «Franckfurt ist ein altväterischer Ort, und von dem Römer habe ich mir viel andere Vorstellungen gemacht: Es will weder der Platz noch der Römer gar nichts sagen. Es giebt doch einige schöne Gebäude, doch wenige: Hingegen giebt es schöne Kaufmanns Gewölber, und viel 1000 Juden.» Ein hartes Urteil vielleicht – aber auch ein zeittypisches. Denn im 18. Jahrhundert blickte man mit Geringschätzung auf den kleinteiligen, bewegten Baustil des Mittelalters herab. Der «Römer», das mittlere und höchste von drei zusammenhängenden Treppengiebelbauten, wurde vermutlich nach den römischen Kaufleuten so benannt, die zu Messezeiten hier ihr Quartier hatten, oder auch (wie gelegentlich zu lesen ist) nach einem seiner Vorbesitzer, der eine Pilgerfahrt nach Rom gemacht haben soll. Der Gebäudekomplex gelangte 1405 in den Besitz der Stadt und wurde zum Rathaus. Hier tagte bei Kaiserkrönungen der Reichstag. Die wieder aufgebauten winkligen Häuser gegenüber, die östliche Römerzeile, geben eine ungefähre Vorstellung davon, wie es am Römerberg einmal ausgesehen hat. Die Häuser trugen sprechende Namen: «Zum Engel», «Goldener Greif», «Wilder Mann». Leopold Mozart hatte für das pittoreske Idyll mit seinen vielen Wetterfahnen, Hauszeichen, farbig bemalten oder geschnitzten Hauseingängen und Wasserspeiern allerdings keinen Blick. Er bevorzugte den neuen Baustil: große, geräumige Häuser, wie sie die reichen Kaufleute für sich bauten. So manches alte Fachwerkhaus fiel ihnen zum Opfer. 15 Oben links: Die Bendergasse in einer Zeichnung von Th. Wolter. Die Familie Mozart wohnte im dritten Haus von links. Oben rechts: So sieht die Bendergasse heute aus: Aufgang zur «Schirn». Unten: Leopold Mozarts Ritzinschrift auf einem Fensterflügel des Hauses Bendergasse 3: «Mozart Maitre de la Musique de la chapelle de Salzbourg avec Sa Famile le 12 Août 1763» 4. BENDERGASSE 3 / SCHIRN 4. BENDERGASSE 3 / SCHIRN Wo sich heute der monumentale Bau der neuen «Schirn» erhebt, stand bis zum Jahr 1944 gleich hinter der Alten Nikolaikirche ein für die Stadt typisches, verwinkeltes Haus: Bendergasse 3. Es war 1763 das erste Domizil der Familie Mozart. Die Dachzimmer wurden oft an Fremde vermietet. Wahrscheinlich hatte ein «Mr.Wahler» aus Frankfurt den Mozarts diese Unterkunft vermittelt; sie hatten ihn in München kennengelernt. Das Haus in der Bendergasse 3 barg einen ganz besonderen Schatz: eine Ritzinschrift Leopold Mozarts, die er wohl mit seinem Brillantring in den Fensterflügel geschrieben hatte. 16 Leopolds Inschrift ist nicht die einzige (auch andere Fremde haben sich hier verewigt), aber ganz sicher die kostbarste. 1879 wurde das Fenster ausgebaut und dem Historischen Museum geschenkt – ein Glück, denn bei den schweren Bombenangriffen des Zweiten Weltkriegs versank das Haus – wie die gesamte Innenstadt – in Schutt und Asche. Erst 1942 hatte man hier eine Tafel zum Gedenken an Mozarts Frankfurter Aufenthalt angebracht. In der Frankfurter Zeitung vom 22. August 1942 war zu lesen: «Man möchte es beinah nicht glauben, dass dort Mozart einmal gewohnt hat. Die Häuser der Bendergasse sind nicht die des Rosenecks oder des Römerberges; sie sind gut bürgerliches Sonntagsbehagen, gegensätzlich zu dem farbenfrohen Schwung und der stillen Verträumtheit der anderen, es erscheint unwirklich, daß die Wucht einer großen Genialität in ihnen Platz gefunden hat. Dennoch schwingt in ihnen eine Melodie, nicht nur der Sang strömenden Lebens, das sie in den Jahrhunderten der Krönungs- und Messebesucher erfüllt hat, sondern auch das Klingen des Blickes zum Tuchgaden mit dem Schöppenbrunnen und zur aufwärts gerichteten Weite des Domes im grünen umgebenden Laub.» Diese Melodie ist für immer verklungen – die Musik Mozarts dagegen hat alle Katastrophen überdauert. 5. «KAISERDOM» ST. BARTHOLOMÄUS Schon nach wenigen Tagen zogen die Mozarts um.Auf dem Weg zu ihrem zweiten Domizil öffnet sich direkt hinter der «Schirn» der Blick auf den «Kaiserdom». In diesem Gotteshaus wurden die deutschen Könige und Kaiser gewählt und gekrönt – auch die Krönung Leopolds II., die Mozart 1790 noch einmal nach Frankfurt führen sollte, fand hier statt. Eine Kaiserkrönung: Das bedeutete für Frankfurt stets ein immenses Aufgebot an kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen. Die Festlichkeiten zogen sich über Wochen hin, verbunden mit einer unvorstellbaren Prachtentfaltung: Kirchliche und politische Würdenträger fuhren in goldenen Karrossen durch die Straßen, von morgens bis tief in die Nacht gab es Bälle, Feuerwerke, Aufmärsche, Empfänge und festliche Konzerte. Leopold II. wurde am 9. Oktober 1790 gekrönt. Unter «Läutung aller Glocken, Schmettern der Trompetten und Paucken und immerwährendem Jubelgeschrey» zogen die hohen Herrschaften in den Dom. Nach dem feierlichen, äußerst aufwendigen Ritual zog der Kaiser mit seinem Gefolge über eine mit Tuch ausgelegte hölzerne Brücke zum Festmahl in den Römer. Anschließend trieb sich das Volk zu Tausenden in den verwinkelten Straßen und Gassen der Altstadt herum. Nach alter Tradition wurde auf dem Platz vor dem Römer ein am Spieß gebratener Ochse dem Volk «preisgegeben». Dazu floß roter und weißer Wein in Strömen aus einem Brunnen, es wurde ein großer Berg Hafer für das Volk aufgeschüttet, es wurden Münzen geworfen – das nannte man in Frankfurt die «Verrichtung der Erzämter». Beim Streit um die besten Stücke ging es mit Hauen und Stechen zu; gelegentlich soll es sogar Tote gegeben haben. 5. «KAISERDOM» ST. BARTHOLOMÄUS Unten: Der frisch gekrönte Kaiser Leopold II. nimmt unter dem Portal des Kaiserdoms die Huldigung der Stadt Frankfurt entgegen – personifiziert als üppige Frauengestalt, die dem Kaiser die Herzen der begeisterten Frankfurter auf dem Präsentierteller darbietet. Der Engel am oberen Bildrand bläst «Vivat Leopoldus Secundus» auf seiner Trompete, und im Hintergrund des Stadtpanoramas geht strahlend die Sonne auf. (Allegorischer Stich von J. C. Berndt, 1790) Rechts: Der Kaiserdom auf einem Ölgemälde um 1765. 6. GASTHAUS «ZUM GOLDENEN LÖWEN», FAHRGASSE 27 In der Fahrgasse 41 (heute Nr. 27), stand das Gasthaus «Zum Goldenen Löwen», eine der vornehmsten Adressen in Frankfurt. Das Haus wurde im Laufe seiner Geschichte mehrfach umgebaut. Heute erinnern nur noch ein steinernes Löwenrelief mit einer Inschrift und der (1781 angebrachte) Löwenbrunnen an das einstmals berühmte Gasthaus. Frankfurt war – mit Ausnahme von Augsburg, von wo Leopold Mozart stammte – die einzige Station auf der großen Reise, die keine fürstliche Hofhaltung aufzuweisen hatte. Frankfurt war «Freie Reichsstadt» und ein internationales Handelszentrum. Die Fremden, die Händler und nicht zuletzt die Juden, die in ihrem eigenen Viertel wohnten, brachten Leben in die Stadt. Während der Messen herrschte hier ein buntes Treiben. Es war üblich, daß Konzertkarten dort gekauft wurden, wo die Künstler wohnten – und so erschien es Leopold Mozart opportun, hier ein standesgemäßes Quartier zu beziehen. Im «Goldenen Löwen« machte die Familie allerlei interessante Bekanntschaften: So berichtet Leopold Mozart von einem «Frauen Zimmer amazonisch gekleidet», das mitsamt «Cammermädl», Kutscher und Bedientem in angetrunkenem Zustand ins Gasthaus kam, oder von seinen Mitbewohnern, unter ihnen der Churtrierische Gesandte, ein Braunschweigischer Husaren-Rittmeister und drei Engländer. Einer von ihnen pflegte vor dem Essen im Main zu baden und dann naß «wie eine getaufte Maus» im Speisesaal zu erscheinen. Allerdings stand es 1763, als die Familie Mozart zu Gast war, wirtschaftlich nicht gerade zum Besten: Nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges waren die französischen Truppen, die jahrelang in Frankfurt stationiert gewesen waren, abgezogen und hatten eine schmerzliche Lücke im Wirtschaftsleben der Stadt hinterlassen. Im August 1763 erschütterte der ungeheure Bankrott der Gebrüder de Neufville in Amsterdam die Finanzmetropole und führte zu einer schweren Geldkrise. Dreißig Handelshäuser gingen allein in Frankfurt, 95 weitere in Hamburg bankrott. «Nun trauet hier keiner dem anderen, bis man besser weiß, wie tief ein und anderer stecket», schrieb Leopold Mozart nach Hause. 6. GASTHAUS «ZUM GOLDENEN Rechts: Ansicht des «Goldenen Löwen» in der Fahrgasse 41 (heute Nr. 27) auf einem zeitgenössischen Kupferstich. In diesem vornehmen Haus war auch der Philosoph Voltaire im Sommer 1753 schon einmal abgestiegen: Er befand sich auf der Flucht von Potsdam, wo er bei Friedrich dem Großen in Ungnade gefallen war. Schon am Tag nach seiner Ankunft wurde er aufgegriffen und unter Hausarrest gestellt, später aber wieder freigelassen. Solche Unannehmlichkeiten blieben der Familie Mozart naturgemäß erspart. Oben: Der steinerne Löwe im Portal der Fahrgasse 27 erinnert noch heute an die große Vergangenheit des Hauses. Am 18. war unser Concert. Es war gut.Am 22.ten wird es wieder seyn, und auch am 25.ten oder 26.ten… Alles gerieth in Erstaunen! Gott giebt uns die Gnade, daß wir, Gott Lob, gesund sind, und aller Orten bewundert werden. Leopold Mozart an Lorenz Hagenauer, 20. August 1763 Links: Die Konzertankündigung Leopold Mozarts in den «Frankfurter Frag- und Anzeigungsnachrichten» vom 16. August 1763. In einer zweiten Ankündigung vom 30. August ist von der «allgemeinen Bewunderung, welche die noch niemahls in solchem Grade weder gesehene noch gehörte Geschicklichkeit der 2 Kinder des Hochfürstl. Saltzburgischen Capellmeisters Herrn Leopold Mozart, in den Gemüthern aller Zuhörer erwecket», die Rede. 7. SCHÄRFENGÄSSCHEN/ ECKE HOLZGRABEN 7. SCHÄRFENGÄSSCHEN/ ECKE HOLZGRABEN Dem Erfolg der Mozartschen Konzert-Unternehmung in Frankfurt tat dies offenbar keinen Abbruch. Die Frankfurter liebten die Musik, wie der Chronist Johann Bernhard Müller schon 1750 versichert: «Die Musik-Liebhaberei ist auch allhier sehr groß. Diese edle Belustigung ist, seitdem der berühmte Herr Telemann hier gewesen, in große Aufnahme gekommen. Es sind wenig angesehene Familien, da nicht die Jugend auf einem oder dem anderen Instrument oder im Singen unterwiesen wird. Die Konzerte sind deswegen sowohl öffentlich als in vornehmen Häusern sehr gewöhnlich und lassen sich dabei insgemein auch fremde und berühmte Virtuosen hören, wenn sie hier durchreisen und sich hier aufhalten.» Zu dieser «edlen Belustigung» wollte auch die Familie Mozart beitragen – so kündigten sie für den 18. August in den «Frankfurter Frag- und Anzeigungs-Nachrichten» ihr Konzert an. Das Konzert fand im «Scharffischen Saal» hinter dem Liebfrauenberg statt. Heute steht hier ein schmuckloses Haus mit grünen Metalltüren; gegenüber befindet sich das Kapuzinerkloster mit seinem idyllischen Innenhof. Der «Scharffische Saal» lag an der Rückfront von Frau Scharffs Weinwirtschaft im «Haus zum Spangenberg». Sein Inhaber hatte ihn «mit allen nur ordentlichen und erforderlichen Bequemlichkeiten, sowohl zu Hochzeiten, Baals, Concerten als auch anderen erlaubten Lustbarkeiten» ausgerüstet, «mit einem bretternen Fußboden versehen, und mit zwey großen Cristallen-Lüstres, und achtzehn versilberten Wandleuchtern, nebst erforderlichen sauberen Stühlen ausgezieret». 19 Ursprünglich war nur ein Konzert vorgesehen, doch daraus wurden vier – man stand um die Konzertkarten Schlange. Unter den Zuhörern der vier Konzerte befand sich auch der Kaiserliche Rat Johann Caspar Goethe mit seinem vierzehnjährigen Sohn. «Ich habe Mozart als 7 jährigen Knaben gesehen, wo er auf einer Durchreise ein Konzert gab. Ich selber war etwa 14 Jahre alt, und ich erinnere mich des kleinen Mannes in seiner Frisur und Degen noch ganz deutlich…» (Johann Wolfgang Goethe zu Johann Peter Eckermann, 3. Februar 1830) Zwischen den Konzerten blieb der Familie Zeit für Spaziergänge und Besichtigungen. Leopold Mozarts Reisetagebuch führt die Sehenswürdigkeiten auf: die Schnurgasse (sie ist auf dem Merianplan noch zu sehen, wurde später jedoch überbaut), die Zeil (wo schon damals wichtige Handelshäuser standen), den Roßmarkt und den Markt, natürlich den Römerberg und den Liebfrauenberg, die Kapuziner- und die Dominikanerkirche, die alte Mainbrücke, die Vorstadt Sachsenhausen mit dem Deutschordenshaus und schließlich das Forsthaus außerhalb der Stadt – ein beliebtes Ausflugsziel. Im Die Nannerl trägt zum spazieren gehen einen Englischen Hut, wie es in diesen gegenden bey Frauenzimmern mode ist.Wenn wir so zu Salzburg: durch die Strassen giengen, lieffe es alles zusamm, als wenn der Rhinoceros käme. Leopold Mozart an Lorenz Hagenauer, Frankfurt, 20. August 1763 18. Jahrhundert versammelte sich hier das Gefolge des Kaisers und der Fürsten zum feierlichen Einzug anläßlich der Krönungen. diplomatischen Agenten Friedrich Melchior Grimm mit; er sollte ihm später in Paris alle Türen öffnen. Leopold Mozart knüpfte in den reichen Bürgerhäusern wichtige Kontakte. Fast alle bedeutenden Honoratioren der Stadt waren Besucher der Konzerte gewesen oder hatten die Mozarts zu sich eingeladen, darunter der Kaiserliche Gesandte Johann Anton von Pergen, der Bürgermeister Johann Isaac Mohrs, kirchliche Würdenträger wie Damian Friedrich Dumeiz, Komponisten wie David Otto, Johann Christoph Fischer und Maestro Francesco Maggiore, Bankiers und Händler wie die Gebrüder Bethmann, Angehörige der Familie Sarasin und Abraham Chiron (um nur einige zu nennen). Am 31. August 1763 fuhr die Familie mit dem Marktschiff zurück nach Mainz.Von dort ging es weiter über viele Stationen – so auch nach London und nach Paris. Eine unbekannte Frankfurter Kaufmannsgattin gab Leopold einen Empfehlungsbrief an den 20 Ich habe Mozart als 7jährigen Knaben gesehen, wo er auf einer Durchreise ein Konzert gab. Ich selber war etwa 14 Jahre alt, und ich erinnere mich des kleinen Mannes in seiner Frisur und Degen noch ganz deutlich… Johann Wolfgang Goethe zu Johann Peter Eckermann, 3. Februar 1830 Rechts oben: Der siebenjährige Mozart am Klavier – so dürfte Johann Wolfgang Goethe ihn erlebt haben. Mitte links: So sieht es im Schärfengäßchen/Ecke Holzgraben heute aus. Unten links: Leopold Mozarts Reisetagebuch mit den tabellarischen Aufzeichnungen zu seinem Frankfurter Aufenthalt. Hier sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und die bedeutendsten Personen verzeichnet. Unten rechts: Die Familie Mozart beim Musizieren: Vater Leopold spielt die Geige, Schwester Nannerl singt, Wolfgang spielt Klavier. Stich von J. B. Delafosse nach einem Bild von L. C. de Carmontelle (1763/64). 8. GASTHAUS «ZUM WEISSEN SCHWAN», STEINWEG 12 Als Wolfgang Amadeus Mozart im September 1790 erneut nach Frankfurt kam, verbrachte er die zweite Nacht seines Aufenthalts im «Weißen Schwan» im Steinweg. Auch von diesem Gebäude ist nichts mehr geblieben; wir stehen vor einem modernen Geschäftshaus. Heute erinnert eine Gedenktafel nur noch an Bismarcks Friedensschluß von 1871, der im «Weißen Schwan» unterzeichnet worden ist. Theaterdirektor Heinrich Böhm wohnte in der Kalbächer Gasse (der sogenannten «Freßgass’») im alten «Backhaus». Bis heute haben sich hier immer wieder Bäckereien, Konditoreien und Feinkostgeschäfte angesiedelt. Die Unterkunft war tatsächlich einigermaßen billig (und offenbar wenig komfortabel). Zum Vergleich: Frau Rat Goethe gab in einem Brief nach Weimar die Auskunft, zur Kaiserkrönung müsse man schon elf Gulden pro Nacht veranschlagen, plus 2 Gulden für die Verpflegung. 9. «BACKHAUS», KALBÄCHER GASSE 10 Schon am nächsten Tag zog Mozart wieder um: Den Theaterdirektor Böhm kannte Mozart schon lange. Seine Truppe hatte im Wechsel mit zwei anderen Gesellschaften für die theatralischen Lustbarkeiten während der Krönungszeit zu sorgen. «Wo glaubst du daß ich wohne – bey Böhm im nemlichen Hause; Hofer auch. wir zahlen 30 gulden das Monath, und das ist noch ausserordentlich wenig. – wir gehen auch zu ihnen in die kost.» Glaubt man den Briefen an Konstanze, so hat Mozart in den ersten Tagen seines Frankfurter Aufenthalts vor allem gearbeitet: Mozart kompo- 8. ZUM «WEISSEN SCHWAN», STEINWEG 12 9. «BACKHAUS», KALBÄCHER GASSE 10 Oben: Das Haus Kalbächer Gasse 10 heute. Im alten «Backhaus» hat Mozart zusammen mit dem Theaterdirektor Böhm gewohnt; heute ist es eine begehrte Adresse für Feinschmecker. Rechts: Wolfgang Amadeus Mozart beim Komponieren, den Mantel flüchtig über die Stuhllehne geworfen, als sei er schon auf dem Heimweg von seinen musikalischen Inspirationen überrascht worden – so stellte sich die Nachwelt das Leben des Genies vor. … ich lebe hier bis dato noch ganz retiré – gehe den ganzen Morgen nicht aus, sondern bleibe in meinem Loch von einer Stube und schreibe; – meine ganze Unterhaltung ist das Theater, wo ich dann Bekannte genug antreffe, von Wien, München, Mannheim und sogar Salzburg… Mozart an Konstanze, Frankfurt den 3. Oktober 1790 Links: Der Komödienplatz mit dem 1782 erbauten Theater in einer Ansicht von 1793. Mozart und später auch sein Sohn Franz Xaver haben hier einige Aufführungen gesehen. Im Komödienhaus wurden viele MozartOpern gespielt. 1792 wurde es zum «Frankfurter Nationaltheater» und erhielt ein eigenes Ensemble. Nach der Eröffnung der Oper (heute Alte Oper) wurde es als Schauspielhaus genutzt. Unten links: Blick von der Kalbächer Gasse auf den Rathenauplatz heute: An dieser Stelle befand sich das Komödienhaus. Unten rechts: Blick in den Zuschauerraum und auf die Bühne des Komödienhauses (um 1800). 10. RATHENAUPLATZ nierte ein Adagio für ein Orgelwerk, um seinem «lieben Weibchen etwelche Ducaten in die Hände zu spielen» – möglicherweise handelte es sich dabei um ein Auftragswerk für das Wachsfigurenkabinett des Grafen Deym in Wien (KV 594). 10. RATHENAUPLATZ Das prächtige Komödienhaus lag am heutigen – wenig imposanten – Rathenauplatz und galt als einer der schönsten Theaterbauten in Deutschland. «Das neue Komödienhaus macht in der That den Frankfurtern Ehre. Es ist dauerhaft und mit Geschmack gebaut. Es sind drey Reihen Logen im Halbzirkel, alle Logen tapeziert, mit Spiegelleuchtern versehen und noch eine geräumige Gallerie für das Volk.» Zur Zeit der Kaiserkrönung 1790 gab es Singspiele und italienische Opern: «Der Apotheker und der Doktor» sowie «Betrug durch Aberglauben» von Dittersdorf, Salieris «Axur, König von Ormus» und «Der Talisman oder die Zigeuner», Bendas «Romeo und Julie», Wranitzkys «Oberon» und manches mehr. Nur nichts von Mozart. Das ist insofern eigenartig, als Mozarts Opern schon früh und mit großem Erfolg in Frankfurt gespielt wurden. Die kurmainzische Schauspielergesellschaft wollte zwar am 5. Oktober seinen «Don Giovanni» spielen, doch zerschlug sich dieser Plan aus unbekannten Gründen. Ob Leopold II. eine geplante MozartAufführung höchstselbst verhindert hat, sei dahingestellt. Mit diesen anerkennenden Worten bedachte die «Berliner Literatur- und Theaterzeitung» am 19. Oktober 1782 das neue Theater. 23 11. KATHARINENKIRCHE Bei seinen Spaziergängen durch Frankfurt kam Mozart auch in die Katharinenkirche, wo er sich zum Mißvergnügen des alten Organisten seinen musikalischen Phantasien überließ (siehe Zitat unten). 12. ZEIL Mit der beschaulichen Zurückgezogenheit der ersten Tage war es bald vorbei: Mozart wurde überall herumgereicht und in den ersten Häusern zum Essen eingeladen: «P.S.: Gestern habe ich bei dem reichsten Kaufmann in ganz Frankfurt gespeist, bei Herrn Schweitzer», teilt er Konstanze am 3. Oktober mit. Franz Maria Schweitzer, Bankier und Seidenhändler, ließ von 1787-1792 ein prächtiges Palais auf der Zeil bauen, das nachmals als «Russischer Hof» zu einer ersten Adresse der Stadt wurde. Außerdem war Mozart bei dem angesehenen Stadtphysicus Johann Wilhelm Friedrich Dietz zu Gast. Der kunstsinnige Dietz bewohnte ein geräumiges Haus auf der Zeil gegenüber dem Gasthof zum «Römischen Kaiser» (Ecke Schäfergasse) und war für seinen lebenslustigen, geradezu verschwenderischen Lebensstil bekannt (wodurch er sich schließlich um seinen ganzen Besitz brachte). Hier begegnete Mozart auch Johann August Tabor, dem Pächter des Komödienhauses, und dem Kammerherrn Ignaz von Beecké, einem brillanten Klavierspieler.Wenn er nicht eingeladen war, verbrachte Mozart mit seinen neuen Frankfurter Freunden die Abende in der Weinwirtschaft Kran in der Bleidenstraße. Von all diesen Häusern haben wir nur noch historische Bilder. 11. KATHARINENKIRCHE 12. ZEIL Eines Sonntags nach beendigtem Gottesdienste kommt Mozart auf das Orgelchor zu St. Katharina und bittet sich’s bei dem alten Organisten aus, etwas auf der Orgel spielen zu dürfen. Er setzt sich auf die Bank und folgt dem kühnen Fluge seiner Phantasie, als ihn plötzlich der alte Organist in der unhöflichsten Weise von der Orgelbank stößt und zu dem Schüler sagt: merke dir diese letzte Modulation, welche Herr Mozart gemacht; das will ein berühmter Mann sein, und macht so grobe Verstöße gegen den reinen Satz? Bericht eines alten Frankfurter Organisten, der diese Szene als junger Schüler erlebt hatte … – und dann, es ist alles Prallerey was man von den Reichsstädten macht. – berühmt, bewundert und beliebt bin ich hier gewis; übrigens sind die leute aber hier noch mehr Pfennig-fuchser als in Wienn. Mozart an Constanze, Frankfurt, 8. Oktober 1790 Oben links: Ankündigung zu Mozarts Konzertmatinee am 15. Oktober 1790. Was genau gespielt wurde, läßt sich nicht mit Sicherheit rekonstruieren. Der von Mozart erhoffte finanzielle Erfolg blieb jedenfalls aus. Rechts: Der Stadtphysicus Johann Friedrich Wilhelm Dietz (1735 – 1805), bei dem Mozart des öfteren zu Gast war. Er bewohnte ein geräumiges Haus auf der Zeil gegenüber dem Gasthof «Zum Römischen Kaiser». Er besaß Mozart-Autographe, die sämtlich verschollen sind. Unten links: Hauptwache und Katharinenkirche Als Mozarts Konzert am 15. Oktober 1790 endlich im Komödienhaus stattfinden konnte, war der Höhepunkt der Krönungsfeierlichkeiten schon vorbei; viele Gäste waren bereits wieder abgereist. «… heut 11 Uhr war meine Academie, welche von Seiten der Ehre herrlich, aber in Betreff des Geldes mager ausgefallen ist. – Es war zum Unglück ein groß Dejeuné bei einem Fürsten und großes Manoever von den Hessischen Truppen … ich war aber ohngeacht diesem allen so gut aufgelegt, und gefiel so sehr, daß man mich beschwor, noch eine Academie künftigen Sonntag zu geben – Montag reise ich dann ab.» (Mozart an Konstanze, Frankfurt, 15. Oktober 1790) Die genaue Programmfolge läßt sich nicht mehr ausmachen. Es dürfte wohl eine der drei 1788 entstandenen Symphonien Es-Dur KV 543, g-Moll KV 550 oder C-Dur KV 551 gespielt worden sein, außerdem das Klavierkonzert in FDur KV 459 oder auch das in D-Dur KV 537 sowie Arien anderer Komponisten. Mozarts freie Improvisation war ein besonderer Höhepunkt. Noch vor der angekündigten letzten Symphonie wurde das Konzert abgebrochen – es hatte drei Stunden gedauert, und den Zuhörern knurrte der Magen. Die drei Frankfurter Zeitungen – «Journal», «Oberpostamtszeitung» und «Staats-Ristretto» – berichteten jeden Tag ausführlich von den gesellschaftlichen Ereignissen rund um die Kaiserkrönung; von Mozarts «Academie» nahmen sie jedoch keine Notiz. Zu einem zweiten Konzert kam es nicht mehr. Am 16. Oktober reiste Mozart ab. 25 Links: «Hinter der Schlimmen Mauer»: Hier befand sich das Peterssche Haus, in dem Johann Nepomuk Schelble gewohnt hat. Rechts: Und so sieht es heute in diesem Stadtgebiet aus: Neubau der Telekom Stiftstraße 25. 13. STIFTSTRASSE 14. ZEIL 13. STIFTSTRASSE/ ECKE STEPHANSTRASSE Dreißig Jahre später, Anfang Dezember 1820, kam Mozarts jüngster Sohn Franz Xaver Wolfgang im Verlauf seiner dreijährigen Konzertreise in Frankfurt an. Auch er wollte in der Freien Stadt sein Glück machen. Johann Nepomuk Schelble, der berühmte Sänger und Gründer des Frankfurter Cäcilien-Vereins, rechnete es sich zur besonderen Ehre, Mozarts jüngsten Sohn in seinem Hause aufzunehmen. Schelble wohnte im Petersschen Haus «Hinter der Schlimmen Mauer». Hier fanden Chorproben und kleinere Konzerte statt. Inzwischen sieht es hier ganz anders aus; die «Schlimme Mauer» gibt es nicht mehr. Ganz in der Nähe residiert die Telekom in einem Neubau, der in seiner gläsernen Kühle ein markantes Emblem des neuen Frankfurt ist. 26 14. ZEIL – EHEMALIGE HAUPTPOST Am 5. Dezember – Mozarts Todestag – führte der Cäcilien-Verein im «Rothen Haus» auf der Zeil im Beisein Franz Xaver Mozarts das Requiem auf – kurioserweise ohne Orchester, weil die Musiker am selben Abend «Figaros Hochzeit» zu spielen hatten. Der Neubau des «Rothen Hauses» (Zeil Lit D 21-23, später Nr. 52) war 1769 eröffnet worden. Später befand sich hier die Hauptpost. Das gesamte Gebiet wird zur Zeit neu gestaltet. Im «Rothen Haus» hatten sich Johann Wolfgang Goethe und Thronfolger Karl August von Weimar kennengelernt. Es wurde für Konzerte und zeitweise sogar als eine Art Spielcasino genutzt. Am 15. Dezember 1820 gab der junge Mozart in diesem Haus selbst ein Konzert, wieder unter Mitwirkung des Cäcilien-Vereins. Anders als die «Academie» des Vaters vor dreißig Jahren erfreute sich dieses Konzert eines lebhaften Zuspruchs. «Frankfurt am Main. Das Concert des Hrn. Mozart war eines der glänzendsten und besuchtesten der letzten Zeit. Die von dem Concertgeber vorgetragenen Stücke seiner Composition beurkundeten Talent und gründliche Kenntniss des Satzes. Das erste Allegro eines Pianoforte-Concerts ist gewiss höchst ausgezeichnet zu nennen; auch die Variationen über ein russisches Thema zeugen von Geschmack und Fantasie. – Die Aufführung der grossen Mozart’schen Sinfonie aus C mit der Fuge gelang vollkommen und entflammte zur Begeisterung. Hr. Schelble sang zwey Arien aus Titus mit bekannter Vorzüglichkeit… Den Schluss machte eine, hier noch nicht gehörte Cantate von Mozart; von den Mitgliedern des Cäcilien-Vereins ausgezeichnet vorgetragen.» So berichtete die «Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung». Links: Die Zeil mit dem «Rothen Haus». Hier erlebte Franz Xaver Wolfgang Mozart eine denkwürdige Aufführung von Mozarts Requiem durch den Cäcilien-Verein. Der Saal war schwarz drapiert und festlich beleuchtet, die Zuhörer erschienen in Trauerkleidung; es wurden Gedichte aufgesagt. Zehn Tage später konzertierte Franz Xaver selbst im «Rothen Haus» und wurde begeistert gefeiert. Unten: Franz Xaver Wolfgang Mozart Abends war dann die eben so feyerliche als rührende Todtenfeyer meines Vaters. In einem schwarz behängten Saale, wurde von dem Caecilien Singverein das Requiem meines Vaters, mit ausserordentlicher Präzißion und wundervollem Vortrage gesungen. Es blieb nichs zu wünschen übrig, als eine Orchester Begleitung, die doch bey der Vortrefflichkeit des hiesigen Orchesters, von herrlicher Wirkung hätte seyn müssen. Obwohl nur vom Claviere unterstützt, sehr viele Thränen flossen. Aus dem Reisetagebuch Franz Xaver Mozarts, 5. Dezember 1820 Diesen Vormittag verließ ich Frankfurt, wo ich viele schöne Stunden verlebte, die ich aber alle Schelble, und einigen Mitgliedern des Vereins verdanke. Die übrigen Leute, lauter lederne Kaufmanns-Seelen, bekümmerten sich gar nicht um mich. Aus dem Reisetagebuch von Franz Xaver Mozart, 3. Januar 1821 Oben: Johann Nepomuk Schelble (1789 – 1837), berühmter Sänger und Leiter des Cäcilien-Vereins. In seinem Hause wohnte Franz Xaver Mozart während seines Frankfurter Aufenthalts. Links: Marianne Willemer (1784 – 1860), eine der Gründerinnen des Cäcilien-Vereins. Sie war mit Johann Wolfgang Goethe befreundet, hatte maßgeblichen Anteil an dessen «Westöstlichem Divan» und berichtete in ihren Briefen viel von der Arbeit des Cäcilien-Vereins. Franz Xaver Mozart war mehrfach bei ihr und ihrem Mann zu Gast. Unten links: In diesem «Haus zum Rothen Männchen» zwischen Mainzergasse und Mainkai hatten Johann Jakob und Marianne Willemer ihre Stadtwohnung. Später befand sich hier eine Badeanstalt. Unten rechts: Der Verleger Johann André (1775 – 1842). Er erwarb Mozarts Nachlaß und brachte viele bislang unveröffentlichte Werke des Komponisten in seinem Verlag heraus. Franz Xaver Mozart besuchte ihn im Dezember 1820. 15. ALTE MAINZER GASSE / MAINKAI 35 Während seines Frankfurter Aufenthalts traf Franz Xaver Mozart mit den wichtigsten Persönlichkeiten des musikliebenden Frankfurter Bürgertums zusammen: Er war zum Soupé bei Wilhelm Manskopf eingeladen, musizierte bei der Familie Passavant, unternahm Ausflüge nach Offenbach zum Verleger Johann André. Er lernte den Komponisten Franz Xaver Schnyder von Wartensee und den Konzertmeister Heinrich Hoffmann kennen. Im Theater – es war noch immer das schöne Komödienhaus, in dem einst sein Vater konzertiert hatte – sah er Boieldieus «Kalifen von Bagdad» und Süßmayrs Singspiel «Soliman der Zweite oder Die drei Sultaninnen». Auch bei der Familie Neufville war der junge Mozart zu Gast: Es waren die Nachkommen jener Bankiers, über deren Bankrott 1763 Großvater Leopold berichtet hatte. Eine nicht unbeträchtliche Rolle im Frankfurter Musikleben spielte Marianne von Willemer. Sie war die treibende Kraft bei der Gründung des Cäcilien-Vereins gewesen und hoffte, auf diese Weise auch Johann Wolfgang Goethe wieder für das kulturelle Leben der Stadt Frankfurt zu interessieren. In ihren Briefen an Goethe ist oft von Schelble und von der Arbeit des Chores die Rede. Franz Xaver Mozart war mehrfach bei Willemers zu Gast – wahrscheinlich im Haus an der Mainfront, und nicht in der Gerbermühle. 15. ALTE MAINZER GASSE / MAINKAI 35 Johann Jakob Willemer hatte das Haus «Zum rothen Männchen» (ursprünglich «Mündelein») 1796 erworben. Es reichte von der heutigen Alten Mainzer Gasse 5 bis zum Mainkai 35. In den großzügig gestalteten Räumen dieses stattlichen Hauses konnte die Familie Willemer einen gediegenen Luxus entfalten. Der Schiffslandeplatz befand sich direkt vor seinen Fenstern; man blickte auf die großen Kräne, die schon Leopold Mozart 1763 bewundert hatte. Sie waren bis weit ins 19. Jahrhundert hinein in Gebrauch. städte sage. Immerhin: Das Frankfurter Musikleben stand durch den Cäcilien-Verein in voller Blüte, Franz Xaver gründete zu Hause seinen eigenen Cäcilien-Verein, und Johann Nepomuk Schelble schrieb in Mozarts Stammbuch: «Nimm theurer Freund beym Abschiede meine Liebe und Verehrung mit Dir! Kurz nur warst Du mir gegeben, aber unvergänglich, was ich empfing. Möge der Himmel uns bald wieder zusammen führen und wenn es möglich ist, auf immer.» Nach einem «ziemlich langweiligen» Silvesterabend bei der Familie Bernard und diversen Abschiedsbesuchen reiste Franz Xaver Mozart am 3. Januar 1821 aus Frankfurt ab. Sein Fazit (Zitat Seite 24) läßt ein wenig an die Worte seines Vaters denken, es sei «alles Prallerey», was man über die Reichs29 MOZART 2006 Bitte informieren Sie sich auf unserer Internetseite: www.holzhausenschloesschen.de Hier finden Sie die wichtigsten Termine verschiedener Veranstalter zum Mozartjahr in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet: www.mozart-in-frankfurt.de Die Internationale Stiftung Mozarteum Salzburg ist Eigentümerin und Betreiberin von Mozarts Geburtshaus und vom Mozart-Wohnhaus und verfügt über die größte Mozart-Bibliothek der Welt (Bibliotheca Mozartiana).Weitere Informationen: www.mozarteum.at Veranstaltungen anderer Städte können Sie auf der Website der «Europäischen Mozart-Wege» ausfindig machen. Außerdem können Sie dort Mozarts Reisen kreuz und quer durch Europa anhand einer Karte nachvollziehen: www.mozart2006.at 30 BILDNACHWEISE Seiten 1 (Titelbild), 10 oben, 10 links, 10 rechts, 19, 21 rechts oben, 21 rechts unten, 22, 27 unten, 28 oben: Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main, Seiten 2f., 5, 6, 8f., 13 links, 14 links, 14 oben, 16 oben links, 16 unten, 17 unten, 17 rechts, 18, 23 links, 23 unten rechts, 24 oben rechts, 24 unten rechts, 26 oben links, 26 Mitte, 28 unten links: Historisches Museum Frankfurt am Main, Seiten 12, 25 oben rechts: Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes der Freien Reichs-,Wahl- und Handelsstadt Franckfurt am Mayn, mitgetheilet von Johann Bernhard Müller, Franckfurt am Mayn 1747 (Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main), Seiten 21, unten links, 25 oben links, 28 unten rechts: nach Albert Richard Mohr: Das Frankfurter Mozart-Buch, Frankfurt am Main 1968 Fotografien: Sabine Teuscher, vividprojects GmbH Design: www.vividprojects.de STIFTEN MACHT GESCHICHTE Als Vorbild und Anregung für ein reichhaltiges Leben in Frankfurt am Main und im Blick auf 1200 Jahre Stadtgeschichte gründeten Frankfurter Bürger die Frankfurter Bürgerstiftung mit dem Sitz im Holzhausenschlößchen zur wissenschaftlichen Erforschung und zur Darstellung der Geschichte Frankfurter Bürger, ihrer vielfältigen Initiativen, Institutionen und ihrer Stiftungen. Die Frankfurter Bürgerstiftung, die es seit ihrer Gründung im Jahre 1989 als ihre Aufgabe ansieht, in unserer Stadt die alten Stiftertraditionen wiederzubeleben, und deshalb gern selbst zum Stiften anstiftet, geht mit gutem Beispiel voran. Die Frankfurter Bürgerstiftung arbeitet ohne städtische oder staatliche Subventionen. Dabei steht die Erforschung verschiedener Familien, Persönlichkeiten, Institutionen und ihrer Stiftungen genau so im Zentrum der Stiftungsarbeit wie auch die jährlich ca. 200 Kulturveranstaltungen in den Bereichen Musik, Lesungen,Vorträge, Kinderveranstaltungen und Ausstellungen. Auch ein jährlich am ersten Samstag im September, zu Ehren des Stifters Adolph Freiherr von Holzhausen, stattfindendes großes Kinderfest wird von der Frankfurter Bürgerstiftung finanziert und durchgeführt. In seinem Testament vom 19. April 1923 schrieb Baron von Holzhausen: «Dieses Fest soll alljährlich im Gedenken an meinen Geburtstag am 7. September oder Anfang September von der Stadt Frankfurt, meiner Erbin, abgehalten werden und zwar für Kinder der Umgebung, und insbesondere soll meiner und der Freiherren von Holzhausen in einer Ansprache würdige Erwähnung getan werden.» Die Frankfurter Bürgerstiftung griff diesen Gedanken über sechzig Jahre nach dem Tod des Stifters zum ersten Mal auf und setzt sich auch für weitere Projekte im Sinne des Stifters ein: So renovierte die Bürgerstiftung das alte Zufahrtstor zum Holzhausenschlößchen, gestaltet das direkte Umfeld des Schlößchens im alten Stil und führte nicht zuletzt im Jahr 1994 eine aufwendige Renovierung des Holzhausenschlößchens durch. Die Frankfurter Bürgerstiftung versteht aber unter »Stiften« nicht nur das Geben von Gut und Geld, sondern ebenso das Einbringen von Ideen, weitblickendem Unternehmergeist, Zeit, sozialem Engagement, kurzum alle privaten Initiativen, die eine Stadtkultur für Frankfurt am Main prägen. Daraus resultiert ein vielfältiges, interessantes Stiftungsprogramm mit zahlreichen kulturellen und wissenschaftlichen Aktivitäten. (Weitere Hinweise hierzu: www.holzhausenschloesschen.de und siehe Monatsprogramm.) Das Holzhausenschlößchen ist zu einem beliebten Treffpunkt vieler Frankfurter Stiftungen und zu einem interessanten Gesprächsforum für die Bürger unserer Stadt geworden. Herzlich willkommen! FRANKFURTER BÜRGERSTIFTUNG IM HOLZHAUSENSCHLÖSSCHEN JUSTINIANSTR. 5 • 60322 FRANKFURT/MAIN TEL. (069) 55 77 91 • FAX (069) 59 88 05 WWW.HOLZHAUSENSCHLOESSCHEN.DE