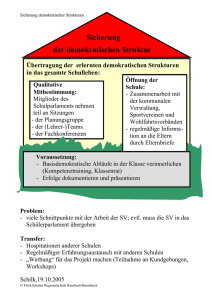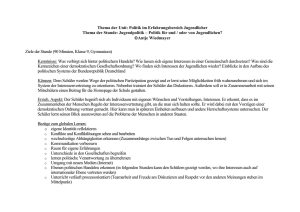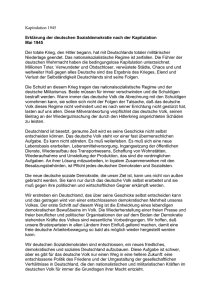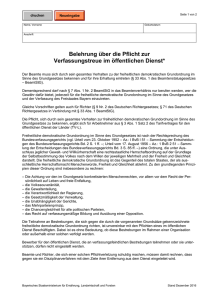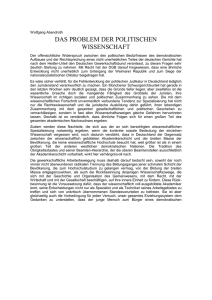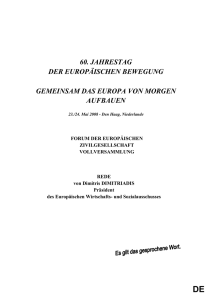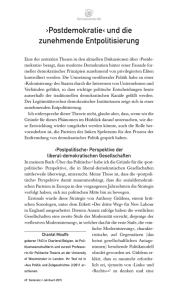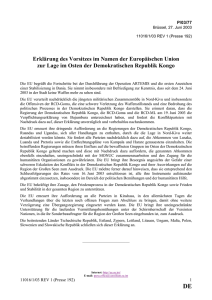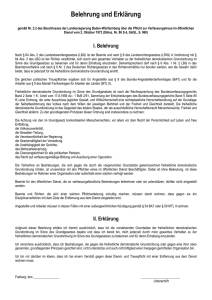„Kommunalwahlrecht für Nicht-EU-BürgerInnen – ein Ding der
Werbung
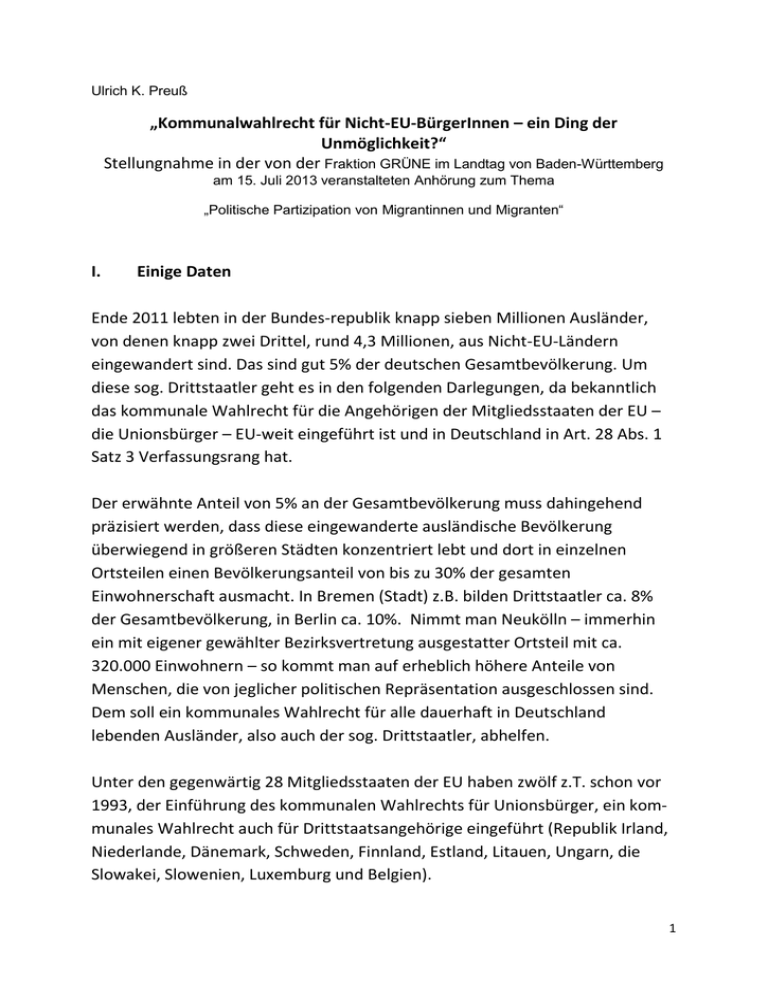
Ulrich K. Preuß „Kommunalwahlrecht für Nicht-EU-BürgerInnen – ein Ding der Unmöglichkeit?“ Stellungnahme in der von der Fraktion GRÜNE im Landtag von Baden-Württemberg am 15. Juli 2013 veranstalteten Anhörung zum Thema „Politische Partizipation von Migrantinnen und Migranten“ I. Einige Daten Ende 2011 lebten in der Bundes-republik knapp sieben Millionen Ausländer, von denen knapp zwei Drittel, rund 4,3 Millionen, aus Nicht-EU-Ländern eingewandert sind. Das sind gut 5% der deutschen Gesamtbevölkerung. Um diese sog. Drittstaatler geht es in den folgenden Darlegungen, da bekanntlich das kommunale Wahlrecht für die Angehörigen der Mitgliedsstaaten der EU – die Unionsbürger – EU-weit eingeführt ist und in Deutschland in Art. 28 Abs. 1 Satz 3 Verfassungsrang hat. Der erwähnte Anteil von 5% an der Gesamtbevölkerung muss dahingehend präzisiert werden, dass diese eingewanderte ausländische Bevölkerung überwiegend in größeren Städten konzentriert lebt und dort in einzelnen Ortsteilen einen Bevölkerungsanteil von bis zu 30% der gesamten Einwohnerschaft ausmacht. In Bremen (Stadt) z.B. bilden Drittstaatler ca. 8% der Gesamtbevölkerung, in Berlin ca. 10%. Nimmt man Neukölln – immerhin ein mit eigener gewählter Bezirksvertretung ausgestatter Ortsteil mit ca. 320.000 Einwohnern – so kommt man auf erheblich höhere Anteile von Menschen, die von jeglicher politischen Repräsentation ausgeschlossen sind. Dem soll ein kommunales Wahlrecht für alle dauerhaft in Deutschland lebenden Ausländer, also auch der sog. Drittstaatler, abhelfen. Unter den gegenwärtig 28 Mitgliedsstaaten der EU haben zwölf z.T. schon vor 1993, der Einführung des kommunalen Wahlrechts für Unionsbürger, ein kommunales Wahlrecht auch für Drittstaatsangehörige eingeführt (Republik Irland, Niederlande, Dänemark, Schweden, Finnland, Estland, Litauen, Ungarn, die Slowakei, Slowenien, Luxemburg und Belgien). 1 II. Die Rechtslage in Deutschland nach den Urteilen des BVerfG vom 31. Oktober 1990 (BVerfGE 83/37 u. 83/60) Auf die mir gestellte Frage „Kommunalwahlrecht für Nicht-EU-BürgerInnen – ein Ding der Unmöglichkeit?“ kann ich im Augenblick nur mit einem klaren „Ja“ antworten. Denn alle bisherigen Versuche, durch Gesetz ein kommunales Wahlrecht für Drittstaatler einzuführen, scheiterten unmittelbar oder mittelbar an zwei Urteilen des Bundesverfassungsgerichts vom 31. Oktober 1990, durch die ein schleswig-holsteinisches und ein hamburgisches Gesetz, die unter bestimmten Voraussetzungen Ausländern ein Wahlrecht zu den Gemeindeund Kreisvertretungen bzw. zu den Bezirksvertretungen zuerkannt hatten, für grundgesetzwidrig erklärt wurden1. An diese Urteile halten sich die Gesetzgeber der Länder und des Bundes gebunden, und auch in der rechtswissenschaftlichen Literatur wird diese Rechtsauffassung überwiegend vertreten. Ohne eine Grundgesetzänderung ist danach das kommunale Ausländerwahlrecht in Deutschland in der Tat unmöglich. Es gibt auch Autoren, die sogar die Einführung des kommunalen Ausländerwahlrechts für Drittstaatler durch eine Grundgesetzänderung für unzulässig halten, da dadurch die sog. Ewigkeitsklausel des Art. 79 Abs. 3 GG verletzt werde. Die verfassungsrechtliche Sperre für die Einführung eines kommunalen Ausländerwahlrechts für Drittstaatler ist also fest in der deutschen Jurisprudenz gegründet – auch noch fast ein Vierteljahrhundert nach jenen Urteilen, so, als wäre inzwischen gesellschaftlich und auch verfassungstheoretisch nichts geschehen. Für einen Nicht-Juristen klingt es vermutlich paradox, dass die Verfassungswidrigkeit des kommunalen Ausländerwahlrechts für Drittstaatler ausgerechnet aus dem demokratischen Prinzip abgeleitet wird. Denn schliesslich soll dieses Recht ja doch die demokratische Legitimation der örtlichen Verwaltung durch die Wahlberechtigung aller, die ihrer Entscheidungsgewalt unterliegen, erhöhen. Aber das Bundesverfassungsgericht hat dem demokratischen Prinzip des Grundgesetzes eine Auslegung gegeben, aus der der Ausschluss von Ausländern – ausgenommen EU-Ausländer – vom Wahlrecht, auch vom kommunalen Wahlrecht, geradezu zwingend folgt. Lassen Sie mich diese Auslegung kurz 1 BVerfGE [Entscheidungssammlung des Bundesverfassungsgerichts Bd.] 83/37 u. 83/60. 2 skizzieren, bevor ich mich dem grundlegenden Fehler dieser Argumentation zuwende. Dreh- und Angelpunkt der Frage ist Art. 28 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes; er lautet: In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Die Frage lautet: Wer ist das Volk? Wer gehört zum Volk? Die Antwort des BVerfG lautet: Volk ist das deutsche Volk, die Gesamtheit der deutschen Staatsangehörigen. Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG bestimme, dass das Staatsvolk der Bundesrepublik Deutschland Träger und Subjekt aller Staatsgewalt ist. Diese Norm lautet: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“. Wie sich aus der Präambel des Grundgesetzes, dem Artikel 146 und verschiedenen anderen Regelungen ergebe, in denen auf das Volk Bezug genommen werde, sei darunter stets das deutsche Staatsvolk zu verstehen, das sich aus den deutschen Staatsangehörigen und den ihnen nach Art. 116 Abs. 1 GG gleichgestellten Personen zusammensetze. Das Wahlrecht, durch dessen Ausübung das Volk die ihm zustehende Staatsgewalt auf den verschiedenen Ebenen des Staatsaufbaus ausübt, setze jeweils die Eigenschaft als Deutscher voraus. So könne gemäß Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG die den Bundesländern zukommende Staatsgewalt ebenfalls nur von Deutschen wahrgenommen werden. Dasselbe gelte gem. Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG auch für die Wahl zu Vertretungen des Volkes in Kreisen und Ge meinden. Diese Vorschrift gewährleiste für alle Gebietskörperschaften auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland die Einheitlichkeit der demokratischen Legitimationsgrundlage und trage damit der besonderen Stellung der kommunalen Gebietskörperschaften im Aufbau des demokratischen Staates Rechnung. Das BVerfG vertrat hier eine Auffassung, die eine ehrwürdige theoretische Tradition aufweisen kann. Es ist die Tradition der demokratischen Nation, oder richtiger: der nationalen Demokratie. Sie entstammt der französischen Revolution und postuliert die Selbstherrschaft des in der Nation geeinten Volkes – Volk als Nation und Volk als demos sind in diesem Konzept identisch. An der Willensbildung des Volkes = Demos können danach nur Angehörige der Nation teilnehmen, denn nur dann bedeutet Demokratie Selbstbestimmung der Nation. Die Beteiligung von Nicht-Angehörigen der Nation an demokratischen Prozessen verletzt danach die Selbstbestimmung der Nation. 3 III. Kritik der Demokratie-Konzeption des BverfG Diese Demokratie-Konzeption hat, wie gesagt, eine ehrwürdige Tradition. Aber ist sie auch die Demokratiekonzeption des Grundgesetzes? Hier bestehen erhebliche Zweifel. Die Idee der Selbstherrschaft der Nation, d.h. die Kongruenz von Nation und Demokratie, beruht auf der Annahme, dass diejenigen, die die Gesetze machen – der Demos – personengleich ist mit denjenigen, die den Gesetzen unterworfen sind. Das ist der Sinn des Begriffs der Selbst-Herrschaft. Das war ein Ideal des 19. Jahrhunderts, das vielleicht bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts noch eine gewisse Plausbilität hatte, aber im 21. Jahrhundert – im Zeitalter globaler Wanderungen und poröser Staats- und Nationsgrenzen – keine Überzeugungskraft mehr besitzt. Längst sind nicht mehr diejenigen, die die Gesetze machen bzw. in deren Namen die Gesetze gemacht werden – die Staatsangehörigen – kongruent mit denen, für die diese Gesetze gelten. Die oben genannten Zahlen bestätigen das für Deutschland: wenn ca. 8% der dauerhaft in Deutschland lebenden Einwohner aus demokratischen Gründen von der Teilnahme an der Ausübung von staatlicher Herrschaft ausgeschlossen sind, dann ist das ein Problem der Demokratiekonzeption, die dieses nicht nur gutheißt, sondern von Verfassungs wegen gebietet. Und wenn auf kommunaler Ebene bis zu 15% der Einwohnerschaft von der Gestaltung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft ausgeschlossen sind, dann droht diese auch noch im Namen der Demokratie herbeigeführte Spaltung der Bevölkerung in Berechtigte und Rechtlose die Überzeugungskraft des demokratischen Prinzips nachhaltig zu beschädigen. An einer Stelle scheint das Gericht selbst Zweifel bekommen zu haben. Es entspreche der demokratischen Idee, insbesondere dem in ihr enthaltenen Freiheitsgedanken, „eine Kongruenz zwischen den Inhabern demokratischer politischer Rechte und den dauerhaft einer bestimmten staatlichen Herrschaft Unterworfenen herzustellen“ (BVerfGE 83, 37 [52]). Das Gericht erkennt damit implizit an, dass in der Wirklichkeit der heutigen Demokratien eine solche Kongruenz nicht mehr besteht. An sich war damit das Fundament seiner Demokratietheorie bereits erschüttert. Doch es beharrte darauf, dass das Junktim von Staatsangehörigkeit und Staatsgewalt unauflöslich sei und schlug stattdessen vor, den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit zu erleichtern. Aus Zeitgründen kann ich auf dieses Argument nicht eingehen, nur so viel: dieser Weg zur Vermeidung des Ausländerwahlrechts funktioniert nicht, schon allein deswegen nicht, weil, wie die statistischen Zahlen zeigen, die große Zahl der legal und dauerhaft in Deutschland lebenden Ausländer gar nicht die deutsche Staatsangehörigkeit erstrebt. 4 Nun könnte man ja einräumen, dass das Demokratiekonzept des BVerfG zwar traditionalistisch einem Ideal des ausgehenden 18. und des 19. Jahrhunderts anhänge, dieses nun aber einmal das Konzept des Grundgesetzes sei und ohne dessen Änderung – unterstellt, man hielte das mit Art. 79 Abs. 3 vereinbar – das kommunale Ausländerwahlrecht in Deutschland nicht eingeführt werden könne. Doch so ist es nicht. Das Demokratiekonnzept des BVerfG – man könnte es als Opas Demokratietheorie bezeichnen – ist nicht das des Grundgesetzes. Denn wenn das Grundgesetz vom demokratischen Prinzip handelt, dann meint es keinesfalls die Selbstbestimmung des Volkes als Nation, sondern die Selbstbestimmung der Menschen, die das das politische Gemeinwesen konstituieren und seiner Autorität unterworfen sind. 1. Wir müssen also das Verhältnis zwischen dem Begriff des Volkes zu dem der Demokratie auf der Grundlage des Grundgesetzes, nicht auf der Grundlage einer inzwischen zur Ideologie abgesunkenen Verfassungstheorie des 19. Jahrhunderts bestimmen. Zu Recht stellt das Bundesverfassungsgericht in dem zitierten Satz fest, dass dem demokratischen Prinzip der Freiheitsgedanken innewohne, und zwar der Gedanke der Freiheit der Individuen, nicht eines Kollektivs, in das das Individuum eingeschmolzen ist und seine Subjektivität weitgehend einbüßt. Das Grundgesetz spricht an verschiedenen Stellen von der „freiheitlichen demokratischen Grundordnung“2 und bekräftigt damit den in der modernen Demokratietheorie jedenfalls der westlichen Verfassungsstaaten vorherrschenden Gedanken, dass es der Demokratie um die Freiheit und Selbstbestimmung der Individuen in dem und durch das politische Gemeinwesen geht. In einer zunehmend post-national orientierten Welt verbindet sich im Bewußtsein der Menschen mit dem Begriff der Demokratie weltweit, wie die Demokratiebewegungen der letzten Dekaden bis in die Gegenwart hinein zeigen, nicht primär das Streben nach nationaler Identität, sondern das Versprechen des Respektes für die Würde der Person und ihres aus dieser Würde abgeleiteten Anspruchs auf faire Teilhabe an der Gestaltung der alle, also auch sie betreffenden Angelegenheiten. Die genaue Lektüre des Grundgesetzes zeigt, dass dies auch die in ihm niedergelegte Demokratiekonzeption ist. Von zentraler und für das weitere Verständnis der Normen des Grundgesetzes wegweisender Bedeutung ist Artikel 1. In Art. 1 Abs. 2 GG bekennt sich das Deutsche Volk zu „unverletzlichen und unveräusserlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft“, also auch des Staates der Bundesrepublik. Der Charakter dieses Staates wird in Art. 20, der laut Art. 79 Abs. 3 zweiten tragenden Säule der Verfassungsidentität Deutschlands, im Einzelnen bestimmt. Wegweisend auch hier wieder2 Art. 10 II;11 II; 18; 21 II; 73 I Nr. 10; 87a IV; 91 I 5 um Absatz 1, der in einem Satz die Selbstqualifizierung der Bundesrepublik als politische Entität enthält: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“ Dieser Satz definiert gemeinsam mit Art. 1 den normativen Gehalt der bundesrepublikanischen Verfassung. Er ist der Obersatz, für den es in den folgenden Absätzen Spezifizierungen gibt. Und dieser Satz definiert den politischen Kern der Bundesrepublik nicht als Staat, dessen Leben sich im Staatswillen vollzieht, sondern als politisches Gemeinwesen (K. Hesse). Die Verfassung öffnet sich zur Gesellschaft, ist nicht nur Verfassung der im Staat organisierten Nation. Die Verfassung ist „Staats- verfassung und Gesellschaftsverfassung in einem, wenngleich in unterschiedlicher Dichtigkeit“ (Hollerbach), ja, mit Art. 20 Abs. 1 ist „zum ersten Male in der deutschen Verfassungsgeschichte eine staatliche Verfassung mit dem rechtsverbindlichen Anspruch hervorgetreten, auch die Verfassung gesellschaftlicher Organisationen auf bestimmte Grundprinzipien festzulegen“ (Ridder). Was hier von größter Bedeutung ist: das politische Gemeinwesen Bundesrepublik ist demokratisch als Ganzes; das demokratische Prinzip bezieht sich nicht nur, wie in der staatslzentrierten Verfassungstheorie der Tradition des 19. Jahrhunderts, auf den Staat, sondern auf das Gesamtpolitikum, in dem der Staat nur ein, wenn auch zentrales Element ist. Wir können diese bedeutsame Neuformulierung des demokratischen Prinzips im Grundgesetz selbst und auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, insbesondere seines Ersten Senats, leicht auffinden. 2. Das prominenteste Beispiel ist Art. 21, der Stellung und Funktion der politischen Parteien regelt. Gem. Abs. 1 Satz 2 sind sie frei gebildete gesellschaftliche Vereinigungen, die bei der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken. Nach Satz 3 muß ihre „innere Ordnung … demokratischen Grundsätzen entsprechen“. Nach der Rechtsprechung de BVerfG nehmen die politischen Parteien „an der politischen Willensbildung des Volkes vornehmlich durch ihre Beteiligung an den Wahlen teil, die ohne die Parteien nicht durchgeführt werden könnten“. Doch mindestens ebenso intensiv sind die Parteien an der Meinungs- und Willensbildung des Volkes, d.h. bei der Formung der politischen Öffentlichkeit beteiligt, ohne die Wahlen ihren demokratischen Charakter verlören und zu einem rein formalen Akt der Stimmenregistrierung degenerierten. Mit anderen Worten, das Grundgesetz erstreckt das demokratische Prinzip auch explizit auf einen bedeutsamen nicht-staatlichen Lebensbereich, indem es die der Staatswillensbildung vorausliegende Sphäre der gesellschaftlichen Kommunikation als Bestandteil der demokratischen, genauer: der feiheitlichen demokratischen Ordnung qualifiziert. Nur am Rande sei bemerkt, 6 dass heute ganz selbstverständlich AusländerInnen an der demokratischen inneren Willensbildung der Parteien rechtmäßig teilnehmen. Bedenkt man, dass, wie Hans Meyer feststellt, die politischen Parteien „schätzungswiese über 80% der späteren Abgeordneten vor allem wegen der starren Liste faktisch allein schon durch die Nominierung (bestimmen)“, so zeigt sich, dass AusländerInnen bereits jetzt als integrale Teile des „Parteivolks“ in den Prozess der demokratischen Willensbildung in den Ländern und im Bund eingebunden sind. 3. Als zweites Beispiel für die Auflösung der ausschliesslichen Bindung des demokratischen Prinzips an die Staatswillensbildung sei hier die Rechtsprechung des BVerfG, insbesondere seines Ersten Senats, zu den Kommunikationsgrundrechten des Grundgesetzes genannt. Sie werden dort in einen engen Zusammenhang mit dem Demokratieprinzip gestellt. Wegweisend wurde die in der Lüth-Entscheidung formulierte und später immer wieder bekräftigte Aussage, dass das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung des Art. 5 GG „als unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt“ und für „eine freiheitlichdemokratische Staatsordnung … schlechthin konstituierend“ sei3. Hier wird der Zusammenhang zwischen dem Freiheitsrecht des Art. 5 und dem demokratischen Prinzip explizit als für das GG „schlechthin konstituierend“ bezeichnet. Dabei ist besonders beachtlich, dass Art. 5 im Gegensatz zu Art. 8 (Versammlungsfreiheit), für den in späteren Entscheidungen ganz ähnlich argumentiert wurde, ein Jedermann-Grundrecht ist, d.h. nicht nur für Deutsche gilt. Hier wird also ebenfalls, wie schon bei der Verknüpfung des demokratischen Prinzips mit der Parteienfreiheit, demokratische Teilhabe auf alle jeweils betroffenen Menschen unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit bezogen. Was folgt aus diesen Argumenten? Es folgt, wie es schon vor mehr als zwanzig Jahren Brun-Otto Bryde treffend ausgedrückt hat, dass „Staatsgewalt … nicht nur von ‚Volk‘ ausgehen, sondern ‚Volk‘ … auch im Licht des demokratischen Prinzips definiert werden [muß], so daß der Ausschluß erheblicher Gruppen der Bevölkerung mit Hilfe eines restriktiven Volksbegriffs keine besonders gute Verwirklichung, sondern eine Einschränkung von Demokratie ist“4. IV. Das demokratische Prinzip auf der kommunalen Ebene Diese auf den ersten Blick sehr theoretischen Ausführungen zum Verhältnis des Volksbegriffs zum Begriff der Demokratie des Grundgesetzes hätte ich Ihnen ersparen können, wenn die hier einschlägigen Urteile des BVerfG nicht den Grundsatz aufgestellt hätten, dass die Gleichung Demokratie = Volksherrschaft 3 4 BVerfGE 7, 198 [208] Bryde in StWuStP 1994/305 [324]. 7 = Herrschaft der Gesamtheit der deutschen Staatsangehörigen nicht nur für die in Art. 20 Abs. 2 GG geregelte Ebene des Bundes, sondern auch für die Länder und die Gemeinden gelte. Einschlägig ist hier der Art. 28 Abs. 1 GG; er lautet: „Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sind auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe von Recht der Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar. …“ Ich beschränke mich hier auf die kommunale Ebene. Das BVerfG leitete aus Art. 28 Abs. 1 GG das oben bereits erwähnte Prinzip der Einheitlichkeit der demokratischen Legitimationsgrundlage ab – jede gewählte Vertretungskörperschaft, angefangen vom Bundestag über die Landtage und die Gemeindevertretungen bis hin zu dem gewählten Einwohnerbeirat eines Stadtteils, sofern er nur Entscheidungen z.B. über die Ausgabe von Haushaltsmitteln zur Gestaltung von Kinderspielplätzen hat, gilt nur dann als demokratisch legitimiert, wenn sie ausschließlich von Deutschen gewählt worden ist. Nach diesem Prinzip gibt es in Deutschland keine lokale Demokratie, d.h. keine Form der Selbstbestimmung der durch die Gemeinschaft der örtlichen Verhältnisse in ihren Interessen betroffenen Einwohner. Jede kommunale Entscheidung muss vielmehr Ausdruck des Willens des örtlich definierten deutschen Volkes sein; der Gesamtwillen der tatsächlich örtlich ansässigen Bevölkerung ist für die Legitimation kommunalpolitischer Entscheidungen unbeachtlich. Wenn aber zwischen 10 und 20% vielleicht sogar mehr – der örtlichen Bevölkerung von der Mitgestaltung der gemeinsamen örtlichen Angelegenheiten ausgeschlossen sind, dann bedeutet das, dass der örtlichen Gemeinschaft als solcher das Recht zur lokalen Selbstbestimmung vorenthalten wird. Dies kann schon deshalb nicht richtig sein, weil damit der oben dargelegte Zusammenhang zwischen dem demokratischen Prinzip mit der Freiheit des Einzelnen und der in Art. 1 GG geschützten Menschenwürde – d.h. der Kern der freiheitlichen demokratischen Ordnung – zerrissen wird. Das Beharren auf dem Prinzip der Einheitlichkeit der demokratischen Legitimationsgrundlage ist aber auch aus einem anderen Grunde verfassungsrechtlich nicht (länger) haltbar. Dies liegt an dem oben zitierten Satz 3 des Art. 28 Abs. 1, der das kommunale Wahlrecht für Unionsbürger, d.h. für EU-Ausländer einführt. Zum Zeitpunkt der hier diskutierten Entscheidungen des BVerfG gab es diese Vorschrift noch nicht; sie wurde erst mehr als zwei Jahre später im Zusammenhang mit der Ratifikation des Maastricht-Vertrages in das Grundgesetz 8 eingefügt5. Durch die Einführung des kommunalen Wahlrechts für EU-Ausländer wurde die Einheitlichkeit der demokratischen Legitimationsgrundlage für den Bund, die Länder und die Kommunen aufgehoben. Denn die wahlberechtigten Unionsbürger wurden durch diese Vorschrift nicht etwa Mitglieder des deutschen Volkes – sie blieben Ausländer, waren aber dennoch teilhabeberechtigt im Sinne des für die Gemeinden gem. Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG geltenden demokratischen Prinzips. M.a.W., das Grundgesetz hat in Art. 28 Abs. 1 selbst explizit die in den Urteilen vom 31. Oktober 1990 behauptete Identität von demokratischem Prinzip und Herrschaftslegitimation durch ausschließlich Deutsche aufgehoben. Enthält das demokratische Prinzip ein wie immer eingeschränktes Wahlrecht für Ausländer, dann mag es so sein, dass mit dem Begriff „Volk“ im Grundgesetz stets nur die Gesamtheit der Deutschen gemeint ist. Aber die Nichtzugehörigkeit von Ausländern zu diesem Volk der Deutschen schliesst sie, wie Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG ausweist, nicht von dem Prozess der demokratischen Legitimation aus. Das Wahlrecht für Ausländer ist danach mit dem demokratischen Prinzip vereinbar. Nun könnte man argumentieren, dass es sich bei dem Kommunalwahlrecht für Unionsbürger um eine Ausnahme von dem fortbestehenden Prinzip handelt, dass nach dem Grundgesetz demokratische Legitimation nur durch Deutsche möglich sei. Man könnte das vielleicht sogar akzeptieren, wenn diese Ausnahme von vornherein einen begrenzten und feststehenden Personenkreis betreffen würde, für dessen Einbeziehung in die demokratische Legitimationskette es sachliche Gründe gibt – etwa den, dass diese Ausländer den Deutschen besonders nahe stehen oder aus sonstigen Gründen mit den Deutschen gleichgestellt werden. Doch das ist nicht der Fall. Zum einen ist die Gruppe der Unionsbürger keine feststehende Größe; sie verändert sich vielmehr mit jedem Beitritt eines neuen Landes, wobei der Beitritt noch nicht einmal eine Grundgesetzänderung erfordert. Zum Zeitpunkt des Erlasses der hier erörterten Urteile des BVerfG vom 31. Oktober 1990 hatte die EU 12 Mitglieder, heute gehören ihr 28 Staaten an. Der Kreis der mit den Deutschen Gleichgestellten unterliegt damit einer ständigen Erweiterung. Der einfache Gesetzgeber kann also ehemalige Drittstaatler in Unionsbürger verwandeln und wird das in der Zukunft mit einiger Wahrscheinlichkeit auch weiterhin tun (z.B. Beitritt Serbiens, Montenegros, Kosovo, u.U. auch die Türkei). Einen solchen rechtlich-politischen Mechanismus kann man nicht als eine Ausnahme von einem Grundsatz des kommunalen Wahlrechts ausschließlich für Deutsche ansehen. 5 Durch das 38. G. zur Änderung des GG v. 21. 12. 1992 (BGBl. I S. 2086). 9 Etwas Grundsätzliches kommt hinzu: Aus der Sicht der vom BVerfG und weiten Teilen der Verfassungsrechtslehre vertretenen Theorie der Identität des demokratischen Prinzips mit der Selbstbetimmung der Deutschen gibt es einen normativ begründeten prinzipiellen Unterschied zwischen dem politischen Status eines Deutschen und dem eines Ausländers. Es gibt aber kein Argument für einen ebenso grundsätzlichen Statusunterscheid zwischen verschiedenen Arten von Ausländern. Der Ausschluss aller Ausländer vom kommunalen Wahlrecht in der Theorie des BVerfG beruhte nicht etwa darauf, dass Deutsche und Ausländer bei der Regelung örtlicher Angelegenheiten unterschiedlich betroffen seien – das sind sie offenkundig nicht. Der Grund liegt nach dieser Theorie darin, dass die Demokratie eine Herrschaftsform der Selbstbestimmung des deutschen Volkes ist. Danach werden deutsche Staatsangehörige (und die ihnen gem. Art. 116 GG rechtlich Gleichgestellten) vor der Mitwirkung von Nicht-Deutschen jeglicher Art an ihrer, der deutschen kollektiven Willensbildung geschützt; sie werden nicht vor der Mitwirkung nur bestimmter NichtDeutscher geschützt. Gewiss gehört Deutschlands Mitgliedschaft in der EU gem. Art. 23 GG zu den fundamentalen Staatszielen des GG. Aber Art. 24 bis 26 GG dokumentieren das nicht weniger fundamentale Verfassungsprinzip der offenen Staatlichkeit, d.h. der Öffnung Deutschlands zur Weltgemeinschaft und zum Respekt des internationalen Rechts und seiner Prinzipien der Nicht-Diskriminierung. Und es trifft auch zu, dass aufgrund des Art. 20 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union [AEUV] – eines völkerrechtlichen Vertrages – nur Unionsbürger das aktive und passive Wahlrecht zum Europäischen Parlament und bei den Kommunalwahlen besitzen; Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG hat für die Kommunalwahlen die innerstaatlichen Verfassungsvoraussetzungen geschaffen. Aber die Bevorzugung von ausländischen Unionsbürgern vor anderen Ausländerkategorien ist verfassungsrechtlich nur in dem Umfang erlaubt, in dem das zur Erfüllung rechtmäßiger vertraglicher Verpflichtungen erforderlich ist. So ist die Beschränkung des Wahlrechts zum EP auf Deutsche und auf ausländische Unionsbürger deshalb gerechtfertigt, weil es bei dieser Wahl um die demokratische Repräsentation gerade der Unionsbürger geht. Zum Europäischen Parlament können daher nur Bürger der EU aktiv und passiv wahlberechtigt sein. Eine Unterscheidung zwischen ausländischen Unionsbürgern und Drittstaatlern hat aber bei der Wahl zu kommunalen Vertretungen keine sachliche Berechtigung, da es einen spezifischen Bezug der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zur Gesamtbürgerschaft der Europäischen Union nicht gibt. Vor allem aber: EU-Recht fordert an keiner Stelle, dass nur ausländische Unionsbürger und nich auch andere Ausländer das aktive und passive Wahlrecht zu kommunalen Wahlen erhalten dürfen. Die Verpflichtung aller EU-Mit10 gliedsstaaten aus Art. 20 Abs. 2 des AEUV bildet kein Hindernis dagegen, über den Kreis der ausländischen UnionsbürgerInnen hinaus auch allen anderen ausländischen Gemeindeeinwohnern das kommunale Wahlrecht zu gewähren. Fassen wir zusammen. Aus zwei Gründen folgt, dass das Grundgesetz einer Ausdehnung des kommunalen Wahlrechts auf sog. Drittstaatler nicht im Wege steht: Erstens, das Grundgesetz identifiziert das demokratische Prinzip – eines der tragenden, jeglicher Verfassungsänderung entzogenen Grundsätze des Grundgesetzes – nicht mit dem aus der Verfassungstradition des ausgehenden 18. und des 19. Jahrhundert stammenden kollektivistischen Prinzip der nationalen Selbstbestimmung. Mit dem Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bringt das GG vielmehr zum Ausdruck, dass das in ihm festgelegte demokratische Prinzip ein Medium der Freiheit und der Selbstbestimmung der Individuen ist, die unter gemeinsamen Gesetzen und Institutionen leben. Der auf die Nation verengte Volksbegriff muss um diese Dimension der Selbstbestimmung der Einzelnen erweitert werden. Das demokratische Prinzip verlangt daher, dass eine Kongruenz zwischen den Inhabern demokratischer politischer Rechte und den dauerhaft einer bestimmten staatlichen Herrschaft Unterworfenen unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft hergestellt werden muss. Zweitens hat das Grundgesetz in Art. 28 Abs. 1 Satz 3 ausdrücklich die Offenheit des demokratischen Prinzips für die Mitwirkung von Ausländern an der demokratischen Willensbildung jedenfalls der örtlichen Gemeinschaft bestimmt. Diese Verfassusngsnorm hat die Einbeziehung von Ausländern in die demokratische Legitimation von kommunalen Entscheidungen anerkannt und damit die vom BVerfG behauptete Sperre gegen eine Beteiligung von Ausländern am Prozess demokratischer Letitimation zuminest auf kommunaler Ebene beseitigt. Deutschlands verfassungsrechtlich gewollte Mitgliedschaft in der EU (Art. 23 GG) bietet keinen rechtlich erheblichen Grund für eine Differenzierung zwischen verschiedenen Kategorien von Ausländern im Hinblick auf die demokratische Legitimation kommunaler Entscheidungen. 11 12