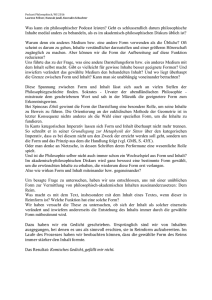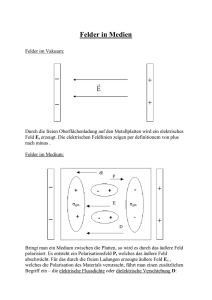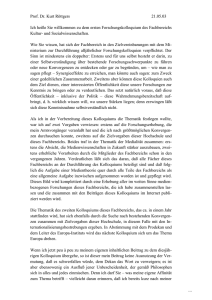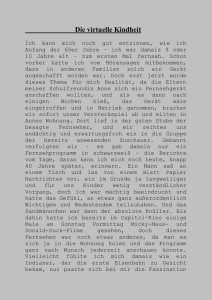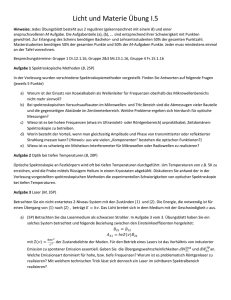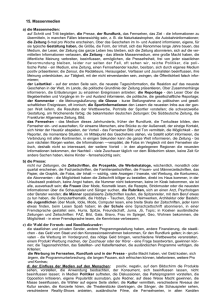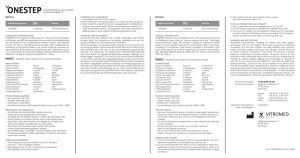Technik als Medium und Reflexionsbegriff
Werbung

Christoph Hubig Technik als Medium und „Technik“ als Reflexionsbegriff 1. Technik als Medium Innerhalb der neueren technikphilosophischen Diskussion hat sich die Rede von einer „Medialität des Technischen“ (Gamm 2000, Hubig 2000; 2006) etabliert. Es mag dies als Turn von einem „weiten“ Technikkonzept als „Inbegriff der Mittel“ (Weber 1976, 32) hin zu einer Neufassung des Konzepts erscheinen, die sich der Konjunktur der Medienphilosophie verdankt. Richtet diese sich doch in generalisierender Absicht „auf eine übersehbare Bedeutungsfülle“ von „Medium“ (Hoffmann 2002, 20), und mag sie sich dabei auf eine Anwendbarkeit des Medienbegriffs „auf nahezu jedes Phänomen“ (Baecker 1999, 174) stützen. Ein Allgemeinplatz würde dann durch einen anderen ersetzt, und der „Aufstieg zum Konkreten“ (Marx) würde verpasst. Gleichwohl erscheint mir dieser Übergang sinnvoll und notwendig. Notwendig wird er, wenn man den ersten Allgemeinplatz Max Webers hinterfragt, sinnvoll wird er, wenn den aufgewiesenen Reflexionsdefiziten durch neue Bestimmungen entsprochen werden kann, zur Bearbeitung von Problemlagen, für die bisher keine geeignete Terminologie zur Verfügung stand. Technik als Inbegriff versammelt in der Tat Mittel kategorial inhomogener Art wie (1) einschlägige Fähigkeiten und Fertigkeiten, (2) die in bestimmten Verfahrensschemata (Prozesstypes) bestimmten Weisen des Herstellens und Veränderns von Dingen, Zuständen und Verfahren selbst, (3) das Wissen um diese Schemata (auch „Technologie“), (4) das konkrete Agieren und Prozessieren (als token) des Bewirkens, (5) die bei diesem Bewirken eingesetzten Artefakte als raumzeitliche Entitäten und schließlich (6) die Ergebnisse eines derartigen Bewirkens als realisierte Zwecke (im Unterschied zu natürlich gewordenen/ „gewachsenen“), die ihrerseits als Mittel einsetzbar sind (Hubig 2006, 281). Von einem Inbegriff sprechen wir freilich dann (und nur dann), wenn seine Elemente unter einem „einheitlichen Interesse“ und einem „einheitlichen Bemerken“ stehen (Husserl, Hua XII, 23; 74). Max Weber sah dieses Interesse in einer Verwendung von Mitteln, „welche bewusst und planvoll orientiert ist […]“ (1976, 32). Dies führte zu einem weiten Konzept von Technik, die es damit für „alles und jedes Handeln“ (ebd.) gibt. Seitens der klassischen Technikphilosophie gab und gibt es Spezifizierungsversuche, die auf Technik als „Realtechnik“ abheben und entsprechende terminologische Eingrenzungen unternehmen. Das „Planvolle“ am Mitteleinsatz verweist uns jedoch auf die unabdingbar zur Technik gehörenden Intellektualtechniken präziser Repräsentation, Berechnung etc. (die ihrerseits auf technisch hergestellte materiale Träger angewiesen sind) sowie auf Sozialtechniken, die zur Realisierung komplexerer Realtechniken notwendig sind und dabei ihrerseits bestimmter Intellektualtechniken der Repräsentation ihrer Regeln als auch bestimmter Realtechniken als Formen der Ermöglichung von Organisation bedürfen. Ein „gemeinsames Interesse“ menschlicher Technik liegt, wie wir sehen werden, neben dem Realisieren von Zwecken überhaupt in der „Sicherung“ (Heidegger 1962) der Realisierung von Zwecken qua Wiederholbarkeit, Planbarkeit, Antizipierbarkeit. Diese Sicherung wird gewährleistet durch die technischen Systeme seit der neolithischen Revolution, die die Zufallstechnik der Jäger und Sammler ablöste, und gibt den Ermöglichungsgrund ab für Mittel als technische Mittel. Durch systemische Überformung (Behausung, Ackerbau und 1 Eine Problematisierung der objektstufigen Unterscheidung „natürlich-technisch“ findet sich in Abschn. 2.1. Hier geht es nur um die Auflistung eines Sprachgebrauchs. Viehzucht mit Umhegung und Bewässerung, Infrastrukturen des Verkehrs, der Kommunikation, der Verteidigung etc.) werden die natürlichen Medien der Jäger und Sammler zu technischen, artifizialisierten Medien. Durch diese Gestaltung natürlicher Medien soll die Möglichkeit eines zielführenden Mitteleinsatzes abgesichert werden. Eine verkürzte Sicht auf den bloßen Mittelcharakter von Technik charakterisiert die klassische philosophisch-anthropologisch orientierte Technikphilosophie, die in diesem verkürzten Sinne zu einer technomorphen Philosophie wird: Der Mensch erscheint als technisches Problem, zu dessen Lösung Technik erforderlich wird, oder die Evolution selbst erscheint als Problemlösungsprozess, innerhalb dessen Technik verortet wird. Mal erscheint dann der Mensch als Mängel- oder Überschusswesen oder er erscheint als Krone oder Katastrophe der Evolution, je nachdem, wie sein Arsenal technischer Mittel in einem größeren, seinerseits technisch modellierten Problemzusammenhang verortet wird (Hubig 2006, Kap. 3). Die Vielfalt dieser anthropologischen Meinungen verdankt sich dem Spielraum der Modellierung von Sachlagen als technischen Problemlagen (Weiteres hierzu unter 2.1). Greift man auf das Konzept „Medium“ zurück, findet man neben einer Vielfalt von terminologischen Eingrenzungen, die unterschiedlichen Fragestellungen geschuldet sind, nur einen letztlich metaphorischen Kern. Dieser weist allerdings Eigenschaften einer eigentlichen und absoluten Metapher auf (König 1994, 156-176; vgl. Snell 1946), die nicht einfach in Begriffe übersetzbar ist, auch nicht bloß heuristische Funktion hat, sondern eine grundlegende Orientierung unseres Denkens ausdrückt, die bestimmte Strategien der Explikation formiert, also Vorstellungen zu erzeugen erlaubt und nicht ihrerseits Gegenstand einer Vorstellung ist. Eine solche Metapher appelliert gleichsam, dasjenige zu erschließen, worauf sie den Blick lenkt. Und dies ist, was im weitesten Sinne „Möglichkeit“ ausmacht, von der wir keine direkte Vorstellung gewinnen, sondern zu deren Erschließung wir uns weiterer (abgeleiteter) Metaphern bedienen, z. B. der des „Raumes“. Ich habe entsprechend versucht, „technische Medialität“ mit den Mitteln der philosophischen Modaltheorie weiter zu untersuchen (Hubig 2006, Kap. 5; vgl. Hubig 20092). Erachtet man Technik als Inbegriff der Mittel (auf den erwähnten verschiedenen Ebenen), so berührt man diejenige Seite des Handelns, die man als instrumentelles Handeln oder in der Sprache des Ingenieurs als „Steuern“ bezeichnen kann: Die Erzeugung eines Outputs durch einen geeigneten Input. Spezifisch menschliches Agieren als technisches Handeln ist darüber hinaus darauf aus, Mittel-Zweck-Verknüpfungen zu sichern, indem der Mitteleinsatz gegen Gefahren unserer äußeren und inneren Natur geschützt wird. Dies ist im Konzept der Regelung i.w.S. erfasst, die im Rahmen technischer Systeme realisiert wird: „Perfekte Regelung macht gelingende Steuerung möglich“ (Ashby 1974, 290). Elementare Regelungsformen sind Abschirmung/Containment, höherstufige Steuerung durch Störgrößenaufschaltung (indem ein Modell der Störung – Intellektualtechnik! – erlaubt, präventiv oder reaktiv unerwünschte Effekte zu kompensieren) und schließlich die Regelung i.e.S. (DIN 19226), in der über Rückkopplung die durch die Störung hervorgerufene Abweichung selbst als Steuerungsimpuls zur Korrektur eingesetzt wird. Erst dadurch werden Erwartbarkeit und Planbarkeit gegeben; dass eine solche Konstruktion gerade dasjenige ausmacht, was wir als naturwissenschaftliches Experiment erachten, erklärt, warum eine solchermaßen technisierte Naturwissenschaft eine naturwissenschaftlich orientierte Technik ermöglichte und umgekehrt. 2 Für eine praktische Technikphilosophie/Technikethik hat dieser Ansatz zur Konsequenz, dass nicht der Einsatz technischer Artefakte ihr eigentliches und spezifisches Thema ist (derlei regelt die allgemeine Ethik mit), sondern die Gestaltung der Möglichkeitsräume technischen Handelns. (Dies gilt analog für die Medienethik i.e.S., deren Thema nicht ist, ob man in einem Medium lügen darf, sondern wie die Medien der Kommunikation zu gestalten sind; und es gilt für die Wirtschaftsethik, deren Thema nicht ist, ob man beim Handel betrügen darf, sondern wie die Systeme des Wirtschaftens anzulegen sind, s. Hubig 2007.) 2 Nun zu den einzelnen Schritten des oben erwähnten „Turns“ – in ausgearbeiteter Form findet sich die Argumentation in Hubig 2006: 1.1 Mittel und Zwecke Mittel und Zwecke lassen sich nicht per se, sondern nur korrelativ bestimmen. Äußere Gegenstände und Ereignisse sind Mittel nur nach Maßgabe ihrer Zuordenbarkeit, ihrer Dienlichkeit zur Realisierung möglicher Zwecke. Zwecke als intendierte Sachverhalte sind dies nur nach Maßgabe einer unterstellten Herbeiführbarkeit (sonst handelt es sich um bloße Wünsche). Dienlichkeit und Herbeiführbarkeit sind Dispositionsprädikate, die nicht auf manifeste Eigenschaften reduzierbar sind; auf der Basis ihrer Aktualisierungen gewinnen wir ein immer unvollständiges Bild ihrer Verfasstheit, welches gleichwohl für die Handlungsplanung unabdingbar ist. Solche Konzepte von Mittel und Zweck bezeichne ich mit Hegel als diejenigen „innerer Mittel“ und „innerer Zwecke“. Den Unterschied zwischen unseren inneren Mittelkonzepten als Vorstellungen und äußeren Mitteln (analog bei den Zwecken) erfahren wir über Widerständigkeit, Hemmung und Überraschung, die sich beim instrumentellen Handeln einstellen und dann wiederum konzeptualisiert werden. Hegel hat im Teleologie-Kapitel seiner Wissenschaft der Logik diese Begriffsdynamik freigelegt, indem er das Konzept des Mittels als Mittelbegriff in einem praktischen Syllogismus verortete: Subjekt (S) will durch Mittel (M) den Zweck (Z) realisieren (M und Z als innere, „subjektive“, vorgestellte) S identifiziert einen äußeren Gegenstand oder ein äußeres Verfahren M’ als Mittel (M) S realisiert durch M’ den äußeren („objektiven“) Zweck Z’ S schließt abduktiv aus der Differenz zwischen Z und Z’ auf Eigenschaften der Medialität von M’. „Medium“ wird von Hegel als „Auch von Eigenschaften“ gefasst (Hegel 1957, 91). Auch John Dewey unterscheidet zu recht zwischen äußeren und inneren Mitteln. Unter „inneren Mitteln“ begreift er aber die intrinsische/interne Beziehung zwischen Eigenschaften des Mittels und des Zweckes. Deshalb nennt er „innere Mittel“ auch „Medien“. Dieser Begriffsgebrauch ist zu wenig differenziert. Denn die Übertragung von Eigenschaften des Mittels auf den Zweck ist auch ein äußerer (kausaler) Vorgang. Als vorgestellter Vorgang betrifft er die innere Mittelhaftigkeit, als realisierter Vorgang ist äußere. Daher sollte man von inneren und äußeren Mitteln sowie von innerer und äußerer Medialität sprechen. Durch das komplexe Verhältnis zwischen den (inneren und äußeren) Mitteln und (inneren und äußeren) Zwecken sowie aufgrund der Notwendigkeit einer permanenten Veränderung der Konzepte, die sich aus dem tatsächlichen technischen Vollzug ergibt, erweist sich die Rede von Technik als System bereits bestimmter Mittel für bestimmte Zwecke als unterkomplex. Somit muss der Begriff Technik vielmehr als System der Dienlichkeit und Herbeiführbarkeit verstanden werden. Dies bedeutet, dass den Mitteln ein Potenzial unterstellt wird bzw. sich dieses während des praktischen Vollzugs als unerwartetes Potenzial zur Konzeptualisierung anbietet. Ein technisches Sachsystem stellt mithin eine Potenzialfunktion dar, die erst dann zu einer Realfunktion wird, wenn das Sachsystem als handlungsrelevant identifiziert und in konkrete Handlungszusammenhänge integriert worden ist (Hubig 2006, 173 f.). Zur Erfassung dieser Potenzialfunktion scheint mir der Begriff Medium ein geeigneter Ausgangspunkt weiterer Klärung zu sein. 3 1.2 Technik als Medium Da wir Möglichkeiten nur in und durch Erfahrung erschließen können und müssen, unterliegt das, was wir als „möglich“ erachten, einer permanenten Veränderung. Der Möglichkeitsraum als ganzer kann somit nie Gegenstand einer Vorstellung werden (abgesehen vom „logischen Raum“ eines Kalküls). Orientieren wir uns nun zur Explikation der Medialität des Technischen am technischen Handlungsvollzug, so erscheint Technik als Medium auf zwei Ebenen, die ihrerseits jeweils eine Dimension innerer (vorgestellter) Medialität und äußerer (im Realitätszugang erfahrener) Medialität aufweisen: 1. Auf der Stufe allgemeiner Planung wird ein Möglichkeitsraum der Realisierung möglicher Zwecke unterstellt. Er ist strukturiert auf der Basis unserer epistemischen Möglichkeiten, disponible Ursachen zu unterscheiden. Dieser Möglichkeitsraum weist daneben eine „äußere“ Dimension auf: Die notwendige (technische) Möglichkeit einer Trennung jener Dispositionen als „umherschweifenden Ursachen“ (Plato, Timaios 51 c) als Voraussetzung ihrer Nutzung. Den Raum dieser „Ursachen“ als Dispositionen bezeichnete Plato als Chora. Es ist der vorgestellte („innere“) und reale („äußere“) Raum von Machbarkeit und Verfügbarkeit. Seine Struktur macht die „Bahnen“ (Eugen Fink), oder, um einen beliebten, aber undifferenziert verwendeten Topos in der Medialitätsdiskussion anzubringen, die „Spuren für …“ die Realisierung möglicher Zwecke aus. Es ist die Ebene einer potenziellen Ermöglichung, ausgedrückt im operativen Gebrauch von „möglich“ als „es ist möglich, dass …“. 2. Unter dieser Konstellation epistemischer Unterscheidungsoptionen und realer Trennungsoptionen wird nun ein Wirklichkeitsraum der Realisierung möglicher Zwecke geschaffen als technisches System, welches diese Zweckrealisierung gelingend machen soll. Wir befinden uns hier auf der Ebene realer Ermöglichung oder der sogenannten „Performanz des Medialen“ (Sybille Krämer 2000, 90). Als innere Medialität besteht dieser Raum in einem Katalog von Funktionsideen/Erwartungen (für Konstrukteure, Entwickler und Nutzer); als äußere Medialität schlagen sich diese Funktionsideen in den Infrastrukturen der technischen Systeme des Transports, der Wandlung und Speicherung von Stoffen, Energie und Information nieder. Niklas Luhmann (1992) spricht hier von lose gekoppelten Systemen. Instrumentelles Handeln besteht nun in der Aktualisierung der in jenem Wirklichkeitsraum angebotenen (möglichen) Mittel-Zweck-Relationen. Dabei wird die Erfahrung der Differenz zwischen vorgestelltem und realisiertem Zweck gezeitigt, über die die Technik als Medium eine „Spur von …“ in Gestalt von unerwarteten (positiven oder negativen) Effekten hinterlässt. Leistungen und Grenzen der realen Ermöglichung (ausgedrückt in der prädikativen Verwendung von „möglich“ i.e.S. von „kann wirken“ (hervorbringen, verändern, verhindern etc.)) werden ersichtlich und erlauben über einen abduktiven Schluss das Verhältnis von vorgestellten Funktionsideen zu realisierten Funktionsideen (Medialität (2)) sowie von epistemischen Unterscheidungen angesichts der Möglichkeiten eines technischen Umgangs mit Dispositionen (Medialität (1)) zu korrigieren und somit schrittweise die Vorstellung der Technik als Medium zu verbessern. Eine gelingende oder misslingende „feste Kopplung“ der lose gekoppelten Elemente eines Mediums, mithin die Herstellung einer Form innerhalb eines Mediums (um auf die bei Niklas Luhmann von Fritz Heider übernommene Leitdifferenz zurückzukommen) führt zu einem erweiteren Bild der Strukturen der jeweiligen technischen Medialität, die jedoch immer dynamisch bleibt, da sich ihre Konzeptualisierung immer aufs Neue an dem „Auch von Eigenschaften“ (Hegel), welches die Performanz des Medialen an der jeweiligen Form zum Vorschein bringt, abarbeiten muss. Ein Beispiel: Ein Schienen-Fahrzeug-System ermöglicht die Erreichung von bestimmten Reisezielen und verunmöglicht das Erreichen anderer Ziele unter Nutzung der im System 4 bereitgestellten Mittel zu anderen als den vorgesehenen Zeitpunkten. Ein solches System sei ein Medium des entsprechenden Verkehrs. Seine innere Medialität (1) ist gegeben durch den Stand unseres jeweiligen technischen Know hows, seine äußere Medialität (1) ist begrenzt durch Dispositionen u. a. durch die maximale Steigfähigkeit des Verkehrsmittels. Seine innere Medialität (2) ist durch den Fahrplan gegeben, seine äußere Medialität (2) durch die Verfasstheit des realen Schienennetzes und den Zustand der Fahrzeuge. Zu ergänzen ist diese Auflistung durch die institutionellen und die organisatorischen Verfasstheiten der Betreiber und Nutzer des Systems – die sozialtechnische Dimension. Durch von den Betreibern und den Nutzern vorgenommene feste Kopplungen werden (möglicherweise gegenläufige) Zwecke in diesem System realisiert. Indem seit der neolithischen Revolution Technik darauf angelegt ist, von den natürlichen Medien unabhängig zu werden und daher seit ihren Anfängen als Systemtechnik auftritt, sucht sie die Steuerungsvorgänge der Realisierung von Zwecken in ihrem Gelingen zu sichern, also das instrumentelle Handeln zielführend zu machen qua Regelungsvorgängen, die das „Auch von Eigenschaften“, welches als externe Störgrößen (der natürlichen Mittel) auftritt, kompensieren sollen. Die drei Typen der Regelung (Containment und/oder höherstufige Steuerung/Störgrößenaufschaltung und/oder Rückkopplung) finden sich in allen technischen Systemen. Im Gegensatz zu Luhmann verstehen wir Technik freilich nicht bloß als feste Kopplung zum Zweck des „Kontingenzmanagements“ der Systeme, denn eine solche feste Kopplung betrifft nur den Charakter der Mittel als hinreichenden Bedingungen der Realisierung von Zwecken. Vielmehr müssen technische Systeme überhaupt als Medien, also als ihrerseits geformte lose Kopplungen verstanden werden, die den zielführenden Einsatz von Mitteln ermöglichen. Die Unterscheidung zwischen Mittel und Medium ist hierbei nicht extensional, sondern intensional in Abhängigkeit vom erkennenden Standpunkt: Ein Haus ist ein Mittel (z. B. zum Schutz vor Witterung) und ein Medium (Möglichkeitsraum) des Wohnens. Eine e-mail ist ein Mittel zur Überbringung einer Beileidsbekundung und zugleich ein Medium, das bestimmte Dimensionen eines Austausches persönlicher Anteilnahme nicht zulässt. Unsere Überlegungen nahmen ihren Ausgang vom defizitären Verständnis der Technik als Inbegriff der Mittel. Ein Inbegriff markiert ein gemeinsames Interesse; er eignet sich nicht als Oberbegriff (für eine Einteilung in Unterklassen), lässt sich aber unter pragmatischen Gesichtspunkten in unterschiedlichster Weise terminologisch fixieren, was auch ständig geschieht. Eine Reflexion auf das gemeinsame Interesse führte uns auf den Begriff des Mediums, der sich aber als bloße, wenn auch absolute, Metapher erwies, die explikationsfähig ist. In jedem Fall zeigt sich aber, dass die Frage nach einer überzeugenden Klärung der prädikativen Verwendung von „Technik“ nicht zu einer befriedigenden Antwort führt. Die zahlreichen, einander widerstreitenden „Definitionen“ von Technik zeugen davon. Nimmt man das einen Inbegriff fundierende „gemeinsame Interesse“ als solches ernst, kann die Frage nach der Technik allerdings auch anders interpretiert werden: Sie erscheint dann als Frage nach einem bestimmten Weltbezug, der sich in diesem Interesse instantiiert.. Wir haben einige inhaltliche Charakteristika dieses Weltbezugs expliziert, insbesondere dasjenige an einer Ermöglichung gelingender Steuerung, also händelbarer Disponibilität. Zur Charakterisierung von Weltbezügen, die nicht ihrerseits als Vorstellungen auftreten, sondern unter denen Vorstellungen produziert werden, steht uns nun freilich noch eine andere Sorte von Begrifflichkeit (jenseits der prädikativen Inbegriffe oder Metaphern) zur Verfügung: die Reflexionsbegriffe, unter denen wir bestimmte Strategien der Welterschließung benennen, die zu bestimmten Vorstellungen führen. Wie wäre „Technik“ als Reflexionsbegriff zu fassen? 5 2. „Technik“ als Reflexionsbegriff Im Rahmen der elementaren Orientierung unserer Lebenswelt unterscheiden wir zwischen Natur als Widerfahrnis und Technik oder Kunst i.w.S. als Gesamt der menschlichen Hervorbringungen, die extensional, intensional, relational oder modal charakterisiert werden können. Letzteres zerfällt wiederum in nicht-tradierte Singularitäten einerseits, tradierte Schemata und Strukturen andererseits, die eben deshalb tradiert werden, weil sie als erhaltenswerte Bedingungen des weiteren singulären Disponierens begriffen werden. Sofern Disponieren, wenn es gelingen soll, neben der Steuerung auch der Regelung bedarf, kann man jene Schemata und ihre Verkörperung in Strukturen als „Regelungsregeln“ begreifen. Sie umfassen die Codes unserer Kommunikation, unsere Wissensordnungen mit ihren kanonisierten Texten, unsere realen Ordnungen als Dispositive der Mittel und die normativen Ordnungen als Ordnungen mit Realisierungsanspruch, der über Gratifikationen und Sanktionen durchgesetzt wird. Unter dem „gemeinsamen Interesse“, welches den Inbegriff Technik orientiert, lassen sich nun nicht in prädikativer Absicht Unterscheidungen zwischen Gegenständen i.w.S. ausfindig machen, die eine bestimmte Klasse von Gegenständen als „Technik“ zu bestimmen erlauben, sondern offensichtlich Bestimmungen an Gegenständen, die diese zu jenem Interesse in einen Bezug setzen. Wenn wir Unterscheidungen an Gegenständen treffen, so zeigen diese Unterscheidungen den jeweiligen Bezug von uns auf diese Gegenstände, unter dem wir bestimmte Eigenschaften der Gegenstände als So und SoEigenschaften identifizieren. Ob solche Eigenschaften als natürlich, technisch oder kulturell etc. höherstufig bestimmt werden, ist als Eigenschaft von Eigenschaften nicht durch letztere gegeben, sondern durch den jeweiligen Bezug zu einem System der Bestimmung von Eigenschaften, das, wenn ein Zirkel vermieden werden soll, sein Fundament nur im Bestimmenden – dem Subjekt – haben kann. (Eine natürliche Eigenschaft zu sein, ist keine natürliche Eigenschaft; dasselbe gilt für technische Eigenschaften.) Es ist daher kein Zufall, sondern durch die Diskussionslage bedingt, dass aus den verschiedenen Ansätzen zur Erfassung von Technik als Medium eine Diskussion um den Status von „Technik“ als Reflexionsbegriff entstand. 2.1 Dogmatisch-naturalistische prädikative Verwendung von „Natur“ und „Technik“ Es finden sich zwar mannigfache dogmatisch-naturalistische Unterstellungen zur „Natur“ des Menschen (als innere und äußere Natur), zur „Natur“ seiner Umwelt als „ursprünglicher“ sowie zur Evolution oder Naturgeschichte. Als „Natur“ oder „natürlich“ wird dasjenige etikettiert, was „ursprünglich“ anzutreffen sei bzw. vom Menschen unbelassen ist. So wird der „ursprüngliche“ Mensch mal als biologisches Mängelwesen, mal als biologisches Überschusswesen modelliert, seine ursprüngliche Umwelt mal als Ort der Gefahren, mal als Aktionsraum, an den er optimaler als alle konkurrierenden Lebewesen angepasst gewesen sei, so dass überschüssige Energien freigesetzt wurden. Und die Evolution erscheint mal als Prozess, der den Menschen als Gipfelpunkt seiner Entwicklung hervorgebracht habe, mal als Geschehen, zu dem der Mensch sich als Fremdkörper verhält und für das er gar eine „Katastrophe“ darstellen mag (s. Hubig 2006, Kap. 3.2). Diese prädikativen Charakterisierungen, die ihrerseits zahlreiche Binnendifferenzierungen aufweisen, täuschen darüber hinweg, dass eine real erfahrene Natur sowie ihre erkenntnismäßige Modellierung immer auf einem jeweils begründungsbedürftigen Verhältnis des Menschen (in praktischer und theoretischer Hinsicht) beruhen. Wenn nun Technik auf jener brüchigen Kontrastfolie als Alternativkonzept entwickelt wird, schreibt sich der naturalistische Pluralismus in den Pluralismus der alternativen Technikkonzepte fort. Eine biologistische Herleitung von Kultivierung und Überformung innerer und äußerer Natur, sei es aus funktionaler Notwendigkeit, sei es auf der Basis eines Freiraums von Entfaltungsmöglichkeiten 6 „begründet“, eröffnet einen Spielraum der „Analyse“ von Handlungsprozessen, die entweder als funktional oder dysfunktional erachtet werden, je nachdem, (1) ob und wie ein „Auseinandertreten“ der inneren oder äußeren Natur mit ihren funktionalen Abhängigkeiten diagnostiziert wird, je nachdem, (2) wie die artifiziellen Umwelten als „sekundäre Systeme“ als menschengemäß affirmiert oder als entfremdet kritisiert werden und je nachdem, (3) wie die „Eigendynamik“ der Entwicklung als natürliches evolutives Geschehen oder als Bedrohung des „eigentlichen“ Menschseins erachtet werden. Entsprechend variieren auch die Diagnosen zu den Optionen eines Umgangs mit diesen Entwicklungen, der Gestaltbarkeit, Modifizierbarkeit, Interventionsmöglichkeiten etc. Der Pluralismus der anthropologisch fundierten Technikphilosophie hat seine Wurzeln im unreflektierten Naturalismus der jeweiligen Naturkonzepte. Die objektstufige prädikative Leitdifferenz „Natur“ – „Technik“ sollte daher verabschiedet werden. 2.2 Die Leitdifferenz „natürlich-technisch“ als Differenz logischer Reflexionsbegriffe Geht man hingegen davon aus, dass „Natur“ und „Technik“ nicht gegeben, sondern im Lichte eines bestimmten Interesses als Inbegriffe erscheinen, ist dieses Interesse als Verhältnis zwischen uns und der Welt zu reflektieren. Dazu setzen wir Termini ein, die technisches (oder wissenschaftliches) Handeln und technische (oder wissenschaftliche) Erkenntnisgewinnung, bei der ja vielfältige Prädikate eingesetzt werden, unter bestimmten tertia comparationis beschreiben. Sie sortieren als Metaprädikate unsere Vorstellungen, die dem objektstufig-prädikativen Begriffsgebrauch, der sich auf dasjenige richtet, „was es gibt“, zugrunde liegen. Entsprechend der kantischen Terminologie handelt es sich um logische Reflexionsbegriffe als conceptus comparationis. Dabei lässt sich, folgt man Peter Janich, Armin Grunwald und Yannik Julliard, eine erste Unterscheidung, diejenige nämlich zwischen „Technik“ und „Natur“ einziehen: „Technik“ als Reflexionsterminus zeigt dieser Auffassung von Reflexion gemäß an, „ob wir uns sprachlicher Mittel bedienen, die unser eigenes poietisch-handwerkliches wie sprachlichbegriffliches Handeln betreffen“ (Janich 2006, S. 44 f.; Grunwald/Julliard 2005), eben Methoden – als abgesichertes geregeltes Steuern. Der Begriff „Natur“ dagegen zeige an, dass wir „solche (sprachliche) Mittel benutzen, die das Widerfahrnishafte, am Gelingen und Misslingen unserer technischen Handlungen Gelernte“ betreffen, das, was das technisch Mögliche und das technisch Unmögliche (im prädikativen Sinne) bestimmt. In dieser Fassung drücken Reflexionsbegriffe also höherstufige Vorstellungen von denjenigen Vorstellungen aus, die durch prädikative Ausdrücke vermittelt werden3. Reflexion, so könnte man auch sagen, wird als Auffinden von Metaprädikaten aufgefasst. Es sind Begriffe für die Konzeptualisierung von Operationen an Gegenständen, nicht Begriffe der Unterscheidung zwischen Gegenständen. Es wird ferner deutlich, dass „Natur“ in ihrer Konzeptualisierung abhängt von „Technik“ als primärem Reflexionsbegriff, weil sie ex negativo charakterisiert wird. Was das „Technische“ betrifft, kann dann unterschieden werden zwischen nicht tradiertem und nicht geregelten poietischem und nennendem Zugriff auf Gegenstände und tradiertem und geregeltem poietischen und (dann) begrifflichem Zugriff. Tradiert und geregelt werden solche Zugriffe unter dem Interesse, Bedingungen eines weiteren Disponierens bereitzustellen. Solche Bedingungen machen dann die oben erwähnten realen, intellektualen und normativen Schemata des objektstufigen Handelns aus. Die Gesamtheit dieser Schemata ist dann als „Kultur“ im Sinne eines solchen logischen Reflexionsbegriffes, also als Metaprädikat zu begreifen. 3 Die Begriffe logischer Reflexion hätte Kant in seiner Auflistung der Vorstellungen anführen können, im Unterschied zu den transzendentalen Reflexionsbegriffen (s.u.) 7 2.3 „Natur“ und „Technik“ als transzendentale Reflexionsbegriffe Während die erwähnten Metaprädikate als logische Reflexionsbegriffe gemeinsame Intensionen von Unterscheidungen an Gegenständen benennen, führt Kant einen weiteren Typ von Reflexionsbegriffen ins Feld, die sich nicht auf Vorstellungen beziehen und deshalb in seiner Liste von Vorstellungen (Kant 1787/1956, B 376f.) nicht auftauchen. Es handelt sich nicht um Titel- und Sortierworte, sondern um Namen für Regeln eines bestimmten Verstandesgebrauchs als Ensemble von Strategien, unter denen jenes Vergleichen von Vorstellungen (bei den logischen Reflexionsbegriffen) stattfindet. Solcherlei ist Thema einer „transzendentalen Reflexion“, als derjenigen Überlegung bzw. Handlung, die (irgendwie) gegebene Vorstellungen mit den Bedingungen ihrer Möglichkeit, also den jeweiligen Erkenntniskräften bzw. –vermögen, „zusammenbringt“. Eine solche transzendentale Reflexion ist also Voraussetzung der logischen Reflexion; den Katalog der Hinsichtnahmen in Zuordnung zu den Erkenntniskräften als rationalem und empirischem Vermögen, also Verstand und Sinnlichkeit, bezeichnet Kant als transzendentale Topik. Da „Natur“, „Technik“ und „Kultur“ nun nicht einen theoretischen, sondern einen praktischen Weltbezug meinen, ist an dieser Stelle Kant unter Beibehaltung seiner Architektur zu ergänzen bzw. zu modifizieren: Es wäre hier also der Bezug dieser Reflexionsbegriffe zu unserem Handlungsvermögen als Vermögen der Freiheit herzustellen bzw. zu unseren Vorstellungen hiervon. Die basale Vorstellung im Zusammenhang mit „Handeln“ ist die Vorstellung der Disponibilität von Mittel- und Zwecksetzungen. Einen empirischen Nachweis des Vermögens der Freiheit kann es gar nicht geben, will man nicht der von Kant aufgezeigten Amphibolie der Reflexionsbegriffe, hier: der Verwechslung des transzendentalen mit dem empirischen Gebrauch, der „Sensifizierung der Begriffe“ – wie sie den Psychologisten und Neurologen unterläuft – erliegen. Dass wir subjektive Freiheit als Konzept unterstellen, erfahren wir daran, dass wir beim Handeln Hemmungen als Provokation empfinden. „Technik“ als transzendentaler Reflexionsbegriff würde ausdrücken, dass wir Verfahren, Fähigkeiten, Vollzüge und deren Resultate nach Maßgabe ihrer Disponibilität bzw. Verfügbarkeit relativ zu unserem Freiheitsanspruch identifizieren. Wenn aber nun diese Disponibilität im Lichte einer Reflexion auf unseren Freiheitsanspruch mit ihren Grenzen konfrontiert wird, kann das Andere ihrer selbst ebenfalls mit einem Reflexionsbegriff belegt werden, der zunächst das Negative von Disponibilität ausdrückt. Sowohl „Natur“ als auch „Kultur“ stehen für dasjenige, was prima facie im singulären Akt technischer Realisierung als nicht disponibel erscheint, freilich in unterschiedlicher Weise. Im ersten Falle, im Falle von „Natur“, handelt es sich um abduktiv erschlossene (mithin unsicher unterstellte) Wirkschemata bezüglich der Realisierung unseres Freiheitsanspruchs, im zweiten Falle, im Falle von „Kultur“, um Schemata der Mittel-Zweck-Verknüpfung, unter denen bestimmte gewünschte Sachverhalte allererst als Handlungszwecke denkbar werden. Die Anerkennung solcher Schemata kann verweigert werden, sofern Handlungszwecke nicht gesetzt oder Gratifikationen (oder Sanktionen) als unerheblich erachtet werden. Wenn auf Handlungsfreiheit verzichtet wird, können jene institutionalisierten Schemata ignoriert werden und die „Geburt der (Handlungs-) Freiheit aus der Entfremdung“ (Gehlen) findet nicht statt. Mit „Natur“ liegt eine abgrenzende, mit „Kultur“ eine affirmative Selbstbeschreibung derjenigen Handlungssysteme vor, in denen Technik eingesetzt wird nach jeweiliger Maßgabe unserer (situativen) Auffassung subjektiver positiver Handlungsfreiheit. „Technik“, „Natur“ und „Kultur“ als transzendentale Reflexionsbegriffe drücken mithin den Bezug unseres Denkens zu unserer Vorstellung zu unserem Handlungsvermögen aus (hierzu Hubig/Luckner 2008; vgl. Hubig 2006, Kap. 7). Die Anerkennung von etwas als nicht disponibel („Natur“), bedingt nicht disponibel, sofern die Realisierung eines konkreten Zweckes für erforderlich gehalten wird („Kultur“), und disponibel („Technik“) beruht auf einer Entscheidung, da sie nicht erkenntnismäßig zu fundieren ist, wie Kant bereits betont. Eine solche ist nur unter normativen Gesichtspunkten zu 8 rechtfertigen. Dass solche Rechtfertigungen unter unterschiedlicher normativer Orientierung erfolgen können, erklärt, warum im Zuge der Problem- und Ideengeschichte unter einer wechselnden Bewertung von wechselnden Erfahrungen der Disponibilität oder Nicht-Disponibilität „Natur“, „Technik“ und „Kultur“ jeweils unterschiedlich gefasst wurden. 9 Literatur Ashby, William Ross (1974): Einführung in die Kybernetik.Frankfurt/M.: Suhrkamp. Baecker, Dirk (1999): Kommunikation im Medium der Information. In: Rudolf Maresch/Niels Weber (Hg): Kommunikation, Medien, Macht. Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 174-191. Gamm, Gerhard (2000): Nicht Nichts. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Gehlen, Arnold (1957): Die Seele im technischen Zeitalter. Reinbek: Rowohlt. Grunwald, Armin; Julliard, Yannik (2005): Technik als Reflexionsbegriff – Überlegungen zur semantischen Struktur des Redens über Technik. In: Philosophia naturalis 42, S. 127157. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich PhG (1957): Phänomenologie des Geistes, hg. von Johannes Hoffmeister, Hamburg: Meiner. Heidegger, Martin (1962):Die Technik und die Kehre, Pfullingen: Neske. Hoffmann, Stefan (2002): Geschichte des Medienbegriffs, Hamburg: Meiner. Hubig, Christoph (2000): Mittel oder Medium? Technische Weltgestaltung und ihre verkürzten Theorien, in: H. van den Boom (Hg.), Entwerfen, Jb. 4, Hochschule der Künste, Braunschweig 2001; Kurzfassung in: Der Blaue Reiter, Nr. 13 (1/2001), S. 99102. Hubig, Christoph (2006): Die Kunst des Möglichen I. Philosophie der Technik als Reflexion der Medialität.:Bielefeld: Transcript. Hubig, Christoph (2007): Die Kunst des Möglichen II. Bielefeld: Transcript. Hubig, Christoph; Luckner, Andreas (2008): Natur, Kultur und Technik als Reflexionsbegriffe. In: Janich, Peter (Hg.), Naturalismus und Menschenbild (Dt. Jb. für Philosophie). Meiner: Hamburg, S. 52-66. Hubig, Christoph (2009). Art. „Möglichkeit“. In: H.-J. Sandkühler (Hg.), Enzyklopädie Philosophie, in Dr. Husserl, Edmund (Hua XII): Philosophie der Arithmetik. Gesammelte Werke XII, hg. von Lothar Eley, Den Haag (1970): Martinus Nijhoff. Janich, Peter (2006): Kultur und Methode. Suhrkamp: Frankfurt/M. Kant, Immanuel (1787/1956): Kritik der reinen Vernunft. Hamburg: Meiner. König, Josef (1994): „Bemerkungen zur Metapher“, in: Kleine Schriften, hg. von Günter Dahms, Freiburg: Alber, S. 156-176. Krämer, Sybille (2000): Das Medium als Spur und als Apparat. In: Sybille Krämer (Hg.): Medium, Computer, Realität, Wirklichkeitsvorstellungen und neue Medien. Frankfurt/M.: Suhrkamp., S. 73-94. Luhmann, Niklas (1992): Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt/M.: Suhrkamp. Platon (1845): Timaios. In: Platons Werke (griech. und dtsch.), hg. von Fr. W. Wagner, Leipzig (1845 ff.): Verlag W. Engelmann. Snell, Bruno (1946): Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Weber, Max (1921/1976): Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen: Mohr.