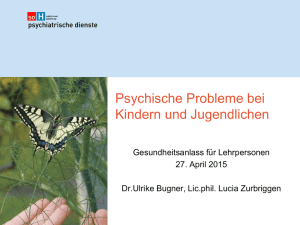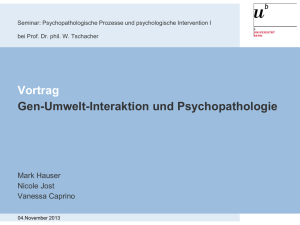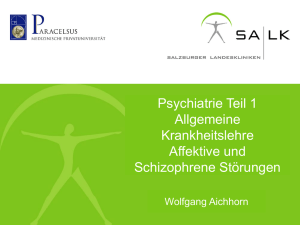Skript von 2014/15
Werbung
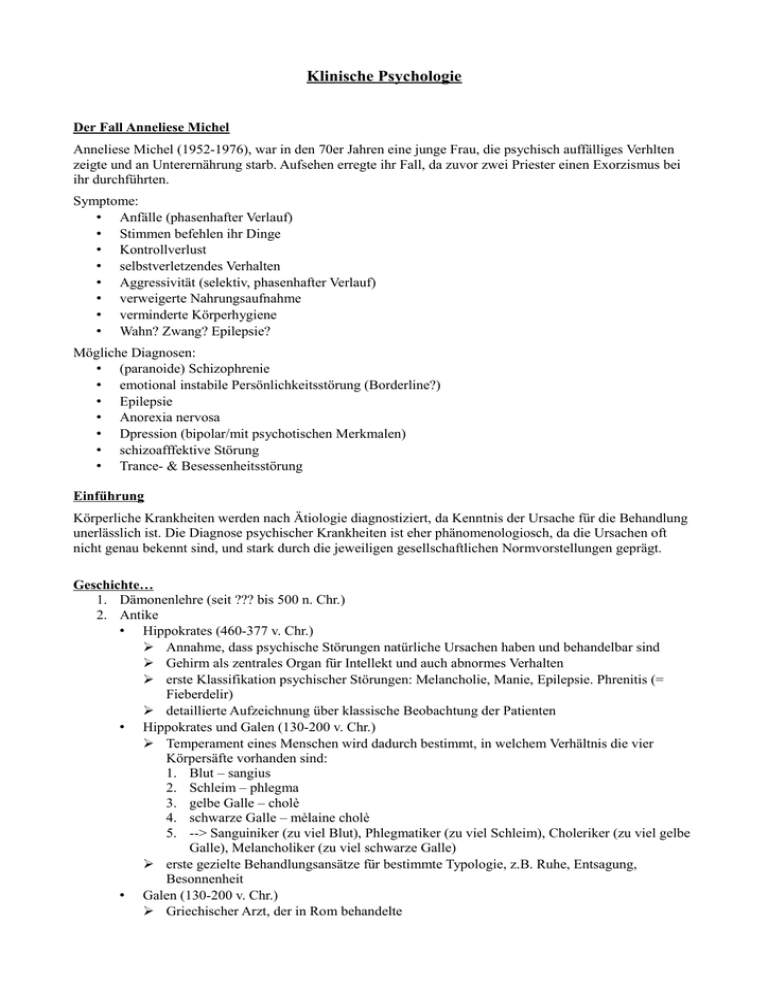
Klinische Psychologie Der Fall Anneliese Michel Anneliese Michel (1952-1976), war in den 70er Jahren eine junge Frau, die psychisch auffälliges Verhlten zeigte und an Unterernährung starb. Aufsehen erregte ihr Fall, da zuvor zwei Priester einen Exorzismus bei ihr durchführten. Symptome: • Anfälle (phasenhafter Verlauf) • Stimmen befehlen ihr Dinge • Kontrollverlust • selbstverletzendes Verhalten • Aggressivität (selektiv, phasenhafter Verlauf) • verweigerte Nahrungsaufnahme • verminderte Körperhygiene • Wahn? Zwang? Epilepsie? Mögliche Diagnosen: • (paranoide) Schizophrenie • emotional instabile Persönlichkeitsstörung (Borderline?) • Epilepsie • Anorexia nervosa • Dpression (bipolar/mit psychotischen Merkmalen) • schizoafffektive Störung • Trance- & Besessenheitsstörung Einführung Körperliche Krankheiten werden nach Ätiologie diagnostiziert, da Kenntnis der Ursache für die Behandlung unerlässlich ist. Die Diagnose psychischer Krankheiten ist eher phänomenologiosch, da die Ursachen oft nicht genau bekennt sind, und stark durch die jeweiligen gesellschaftlichen Normvorstellungen geprägt. Geschichte… 1. Dämonenlehre (seit ??? bis 500 n. Chr.) 2. Antike • Hippokrates (460-377 v. Chr.) ➢ Annahme, dass psychische Störungen natürliche Ursachen haben und behandelbar sind ➢ Gehirm als zentrales Organ für Intellekt und auch abnormes Verhalten ➢ erste Klassifikation psychischer Störungen: Melancholie, Manie, Epilepsie. Phrenitis (= Fieberdelir) ➢ detaillierte Aufzeichnung über klassische Beobachtung der Patienten • Hippokrates und Galen (130-200 v. Chr.) ➢ Temperament eines Menschen wird dadurch bestimmt, in welchem Verhältnis die vier Körpersäfte vorhanden sind: 1. Blut – sangius 2. Schleim – phlegma 3. gelbe Galle – cholè 4. schwarze Galle – mèlaine cholè 5. --> Sanguiniker (zu viel Blut), Phlegmatiker (zu viel Schleim), Choleriker (zu viel gelbe Galle), Melancholiker (zu viel schwarze Galle) ➢ erste gezielte Behandlungsansätze für bestimmte Typologie, z.B. Ruhe, Entsagung, Besonnenheit • Galen (130-200 v. Chr.) ➢ Griechischer Arzt, der in Rom behandelte 3. 4. 5. 6. 7. 8. ➢ Studium der Anatomie des Nervensystems anhand von Tiersektionen ➢ Unterscheidung zwischen emotionalen und körperlichen Ursachen für abnormes Verhalten / psychische Störungen z.B. Kopfverletzungen, Alkoholkonsum, Schock, Angst, mestruelle Veränderungen, Enttäuschungen in der Liebe etc. Mittelalter • übernatürliche Phänomene als Erklärung für abnormes Verhalten • Rückehr der Dämonenlehre • Exorzismus und Ausschluss: Umgang mit psychisch auffälligen Menschen fast nur durch Geistliche, Klöster als "Zuflucht" • Hexenverfolgung: psychisch kranke als Opfer der Inquisition Renaissance (15./16. - 18. Jhd.) • Irrenhäuser entstehen • Annahme: jeder Mensch hat von Geburt an ratio und ist somit vernunftbegabt; Menschen entscheiden sich also gezielt, verrückt zu werden (es ist ihr eigener Wille, ihre eigene Schuld) • pro: Abkehr von der Dämonenlehre • contra: Wegsperrcharakter Humanitäre Reform (18./19. Jhd.) • "Befeiung der Irren" durch Philippe Pinel um 1794 im Pariser "Hospice Bicetre" • Einsatz dafür, dass Geisteskranke nicht wie Gefangene an Ketten gelegt wurden, sondern in Irrenanstalten medizinisch behandelt wurden • "traitment moral": Umgang mit Kranken, der durch Zuwendung, Geduld, Milde gekennzeichnet ist • ABER: auch sehr bedemkliche Heilmethoden: Drehstuhlbehandlung, Hungerkuren etc. • William Tuke gründet 1796 das "York Retreat" • Auffassung der Quäker, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollen • Freundlichkeit & Akzeptanz als Hilfsmittel zur Genesung • , Benjamin Rush Anfänge der Psychiatrie v.a. durch Emil Kraeplin (1856-1926) • führende Gestalt der deutschen Psychiatrie um die Jahrhundertwende • Entwicklung einer Klassifizierung der Geisteskranken, die noch heute Grundlage für die Diagnose bildet • Deskriptive Methoden in der annahme, dass schwere psychiatrische Erkrankungen erbliche, physiologische und charakterliche Ursachen haben • 1833 erste Auflage seines Kompendium der Psychiatrie Somatogene vs. Psychogene Sichtweise • Somatogene Sichtweise ➢ schwere psychiatrische Erkrankungen sind vererbt, physiologisch begründet und unheilbar ➢ Klassifizierung in Dementia praecox (Schizophrenie), manisch-depressives Irresein und Paranoia ➢ Forderung: „Ein rücksichtsloses Eingreifen gegen die erbliche Minderwertigkeit, das Unschädlichmachen der psychopathisch Entarteten mit Einschluss der Sterilisierung“ ➢ Versuch der körperlichen Behandlung: Zahnextraktion, Hydrotherapie, Insulinschocktherapie, Lobotomie, EKT • Psychogene Sichtweise ➢ Mesmer (1778): Behandlung der Hysterie mit Hypnose ➢ Nancy-Schule: Hypnose kann Hysterie auslösen ➢ Freud (1856-1939): Theorie der Psychoanalyse ➢ Pawloa (1849-1936) uns Skinner (1904-1990): Lerntheoretische Psychologie Eugenik und Sozieldarwinismus • „Bei Wilden werden die an Geist und Körper Schwachen bald beseitigt und die, welche leben bleiben, zeigen gewönlich einen Zustand kräftiger Gesundheit. Auf der anderen Seite thun wir civilisierte Menschen alles nur Mögliche, um den Process dieser Beseitigung aufzuhalten. Wir bauen Zufluchtstätten für die Schwachsinnigen, für die Krüppel und die Kranken; wir erlassen Armengesetze und unsere Aerzte strengen die grösste Geschicklichkeit an, das Leben eines Jeden bis zum letzten Moment noch zu erhalten. […] Hierdurch geschieht es, dass auch die schwächeren Glieder der civilisierten Gesellschaft ihre Art fortpflanzen. Niemand, welcher der Zucht domesticierter Thiere seine Aufmersamkeit gewidmet hat, wird daran zweifeln, dass dies für die Rasse des Menschen im höchsten Grade schädlich sein muss […]“ → Charles Darwin (1871). Die Abstammung des Menschen • Zwangssterilisierung in mehr als 20 Ländern zum Teil bis 1970/80 9. Sukzessive Entdeckung und Einführung von Psychopharmaka • 1949 Entdeckung des antimanischen Effekts des Lithium • 1952 Entdeckung des Chlorpromazin als erstes Neuroleptikum • 1954 Entdeckung des Meprobamats als Anxiolytikum • 1957 Endeckung des Imipramin als Antidepressivum • 1961 Entwicklung des ersten Benzodiazepins (Diazepam) 10. Antipsychiatriebewegung (ab 1960) • Szaz, Scheff, Foucault ➢ Psychische Krankheit als Produkt sozialer und politischer Prozesse: soziale Ablehnung abweichenden Verhaltens → Etikettierung als Krankheit → gesellschaftliche Ausgrenzugn → Krankheitskarriere • Gesellschaftliche Aufmerksamkeit wird gelenkt auf... ➢ durchschnittl. 8,5 Jahre Verweildauer in Psychiatrien bei der Diagnose Schizophrenie ➢ mangelhafte bauliche Situation und Unterbringung ➢ Kliniken als landwirtschaftliche Betriebe 11. Moderne Entwicklung: Von der "Verwahrung zur Therapie" • Verbesserung der stationären Behandlung und Deinstutionalisierung (Psychiatrie-Enquète, 1975) ➢ Förderung von Beratungsdiensten und Selbsthilfegruppen ➢ gemeindenahe Förderung ➢ Umstrukturierung der großen psychiatrischen Krankenhäuser ➢ getrennte Versorgung für psychisch Kranke und geistig Behinderte ➢ Gleichstellung somatisch und psychisch Kranker ➢ Förderung der Aus- Fort- und Weiterbildung ➢ Versorgung psychisch Kranker und Behinderter als Teil der allgemeinen Gesundheitsverordnung • Gesetze zum Schutz der Freiheitsrechte psychisch Kranker (PsychKG) • Aufbau außerstationärer Einrichtungen: Tageskliniken, Wohnungen, Werkstätten, sozialpsychiatrische Dienste • ambulante psychotherapeutische Versorgung • Präventionsansätze Klinische Psychologie als "Beruf" Nachbar-/Teilgebiete der klinischen Psychologie und ihre Verbindungen zur klinischen Psychologie • Allgemeine Psychologie: Methodenlehre, Erforschung von Vorgängen wie Lernen, Gefühle, Motivation, Wahrnehmung, Sprache, Denken Gedächtnis • Entwicklungspsychologie: methodische und inhaltliche Gemeinsamkeiten, v.a. Entstehung psychischer Probleme • Sozialpsychologie: wichtige theoretische Innovationen oft von sozialpsychologischen Theorieansätzen beeinflusst (z.B. Attributionstheorie, Kommunikationstheorie, Einstellungsforschung, etc.) • Persönlichkeits- / Differentielle Psychologie: klinische Interventionen sind immer auch mit persönlichkeitspsychologischen Hypothesen verbunden, Persönlichkeitstheorien beziehen sich auf die Beschreibung und Entstehung psychischer Störungen (insbes. Persönlichkeitstsörungen) • medizinische Psychologie: Aufgreifen von Anregungen aus der Verhaltensmedizin Definition Klinische Psychologie Klinische Psychologie ist diejenige Teildisziplin der Psychologie, die sich mit psychischen Störungen und den psychischen Aspekten somatischer Störungen und Krankheiten in der Forschung, der Diagnostik und Therapie beschäftigt. Dazu gehören u.a. die Themen: • • • • Ätiologie und Bedingungsanalyse Klassifikation und Diagnostik Prävention, Psychotherapie und Rehabilitation Epidemilogie und Gesundheitsversorgung Einrichtungen, in denen Klinische Psychologen arbeiten • stationäre / teilstationäre psychiatrische Einrichtungen • Rehaklinik / Psychosomatik • Beratungsstellen / Ambulanzen • Ambulante Niederlassung als Psychotherapeut • Wissenschaftliche Einrichtungen • Begutachtung (Forensik, TÜV,...) • Gesundheitspolitik (Psychotherapeutenkammer, Krankenkassen) Psychotherapeut • Diplom / Master mit Schwerpunkt Klinische Psychologie → Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeut → Bestehen der Approbationsprüfung • Bezeichnung darf nur von Ärzten, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugenlichenpsychotherapeuten geführt werden • Ausübung von Psychotherapie ist jede mittels wissenschaftlich anerkannter psychotherapeutischer Verfahren vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Lindereung von Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist • im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung ist eine somatische Abklärung herbeizuführen • zur Ausübung von Psychotherapie gehören nicht psychologische Tätigkeiten, die die Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte oder sonstiger Zwecke außerhalb der Heilkunde zum Gegenstand haben • wissenschaftlich anerkannte Psychotherapieverfahren im Sinne des PsychThG: ◦ (kognitive) Verhaltenstherapie (VT) ◦ Psychoanalyse (PA) ◦ tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (TFP) ◦ Systemische Therapie (ST) ◦ Gesprächspsychotherapie (GT) → aber: sozialrechtliche Anerkennung als ambulante Behandlungsverfahren in der gesetzlichen Krankenversichrung (und damit Möglichkeit zum Erwerb eines Kassensitzes) nur für VT, PA, TFP Ethische Richtlinien Ethische Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychologie e.V. (DGPs) und des Bundesverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. (BDP): • Kollegiales Verhalten • Umgang mit Patientendaten (Schweigepflicht!) • Einwilligung bei Aufzeichnung oder Speicherung von Daten • Sorgfaltspflicht bei Gutachten • ethische Grundsätze für „gute wissenschaftliche Praxis“ (bspw. Einwilligung, Aufklärung bei Studien) • besondere Verantwortung gegenüber dem Klienten (Psychotherapeuten behandeln Störungen mit den bestmöglichen Therapieverfahren. Patienten haben ein Recht auf die nach dem jeweiligen wissenschaftlichen Stand bestmöglichen Behandlung) • Aufbewahrung der Therapieaufzeichnungen für mind. 10 Jahre 3 Dimensionen der Klinischen Psychologie • Psychische Störungen, Aufgabenbereiche, Paradigmen • z.B. Rehaklinik: Psychische Störungen Sucht, Aufgabenbereich Diagnostik, Paradigma Tiefenpsychologisch Fundierte Therapie Klassifikation und Diagnostik psychischer Störungen Was ist eine psychische Störung? • Problem bei einer kategorialen Definition: • normal vs. abnormal • gesund vs. krank ▪ Kennzeichen von Symptomen: Kumulierung (versch. Symptome treten gleichzeitig auf), Dauer, Intensität, Leiden / funktionelle Beeinträchtigung • Krankheit? • Medizinische Krankheitsmodell • Problem: blendet Umfeld aus • Normabweichung? • Psychosoziales Störungsmodell • Problem: Definition der Norm bzw. von welcher Norm wird abgewichen? (statistische Norm, Idealnorm, funktionale Norm) • Lösung? • Psychosoziales Störungsmodell → ist diese Normabweichung in irgendeiner Weise problematisch? • Unter psychischer Störung versteht man ein Syndrom oder Muster individueller Erlebens- und Verhaltensweisen, das Leiden verursacht und welches mit Einschränkungen in einem oder mehreren Bereichen des Funktionierens, mit erhöhtem Risiko für Krankheiten, Tod oder Einschränkungen in der Lebensführung verbunden ist. Was genau ist abweichendes Verhalten? (aus Buch) • gibt keine allgemeingültige Definition, aber große Einigkeit welche Zustände eine psychische Störung sind und welche nicht • meist durch Vergleich mit prototypischen Modell • man muss immer berücksichtigen, dass Werte und Erwartungen einem permanenten Wandel unterliegen • 6 Merkmale abweichenden Verhaltens: • Leid: ist Indikator für eine Störung, aber weder notwendige noch hinreichende Bedingugn • Maladaptivität: Bsp: Auftragskiller und Trickbetrüger: für beide ist ihr Verhlaten nicht maladaptiv, sondern ihre Art und Weise Geld zu verdienen --> aber in Bezug auf Gesellschaft maladaptiv • Devianz oder Abweichung: normalerweise statisch gesehen seltenes Verhalten = abweichend, allerdings auch mit Wertvorstellung gekoppelt, d.h. nur stat. seltenes & nicht wünschenswertes Verhalten = abweichen --> superintelligent pos. bewertet wohingegen Minderbemittelheit neg. bewertet • Verletzung gesellschaftlicher Standards: Bsp. falsch parken eigentlich Regelverstoß, aber machen so viele, dass nicht als Normabweichung betrachtete vs. Mutter bringt ihr Kind um • Soziales Unbehagen: wenn jdm soziale Regeln verletzt meist von Mitmenschen als unbehaglich oder Besorgnis erregend wahrgenommen • Irrationalität und Unvorhersagbarkeit: wir erwarten von anderen ein bestimmtes (vorhersehbares Verhalten) & dass sie ihr Verhalten kontrollieren können! irrationalem Verhalten wirkt auf uns unkontrollierbar → z.B. desorganisiertes Sprechen und Verhalten bei Schizos oder in der manischen Phase Klassifikation • Gruppierung anhand von gemeinsamen Merkmalen • Taxonomie: Ergebnis von Einigung über Regeln der Klassifikation • Vorteile und Ziele der Klassifikation: ▪ Kommunikation (Übereinstimmung zwischen Diagnostikern) ▪ Strukturierung und Abgrenzung ▪ Grundlagen für Ursachenforschung, Verlaufsforschung, Prognose ▪ Optimierung und Vereinheitlichung der Behandlungsansätze • ▪ Verbesserung der Reliabilität von Diagnosen Nachteile der Klassifikation ▪ Informationsverlust ▪ Stigmatisierung (durch klinische Diagnose, auch Stereotypisierung = man sieht Stereotyp der Störung und nicht den Individualmensch) / Etikettierung (Diagnose beeiflusst Selbstkonzept der Person) und sekundäre Devianz (=Abweichung von in einer bestimmten Zeit gültigen Normen und Wertvorstellungen) ▪ Verwechslung von Deskription und Erklärung ▪ selbsterfüllende Prophezeiung ▪ Schaffung „künstlicher Einheiten“ (z.B. ab best. Anzahl von Symptomen gilt man als krank) ▪ bildet basale Dimensionen dahinter bzw. fließende Übergänge nicht ab Symptom = einzelner Indikator einer Erkrankung können Affekt (z.B. Niedergeschlagenheit), Verhalten (z.B. Schlafstörungen) o. Kognition (z.B. übertirebene Sorge) betreffen Syndrom = gleichzeitige Vorliegen mehrerer Symptome depressive Verstimmung = Symptom Depression = Syndrom Deskriptive Klassifikationssysteme: DSM & ICD • Theoriefrei (d.h. fokussiert nicht auf Ursachen, sondern Symptome & weist darauf hin, dass Störungen = Folgen von Dysfunktionen im Individuum (nicht Gruppe) sind) • Kategoriale Klassifikationssysteme • International kompatibel • Operationalisierbare Kriterien • Vergleichsweise hohe Reliabilität Diagnostisches und Statistisches Handbuch Psychischer Störungen (DSM IV TR) • DSM I erstmals durch die APA 1952 publiziert • DSM III (deutlich verändertes Konzept: Multiaxiale Diagnostik) • DSM V seit kurzem eingeführt • Maximierung der Reliabilität durch: ▪ explizite, ausformulierte Kriterien ▪ Beschränkung auf erfassbare Syptome ▪ Komorbidität(en) möglich Multiaxiales System des DSM IV • Achse I: Klinische Störungen und andere klinisch relevante Probleme (Angst- oder affektive Störungen usw.) • Achse II: Persönlichkeitsstörungen und geistige Behinderungen • Achse III: Medizinische Krankheitsfaktoren • Achse IV: Psychosoziale und umgebungsbedingte Probleme • Achse V: Globale Beurteilung des Funktionsniveau (GAF - Skala) • 16 Störungskategorien für DSM IV (Achse I und II) → Folie Seite 15 → nicht prüfungsrelevant Persönlichkeitsstörungen nach DSM IV • sind überdauernde Muster von Erleben und Verhalten • sind stabil über die Zeit • zeigen merkliche Abweichung von den Erwartungen der soziokulturelen Umgebung • sind tief greifend und unflexibel • haben ihren Beginn in der Adoleszenz oder im frühen Erwachsenenalter • führen zu Leid oder Beeinträchtigung, sei es bei den Betroffenen, sei es im sozialen Umfeld Klassifikation von Persönlichkeitsstörungen (DSM IV TR) Cluster A Cluster B (sonderbar, exzentrisch) (dramatisch, emotional) Cluster C (ängstlich, vermeidend) Paranoide Persönlichkeitsstörung Antisoziale Persönlichkeitsstörung Vermeidend-selbstunsichere Persönlichkeitsstörung Schizoide Persönlichkeitsstörung Borderline-Persönlichkeitsstörung Depentente Persönlichkeitsstörung Schizotypische Persönlichkeitsstörung Histrionische Persönlichkeitsstörung Zwanghafte Persönlichkeitsstörung Narzistische Persönlichkeitsstörung → nicht mehr aktuell DSM IV Achse IV: Globale Beurteilung des Funktionsniveaus (GAF-Skala) Wertebereich Beschreibung 100-91 Optimale Funktion in allen Bereichen 90-81 Gute Leistungsfähigkeit auf allen Gebieten 80-71 Höchstens leichte Beeinträchtigung 70-61 Leichte Beeinträchtigung 60-51 Mäßig ausgeprägte Störung 50-41 Ernsthafte Beeinträchtigung 40-31 Starke Beeinträchtigung in mehreren Bereichen 30-21 Leistungsunfähigkeit in fast allen Bereichen 20-11 Selbst- und Fremdgefährlichkeit 10-1 Ständige Gefahr oder anhaltende Unfähigkeit 0 Unzureichende Information Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik 1. Krankheitserleben und Behandlungsvoraussetzung 2. Beziehung 3. Grundkonflikte und zusätzliche Kategorien 4. Struktur (d.h. grundsätzliche Fähigkeit des psych. Funktionierens) 5. ICD-10-Symptome → auch 5 Achsen wie beim DSM IV- Modell, aber andere ICD 10 (Kategrie F) • weitgehend kompatibel mit dem DSM, aber auch wichtige Unterschiede • weniger homogen, konsistent und explizit als das DSM • in der Forschung weniger gebräuchlich, in der Praxis in Deutschland vorgeschrieben • Klassifikation nach ICD 10: ▪ F0: organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen ▪ F1: psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen ▪ F2: Schizophrenie, schitotype und wahrhafte Störungen ▪ F3: affektive Störungen ▪ F4: neurotische-, Belastungs- und somatoforme Störungen ▪ F5: Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen oder Faktoren ▪ F6: Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen ▪ F7: Intelligenzminderung ▪ F8: Entwicklungsstörungen ▪ F9: Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend ▪ F10: nicht näher bezeichnete psychische Störung Epidemiologie = Wissenschaft von der Verteilung von Krankheiten, Störungen oder gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen • räumliche und zeitliche Verteilung von Krankheiten • Bestimmung von Determinanten (Sozial, Genetisch, Verhaltensorientiert oder Umwelt) • festgelegte Zielpopulation (Bsp. Bevölkerung, Patientengruppe etc.) • festgelegte Falldefinitionen • Erfassung der Fälle mit standardisiertem Instrument • festgelegter Zeitraum → über all das gibt eine epidemiologische Studie Auskunft (z.B. letztendlich Aussage über Anzahl von Neuerkrankungen an Depression dieses Jahr in Deutschland) → Erstellung eines ätiologischen Modells (woher kommen Depressionen, warum sind etwas mehr Frauen betroffen,...) Epidemiologische Befunde • Punktprävalenz: Anteil der Fälle in einer Population zu einem Zeitpunkt • Zeitraumprävalenz: Anteil der Fälle in einem Zeitraum • Lebenszeitprävalenz: Anteil derjenigen, die meistens ein mal im Leben Fallkriterien erfüllen → betrifft den Lebenslauf der SP bis jetzt; junge Leute haben evtl. bis jetzt noch nichts entwickelt, erkranken aber später noch • Risiko: Wahrscheinlichkeit, einmal im Leben Fallkriterien zu erfüllen → betrifft die gesamte Lebensspanne aller; junge Leute haben hier sozusagen noch „länger Zeit“ eine Störung zu entwickeln; Alte haben evtl. schon eien gehabt • Inzidenz: Anteil der neuen Fälle in einem definierten Zeitraum Risikofaktor Korrelat: Depression – Armut Beispiel: Armut geht voran Armut als Risikofaktor Beispiel: Armut kann verändert werden Armut als variabler Risikofaktor Beispiel: Lindert es die Depression wenn die Person aus der Armut geholt wird? Armut als kausaler Risikofaktor • weiteres Bsp.: Storchaufkommen und Geburtenrate korrelieren, aber es besteht kein kausaler Zusammenhang! Wichtige epidemiologische Untersuchungen • National Comorbidity Survey (USA) • Epidemiological Catchment Area Survey (USA) • Bundesgesundheitssurvey (Deutschland) • „European Brain Council“ Analyse (EU) • Determinants of Outcome Study (WHO) ▪ Key Informant Survey zu Schizophrenie Häufigste psychische Störungen (12-Monatsprävalanz) • jedes Jahr sind 33,3% der Bevölkerung von mindestens einer Störung betroffen: • Angststörungen (16,2%), Alkoholstörungen (11,2%), unipolare Depression (8,2%), Zwangsstörungen (3,8%), somatoforme Störungen (3,3%), bipolare Störungen (2,8%), Psychotische Störungen (2,4%), Posttraumatische Störungen (2,4%), Medikamentenmissbrauch/-abhängigkeit • (1,5%), körperlich bedingte psychische Störungen (0,9%), Anorexia Nervosa (0,7%) über alle Störungen hinweg gibt es kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen Varianten epidemiologischer Studien • Haushalts-Surveys • Ziel: repräsentative Studie z.B. über Bielefeld • Methoden z.B. Zufallsanrufe • Geeignet für… • Studien über Störungen mit geringem Hospitalisierungsgrad • Störungen die die Teilnahmebereitschaft nicht noch stärker einschränken • Key-informant Surveys • Alle psychisch Kranken die je mit einer Einrichtung zu tun hatten werden erfasst • aus der Anzahl kann man Prävalenz errechnen • Geeignet für … • Krankheiten mit hohem Hospitalisierungsgrad • Längsschnittstudien: Geburtskohrten, High-risk Studien • gezielt Populationen aussuchen, die viele Risikofaktoren aufweisen Bsp. Zur Risikoeinschätzung bei Majore Depression • AV: erfüllt Pers. Störung oder nicht • als Frau 1,7 mal so wahrscheinlich, an einer Majoren Depression zu erkranken (Unterschied ist auch signifikant) ➔ Odds Ratio und Relative Risk Maß zur Berechnung von Risikoeinschätzung Psychische Störungen: Affektive Störungen (Kapitel 7) Was sind affektive Störungen? (au Buch) - Zwei zentrale Stimmungslagen: 1. Manie: intensive und unrealistische Gefühle von Begeisterung und Euphorie 2. Depression: außergewöhnliche Traurigkeit bis hin zum Gefühl einer emotionalen Leere - Stimmungslagen werden als entgegengesetzte Enden eines Kontinuums verstanden, in der Mitte ist dann die normale Stimmungslage - Man unterscheidet affektive Störungen nach: 1. Schweregrad: Anzahl der erlebten Dysfunktionen Erlebtes relatives Ausmaß der Beeinträchtigung 2. Dauer: Akut, chronisch oder wiederkehrend - Häufigste klinisch relevante Stimmungsbeeinträchtigung: Major Depression - Zweite zentrale Stimmungslage ist die manische Episode Hauptformen affektiver Störungen • bipolar: manische und depressive Episoden Kriterien für eine Episode einer Major Depression • A) entweder depressive Stimmung oder Anhedonie plus 4 der folgenden Symptome: ▪ deutlicher Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme ▪ Schlaflosigkeit oder vermehrter Schlaf ▪ psychomotorische Unruhe oder Verlangsamung ▪ Müdigkeit oder Energieverlust ▪ Gefühle von Wertlosigkeit oder übermäßige Schuldgefühle ▪ Konzentrationsstörungen, verringerte Entscheidungsfähigkeit ▪ Todesgedanken, Suizidgedanken • B) Symptome erfüllen nicht die Kriterien einer „gemischten Episode“ • C) Bedeutsame Belastung oder Funktionseinschränkung • D) Symptome nicht nur erkennbar durch organische Ursache • E) Symptome nicht besser erklärbar durch Trauerreaktion ➔ Symptome dauern mehr als 2 Wochen an ➔ bedeutsame Änderung im Leistungsniveau ➔ Arten von Symptomen (aus Buch): • Kognitiv --> Gefühle von Schuld oder Wertlosigkeit, Suizidgedanken • Verhaltensbezogen --> Erschöpfung oder Agitiertheit • Somatisch --> Veränderungen im Appetit, Schlafgewohnheiten Depression im DSM IV • A) Auftreten ▪ einzelne Episode: einmalige depressive Episode ▪ rezidivierend: 2 oder mehr aufeinanderfolgende Episoden (ein Intervall von mind. 2 Monaten muss zwischen 2 Episoden liegen) • B) depressive Episode lässt sich nicht besser durch eine schizoaffektive Störung erklären bzw. ist nicht überlagert durch eine Schizophrenie, eine schizophreniforme Störung oder eine andere psychotische Störung • C) es gab niemals eine manische Episode, eine gemischte Episode oder eine hypomane Episode Depressive Störung (Major Depression, 296.xx) • X1: 2 für eine einzelne depressive Episode 3 für rezidivierende Episoden • X2: 1: Geringer Schweregrad, 2: Mäßiger Schweregrad, 3: Schwer, ohne psychotische Symptome 4: schwer, mit psychotischen Symptomen 5: in partieller Remission 6: Volle Remission 0: unspezifisch Kriterien für eine manische Episode • Eine Phase ungewöhnlicher, anhaltender, überschwänglicher und gereizter Stimmung über mindestens eine Woche. • Dabei treten mindestens drei (bei gereizter Stimmung vier) der folgenden Symptome auf: 1. Übergroßes Selbstbewusstsein oder "Größenwahn“ 2. Geringes Schlafbedürfnis 3. Vermehrte Gesprächigkeit oder Rededrang 4. Gedankenrasen, Ideenflucht 5. leicht ablenkbar 6. Steigerung zielgerichteter Aktivitäten oder psychomotorische Unruhe 7. Exzessive Beschäftigung mit angenehmen Tätigkeiten, die wahrscheinlich unangenehme Folgen haben • Deutliche Beeinträchtigungen, Hospitalisierung notwendig o. ä. • Die Störung wird nicht durch eine Substanz oder Krankheit verursacht Psychische Störungen: Angststörungen (Kapitel 5 und 6) Kriterien einer Panikattacke nach DSM-IV TR • Eine Panikattacke ist keine kodierbare Störung • Codiert wird die spezifische Diagnose, innerhalb der die Panikattacken auftreten, z.B. „300.01, Panikstörung ohne Agoraphobie“ bzw. „300.21, Panikstörung mit Agoraphobie“ • Eine klar abgrenzbare Episode intensiver Angst und Unbehagens, bei der mindestens 4 der nachfolgend genannten Symptome abrupt auftreten und innerhalb von 10 Minuten einen Höhepunkt erreichen: 1. Herzstolpern, Herzklopfen oder beschleunigter Herzschlag, 2. Schwitzen, 3. Zittern oder Beben, 4. Gefühl der Kurzatmigkeit oder Atemnot, 5. Erstickungsgefühle, 6. Schmerzen oder Beklemmungsgefühle in der Brust, 7. Übelkeit oder Magen-Darm-Beschwerden 8. Schwindel, Unsicherheit, Benommenheit oder der Ohnmacht nahe sein, 9. Derealisation (Gefühl der Unwirklichkeit) oder Depersonalisation (sich losgelöst fühlen), 10. Angst, die Kontrolle zu verlieren oder verrückt zu werden, 11. Angst zu sterben, 12. Parästhesien (Taubheit oder Kribbelgefühle), 13. Hitzewallungen oder Kälteschauer. Symptome einer Panikattacke nach DSM-IV • "Das erste Mal als es passierte, fuhr ich gerade auf der Autobahn. Ich hatte das Gefühl, eine Art Knoten in meiner Brust zu haben. Es fühlte sich so an, als wenn ich irgendetwas verschluckt hätte, das stecken geblieben ist. Das Gefühl hielt die ganze Nacht über an. Ich hatte das Gefühl, einen Herzinfarkt zu haben. Ich nahm an, daß es das war, was mit mir passierte. Ein Gefühl der Panik kam auf. Eine Hitzewelle durchlief meinen ganzen Körper. Es war so, als würde ich in Ohnmacht fallen." Panikstörung Panikstörung OHNE Agoraphobie • Wiederkehrende, unerwartete Panikattacken • Anhaltende Besorgnis über das Auftreten einer weiteren Attacke („Angst vor der Angst“) bzw. Sorgen über die Konsequenzen der Attacke („Herzstillstand“) • Panikattacken werden nicht besser durch die Wirkung einer Substanz bzw. durch medizinische Ursachen erklärt, auch nicht durch eine andere psychische Störung (bspw. PTBS…) Panikstörung MIT Agoraphobie • Kriterien für Agoraphobie sind zusätzlich erfüllt = Angst vor Orten, von denen eine Flucht schwierig/ peinlich ist bzw. an denen eine Attacke möglich ist = Vermeidung dieser Orte Phobien • Agoraphobie (ohne Panik, 300.22) • Spezifische Phobie (300.29) • Soziale Phobie (300.23) Spezifische Phobie • Angst ausgelöst durch ein spez. Objekt/ eine spez. Situation oder deren Erwartung • Ausgeprägte Angst, die übertrieben oder unbegründet ist (Einsicht beim Betroffenen vorhanden) • Angstreaktion/ Panikattacke bei Konfrontation mit dem gefürchteten Reiz • Vermeidung der Situation bzw. Konfrontation mit starkem Unbehagen • Funktionale Beeinträchtigung, Dauer > 6 Monate Soziale Phobie - Fallbeispiel • Ein 48-jähriger Chemiker leidet unter starken Ängsten, zu zittern. Erstmals zeigte sich die Problematik, als er noch studierte. Er habe damals eine große Unruhe empfunden, wenn andere Menschen ihm bei der Arbeit (insbesondere bei chemischen Experimenten) zugesehen hätten. In der Regel versuchte er, solchen Situationen aus dem Wege zu gehen, indem er unter Vorwänden den Raum verlassen habe oder (im weiteren Verlauf) erst sehr spät ins Labor gekommen sei und dann im Wesentlichen nachts gearbeitet habe. Seine größte Befürchtung sei immer gewesen, dass jemand sehen könnte, wie er zittere und „vor versammelter Mannschaft“ die anderen Anwesenden auf sein Zittern aufmerksam machen könnte. Er denke, dass so etwas dazu führen könne, dass er „endgültig unten durch“ wäre. Die Ängste hätten sich über mittlerweile zwanzig Berufsjahre erhalten, er habe sich „eigentlich damit arrangiert“. Große Angst mache ihm jedoch die Tatsache, dass die Problematik zunehmend auch sein Privatleben beeinflusse: Er habe festgestellt, dass er in den Supermarkt immer Bargeld mitnehme, da er fürchte, bei der Unterschrift auf dem Kreditkartenbeleg zu zittern. Auch im häuslichen Umfeld gebe es Ängste, beispielsweise anlässlich eines Abends, an dem er mit seiner Frau und Freunden ein Gesellschaftsspiel spielen wollte und dies zwischenzeitlich unter einem Vorwand aus Angst zu zittern abgebrochen habe. Seit diesem Abend fühle er sich „total in der Defensive“ und befürchte, dass seine Ängste ihm „das ganze Leben versauen“. Soziale Phobie • Angst vor einer oder mehreren sozialen oder Leistungssituationen, bei der die Person fremden Menschen und deren Urteil ausgesetzt ist. • Angst vor Demütigung und Peinlichkeit/ Scham (Typische soziale Situationen, z.B. Essen und Sprechen in der Öffentlichkeit, Begegnung von Bekannten in der Öffentlichkeit, Hinzukommen oder Teilnahme an kleinen Gruppen etc.) • Spez. Situation ruft fast immer/ regelmäßig Angst hervor • Einsicht des Betroffenen, dass die Angst übertrieben ist • Vermeidung sozialer Situationen (bzw. Ertragen mit viel Angst, Unwohlsein) • Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit, des Funktionsniveaus Generalisierte Angststörung nach DSM-IV-TR • Übermäßige Angst und Sorgen bzgl. Bestimmter Ereignisse oder Tätigkeiten • mind. 6 Monate lang an der Mehrzahl der Tage vorhanden • Sorgen werden als unkontrollierbar wahrgenommen • Angst/ Sorgen treten mit mindestens 3 der folgenden Symptome auf: • Ruhelosigkeit (oder „auf dem Sprung sein“) • Muskelspannung • leichte Ermüdbarkeit/ Erschöpfung • Konzentrationsstörungen (oder „Leere im Kopf“) • Reizbarkeit • Schlafstörungen • Klinisch bedeutsames Leiden/ Beeinträchtigungen Häufigkeiten von Angststörungen: 12-Monatsprävalenz von Angststörungen nach DSM-VI bei Männern und Frauen Agoraphobie Panikstörungen spezifische Phobien soziale Phobie generalisierte Angststörung Angststörung NNB irgendeine Angststörung (ohne Zwangsstörung, Posttraumatische Belastungsstörung) Durchschnittliches Alter bei Beginn von Angststörungen Weitere Angststörungen im DSM-IV • Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) • einer PTBS gehen ein oder mehrere belastende Ereignisse von außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophalem Ausmaß (Trauma) voran • dabei muss Bedrohung nicht unbedingt die eigene Person betreffen, sondern sie kann auch bei anderen erlebt werden (z. B. wenn man Zeuge eines schweren Unfalls oder einer Gewalttat wird) • tritt in der Regel innerhalb von einem halben Jahr nach dem traumatischen Ereignis auf • geht mit unterschiedlichen psychischen und psychosomatischen Symptomen einher (z.B. Gefühl von Hilflosigkeit, Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses) • Zwangsstörung: Zwangshandlungen (versuchen immer, etwas zu neutralisieren; Person ist klar, dass sie übertriebenes Verhalten zeigt), Zwangsgedanken Somatoforme Störungen (Kapitel 8) Allgemein • Wiederholte Darbietung körperlicher Symptome mit hartnäckigen Forderungen nach medizinischen Untersuchungen trotz wiederholter Befunde, dass die Symptome nicht körperlich begründbar sind Hypochondrie (Angst, an einer bestimmten Krankheit zu erkranken) • Kriterien für Hypochondrie nach DSM-IV-TR: • Übermäßige Beschäftigung mit der Furcht, krank zu sein/krank zu werden, die auf einer Fehlinterpretation körperlicher Symptome basiert. • Befürchtungen bleiben trotz ärztlicher Untersuchungen und Rückversicherungen bestehen. • Die Beschäftigung mit der Furcht verursacht Leid oder Beeinträchtigung • Die Dauer beträgt mindestens sechs Monate. • Weitere Merkmale: • Leugnung psychischer Ursachen • Meist chronischer Verlauf, Symptomschwere schwankt • Lebenszeitprävalenz: 2-7% (wahrscheinlich häufigste somatoforme Störung) ◦ Keine Geschlechtsunterschiede, Beginn meist im frühen Erwachsenenalter • Komorbiditäten: affektive Störungen, Panikstörungen und/oder andere somatoforme Störungen Somatisierungsstörung • Kriterien für Somatisierungsstörung • Zahlreiche körperliche Beschwerden, die vor dem 30. Lebensjahr beginnen, über mehrere Jahre andauern, zur Inanspruchnahme einer medizinischen Behandlung oder bedeutsamen Beeinträchtigung führen. • Jedes der folgenden Kriterien muss zu irgendeinem Zeitpunkt laut Patient erfüllt worden sein: • Vier Schmerzsymptome an unterschiedlichen Körperstellen z.B. Kopf, Unterbauch, Rücken, Gliedmaßen ◦ Zwei gastrointestinale Symptome außer Schmerz z.B. Übelkeit, Blähungen, Durchfall (ohne Vorliegen einer Schwangerschaft) ◦ Ein sexuelles Symptom (außer Schmerz) z.B. Sexuelle Interessenlosigkeit oder Dysfunktion, menstruelle Unregelmäßigkeiten ◦ Ein pseudoneurologisches Symptom (sensorisch oder motorisch – außer Schmerz) z.B. sensorischer Empfindungsverlust, unwillkürliche Muskelkontraktionen • Entweder 1. oder 2.: ◦ 1. Kann nicht durch medizinische Krankheitsform erklärt werden. ◦ 2. Liegt eine medizinische Krankheitsform vor, sind die Beschwerden übermäßig ausgeprägt. • Die Symptome werden nicht absichtlich hervorgerufen oder vorgetäuscht. • LZP: 0,2-2% bei Frauen, weniger als 0,2% bei Männern • Beginn üblicherweise in der Adoleszenz • In Schichten mit niedrigem soziökonomischem Status häufiger • Sehr häufig Komorbiditäten (z.B. Major Depression, Panikstörung, phobische Störungen, GAS) Schmerzstörung • Kriterien für die Schmerzstörung • Schmerz an einer oder mehreren Körperstellen als Schwerpunkt des klinischen Erscheinungsbildes • Schmerz verursacht Leid oder Beeinträchtigung der Funktionalität in klinisch bedeutsamem Ausmaß • Psychische Faktoren spielen offenbar eine wichtige Rolle beim Schmerzerleben • Die Symptome oder Beeinträchtigungen werden nicht absichtlich hervorgerufen oder vorgetäuscht Konversionsstörung • Kriterien für die Konversionsstörung • Ein oder mehrere Symptome, die willkürlich motorische oder sensorische Funktionen beeinflussen und dadurch auf eine neurologische oder sonstige medizinische Krankheitsform hindeuten. ◦ z.B. Lähmung, Blindheit, Taubheit, pseudoepileptische Anfälle • Psychische Faktoren sind erkennbar mit den Symptomen assoziiert • Die Symptome oder Defizite werden nicht absichtlich erzeugt oder vorgetäuscht. • Die Symptome oder Defizite können nicht durch eine medizinische Krankheitsform oder die Wirkung einer Substanz erschöpfend erklärt werden. • Verursacht Leid oder Beeinträchtigungen der Funktionalität in klinisch bedeutsamem Ausmaß. • Nicht auf Schmerz oder sexuelle Funktionsstörung begrenzt, treten nicht ausschließlich im Verlauf einer Somatisierungsstörung auf, können nicht besser durch eine andere psychische Störung erklärt werden. • Prävalenz: auf höchstens 0,5% geschätzt • Konversionsstörungen waren früher relativ häufig • Oft als Vermeidung von Kampfsituation ohne als Feigling zu gelten • Erklärung für sinkende Prävalenz: wachsendes Wissen um medizinische und psychische Krankheiten • • • • Störung verliert ihre defensive Funktion, wenn sich leicht zeigen lässt, dass die Symptomatik keine organische Grundlage hat Außerhalb von militärischen Kampfsituationen: Frauen 2-10mal häufiger betroffen Komorbiditäten: Major Depression, Angststörungen, Somatisierungsstörungen, dissoziative Störungen La belle indifférence (die schöne Gleichgültigkeit) tritt bei 30-50% aller Betroffenen auf Scheinbares Fehlen subjektiver Betroffenheit Körperdysmorphe Störung (kleiner körperlicher Makel oder gar kein Makel wird stark übertrieben wahrgenommen) • Kriterien für die Körperdysmorphe Störung • Übermäßige Beschäftigung mit einem imaginären Defekt des eigenen Äußeren. Wenn eine leichte körperliche Anomalie vorliegt, ist die Sorge der Person darüber deutlich übertrieben. • Beschäftigung mit dem Defekt verursacht Leid oder Beeinträchtigung • LZP: ca. 1-2% • Beginn: üblicherweise in der Adoleszenz (Beschäftigung mit seinem Aussehen beginnt) • Komorbiditäten: sehr oft Depressionen (oft auch suizidal), häufig soziale Phobien, Zwangsstörungen Dissoziative Störungen (Kapitel 8) Allgemein • Teilweiser oder völliger Verlust der normalen Integration von Bewusstsein, Gedächtnis, Identität, Wahrnehmung oder der Kontrolle von Körperbewegungen Depersonalisierungsstörung (Gefühl der Losgelöstheit vom eigenen Körper, "Herausgezoomt"-Gefühl, aber trotzdem bewusstseinsklar) [nur im DSM] • Kriterien für die Depersonalisationsstörung • Andauerndes oder wiederkehrendes Erleben des Losgelöstseins von den eigenen mentalen Prozessen oder dem eigenen Körper. • Die Realitätsprüfung - anders als bei psychotischen Zuständen - bleibt während dieses Erlebens intakt. • Leid oder Beeinträchtigung in klinisch bedeutsamem Ausmaß. Dissoziative Amnesie und dissoziative Fugue und Stupor (= Ganzkörpersteifheit) • Kriterien für die dissoziative Amnesie • Hauptmerkmal: Unfähigkeit, sich an wichtige persönliche Informationen zu erinnern; diese ist zu umfassend, um durch gewöhnliche Vergesslichkeit erklärt zu werden. • Tritt nicht ausschließlich im Verlauf einer Dissoziativen Identitätsstörung, dissoziativen Fugue, PTBS, akuter Belastungsstörung oder Somatisierungsstörung auf und geht nicht auf die direkte körperlicher Wirkung einer Substanz oder eines neurologischen oder anderen medizinischen Krankheitsfaktors zurück. • Die Symptome verursachen Leid oder Beeinträchtigung in klinisch bedeutsamem Ausmaß. • Kriterien für die dissoziative Fugue • Plötzliches Weggehen von daheim, Unfähigkeit sich an eigene Vergangenheit zu erinnern. • Verwirrung über die eigene Identität, oder es wird (teilweise/komplett) eine neue Identität angenommen. • Nicht ausschließlich im Verlauf einer Dissoziativen Identitätsstörung auf und geht nicht auf die direkte körperliche Wirkung einer Substanz oder eines medizinischen Krankheitsfaktors zurück. • Die Symptome verursachen Leid oder Beeinträchtigung in klinisch bedeutsamem Ausmaß. Trance- und Bessessenheitszustände [nur im ICD] Dissoziative Bewegungsstörung und Krampfanfälle [nur im ICD] Dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen [nur im ICD] Dissoziative Identitätsstörung • Kriterien für die Dissoziative Identitätsstörung • Zwei oder mehr unterschiedliche Identitäten, die jeweils eigene und relativ stabile Muster hinsichtlich Wahrnehmung, Umgang und Denken in Bezug auf die Umwelt und das Selbst aufweisen. • Mindestens zwei der Identitäten übernehmen wiederholt die Kontrolle über das Verhalten der Person. • Unfähigkeit, sich an wichtige persönlichen Informationen zu erinnern; diese ist zu umfassend, um durch gewöhnliche Vergesslichkeit erklärt zu werden. • Die Störung geht nicht auf die direkte körperliche Wirkung einer Substanz oder eines medizinischen Krankheitsfaktors zurück. • Hinweis: Bei Kindern sind die Symptome nicht durch imaginäre Spielkameraden oder andere Fantasiespiele zu erklären. Substanzinduzierte Störungen (Kapitel 12) Prägnanz-Typen der Abhängigkeit nach WHO Abhängigkeitstypen • Morphin-Opiat Typ • höchstes Abhängigkeitspotenzial, schnelle Toleranzentwicklung, Verabreichung • meist intravenös, Wirkung: Euphorisches „Entrückt sein“, Schmerzstillung • Barbiturat-Alkohol Typ • Missbrauch von Alkohol, Barbituraten oder Benzodiazepinen, • hier auch low-dose dependence (" Caveat vor Rebound-Effekt beim Absetzen) • Kokain-Typ • starke psychische, keine physische Abhängigkeit, euphorische Wirkung, • Rededrang, Libidosteigerung, reduziertes Hunger- und Schlafgefühl; (bei • chronischem Konsum paranoid-halluzinatorische Psychosen möglich) • Cannabis-Typ • Amphetamin-Typ • Halluzinogen-Typ Umfang Personen mit problematischem Konsummuster Hochrechnung aufgrund Daten eines bundesweiten Suchtsurveys (Kraus, 2008) mit 18- bis 64-Jährigen. Rauschtrinken bei Frauen und Männern * 5 oder mehr Gläser alkoholischer Getränke an mind. 4 der letzten 30 Tage Alkoholkonsum Jugendlicher DSM-IV TR: Missbrauch • A Unangepasstes Muster des Substanzgebrauchs, das in klinisch bedeutsamer Weise zu Beeinträchtigungen/ Leiden führt (zumindest ein Kriterium innerhalb von 12 Monaten): 1. wiederholtes Versagen bei der Erfüllung wichtiger Verpflichtungen (z.B. Schule, Arbeitsplatz, Haushalt) 2. wiederholte körperliche Gefährdung (z.B. im Straßenverkehr) 3. wiederholte Probleme mit dem Gesetz (z.B. Verhaftungen) 4. fortgesetzter Gebrauch trotz ständiger wiederholter Probleme (z.B. Familienstreit). • B zu keiner Zeit Erfüllung der Kriterien für Abhängigkeit. DSM-IV TR: Abhängigkeit • Unangepasstes Muster des Substanzgebrauchs (zumindest 3 Kriterien innerhalb des gleichen Zeitraums von 12 Mon.): 1. Toleranz : a) Dosissteigerung oder b) verminderte Wirkung bei gleicher Dosis 2. Entzugssymptome: a) Entzugssyndrom der jeweiligen Substanz oder b) Gebrauch zur Vermeidung von Entzugssymptomen 3. häufige Einnahme in größeren Mengen oder längeren Zeiträumen 4. anhaltender Wunsch/ erfolglose Versuche den Gebrauch zu verringern/ zu kontrollieren, 5. hoher Zeitbedarf für Substanzbeschaffung, 6. Aufgabe/ Einschränkung wichtiger Aktivitäten (z.B. Beruf, Freizeit) 7. Fortgesetzter Gebrauch trotz Kenntnis der negativen Auswirkungen Polytoxikomanie • Missbrauch und Abhängigkeit betreffen verschiedene Substanzen, wobei der Konsum entweder gleichzeitig oder nacheinander erfolgt. • Die Diagnose einer Mehrfachabhängigkeit beschränkt sich auf die Feststellung eines Zeitabschnitts von mindestens 6 Monaten, in dem die Person wiederholt Substanzen aus wenigstens drei Kategorien (ohne Nikotin und Koffein) zu sich nahm, ohne dass der Konsum einer einzigen psychotropen Substanz im Vordergrund stand. Weiterhin müssen während dieses Zeitabschnitts die Abhängigkeitskriterien für psychotrope Substanzen (als Gruppe) erfüllt sein, jedoch nicht für jede einzelne Substanz. Drogentodesfälle in Deutschland • vor Wende relativ konstant um 500, danach starker Anstieg bis über 2000 (im Jahr 1991) und dann gleichmäßiger Abstieg bis ca 950 (im Jahr 2012) gesellschaftliche Folgen von Alkohol • täglich 0,6 l Bier oder 0,3 l Wein gelten bei Männern als riskant, bei Frauen 0,4 l Bier und 0,2 l Wein Zusammenhang Alkohol-Gewalt-Kriminalität • Prozent der Tatverdächtigen unter Alkoholeinfluss 1993 • 29.9% bei Tötungsdelikten, die eine Planung und im Einzelfall auch eine gewisse Impulskontrolle voraussetzen (z.B. Raubmorde) • 30.1% bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung • 42.4% bei Totschlagdelikten • 52.9% bei Sexualmorden Teufelskreis der Sucht (Zusatz aus altem Skript) Schizophrenie und andere Psychotische Störungen (Kapitel 14) Psychose • = Psychiatrische Erkrankungen, bei welchen die Beeinträchtigung der psychischen Funktionen ein so großes Ausmaß erreicht hat, dass dadurch Einsicht und Fähigkeit, einigen der üblichen Lebensanforderungen zu entsprechen oder der Realitätsbezug erheblich gestört sind • = Psychiatrische Erkrankungen, die durch Wahnerleben und eine veränderte Wahrnehmung bzw. Interpretation der Realität geprägt sind • = Psychiatrische Erkrankungen, bei denen produktive Symptomatik in Form von Gedächtnisstörungen, Denkzerfahrenheit, Wahn, Halluzinationen, Ich-Störungen vorliegt • • • • Psychose: Person ist von Wahrnehmung überzeugt, die nicht mehr durch Realitätsprüfung verändert werden kann Illusion: Sinneswahrnehmung ist real (z.B. Schatten), wird aber missinterpretiert (z.B. Angreifer) --> Misinterpretation kann aber korrigiert werden (z.B. durch wiederholtes Hinschauen) Wahn: Interpretation von allem, was passiert in eine best. Richtung (z.B. Verfolgungswahn: Person telefoniert, dies wird von Betroffenem als Gespräch mit CIA interpretiert); Überzeugung, die logisch inkonsistent ist oder wohlbestätigtem Wissen über die reale Welt widerspricht und trotz gegenteiliger Belege aufrechterhalten wird, weil die persönliche Gewissheit der Betroffenen so stark ist, dass sie rational nicht mehr zugänglich sind --> Inhaltliche Denkstörung Halluzination: Sinneseindrücke, die eingebildet sind (akustisch und visuell) --> sensorische Erfahrung ohne äußeren, realen Stimulus Organische Psychosen (exogene Psychosen) • aufgrund von Hirnerkrankungen, Infektionen (z.B. Demenz, Gehirnentzündungen, raumfordernde Prozesse) • aufgrund von Hirnverletzungen (Schädel-Hirn-Trauma) • aufgrund von exogen zugeführten Substanzen (Medikamenten, Drogen) Nichtorganische Psychosen (endogene Psychosen) • Psychosen des schizophrenen Formenkreises (schizophrene Psychosen) • affektive Psychosen (Depression, Manie, bipolare Störungen mit psychotischen Merkmalen) • die Mischform der sogenannten schizo-affektiven Psychose Organische Psychosyndrome • Akute organische Psychosyndrome • mit Bewusstseinsveränderung (Delir) • ohne Bewusstseinsveränderung (z.B. Halluzinose, amnestische Zustände, affektive Durchgangssyndrome) • bei hirnorganischen Verletzungen durch Alkohol- oder Drogenabhängigkeit • postoperativ, durch starke Schmerzen, Stress oder Schmerzmittel (v.a. bei Patienten, die sehr ängstlich vor dem Eingriff sind) • Chronische organische Psychosyndrome • Demenz • Alzheimer-Demenz • Vaskuläre Demenz (Grunderkrankung oft Hypertonie, Herzinsuffizienz) Schizophrene Psychose • • • Rate an schizophren Erkrankten / 100 000 Bevölkerung – Krankheitsausbruch in Abhängigkeit vom Lebensalter (Häfner, 2000) Lebenslanges Erkrankungsrisiko: ca. 1,0% Risikofaktoren: ◦ Menschen mit einem schizophrenen Elternteil – genet. Disposition und familiäre Erfahrungen ◦ Menschen, deren Väter bei der Geburt bereits im fortgeschrittenen Lebensalter waren (ab 45 – 50 Jahre), haben ein 2-3mal höheres Risiko • • • beginnt meistens im späten Heranwachsenden – und frühen Erwachsenenalter ◦ Tritt bei Männern in früheren Altersstufen häufiger auf als bei Frauen ◦ Durchschnittliches Alter für eine Neuerkrankung bei Männern: ca. 25 Jahre; bei Frauen: ca. 29 Jahre ◦ Nach dem 35. Lj. fällt die Anzahl der Neuerkrankungen bei Männern rapide ab, bei Frauen hingegen nicht Zunahme an Neuerkrankungen ab dem 40. L.j. Mögliche Erklärung: Weibliche Geschlechtshormone (z.B. Östrogen) haben schützende Wirkung ◦ Wenn der Östrogenspiegel niedrig ist (z.B. vor der Menstruation), werden die psychotischen Symptome bei schizophrenen Frauen oft schlimmer ◦ Sinkende Östrogenspiegel während der Wechseljahre als Ursache dafür, dass späte Neuerkrankungen bei Frauen häufiger auftreten als bei Männern Komorbititäten: Depression und Alkohol- und Drogenmissbrauch Symptome der Schizophrenie • • • • • Abulie: Antriebslosigkeit Alogie: Sprechunvermögen, weil keine korrekten bzw. ausreichend logischen Sätze gebildet werden können Anhedonie: Lust- & Interessensverlust Asozialität im Sinne von Rückzug von sozialen Kontakten katatone Symptome: Extreme Bewegungsstörungen im Rahmen einer psychischen Erkrankung Formale Denkstörungen • Denkverlangsamung: Gedankengang schleppend, verzögert, erscheint dem Pat. mühsam • Umständliches Denken: Weitschweifigkeit, keine Trennung zwischen Nebensächlichem und Wesentlichem • Eingeengtes Denken: Verhaftetsein an ein Thema/ wenige Themen • Perseveration: Wiederholung gleicher Denkinhalte/ Angaben • Gedankendrängen: Pat. fühlt sich unter dem Druck ständig wiederkehrender Einfälle / Gedanken (angenehm und unangenehm) • Ideenflucht: Vermehrung von Einfällen, die nicht von einer Zielvorstellung straff geführt werden (Ziel wechselt aufgrund von Assoziationen) • Vorbeireden: Pat. geht nicht auf die Frage ein, auch wenn klar ist, dass er die Frage verstanden hat • Gedankenabreißen • Inkohärenz/ Zerfahrenheit: Paragrammatismus bis Wortsalat sind möglich (Satzbau gestört) --> Inkohärenz und Zerfahrenheit bezeichnen dasselbe Phänomen, der Begriff Inkohärenz wird allerdings bei Demenz verwendet und Zerfahrenheit bei Schizophrenie • Neologismen Inhaltliche Denkstörungen / Wahn • = krankhafte, falsche Beurteilung der Realität, die erfahrungsunabhängig auftritt und an der mit subjektiver Gewissheit festgehalten wird • Unterschiedliche Formen • Wahneinfall (plötzliches Aufkommen wahnhafter Überzeugungen) • Wahnwahrnehmung (abnorme Bedeutungszuschreibung an richtige Sinneswahrnehmung) • Wahnstimmung (emotionale Gespanntheit im Vorfeld des Wahns mit Bedeutungszumessungen und inbeziehungsetzen, das von Gesunden nicht nachvollzogen werden kann) • Weitere Wahnphänomene: Beziehungswahn, Verfolgungswahn, Eifersuchtswahn, Schuldwahn, Größenwahn, ... DSM-IV-TR: Schizophrenie • A. Charakteristische Symptome: Mindestens zwei der folgenden Symptome müssen für einen Monat oder länger bestehen: 1. Wahn 2. Halluzinationen 3. Desorganisierte Sprechweise (häufiges Entgleisen, Zerfahrenheit) 4. Grob desorganisiertes oder katatones Verhalten 5. Negative Symptome, d.h. flacher Affekt, Alogie oder Willensschwäche • Nur ein Kriterium „A“ ist erforderlich, wenn der Wahn bizarr ist oder die Halluzinationen aus einer kommentierenden Stimme oder aus einem Dialog bestehen. • B. Soziale/ berufliche Leistungseinbußen: • Einer oder mehrere Funktionsbereiche wie Arbeit, zwischenmenschliche Beziehungen oder Selbstfürsorge sind für eine bedeutende Zeitspanne seit Beginn der Störung deutlich unter dem früheren Niveau (bzw. bei Störung in der Kindheit/ Adoleszenz wird das zu erwartende Niveau nicht erreicht). • C. Dauer: • Die Zeichen des Störungsbildes halten mindestens 6 Monate an. Dabei müssen floride Symptome über 1 Monat [oder weniger, wenn erfolreich behandelt] vorhanden sein („Akriterien“). Prodromale und residuale Perioden können durch ausschließlich negative Symptome gekennzeichnet sein, A-Symptome können sich jedoch abgeschwächt manifestieren (seltsame Überzeugungen, ungewöhnliche Wahrnehmungserlebnisse). • D. Ausschluss einer schizoaffektiven oder affektiven Störung: • Keine Major Depression-Episode und keine manische oder gemischte Episode ist zusammen mit den floriden Symptomen (= A-Symptome) aufgetreten. Falls eine affektive Episode aufgetreten ist, war ihre Gesamtdauer im Verhältnis zu der floriden/ residualen Phase nur kurz. • E. Ausschluss Substanzeinfluss/medizinische Krankheitsfaktoren: • Keine körperliche/ substanzinduzierte Ursache. • F. Beziehung zu einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung: • Bei einer Vorgeschichte mit autistischer/ tiefgreifender Entwicklungsstörung wird die Diagnose Schizophrenie nur dann gestellt, wenn 1 Monat [oder weniger, wenn erfolreich behandelt] lang ausgeprägte Wahnphänomene oder Halluzinationen vorhanden sind. Entwicklungsstadien einer schizophrenen Erkrankung Schizophreniesubtypen 295.30 Paranoider Typus (häufigste Form) • Hauptmerkmal: Ausgeprägte Wahnphänomene oder akustische Halluzinationen bei weitgehend unbeeinträchtigten kognitiven Funktionen und erhaltener Affektivität. • Diagnosekriterien: Starke Beschäftigung mit Wahn/Halluzinationen; desorganisierte Sprechweise, desorganisiertes bzw. katatones Verhalten oder verflachter Affekt stehen nicht im Vordergrund 295.10 Desorganisierter Typus (ICD-10: Hebephrene Schizophrenie) • Hauptmerkmale: Desorganisierte Sprache, desorganisiertes Verhalten und verflachter oder inadäquater Affekt. Die Verhaltensbeeinträchtigung kann dazu führen, das Alltägliches nicht mehr durchgeführt werden kann (Duschen, Ankleiden, Essenszubereitung). • Diagnostische Kritereien: a. Desorganisierte Sprechweise, desorganisiertes Verhalten, verflachter bzw. inadäquater Affekt vorherrschend, b. die Kriterien für den katatonen Typus sind nicht erfüllt. 295.20 Katatoner Typus • Hauptmerkmal: Ausgeprägte Störung der Psychomotorik. Möglich sind motorische Unbeweglichkeit, übermäßige, nicht zweckgerichtete motorische Aktivität, Mutismus, Willkürbewegungen, Echolalie, Echopraxie, Stupor, Katalepsie. • Diagnostische Kriterien: Mindestens zwei der folgenden: 1. Motorische Unbeweglichkeit (Katalepsie oder Stupor), 2. Übermäßige motorische Aktivität (nicht zweckgerichtet), 3. Extremer Negativismus oder Mutismus, 4. Willkürbewegungen (Haltungsstereotypien, Manierismen, Grimassieren), 5. Echolalie oder Echopraxie. 295.90 Undifferenzierter Typus • Hauptmerkmal: Die diagnostischen Kriterien „A“ für Schizophrenie sind erfüllt, nicht jedoch die Kriterien für den paranoiden, desorganisierten oder katatonen Typus. 295.60 Residualer Typus • Hauptmerkmal: Eine schizophrene Episode hat vorgelegen, das gegenwärtige Bild zeigt keine ausgeprägten positiven psychotischen Symptome. • Diagnostische Kriterien: • a. Fehlen ausgeprägter Wahnphänomene, Halluzinationen, desorganisierter Sprechweise/Verhalten, • b. Fortbestehende Hinweise auf das Störungsbild: Negativsymptomatik oder abgeschwächte „A“ Symptome. Beispiel residualer Schizophrenietypus • "Wenn ich irgend jemanden ins Haus lasse, werde ich erschossen, sagen sie. (Therapeut: Wer sagt das?) Das ist der Adler. Der Adler arbeitet sich bei General Motors durch. Sie haben etwas mit der Kontrolle bei General Motors, die hier jeden Monat durchgeführt wird, zu tun. Wenn du die 25er Zeit machst, d.h., dass du um 25 Minuten nach 1 das Haus verlässt um die Post wegzubringen, können sie dich kontrollieren und sie wissen wo du dich aufhältst. Das ist der Adler. Wenn du nichts tust, dann sagen sie dir schon, was du tun sollst. Jesus schießt dann mit der Schrotflinte und dann... geh nicht ans Telefon und öffne auch nicht die Tür, weil du sonst (von dem) Adler erschossen wirst." Stigma „schizophren = gewalttätig“ • Walsh et al. (2002). Violence and schizophrenia: examining the evidence. British Journal of Psychiatry, 180, 490-495. • Es gibt einen Zusammenhang zwischen Gewalt und Schizophrenie, aber weniger als 10% der Gewalt in der Gesellschaft kann der Schizophrenie zugeordnet werden • Komorbide substanzbezogene Störung erhöht das Risiko für Gewaltanwendung sehr deutlich • Fazel et al. (2009). Schizophrenia and Violence: Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS Medicine, 6 (8), e1000120. • Leicht erhöhtes Risiko für Gewaltanwendung bei Schizophrenie (& anderen Psychosen) im Vergl. zur Allgemeinbevölkerung • 4fach erhöhtes Risiko bei Schizophrenie und komorbider substanzbezogener Störung (vergl. mit „nur“ Schizophrenie) • Risiko für Gewaltanwendung bei Substanzmissbrauch ohne psychotische Störung ebenso hoch Paradigmen der Klinischen Psychologie: Allgemeines Paradigmen der klinischen Psychologie • Es gibt kein einheitliches und umfassendes Theoriesystem, das allgemein akzeptiert ist • --> verschiedene Paradigmen konkurrieren • Paradigmen fußen auf unterschiedlichen historischen Hintergründen und können zu verschiedenen theoretischen und praktischen Konsequenzen führen • Paradigma = wissenschaftliche Schule mit gemeinsamen theoretischen Grundannahmen • Beschäftigung mit verschiedenen Paradigmen und ihren grundlegenden Aussagen zur Entstehung (und Aufrechterhaltung) psychischer Störungen --> Nutzung dieser in der klinischen Praxis: Diagnostik, Therapie, Prävention • Arten von Paradigmen in der Klinischen Psychologie: Behaviorales Paradigma, Kognitives Paradigma, Psychodynamisches Paradigma (diagnost. Instrumente dabei: Biographie, Rorschach-Test), Systemisches Paradigma (diagnost. Instrumente dabei: Umfeld der Person betrachten), Humanistisches Paradigma, Neurobiologisches Paradigma --> Art des Paradigmas entscheidet über diagnostisches Verfahren Paradigmen der Klinischen Psychologie: Behavioristisches Paradigma Grundannahme • Psychische Störungen werden durch dieselben Lernprozesse erworben wie andere Verhaltensweisen --> fehlangepasste Verhaltens- und Erlebensweisen und „normale“ werden nach denselben Gesetzmäßigkeiten gelernt • Alle möglichen Verhaltensweisen können mit dem Erlernen von S-R-Koppelungen erklärt werden • Menschen sind die Summe ihres gelernten Verhaltens: • des äußeren Verhaltens („eine Brücke vermeiden“) --> Reaktion • des inneren Verhaltens („Angst vor Höhe zu haben“ ) --> Gedanken & Gefühle Klassische Konditionierung • UCS (unkonditionierte Stimuli) lösen aufgrund von angeborenen Reflexen zwangsläufig bestimmte UCR (unkonditionierte Reaktionen) aus • Tritt vor dem UCS mehrfach ein bedeutungsloser Reiz auf, dann kann dieser zum CS (konditionierten Stimulus werden) und zukünftig auch alleine eine CR (konditionierte Reaktion) auslösen, welche der UCR sehr ähnlich ist • Lernprozess beruht auf zeitlicher Assoziation Klassische Konditionierung - Pawlow • Erinnerung an Speichelfluss beim Hund auf Futter bzw. Glocke • ein unkonditionierter Stimulus (z.B. Futter) führt zur unkonditionierten Reaktion (z.B. Speichelfluss) UCS → UCR • Glockenton als neutraler Reiz allein kann keine konditionierte Reaktion auslösen: Glocke (= neutraler Reiz) → CR • wird sie jedoch mit dem US (z.B. Futter) gepaart, wird die unkonditionierte Reaktion (z.B. Speichelfluss) ausgelöst Glocke + UCS → UCR • wird anschließend nur noch der Glockenton dargeboten, ist dieser ein konditionierter Stimulus geworden und löst die konditionierte Reaktion (z.B. Speichelfluss) aus Glocke (= CS) → CR Klassische Konditionierung – Watson & Rayner • „little Albert“ (1-jähriger Junge) • lautes Geräusch (UCS) → Schreckreaktion und Flucht (UCR) • Ratte + lautes Geräusch → Schreckreaktion und Flucht (UCR) • Ratte (CS) → Schreckreaktion und Flucht (CR) Störungsbeispiel • eine Person wird in der Straßenbahn überfallen • Angstreaktion = CR Angstreaktion = UCR Konsequenz: Straßenbahnen an sich führen zur Angstreaktion, werden in der Folge vermieden Klassische Konditionierung – „Erweiterungen“ • Generalisierung: CRs werden auf andere, mehr oder weniger dem CS ähnliche Reize übertragen • Konditionierung höherer Ordnung: Neutrale Stimuli, die an einen CS gekoppelt werden können auch eine CR auslösen • Semantische Konditionierung (Spezialfall der Konditionierung höherer Ordnung) • Neutrale Stimuli (z.B. das Wort „Ratte“), die an einen CS gekoppelt werden, können eine CR auslösen • Der internale Reiz „Ratte“ reicht aus um eine CR auszulösen • Sensible Phasen: In manchen Entwicklungsphasen sind Menschen besonders sensibel für bestimmte Konditionierungsvorgänge • Konstitutionelle Unterschiede: ... in der Konditionierbarkeit (emotionale Labilität oder Neurotizismus im Sinne Eysencks) Grundbegriffe der Lerntheorie • Löschung/ Extinktion: Der CS wird wiederholt OHNE den UCS dargeboten --> die CR wird schwächer bzw. findet irgendwann nicht mehr statt • „Preparedness“ (Seligman): Evolutionär bedeutsame Assoziationen (z.B. Angst vor Schlangen, Spinnen, etc.) werden besser/ schneller gelernt als andere • Furchtkonditionierung bei Ratten: Operante Konditionierung (B. F. Skinner) • (früher) instrumentelle Konditionierung • Konsequenzen des Verhaltens sind entscheidend • Auftreten eines beliebigen Verhaltens hängt von dessen Konsequenzen ab • Prozess der Verstärkung: Die Auftretenswahrscheinlichkeit einer bestimmten Reaktion wird durch anschließend erfolgende Belohnung (bzw. Vermeidung eines aversiven Reizes) vs. Bestrafung verändert. • Lernen in der Skinner-Box: Typen Operanten Lernens Störungsbeispiel • Vor allem „Konditionierte Vermeidungsreaktionen“ spielen bei vielen psychischen Störungen eine Rolle • Bsp. Agoraphobisches Vermeidungsverhalten • Person hat u.a. Angst, im Hörsaal nicht an der Treppe und in der Reihenmitte zu sitzen, betritt jeden Hörsaal bereits angstvoll und angespannt. • --> Person setzt sich in die vorderste Reihe, nah an die Tür • --> Anspannung lässt nach, Person beruhigt sich = negative Verstärkung • --> Vermeidungsverhalten wird in Zukunft aufrecht erhalten Operante Konditionierung – „Erweiterungen“ • Verstärkerstärke: Um eine operante Reaktion (= Lernen neuen Verhaltens) hervorzurufen muss die Verstärkung stark sein, zur Aufrechterhaltung reicht eine moderate Verstärkung • Intermittierende Verstärkung: Verhaltensweisen werden langsamer gelernt, wenn sie nicht immer sondern gelegentlich verstärkt werden, aber sie sind besonders löschungsresistent (v.a. wenn nicht regelmäßig) • Relativität von Verstärkern: • Positive Verstärker sind nicht grundsätzlich Geld, Lob, Zustimmung • Negative Verstärker sind nicht mit Tadel, Schmerzen, etc. Gleichzusetzen • --> Verstärkungswert variiert von Mensch zu Mensch • Emotionale „Verhaltensweisen“: Auch Emotionen sind als (innere) Verhaltensweisen zu betrachten, die in Form und Ausmaß durch soziale/ materielle Konsequenzen beeinflusst werden Behavioristisches Paradigma: Bewertung contra: • stellvertretendes Lernen / Lernen am Modell kann durch Konditionierung nicht erklärt werden • es ist schwierig, sich die Entstehung bestimmter Krankheitsbilder durch Konditionierung zu erklären • Konditionierung wird als mechanistisch & stumpfsinnig beschrieben, denn die kognitive Komponente wird komplett vernachlässigt pro: • sparsame Theorie Modelllernen (Albert Bandura) • auch „Beobachtungslernen“, „Lernen am Modell“ • „Bobo/Rocky-Experiment“ (Bandura, 1963) mit 4-5jährigen Kindern: Kinder wenden das Verhalten an, welches beim beobachteten Erwachsenen positiv verstärkt wurde • Relevanz in der klinische Psychologie: • Erlernen von Gewalt • Kinder entwickeln oft Ängste, die sie bei ihrer Mutter beobachtet haben Paradigmen der Klinischen Psychologie: Behavioristisches Paradigma Vergleich mit Behaviorismus • Behaviorismus: S → R „Mensch ist die Summe seines gelernten Verhaltens“ • Kognitivismus: S → K → R „gedankliche Prozesse als entscheidende Determinanten menschlichen Handelns“ Was meint Kognition? • Im engeren Sinn...: „Kognition ist die Aktivität des Wissens, der Erwerb, die Organisation und der Gebrauch von Wissen“ (Neisser, 1979) • Im Sinn kognitiver Ansätze...: • Wahrnehmungen, Interpretationen, Bewertungen • Annahmen, Erwartungen, Lebensregeln • Einstellungen, Überzeugungen, Schemata • Denkfehler, Copingstile (Selbstverbalisation, inneres Sprechen) Grundgedanke kognitiver Theorien • Bedeutung von Kognitionen: Gedankliche Prozesse als entscheidende Determinanten menschlichen Handelns • Kognitionen als mit entscheidende Determinanten von Emotionen, und damit von emotionalen Störungen. • Irrationale oder dysfunktionale Gedanken oder Überzeugungen führen zu emotionalen Störungen und halten sie aufrecht. • In Bezug auf das therapeutische Vorgehen: Die Veränderung dieser Gedanken und Annahmen führt zu psychischem Wohlbefinden. Ellis` ABC Modell • Grundannahme: Psychologische Probleme entstammen irrationaler oder katstrophisierenser Gedanken Ellis‘ 11 störungsverursachende Überzeugungen 1. Für jeden Erwachsenen ist es absolut notwendig, von praktisch jeder anderen Person in seinem Umfeld geliebt und anerkannt zu werden. ◦ beispielhafte Verhaltenskonsequenzen: ständige Enttäuschungen (--> Depression), Selbstzweifel (--> soz. Phobie) 2. Man muss in jeder Hinsicht kompetent, angemessen und leistungsfähig sein, ansonsten ist man eine wertlose und unangemessene Person. ◦ beispielhafte Verhaltenskonsequenzen: ständige Enttäuschungen (--> Depression), Workaholic (--> Burnout) 3. Menschen müssen immer absolut anständig und rücksichtsvoll handeln, andernfalls sind sie verdammenswerte Bösewichte. Sie verkörpern ihre schlechten Taten. 4. Es ist entsetzlich und grässlich, wenn die Dinge nicht so laufen/ sind wie man es gerne möchte. 5. Emotionale Probleme werden hauptsächlich von äußeren Umständen verursacht. Der Einzelne hat wenig oder keine Möglichkeiten seine dysfunktionalen Gefühle oder Verhaltensweisen zu verstärken oder abzuschwächen. 6. Wenn etwas gefährlich oder angsteinflößend sein könnte, sollte man sich ständig damit beschäftigen und sich damit befassen, dass es eintreten könnte. 7. Man soll nicht und darf sich nicht den Verantwortungen und Unwägbarkeiten des Lebens stellen, es ist leichter diese zu vermeiden. 8. Man muss weitgehend von anderen abhängig sein. Man kann das eigene Leben nicht alleine meistern. 9. Die eigene Vergangenheit bestimmt das gegenwärtige Verhalten und weil etwas in der Vergangenheit einmal das Leben stark beeinflusste, wird es immer einen ähnlichen Einfluss haben. 10. Die Probleme anderer sind schrecklich und man muss sich darüber aufregen. 11. Es gibt stets eine präzise, richtige und perfekte Lösung für menschliche Probleme. Es ist schrecklich wenn diese perfekte Lösung nicht gefunden wird. Beck‘s kognitives Modell • Grundannahme: Psychologische Probleme werden durch Denkfehler begründet, die sich auf zugrunde liegende kognitiven Schemata beziehen. • Kognitive Triade: Negative Bewertung der eigenen Person, Umwelt, Zukunft • Fehlerhafte Informationsverarbeitung hält negative Schemata aufrecht (kognitive Fehler): • Willkürliche Schlussfolgerungen (Schlussfolgerungen, die willkürlich, ohne jeden Beweis und oft sogar trotz gegenteiliger Erfahrungen aus alltäglichen Ereignissen gezogen werden; z.B. Misserfolg im Leistungsbereich --> Schlussfolgerung „Ich bin ein Versager“) • Selektive Verallgemeinerung (positive Aspekte von Situationen werden übersehen • Übergeneralisation (aufgrund eines Vorfalls wird eine allgemeine Regel aufgestellt, die unterschiedslos auf ähnliche und unähnliche Situationen angewendet wird; z.B: verpasster Zug --> heute läuft alles schief) • Maximierung bzw. Minimierung (Negatives groß reden, Positives klein reden) • Personalisierung (alles auf sich beziehen) • Verabsolutiertes, dichotomes Denken (Schwarz-Weiß-Denken, d.h. Einteilung in extrem negative oder extrem positive Kategorien) • → Dysfunktionale Schemata (stabile Konzepte) tragen eine Schlüsselrolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen. Störungsbeispiele Albert Bandura: Die Rolle von Erwartungen • Verhaltensweisen werden weniger durch die objektiven Konsequenzen, als durch die subjektive Erwartung von Konsequenzen gesteuert • Outcome-Erwartungen • Erwartung, dass ein bestimmtes Verhalten zum gewünschten Erfolg führt • Efficacy-Erwartungen • Zutrauen, dass erfolgversprechende Verhaltensweise auch tatsächlich durchgeführt wird Bewertung des kognitiven Paradigmas? • Pro: Hinzunahme der kognitiven Komponente • Contra: Vernachlässigung der Emotionalität; Bedeutung kognitiver Ursachenerklärung wird überschätzt Paradigmen der Psychologie: Psychodynamisches Paradigma Sigmund Freud (06.05.1856 - 23.09.1939) • ursprüngliche Tätigkeit als Mediziner in der hirnanatomischen Forschung • 1895 zusammen mit Breuer die „Studien über Hysterie“ • 1900 Veröffentlichung der „Traumdeutung“ • Begründer der Psychoanalyse, die in ihrer „klassischen“ Form bis heute Anwendung findet Grundgedanke • Psychische Störungen werden durch unbewältigte und unbewusste Konflikte in der (frühen) Kindheit verursacht Aspekte der Psychoanalyse • strukturelle Aspekte: Es – Ich – Über-Ich • dynamische Aspekte: Trieblehre • entwicklungstheoretische Aspekte: Psychosexuelle Entwicklungsphasen • therapeutische Aspekte: Heilmethode Psychoanalyse Das Unbewusste • Der bewusste Teil des menschlichen Geistes nimmt nur einen sehr kleinen Teil ein (Eisbergspitze) • Im Unterbewussten liegen schmerzliche Erinnerungen, verbotene Wünsche und andere, verdrängte Erfahrungen • --> Diese Erfahrungen verschaffen sich in Form von Träumen, Phantasien, Versprechern etc. Zugang zum Bewusstsein (z.B. Freud`sche Versprecher) Die Instanzen Topografisches Modell nach Freud ES = Quelle der Triebe • Erste psychische Struktur, die sich entwickelt • Agiert nach dem Lustprinzip (unmittelbare Bedürfnisbefriedigung, keine Rücksicht auf moralische Bedenken) • 2 Kategorien von Trieben: • Todestrieb (Thanatos) angetrieben von Destrudo: Kategorie von Trieben, die nach der vollständigen Aufhebung der Spannung streben, d.h. danach, das Lebewesen in den anorganischen Zustand zurückzuführen. (Aggressions- und Destruktionstrieb) Gegensatz dazu • Lebenstrieb (Eros): konstruktive Triebe, v.a. sexueller Natur (Libido), streben danach, immer größere Einheiten zu schaffen und aufrechtzuerhalten, auch Selbsterhaltungstrieb • Das ES kann keine realen Handlungen hervorbringen, sondern nur Vorstellungsbilder und Wunscherfüllungsfantasien (= Primärprozess-Denken) Ich • • • folgt dem Realitätsprinzip Realistisches Denken als Sekundärprozess, der versucht, Triebwünsche des ES in gesellschaftlich angemessener (und später einer durch das Über-Ich bewilligten) Weise zu realisieren Einsatz v. Vernunft und anderer intellektueller Ressourcen im Umgang mit der Außenwelt nötig Über - Ich • bildet sich mit dem Aufwachsen eines Kindes, Lernen von Regeln, Grenzen, Erwartungen etc. • folgt dem Moralitätsprinzip, entspricht dem Ich-Ideal • „Gewissen“ • Sanktionierungsmechanismen des Über-Ich sind Schuldund Schamgefühle, Belohnung erfolgt durch Stolz • inneres Kontrollsystem, welches die „hemmungslosen“ Wünsche und Triebe des ES begrenzen soll Psychodynamik (wie kann Störung entstehen?) • Auffassung, dass das Verhalten einer Person in starkem Maß von unbewussten psychischen Kräften bestimmt wird • Innere Kräfte interagieren miteinander und formen das Verhalten, Denken und Fühlen der Person (dynamische innere Kräfte) • Gestörtes Verhalten oder Symptome werden als Folgen innerpsychischer Konflikte der inneren Kräfte verstanden oder als Versuche, die Konflikte im Unbewussten zu lösen • die Tiefenpsychologie geht davon aus, dass jedes problematische Verhalten durch frühere Erfahrungen (Kindheit) determiniert ist bzw. die Aktualisierung in der Kindheit unbewältigter Konfliktsituationen darstellt (d.h. heutige Konflikte sind Aktualisierung der früheren Konflikte) Neurose = unbewältigter Konflikt • löst Angst aus • v.a. intrapsychische Konflikte, die nicht bewusst sind • Innere Ambivalenzen (zwischen gegensätzlichen Impulsen, Motiven etc.), die sich immer wieder im Leben der Betroffenen finden, ohne dass eine zufriedenstellende Bewältigung möglich wäre • Konfliktmuster bleiben über lange Lebenszeiträume erlebens- und handlungsbestimmend Konflikte zwischen Instanzen • Konflikt zwischen einem starken Über-Ich gegen ein (schwaches) ES: Triebimpuls wird wenig wahrgenommen, stark durch das Über-Ich gehemmt --> mögliche resultierende Störungen: Zwänge, soziale Phobie, Somatisierungsstörung • Konflikt zwischen einem starken ES und einem (schwachen) Über-Ich: Starker Trieb und schwache Hemmung, die Verantwortung für eigenes Handeln und für eigene Impulse wird eher nicht übernommen --> mögliche resultierende Störungen: Sucht, Arbeitsstörungen / Lern- & Leistungsstörungen (z.B. Prokratination), Binge Eating, dissoziale Persönlichkeitsstörung • Bündnis zwischen dem Ich mit dem Über-Ich gegen ein (schwaches) ES: Triebe, Wünsche und Impulse kaum wahrgenommen, das Ich setzt rigide Verbote des Über-Ichs sehr streng um --> mögliche resultierende Störungen: oft Schuld als zentraler Faktor, Depression, Anorexie • Bündnis zwischen dem Über-Ich und dem ES gegen ein schwaches Ich: Konflikt zwischen stark spürbaren Triebimpulsen und einer starken gegengerichteten Triebhemmung; allein der Wunsch kann beim (sadistischen) Über-Ich Bestrafungsimpulse auslösen --> mögliche resultierende Störungen: Bulimie, selbstverletzendes Verhalten (z.B. Borderline), Sucht mit häufiger Abstinenzverletzung Angst und Abwehr • Angst als zentrales Element und universelles Symptom neurotischer Störungen • Angst signalisiert, dass Wünsche und Triebregungen ins Bewusstsein dringen • Neurotische Angst kann nicht durch rationale Maßnahmen bewältigt werden, da der zugrunde liegende Konflikt unbewusst ist • Daher greift das Ich auf Abwehrmechanismen zurück, die die unerwünschten Inhalte wieder aus dem Bewusstsein verdrängen, um die Angst-Gefühle bewältigen zu können Abwehrmechanismen (kleine Auswahl) • Verdrängung: Verhinderung des Eindringens unerwünschter oder gefährlicher Erfahrungen in das Bewusstsein (>Vermeidung von negativen Affekten) • Projektion: Übertragung eigener Unzulänglichkeiten und unmoralischer Wünsche auf andere • Regression: Rückzug auf eine frühere Entwicklungsstufe mit primitiveren Reaktionen • Verleugnung: Schutz vor einer unangenehmen Wirklichkeit durch die unbewusste Weigerung, ihre Bedeutung wahrzunehmen • Rationalisierung: Versuch, sich einzureden, dass das eigene Verhalten verstandesmäßig begründet ist und somit gerechtfertigt; Gefühlshafte Anteile werden ignoriert oder unterbewertet • • • • • • Kompensation: Verhüllung einer Schwäche durch Überbetonung eines erwünschten Charakterzuges Sublimierung: Befriedigung nicht erfüllter (sexueller) Bedürfnisse durch gesellschaftlich akzeptierte Leistungen Isolierung: Abtrennung eines unerfüllbaren (vom Ich nicht annehmbaren) Wunsches von der eigenen Person Ungeschehen machen: Sühneverlangen für unmoralische Wünsche und Handlungen, um diese damit aufzuheben (oft durch Verhaltensrituale) Verschiebung: Entladung gewöhnlich feindseliger aufgestauter Energie auf weniger gefährliche Objekte Projektive Identifikation: Jemand verhält sich so, dass die eigenen, meist aggressiven Impulse beim Gegenüber geweckt werden und dieser sie stellvertretend (gegen den Pat.) auslebt Psychosexuelle Entwicklung: Phasen der psychosexuellen Entwicklung • Orale Phase (1. – 2. Lebensjahr) • Mund als primäre Zone des Lustgewinns, Saugen als Quelle größter Befriedigung • Anale Phase (2. – 3. Lebensjahr) • Anus als Hauptquelle angenehmer Empfindungen; Reinlichkeitserziehung • Phallische Phase (3. – 5./6. Lebensjahr) • Lustempfinden durch Stimulation der eigenen Genitalien • Latenzperiode (6. – 12. Lebensjahr) • Sexuelle Motive treten in den Hintergrund • Genitale Phase (mit der Pubertät) • Lustempfinden wird aus sexuellen Beziehungen gewonnen Psychosexuelle Entwicklung: Störungsentwicklung • In jeder Phase ist eine angemessene Befriedigung notwendig, um eine Fixierung zu vermeiden und damit die Entwicklung möglicher psychischer Störungen. • Bestimmte psych. Störungen haben ihren Ursprung in phasenspezifischen Fixierungen: • orale Phase --> Depressionen, Süchte • anale Phase --> Zwangsstörungen, Phobien • phallische Phase --> Störungen der Identität • je früher die Fixierung, desto schwerwiegender ist die Störung Freud‘s Erklärungsansatz psychischer Störungen in 5 Punkten (Achtung: stark vereinfacht) • Psychische Störungen (sog. Neurosen) entstehen dadurch, dass aktuelle Lebenssituationen mit unbewältigten Konfliktsituationen aus der Kindheit "verwechselt“ werden • Verwechslung ist möglich, weil Konflikte in der Kindheit ins Unbewusste verdrängt wurden • keine bewusste Analyse mehr möglich • aktuelle und damalige Situationen sind nicht unterscheidbar • es entsteht Wiederholungszwang • Die Ausgangskonflikte in der Kindheit entstehen, wenn eigene Triebimpulse des Kindes mit Beschränkungen aus der Umwelt (z.B. Strafandrohung der Eltern) in Konflikt geraten. Mit der Zeit lösen diese "gefährlichen" Triebimpulse deshalb Angst aus • Die Angst wird zum Motor für Abwehrprozesse (z.B. Verdrängung, Sublimierung, Projektion). • Abwehrprozesse führen dann zu gravierenden Störungen, wenn sie keinen (ersatzweisen) Abbau der Triebspannungen ermöglichen Freuds Antwort auf die sog. Spezifitätsfrage: Die Art der Störungen hängt davon ab, in welcher Entwicklungsphase die unbewältigten Konflikte auftreten. Faustregel: Je früher die Konflikte, desto gravierender die Störung Erweiterungen – Objektbeziehungstheorie Melanie Klein, Margaret Mahler und Otto Kernberg: • geht davon aus, dass die frühesten Erfahrungen mit Bezugspersonen Grundlage für alle späteren Beziehungsgestaltungen bilden • Seelische Strukturen sind auch das Ergebnis frühester Beziehungserfahrungen OBJEKT • = die seelische Repräsentanz einer äußeren Beziehung, die durch die subjektive Erlebensweise geprägt und gestaltet wird. Das verinnerlichte Objekt ist also nicht so wie das äußere Objekt, sondern so wie die Person (Subjekt) es erlebt hat. (d.h. keine 1 zu 1 Abbildung) • Reale Begegnungen werden stets auf der Grundlage innerer Objektrepräsentanzen wahrgenommen und verinnerlicht Entwicklung von Objektrepräsentanzen • Durch einen Prozess namens Introjektion macht das Kind wichtige Personen in symbolischer Form zu einem Teil seiner Persönlichkeit (durch Vorstellungsbilder und Erinnerungen) • Bsp.: Kind mit einem sehr strafenden Vater internalisiert Bilder dieses Objekts, dieses Abbild übt dann sehr strenge Selbstkritik aus und beeinflusst das Verhalten des Kindes • Internalisierte Objekte haben gegensätzliche Eigenschaften (anregend vs. frustrierend) und können sich vom Ich abspalten und unabhängig weiter existieren --> KONFLIKT • Objektbeziehungspsychologie heute mit das wichtigste Paradigma der Psychoanalyse, vor allem bei der Erklärung (und Behandlung) von Persönlichkeitsstörungen Borderline-Persönlichkeitsstörung n. Otto Kernberg • frühe, destabilisierende Beziehungserfahrungen • pathologisch internalisierte Objekte können nicht integriert und zusammengeführt werden • Pat. entwickeln keine stabile persönliche Identität (des Selbst) • Pat. können sowohl das Selbst als auch andere Menschen nicht als Mischung aus guten und schlechten Eigenschaften wahrnehmen, sondern neigen zum „Schwarz-Weiß-Denken“ Bewertung des psychodynamischen Paradigmas • pro: Ansatz klingt größtenteils plausibel • contra: realitätsfern, Operationalisierung meist nicht möglich und somit ist die Theorie nicht empirisch prüfbar (v.a. Begriff des Unbewussten) Paradigmen der klinischen Psychologie: Systemisches Paradigma Definition System • Aggregat von Elementen, die durch bestimmte gesetzmäßige Vorgänge miteinander verknüpft sind und sich wechselseitig beeinflussen. • Der Systembegriff wird im klinischen Zusammenhang vor allem auf soziale Systeme (Paare, Familie) angewendet. • In Psychologie z.B. Aggregat = Familie, Elemente = Familienmitglieder • In Psychologie z.B. Aggregat = Krankenhaus, Elemente = einzelne Abteilungen oder Personen der einzelnen Abteilungen Grundsätze • Der systemische Ansatz vertritt kein störungsspezifisches Konzept • Grundgedanke: Die Störung, welche der Klient präsentiert, ist die bestmöglichste Lösung für das familiäre System in einer Konfliktsituation. • Somit ist der Symptomträger auch nicht der „eine Kranke“, sondern das System, z.B. die Familie, in der sich die Störung entwickeln konnte, ist gestört ➔ Wertschätzende Haltung für die „bisherige ideale Lösung“ ➔ Therapieziel: Erweiterung der zur Verfügung stehenden Lösungsmöglichkeiten für das betroffene System (bspw. lösungsorientierte Ansätze) Grundkonzepte systemischer Theorie 1. Zirkularität • Das Verhalten jedes Mitgliedelements eines Systems ist zugleich Ursache und Wirkung des Verhalten der anderen Mitglieder. Eine lineare Ursache-Wirkungs-Beschreibung („Er trinkt, weil sie ihn unter Druck setzt.“ vs. „Sie setzt ihn unter Druck, weil er trinkt.“) ist nicht möglich. 2. Kommunikation • = Austausch von Botschaften zwischen Systemmitgliedern. Ein Inhaltsaspekt („Was wird gesagt?“) lässt sich von einem Beziehungsaspekt („Wie wird etwas gesagt?“ oder „Was denkt A darüber, dass B dies gerade jetzt zu C sagt?“). Oft stimmt der Beziehungsaspekt mit dem Inhaltsaspekt nicht überein (paradoxe Kommunikation) 3. Regeln • Mit der Zeit ergeben sich im System bestimmte Kommunikationsabläufe, in denen ein Beobachter Muster (= formal ähnliche Abläufe bei wechselnden Inhalten) erkennen kann, die als Regeln formuliert werden können. („immer wenn A weint, geht B zu A und tröstet A“) • Sämtliche Kommunikationsvorgänge in einer Familie beruhen auf einem umfassenden Regelsystem 4. System-Umwelt-Grenzen • Wer gehört (noch) zum System? Wer nicht? • Wie offen und durchlässig oder wie geschlossen ist das System? • Kann auch auf Einzelpersonen angewendet werden --> Kann sich auch auf das System „eigene Gefühlswelt“ beziehen, z.B. „Sind starke Rachegefühle legitime Mitglieder meiner Gefühlswelt?“ 5. systemtheoretische Analyse: • Versuch Regelsysteme zu beschreiben • Beschreibungen sollen die psychischen Störungen eines Familienmitglieds unmittelbar verständlich machen, ohne sie im eigentlichen Sinne zu erklären • --> Zentraler Unterschied zu anderen Paradigmen: „beschreiben statt erklären“ Pathogene Kommunikation • Tangentialisierung: • Der Interaktionspartner B verweigert immer wieder eine Stellungnahme zum Beziehungsaspekt, der in den Äußerungen des Partners A enthalten ist • z.B. Kind macht Sandkuchen für Mutter und übergibt ihn in Wohnung --> Mutter schimpft über Sand in der Wohnung • Mystifikation: • Partner A wird vor die Alternative gestellt, seiner eigenen Wahrnehmung zu trauen oder dem, was Partner B sagt • Die Äußerungen von B haben dabei folgenden Inhalt: „Was Du siehst/ denkst/ fühlst ist falsch! Ich sage Dir, im Grunde siehst/ denkst/ fühlst du folgendes....“ • z.B. Junge hat Angst, in den Keller zu gehen --> Vater: "Mein Sohn hat keine Angst!" --> Mystifikation sagt aus: "so, wie du bist, ist es falsch" • Das wiederholte Auftreten solcher Vorgänge in der Kind-Eltern-Beziehung kann beim Kind auf die Dauer zu Störungen führen, (a) weil diese Beziehung für das Kind lebenswichtig ist, und (b) weil sich das Kind in der Bewertung seiner eigenen Wahrnehmungen noch unsicher ist. • Lösung: Metakommunikation Bewertung des systemischen Paradigmas • pro: Betrachtung des Umfelds • contra: • Zweifel daran, ob man durch Betrachtung der Kommunikation klinische Störungen heilen kann → nur für subklinische Probleme effektiv; präventiv sinnvoll, aber Effektivität zur • Minderung klinischer Störungen fragwürdig Kommunikationsfähigkeit, Perspektivübernahme und Fähigkeit zur Reflexion als wichtige Voraussetzung → schwierig, da nicht alle Personen dazu in der Lage Paradigmen der klinischen Psychologie: Humanistisches Paradigma (Begründer: Carl Rogers) Klientenzentrierter Ansatz • Quellen: Existenzphilosophie; Humanismus; empirische Psychologie • 1. Phase: „Nicht-direktive Beratung“ (1938-1950) • 2. Phase: „Klientenzentrierte Psychotherapie“ (1950-1965) • 3. Phase: „Person(en)zentrierte Psychotherapie“ (ab 1965) • Deutschland: „Gesprächspsychotherapie“ Klientenzentrierte Persönlichkeitstheorie • Axiom: Aktualisierungstendenz • Die dem Organismus eigene Tendenz, all seine Kapazitäten so zu entwickeln, dass sie dazu dienen, den Organismus zu erhalten oder zu erweitern („enhance“) (Rogers, 1959) • Organismen entwickeln sich, insbesondere auch in Zeiten von Anforderung und Bedrohung, in Richtung • Überleben • Vermehrung • Differenzierung von Funktionen • Steigerung der Wirksamkeit • Autonomie • Flexibilität • Die Aktualisierungstendenz äußert sich in der organismischen Bewertung (Erfahrungen werden vom Organismus bewusst oder unbewusst bewertet) • Bedeutung für Aufrechterhaltung und Entfaltung des Organismus (alles wird bewusst oder unbewusst darauf bewertet, ob es gut oder schlecht / wichtig oder irrelevant für mich ist) • Affekte Zentrale Begriffe • Mensch = Organismus, der sich in Koevolution mit seiner Umgebung befindet (Koevolution: Mensch beeinflusst Umgebung und Umgebung beeinflusst Mensch) • Erfahrung, Symbolisierung, Selbst (siehe unten) • --> sind Funktionen und Orientierungspunkte des Organismus, seine Informationsgrundlage für all seine Aktivitäten Organismus • Gesamtheit aller physischen und psychischen Funktionen des Menschen • Reagiert als „organisiertes Ganzes“ • Menschliches Verhalten ist subjektiv begründet, es wird gesteuert durch die Erfahrungen, die vom Organismus als bewertete Erfahrungen gespeichert worden sind Erfahrung • Alles, was sich gegenwärtig innerhalb des Organismus in einem bestimmten Augenblick abspielt • Empfindungen der Sinnesorgane (visuell, Geräusche, Tastempfindungen…) • Vorgänge im Organismus (Muskelanspannung, Hunger, Schmerzen, …) • Kognitive Prozesse (Gedächtnis, Bewertung, ...) • und was prinzipiell dem Prozess der Gewahrwerdung (Bewusstwerdung) zugänglich ist • der unbewusste Anteil ist dabei nicht eine Instanz oder Verdrängtes, sondern eine Qualität psychischer Prozesse (unterschwellige Wahrnehmung) Symbolisierung • Bewusstwerdung, Gewahrwerdung, symbolische Repräsentation eines Teils unserer Erfahrung • Unterschiedlicher Schärfegrad: • Exakt: Interaktionspartner erkennen und beachten bedingungslos die Erfahrung z.B. Angst und Vorfreude bei ersten Date • Unvollständig: Erfahrung wird nur zum Teil beachtet und verstanden z.B. nur Vorfreude bei erstem Date (Mann denkt: "Ich bin so ein toller Hecht. Da hab` ich nichts zu befürchten) • Verzerrt: Erfahrung wird verzerrt verstanden z.B. Ärgeraspekt des Kindes wird mit Müdigkeit erklärt • Nicht symbolisiert: Erfahrung wird nicht beachtet oder explizit ausgeschlossen z.B: "mein Sohn hat keine Angst" • Vermittlung durch bedeutsame Sozialpartner (durch Verstehen & positive Beachtung) Selbst (-konzept; - struktur) • aus Erfahrungen werden Selbsterfahrungen • aus den Selbsterfahrungen bildet sich eine Struktur, das Selbstkonzept (Selbstbild, Selbststruktur) • Erfahrung: ich sehe eine Blume • Selbsterfahrung: ich erlebe, dass ich eine Blume sehe • Selbstkonzept: ich nehme mich wahr, als eine Person, die erlebt, dass sie eine Blume sieht • In sich geschlossene und konsistente Einheit • strukturierende Funktion (z. B. Infos mit Erinnerungen verbinden und einordnen, strukturieren) • emotionale Funktion (Diskrepanz beim Vergleich des aktuellen mit idealen Selbst $ negative Reaktion) • handlungsleitende Funktion (Entscheidungen, Erklärungen, Bewertungen, Pläne) • Selbstkonzept: • Selbstkonzept ist ein Zusammenschluss von Wahrnehmungsmustern, die zur Begegnung mit dem Leben benutzt werden • Wahrnehmung der Charakteristiken des „Mich“ von einem äußeren Bezugsrahmen aus • Einschließlich Bewertungen Kongruenz und Inkongruenz • Kongruenz/ Inkongruenz zwischen Selbst und Erfahrung bezieht sich auf das Ausmaß in dem die Erfahrung der Symbolisierung im Selbst entspricht • Kongruenz: Erfahrung kann in Selbsterfahrung integriert werden, stellt keine Bedrohung für Selbstkonzept dar • Inkongruenz: Selbst mit seinen Inhalten ist durch die Erfahrung in Frage gestellt und bedroht • Abwehr • Entfaltende Funktionen der Selbstaktualisierungstendenz beeinträchtigt Selbstaktualisierungstendenz • Verändernde Umwelten erfordern Anpassungsleistung des Organismus (Assimilation vs. Akkommodation) • Selbstaktualisierungstendenz ist bestrebt, das Selbst zu • erhalten (Orientierung erlauben) • entfalten (Schritthalten mit Veränderungen) • Selbst muss sich mit entwickeln • Psychische Störungen entstehen durch Behinderungen der einzigartigen menschlichen Tendenz zur Selbstverwirklichung "Fully functioning person" Paradigmen der klinischen Psychologie: Neurobiologisches / Biopsychologisches Paradigma Frühere „biologische“ Erklärungsansätze • Biologische Vorgänge führen zu psychischen Störungen (z.B. organisch bedingte psychische Störungen nach ICD-10) Klassifikation nach ICD 10 Organische Psychosyndrome Akute organische Psychosyndrome • mit Bewusstseinsveränderung (Delir) • ohne Bewusstseinsveränderung (z.B. Halluzinose, amnestische Zustände, affektive Durchgangssyndrome) • bei hirnorganischen Verletzungen durch Alkohol- oder Drogenabhängigkeit • postoperativ, durch starke Schmerzen, Stress oder Schmerzmittel (v.a. bei Patienten, die sehr ängstlich vor dem Eingriff sind) Chronische organische Psychosyndrome • Demenz • Alzheimer-Demenz • Vaskuläre Demenz (Grunderkrankung oft Hypertonie, Herzinsuffizienz) Frühere „biologische“ Erklärungsansätze • Psychologische Vorgänge führen zu körperlichen Störungen (frühere Sichtweise der sog. Psychosomatik) Grundgedanke des biopsychologischen Paradigmas • letzten Endes beruhen alle körperlichen und psychischen Erkrankungen und Störungen auf einer Interaktion zwischen biologischen und psychosozialen Verursachungsfaktoren Das Biopsychologische Paradigma • Unterschiedliche Beziehungen zwischen biologischen und psychologischen Prozessen werden in verschiedenen Forschungsdisziplinen fokussiert • Neuropsychologie (Akzentuierung der Funktionen des Gehirns und des zentralen Nervensystems) • Psychophysiologie (Akzentuierung des AN) • Biochemie (Stoffwechselprozesse) • Verhaltensgenetik (Vererbungsvorgänge) • aus Internet: • Verschiedene Aspekte können aus Sicht des Biopsychologischen Paradigmas die Persönlichkeit bedingen: • Aufbau der biologischen Systeme (auf Organebene) • Anatomische Feinstruktur (auf Zellebene, z.B. Vernetzungsgrad von Neuronen) • Aktivität der biologischen Systeme (z.B. im ZNS, Hormon-, Immunsystem) Biologisch kausale Faktoren für psychische Störungen • Neurotransmitterhaushalt • Stressachse/ Hormonhaushalt • organische Schäden/ cerebrale Dysfunktion • Neuronale Plastizität • Genetik Erregungsleitung an Synapsen Beispiel Acetylcholin • AP erreicht die Synapse --> Ca+ strömen in das Axonende --> Vesikel werden angeregt, Acetylch. In den synaptischen Spalt auszuschütten --> 2 Acetylch.-Moleküle wirken am postsynaptischen Rezeptor --> Na+-Ionen strömen in die postsyn. Zelle --> Acetylcholin wird von dem Enzym Cholinesterase gespalten --> Spaltprodukte gelangen wieder in die präsynaptische Zelle Neurotransmitter-Ungleichgewicht • Neurotransmitter wird im Übermaß produziert und in den synaptischen Spalt freigesetzt • Fehlerhafte Prozesse, durch die die Neurotransmitter nach ihrer Wirkung an der postsynaptischen Membran deaktiviert werden (bspw. durch Spaltung oder Wiederaufnahme in das präsynaptische Endknöpfchen) " erhöhte Menge des Neurotransmitter im synaptischen Spalt vorhanden • Störungen der Rezeptoren der postsynaptischen Membran, übersteigerte oder herabgesetzte Empfindlichkeit Neurotransmitter & psychische Störungen • Noradrenalin --> akute Stressreaktion • Adrenalin --> akute Stressreaktion • Dopamin --> Schizophrenie, Sucht • Serotonin --> Depression • GABA (inhibitorischer Neurotransmitter, wichtig für Angstreduktion) --> Erregungszustände Stressachse / Hormonhaushalt • Stressor → bedroht Homöostase (Gleichgewicht) des Körpers • Stressachsen im Überblick: • SAM-Achse: schnelle Achse über Rückenmark (rechts) • HPA-Achse: langsame Achse (links) SAM (sympathetic adrenomedullary) -Achse • Sinn der SAM-Achse: für Alarmreaktion (flight or fight): HPA-Achse vom Hypothalamus durch Hormon CRH zu Hypophyse und von Hypophyse durch Hormeon ACTH zur Nebennierenrinde HPA-Achse funktioniert mit einer Feedback-Schleife HPA-Achsen Veränderungen bei psychischen Erkrankungen • • • Vgl. linkes und rechtes Bild: • zu viel Ausschüttung von CRF (Pfeil bei C dicker als bei A) • dadurch stumpft Hypophyse ab und schüttet weniger ACTH aus • dadurch auch weniger Cortisol (Pfeil bei C dünner als bei a) verstärkte Sensitivität der negativen Feedbackschleife der HPA-Achse bei PTBS [Yehuda, 2001] bei Depression befindet sich mehr Cortisal im Blut einige biologische Kosten von Stress • Herabsetzung von Immunparametern (Zahl der Granulozyten, der natürlichen Killerzellen sowie der B- und T-Lymphozyten) im Blut • Abwehrzellen werden „gebremst“ > Schwächung des Immunsystems • erhöhter Blutdruck und Herzschlag verringern die Elastizität der Blutbahnen • Drosseln der Blutversorgung macht Magen- und Darmschleimhaut anfällig für Geschwüre • Aktivierung der HPA-Achse • Immunsystem verändert Psyche (Krankheitsverhalten) Physiologische (und morphologische) Effekte von Stress • Cortisol kann zu morphologischen Veränderungen führen (Hippokampus reagiert sensitiv auf Cortisol) → bei extremem Stress verlieren Zellen (Dendriten?!) des Hippokampus ihre Funktionalität bis hin zum Absterben Effekte von Stress auf Hirnstrukturen • • • • • • • • Cortisol reagiert in verschiedenen Bereichen des Gehirns unterschiedlich Hippokampus: mittleres Stresslevel fördert, geringes oder extremes schadet im Hinblick auf Gedächtnisleistung Neuronen im Hippocampus werden zerstört, was zur Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses führt. Die Speicherung von neuen Informationen wird verhindert. Folge: Konzentrationsstörungen, Probleme, sich neue Informationen zu merken. Die Neurogenese im Hippocampus wird durch den dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel gehemmt. Der Hippocampus kann bis zu 25 % schrumpfen. Seine Funktion ist eingeschränkt. Folge: Informationen werden falsch oder unzureichend bewertet und verarbeitet Der Frontallappen verkleinert sich. Folge: Es treten Verhaltensauffälligkeiten auf. Die Amygdala ist hyperaktiv und schrumpft im weiteren Verlauf. Folge: Es treten affektive Störungen auf. Ist man den Stressauslösern dauerhaft ausgeliefert, kann es zu schweren Depressionen kommen. Und die Schädigung des Gehirns durch Stress kann zu frühzeitiger Demenz führen. Limbisches System Genetik: das menschliche Erbgut • Doppelhelix-Struktur der DNA: • der menschliche Chromosomensatz: Replikation der DNA bei der Zellteilung • • Mutation = „Irrtum“ bei der Replikation eines DNA-Stranges; erbringt ein verändertes, neues Allel Polymorphismen = Auftretenswahrscheinlichkeit einer Genvariante (Mutation) ist größer als ein Prozent der Bevölkerung Typen von Chromosomenaberrationen Störungen aufgrund von Chromosomenanomalien Genexposition • = Schritt vom Genotyp (DNA Info) zum Phänotyp • = Proteinbiosynthese • • • In jeder neuen Zelle befindet sich die identische Erbsubstanz, die Zelldifferenzierung kommt dadurch zustande, dass bestimmte Gene an- und ausgeschaltet werden Mechanismen dafür noch unklar, die Umwelt (z.B. Stress) scheint auf diesen Prozess aber Einfluss nehmen zu können epigenetisceh Infos können vererbt werden Ätiologie psychischer Störungen Bedeutung der Ätiologie für die anderen Aufgabenbereiche • Diagnostik: Ätiologische Annahmen bestimmen an welchen Informationen über die Klienten PsychologInnen interessiert sind • Psychotherapie: Ätiologische Annahmen bestimmen die Ziele und Methoden der angewandten Interventionen • Prävention: Interventionen sind besonders stark von ätiologischen Annahmen abhängig Ätiologie • = Ursachenforschung: Wie entstehen psychische Störungen? (im Einzelfall, in einer Population …) • Ätiologieforschung liefert Evidenz hinsichtlich der Annahmen der unterschiedlichen Paradigmen • Theoretische Annahmen werden auf die Dauer nur akzeptiert, wenn sie sich empirisch ausreichend belegen lassen Methoden der Ätiologieforschung • Fallstudien • • • • • • Eine 46jährige, verheiratete Hausfrau wurde vom Psychiater ihres Mannes zur Konsultation überwiesen. Im Verlauf der Erörterung bestimmter Ehekonflikte, die er mit seiner Frau hatte, hatte der Mann die "Schwindelattacken" seiner Frau erwähnt, die sie sehr behinderten. In der Konsultation beschrieb die Frau, sie werde vier oder fünf Abende pro Woche von extremem Schwindel, begleitet von leichter Übelkeit, überwältigt. Während dieser Attacken erscheine ihr das Zimmer um sie herum "schimmernd" und sie habe das Gefühl zu "schweben" und das Gleichgewicht nicht halten zu können. Unerklärlicherweise traten die Attacken fast immer nachmittags um vier Uhr auf. Gewöhnlich musste sie sich auf die Couch legen, und oft ging es ihr erst um sieben oder acht Uhr abends wieder besser. Danach verbrachte sie den Rest des Abends meist vor dem Fernseher, und sehr oft schlief sie im Wohnzimmer ein und ging erst um zwei oder drei Uhr morgens ins Schlafzimmer und zu Bett. Ihr Internist, ein Neurologe und ein Hals-Nasen-Ohren-Spezialist hatten die Patientin mehrfach für körperlich gesund erklärt. Auf die Frage nach ihrer Ehe beschrieb die Patientin ihren Mann als äußerst anspruchsvollen Tyrannen, der sie und ihre vier Kinder verbal misshandelte. Sie gab zu, dass sie täglich seine Rückkehr von der Arbeit fürchtete, weil sie wusste, dass er das Haus als Saustall bezeichnen und ihm das Essen nicht schmecken würde. Seit dem Beginn ihrer Attacken ging er, wenn sie nicht in der Lage war, das Abendessen zuzubereiten, mit den vier Kindern zu McDonalds oder in eine Pizzeria. Danach richtete er sich im Schlafzimmer ein, um ein Baseball-Spiel anzuschauen, und sie unterhielten sich kaum miteinander. Trotz ihrer Schwierigkeiten behauptete die Patientin, sie liebe ihren Mann und brauche ihn sehr. → sekundärer Krankheitsgewinn, da Frau durch Krankheit den Launen des Mannes entgeht → Konfliktvermeidung → Konversionsstörung: Verschiebung des Ehekonflikts auf die somatische Ebene Querschnittstudien (nur Korrelationen, keine Kausalitäten!) Experimente: Tierexperimente (Problem der Generalisierbarkeit & Ethik), Analogiestudien (Problem , on Analogie gut genug ist) „natürliche Experimente“ Längsschnittstudien (Problem: Kohorteneffekt) Sequenzmodelle = Zeitwandelmodelle (Schaie, Baltes) → Mischform aus Quer- & Längsschnittstudien • • • gelb: Querschnittstudie (contra: Konfundierung mit Zeitpunkt → liegt Effekt am Alter oder an der Kohorte?) lila: Längsschnittstudie (contra: durch die Beobachtung einer Kohorte über einen längeren Zeitraum variiert das Alter) pink: Sequenzmodell (aus verschiedenen Kohorten immer Probanden im Alter von 80 J.) Risikofaktor oder Folge?: Beispiele • Schizophrenie: Soziale Drift vs. soziale Schicht (soziogene Therorie) • Soziale Unterstützung und psychische Erkrankungen (war die fehlende soz. Unterstützung zuerst da und kam dann die psych. Störung oder andersherum?) • Körperliche Misshandlung und psychische Erkrankung/Behinderung bei Kindern „Optimale“ Ätiologieforschung • Ätiologische Hypothesen sollten immer durch Ergebnisse abgesichert werden, die mit verschiedenen Methoden gewonnen wurden. • dabei sollte zielgerichtet vorgegangen werden: Die allgemeine Bedeutung einer ätiologischen Hypothese lässt sich z.B. durch Querschnittuntersuchungen klären, die in ihnen implizierte Verursachungsrichtung durch Tier- oder Analogieexperimente, ihre externe Validität v.a. durch Einzelfallstudien, "natürliche Experimente" oder Längsschnittstudien. Ursachen für psychische Störungen • Notwendige Ursache: • X ist eine Bedingung, die für das Auftreten der Störung Y unbedingt vorliegen muss (traumatische Erfahrung – PTBS) • Hinreichende Ursache: • Bedingung X garantiert das Auftreten der Störung Y, allerdings ist X keine notwendige Ursache (Verlust von Verstärkern – Depression) • Beitragende Ursache: • Bedingung X erhöht die Auftretenswahrscheinlichkeit für eine Störung Y (die häufigste Ursache hinsichtlich psychischer Störungen) Diathese – Stress – Modelle • Diathese und Stress als 2 Faktoren für psychiatrische Störungen Diathese = Vulnerabilität • Genetische Disposition • Pränatale, perinatale und postnatale Erfahrungen • Frühkindliche Bindung • Geschlecht • soziale Schicht • Negative Kindheitserfahrungen (Missbrauch) • … Stress • Mikrostressoren/ „Daily Hassles“ • Makrostressoren/ Kritische Lebensereignisse • Traumatischer Stress Stress = Überforderung Diathese-Stress-Modelle • Interaktionsmodell für den Zusammenhang zwischen Diathese und Stress • gleicher Ausgangspunkt für alle • additives Modell für den Zusammenhang zwischen Diathese und Stress • verschiedene Ausgangspunkte (Frauen oberer, Männer unterer Graph) • • Zusammenwirken mehrerer Ursachenfaktoren ist meist weder Summation noch Interaktion Ursachenfaktoren und Störung beeinflussen sich gegenseitig (sog. Transaktion) Transaktion: Beispiel • Ein junger Mann mag aufgrund geringer Lernerfahrungen nur über ein beschränktes Repertoire an Verhaltensweisen verfügen, um Kontakte zu gleichaltrigen Frauen aufzunehmen. Diese geringe soziale Kompetenz führt dazu, dass er entsprechende Kontaktsituationen zu meiden beginnt. Dadurch verlernt er auch noch die wenigen Verhaltensfertigkeiten, die zu diesem Zeitpunkt noch vorhanden sind. Schließlich fühlt er sich zu einer Kontaktaufnahme völlig außerstande, »weil er überhaupt nicht weiß, wie er es anfangen könnte«. Beispiel für ein Modell mit 3 Ursachenfaktoren • Die disponierenden Bedingungen bestehen darin, dass die Aufmerksamkeit der Familie schon lange vor dem Auftreten der Störung auf die Themen »Essen« und »Ess-Störungen« ausgerichtet ist. Das kann etwa dadurch geschehen, dass die Eltern selbst unter Essstörungen gelitten haben, frühe organische Erkrankungen des Kindes die Aufmerksamkeit auf Ess- und Verdauungsbeschwerden lenkten und familiäre Theorien von Askese, Leiblichkeit und Genießen dominiert haben. Auslösende Bedingungen sind Belastungen »in der Pubertät, die durch die notwendige Neuorganisation des Körper- und Selbstbildes, die Übernahme neuer sozialer und familiärer Rollen, die schrittweise Ablösung von der Familie usw. ausgelöst werden«. Als aufrechterhaltende Bedingungen schließlich kommen eine Reihe von Faktoren in Betracht: Von der Familie wird versucht, durch abwechselnde Zuwendung, Härte, Bestrafung und Nichtbeachtung eine Veränderung zu erzwingen, Strategien, die als intermittierende Verstärkung des Problemverhaltens zu interpretieren sind. Zudem führt das Erleben, den eigenen Hunger zu überwinden, zu einem erhöhten Selbstwertgefühl, das auch zur Entwicklung einer neuen stabilen Rolle in der Familie beiträgt. Begleitet wird dieser Prozess durch eine physiologische Habituation an den anorektischen Zustand. (Zit. n. Bastine, 1984) Risiko und Resilienz Resilienz (= Wiederstandsfähigkeit) 1. die positive, gesunde Entwicklung trotz hohem Risikostatus, beispielsweise bei chronischer Armut, elterlicher Psychopathologie etc. 2. die beständige Kompetenz unter extremen Stressbedingungen, wie elterlicher Trennung und Scheidung oder Wiederheirat eines Elternteils (sog. kritische Lebensereignisse); 3. die positive bzw. schnelle Erholung von traumatischen Erlebnissen wie Gewalterfahrungen, Naturkatastrophen oder Kriegs- und Terrorerlebnissen • ist nicht angeboren, sondern „erlernbar“ • Keine „Alles-oder-Nichts-Fähigkeit“, sondern Resilienz variiert mit der Zeit bzw. mit bestimmten Lebensumständen • Wurzeln für Resilienz liegen einerseits in der Person, andererseits in der Lebensumwelt Kauai Kohortenstudie (Emmy Werner und Ruth Smith) • • • • gewisser Prozentsatz ist resilient im Erwachsenenalter noch mehr resilient als im Jugendalter Viele der „High Risk“ Jugendlichen sind im Erwachsenenalter unauffällig → es muss sich keine psychische Störung entwickeln Veranlagung / Genetik Evidenz für genetische Zusammenhänge • Familiäre Häufung • Konkordanzraten in Abhängigkeit des Verwandtschaftsgrades • Konkordanzraten von Zwillingen: Vergleich MZ/DZ • Adoptionsstudien Beispiel Schizophrenie Vulnerabilitätsfaktor Umwelt Pränatale und perinatale Umwelterfahrungen • Substanzkonsum in der Schwangerschaft • Stress in der Schwangerschaft • Infektionen in der Schwangerschaft • Geburtskomplikationen Gehirnentwicklung und Alkohol (inkl. andere Drogen) • Pränatale Wirkung von Alkohol und anderen Drogen: • Speziell in der frühen Schwangerschaft kommt es zu einer Veränderung der Kortexentwicklung, u.A. eine reduzierte Ausbildung von Neuronen • Veränderungen in der Art und Weise wie chemische Messenger zum Einsatz kommen • Folgen für das Kind: • Schwierigkeiten bei der Aufmerksamkeit • Schwierigkeiten mit dem Gedächtnis • Problemlösefähigkeiten eingeschränkt • Abstraktes Denken eingeschränkt • Starke Schädigung: Fetale Alkoholspektrum-Störungen (FASD) z.B. FAS, ARND: Minderwuchs, körperliche Missbildungen, Schädigungen des zentralen Nervensystems, Verhaltensstörungen, intellektuelle Beeinträchtigungen Effekte von mütterlichem traumatischen Stress auf den Fötus während der Schwangerschaft (9/11) • Befunde aus der Literatur: • Niedrigere Cortisollevel bei PTBS • Niedrigerer Cortisolspiegel bei Kindern von Holocaustüberlebenden • >> Ist Letzteres ein Beweis, dass Vulnerabilität transgenerational „weitergegeben wird“? • Yehuda et al., 2005: • • • Kinder waren generell kleiner (egal ob Mutter PTBS hatte) Niedrigere Cortisollevel bei Müttern mit PTBS und ihren 1-jährigen Babies nach 9/11 im Vergleich zu Müttern, die keine PTBS entwickelten und deren 1-jährigen Babies Niedrigere Cortisollevel waren am stärksten bei Babies deren Mütter PTBS hatten und die zu 9/11 im 3. Trimester waren Postnatale Umwelterfahrungen • Scheidung • Konflikte der Eltern • Trennung von einem Elternteil • Psychopathologie der Eltern • Ab der Vorschule: maladaptive Beziehungen zu Gleichaltrigen (Peers) Erziehungsstil • • autoritativ = optimaler Erziehungsstil: hohe Wärme und hohe Kontrolle laissez-faire: hohe Wärme, wenig Kontrolle Bedeutung mütterlicher Kontrolle (Thirlwall, Behav Res Therapy, 2010) • Experiment mit 4-5 jährigen Kindern und ihren Müttern • Experimentelle Modifizierung der mütterlichen Interaktion während der Vorbereitung auf eine kurze Rede a) Kontrollierendes Verhalten (häufige Angebote v. Hilfe und Anleitung, schreiben auf dem Papier des Kindes, nah beim Kind sitzen, „überinvolviert“ usw.) b) Autonomie-unterstützend (auf Fragen des Kindes warten, sich im Stuhl zurücklehnen, das Kind unterstützen, es selbst zu probieren usw.) • Kinder mir geringer trait-Angst sind weniger anfällig für die Manipulation Exkurs: Mediatoren und Moderatoren • zwei Variablen A und B sind Risikofaktoren für ein späteres Ereignis X • Dominanz: Frage, wie man mit A und B die Wahrscheinlichkeit für X am besten vorhersagen kann; kodominant = Wahrscheinlichkeit für X lässt sich am besten unter Berücksichtigung von A und B vorhersagen • Mediatorvariable: - A geht B voraus - A hat Effekt auf B - A und B sind kodominant • z.B. Temperament, Erziehungsstil und Angst als Variablen Adverse Childhood Experiences (ACE) [Vincent J. Felitti, Robert F. Anda] • Kollaboration zwischen Klinik „Kaiser Permanente“, San Diego & Centers for Disease Control and Prevention (CDC) • Untersuchung von mehr als 17.000 Teilnehmern in den Jahren 1995 – 1997 • Retrospektive Erfassung von ACE • Umfassende Daten hinsichtlich somatischer Gesundheit • Prospektive Erhebung läuft derzeit weiter Logik der ACE-Studie Häufigkeit der “Adverse Childhood Experiences” • je mehr ACE, desto stärker die Psychopathologie (robuster Effekt, linearer Zusammenhang) Häufigkeit multipler ACEs (Prozentzahlen) Aversive Kindheitserfahrungen & Depression • • Verglichen mit einer Person ohne ein einziges ACE ist eine Person mit einem Score von 4 oder höher • … mit doppelter Wahrscheinlichkeit Raucher • … hat mit 12fach höherer Wahrscheinlichkeit einen Suizidversuch hinter sich • … ist mit 7fach höherer Wahrscheinlichkeit alkoholabhängig • … hat mit 10fach höherer Wahrscheinlichkeit Drogen injiziert Zusätzlich deutliche Folgen für die körperliche Gesundheit kardio-vaskuläre Erkrankungen, Krebs, AIDS und andere sexuell übertragbare Krankheiten, ungewollte Schwangerschaften … Stress und psychische Gesundheit • Idealfall: repräsentative prospektive Studie • Andere Möglichkeiten: • Studien in „High Risk“ Populationen • Retrospektive Befragung von Psychisch Kranken • Einzelfälle … Dosis-Effekt bei Posttraumatischer Belastungsstörung • PTBS Prävalenz bei Kindern je nach Anzahl erlebter aversiver Ereignistypen (Tsunami, Krieg, Familiäre Gewalt) • Eine Regressionsanalyse zeigte, dass alle 3 Typen (fam. Gewalt, Tsunami-Schwere und Kriegserlebnisse ) signifikante Prädiktoren für die PTBS waren. Lineare Regression • Modell zur Vorhersage einer linearen abhängigen Variable Y durch eine unabhängige Variable X. (z.B. X= soziale Unterstützung, Y = Depressionsschwere) • Regressionsgerade mit Steigung b unfd additiver Konstante a (Wert, an dem die Regressionslinie die y-Achse schneidet) • b = mittlere Veränderungsrate der Y-Werte pro Zunahme einer Einheit von X-Werten Kumulativer Stress bei Kindern im Krieg • Risiko-Gradienten für tamilische Kinder, die Opfer des Kriegs und des Tsunamis wurden • “Positive Adaptation” gruppiert nach: a) Anzahl verlorener Familienmitglieder b) Anzahl aversiver Erfahrungen (Krieg und Gewalt in der Familie) c) Schwere der Tsunami-Exposition • Linerare Beziehung zwischen Risiko und Adaptation für alle 3 Stressoren! Risiko- und Resilienzfaktoren bei ehemaligen Kindersoldaten Maße zum Vergleich des Risikos: Relatives Risiko • Bsp. „Risiko für Männer vs. Frauen, eine Depression zu entwickeln“ • RR = Relatives Risiko (p) = Quotient aus dem aus dem Risiko der Frauen und dem Risiko der Männer • • RR liegt zwischen 0 und + unendlich RR = 2: Frauen haben ein doppelt so hohes Risiko wie Männer Maße zum Vergleich des Risikos: Odds Ratio • Odds = Quotient p/(1-p) aus dem Risiko, z.B. für eine Angststörung und der Gegenwahrscheinlichkeit dafür; liegt zwischen null und unendlich Beträgt das Risiko ca. null, so stimmt das Odds ungefähr mit dem Risiko überein, liegt das Risiko aber nahe eins, nimmt das Odds sehr große Werte an • Odds Ratio = Quotient aus dem Odds in zwei Gruppen (Männer vs. Frauen) - liegt auch zwischen 0 und unendlich - OR = 1, wenn Risiko bei Frauen und Männern gleich groß Zusammenwirken von Genetik und Umwelt Gen-Umwelt-Interaktion/Zusammenspiel • MAO-A Genotyp + Misshandlung " antisoziales Verhalten • 5HTT Transporter Gen + Misshandlung " Depression • α (2B)-adrenoceptor + Trauma " Intrusive Erinnerungen • ... Serotonin Transporter Gen: Polymorphismus Gen x Umwelt Zusammenspiel (SLC6A4) • • SLC6A4: promoter polymorphism serotonin transporter gene Risiko Störungen (hier: PTSD) zu entwickeln hängt nicht nur von der Dosis aversiver Erfahrungen, sondern auch von genetischen Faktoren ab. Stress/ Genetik Interaktion Gen-Umwelt-Interaktion bei Missbrauch und antisozialem Verhalten • Gen: Polymorphismus des MAO-A Gens (kodiert das MAOA Enzym, welches Neurotransmitter, z.B. Noradrenalin und Dopamin metabolisiert) • Umwelt: Misshandlungserfahrungen zwischen dem 3. und 11. Lebensjahr Gen x Umwelt (α2b-adrenergic receptor) Zusammenfassung • Stress erhöht Wahrscheinlichkeit, an psychischer Erkrankung zu leiden • additives Modell: grundsätzlich höheres Stressniveau bei Frauen als bei Männern • Interaktionsmodell: Stress wirkt sich erst aus, wenn er höher wird • Transaktion: Störung wirkt zurück auf Diathese / Stress → bidirektionale Verbindung • Resilienz = psychische Widerstandsfähigkeit • wenn Trauma erfolgt, kommt es zu einer schnellen Erholung • trotz ungünstigen Bedingungen kommt es zu einer gesunden Entwicklung • beständig gesund bleiben, auch wenn Stress hoch ist • verschiedene Risikofaktoren pränatal, postnatal Diagnostik und Einführung Psychotherapie: Klinische Diagnostik Diagnostik - Kritikpunkte • Eigenschaftstheoretische Grundlagen der herkömmlichen Diagnostik (Konsistenz von Verhalten, Problematik des Eigenschaftsbegriffs (Trait vs. Situation)) • Mangelnder Nutzen der Diagnostik für die anstehenden Entscheidungen (Diagnostik hatte in der Vergangenheit oft wenig damit zu tun, was mit den PatientInnen tatsächlich geschah) • Vorbehalte: • Beurteilung • Verantwortung • Helfen vs. Beurteilen/ Entscheiden • Vorbehalte gegen einzelne diagnostische Methoden Diagnostik – Warum? • Kein Anspruch mehr endgültige Aussagen über Menschen zu treffen und darüber „wie sie wirklich sind“ • Ziel: praktische Entscheidungen vorbereiten und verbessern, die im Zusammenhang mit dem Auftreten psychischer Störungen getroffen werden müssen • von der betreffenden Person selbst • vom klinischen Psychologen gemeinsam mit der Person • vom klinischen Psychologen über die Person hinweg (z.B. Zwangseinweisung) Diagnostik – schematischer Ablauf Diagnostik - Schwierigkeit • Keine unmittelbare Messung relevanter Merkmale möglich (z.B. ≠ Größe, Gewicht, etc.) • Sammeln von Informationen anhand derer auf innere Vorgänge geschlossen werden kann • --> Entwicklung besonderer diagnostischer Methoden Diagnostik - Gütekriterien • In Untersuchungen von Cooper et al. (1972) und Cranach & Strauss (1978) verglich man die Diagnosen von Klinikpatienten in New York, London und München • In New York waren fast doppelt so viele Patienten »schizophren« wie in London oder München (nämlich über 60%) • In London dagegen wurde die Diagnose "Depressive Psychose« mehr als viermal so häufig wie in New York und fast zehnmal so häufig wie in München gestellt • Vergleiche mit den Diagnosen eines besonders geschulten Forscherteams ergaben, dass diese Differenzen nur zu einem geringen Teil durch wirkliche Unterschiede zwischen den Patientenstichproben zu erklären waren • Hauptgütekriterien: Objektivität, Reliabilität, Validität • Nebengütekriterien: Utilität, Testfairness, Testökonomie, Transparenz, Unverfälschbarkeit, Zumutbarkeit, Normierung Gütekriterien • Objektivität: Unabhängigkeit von Einflüssen der Untersucher und/ oder der Untersuchungssituation bei Durchführung, Auswertung und Interpretation • Reliabilität (Konsistenz): Zuverlässigkeit der Messung des Merkmals • Inter-Rater Reliabilität • Test-Retest-Reliabilität • Parallel-Form-Reliabilität • Interne Konsistenz - Durchschnittl. Inter-Item Korrelation - Durchschnittl. Item-Total Korrelation - Split-Half Reliabilität - Cronbach‘s alpha • Validität: Misst das Verfahren tatsächlich das gewünschte Merkmal? Ist das Verfahren tauglich zur Messung des Merkmals? • Konstruktvalidität • Inhaltsvalidität - Augenscheinvalidität (triviale Validität) - logische Validität • Kriteriumsvalidität - innere (Kriteriums)Validität - äußere (Kriteriums)Validität - konkurrent (übereinstimmend) - prädiktiv (prognostisch, vorhersagend) > konvergent (es soll hoch korrelieren mit einem Instrument, das dasselbe misst) - diskriminant (divergent; ich vergleiche das eine Instrument mit einem Konstukt mit einem Instrument, das etwas anderes misst) • Intern (wenn ich genau weiß, dass Manipulation eienr bestimmten Variable zum Ergebnis führt) – extern (hoch, dann Allgemeingültigkeit) Diagnostik – spezielle Aufgaben • Beispiel zu gegenwartsbezogene Differentialdiagnose: • • • • vergangenheitsbezogenen • Klärung des Verlaufs: z.B. erstmaliges Auftreten oder wiederkehrend • Ätiologie: z.B: ähnliche Erkrankungen in der Familie • Klärung vergangener (psychischer) Vorgänge: prägende Erlebnisse gegenwartsbezogen • diagnostische Beschreibung: „was hat Sie zu mir geführt?“ → rein deskriptiv sammeln, unter was der Patient leidet • Differentialdiagnose: auf eine gezielte Störung hinarbeiten und andere Störungen ausschließen • Klassifikation: Diagnose nach ICD 10 oder DSM-IV zukunftsbezogenen • Prognose: z.B: wenn Psychotherapie bisher nicht wirksam, andere Behandlungsmethode wählen • Indikation: habe ich ein passendes Behandlungsmanual? • Evaluation: (nach Behandlung) war Therapie hilfreich? Ist Störung noch vorhanden? Abfolge meist: gegenwärtige und vergangenheitsbezogene Informationen → zukunftsbezogene Entscheidung Methoden der Klinischen Diagnostik • Klinische Fragebögen • Neuropsychologische Tests • Klinische Interviews • Verhaltensbeobachtung • Apparative Untersuchungen • Erfassung der biographischen & Krankheitsanamnese • funktionale Verhaltensanalyse Diagnostik und Einführung Psychotherapie: Ablauf Diagnostik Ablauf Diagnostik (Hautzinger, 1994) • (z.B. zur Abklärung der Indikation einer ambulanten Psychotherapie) Erfassung der Lebens- und Krankheitsgeschichte Somatische/ Neurologische Abklärung • Bildgebende Verfahren: • strukturell: Computertomographie (CT --> Knochen und Blut werden hier hell dargestellt), Magnetresonanztomographie/Kernspintomographie (MRT) • funktionell: fMRT (rot = mehr Aktivität im Vgl. Zu Kontrollbedingung, blau = weniger Aktivität), Positron-Emissions-Tomographie (PET) • Psychophysiologische Verfahren: • Elektroenzephalogramm (EEG) • Peripher-Physiologische Verfahren, Messung von Herzrate und Hautleitfähigkeit (eher zu Forschungszwecken) Kernspintomographie/ Magnetresonanztomographie • seit Beginn der 80er Jahre wird es als diagnostisches Verfahren in der Medizin verwendet • basiert darauf, dass sich Wasserstoffatome in einem Magnetfeld wie kleine rotierende Stabmagnete verhalten, die sich normalerweise zufällig und in unterschiedlichen Richtungen orientieren • In der MRT werden die "magnetischen" Drehachsen der Wasserstoffkerne des Körpers (H+) durch ein sehr starkes Magnetfeld ausgerichtet. • Mit Hilfe von Radiowellen (mit einer genau definierten Frequenz = Resonanzfrequenz) lassen sich die ausgerichteten Wasserstoffkerne selektiv beeinflussen. • Bei Abschaltung der "störenden" Radiowellen richten sich die Drehachsen wieder entlang des Magnetfeldes aus, wobei die "zurückkehrenden" Wasserstoffkerne ihrerseits schwache Radiowellen aussenden, die mit empfindlichen Antennen registriert werden. • Das Signal eines bestimmten Gewebes wird hauptsächlich durch den Gehalt an Wasserstoffkernen sowie den speziellen chemischen und physikalischen Eigenschaften des Gewebes geprägt Funktionelle Kernspintomographie (fMRT) • Blood Oxygen Level Dependency (BOLD) = bildgebendes Verfahren der funktionellen Magnetresonanztomografie (fMRT), mittels dessen sich lokale Änderungen der Gehirnaktivität bestimmen lassen. • Logik: • Verteilung von Atomen wie bspw. Sauerstoff variiert mit der Aktivität der Hirnregionen • Der von Hämoglobin transportierte Sauerstoff verändert die magnetischen Eigenschaften des Blutes. • Mittels fMRT lassen sich die funktionell induzierten Veränderungen der Sauerstoffsättigung des Blutes aufspüren • Vorteil: • keine Notwendigkeit der Injektion von Kontrastmitteln • hohe räumliche Auflösung (1-2 mm), sogar höher als bei PET • Nachteil: • Geringe zeitl. Auflösung, d.h. neuronale Aktivität von wenigen ms kann nicht erfasst werden Klinische Interviews • Unstrukturiert vs. strukturiert (vorgefertigte Fragen, festgelegte Vorgehensweise, erleichterte Einordnung der Antworten, dauern typischerweise länger) • Erhöhung der Reliabilität durch „Rating-Skalen“, die die erfassten Daten quantifizieren • Oft „screening“ am Anfang zur Bestimmung relevanter Problembereiche Klinische Fragebögen • störungsspezifisch oder bereichsspezifisch (kognitive Ebene, z.B. „Agoraphobic Cognition Questionnaire“ oder interaktionale Ebene „Social Interaction Anxiety Scale“, SIAS) • Selbst- oder Fremdbeurteilung möglich --> wenig Verzerrungen • Gütekriterien! • Pro: schnelle Auswertung durch Schablone Andere psychodiagnostische Tests • Projektive Persönlichkeitstests: → Annahme, dass bei der Interpretation mehrdeutiger Stimuli eigene Probleme, Motive und Wünsche „hineinprojiziert“ werden Psychometrische Persönlichkeitstests • Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2 in dt. Version im Jahr 2000) zur Persönlichkeitsbeurteilung auf versch. Skalen (Hypochondrie, Depression, Hysterie, Psychopathie, (maskuline-feminine) Interessenskala, Paranoia, Psychasthenie, Schizoidie, Hypomanie, Soziale Introversion) mit insgesamt 567 Items • • Klinische Verhaltensbeobachtung • Beobachtung des Verhaltens in einer natürlichen Sit. (Bsp. Mutter-Kind-Interaktion zu Hause) oder in einer analogen (im Labor nachgestellten) Situation (besser kontrolliert) • Self-Monitoring: Pat. beobachtete sich selbst und führt Protokoll (Gedankentagebuch, Aktivitätenprotokoll etc.) • Rating-Skalen für den Kliniker, z.B. die BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale), die im Anschluss an ein Interview mit einem Pat. ausgefüllt werden kann Einführung Psychotherapie Was ist Psychotherapie? • „Psychotherapie ist ein bewusster und geplanter interaktioneller Prozess zur Beeinflussung von Verhaltensstörungen und Leidenszuständen, die in einem Konsens (möglichst zwischen Patient, Therapeut und Bezugsgruppe) für behandlungsbedürftig gehalten werden, mit psychologischen Mitteln (durch Kommunikation) meist verbal aber auch nonverbal, in Richtung auf ein definiertes, nach Möglichkeit gemeinsam erarbeitetes Ziel (Symptomminimalisierung und/ oder Strukturänderung der Persönlichkeit) mittels lehrbarer Techniken auf der Basis einer Theorie des normalen und pathologischen Verhaltens.“ (Hans Strotzka, Wien 1978) Die therapeutische Allianz • Gute therapeutische Beziehung, effektive „Allianz“ zwischen Klient und Therapeut als entscheidende Voraussetzung für den Behandlungserfolg • Wichtige Faktoren: Erfahrung, Kompetenz des Therapeuten, Motivation beim Klienten • Elemente einer guten therapeutischen Allianz • Streben nach Zusammenarbeit mit dem Patienten bei der Lösung eines Problems • Einvernehmen zwischen Patient und Therapeut hinsichtlich der Therapieziele • Emotionale Bindung zwischen Patient und Therapeut • Klare Kommunikation Wer bietet Psychotherapie an? • Niedergelassene Psychologische Psychotherapeuten • Niedergelassene Ärztliche Psychotherapeuten • Psychiater • Psychiatrische Kliniken • Psychosomatische Kliniken • Tageskliniken • Reha-Einrichtungen (z.B. Sucht) (stationär viele Gruppenangebote und pharmakologische Therapie) Psychotherapie in Deutschland • An der vertragsärztlichen Versorgung (Kassenzulassung) teilnehmende Psychologische und ärztliche Psychotherapeuten pro Bundesland bezogen auf 100.000 Einwohner ab 18 J. Psychotherapeutische Ansätze und Bezeichnungen: Beispiele • Musiktherapie, Tanztherapie, Kunsttherapie • Psychoanalyse • Selbstsicherheitstraining • Stressmanagement, Autogenes Training • strukturierte Lerntherapie • Verhaltenstherapie Warum Therapieforschung? • Qualitätssicherung • Strukturqualität (Qualität der Ausbildung) • Prozessqualität (kunstgerechte Therapiedurchführung) • Ergebnisqualität (Behandlungsziele/ -ergebnisse) • Empirische Wirksamkeitsnachweise • Maßnahme zur Verbesserung der Therapie und Indikation Evidenzbasierte Psychotherapie 3 Gebiete der Therapieforschung: • Erfolgsforschung Wie erfolgreich ist Psychotherapie insgesamt? Wie erfolgreich ist ein bestimmtes Therapieverfahren? • Prozessforschung Welche Prozesse laufen in Therapien ab? Welche Prozesse sind für den Therapieerfolg förderlich/ hinderlich? • Indikationsforschung Bei welchen Störungen und welchen KlientInnen mit welchen Startvoraussetzungen führt welche therapeut. Intervention zu welchen Veränderungen? Grundregeln zur wiss. Evaluierung von Therapien GUT KONTROLLIERTE THERAPIESTUDIE • Klar definierte Zielsymptomatik • Reliable und valide Instrumente (Prä & Post-Therapie) • Blinde & ausgebildete Interviewer • Manualisierte, spezifische und replizierbare Therapieprogramme • Randomisierte Zuordnung zu Behandlungsprotokollen • Einhaltung des Behandlungsprotokolls (‚adherence‘) Kodierungssystem für die Stärke der Evidenz von Behandlungsansätzen (Agency of Health Care Policy and Research Classification) • Level A: Randomisierte, gut kontrollierte klinische Studien • Level B: Gut kontrollierte klinische Studien ohne Randomisierung/ Plazebo-Gruppen • Level C: Klinische Studien aus einem natürlichem Setting heraus kombiniert mit klinischen Beobachtungen • Level D: Langjährige und weit verbreitete klinische Praxis • Level E: Langjährige Praxis einer begrenzten Gruppe von Klinikern; keine empirische Testung • Level F: Kürzlich entworfenes Behandlungsprotokoll, welches weder klinisch noch wissenschaftlich getestet wurde Design einer Randomisiert-Kontrollierten Therapiestudie (RCT) • Consort E-Flowchart muss immer mit angegeben werden: • Beispiel: Studie zu PTBS: Beurteilung eines RCT • Wie wurde randomisiert? • Gab es schon vor der Therapie signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen? • Wie hoch ist die Dropout-Rate? • Wer hat die Nachuntersuchungen durchgeführt – blinde Rater? • Wie wurde die „treament adherence“ sicher gestellt? • Wie wurde bei der Analyse mit fehlenden Daten umgegangen, intentto-treat Analyse vs. treatmentcompleter Analyse? • Werden Verschlechterungen berichtet? • Welche „outcomes“ werden berichtet? • Wurden langfristige Therapieeffekte gemessen? Ergebnisdarstellung (Gruppenmittel) • bei Graphen sieht man sofort, dass alle ähnlichen Verlauf haben EFFEKTSTÄRKE als Maß für die Effektivität einer Behandlung • = statistisches Maß zur Bestimmung der standardisierten Differenz zwischen zwei Mittelwerten a) prä-post Therapie-Vergleich b) Vergleich zwischen 2 Gruppen (bspw. treatment vs. placebo) • Effektstärke ist unabhängig von der Stichprobengröße --> ideale Verwendung in Metaanalysen Die Bedeutung von Cohens d • • • Interpretiert als der durchschnittliche Perzentilbereich der behandelten Gruppe relativ zur unbehandelten Gruppe • Bsp.: ES 0.0 sagt aus, dass sich das Mittel der behandelten Gruppe im Bereich des 50 Perzentils der behandelten Gruppe befindet. Interpretiert als Prozent der Nichtüberlappung des scores der behandelten Gruppe und der unbehandelten • Bsp.: ES 0.8 entspricht einem ‚nonoverlap‘ von 47.7 % in den beiden Verteilungen. Ergebnisdarstellung • • • • wenn Person auf der Geraden liegt, entspricht der post-Wert dem prä-Wert d.h. es ist keine Veränderung eingetreten (Therapie war nicht effektiv) über Geraden: tendenzielle Verschlechterung unter Geraden: tendenzielle Verbesserung → Wunschziel um Gerade liegt „Unsicherheitsbereich“ (Konfidenzintervall) Psychotherapie Reizkonfrontation • auch Expositionstherapie oder Konfrontationstherapie • Verfahren: Konfrontation mit den aversiven Stimuli sowie Verhinderung der Flucht (v.a. bei Ängsten und Zwängen) • angenommene Wirkmechanismen: • Löschung (im Sinne des klassischen Konditionierens):Durch die Verhinderung von Fluchtund Vermeidungsverhalten werden die konditionierten Reaktionen (z.B. Ängste) gelöscht. • Neurophysiologische Erklärung: Durch die lang andauernde Konfrontation mit den angstauslösenden Reizen findet eine Habituation statt. • Kognitive Erklärung: Es kommt zu kognitiven Neubewertungen hinsichtlich der Bedrohlichkeit von Situationen, positive Erwartungen an die eigene Bewältigungskompetenz etc. werden aufgebaut, die zu einer Veränderung des kognitiven Schemas über die zuvor schwierigen Situationen beitragen. Systematische Desensibilisierung • beruht auf der Methode der Gegenkonditionierung (Joseph Wolpe, 1915-1998) • Erkenntnis, dass bestimmte Reaktionen mit Angst unvereinbar sind und dazu dienen können, Ängste zu unterdrücken, z.B. Essen oder körperliche Entspannung. • Schritte • 1. TherapeutIn und KlientIn stellen eine „Angsthierarchie“ der befürchteten Situationen auf. • 2. Der Klient erlernt eine Entspannungstechnik wie die Progressive Muskelentspannung nach Jakobson. • 3. Die Angsthierarchie wird mit dem Klienten Schritt für Schritt und in entspanntem Zustand durchgearbeitet. --> Vorgehen üblicherweise „in sensu“ Beispiel-Instruktion • "Gut. Gleich werde ich Sie bitten, sich eine Szene vorzustellen. Wenn Sie die Situationsbeschreibung gehört haben, stellen Sie sich die Szene bitte so lebendig wie möglich vor, so als sähen Sie sie mit eigenen Augen, als seien Sie wirklich dort. Versuchen Sie, sie sich in allen Einzelheiten auszumalen. Während Sie sich die Situation vorstellen, fühlen Sie sich vielleicht weiter so entspannt, wie Sie es jetzt sind. Wenn ja, dann ist es gut. Nach fünf, zehn oder 15 Sekunden werde ich Sie bitten, die Vorstellung der Szene zu unterbrechen und zu Ihrem schönen Bild, das Sie sich vorhin ausgesucht haben, zurückzukehren und nur zu entspannen. Wenn Sie aber nur die geringste Steigerung der Angst oder Spannung spüren, dann geben Sie mir dies durch Heben Ihres linken Zeigefingers zu erkennen. Wenn Sie das tun, greife ich ein und bitte Sie, sich die Situation nicht mehr vorzustellen, und helfe Ihnen, sich noch einmal zu entspannen. Es ist wichtig, daß Sie mir Spannung auf diese Weise melden, weil wir Sie so viel wie möglich angstauslösenden Situationen aussetzen wollen, ohne daß Sie Angst bekommen..." (Goldfried und Davison, 1976, S. 124-125 zitiert aus: Comer (1995, 162)) Reizkonfrontation in vivo • 1) Diagnostische Phase • 2) Kognitive Vorbereitung • Individuelles Entstehungsmodell, Angsthierarchie, Identifikation von Vermeidungsstrategien, Gedankenexperiment • 3) Intensivphase der Reizkonfrontation a) Graduiertes Vorgehen b) Massiertes Vorgehen (flooding) • 4) Selbstkontrollphase Graduierte Reizkonfrontation in vivo • Übungsbeispiel Panik & Agoraphobie • Ziel: Herr S. sollte weitgehend angstfrei in einer vollbesetzten U-Bahn stehen können. • • • • • Die Situation »in einer vollbesetzten U-Bahn stehen«, ist in der Angsthierarchie (0–100) von Herrn S. mit 100 angegeben. Die Situation: »in einer vollbesetzten U-Bahn sitzen« mit 80, die Situation »in einer rege, aber nicht vollbesetzten U-Bahn stehen« mit 70. Die Situation »auf den U-Bahnsteig gehen« hatte für Herrn S. eine Angststärke von 20. Die Situation »in einer leeren U-Bahn stehen« löste eine Angst von der Stärke 50 aus. Vorgehen: Nach dem Erstellen der Angsthierarchie wird jede Situation in Sequenzen zerlegt. Die Situation »in einer leeren U-Bahn sitzen« wird zerlegt in die Sequenzen »einsteigen «, »sich orientieren«, »sich einen Platz suchen und hinsetzen«, »sitzen und fahren«. Zunächst wird nun mit Herrn S. geübt, eine Fahrkarte zu kaufen und auf den Ubahnsteig zu gehen. Nachdem er dies angstfrei kann, wird die Situation »in einer leeren Ubahn sitzen« geübt. Dazu wird eine Zeit am späten Vormittag an einer Endhaltstelle einer U-Bahn-Linie gewählt. Herr S. lernt nun zunächst in die U-Bahn einzusteigen, bis er dies weitgehend angstfrei beherrscht. Dann folgt die nächste Sequenz: »sich orientieren«. Die einzelnen Sequenzen werden so lange geübt, bis der Patient keine oder für ihn subjektiv erträgliche Angstsymptome berichtet und der Überzeugung ist, es nun zu schaffen. Dies wird für jede Situation so durchgeführt, bis Herr S. in der Lage ist, in einer vollbesetzten U-Bahn weitgehend angstfrei zu stehen (Zielverhalten). Wichtig bei der Durchführung der Übungen ist, dass der Patient keine von ihm ansonsten angewandten Vermeidungsstrategien (Baldrian nehmen, sich ablenken etc.) einsetzen kann. Dies ist die vorrangige Aufgabe des Therapeuten in einer Konfrontationsübung. Massierte Reizkonfrontation in vivo • Unterschied zum graduierten Vorgehen: Es gibt keine mehrstufigen Sequenzen einer Situation, sondern der Patient verspürt gleich das volle Ausmaß der Symptomatik, d. h. er wird sofort in eine sehr angstauslösende Reizsituation geführt. • Ziel: Herr S. soll in einem vollbesetzten Aufzug in einem Kaufhaus fahren sowie einkaufen und Schlange stehen • • Der Therapeut sucht gemeinsam mit Herrn S. zur Hauptgeschäftszeit ein Kaufhaus auf, in dem ein gläserner Aufzug über mehrere Stockwerke fährt. Sofort nach Eintreten in das Kaufhaus wird Herr S. vom Therapeuten in diesen Aufzug geführt und bleibt so lange in dieser Situation, bis die Angst auf ein für ihn erträgliches Maß gesunken ist. Die Angststärke ist zunächst 100, Herr S. verspürt alle, sonst von ihm vermiedenen unangenehmen körperlichen Symptome und versucht zu fliehen, woran er aber vom Therapeuten – der sich vorher schriftlich die Erlaubnis dazu hatte geben lassen – gehindert wird. Nach ungefähr 30 Minuten beginnen die körperlichen Angstsymptome erheblich nachzulassen, was von Herrn S. erleichtert bemerkt wird. Die Angstkurve fällt ab bis auf einen Wert von 20 und Herr S. verlässt gemeinsam mit dem Therapeuten den Aufzug um ein Produkt zu kaufen und sich in eine Warteschlange vor eine Kasse zu stellen. Auch hier geht die Angst zunächst wieder bis auf 100 hoch, nimmt aber schon nach 15 Minuten erheblich ab. Nach 25 Minuten – und immer wieder neuem Anstellen in der Warteschlange – ist die Angst bis auf 10 gesunken. Um den Effekt der Übungen zu überprüfen und zu stabilisieren, werden beide Übungen gleich anschließend wiederholt. Herr S. bemerkt zum einen, dass die Angst nicht mehr so stark war, wie beim ersten Mal, und dann auch schneller nachlässt. Operante Verfahren • beruhen auf den Prinzipien der operanten Konditionierung (Skinner); die Verwendung von Verstärkung spielt dabei eine entscheidende Rolle. • Instrumentelles Verhalten: Operantes oder auch instrumentelles Verhalten bezeichnet spontan gezeigtes Verhalten, dessen zukünftige Auftretenswahrscheinlichkeit durch seine unmittelbaren Konsequenzen bestimmt wird (operante Konditionierung). • Ein Verstärker wird definiert als jeder materielle Gegenstand, Konsumartikel, jede Aktivität, Person oder jedes soziale Ereignis, das die Stärke und Frequenz eines individuellen Verhaltens, zu dem es kontingent ist, verändert (Lecomte, Liberman & Wallace, 2000). • Diagnostische Phase: • Verhaltensanalyse, um zu klären, welche Umweltbedingungen für das Auftreten des problematischen Verhaltens verantwortlich sind, bzw. welche Bedingungen das Auftreten erwünschter Verhaltensweisen verhindern. • Definition des Problemverhaltens und „Baseline-Erhebung“ • Therapeutische Phase: • Zieldefinition und Festlegung der Methoden • Die Verstärkungsbedingungen werden so umgestaltet, dass das problematische Verhalten gelöscht wird bzw. das erwünschte Verhalten wirksam verstärkt wird (differenzielle Verstärkung). Operante Verfahren - Techniken • verbale/ nonverbale Rückmeldung (positive Verstärkung) • Kontingenzmanagement (Token Economy, Time out, Kontingenzverträge) • Stimuluskontrolltechniken (Stimulusbedingungen, unter denen ein bestimmtes problemat. Verhalten auftritt werden eingeschränkt, Bedingungen unter denen das erwünschte Verhalten auftritt werden konkretisiert und verstärkt) • Diskriminationslernen • etc. • --> je sicherer man in seinem Zielverhalten wird, esto mehr soll intermittierend verstärkt werden kognitive Methoden: Grundgedanke kognitiver Theorien • Bedeutung von Kognitionen: Gedankliche Prozesse als entscheidende Determinanten menschlichen Handelns • Kognitionen als mit entscheidende Determinanten von Emotionen, und damit von emotionalen Störungen. • Emotionen, Verhalten und physiologische Prozesse werden in großem Maße durch kognitive Prozesse beeinflusst • Irrationale oder dysfunktionale Gedanken oder Überzeugungen führen zu emotionalen Störungen und halten sie aufrecht • In Bezug auf das therapeutische Vorgehen: Die Veränderung dieser Gedanken und Annahmen führt zu psychischem Wohlbefinden. Kognitive Therapie Ellis‘ 4 Grundkategorien von irrationalen Überzeugungen • Absolute Forderungen: Wünsche werden zu absoluten Forderungen („Ich muss“, „Die anderen müssen“, „Die Welt muss“) • Globale negative Selbst- und Fremdbewertungen: statt einzelner Eigenschaften und Verhaltensweisen („ich bin wertlos/ein Versager“) • Katastrophisieren: unerwünschte Ereignisse werden extrem überbewertet („Es wäre absolut schrecklich, wenn“) • Niedrige Frustrationstoleranz: glaube, negative Ereignisse nicht aushalten zu können („Ich könnte es nicht ertragen, wenn“) Therapieziel des kognitiven Ansatzes: Patient soll befähigt werden… • Zusammenhänge zwischen Denken, Fühlen & Handeln zu erkennen • Das „Für und Wider“ des gestörten automatischen Denkens zu prüfen • Einseitige Kognitionen durch stärker an Realität orientiertes Verständnis zu ersetzen • Negative automatische Gedanken zu kontrollieren • Dysfunktionale Annahmen, die Erfahrungen verzerren, zu erkennen und zu ändern Kernkomponenten Kognitiver Therapie 1. Psychoedukative Komponente: Vermittlung der Grundidee des kognitiv-therapeutischen Ansatzes 2. Explorative Komponente: Herausarbeitung und Explikation bzw. Besusstmachung dysfunktionaler oder irrationaler Gedanken, Schemata, Interpretations- & Bewertungsmuster, Einstellungen & Glaubenssysteme 3. Interventionskomponente: Veränderung maladaptiver kognitiver Prozesse & Strukturen Exploration dysfunktionaler Gedanken ABC Analyse: Kognitive Umstrukturierung 1. Herausarbeiten/ Identifizierung dysfunktionaler Gedanken (zugrundeliegende Annahmen) 2. Disputation (bzw. Prüfung) dysfunktionaler Gedanken und Grundannahmen 3. Aufbau alternativer funktionaler Konzepte 4. Training neuer Konzepte Techniken der Disputation Sokratischer Dialog • Durch lenkende Fragen („geleitetes Entdecken“) soll der Pat. Zur kritischen Reflexion seiner Gedanken und Grundannahmen und zur Aufdeckung von Widersprüchen angeregt werden. • Haltung des Therapeuten: naiv-fragend, zugewandt akzeptierend, zieloffen; das Gespräch wird durch gezielte Fragen gelenkt, aber es werden keine Lösungsmöglichkeiten vorgegeben • Patient muss intellektuell in der Lage sein, dem Diskurs zu folgen • (s. Beispiel „Wie bestimmt man den Wert eines Menschen?“) Aufbau alternativer, funktionaler Konzepte • Formulierung alternativer Gedanken: rationaler Gedanke: Ergebnis a) Schieben Sie den rationalen Gedanken auf b) Schätzen Sie die Richtigkeit dieses Gedankens auf einer Skala von 1-100 ein a) Schätzen Sie nochmals die Richtigkeit dieses Gedankens auf einer Skala von 1-100 ein b) Spezifizieren Sie die daraus resultierenden Emotionen und geben Sie deren Stärke an (1100) Verhaltensexperimente • Bsp.: Befürchtung: „Wenn ich einen Fehler mache, verliere ich meinen Job.“ • Formales Hypothesentesten vs. Entdeckungsexperimente • Aktiv vs. Beobachtend • In der Sitzung vs. zwischen den Sitzungen • Rollenspiel vs. Real-Life Training sozialer Fertigkeiten: Assertiveness-Training-Programm (ATP, Ullrich & de Mynck) • Übungen zu 4 Bereichen sozialer Ängste • Kritik- und Fehlschlagangst (Kritik annehmen und äußern) • Kontaktangst (Kontakte herstellen und aufrechterhalten) • Ablehnungsangst beim Äußern eigener Bedürfnisse (berechtigte Forderungen stellen) • Ablehnungsangst bei der Abgrenzung gegenüber anderen (Nein sagen) Training sozialer Fertigkeiten: Gruppentraining sozialer Kompetenzen (GSK) (Rüdiger Hinsch & Ulrich Pfingsten) • Ziel: Vermittlung sozialer Kompetenzen, mit deren Hilfe eigene, positiv bewertete Ziele in verschiedenen Situationen adäquat verfolgt und erreicht werden können. • Trainiert werden eine Vielzahl von verschiedenen Fähigkeiten, die in unterschiedlichen sozialen Situationen benötigt werden: • 1) Recht durchsetzen: begründete Ansprüche und Forderungen durchsetzen, z. B. einen schadhaften Artikel im Geschäft reklamieren; • 2) Beziehungen gestalten: Aufnahme und Aufrechterhaltung persönlicher Beziehungen, z. B. ein Gespräch initiieren; • 3) Sympathie erwerben: nicht legitimierte Forderungen durchsetzen, z. B. in einer Warteschlange vorgelassen werden. Psychoanalyse: Aspekte der Psychoanalyse 1. Strukturelle Aspekte: Es - Ich – Über-Ich 2. Dynamische Aspekte: Trieblehre 3. Entwicklungstheoretische Aspekte: psychosexuelle Entwicklungsphasen 4. Therapeutische Aspekte: Heilmethode „Psychoanalyse“ Psychoanalyse: Psychodynamische Therapien • Psychoanalyse (klassische Therapie nach Freud) • Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie • Analytische Psychotherapie (Jung) • Individualpsychologie (Adler) • Psychodynamische Kurztherapie • Tranference Focused Psychotherapie • Psychodynamische Gruppentherapie Psychoanalyse: (klassische) Psychoanalyse • Setting: • 3-5 h/Woche, insgesamt 100 – 1000+ h über 2-3 Jahre • Liegend, fehlender Sichtkontakt • Keine Vorgabe von Themen ! Anleitung zur Freien Assoziation • Eigenschaften: • Stark regressionsfördernd • Förderung und Bearbeitung der Übertragungsneurose • Orientierung an infantilen Strukturen und Konflikten • Ziel: Umstrukturierung der Persönlichkeit Psychoanalyse: Analytische Psychotherapie • Setting: • 2-3 h/ Woche, insgesamt 200 – 300 h über 2-3 Jahre • Liegend, selten auch sitzend • Eigenschaften: • Regression teilweise begrenzt • Keine Förderung der Übertragungsneurose, statt dessen gegenwartsbezogenes Durcharbeiten der Übertragungen • Orientierung eher an aktuellen Strukturen und Konflikten • Ziel: Strukturelle Veränderungen Psychoanalyse: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie • Setting: • 1-2 h/ Woche, insgesamt 50-80 (100)h über 1-2 Jahre • Sitzend, „face-to-face“ • Eigenschaften: • Begrenzung der Regression • Begrenzung der Übertragung • Orientierung an aktuellen Konflikten und Symptomen; konsequentere Orientierung auf einen Behandlungsfokus • Ziel: Umschriebene Umstrukturierung der Persönlichkeit, Symptomminderung Psychoanalyse: Allgemeines Ziel • Psychische Störungen entstehen aus unbewältigten Konflikten der Kindheit • Diese Konflikte wurden in das Unbewusste verdrängt, aktuelle und kindliche Lebenssituation kann nicht voneinander unterschieden werden • Beeinträchtigung durch Versuche Kindheitskonflikte in alltäglichen (Erwachsenen)situationen zu lösen • Diese Versuche behindern die effektive Bewältigung der wirklich anstehenden Aufgaben (Beruf, Familie, etc.) • Bewusstmachen und Neubewältigung der pathogenen, unbewussten, unbewältigten Konflikte (aufdeckendes Verfahren) Psychoanalyse: Das Unbewusste • Der bewusste Teil des menschlichen Geistes nimmt nur einen sehr kleinen Teil ein (Eisbergspitze) • Im Unterbewussten liegen schmerzliche Erinnerungen, verbotenen Wünsche und andere, verdrängte Erfahrungen • --> Diese Erfahrungen verschaffen sich in Form von Träumen, Phantasien, Versprechern etc. Zugang zum Bewusstsein Psychoanalyse: Freie Assoziation • Die psychoanalytische Grundregel der freien Assoziation erfordert vom Patienten, dass dieser mit der größtmöglichen Offenheit alle Gedanken und Phantasien aussprechen soll, ohne Rücksicht auf Konventionen oder Einschränkungen zu nehmen. • Die freie Assoziation zielt auf die Rekonstruktion unbewusster Konflikte sowie auf die Erfassung der Abwehr Psychoanalyse: Grundlegend Aufgabe der/des TherapeutIn • Sie/er stellt auffällige Ereignisse in der Therapie zunächst als Tatsachen eindeutig fest, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Unter Umständen macht sie/er sie der/dem KlientIn durch weitere konfrontierende oder klärende Fragen besonders deutlich. Außerdem benutzt sie/er Interpretationen (Deutungen), um die unbewusste Bedeutung solcher Ereignisse klarzustellen • Annäherung an den unbewältigten frühkindlichen Konflikt (=Durcharbeiten des Konflikts) Psychoanalyse: Traumdeutung • „Königsweg zum Unbewussten“ • Im Traum verschaffen sich unbewusste Inhalte (verbotene Wünsche und Gefühle) Ausdruck, da die Abwehrmechanismen im Schlaf schwächer sind • Manifester Trauminhalt: • Inhalt des Traumes, der nach dem Aufwachen erinnert wird • Latenter Trauminhalt: • Verstellter Trauminhalt (unbewusster Wunsch, Konflikt), der durch freie Assoziationen und Deutung zugänglich gemacht werden soll • Der latente Traum ermöglicht eine partielle Befriedigung der unterdrückten Wünsche und bietet somit die Möglichkeit der Abfuhr von Triebspannungen • --> Aufgabe des Therapeuten liegt darin, die verborgenen Bedeutungen des latenten Trauminhalts aufzudecken. Dazu werden die manifesten Inhalte anhand der Assoziationen des Patienten gedeutet Psychoanalyse: Übertragung • Konzept der ubiquitären Übertragungsbereitschaft: Menschen begegnen und erleben andere Menschen so, wie sie es in früheren Beziehungen erfahren haben. • Die besondere Bedeutung der Übertragung für die Psychoanalyse liegt in der systematischen Analyse der Übertragung in der Beziehung zwischen Pat. und Analytiker • Übertragungsanalyse als wesentliches Mittel zur Heilung. Indem die Erfahrung des Patienten analysiert und der bewussten Erfahrung zugänglich gemacht wird, kann der Zwang zur Wiederholung vergangener Beziehungsschemata in gegenwärtigen Beziehungen unterbrochen werden Psychoanalyse: Formen der Übertragung • Positive Übertragung • Der Pat. schreibt dem Therapeuten positive Merkmale einer gesunden Elternfigur zu (Fürsorglichkeit, Verlässlichkeit etc.) • Kann in milder Form den Aufbau einer therapeutischen Arbeitsbeziehung fördern, allerdings Risiko der Idealisierung • Negative Übertragung • Aufgrund vergangener Beziehungserfahrungen hat der Pat. Die Erwartung, vom Therapeuten verurteilt, verachtet oder nicht ernst genommen zu werden Kann zu Widerstandsphänomenen führen " auch Chance, wenn die Übertragung verstanden und bearbeitet wird Erotisierende/ Sexualisierende Übertragung • Der Patient ist der Überzeugung, vom Therapeuten sexuell begehrt zu werden bzw. versucht sich, als attraktiver Sexualpartner zu präsentieren • --> Patienten vermeiden möglicherweise schwierige Gedanken und Gefühle, weil sie auf Erwiderung ihrer Gefühle hoffen • --> Allerdings Chance, dass durch ein empathisches Durcharbeiten des Verzichts auf die Liebesgefühle Fixierungen an die Liebesobjekte der Kindheit gelöst werden können Ein Hauptziel der Psychoanalyse besteht darin, die Übertragungsneurose in der Beziehung zwischen Pat. Und Therapeut zu bearbeiten! • • • Psychoanalyse: Gegenübertragung • Der Therapeut reagiert auf den Pat. (auf dessen Übertragungsphänomene) mit eigenen Gefühlen, Erwartungen, Vorurteilen etc. • Laut Freud steht die Gegenübertragung einer fruchtbaren Behandlung im Weg „Diese Gegenübertragung muss vom Arzt vollständig überwunden werden; das allein macht ihn psychoanalytisch mächtig. Das macht ihn zum vollkommen kühlen Objekt.“ • Wichtigkeit der eigenen Psychoanalyse (Lehranalyse), damit Therapeuten ein tiefgehendes Verständnis ihrer eigenen Motive, Konflikte und Schwachstellen entwickeln • Abstinenzregel: Die Gegenübertragung soll in der Psychoanalyse NICHT verbalisiert und NICHT in Handlungen umgesetzt werden Psychoanalyse: Widerstand • bezeichnet alle Phänomene im Therapieprozess, die sich dem Erreichen der Therapieziele entgegensetzen • Hat die Funktion, das psychische Gleichgewicht des Patienten „stabil“ zu halten. Dieses Verhalten, welches in der therapeutischen Situation als kontraproduktiv erkannt wird, ist im Alltag oft sinnvoll und vernünftig. • Psychoanalyse ist über weite Strecken „Widerstandsanalyse“ Psychoanalyse: Analyse der Widerstände • Die Widerstände werden auf unbewusste Motive hin untersucht und gedeutet. Es wird im einzelnen geklärt, welche Befürchtungen und Erwartungen den Patienten dazu veranlassen, sich a) unbewusst gegen die Behandlung b) gegen das Aussprechen seiner Gefühle und speziell c) gegen das Erleben seiner Übertragung (= Übertragungswiderstand) zur Wehr zu setzen Psychoanalyse: Therapeutische Beziehung in der Psychoanalyse • --> Setting ist auf Asymmetrie angelegt • Patient liegt auf der Couch • Grundregel der freien Assoziation • Analytiker sitzt außerhalb des Blickfeldes • Analytiker schweigt viel • Keine Beantwortung von Fragen, sondern Anregung an den Patienten, auf Fragen zu verzichten, statt dessen zu untersuchen, welche Bedeutung diese Fragen für ihn haben • Äußerungen beziehen sich häufig auf Deutungen über den unbewussten Hintergrund des Gesagten Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie nach Rogers: zentrale Begriffe der Persönlichkeitstheorie (vgl. Skript oben zu Paradigmen) - Erfahrung - Selbst - Symbolisierung - Inkongruenz - Selbstaktualisierungstendenz Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie: "Fully functioning person" • hypothetisches ideales Selbst nimmt jede Form der Erfahrung mit auf --> keine Inkongruenz • in Realität nicht erreichbar Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie: Prinzipien der Gesprächstherapie • Fokus auf die natürliche Fähigkeit des Organismus zur Selbstheilung • Hauptziel: Auflösung von Inkongruenz, um dem Klienten zu helfen, sich selbst zu akzeptieren und er selbst zu sein • Erreichen des Ziels durch: TherepeutIn realisiert drei Grundhaltungen (Echtheit, unbedingte Wertschätzung, Empathie), die bei KlientInnen zu zunehmender Selbstexploration und Integration von „verleugneten“ Erfahrungen führen soll Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie: Echtheit (Kongruenz) • TherapeutIn tritt KlientIn nicht mit der Fassade des Experten entgegen, sondern: aufrichtig, ehrlich und authentisch (wahrhaftig) • TherapeutIn hat also selbst Zugang zu ihren/seinen Gefühlen und Empfindungen, sie/er braucht diese nicht zu verleugnen oder zu verzerren • Echtheit deshalb auch = Kongruenz der/des TherapeutIn Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie: Unbedingte Wertschätzung (Akzeptanz) • TherapeutIn bringt KlientIn menschliche Sympathie, emotionale Wärme und Respekt entgegen • und zwar "unbedingt", d.h. weitgehend unabhängig davon, welche Inhalte die/der KlientIn zum Ausdruck bringt (auch bedingungsfreie Anerkennung genannt) Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie: Empathie (einfühlendes Verstehen) • TherapeutIn ist ständig bemüht, sich in die subjektive Welt der/des KlientIn hineinzuversetzen • Dabei soll die/der TherapeutIn immer wieder klar aussprechen, wie sie/er die Empfindungen und Gefühle wahrnimmt, die die/der KlientIn in seinen Äußerungen - oft nur vage - anklingen lässt (manchmal auch Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte genannt) Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie: Gesprächstherapeutische Beziehung Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie: Prinzipien therapeutischen Handelns - Spezifische Zentrierung der Aufmerksamkeit - Empathisches Zuhören - Verbalisierung der Erfahrungen des Patienten durch den Therapeuten - Nichtdirektivität Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie: Beispielinstruktion zu Beginn der Therapie • "Ich biete Ihnen an, mit mir frei und offen über alles zu sprechen, was Sie beschäftigt oder belastet. Sie bestimmen selbst, worüber Sie sprechen. Ich werde mich bemühen, Ihnen dadurch zu helfen, dass ich Ihnen immer genau sage, was ich verstanden habe aus dem, was Sie sagen. Ich werde Ihnen keine Ratschläge oder Hinweise geben. Es ist unsere Erfahrung, dass man durch solche Gespräche ruhiger und entspannter wird, wenn auch nicht sofort und immer, und dass es in der Regel so ist, dass, je klarer und deutlicher Probleme werden, sich umso eher auch Möglichkeiten und Wege zu Ihrer Lösung finden.“