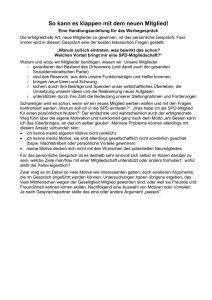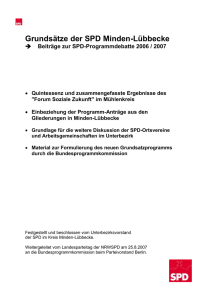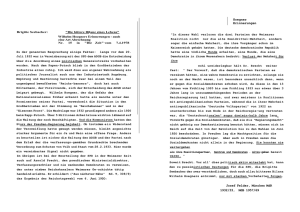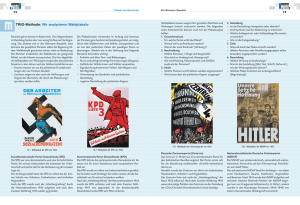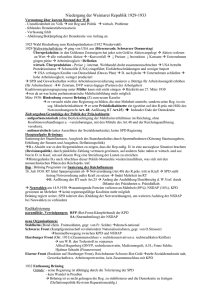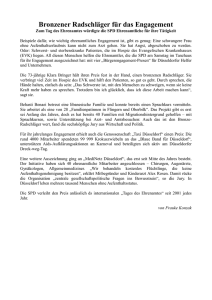Der Kampf für die Freiheit
Werbung

Christoph Ehmann Der Kampf für die Freiheit – Die Verhinderung der Zwangsvereinigung in Berlin und die Folgen Vortrag zur Feierstunde „70 Jahre Wiedergründung der Berliner SPD“ am 7. April 2016 in der Aula der Zinnowwaldschule Berlin - Zehlendorf Sehr verehrte Damen! Meine Herren! Liebe Freundinnen und Freunde! Liebe Genossinnen und Genossen! Willy Brandt antwortete in einer Veranstaltung zum 40. Jahrestag der Urabstimmung 1986 auf die Frage eines jungen Sozialdemokraten, ob es denn viel Sinn ergebe, immer wieder zurückzublättern; ob die Partei sich nicht voll auf das konzentrieren sollte, was vor denen liegt, die jetzt jung sind: „Ihr tut gut daran, Lehren aus der Vergangenheit ernsthaft zu bedenken, jedenfalls zu prüfen, wo es sich um Lehren handelt - und wo um leeres Zeug. Zu dem, woran man in der Rückschau nicht vorbeikommt, gehört die Zwangsvereinigung vom Frühjahr 1946, gehört die Berliner Urabstimmung Ende März jenen Jahres.“ Schauen wir also zurück! 1. Kapitel: Bis zur Urabstimmung Für die Mehrzahl derjenigen Mitglieder der KPD und der SPD, die die Nazizeit überlebt hatten, war die lang ersehnte Befreiung vom Faschismus die große Chance zum Neubeginn, zu einem Neubeginn unter Vermeidung der Fehler und Feindschaften der Weimarer Republik. Die Prager Erklärung des SPD-Vorstands 1934 hatte ebenso wie der Beschluss des Exekutivkomitees der KPD, 1935 im Exil in Moskau gefasst, in der Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung seit 1917 die eigentliche Ursache für den Sieg des Faschismus gesehen. In Zukunft sollte es nur eine große, gemeinsame sozialistische Partei für ganz Deutschland geben. Beide Parteien konnten auf einen konsequenten Kampf gegen den Faschismus verweisen: Mitglieder der KPD saßen nach dem Reichstagsbrand Ende Februar 1933 bereits in Haft oder waren in die Illegalität untergetaucht. Die SPD hatte am 5. März 1933 allein dem Druck der Nazis widerstanden und das Ermächtigungsgesetz geschlossen abgelehnt. Der Parteivorsitzende Otto Wels hatte unter den Schreien der braunen Horden auf den Zuschauerbänken ausgerufen: „Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht“. Das erste KZ Dachau wurde vom 22. März 1933 an zunächst mit Kommunisten und Sozialdemokraten gefüllt. Der politische Stellungskampf der Siegermächte begann schon vor der Potsdamer Konferenz vom Juli/August 1945. Dabei hatte die Rote Armee zunächst klare Vorteile, soweit es Berlin betraf. Die Rote Armee hatte Berlin am 2. Mai1945 endgültig erobert. Berlin, obwohl vollständig in der sowjetischen Zone liegend, sollte wie der Rest Deutschlands, in Besatzungszonen aufgeteilt werden. Denn in der Hauptstadt wollten alle gleichstark vertreten sein. Und dass Berlin die Hauptstadt war und bleiben sollte, stellte von den Alliierten zunächst niemand in Frage. Die Vorstellung, ein Ort wie Bonn könnte jemals eine zentrale Bedeutung für Deutschland erhalten, war ihnen, aber nicht nur ihnen, völlig fremd. 1 Doch erst am 4. Juli 1945 ließ die Rote Armee die amerikanischen und britischen Alliierten, abgesehen von einem kleinen Vorauskommando, in die Stadt. Die zwei Monate Mai und Juni versuchte die Sowjetunion zu nutzen, um die zukünftige politische Landschaft in Gesamtdeutschland vorzuprägen, z. B. durch die rasche Zulassung von politischen Parteien. Diese würden ihre Zentralen natürlich in der Hauptstadt haben, wo die rote Armee so lange wie möglich allein den Ton vorgeben wollte. Für dieses Vorgehen waren durch die sowjetische Führung Genossen um Walter Ulbricht im Moskauer Exil gezielt vorbereitet worden. Sie hatten die stalinistischen Säuberungen auf welche Weise auch immer lebend überstanden. Schon drei Tage vor der Kapitulation, am 30. April, war die Gruppe Ulbricht mit zehn Mitgliedern in Bruchmühlen bei Berlin eingetroffen, wo der politische Stab der Armee von Marschall Schukow sein Quartier hatte. Wenige Tage später, am 8. Mai 1945 bezog die Gruppe ihr Hauptquartier in der Prinzenallee 80 (heute: Einbecker Str. 41) in Lichtenberg. Die Gruppe Ulbricht bereitete den Aufbau der Verwaltung vor, an deren Spitze möglichst Vertreter des Bürgertums stehen sollten. Ulbricht nahm denn auch sofort Kontakt zu den Kirchen und zu bürgerlichen Vertretern wie dem früheren Deutschnationalen Ferdinand Sauerbruch auf. Es galt, Offenheit und Kooperationsbereitschaft zu zeigen. Die bereits existierenden Gruppen der Sozialdemokraten, die sich in Berlin wieder zusammengefunden hatten und den Wunsch nach der einen sozialistischen Partei zum Ausdruck bringen wollten, wurden hingegen im Monat Mai von ihm weder aufgesucht noch empfangen. Der Grund wurde bald deutlich: Am 4./5. Juni wurden Mitglieder der Gruppe Ulbricht nach Moskau bestellt und mit zwei Aufträgen konfrontiert: Zum einen sollte sofort die Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands erfolgen. Zum zweiten sollten drei weitere Parteien zugelassen werden: Zwei bürgerliche Parteien, eine christliche, nach dem Muster des katholischen Zentrums, möglicherweise aber auch überkonfessionell, und eine liberale. Sowie als dritte die SPD. Die Bildung einer Partei der Arbeiterbewegung, gemeinsam mit den Sozialdemokraten, wurde ausdrücklich verboten. Stattdessen sollten die vier Parteien eine „Antifaschistisch-demokratische Einheitsfront“ bilden und die sowjetische Besatzungszone und die Stadt einvernehmlich regieren. Selbstverständlich nach den Vorgaben der Sowjetischen MilitärAdministration - SMAD. Als eine Woche später, am 10. Juni 1945 die SMAD mitteilte, dass politische Parteien gegründet werden könnten, war die KPD bereits am nächsten Tag, dem 11. Juni zur Stelle. Die SPD, für die sich ein Zentralausschuss aus überlebenden Genossen unter Führung von Otto Grotewohl mit einem Zentrum in Schöneberg und Steglitz gebildet hatte, beantragte und erhielt die Zulassung für die gesamte Sowjetische Besatzungszone, einschließlich Berlins, am 15.Juni. Am 17. Juni kamen die SPD-Initiativen Berlins zusammen und wählten einen Groß-Berliner Bezirksvorstand. Der Zentralausschuss sollte örtliche Parteigründungen außerhalb Berlins vorantreiben. Die CDU, die sich gänzlich neu bilden musste, erhielt ihre Zulassung am 26. Juni, die LDPD am 5. Juli. In der britischen Besatzungszone erging die Aufforderung zur Gründung von Parteien zwei Monate später, am 6. August, in der amerikanischen Zone drei Monate später im September 1945, in der französischen Zone erst im Frühjahr 1946. Wenn auch die Zulassungen der vier Parteien durch die SMAD zügig erfolgten, so konnte von einer Gleichbehandlung keine Rede sein. Parteiarbeit bestand damals wie heute in der Produktion von Papier: Flugblätter, Zeitungen, Plakate. Bei der Papier-Zuteilung wurde die KPD bevorzugt. Um Parteigründungen außerhalb Berlins zu unterstützen, benötigte man Autos: Der KPD standen bereits im Juni 1945 40 Autos und zwei Flugzeuge zur Verfügung, der SPD fünf alte PKWs. Aber auch diese waren ohne Reisegenehmigungen und ohne ausreichende Benzinzuteilungen außerhalb Berlins nicht zu nutzen. Solche Genehmigungen wurden den Mitgliedern des Zentralausschusses 2 erstmals Ende August erteilt. Örtliche Parteigründungen konnten nach den Vorstellungen einiger sowjetischer Stadtkommandanten in der SBZ aber nur in Anwesenheit eines Mitglieds des zugelassenen Parteivorstandes aus Berlin ordnungsgemäß stattfinden. Also fanden sie im Juli und August für SPD, CDU und LDPD nicht statt. So zeigte sich Otto Grotewohl, der noch im Mai den Plan der einen sozialistischen Partei favorisiert hatte, ein halbes Jahr später angesichts der stalinistischen Praxis der unter dem besonderen Schutz der SMAD agierenden KPD ernüchtert. Die KPD hatte eine gemeinsame Feier von SPD und KPD zur Erinnerung an die Novemberrevolution 1918 für den 9. November vorgeschlagen. Die SPD hatte abgelehnt und ihrerseits zum 11. November eingeladen, unter anderen auch Wilhelm Pieck als den mittlerweile aus Moskau zurückgekehrten Sprecher der KPD. Wolfgang Leonhard, der Pieck begleitete, beschreibt die die Reaktion auf Grotewohls Rede in seinen Erinnerungen „Die Revolution entlässt ihre Kinder“ folgendermaßen: „Schon nach wenigen Worten spürte ich, dass die Rede gar nicht auf „Linie“ war... (Am Ende) bezeichnete Grotewohl es als die Aufgabe der SPD, innenpolitisch eine mittlere Position zwischen den bürgerlichen und der Kommunistischen Partei zu beziehen und außenpolitisch eine Mittlerrolle zwischen der Sowjetunion und den westlichen bürgerlichen Demokratien zu spielen. Die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit mit der KPD oder die Entwicklung zu einer Einheit beider Parteien wurde in Grotewohls Rede nicht erwähnt.“ Doch es traf die Moskauer Strategen noch heftiger. Bei den Novemberwahlen in Österreich und in Ungarn hatten die dortigen kommunistischen Parteien krasse Niederlagen erlitten und endeten jeweils hinter einer bürgerlichen bzw. Bauernpartei und den Sozialdemokraten auf dem 3. Platz. Ab Ende November 1945 war deshalb der bis dahin noch vehement abgelehnte Zusammenschluss mit der Sozialdemokraten das vorrangige Ziel der KPD. Auch wenn angesichts der ablehnenden Haltung der mittlerweile auch in den Westzonen gegründeten SPD mit Kurt Schumacher an der Spitze, sie nur in der SBZ, aber einschließlich Berlins, möglich sein könnte. Da auch das Verhältnis zu den Westalliierten deutlich schlechter geworden war, hatte die Sicherung des besetzten Gebiets Vorrang vor möglichen Plänen für ein Gesamtdeutschland. Der Zentralausschuss der SPD und die Parteileitung der KPD vereinbarten, ohne Rückkoppelung zu den Mitgliedern, für den 20./21. Dezember die Einberufung eines Ausschusses, der mit je 30 Personen von den beiden Leitungsgremien beschickt wurde, und der als „60er-Ausschuss“ gewisse Berühmtheit erlangen sollte. Grotewohl vertrat auf dieser Tagung die mit Kurt Schumacher vereinbarte Position, dass ein Einigungsbeschluss nur durch einen SPD-Parteitag aller Besatzungszonen („Reichsparteitag“ - heute: Bundesparteitag) getroffen werden könne. In dem Protokoll der Tagung fand diese grundlegende Bedingung keine Erwähnung. Es enthielt hingegen einen anderen, exakt konträren Beschluss: Es war eine Gruppe zur Erarbeitung eines Statuts für die geplante Einheitspartei eingesetzt worden. Dieses „Weihnachtsgeschenk“ stieß vielen Sozialdemokraten mächtig auf. Schon eine Woche später, am 29. Dezember lehnte der Berliner Bezirksvorstand auf einer Sitzung gemeinsam mit den Berliner Kreisvorsitzenden die Forderung nach einer Einheitspartei einhellig ab und forderte erstmals zu diesem Thema eine „Urabstimmung“ aller Partei-Mitglieder. In den folgenden Tagen und Wochen war der „Verschmelzungsbeschluss“ - so nannte man die Forderung nach dem Zusammenschluss beider Parteien im Alltag - Thema zahlreicher SPDVeranstaltungen in allen Stadtteilen, wo er zumeist abgelehnt wurde. Der Kreisverband Kreuzberg sprach sich z.B. mit 188 zu 8 Stimmen gegen jegliche „Verschmelzung“ aus. Die Proteste bleiben nicht auf Berlin beschränkt: In Rostock z.B. lehnten die Genossinnen und Genossen am 16. Januar die Pläne des Zentralausschusses mit großer Mehrheit ab. 3 Doch Grotewohl und einige andere „führende Genossen“ - „führende Genossinnen“ gab es damals noch weniger als heute - waren auf die Position des „60er-Ausschusses“ eingeschwenkt. Angesichts des Unterschieds bei den Mitgliederzahlen in der SBZ, die bei der SPD leicht höher lagen als bei der KPD, mögen auch einige SPD-Mitglieder geglaubt haben, Sozialdemokraten würden in der vereinigten Partei den Ton angeben können. Es werden aber wohl andere Gründe ausschlaggebender gewesen sein. Grotewohl erfuhr Freundlichkeiten von beiden Seiten. Vom Westen wurde ihm Geld angeboten. Der Osten ging, so heißt es, geschickter vor: Man versprach ihm die Drucklegung seines Buches in hoher Auflage und für jedes Exemplar eine Mark. Das war, gesetzt den Fall es ist so geschehen, deutlich geschickter. Zudem konnte ein Führungsamt in der neuen Partei versprochen werden, das ihm in der SPD wegen der Konkurrenz zu Kurt Schumacher wohl verwehrt bleiben würde. Doch Bestechungen bleiben, insbesondere wenn sie erfolgreich waren, gewöhnlich unbekannt. Erwas anderes ist es, wenn es um eine gezielte „Meinungsförderung“ ging. Zwei bekanntgewordene Versuche der gezielten „Meinungsförderung“ sollen beispielhaft genannt werden: Gustav Dahrendorf, wohnhaft im Süntelsteig 28, in der Berliner Verwaltung zuständig für die Energieversorgung und Mitglied des Zentralausschusses sah sich solchen Avancen der SMAD ausgesetzt, zumal er mittlerweile als ein Skeptiker hinsichtlich der Verschmelzung galt. Sein Sohn, Ralf Dahrendorf, damals 17 Jahre alt, beschreibt in seinen Erinnerungen: „Über Grenzen“, einen solchen Versuch: „Weihnachen 1945. Vor unserem Haus fuhr ein sowjetischer Jeep vor, und zwei Leute brachten uns allerlei Pakete mit Wurst und Schinken, Krimsekt und Kaviar, Zigaretten und anderem, was das Herz begehrte. Ein Geschenk der Militäradministration in Karlshorst. In der Familie brach eine gefühlsgeladene Diskussion los. Wir nagten nicht am Hungertuch, aber Wohltaten waren höchst willkommen. Indessen argumentierten meine Mutter und ich, dass wir nichts davon essen und trinken dürften, sondern alles zurückschicken müssten. Wir ließen uns nicht durch die Stalinisten bestechen. Mein Vater sah die Sache gelassen. Genießen wir die guten Dinge woher sie auch kommen, denn das ändert meine Meinung um keinen Deut; und wenn wir hier weg müssen, kann es nicht schaden, vorher noch einmal gut gegessen zu haben.“ Zwei Monate später, Mitte Februar, konnten er und Ralf nur durch rasches Eingreifen der Amerikaner und Briten vor dem Zugriff der SMAD gerettet und nach Westen ausgeflogen werden. In der Sowjetischen Besatzungszone ging die SMAD in der Regel direkter vor. Heiner Müller, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Bühnenautor, schilderte in seiner Autobiografie: Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen, wie eine Meinungsförderung in Waren/Müritz, Mecklenburg, vor sich ging: „Mein Vater (SPD-Kreisvorsitzender) wurde zum NKWD bestellt. Da saß ein sowjetische Major, der sagte: „Genosse Müller, Du gegen Vereinigung?“ - „Nein, ich bin nicht gegen Vereinigung, aber...“. Der Major: „Du gegen Vereinigung. Morgen Versammlung. Du sprechen für Vereinigung.“ Mein Vater: „Ich nicht spreche für Vereinigung“. Dann kam ein Leutnant mit einer Akte und der Major zog ein Papier mit einer Aussage vom Chauffeur und von der Sekretärin meines Vaters hervor. Die hatten ausgesagt, dass er und sein Stellvertreter eine faschistische Widerstandsgruppe gebildet und in einem Keller der Altstadt Waffen gelagert hätten. Der Major sagte: „Du sprechen für Vereinigung, ich vergessen Papier“. So geschah es dann. Carl Moltmann, der SPD-Vorsitzende in Mecklenburg, sah denn auch in dem Zusammenschluss die einzige Möglichkeit des Überlebens. Und Otto Grotewohl erhielt täglich solche Nachrichten aus der Provinz. Aus mancher Bestechung konnte rasch eine Erpressung werden. So falsch ist das Wort von der „Zwangsvereinigung“ doch wohl nicht. 4 Nur der besondere Status von und die Anwesenheit der westlichen Alliierten in West-Berlin bot dort - und nur dort - die Chance, dem Diktat der SMAD zu widerstehen. Berlin entwickelte sich zum Vorbild für jenes kleine gallische Dorf, lange bevor es deren Erfinder kreierten. 2. Die SPD Groß-Berlin hört nicht auf zu bestehen Mitte Februar legten KPD und SPD den Termin für den Zusammenschluss der Parteien auf den 20./21. April fest. Der Berliner Opposition blieben noch 2 Monate Zeit. Am 14. Februar trafen sich auf Einladung Curt Smolinzkys, Kreisvorsitzender Tempelhof, in Tempelhof erstmals die opponierenden Kreisverbände und beschlossen eine „Urwahl“ genannte Urabstimmung unter den Berliner Parteimitgliedern über die folgenden Fragen: 1. Bist du für den sofortigen Zusammenschluss beider Arbeiterparteien? 2. Bist du für ein Bündnis beider Parteien, welches gemeinsame Arbeit sichert und Bruderkampf ausschließt? Auf einer Funktionärskonferenz am 1. März im Admiralspalast wurde die Urabstimmung von den 2000 Anwesenden trotz Grotewohls rund eineinhalbstündiger Gegenrede beschlossen. Der Zentralausschuss reagierte umgehend. Die Spalten der Parteizeitung „Das Volk“ wurden für Beiträge der Verschmelzungsgegner gesperrt. Doch es ging längst nicht mehr um eine parteiinterne Streitigkeit. Das wurde jedem spätestens dann deutlich, als der damals überparteiliche „Tagesspiegel“ vom 15. März 1946 an täglich ein bis zwei Seiten den Oppositionellen mit der Begründung zur Verfügung stellte: „Es geht um den Probefall der Demokratie: Den Umgang mit der Opposition und der Freiheit der Persönlichkeit. Diese Vergewaltigung der Demokratie ist keine parteiinterne Angelegenheit mehr, sondern Sache der Öffentlichkeit“. Die SPD-Mitglieder waren aufgerufen, stellvertretend für alle Berliner zu handeln. Die Alliierten genehmigten die Durchführung der Urabstimmung für den 31. März. Die SMAD erlaubte sie auch, stellte jedoch administrative Vorbedingungen, die von den Ostberliner Kreisverbänden nicht, vor allem nicht rechtzeitig erfüllt werden konnten, so dass sie dort nicht stattfinden durfte. Der Zentralausschuss rief zum Boykott der Urabstimmung auf. In Ostberlin öffneten dennoch einige Abstimmungslokale für weniger als eine Stunde, bevor die Rote Armee sie schloss und die Urnen einsammelte. Es gelang jedoch, aus einem Stimmlokal in Berlin-Mitte eine Urne nach Westberlin zu bringen. Die Auszählung der 140 Abstimmungszettel ergab genau acht Stimmen für den sofortigen Zusammenschluss. Im Westen war die Urabstimmung eine großer Erfolg der Gegner des „sofortigen Zusammenschlusses“: 71,2 % der Westberliner Parteimitglieder waren trotz des Aufrufs zum Wahlboykott dem Wahlaufruf gefolgt. Von denen hatten sich 80,4 % gegen den sofortigen Zusammenschluss ausgesprochen. 60 % hatten allerdings auch für eine Zusammenarbeit der zwei eigenständigen Parteien votiert. Das aber genau hatte der KPD nicht genügt, denn in einem solchen Bündnis wäre sie hoffnungslos der kleinere Partner geblieben. Die SED - und einige Geschichtenschreiber bis heute - versuchte sich im Zahlenspiel. So heißt es z.B. in der „Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“, die 1968 im Ostberliner Dietz Verlag erschien: „Fast zwei Drittel der Berliner Organisation der SPD folgten dem (Boykott-)Aufruf des Zentralausschusses und blieben diesem statutenwidrigen Schwindelmanöver fern... Von den 66.245 Mitgliedern der Berliner SPD lehnten 19.529 die sofortige Vereinigung ab.“ Die rd. 33.000 in Ostberlin wohnenden SPD-Mitglieder waren wider Willen zu „Boykottbefürwortern“ gemacht worden. 5 Der Zentralausschuss, der sich immer noch für die einzig lizensierte SPD-Vertretung in der SBZ und Berlin hielt, kommentierte das Abstimmungsergebnis wie folgt: „Wo Funktionäre nicht eindeutig für die Einheit der Arbeiterschaft eintreten, können sie ein Amt in der Sozialdemokratischen Partei nicht länger bekleiden.“ Soviel hatte man schon von den Stalinisten gelernt. Doch der Berliner Bezirksvorstand entschied am 3. April, binnen vier Tagen und noch vor dem anvisierten Vereinigungsparteitag am 20./21. April einen Parteitag der Berliner SPD für den 7. April einzuberufen. Ein passender Saal wurde im zerstörten Berlin in der die Aula der Zinnowwald-Schule gefunden. Da die Schule damals noch als Krankenhaus genutzt wurde, fanden die Gegner für die Berliner SPD anschließend den Spottnamen „Zehlendorfer Krankenhaus-Partei“. Die Partei sollte sich in Zukunft, vielleicht bedingt durch diesen kurzen Krankenhaus-Aufenthalt, allerdings als sehr gesund erweisen. Doch war die „Krankenhaus-Partei“ die richtige SPD? Die Zulassung hatte seinerzeit der Zentralausschuss und somit die Grotewohl-SPD erhalten. Konnte sich ein Bezirk so einfach selbständig machen? Auch war zweifelhaft, ob der neuen SEPD eine Lizenz für Berlin erteilt würde. Denn für solche Parteizulassungen waren nun neben der SMAD auch die anderen Alliierten zuständig. Der amerikanische Stadtkommandant, General Barker, hatte aber am 29. März erklären lassen, „dass keine Verschmelzung anerkannt werden kann, die nicht freiwillig von den Mitgliedern, sondern nur von einer Gruppe von Parteifunktionären verlangt wird.“ Um keine Zweifel an den rechtlichen Voraussetzungen ihrer politischen Arbeit entstehen zu lassen, richtete der neu neugewählte Vorstand, bestehend aus den drei gleichberechtigten Vorsitzenden Franz Neumann, Reinickendorf, Curt Swolinzky, Tempelhof, und Karl Germer, Wilmersdorf, schon am nächsten Tag einen formellen Lizensierungsantrag an die Alliierte Kommandatura. Das brachte die Sowjetische Besatzungsmacht in einige Schwierigkeiten. Sollte sie eine Partei auf ihrem Berliner Territorium zulassen, auf deren Vernichtung sie mit ihren deutschen Genossen monatelang und mit allen Mitteln hingewirkt hatte? Andererseits war zu befürchten, dass die westlichen Besatzungsmächte dem von Moskau initiierten Parteizusammenschluss SEPD die Zulassung verweigern könnten. Die vier alliierten Stadtkommandanten gaben den SPD-Antrag an den Vier-Mächte-Kontrollrat weiter. So dauerte es ganze sieben Wochen, bis mit dem 31. Mai endlich eine Entscheidung bei Karl Germer eintraf. Der kurze Beschluss lautete: 1. „Die Alliierte Kommandatura gestattet der SPD in Berlin, zur Zeit unter der in ihrem Brief vom 8. April 1946 angegebenen Leitung, die Ausübung ihrer Tätigkeit innerhalb der Stadtgrenzen von Groß-Berlin. (Damit gab es eine offiziell zugelassene Groß-Berliner SPD.) 2. Die Alliierte Kommandatura erteilt eine ähnliche Genehmigung an die SEPD. (Das war der Kompromiss.) 3. Den Sozialdemokraten, die sich entweder der SEPD oder der SPD anschließen wollen, sind keine Hindernisse in den Weg zu legen. 4. Die Alliierte Kommandatura wird darauf sehen, dass in jedem Verwaltungsbezirk Berlins beiden Parteien Büroräumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden.“ Die SPD konnte somit in allen Bezirken Berlins wirken und in direkte Konfrontation mit der SED treten, was denn auch sehr bald geschah. Wenige SPD-Mitglieder waren der SEPD beigetreten. Hingegen hatte Ende 1946 die SPD im Osten immer noch 14.000 eingetragene Mitglieder, das entsprach etwa 40 % der Mitgliederzahl von vor der Vereinigung. Auch blieb die Infrastruktur erhalten. Sie konnte weiterhin über die 8 Ostberliner Kreisbüros verfügen. 6 Bei den ersten - und einzigen - freien Wahlen in Ganz-Berlin am 20. Oktober 1946, feierte sie einen überwältigen Erfolg. Bei einer Wahlbeteiligung von über 92 % entfielen in Groß-Berlin auf die SPD 48,7 %. Die SED lag an dritter Stelle mit 19,8 %. Selbst in Ostberlin hatte die SPD mit 43,6 % deutlich mehr Unterstützung als die SED mit lediglich 29,9 %. Der Ostberliner Magistrat reagierte etwas später mit der Entlassung aller SPD-Mitglieder, die es noch in der Verwaltung gab. Das waren mehr als 2.000 Personen. Westberliner Bezirke versuchten einige von ihnen aufzufangen. Doch die Hilfe war nicht nur in einer Richtung wirkungsvoll. Die Solidarität war keine Einbahnstraße. Während der Blockade 1948/49 revanchierten sich Ostberliner Sozialdemokraten. Sie schmuggelten immer wieder Kohlen für die Westberliner Kreisbüros durch die scharfen Kontrollen. Als Dank dafür luden Westberliner Sozialdemokraten zu Weihnachten 1949 über 2.700 Kinder und über 300 Rentner aus Ostberliner Abteilungen ein. Die SPD Groß-Berlin blieb eine Partei mit einem Landesvorstand und einer Landesdelegiertenversammlung, zu der auch Delegierte der 8 Ost-Kreisverbände gehörten. Ab 1950 wurden sechs Ostberliner Sozialdemokraten auf sicheren Westberliner Listenplätzen in das Westberliner Abgeordnetenhaus gewählt. Auch im Bundestag sicherte die Berliner SPD die Repräsentanz Ostberliner Genossinnen und Genossen. Ab 1952 gehörten Kurt Neugebauer, Kreisvorsitzender in Friedrichshain, und ab 1953 Gretel Berger-Heise, Kreisvorsitzende in Weißensee, zu den Berliner Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Eine derartige Repräsentanz des Ostens hat es bei keiner der anderen Parteien je gegeben. Die SPD war und blieb die Partei für Ganz-Berlin. Um ein erneutes Wahldesaster wie im Oktober 1946 zu vermeiden, wurden im Osten bei Wahlen nur noch SED-dominierte Einheitslisten zugelassen. Eine solche Beteiligung unter gnädiger Duldung der SED lehnte die SPD ab. „Diese Art der 'politischen Wirksamkeit' kann eine demokratische Partei, ohne sich selbst aufzugeben, nicht erfüllen.“ Anders machte es beispielsweise die Ost-CDU. Auf ihrem 6. Parteitag 1952 erklärte sie, die Einheitsfront „vorbehaltlos“ zu unterstützen. Während aus den Verwaltungen, den Gewerkschaften und den gesellschaftlichen Organisationen im Osten alle Sozialdemokraten hinausgedrängt wurden und der „Sozialdemokratismus“ als der Hauptgegner der SED bis in die 70er Jahre verfolgt wurde, konnten seit 1953 Eintritte in die kleineren Ost-Parteien durchaus sichere, wenn auch meist nur kleinere Karrieren und Posten im Osten garantieren. Neuaufnahmen in die SPD waren in den Ost-Kreisverbänden nicht ausgeschlossen, doch schwierig. Denn die SED hatte erhebliches Interesse daran, die Berliner SPD auf jeder Ebene zu unterwandern. Kandidaten mussten deshalb bis zu 3 Paten oder Leumundszeugen bringen, um eine Aufnahme zu erreichen. Dennoch zählten die 8 Kreise am 30.6.1961, also sechs Wochen vor dem Mauerbau 5.327 Mitglieder. Als die DDR-Regierung am 22. August Westberlinern zur Gänze das Betreten Ostberlins verbot, war eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr aufrecht zu erhalten. Der SPD-Landesvorstand beschloss deshalb am 23. August die Ostberliner Mitglieder aus ihren Pflichten der Partei gegenüber zu entlassen. Gleichzeitig bekräftigte er, dass die SPD an ihrem Recht festhielte, die sozialdemokratische Partei im Ostsektor wieder herzustellen, und er verpflichtete sich, „jederzeit treu zu diesen ehemaligen Mitgliedern zu stehen.“ 3. Hat sich das alles gelohnt? Die „Urwahl“ 1946 hatte sich zu einer Abstimmung über die Sicherung der Freiheit der Einzelnen und ihrer Grundrechte auf der einen Seite und die Unterordnung der Menschen unter eine Ideologie, deren Ausformung in alltägliche Praxis von einer selbsternannten allwissenden Vorhut bestimmt wird, entwickelt. 7 In dieser Kontroverse wussten sich die Berliner Sozialdemokraten unterstützt, wenn nicht gar getragen von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung, der durchaus klar war, um welche Zukunftsperspektive für die Stadt und für Deutschland es ging. Mit ihren Aktionen und ihrer Abstimmung gegen die Verschmelzung brachten Berliner Sozialdemokraten, nicht nur ihren, sondern auch den Willen ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger zum Ausdruck. Ihr Bestehen darauf, eine Partei für Ganz-Berlin, für Groß-Berlin zu sein, hielt sie als einzige Partei, auch nach dem Mauerbau 1961 durch. Die von Willy Brandt und Egon Bahr gegen Widerstände realisierte Politik der Passierscheinabkommen unterstrich dieses Denken und Handeln für ein nie aufgegebenes, zukünftig wieder möglich werdendes Gesamt-Berlin. Perspektiven für Gesamtberlin waren immer auch Perspektiven für Gesamtdeutschland. Mit ihrer Entscheidung gegen die Zwangsvereinigung stabilisierten die Berliner Sozialdemokraten die demokratischen Grundlagen West-Berlins. Und sie gaben den westlichen Alliierten die Gewissheit, dass deren Eintreten für die Freiheit, für die politische Idee der Demokratie in Berlin und in Deutschland, von einer Bevölkerung nicht nur hingenommen, sondern mit großem persönlichen Einsatz getragen wurde. Es gab viele Möglichkeiten in den 40er und 50er Jahren, sowjetischem Druck auf West-Berlin nachzugeben. Dass dies nicht geschah, beruhte auch auf dem deutlichen Votum der Berliner Sozialdemokraten für die Freiheit. Ernst Reuter, Otto Suhr und Willy Brandt standen für diesen Freiheitswillen. Kennedy war stolz darauf, sich als „Berliner“ bezeichnen zu dürfen. Doch der Mauerbau veränderte auch die nunmehr nur Westberliner SPD erheblich. Man sollte parteiübergreifend zusammenrücken. Doch „parteiübergreifend“ war nur der Antikommunismus. Er wurde auch zu herrschenden Linie der Berliner SPD. Das politische Erscheinungsbild wurde zuweilen etwas unscharf. Mit der „Bekämpfung des Kommunismus“ ließ sich viel rechtfertigen: die zunehmende Praxis der Parteiausschlussverfahren gegen Minderheiten, u. a. weil sie gegen das amerikanische Engagement im Vietnamkrieg protestierten, die Billigung von Schüssen und Wasserwerfern gegen junge Demonstranten gegen diktatorische Regime wie das in Persien. Zu Kommunistenfreunden konnten auch jene gemacht werden, die gegen die Korruption bei der Vergabe städtischer Aufträge oder bei der Versorgung alter Genossen mit gutdotierten Posten in Landesbetrieben oder gegen politische Hardliner innerparteilich votierten. Doch diese Zeit ist überwunden. Berlin ist seit einem Vierteljahrhundert wieder Groß-Berlin. Die Anziehungskraft der Stadt ist stark. Sie ist eine wachsende Stadt. Sie hat gerade auch in den letzten Monaten ihre Weltoffenheit bewiesen. Es ist unsere Aufgabe, sie auch als die Stadt der Freiheit des Einzelnen, der Toleranz gegenüber anderen Meinungen, der Vorherrschaft des Rechts gegenüber der Macht und der Respektierung der Würde aller seiner Bürgerinnen und Bürger jedweder Herkunft zu bewahren und zu stärken. Doch das müsste das Thema eines anderen Vortrags sein. Lassen Sie uns diesen Abend schließen mit jenem Lied, das auch die Delegierten am Ende des Parteitages 1946 um fast die gleiche Uhrzeit anstimmten und das sie nicht den Kommunisten überlassen wollten: „Brüder zur Sonne, zur Freiheit“. 8