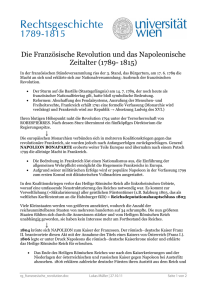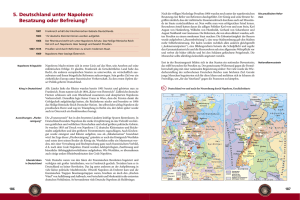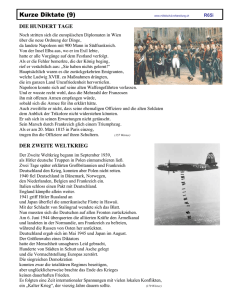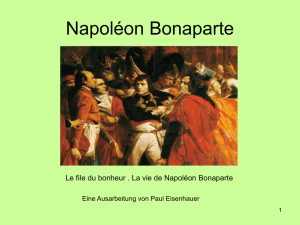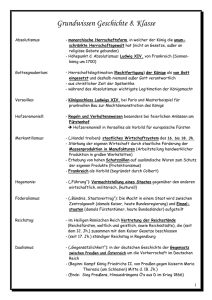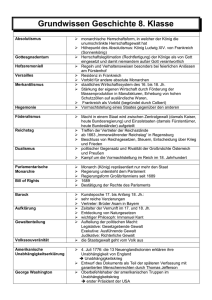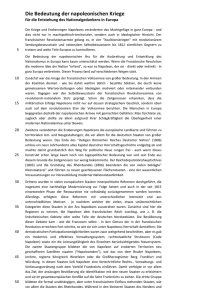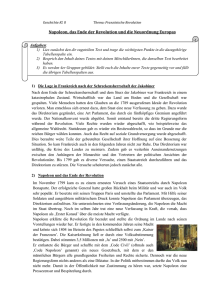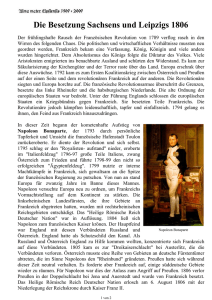Der Tod des Diktators
Werbung

Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators V © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt (Hg.) Der Tod des Diktators Ereignis und Erinnerung im 20. Jahrhundert Vandenhoeck & Ruprecht © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators Mit 17 Abbildungen Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN 978-3-525-30009-1 Umschlagabbildung: In einem Hinterhof liegende Lenin-Statue im Norden Bukarests, 2006 (Bild wurde bearbeitet); © REUTERS / Bogdan Cristel © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Oakville, CT, U.S.A. www.v-r.de Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Verlages öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch bei einer entsprechenden Nutzung für Lehr- und Unterrichtszwecke. Printed in Germany. Satz und Litho: SchwabScantechnik, Göttingen Druck und Bindung: a Hubert & Co. Göttingen © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators Inhalt Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt Der Tod des Diktators. Ereignis und Erinnerung im 20. Jahrhundert . . . 7 Rüdiger Schmidt Napoleon Bonaparte. Charisma, Tod und Mythos . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Benno Ennker Das lange Sterben des Vladimir I. Lenin. Politik und Kult im Angesicht des Todes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Verena Kümmel Faustpfand und Ballast. Die Leiche Benito Mussolinis und die italienische Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Hans-Ulrich Thamer Der tote Hitler. Das Ende des Diktators und die Wandlungen eines Mythos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Klaus Kellmann Stalins langer Tod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Martin Großheim Ho Chi Minh. Die Konservierung einer Ikone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Mathias Tullner Walter Ulbricht. Demontage eines lebenden Denkmals des Weltkommunismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Walther L. Bernecker Der Tod des spanischen Diktators Francisco Franco. Sterben im Zeitlupentempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Inhalt © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 5 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators Martin Kroher Mao Zedong. Das befleckte Staatssymbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Ljiljana Reinkowski Es lebe Tito, es starb Tito. Das Bild Titos im kommunistischen Jugoslawien und in den jugoslawischen Nachfolgestaaten . . . . . . . . . . . . 199 Rudolf Gräf Ein Ende ohne Neuanfang. Der Sturz von Nicolae Ceausescu im Jahre 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Klaus Schlichte Die zwei Leben des Idi Amin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Caroline Fetscher Der postmoderne Despot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Stefan Rinke / Georg Dufner Ein Abgang in drei Akten. Chile und der lange Schatten Augusto Pinochets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Thomas Großbölting Saddam Hussein. Der doppelte Tod des irakischen Diktators . . . . . . . . . 303 Abbildungsnachweis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Herausgeber, Autorinnen und Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 6 Inhalt © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt Der Tod des Diktators Ereignis und Erinnerung im 20. Jahrhundert Wo die Macht des Diktators zu dessen Lebzeiten unbegrenzt erscheint, da bricht sich diese Grenzenlosigkeit in dessen Tod.1 Das Ableben des Mächtigen markierte nicht nur ein individuelles Ende. Sehr oft stand mit dem Tod des Diktators ein ganzes Herrschaftsgefüge zur Disposition. Wo Gefolgsleute und Anhänger diesen Schnitt fürchten mussten, da waren die Konsequenzen auch für die Beherrschten meist tiefgreifender als es in einer Demokratie je denkbar wäre. Im Mittelalter, so ist vielfach gezeigt worden, wappnete man sich nach dem Sterben des Mächtigen gegen ein mögliches Machtvakuum vor allem auf der symbolischen Ebene: Auch der tote König galt noch als König, weil man zwischen der Person und der Sakralität ihrer Herrschaftsausübung unterschied. Die mittelalterliche Vorstellung von den zwei Körpern des Königs, wie sie Ernst H. Kantorowicz so eindrücklich beschrieben hat, entwickelte sich auf dem Weg in die Moderne zur französischen Heroldsformel »Der König ist tot, es lebe der König«.2 Die 1824 zum letzten Mal gebrauchte Sentenz suchte die Dramatik des Herrschertodes dadurch zu entschärfen, dass sie die Krone und damit die Macht nahtlos vom verstorbenen Monarchen auf seinen durch die Erbfolge bestimmten Nachfolger übertrug. Es liegt auf der Hand, dass diese Symbolik selbst in der Vormoderne oft genug wirkungslos blieb, wurde doch um die Macht nach dem Ableben des Throninhabers erbittert gestritten. Im 20. Jahrhundert konnte die Fiktion eines reibungslosen Übergangs kaum noch aufrechterhalten werden. Das »Zeitalter der Extreme« (Hobsbawm) war von vielfältigen politischen Brüchen und Umwälzungen gezeichnet, die sich vor den Augen der Öffentlichkeit abspielten. Der Tod des ersten Mannes im Staate war deshalb eine Herausforderung, die weit über den Kreis des Privaten hinausreichte und ganz unabhängig von der Staats- und Regierungsform per se eine öffentliche Angelegenheit war und ist. Der Tod eines Mächtigen war ein in vielen Medien reflektiertes Massenereignis. Bis heute stellt jedes Staatsbegräbnis ein hochoffizielles und zeremoniell überformtes Ritual dar. Die dabei verwandten Symbole und rituellen Ausdrucksformen sind oftmals dem religiösen Bereich entliehen und ähneln sich selbst über die Jahrhunderte hinweg – nur eine schmale Zahl von Gesten und Riten scheint uns zur Verfügung zu stehen, um den Übergang vom Leben in den Tod zu zelebrieren. Vordergründig Der Tod des Diktators © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 7 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators dient die Zeremonie natürlich dem Begräbnis des Verstorbenen, in ihrer Signalfunktion zielt sie aber vor allem auf die Lebenden. Ein zentraler Punkt ist auch heute noch der Körper des Toten, der Leichnam. Er kann der entscheidende Trumpf sein im Spiel um die zukünftige Macht. Die Umbrüche in Osteuropa, die weitgehend friedlichen Revolutionen von 1989/90 haben dieses erneut gezeigt: In Ungarn war die Umbettung des früheren Ersten Sekretärs der Kommunistischen Partei Ungarns und Reformkommunisten Imre Nagy ein wichtiges Fanal der Opposition gegen die kommunistische Regierung. Als führender Kopf des ungarischen Aufstandes 1956 wurde er 1989 als antikommunistischer Held erneut beigesetzt.3 Diese Form der symbolischen Kommunikation kennt auch die entgegengesetzte Perspektive. Mögliche Orientierung ins Gestern, so prophezeit die Anthropologin Katherine Verdery für das Beispiel Rumänien, lasse sich ablesen am Umgang mit den Diktatoren. Wer wissen wolle, wie es um eine mögliche kommunistische Restauration stehe, solle wie ein Adler auf das Grab von Nikola Ceausecu in Bukarest blicken.4 Wo die physischen Körper fehlten, traten auch Verkörperungen an deren Stelle. Im Stile öffentlicher Hinrichtungen wurden in Moskau, in Warschau, Bukarest und anderswo Statuen der Säulenheiligen des Sozialismus – Lenin, Stalin, Dscherzinsky – gestürzt. Einige von ihnen erhielten sogar öffentliche Begräbnisse. In Eriwan, Armenien, wurden beispielsweise diese Statuen von ihren Sockeln entfernt, auf einen Lastwagen geladen und wie in einem offenen Sarg wieder und wieder um den zentralen Platz der Hauptstadt gefahren. Passanten und Umstehende warfen ganz wie bei einer Beerdigung Tannenzapfen und Geldmünzen in den fahrenden Wagen. In der Mongolei, in der 1990 eine riesige Leninstatue gestürzt wurde, schütteten Bauern Milch auf das noch sichtbare Fundament des einstigen Denkmals. Auf diese Weise hofften sie, die bösen Geister bannen zu können, die mit der dargestellten Person verbunden waren.5 Diese wenigen Beispiele zeigen, wie weit das Ereignis über den eigentlichen Akt der Bestattung als Zäsur wirkte. Symbolisch werden Pflöcke eingeschlagen, die die Erinnerung an den Herrscher wachhalten, einen Personenkult um den Toten begründen oder – so das andere Extrem – ihn ganz aus dem Gedächtnis der Nation zu tilgen versuchen. Legitimierung und Verdammung liegen unmittelbar beieinander. Das Drehbuch und die Dramaturgie der Akte sind dabei durchaus abhängig von den verschiedenen Staatsformen: In den modernen Demokratien ist Macht und der damit verbundene Einfluss von den Wählern abhängig und nur auf Zeit verliehen. Tendenziell ist damit der Zusammenhang einer einzelnen Person und der ihr verliehenen Macht eher lose, auch wenn der mediale Trend zu einer immer stärkeren Personalisierung der Politik in eine andere Richtung verweist. Anders stellte sich die Situation für die im 20. Jahrhundert so weit verbreiteten Diktaturen dar. Die Machtbasis der Diktatoren beruhte nicht selten in hohem Maße auf charismatischen und plebiszitären Elementen. Charisma, darauf hat 8 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators im Gefolge von Max Weber die Forschung vielfach verwiesen, beruht nicht nur auf individuellen Qualitäten, sondern bezeichnet ein Beziehungsverhältnis zwischen Herrscher und Beherrschten.6 Von außen werden Erwartungen an den Diktator herangetragen, die ihn zu einem »Übermenschen« stilisieren. Seine nicht nach objektiven Maßstäben, wohl aber aus Sicht der Rezipienten herausragende Persönlichkeit kann dabei allerdings nicht mehr wie in der traditionalen Welt als göttlich verstanden werden. Stattdessen wird ihm ein ganzer Strauß von Fähigkeiten zugeschrieben, die es ihm ermöglichen sollen, die Gesellschaft aus ihrer Krise zu einer neuen Existenzstufe zu führen.7 Wie stark Führer- und Diktatorenkulte die politische Kultur des 20. Jahrhunderts prägten, lässt sich vor allem an der Reaktion der Institution ablesen, die traditionell für die Verwaltung der Gnadengaben zuständig war: »Geradezu gigantisch« stieg die Zahl der von der katholischen Kirche vorgenommenen Selig- und Heiligsprechungen im 20. Jahrhundert, resümiert Arnold Angenendt eine Entwicklung, die wohl nicht zuletzt auch als Gegenreaktion auf das Aufkommen der vielen Ersatzheiligen zu sehen ist, die die totalitären Ideologien und politischen Religionen des 20. Jahrhunderts hervorbrachten.8 Selbst in den Diktaturen des sowjetischen Systems war oftmals die Partei allenfalls das mythische Gerüst, auf dem sich der Personenkult der Leitfigur umso strahlender abhob. Nicht nur die angestellten Überlegungen, sondern auch die in diesem Buch versammelten Beispiele zeigen, dass in den modernen Diktaturen des 20. Jahrhunderts der Tod des ersten Mannes – hier beschränkt sich die Geschichte tatsächlich auf das männliche Geschlecht – mehr als ein Herrschaftswechsel war. Er konnte den Übergang auf einen Nachfolger bedeuten oder, so in vielen Fällen, den Umbruch des gesamten Systems politischer Herrschaft nach sich ziehen. Immer aber war das Verhältnis von Beherrschten und Herrschenden neu zu justieren. In den mehr oder weniger durchherrschten diktatorischen Gesellschaften konnte dieses nicht beim Umbau des Machtapparats im engeren Sinne stehen bleiben, sondern zog automatisch weite Kreise in die Gesellschaft hinein. Die Autorinnen und Autoren dieses Bandes nehmen die Dramatik des jeweiligen Ereignisses auf und können zugleich zeigen, dass der Tod und dessen öffentlicher Vollzug weit darüber hinaus weist: Der Tod des Diktators, die Umstände seines Ablebens, die verschiedenen Formen des Umgangs mit seinem Leichnam und die so (mit) geprägte Erinnerung lassen in nuce wichtige Facetten der Wechselbeziehung zwischen Diktatur und ihrer Führung einerseits und der diktatorisch beherrschten bzw. sich davon lösenden Gesellschaft erkennen. Diesen Zusammenhängen geht der vorliegende Band an zentralen Beispielen vor allem, aber nicht ausschließlich des zurückliegenden Jahrhunderts nach: Die Ereignisse um den Tod des Diktators und die mit ihnen verbundenen öffentlichen Geschehnisse erzählen ebenso viel über den Charakter, der mit dem Toten verbundenen Diktatur, wie über das politische Erbe des Zwangsregimes, mit dem die Nachfolgegesellschaft umzugehen hatte. Der Tod des Diktators © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 9 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators Die Beiträge des vorliegenden Bandes thematisieren die besonderen Umstände sowie auch die politischen und gesellschaftlichen Folgen des Tods von Diktatoren. So unterschiedlich der Aufstieg und die »Karrieremuster« von Personen, denen es gelang, sich als Diktatoren zu etablieren, auch verlaufen sein mochte – bei allen Unterschieden der sozialen Herkunft, Bildung wie auch der politischen Sozialisation war ihnen doch eins gemeinsam: Sie wussten die jeweiligen besonderen politisch-sozialen Umstände zu nutzen, um an die Macht zu gelangen und ihre Diktatur zu etablieren. In der Regel reagierten sie dabei auf die spezifischen bzw. jeweils aktuellen Krisensymptome einer Gesellschaft, die zumeist geeignet waren, eine radikale politische Zäsur zu begünstigen. Das traf für Adolf Hitler, der in den Krisenjahren der Weimarer Republik die strukturellen wie aktuellen politisch-sozialen Probleme der ersten deutschen Demokratie demagogisch auszunutzen verstand, ebenso zu, wie für Franco oder Mao Zedong, denen der Bürgerkrieg in ihren Ländern zum Aufstieg verholfen hatte. Die Beispiele der in diesem Band behandelten Diktatoren werfen insofern immer auch ein Licht auf die jeweilige Gesellschaft, die eine Diktatur ermöglichte bzw. auf die Eliten und sozialen Trägerschichten, die eine Diktatur stützten oder jedenfalls tolerierten. Der Tod des Diktators konfrontierte die Regime wie auch die sie tragenden Gesellschaften demzufolge mit der Herausforderung, entweder unter veränderten Bedingungen und mit anderen Personen die Kontinuität der Diktatur zu garantieren oder einen Bruch des politischen Systems zu erreichen, der sich mit dem Ableben des ersten Mannes an der Spitze des Staates verband. Ob der Tod des Diktators den Übergang zur Demokratie begünstigte, ob sich mit dem Ableben des Diktators die autokratischen Strukturen und Impulse des Regimes gegebenenfalls abschwächten oder sogar intensivierten: Immer musste der staatliche Machtapparat auf eine Legitimationslücke reagieren und versuchen, diese zu schließen. Das war grundsätzlich möglich, indem man – wie beispielsweise beim Übergang von Lenin zu Stalin – die bruchlose Anschlussfähigkeit des »neuen« Regimes an die überlieferten politischen Strukturen behauptete. Das konnte geschehen, indem man – wie im nachmaoistischen China – die »Legitimationsressourcen«, die sich mit dem toten Diktator verbanden, für Zwecke einer tendenziell gewandelten Politik in Anspruch nahm. Die (partielle) Delegitimation eines Diktators konnte – wie bei Ho Chi Minh – dazu führen, dass dieser in den Bereich des Legendären verwiesen wurde und damit in mancherlei Hinsicht nach wie vor als politische Ikone galt, ohne – abgesehen von eher symbolisch überformten Instrumentalisierungsabsichten – für die aktuelle Politik Vietnams noch von maßgeblicher Bedeutung zu sein. Ebenso rasch und tiefgreifend konnte aber auch das Andenken an den Diktator getilgt werden, wenn der Nachfolger – wie durch die Ablösung Ulbrichts durch Honecker bezeugt – die Erinnerung an den Vorgänger weitgehend unterdrücken ließ, um die eigene Person in ein helleres Licht zu rücken wie auch um die (partielle) Abkehr von jenen politischen Vorstellungen zu unterstreichen, die sich mit dem der Ächtung 10 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators anheimgefallenen Diktator verbanden. »Die Vergangenheit«, hat Alexander Vatlin jüngst geurteilt, »lässt sich nicht vorhersehen, folgt sie doch den Änderungen der offiziellen Parteilinie«.9 Der Tod des Diktators stellte jede Diktatur auf eine Bewährungsprobe, in der es darum ging, die aktuelle Gegenwart in ein Verhältnis zur Vergangenheit und zur Zukunft zu setzen. Ob man Diktatoren demontierte, dämonisierte oder glorifizierte, ob man sie ächtete oder für Zwecke aktueller Politik instrumentalisierte – ihr Tod ging nie lautlos vonstatten, sondern diesem folgte immer ein Prozess der Erinnerung und der aktiven Auseinandersetzung. Anmerkungen 1 Für vielfältige Mithilfe bei der Redaktion dieses Bandes danken die Herausgeber Katharina Hennig, Manuela Knopik und Bianka Litschke. 2 Ernst H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology, Princeton 71997. 3 Vgl. János M. Rainer, Imre Nagy. Vom Parteisoldaten zum Märtyrer des ungarischen Volksaufstandes. Eine politische Biografie 1896–1958, Paderborn 2006. 4 Vgl. Katherine Verdery, What was socialism, and what comes next? Princeton u. a. 1996, S. 232. 5 Vgl. ebd. 6 Vgl. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, Tübingen 51976, S. 654–682. 7 Vgl. Frank Möller, Einführung. Zur Theorie des charismatischen Führers im modernen Nationalstaat, in: ders. (Hg.), Charismatische Führer der deutschen Nation, München 2004, S. 1–19, S. 14. 8 Arnold Angenendt, Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart, München 1994, S. 331. 9 Alexander Vatlin, Die unvollendete Vergangenheit. Über den Umgang mit der kommunistischen Geschichte im heutigen Russland, in: Großbölting, Thomas u. a. (Hg.), Das Ende des Kommunismus. Die Überwindung der Diktaturen in Europa und ihre Folgen, Essen 2010, S. 75. Der Tod des Diktators © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 11 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators Rüdiger Schmidt Napoleon Bonaparte Charisma, Tod und Mythos Die Französische Revolution, urteilt Hans-Ulrich Thamer, »wurde zum Laboratorium der Moderne, indem sie in der kurzen Spanne eines Jahrzehnts die unterschiedlichen Verfassungsformen entwickelte, die für das 19. und 20. Jahrhundert wirkungsmächtig werden sollten, von der konstitutionellen Monarchie über die Republik bis zur bonapartistischen Diktatur«.1 Es war schon unter den Zeitgenossen strittig, ob der erst dreißigjährige General Bonaparte im November 1799 das revolutionäre und kriegführende Frankreich vor äußerer Bedrohung rettete und vom inneren Chaos erlöste oder ob es sich hier lediglich um den »Mythos des Retters« handelte.2 Am 9. November 1799, nach dem Revolutionskalender war es der 18. Brumaire, stürzte Bonaparte das Direktorium und ließ sich selbst zum Ersten Konsul proklamieren. »Ich bin die Revolution«, verkündete er nach dem Staatsstreich und versicherte zugleich, dass die Revolution beendet sei.3 Die Revolution hatte ihn emporgetragen, jetzt versuchte er sie zu beerben.4 Es war in mancherlei Hinsicht bezeichnend für die Situation nach dem 18. Brumaire, dass der Staatsstreich in Frankreich eher mit Überraschung und Erstaunen als mit Unwillen oder gar Auflehnung aufgenommen wurde.5 In Paris blieb es ruhig. In den Faubourgs, in denen die sozialen Trägerschichten der Revolution zu Hause waren, schien der revolutionäre Elan seit der Niederwerfung der letzten Aufstände im April und Mai 1795 erloschen. Auch außerhalb der Hauptstadt hatte es kaum Widerstand gegen den Staatsstreich gegeben; niemand rechnete mit der Gegenwehr breiterer Bevölkerungsschichten, die sich angesichts des kürzlich erfolgten Umsturzes bemüßigt fühlten, ihre gerade hinweggefegten Abgeordneten zu verteidigen. Im Gegenteil: Vor allem in den bürgerlichen Vierteln reagierte man eher mit Erleichterung auf den unblutigen Ausgang des 18. Brumaire. Zu sehr war das Direktorium in Misskredit geraten, zu wenig war man noch willens, die Souveränität des Volkes zu verteidigen. Der Sieg vom 9. November wäre indes unvollkommen gewesen, wenn Bonaparte nicht nach dem Staatsstreich vollendete Tatsachen geschaffen hätte, die ihn schließlich an die Spitze der Nation tragen sollten. Rasch hatte der General seine Konkurrenten Emmanuel Joseph Sièyes und Pierre Roger Ducos ausmanövriert und sich den Löwenanteil an der Macht gesichert, bekam dafür allerdings »die Feindseligkeit derjenigen Brumairianer zu spüren, die ihn gerufen hatten, damit Napoleon Bonaparte © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 13 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators er den Staatsstreich ausführe, nicht aber, damit er dessen Hauptnutznießer sei«.6 Mehr und mehr wurde deutlich, dass ein Regime Bonaparte nichtsweniger als »die Revolutionierung der Wirklichkeit unter Abzug der Revolution« bedeuten würde.7 Als er sich am 15. Dezember 1799 mit den Worten »Die Revolution ist zu den Grundsätzen zurückgekehrt, von denen sie ausging; sie ist zu Ende« an die französische Nation wandte, hatte er die Revolution – paradox genug – im Namen der Ideen von 1789 beendet.8 Die neue Konsularverfassung, die am 25. Dezember 1799 in Kraft trat, war ganz auf seine Bedürfnisse zugeschnitten, es handelte sich um die Konstitution einer kaum verschleierten Diktatur.9 An der Spitze des Staates standen drei Konsuln, von denen Bonaparte als Premier Consul mit quasi-diktatorischen Vollmachten ausgestattet war. Er wurde auf zehn Jahre vom Senat gewählt, nur er allein ernannte Minister, Generale, die Mitglieder des Staatsrats und Verwaltungsbeamte. Das allgemeine Wahlrecht blieb bestehen, wurde jedoch durch einen neuen Wahlmodus eingeschränkt. Die gesetzgebende Gewalt verteilte sich auf zwei Versammlungen, von denen die hundert Mitglieder des Tribunats die Gesetze ohne Entscheidungsrecht diskutieren und die gesetzgebende Körperschaft – »das Korps der Stummen« – die Gesetze ohne das Recht der Beratung beschließen konnten. Das Plebiszit, das Bonaparte im Januar 1800 über die Verfassung anberaumte, war demzufolge auch ein Plebiszit über den Ersten Konsul, bestätigte aber eindrucksvoll die »pseudodemokratisch verbrämte Diktatur Bonapartes«.10 Mit rastloser Energie widmete sich der Erste Konsul ab jetzt der innenpolitischen Neuordnung Frankreichs: Dazu zählte die Sanierung der Finanzen, die Reorganisation der Verwaltung und die Förderung der Industrie; die öffentliche Infrastruktur wurde erneuert, wozu auch der Neubau von Straßen und Kanälen zählte. Getragen von einem Kurs der nationalen Versöhnung kehrte das Land in kürzester Zeit zu geordneten Wirtschaftsverhältnissen zurück; darüber hinaus wurden das Prinzip der Wahrung des Besitzes und der Gleichheit vor dem Gesetz, auch die Entfeudalisierung des ländlichen Besitzes nicht angetastet, ja mehr noch, mit dem Code Civil (1804) hatte Napoleon die elementaren Rechte der Freiheit, der Gleichheit und des Schutzes des Privateigentums verbindlich geregelt. War die Revolution also doch nicht zu Ende? Hatte sie nur die Form verändert und war eine Metamorphose eingegangen, wie Napoleons Biograf Fournier vermutet?11 Ohne Zweifel hatten seine Reformen Erfolg. Doch das Budget hatte er ausgeglichen, indem er die Kriegskosten den Besiegten aufbürdete. Den inneren Frieden hatte er hergestellt, indem er keine organisierte Opposition duldete und eine Vielzahl von politischen Blättern verbieten ließ. Seine Gegner gaben sich duldsamer, seit er sie mit einem umfassenden Netz von Spionen überwachen ließ. Bonaparte sicherte seine Macht ebenso schrittweise wie planmäßig, nicht ohne diese auch wie in den Jahren 1800, 1802 (Konsul auf Lebenszeit) und 1804 durch Volksabstimmungen bestätigen zu lassen, um seine Herrschaft plebiszitär abzusichern. Die Konsulatsverfassung bildete hierbei das 14 Rüdiger Schmidt © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators Fundament und das Sprungbrett zur Erreichung der uneingeschränkten Herrschaft, für die es nur noch des Senatsbeschlusses vom 18. Mai 1804 bedurfte, um diese durchzusetzen.12 Mit der Annahme des Kaisertitels »durch die Gnade Gottes und die Verfassung der Republik« hatte Bonaparte, der sich erst nach der Proklamation des Erbkaisertums Napoleon nannte, am 2. Dezember 1804 ein »Volkskaisertum« etabliert, das von nicht wenigen Zeitgenossen als Verrat an der Revolution gebrandmarkt wurde.13 Auf eigentümliche Weise waren in seiner Herrschaft von jetzt an Revolution, Reform und Tradition miteinander verschmolzen.14 Dabei war die quasi-charismatische Herrschaft Napoleons traditional und modern zugleich: Traditional, weil sie ihren aus einer Notsituation heraus geborenen diktatorischen Impuls seit 1804 in traditioneller Form zu veralltäglichen suchte. Modern, weil sie ihre Kommunikations- und Darstellungsformen dabei fortwährend und eklektisch aktualisierte.15 Da Napoleons Herrschaft unter dem Defizit der Legitimität litt, blieb er auf innen- wie außenpolitische Erfolge fortwährend angewiesen, um in seiner Rolle als Held und Retter der französischen Nation nicht in Frage gestellt zu werden. »Ihr Könige, die ihr auf dem Thron geboren seid, könnt besiegt von ihm herabsteigen«, bemerkte er zu Metternich, »aber ich muß, um mich auf dem Thron zu behaupten, immer wieder Siege erringen«.16 Die sozialen Voraussetzungen der napoleonischen Herrschaft blieben darum beständig gefährdet, weil er zum einen mit der Negation liberal-demokratischer Verfassungsprinzipien die revolutionäre Kontinuität gebrochen hatte, zum anderen als Kaiser über keine monarchische Tradition verfügte und darüber hinaus die Distanz zum Ancien Régime wahren musste. Sein Ziel war darum die ständige »Arbeit am Mythos« im Sinne einer Heroisierung der Gegenwart, die darauf angelegt war, die fehlende Vergangenheit zu kompensieren.17 So rasant Napoleon die Macht an sich gerissen, innenpolitisch konsolidiert und behauptet hatte, so eindrucksvoll waren seine militärischen Erfolge, mit denen er nicht weniger bezweckte als die Neuordnung Europas. Nach dem Frieden von Tilsit (1807), der den vierten Koalitionskrieg beendete, befand er sich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Der Krieg selbst schreckte ihn nicht: »Habe dieser seine Gefahren, so der Friede nicht minder«.18 Die ersten Niederlagen beeindruckten ihn wenig. Denn »ich fühle mich«, sagte er vor dem Waffengang nach Moskau, »nach einem Ziel hingetrieben, das ich nicht kenne. Wenn ich es erreicht haben werde, wird ein Atom genügen, mich niederzuwerfen. Bis dahin vermögen alle Anstrengungen der Menschen nichts gegen mich«.19 Doch der Russlandfeldzug (1812) wurde zum Menetekel und endete mit dem Untergang der Großen Armee. Der junge Kriegsgott von 1796 hatte die Initiative des Handelns verloren. »Sehen Sie«, sagte er zu Maret, »so ist der Krieg. Am Morgen Sieger, am Abend besiegt. Vom Triumph zum Fall ist [es] oft nur ein Schritt«.20 Bei seiner Abdankung war er Mitte vierzig und hatte noch sieben Jahre zu leben. Napoleon Bonaparte © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 15 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators Restauration, »Verbannung und Verklärung«21 Es wundert nicht, dass die Gesellschaft, in die Ludwig XVIII. im Jahr 1814 aus dem Exil zurückkehrte, nach wie vor die Gesellschaft Napoleons war und in vielerlei Hinsicht übrigens auch blieb.22 Es war nicht der Thron Ludwigs XVI., sondern der Thron des Kaisers, auf den sich der Bourbone niedergelassen hatte.23 So sehr sich die Restauration als »Gegen-Ort« der Revolution verstand, so wenig war es den politischen Eliten möglich, bruchlos an die bourbonische Monarchie des Ancien Régime anzuknüpfen.24 Ihre Kraft bezog die Restauration darum zunächst auch weniger aus dem, wofür sie war, sondern aus dem, wogegen sie sich richtete. König Ludwig XVIII., das war eher der Roi Inévitable – der Unvermeidliche – , nach seinem Intellekt und Habitus mitnichten die geeignete Person, um mit der – wenngleich durch die Niederlage vor Moskau in Mitleidenschaft gezogenen – Strahlkraft eines Napoleon rivalisieren zu können.25 Am Anfang der Restauration stand Napoleon auch deshalb, weil er ihrem Anfang sogleich ein vorläufiges Ende machte.26 Auf die Episode der ersten Restauration folgte die Episode der »hundert Tage«. Mit 1100 Getreuen, die ihm ins Exil gefolgt waren, hatte Napoleon seinen Verbannungsort auf Elba verlassen, landete am 1. März 1815 in Antibes an der französischen Südküste und marschierte unter den Triumphrufen des Volkes nach Paris. Was Chateaubriand nach der Rückeroberung Frankreichs und der Franzosen »die Invasion eines Landes durch einen Mann« nannte, diese Phase des letzten Aufflackerns seiner Macht, sollte Napoleon später als die schönste Zeit seines Lebens bezeichnen. Zuerst brachte er die Armee, dann das Volk auf seine Seite. Er war nur noch vierzig Stunden von Paris entfernt, als die letzte königliche Garde Hals über Kopf zur Flucht aufbrach. Ohne dass ein Schuss gefallen war, zog der Kaiser am 20. März wieder in die Hauptstadt ein, aus der Ludwig XVIII. tags zuvor überstürzt an die französische Küste entkommen war. Napoleon sagte: »Sie haben mich kommen lassen, wie sie den anderen gehen ließen«.27 Der Kaiser ließ eine neue Verfassung entwerfen. Den europäischen Mächten wollte er demonstrieren, dass sich seine politischen Ambitionen auf Frankreich richteten, den Franzosen zeigen, dass er seinem autokratischem Stil entsagt hatte. Doch die Rolle des konstitutionellen Kaisers lag ihm nicht, sie schwächte ihn auch, er fand sich nicht mehr in der gewohnten Rolle: »Man kettet mich an, Frankreich sucht mich und findet mich nicht mehr«, klagte er gegenüber Constant.28 Für ein Verfassungsplebiszit, das ihm schließlich eine auffallend hohe Zahl von Stimmenthaltungen einbrachte, hätte er den Sprung von Elba auf das Festland nicht zu wagen brauchen. Das Bürgertum hatte ihm bei der Wahl sein deutliches Misstrauen zum Ausdruck gebracht; die Woge der Begeisterung, die Napoleon von der südfranzösischen Küste bis nach Paris getragen hatte, war jedenfalls dahin. Und in der Vendée, im Südwesten und Süden des Landes brachen royalistische Aufstände los, die für geraume Zeit 16 Rüdiger Schmidt © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators wichtige Truppenteile binden würden, die ihm bei seinem Feldzug gegen die Alliierten fehlten. Die europäischen Mächte waren jedenfalls entschlossen, Napoleon Einhalt zu gebieten. Kaum hatte die Nachricht von seiner Rückkehr den Wiener Kongress alarmiert, erklärten die Alliierten ihn für geächtet (13. März 1815) und begannen ihre Truppen zu mobilisieren. Napoleon ergriff die Initiative. Mit einer Armee von 125.000 Mann marschierte er in Belgien den Armeen Blüchers und Wellingtons entgegen, schob sich zwischen die Heere der Gegnerkoalition, die er einzeln nacheinander zu schlagen suchte. Am 16. Juni besiegte er Blücher bei Ligny, doch gelang es ihm nicht, dessen Armee zu vernichten. Es war Napoleons letzter Sieg. Zwei Tage später, am 18. Juni 1815, wurde er bei Waterloo entscheidend geschlagen. Selbst die Alte Garde des Feldherrn, auf die er seine ganze Hoffnung gesetzt hatte, zeigte sich nicht mehr in der Lage, eine schlachtentscheidende Wende zugunsten Napoleons herbeizuführen. Sie wurde von preußischen Truppen zusammengeschossen, nachdem Blücher am Abend der Armee Wellingtons zur Hilfe geeilt war und so die Schlacht entschied. Es war Napoleons letzte Bataille und zum ersten Mal musste er den Anblick seines fliehenden Heeres ertragen. »Die Leute von 1815 waren nicht mehr die von 1792«, sollte er später auf Sankt Helena sagen.29 Es gelang Napoleon nur knapp, sich der Gefangennahme zu entziehen. Er hatte – wie schon in Ägypten, wie auch in Russland – die Reste seines Heeres im Stich gelassen; am Morgen des 21. Juni betrat er wieder das ÉlyséeSchloss. Doch in Paris – so Napoleons Biograf Fournier – hatte man »einen Erfolg des Kriegsfürsten fast ebenso sehr [befürchtet] wie eine Schlappe des Heeres, das er befehligte. Nicht bloß, weil er, siegreich, wieder der alte unumschränkte Herrscher werden […] konnte, sondern weil der Krieg damit erst recht begann und wer weiß wann endete«.30 Es waren nur noch die Arbeiter aus der Faubourg St. Antoine, die ihn hochleben ließen, sie umdrängten den Palast und riefen nach der Diktatur. Tatsächlich kam er zu dem Schluss, er bedürfe diktatorischer Vollmachten, »um das Vaterland zu retten«. Es wäre zudem der Nation würdiger (plus nationale) und nützlicher, wenn sie ihm von der Kammer der Deputierten übertragen würde.31 Doch wusste im Grunde jedermann, nicht zuletzt auch der Kaiser selbst, dass sein Einfluss geschwunden war. »Der Respekt vor mir war groß«, äußerte er später, solange ich gefürchtet war. Aber […] als Besiegter – da hatte ich nichts zu erhoffen«.32 Napoleon spielte auf Zeitgewinn, doch es war aussichtslos, zumal die Truppenverbände der siegreichen Verbündeten auf Paris vorrückten und bereits abzusehen war, dass dann eben die Alliierten jene Entscheidung herbeiführen würden, die jetzt – jedenfalls formell – noch eine Angelegenheit der französischen Politik war.33 Die liberale Mehrheit der Abgeordnetenkammer verlangte die Abdankung des Kaisers, am Nachmittag des 22. Juni 1815 gab Napoleon dem Drängen nach und trat zurück. Napoleon Bonaparte © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 17 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators Eine Woche verbrachte er noch in Malmaison, wo er einst mit Joséphine, die hier Ende Mai 1814 verstorben war, eine glückliche Zeit verbracht hatte. Am 29. Juni verließ er das Schloss im Frack eines Bürgers, um sich nach Rochefort zu begeben, wo zwei Fregatten warteten, um ihn nach Amerika zu bringen. An eine Überfahrt war jedoch nicht zu denken, da ein britischer Kreuzer – die »Bellerophone« – die Ausfahrt blockierte. Mitte Juli fügte sich Napoleon schließlich in sein Schicksal und begab sich an Bord des feindlichen Schiffes. Erst im Hafen von Plymouth erfuhr er von der Entscheidung der britischen Regierung, ihn auf eine Insel im Südatlantik, gut 1800 Kilometer von der afrikanischen Küste entfernt, zu verbannen. »Sankt Helena, das ist mein Todesurteil«, soll er gesagt haben.34 »Wie in einem doppelten Kursus mittelalterlicher Epen« schien Napoleon »zweimal seinen Weg gehen zu müssen, damit erst im zweiten Durchgang die Unabänderlichkeit des Exils bestätigt werden konnte.«35 Am 7. August begab sich Napoleon an Bord der »Northumberland«, die ihn nach Sankt Helena bringen sollte. Nach zwei Monaten auf See erreichte das britische Linienschiff die kahle Felseninsel und ging am 15. Oktober in Jamestown vor Anker. Napoleon hat diese Insel nie mehr verlassen. Er hatte die Tuilerien, Schönbrunn, den Kreml und das Schloss Élysée bewohnt. Jetzt bezog er seinen letzten Wohnsitz, Longwood House, die ehemalige Residenz des britischen Gouverneurs.36 Es begann die Periode des Erinnerns, der Reflexion und der Apologie; es ging darum jene Legende zu erschaffen, die seinen Nachruhm mehrte. »Wir werden die Geschichte der Tapferen schreiben«, hatte er gesagt, bevor er Frankreich verließ.37 Er tat mehr als das, erzählte, ja verklärte seine Geschichte in der Hoffnung, seinen unsterblichen Ruhm zu festigen und behauptete, mehr und mehr werde er seiner »Tyrannenhaut entkleidet«.38 Er wusste, dass seine Äußerungen vom Grafen Las Cases sowie den Generalen Bertrand, Gourgaud und Montholon – sie zählten zur Entourage, die Napoleon ins Exil gefolgt war – protokolliert wurden, alle vier führten ein Tagebuch. Schon während der Überfahrt hatte Napoleon mit den Diktaten begonnen, auf Sankt Helena diktierte er Las Cases einen Teil seiner Mémoires. Der Graf veröffentlichte 1823 das bekannte Mémorial de Sainte Helene in acht Bänden, das sich auf den Zeitraum vom 20. Juni 1815 bis zum 25. November 1816 erstreckt und erzielte damit einen beträchtlichen Erfolg.39 Das Mémorial, darüber hinaus die Cahiers des Generals Bertrand stellen die Beweisstücke einer Legendenbildung dar, die in ihren Umrissen schon vorher existierte, vor allem aber Napoleons Fähigkeit zur Selbstinszenierung erneut unter Beweis stellte: »Ich habe den Abgrund der Anarchie wieder geschlossen und das Chaos geordnet. Ich habe die Revolution entsühnt, die Völker geläutert […] Ich habe jeden möglichen Wetteifer entfacht, alle Verdienste belohnt und die Grenzen des Ruhmes weitergesteckt«.40 Napoleon stilisierte sich zum großen Europäer, der dem Kontinent die Errungenschaften der Revolution gebracht und ihn so neu geordnet habe.41 Auch das »Martyrium« von Sankt Helena war 18 Rüdiger Schmidt © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators Abb. 1: Napoleon auf Sankt Helena (zeitgenössischer französischer Stich). Napoleon Bonaparte © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 19 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators Teil seiner Selbstinszenierung, wobei es nur noch eines gedanklichen Schritts bedurfte, um das Schicksal Napoleons mit dem Kreuzestod Christi in eine direkte Beziehung zu setzen.42 Als man ihm 1817 einen Fluchtplan vorschlug, lehnte er diesen mit der denkwürdigen Begründung ab, dass er »noch fünfzehn Jahre zu leben [habe], weshalb das alles sehr verführerisch [sei]. Aber es ist eine Narretei, denn ich muss hier sterben oder Frankreich kommt, mich hier zu suchen. Wenn Jesus Christus nicht am Kreuz gestorben wäre, würde er nicht als Gott gelten«.43 Während der ersten Monate seiner Gefangenschaft auf Sankt Helena erfreute sich Napoleon einer hinlänglich guten Gesundheit, wenngleich er in Folge der erzwungenen Untätigkeit an Leibesfülle zunahm.44 »So wenig man ißt«, hatte er einst betont, »man ißt doch immer zuviel. Vom Zuvielessen kann man krank werden, vom Gegenteil nie«.45 Doch üppige Mahlzeiten, die ihm früher nichts bedeuteten, halfen ihm jetzt, der täglich erlittenen Eintönigkeit und Langeweile zu begegnen. Schon Ende der Dreißig hatte Napoleon die ersten Anzeichen eines Magenleidens gespürt, von Zeit zu Zeit fühlte er sich in den letzten Kriegsjahren von Magenkrämpfen beeinträchtigt. Seit dem Herbst 1817 begann sich sein Zustand zu verschlimmern, die Gesundheitsbulletins klangen immer alarmierender. Am 27. Oktober 1817 teilte Bertrand dem Gouverneur mit: »Seit einem Monat, da ich die Ehre hatte, Ihnen letztmals zu schreiben, hat sich die Gesundheit des Kaisers erheblich verschlechtert«.46 Berichten seines Arztes O’Mearas zufolge litt Napoleon an chronischer Hepatitis, die der Mediziner auf das ungesunde Klima zurückführte; zudem klage der Patient über zunehmende Appetitlosigkeit, Schlafstörungen und eine Schwellung der Beine. O’Mearas, der das Vertrauen des britischen Gouverneurs Hudson Lowe verloren hatte, wurde auf dessen Veranlassung abgelöst; der Rat anderer hinzugezogener Ärzte wurde von Napoleon indessen verschmäht. Im September 1819 übernahm Francesco Antommarchi, ein junger Chirurg korsischer Herkunft die Betreuung des Patienten. Ihm gelang es, Napoleon zu einer Änderung seiner Lebensweise zu bewegen, Ausflüge zu Pferde zu unternehmen und im Garten zu arbeiten. Doch nur kurzfristig hatten die Tätigkeiten im Freien Napoleons Zustand gebessert, trotz der ihm auferlegten Körperdisziplin verschlechterte sich sein Zustand von Tag zu Tag. Die körperliche Anstrengung erschöpfte ihn, stichartige Schmerzen und Übelkeit setzten ihm zu, immer häufiger musste er er das Bett hüten. In der Silvesternacht 1820 erzählte er zum letzten Mal aus vergangenen Zeiten, danach nahm seine Krankheit einen raschen Verlauf.47 Gegenüber Bertrand bemerkte er am 11. Februar 1821: »Ich werde dieses Jahr nicht überleben, auf keinen Fall aber das kommende«.48 Eine letzte Spazierfahrt unternahm er Mitte März 1821, um hernach in einen Zustand völliger Erschöpfung zu fallen. Die Nahrung, die er noch zu sich nehmen konnte, beschränkte sich auf wenige Bissen, die er nur mit größter Mühe schlucken konnte und zumeist sogleich wieder erbrach. Bertrand vertraute er an, dass es für ihn ein Glück wäre, wenn sein Leben jetzt enden würde: 20 Rüdiger Schmidt © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators »Ich möchte sterben. Ich fürchte den Tod nicht. Für mich wäre es ein großes Glück, binnen vierzehn Tagen tot zu sein. Was kann ich mir noch erhoffen? Möglicherweise doch nur ein noch elenderes Ende. Das einzige, was ich fürchte, ist, dass die Engländer meinen Leichnam behalten wollen und ihn in Westminster beisetzen. Man muss sie dazu zwingen, dass sie ihn an Frankreich übergeben […] Nachdem sie mich ermordet haben, ist es das Mindeste, dass sie meine sterbliche Hülle nach Frankreich, dem einzigen Vaterland, das ich geliebt habe und wo ich bestattet zu werden wünsche, überführen«.49 Am 15. April diktierte er Montholon sein Testament, worin er seinen persönlichen Besitz unter seine getreuesten Anhänger verteilte und Anweisungen zu seiner Beisetzung formulierte: »Ich wünsche, dass meine Asche an den Ufern der Seine ruht, inmitten des französischen Volkes, das ich so sehr geliebt habe«. Am 30. April begann sich sein Bewusstein zu verwirren, er fiel ins Koma, aus dem er nur noch für kurze Momente erwachte. Am 5. Mai 1821, kurz vor achtzehn Uhr, starb Napoleon. Draußen fegte ein heftiger Sturm über die Insel, der auch jenen Weidenbaum entwurzelte, unter dem er so gern gesessen hatte. Marchand bedeckte den Leichnam mit dem grauen Mantel, den der Erste Konsul Napoleon in der Schlacht von Marengo getragen hatte. Die Sektion des Leichnams ergab, dass der Magen des Kaisers von einem Krebsgeschwür befallen war, ein Befund, an dem auch Napoleons Vater gestorben war.50 Nach der Autopsie wurde der Körper einbalsamiert, in die grüne Jägeruniform der Chasseurs de la Garde eingekleidet und auf Napoleons eisernen Feldbett aufgebahrt. Der britische Gouverneur Hudson Lowe hatte verfügt, dass Napoleon entgegen dessen letzten Wunsch auf Sankt Helena beigesetzt werden sollte. Eine Überführung des toten Kaisers nach Europa hätte dort nicht weniger Aufsehen erregt als die Ankunft des lebendigen.51 Am 10. Mai 1821 wurde Napoleon zu Grabe getragen, auf dem Deckel des Mahagonisarges lagen der Mantel von Marengo, Napoleons Degen und ein Kruzifix. Soldaten der Garnison gaben ihm das Geleit, dem Sarg folgten die Begleiter und die Dienerschaft Napoleons, Sir Hudson Lowe und der Kommissar der französischen Regierung. Als man den Sarg in die Grube senkte, feuerten die Kanonen des britischen Admiralschiffs vor Jamestown Salut.52 Der Retour des Cendres Die Idee, Napoleons sterbliche Überreste nach Paris zurückzuholen, geht auf dessen eigenes Vermächtnis zurück.53 An eine Rückführung des Leichnams war vor 1830 indes nicht zu denken. Aber auch nach der Julirevolution, die den französischen König Karl X. zur Abdankung und Flucht nach England zwang, wurde zunächst alles getan, um dieses Thema weitgehend aus der öffentlichen Napoleon Bonaparte © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 21 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators Diskussion herauszuhalten. Behutsam wurde daneben aber auch der Napoleonkult kanalisiert und so etwa die über vierzig Meter hohe Vendôme-Säule 1833 erneut mit der bronzenen Statue des Kaisers bekrönt, wo man sie 1815 entfernt hatte.54 Als Jérôme Bonaparte, jüngster Bruder des Empereur, der kranken Mutter die Nachricht überbrachte, erhob sie sich und sagte: »Der Kaiser steht wieder mitten in Paris«.55 Vor allem von den Veteranen war diese Aktion ebenso wie die Fertigstellung des Arc de Triomphe mit lautstarker Zustimmung begrüßt worden. Nach der Schlacht von Austerlitz am 2. Dezember 1805, in der das österreichische und russische Heer auf den Tag genau ein Jahr nach der Selbstkrönung des Kaisers besiegt worden war, hatte Napoleon den Triumphbogen 1806 in Auftrag gegeben. Dreißig Jahre später war der Arc de Triomphe an der Place de L’Étoile fertiggestellt worden, um an den Ruhm des Feldherrn und der französischen Armee zu erinnern.56 Zwar wurde der Kult Bonapartes unter dem Bürgerkönig Louis Philippe vorsichtig im Sinne einer »legénde napoléonienne« gefördet, aber die offizielle Erinnerung an Napoleon blieb zwischen den politischen Lagern und Fraktionen nicht unumstritten.57 Welches Andenken sollte man bewahren, welche Vergangenheit ließ sich für Zwecke der Gegenwart aktualisieren, worüber sollte man besser schweigen? Mit der Julimonarchie verband sich die Gründungslegende, sie als Vollendung der umstürzenden Ereignisse von 1789 darzustellen. Rasch entspann sich in Folge der Revolution von 1830 jedoch ein »langer Kampf zwischen den Kräften des mouvement und der résistance«;58 und zumal die Erinnerungspolitik der Republikaner schwankte zwischen radikaler Ablehnung und einer eher emotional bestimmten Napoleon-Verehrung. Längst konnte der Kult um Napoleon nach der Abdankung Karls X. nicht mehr nur Ausdruck der Opposition gegen die Bourbonenherrschaft sein. Vielmehr bildete jener Mythos des Helden, den Napoleon schon zu Lebzeiten umgab, unter dem Eindruck heftiger politischer Auseinandersetzungen und Fraktionskämpfe die Projektionsfläche für Verheißungen, mit der man an die ruhmreiche Vergangenheit der Grande Nation anzuknüpfen versuchte. Allenthalben wurde eine Dekade nach dem Tod Napoleons dessen Wiederbelebung betrieben: Er kehrte zurück auf die Bühnen der Theater, kam in Dutzenden von Stücken auf die Bretter, darunter das Drama von Alexandre Dumas in sechs Akten, welches am 10. Januar 1831 im Odéon Theater in Paris Premiere feierte.59 Das Publikum reagierte enthusiastisch: »Wie dem aber auch sey« – so beschreibt Heinrich Heine 1837 die Reaktionen der Zuschauer – »nicht bloß die alten Bonapartisten, sondern auch die große Masse des Volks wiegt sich gern in diesen Illusionen, und die Tage des Kaiserreichs sind die Poesie dieser Leute, eine Poesie, die noch dazu Opposizion bildet gegen die Geistesnüchternheit des siegenden Bürgerstandes. Der Heroismus der imperialen Herrschaft ist der einzige, wofür die Franzosen noch empfänglich sind, und Napoleon ist der einzige Heros, an den sie noch 22 Rüdiger Schmidt © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators glauben. […] Wenn in den kleinen Vaudevillen der Boulevards Theater eine Scene aus der Kaiserzeit dargestellt wird, oder gar der Kaiser in Person auftritt, dann mag das Stück auch noch so schlecht seyn, es fehlt doch nicht an Beyfallsbezeugungen; denn die Seele der Zuschauer spielt mit, und sie applaudiren ihren eigenen Gefühlen und Erinnerungen. Da giebt es Couplets, worin Stichworte sind, die wie betäubende Kolbenschläge auf das Gehirn eines Franzosen, andere, die wie Zwiebeln auf seine Thränendrüsen wirken. Das jauchzt, das weint, das flammt bey den Worten: Aigle français, soleil d’Austerlitz, Iéna, les pyramides, la grande armée, l’honneur, la vieille garde, Napoléon […] oder wenn gar der Mann selber, l’homme, zum Vorschein kommt, am Ende des Stücks, als Deus ex machina! Er hat immer das Wünschelhütchen auf dem Kopfe und die Hände hinterm Rücken und spricht so lakonisch als möglich. Er singt nie. Ich habe nie ein Vaudeville gesehen, worin Napoleon gesungen. Alle anderen singen«.60 Wie in einer Art kollektiver Selbstvergewisserung über die Unvergänglichkeit der Grande Nation und wie um die trübe Gegenwart zu vertreiben, lebte im Theater die leidenschaftlich rezipierte Realität einer entschwundenen Epoche wieder auf. »Man sah ihn in der Tat eine Stunde lang, diesen legendären Napoleon […] Er lebte, er bewegte sich, er handelte vor ihren Augen, dieser Wundermensch, für kurze Zeit aus seiner überirdischen Sphäre in die Illusion der kümmerlichen Kulissen und eigenartigen Uniformen herabgestiegen […]«.61 Der Kaiser erschien indes nicht nur auf den Bühnen der Nation, sein Bild wurde darüber hinaus auf unzähligen Lithografien verewigt, sein Konterfei schmückte diverse Schmuckuntensilien und Gebrauchsgegengestände, man fand ihn auf Tabaksdosen, Würfelbechern und Zifferblättern.62 »Sein Bild«, so Heine, »sieht man überall, in Kupferstich und Gyps, in Metall und Holz, und in allen Situazionen«.63 Der ins Volkstümliche gewendete Napoleon erhielt Ende der 1830er Jahre auch eine literarische Hommage, als Paul-Matthieu Laurent de l’Ardeches’ »Histoire de l’Empereur Napoléon« erschienen war, ein im Grunde eher durchschnittliches Werk, das – wie so oft – auf eine Stilisierung des Helden zielte. Dem Buch war durch die beigefügten Illustrationen von Horace Vernet rasch eine große Popularität beschieden, was seinen Grund darin hatte, dass der tote Kaiser dem Leser in Wort und Bild gewissermaßen anekdotisch reduziert präsentiert wurde.64 Die teils politisch inspirierte, teils auch ins Sentimentale umschlagende Verehrung, die Napoleon aus allen Kreisen der Bevölkerung entgegenschlug, schien jedenfalls kaum Grenzen zu kennen. Stendhal, der als junger Offizier am Italienfeldzug teilgenommen hatte, später zum kaiserlichen Kriegskommissar avanciert war und Napoleon einst dafür gebrandmarkt hatte, dass dieser »den eigenen Despotismus hinter dem Kult des Ruhms zu verbergen« wisse, feierte ihn 1837 als »den größten Menschen, den die Welt seit Cäsar sah«.65 Schon zu Napoleons Lebzeiten verschwamm der »Roman« seines Lebens mit der Realität und sollte der Gegenwart Geltung und Sinn verleihen.66 Nach seinem Tod – so schien es – entwickelte sich die Napoleon Bonaparte © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 23 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators Person des Kaisers umso mehr zum Mythos, der die unerfüllten Sehnsüchte der Gegenwart auf eine große Vergangenheit projizierte. Seit der Julirevolution waren mehr als dreißig Petitionen an die französische Abgeordnetenkammer gelangt, in denen um die Überführung des Leichnams Napoleons nachgesucht wurde.67 Dass man schließlich erst 1840 ernsthaft erwogen hatte, die sterblichen Überreste des Kaisers nach Paris zu überführen, war der innen- und außenpolitischen Krise geschuldet, in die sich die französische Politik hineinmanövriert hatte. Im Frühjahr und Sommer des Jahres rückte die Orientkrise ins Zentrum der europäischen Politik, als Großbritannien, Österreich, Preußen und Rußland eine Schwächung des Osmanischen Reiches nicht hinzunehmen bereit waren und zur Befriedung der Levante im Juli 1840 den Londoner Vertrag geschlossen hatten, der eine gemeinsame Politik zugunsten des türkischen Sultans vorsah und sich dabei gegen den ägyptischen Potentaten Muhammad Ali Pascha richtete. Frankreichs Ministerpräsident Thiers hatte indes zugunsten der Separationsbestrebungen Kairos Partei ergriffen. Als es zur Landung alliierter Truppen in Syrien und zur Beschießung Beiruts durch die englische Flotte kam, nahm der drohende Krieg die Züge einer Probe auf den nationalen Selbstbehauptungswillen der französischen Nation an, zumal die Wiederbelebung der Koalition von 1814 die französische Öffentlichkeit auf das Höchste erregt hatte.68 Die Demütigung, die Frankreich im Zuge der Orientkrise erfahren musste, weckte das Bedürfnis nach Kompensation, endete zuletzt aber mit dem Rücktritt des französischen Ministerpräsidenten. Um unter dem Eindruck der angespannten außenpolitischen Situation Frankreichs während der Orientkrise die Einheit der Nation zu demonstrieren und um die ungebrochene Popularität Napoleons für Zwecke der innenpolitischen Konsolidierung zu nutzen, hatte Adolphe Thiers allerdings schon im Frühjahr des Jahres 1840 in geheimen Verhandlungen mit der britischen Regierung den Retour des Cendres in die Wege geleitet. Als der französische Innenminister Charles de Rémusat am 12. Mai den Abgeordneten der Assemblée Nationale verkündete, dass die Regierung die Rückführung der sterblichen Überreste Napoleons beschlossen habe, kam dies einer Sensation gleich: »Le roi a ordonné à S. A. R. Monseigneur le prince de Joinville de se rendre avec sa frégatte à l’île Sainte-Hélène pour y recueillir les restes mortels de l’Empereur Napoléon«.69 Der Leichnam des Kaisers werde von Sankt Helena nach Paris überführt, würdevoll bestattet werden und dort für immer ruhen: »Une cérémonie solennelle, une grande pompe religieuse et militaire inauguera le tombeau, qui doit les garder à jamais«.70 Zwar entspann sich eine längere und eher fadenscheinig geführte Debatte darüber, wo die sterblichen Überreste Napoleons beigesetzt werden sollten. Tatsächlich – urteilt beispielsweise Klaus Deinet – ging es jedoch »letztlich um die Frage, ob Frankreich bereits reif sei für eine so direkte Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit«.71 Jedenfalls der Neffe und selbst ernannte Erbe 24 Rüdiger Schmidt © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 Thomas Großbölting / Rüdiger Schmidt, Der Tod des Diktators des Kaisers, Louis Napoléon, verband mit der Idée napoléonienne ganz andere Ziele als die Absicht, mit der Beisetzung des Empereur auch dessen Mythos zu beerdigen.72: »Es gilt nicht nur die sterblichen Reste, sondern die Ideen des Kaisers zurückzuholen«.73 Doch an welchem Ort sollte Napoleon bestattet werden? Eine Begräbnisstätte unter der Vendôme-Säule konnte kaum in Frage kommen, wollte man nicht einen öffentlich zugänglichen Ort schaffen, bei dem möglicherweise die Gefahr bestand, dass er sich zur Weihestätte einer ungesteuerten Verehrung entwickeln könnte. Eine Grablegung in der Abtei von Saint-Denis, mithin am traditionellen Bestattungsort der französischen Könige, mochte man zum einen nicht in Erwägung ziehen, weil diese Stätte während der Französischen Revolution geschändet worden war. Mit der Exhumierung der Leichname der französischen Könige hatten die Revolutionäre einst beabsichtigt, diese auch dem kollektiven Gedächtnis bzw. dem an einen Ort gebundenen öffentlichen Gedenken zu entziehen.74 Zum anderen schien eine demonstrativ in Szene gesetzte Integration Napoleons in das monarchische Frankreich innenpolitisch kaum durchsetzbar zu sein und es musste darüber hinaus auch für die europäischen Fürstenhäuser wie eine Provokation wirken, wenn dem toten Empereur nachträglich jene dynastische Legitimität zuteil geworden wäre, die er sich – wenngleich vergeblich – durch die Heirat mit Marie Louise 1810 erhofft hatte. Dass Napoleon seine Rechtmäßigkeit wesentlich aus einem »Verdienstkaisertum« bezogen hatte, was insbesondere dem Bürgertum imponierte, da der Herrscher als ein durch Taten ausgewiesener Held nicht auf die Legitimität einer Ahnenreihe angewiesen war, schien letztlich auch dagegen zu sprechen, ihn in Saint-Denis beizusetzen.75 Die nationale Ruhmeshalle des Pantheon auf der Montagne Sainte-Geneviève wäre für eine Beisetzung Napoleons dagegen in mancherlei Hinsicht in Frage gekommen, zumal hier auch die großen Philosophen der Aufklärung Rousseu und Voltaire oder die Märtyrer der Revolution – wenngleich zum Teil nur kurzfristig – ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten. Aber mit einer Pantheoniserung Napoleons als Heros unter Heroen wäre letztlich die Einzigartigkeit des Imperators relativiert worden, so dass schließlich doch nach einer Lösung »à Napoléon seul« gesucht werden musste. Schließlich hatte man den zwischen 1679 und 1708 erbauten, von König Ludwig XIV. einst zur Aufnahme und Versorgung von versehrten Kriegsveteranen in Auftrag gegebenen Invalidenkomplex als letzte Ruhestätte Napoleons bestimmt. Diese Entscheidung trug zum einen dem Wunsch Napoleons Rechnung, an den Ufern der Seine begraben zu werden, zum anderen schien die sich mit dem Invalidenkomplex verbindende militärische Tradition und Symbolik am ehesten geeignet, den toten Kaiser als Empereur und militärischen Helden zu ehren. Dass das Hôtel des Invalides dereinst im Auftrag Ludwigs XIV. erbaut worden war, trug in mancherlei Hinsicht zusätzlich zur Erhöhung Napoleons bei, wurde er so doch in die Nähe des Sonnenkönigs gerückt. Napoleon Bonaparte © 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 978-3-525-30009-1 25