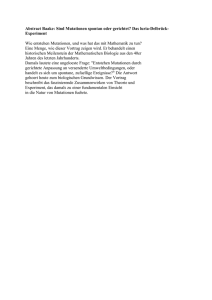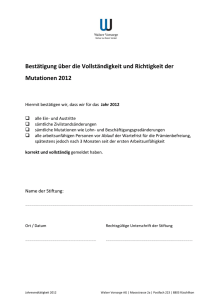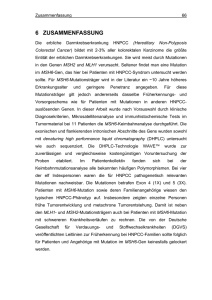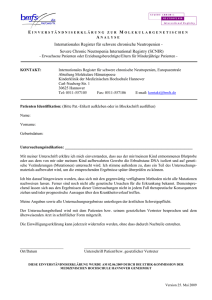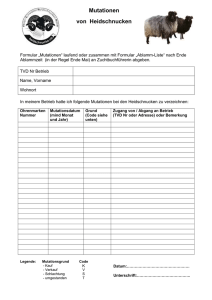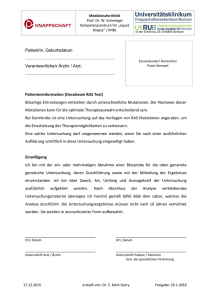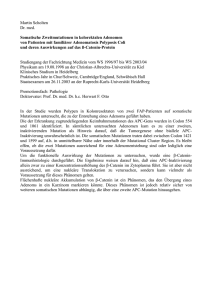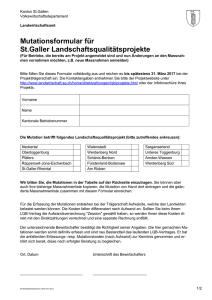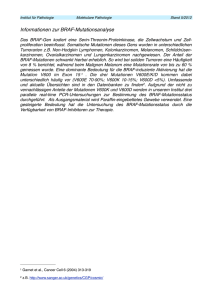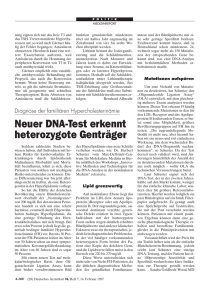Zusammenfassung der Vorträge - Lipid-Liga
Werbung

Zusammenfassung der Vorträge Therapie bei schwerer Hypertriglyzeridämie Symposium am 11. Dezember 2015 in Radebeul Veranstalter Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen DGFF (Lipid-Liga) e.V. Vorträge Therapiekonzepte bei schwerer Hypertriglyzeridämie Prof. Dr. Hans-Ulrich Klör, Kassel Genetische Ursachen schwerer Hypertriglyzeridämien – LipoproteinLipase & Co. PD Dr. Michael Hoffmann, Freiburg Entwicklung der LPL-Gentherapie Dr. Harald Petry, UniQure Amsterdam Prof. Dr. Hans-Ulrich Klör MEDIKUM Kassel Kurfürstenstraße 10–12 34117 Kassel E-Mail: [email protected] Therapiekonzepte bei schwerer Hypertrigylzeridämie • • • Eine Hypertriglyzeridämie liegt bei Triglyzeridwerten ≥ 400 mg/dl vor Die Ernährungstherapie zielt vor allem auf den Austausch von langkettigen Fettsäuren gegen MCT-Fette sowie die Gabe von Omega-3Fettsäuren (EPA/DHA) ab Die Ernährungstherapie kann mit Ezetimib oder Fibraten kombiniert werden Die schwere Hypertriglyzeridämie (SHTG) ist eine Fettstoffwechselstörung, die durch stark erhöhte Trigylzeridkonzentrationen im Plasma (TG ≥ 1000 mg/dl) gekennzeichnet ist. Eine signifikante Hypertriglyzeridämie liegt bereits ab TG-Werten ≥ 400 mg/dl vor. In der Praxis wird sie nur selten erkannt und Schätzungen zufolge erhalten weniger als 3 Prozent der betroffenen Patienten eine adäquate Therapie. Deutlich erhöhte Triglyzeridkonzentrationen ≥ 500 mg/dl weisen in den USA 2,5 Mio. Menschen auf (NHANES-Studie 1999 bis 2008). In Deutschland sind schätzungsweise bei etwa 700.000 Menschen die TG-Konzentrationen auf ≥ 400 mg/dl erhöht, 35.000 Personen erreichen Werte von zum Teil weit über 1000 mg/dl. Die gehäufte Prävalenz der Erkrankung in bestimmten Regionen deutet darauf hin, dass die Erkrankung vor allem genetisch bedingt ist. Körpergewicht, Alkohol- und Tabakkonsum erhöhen das Risiko für die Erkrankung dagegen in geringerem Umfang. Das Hauptsymptom der SHTG ist die Pankreatitis (bis zu 350-fach erhöhtes Risiko im Vergleich zu Gesunden), die zu einer Zerstörung der Inselzellen des Pankreas führt. Zu den Komorbiditäten zählt daher auch der Diabetes mellitus Typ 2. Auch das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen ist erhöht. Diätetische Therapiemaßnahmen zielen hauptsächlich auf eine Modulation des Fettsäuremusters ab. Neben der Reduktion von langkettigen Fettsäuren ist die Zufuhr von MCT-Fetten zu erhöhen, die direkt über die Portalvene in die Leber aufgenommen werden. Omega-3-Fettsäureethylester werden bei einer SHTG in einer Dosierung von 4 g EPA/DHA pro Tag empfohlen. Eine Umstellung der Ernährung ist vor allem in Kombination mit Ezetimib, das die Cholesterin-Resorption in den Enterozyten hemmt, erfolgreich. Auch Fibrate kommen zum Einsatz. Im Gegensatz dazu verfehlen Statine bei SHTG-Patienten ihre Wirkung. Im akuten Stadium ist eine Apherese durchzuführen. Neuartige Ansätze in der Therapie der SHTG betreffen u.a. das Apolipoprotein CIII, eine Komponente des VLDL (very low density lipoprotein), das die Spaltung der Triglyzeride unterbindet. Lomitapid, ein neu zugelassenes Oligonucleotid, senkt den Plasma-Triglyzeridspiegel, indem es selektiv das mikrosomale Triglyzerid-Transfer- Protein (MTP) hemmt, das für den Transport von Lipidmolekülen verantwortlich ist. Auch eine neue LPL-Gentherapie mit Alipogentiparvovec sieht erfolgversprechend aus. PD Dr. Michael Hoffmann Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin Universitätsklinikum Freiburg Hugstetterstraße 55 79106 Freiburg E-Mail: [email protected] Genetische Ursachen schwerer Hypertriglyzeridämien Lipoprotein-Lipase & Co • • • Mutationen der Lipoprotein-Lipase stehen an erster Stelle Weitere Mutationen, z. B. der Apolipoproteine CII, AV, sind bekannt Nur 5 bis 10 Prozent der schweren Hypertriglyzeridämien lassen sich durch funktionelle Mutationen in einem Gen erklären Die Genetik isolierter schwerer Hypertriglyzeridämien ist sehr vielfältig. Als häufigste Ursache gelten Mutationen der Lipoprotein-Lipase (LPL). LPL dient als Katalysator bei der Aufspaltung von Triglyzeriden aus Lipoproteinen. Beim Menschen sind bisher über 150 verschiedene Mutationen der LPL bekannt, die zu einer Deletion oder Inaktivierung führen. Darüber hinaus gibt es verschiedene genetische Polymorphismen (SNPs). Diese können sowohl zu einer erniedrigten (z.B. Mutationen D9N, N291S) als auch erhöhten (Mutation S447Ter) LPL-Aktivität führen. Neben LPL gibt es weitere Kandidaten für Mutationen: Apolipoprotein CII wird in der Leber und im Darm exprimiert und ist mit VLDL, HDL und Chylomikronen assoziiert. Bei ApoCII-Mutationen bildet sich der Phänotyp nur bei einem Defizit an ApoCII aus, während heterozygote Träger unauffällig sind. Apolipoprotein CIII ist für die Aufnahme von triglyzeridreichen Lipoproteinen verantwortlich. Verschiedene SNPs sind mit erhöhten Triglyzerid-Spiegeln assoziiert. Apolipoprotein AV ist ein sehr polymorphes Gen mit über 40 SNPs, wobei verschiedene Haplotypen mit hohen Triglyzerid-Werten assoziiert sind. Ein Defekt im ApoAV-Gen benötigt in der Regel ein weiteres Ereignis zur Ausprägung einer Hypertriglyzeridämie. Glycosylphosphatidylinositol-anchored high-density lipoprotein-binding protein 1 (GPIHBP1) ist verantwortlich für den Transport von LPL durch die Endothelzellen. Bei einer homozygoten Mutation wird die Bindung von LPL an den Rezeptor verhindert. Ein Phänotyp ist bei heterozygoten Trägern nicht bekannt. Lipase Maturation Factor 1 (LMF1) bindet im Endoplasmatischen Reticulum an Lipasen und stabilisiert die Dimerbildung. Zwei funktionelle Mutationen (Y439X und W464X) in Patienten mit schwerer HTG sind beschrieben. Heterozygote Träger des LMF1 bilden keinen Phänotyp aus. Cyclic AMP-responsive element–binding protein H (CREB-H) ist vielfältig an der Regulation des Triglyzerid-Stoffwechsels beteiligt. Es ist das einzige Gen mit dominanter Ausprägung der Mutationen, allerdings mit unvollständiger Penetranz. Insgesamt lassen sich nur 5 bis 10 Prozent aller schweren Hypertriglyzeridämien (SHTG) durch funktionelle Mutationen in den genannten Genen erklären. Für alle anderen SHTG kommen additive Effekte von Genvarianten mit geringem Effekt in Frage sowie andere, bisher unbekannte Gene. Eine weitere Erklärung könnte in fehlgesteuerten Regulationen, wie beispielsweise einer Methylierung des Promotors, liegen. Dr. Harald Petry UniQure N.V. Meibergdreef 61 1105 BA Amsterdam, Niederlande E-Mail: [email protected] Entwicklung der LPL-Gentherapie • • • Alipogentiparvovec ist die erste in der westlichen Welt zugelassene Gentherapie Mittels eines viralen Vektors wird das LPL-Gen S447X übertragen Eine einzige intramuskuläre Anwendung führt zur langfristigen Produktion des LPL-Proteins Alipogentiparvovec (Glybera®) ist eine neuartige Gentherapie, die bei Patienten mit Lipoproteinlipase-Defizienz (LPLD) die Inzidenz und den Schweregrad der Pankreatitis langfristig reduziert. Es ist das erste in der westlichen Welt zugelassene Gentherapeutikum und hat sich zur Behandlung von LPLD, für die keine andere Therapie verfügbar ist, als wirksam erwiesen. Alipogentiparvovec gilt als OrphanArzneimittel, mit dem im September 2015 der erste Patient damit behandelt wurde. Der Durchbruch in der Entwicklung dieser Terapie gelang durch die Übertragung des LPL- Gens (S447X; dies ist eine natürlich vorkommende LPL-Variante mit Funktionszugewinn) mittels eines viralen Vektors (AAV1). Dieser sogenannte AAV1LPLS447X-Vektor wird in den Skelettmuskel des Patienten injiziert. Nach Transkription und Translation in den Skelettmuskelzellen wird dort das LPL-S447X-Protein exprimiert. Bereits wenige Wochen nach der Verabreichung exprimiert der episomale Alipogentiparvovec-Vektor nachweisbare LPL-Funktionswerte. Eine einzige intramuskuläre Anwendung von Alipogentiparvovec führt zur langfristigen Produktion des LPL-Proteins. Die Dosierung ist abhängig vom Gewicht und ein 65 kg schwerer Patient benötigt 22 Fläschchen mit je 3x1012 Genomkopien, was insgesamt 44 Injektionen entspricht. In den durchgeführten klinischen Studien wurden 27 Patienten mit der Gentherapie behandelt. Die muskuläre Übertragung und LPL-Produktion wurde erfolgreich nachgewiesen. Nach der Behandlung ging die Inzidenz der Pankreatitis um etwa 60 Prozent zurück, auch die Dauer der Krankenhausaufenthalte reduzierte sich. Als häufigste Nebenwirkung der Gentherapie treten bei etwa einem Drittel der Patienten Schmerzen in den Beinen auf. Angesichts der kleinen Patientenpopulation bieten die erfassten Nebenwirkungen aber kein vollständiges Bild über Art und Häufigkeit der Ereignisse. Die Anlage eines internationalen, prospektiven Patientenregisters für LPLD (GENIALL Register) ermöglicht eine zentrale Datenerfassung. Patienten, die mit Alipogentiparvovec behandelt werden wollen, müssen einer Nachbeobachtung in diesem Register zustimmen. Die Nachbeobachtungsdauer beträgt bis zu 15 Jahre. Das erste aktive deutsche GENIALL Zentrum befindet sich in der Berliner Charité.