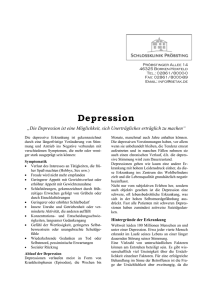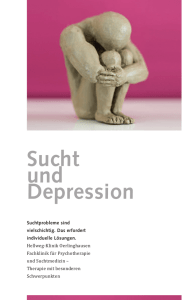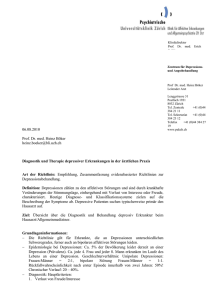Was ist eine Depression? Fragen und Antworten
Werbung

Handbuch Psych. Gesundheit Was ist eine Depression? Fragen und Antworten Eine Information der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) Eine Depression ist eine psychische Erkrankung, die sich in zahlreichen Beschwerden äußern kann. Eine anhaltende gedrückte Stimmung, eine Hemmung von Antrieb und Denken, Interessenverlust sowie vielfältige körperliche Symptome, die von Schlaflosigkeit über Appetitstörungen bis hin zu Schmerzzuständen reichen, sind mögliche Anzeichen einer Depression. Die Mehrheit der Betroffenen hegt früher oder später Suizidgedanken, 10 bis 15% aller Patienten mit wiederkehrenden depressiven Phasen sterben durch Suizid. Häufigkeit In Deutschland leiden schätzungsweise 5% der Bevölkerung, d.h. etwa 4 Millionen Menschen, aktuell an einer Depression. Pro Jahr erkranken etwa 1 bis 2 Personen von 100 neu. Depressive Episoden kommen in jedem Lebensalter vor, der Erkrankungsgipfel liegt zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. Nach aktuellen Studien erkranken viele Patienten aber bereits im Alter von 16 bis 20 Jahren erstmals. Die Wahrscheinlichkeit im Laufe des Lebens eine Depression zu entwickeln, beträgt zwischen 7 und 18%. Frauen sind etwa doppelt so häufig wie Männer betroffen. Bei etwa einem Drittel der Fälle nimmt die Depression einen chronischen Verlauf. Viele der Betroffenen suchen allerdings keinen Arzt auf, sei es aus Unwissenheit, Verdrängung oder aus Schamgefühl. Häufig werden aber auch Depressionen aufgrund ihres vielfältigen Erscheinungsbildes vom Hausarzt nicht erkannt. Es gehört neben medizinischem Fachwissen viel psychiatrische Erfahrung dazu, um eine Depression schnell und sicher zu diagnostizieren. Wird einmal die richtige Diagnose gestellt, ist die Lage alles andere als aussichtslos. In den letzten Jahrzehnten hat sich hinsichtlich der Therapie einiges getan und mehr als 80% der Erkrankten kann geholfen werden. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Allgemeinbevölkerung für dieses Thema sensibilisiert und aufgeklärt wird: Denn eine Depression kann jeden treffen, unabhängig von Alter, Geschlecht und sozialem Status. Was können die Ursachen von Depressionen sein? Eine Depression entsteht in der Regel aus dem Zusammenwirken mehrerer Faktoren. Welche Rolle erbliche, neurobiologische und umweltbedingte Faktoren spielen, ist individuell unterschiedlich und im Einzelfall nicht leicht zu beantworten. Eine genetische Veranlagung, Störungen des Gehirnstoffwechsels sowie bestimmte lebensgeschichtliche, psychosoziale, interpersonelle und Persönlichkeits-Faktoren können alleine oder in Kombination entscheidend zu einer depressiven Erkrankung beitragen. Genetische Veranlagung Eine erbliche Vorbelastung trägt nach dem heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand zu der Entstehung einer Depression wesentlich bei. Denn Depressionen treten familiär gehäuft auf. Sind Verwandte ersten Grades betroffen, liegt die Gefahr, selbst eine Depression zu entwickeln, bei etwa 15%. Bei eineiigen Zwillingen steigert sich das Risiko, dass beide an einer Depression erkranken auf mindestens 50%. Dies belegt, dass ein genetischer Faktor vorhanden sein muss. Genetische Faktoren können darüber hinaus die Empfindlichkeit (Vulnerabilität) gegenüber psychosozialen Belastungen erhöhen. Stoffwechsel- und Funktionsstörungen im Gehirn Viele Untersuchungen deuten darauf hin, dass Depressionen u.a. durch eine Stoffwechselstörung im Gehirn hervorgerufen werden. Dabei scheinen bestimmte 2 Überträgersubstanzen (so genannte Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin, Noradrenalin, Acetylcholin, Gamma-Aminobuttersäure) aus dem Gleichgewicht geraten zu sein. Depressive Patienten weisen im Vergleich zu Gesunden oft eine erniedrigte Konzentration dieser Botenstoffe auf, wobei das Ausmaß der betroffenen Neurotransmitter-Systeme individuell unterschiedlich sein kann. Diese Annahme wird durch den generellen Wirkmechanismus einer bestimmten Medikamentengruppe, den so genannten „Antidepressiva“ gestützt. Diese Wirkstoffe sorgen für eine Erhöhung bestimmter Botenstoffe im neuronalen System und helfen, die Symptome einer Depression zu mindern bzw. sie zu unterdrücken. Antidepressiva sind jedoch nicht bei allen Patienten wirksam, vermutlich gibt es individuelle Unterschiede in der Ausprägung der Neurotransmitter-Störungen. Lebensgeschichtliche und Persönlichkeits-Faktoren Ein weiterer Faktor, der zur Entstehung einer Depression beitragen kann, beruht auf einer fehlgeleiteten Entwicklung in der Kindheit. Auch der frühe Verlust eines Elternteils, eine Störung der Mutter-Kind-Beziehung sowie das Fehlen eines Selbstwertgefühls seit frühester Kindheit können zu einer besonderen Verletzlichkeit gegenüber Enttäuschungen führen. Unzureichend verarbeitete Verlusterlebnisse bzw. Traumata (z.B. sexueller Missbrauch, Erlebnis von Katastrophen) können bei erneuten Krisensituationen (z.B. Trennung vom Partner) den Ausbruch einer Depression fördern. Ein ängstlich-überfürsorglicher Erziehungsstil und eine daraus resultierende „erlernte Hilflosigkeit“ sowie mangelnde Stressbewältigungsmöglichkeiten der Betroffenen können ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Depression sein. Dabei können diese Faktoren allerdings nicht nur Ursache, sondern auch Resultat der Erkrankung eines Familienmitgliedes sein. So kann ein überbehütender Umgang dadurch erklärt werden, dass Eltern frühzeitig die psychische Verletzlichkeit und Erkrankungsbereitschaft des Kindes wahrnehmen und entsprechend schützend reagieren. Interpersoneller und psychosozialer Kontext Bei vielen Depressionen tritt die Erkrankung nach kritischen, belastenden oder negativen Ereignissen auf, z.B. dem Verlust eines Partners bzw. Angehörigen oder Probleme mit nahen Bezugspersonen, Scheidung/Trennung etc. oder einfach nur Veränderungen der gewohnten Lebensweise wie z.B. durch Berentung. Es ist nachgewiesen, dass belastende Lebensereignisse zu neurobiologischen Reaktionen wie z.B. vermehrter Ausschüttung des Stresshormons Cortisol führen, welches auch bei Depression in erhöhter Konzentration im Blut gefunden wird. Häufig spielen auch körperliche Erkrankungen (z.B. chronische Schmerzen, Krebs-, Herz-Kreislauf- und Demenz-Erkrankungen) und bestimmte Medikamente bei der Auslösung einer Depression eine Rolle. Wie bemerke ich eine Depression? Vorboten einer möglichen Depression Einer Depression gehen oft unspezifische Frühsymptome voraus, d.h. Anzeichen, die auch auf verschiedene andere Erkrankungen hinweisen könnten. Diese möglichen Frühsymptome können ohne Anlass oder als Reaktion auf belastende Ereignisse auftreten und sich langsam über Wochen oder Monate, seltener über Nacht oder mehrere Tage, zu einer depressiven Phase ausweiten. Mögliche erste Anzeichen sind: • • • • • • Schlafstörungen; Schmerzen (z.B. unspezifische Kopf- oder Bauchschmerzen); ständige Müdigkeit, Energiemangel; nachlassendes sexuelles Interesse; Reizbarkeit, Angst; zunehmende Lustlosigkeit, Apathie; 3 • • missmutige Stimmungslage; Appetitlosigkeit. Wenn die Depression akut ist Die meisten depressiven Patienten können ihre Beschwerden anfangs nicht einordnen und sind sich nicht bewusst, dass es sich um eine seelische Störung handelt. Eher glauben sie, sich nicht genug anzustrengen oder zusammenzureißen. Oftmals gehen sie zu Beginn einer depressiven Phase mit uncharakteristischen Symptomen wie Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, schlechter Laune etc. zum Arzt. Einige Betroffenen schildern ihre Gemütslage meist als Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Apathie. Andere Patienten fühlen sich in depressiven Episoden deprimiert, innerlich leer oder auch gefühllos, unfähig in gewohnter, normaler Weise auf freudige oder bedrückende Ereignisse zu reagieren. Betroffene verlieren ihren Antrieb sowie ihr Interesse und ihre Freude am Leben, sind ständig müde. Ihr Alltag ist geprägt von Energie- und Lustlosigkeit. Typisch ist, dass sich die Betroffenen zu allem zwingen müssen – anfangs nur zu aufwändigeren und ungeliebten, später aber auch zu leichteren und angenehmen Tätigkeiten. Sie verfolgen keine Ziele mehr und vernachlässigen ihre Familie, den Beruf und sogar alltägliche Verrichtungen wie Nahrungsaufnahme und Hygiene. Die Heftigkeit der Symptome schwankt meistens während des Tages. Weiter können frühmorgendliches Erwachen sowie ein morgendliches Stimmungstief und eine deutlich verminderte sexuelle Lust (Libidoverlust) auftreten. Vielfach wird eine Gewichtsabnahme aufgrund der Appetitlosigkeit beobachtet. Bei 70 bis 80% der Patienten tritt die Depression in Verbindung mit Angstgefühlen, zum Teil bis hin zu einer behandlungsdürftigen Angststörung auf. Bei etwa 15% der depressiven Patienten kommt es zu psychotischen Anzeichen wie Wahnideen (psychotische, „wahnhafte“ Depression). Die Hemmung des Antriebs kann sich auch im äußerlichen Erscheinungsbild mit einer Verlangsamung der Reaktionen, Bewegungen und Sprache bemerkbar machen, Mimik und Gestik sind starr. Im Extremfall können Betroffene nur unter großer Mühe reden oder sich bewegen. Auch das Denken und die Auffassungsgabe sind gehemmt: Kreativität, Konzentrations- und Merkfähigfähigkeit schwinden. Im Extremfall so weit, dass fälschlicher Weise eine Hirnabbauerkrankung vermutet wird. Als körperliche Beschwerden können im Rahmen einer Depression z.B. Schmerzen, Druckgefühle auf der Brust oder Atembeschwerden auftreten – in manchen Fällen können diese sogar im Vordergrund stehen. Generell können auch Phasen der Hormonumstellung, insbesondere bei Frauen z.B. nach einer Geburt oder in der Menopause von depressiven Störungen begleitet werden. Wie kann sich eine Depression auswirken? Depressive Patienten, die sich nicht in Therapie begeben, befinden sich schnell in einem Teufelskreis. Die Symptome einer depressiven Störung belasten die ganze Familie, Partnerschaft und auch Freundschaften. Häufig kommt es zusätzlich zu Problemen am Arbeitsplatz. Diese krankheitsbedingten sozialen Beeinträchtigungen sind erheblich und scheinen bei vielen Patienten auch nach Abklingen der depressiven Symptome anzuhalten. Als Folge neigen depressive Patienten zu Missbrauch von Alkohol, Medikamenten oder Drogen. Hohes Suizid-Risiko Die schlimmste Auswirkung einer Depression ist der Suizid. 10 bis 15% aller Patienten mit wiederkehrenden depressiven Phasen, die deshalb mindestens 1 Mal stationär behandelt werden musstensterben durch Suizid. Besonders gefährdet sind Personen, die in belastenden psychosozialen Verhältnissen leben, etwa geschieden sind oder alleine leben, Alkohol oder Drogen missbrauchen, außerdem Betroffene im fortgeschrittenen Alter und solche die schon Suizidversuche hinter sich haben. Wenn Ängste, Panikattacken oder Schlafstörungen gleichzeitig das depressive Störungsbild mitbestimmen ist ebenfalls hohe 4 Vorsicht geboten. Die Patienten bringen sich meist am Anfang oder am Ende einer Episode, wenn die Stimmung schon gedrückt, aber der Antrieb noch oder schon wieder vorhanden ist, um. Besonderheiten bei älteren Menschen Bei den über 65-Jährigen ist die Altersdepression die häufigste psychische Erkrankung. Paradox erscheint, dass die Gemütserkrankung nur bei rund 10% der Betroffenen diagnostiziert wird und noch weniger von ihnen eine adäquate Behandlung erhalten. Das Diagnoseproblem besteht unter anderem darin, dass sich das Krankheitsbild oft mit anderen alterstypischen Krankheiten wie z.B. der Demenz überlappt. Auslöser, im Alter an einer Depression zu erkranken, finden sich oft im Gesundheitszustand des Betroffenen. Ständige Schmerzen, nachlassende Herz- und Gehirnleistung oder Bewegungseinschränkung können die Lebensqualität so stark beeinträchtigen, dass eine Depression ausbrechen kann. Auch soziale Probleme wie Isolation, Tod oder Krankheit des Partners, Umzug in eine Pflegeeinrichtung stellen Risikofaktoren dar. Die Symptome der Depression im Alter sind denen der jüngeren Generation sehr ähnlich, nur entwickeln sie sich eher schleichend und werden oft von körperlichen Beschwerden verdeckt. Dies erschwert die Diagnosestellung enorm. Bei der Behandlung ist auf das Alter und die Verfassung des Patienten Rücksicht zu nehmen. In der Regel lässt sich die Depression auch hier erfolgreich therapieren. Allerdings ist zu beachten, dass Stoffwechsel und Organe des älteren Menschen die entsprechenden Medikamente im Vergleich zu jüngeren schlechter vertragen, weswegen bei der Auswahl der Medikamente die Verträglichkeit im Vordergrund steht. Ein weiterer Unterschied zu jüngeren Patienten besteht in dem viel höheren Risiko eines Rückfalls auch bei einer erfolgreich therapierten Depression. Deshalb wird bei älteren Menschen mit wiederkehrenden Depressionen empfohlen, die letzte wirksame und nebenwirkungsärmere Medikation zur Rezidivprophylaxe (Wiedererkrankungs-Vorbeugung) lebenslang beizubehalten. Untersuchungsmethoden Basis für die Diagnosestellung ist eine umfangreiche psychische Befunderhebung, die ein ausführliches Arzt-Patienten-Gespräch u.a. zu Belastungssituationen in jüngster Zeit beinhaltet. Hilfreich ist auch der zusätzliche Einsatz von standardisierten Fragebögen. Im Idealfall werden auch Angehörige in die Befragung einbezogen, wenn der Betroffene einverstanden ist (außer in Notfällen). Wichtig für den Arzt ist es auch, neben den aktuellen Beschwerden Vorerkrankungen zu kennen, die in der Vergangenheit aufgetreten sind. Schließlich muss geklärt werden, ob eine familiäre Belastung vorliegt. Grundlage der Diagnosestellung sind weltweit einheitliche Standards zu Symptomen und Schweregraden. Ausschluss körperlicher Ursachen Für eine sichere Diagnose muss der Betroffene auch körperlich – neurologisch und internistisch - untersucht werden, um organische Krankheiten mit ähnlicher Symptomatik ausschließen zu können. Hierzu gehören z.B. Hirntumore, Morbus Parkinson, Multiple Sklerose, Hirnhautentzündung, Epilepsie, Migräne, Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen oder Störungen der Nebennierenfunktion. Bei älteren Patienten ist ein Ausschluss einer Demenz -Erkrankung wichtig. Routinemäßig kommen Blut-Untersuchungen (Schilddrüsen-, Leber- und Nierenwerte) und apparative Verfahren wie z.B. eine Elektrokardiografie (EKG), eine Ableitung der Hirnströme (EEG) und eventuell auch eine Computertomografie oder eine Kernspintomografie des Kopfes zum Einsatz. Insbesondere beim erstmaligen Auftreten einer depressiven Erkrankung ist es wichtig, körperliche Ursachen der Depression auszuschließen. Darüber hinaus klärt der Arzt ab, dass nicht bestimmte Medikamente wie etwa manche Herz- 5 Kreislauf-Medikamente, Steroidhormone (z.B. Cortison), Antibiotika und Zytostatika oder Suchtstoffe wie Alkohol die depressiven Störungen verursachen. Abgrenzung von anderen psychischen Erkrankungen Für die Behandlung wichtig ist es, Depressionen gegenüber anderen psychischen Krankheitsbildern wie der Schizophrenie oder Angststörung abzugrenzen. Denn Angst- und Depressionszustände treten z.B. häufig zusammen auf. Auch gilt es abzuklären, dass die Depression nicht im Rahmen einer bipolaren Störung („manisch-depressive Erkrankung“) auftritt, bei der es neben depressiven Phasen auch zu Phasen übersteigerter („manischer“) Stimmung kommt. Etwa ein Fünftel der Patienten mit der Diagnose „unipolare Depression“ durchläuft innerhalb der folgenden Jahre eine Manie und erfüllt dann die Diagnose einer bipolaren Störung, die anders als eine „reine“ Depression behandelt wird. Die frühe Diagnose ist für einen positiven Verlauf der depressiven Erkrankung sehr wichtig. Je weniger Krankheitsepisoden bis zum Beginn einer entsprechenden Therapie stattgefunden haben, desto besser ist die langfristige Prognose. Außerdem kann durch einen frühen Behandlungsbeginn vermieden werden, dass es zu weiteren negativen gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen kommt. Therapiekonzepte / Behandlungsphasen Die Symptome von depressiven Episoden lassen sich mit modernen Behandlungsmethoden oft beheben oder zumindest lindern und die Lebensqualität der Betroffenen damit entscheidend verbessern. Trotzdem bleibt den Betroffenen eine lebenslange gesteigerte Neigung, depressive Symptome zu entwickeln, deren Ursachen sich bisher nicht heilen lassen. Jede depressive Episode erhöht das Risiko für eine weitere Episode und das Absetzen der Behandlung steigert die Wahrscheinlichkeit für eine solche Entwicklung. Wesentliche Grundlage der Behandlung mittelschwerer bis schwerer Depressionen ist der Einsatz antidepressiver Medikamente, die Durchführung einer Psychotherapie oder die Kombination beider Maßnahmen. Bei leichten und mittelschweren depressiven Phasen ist Psychotherapie ebenso wirksam wie Medikamente. Psychotherapie benötigt allerdings mehr Zeit als ein Antidepressivum, bis die Wirkung eintritt. Bei leichten Depressionen können auch alleine unterstützende ärztliche Gespräche (Clinical Management) wirksam sein. Bei schweren depressiven Episoden (und bei Dysthymien, d.h. leichteren, jedoch chronischen Depressionen) ist nach heutigen Erkenntnissen eine Kombinationstherapie wirksamer als Psychotherapie alleine Ob eine ambulante Behandlung möglich oder ein stationärer Aufenthalt nötig ist, ist u.a. von der Art und der Schwere der Depression sowie vom individuellen Suizidrisiko abhängig. Bei einer psychotischen Depression ist eine Klinikeinweisung z.B. meist unumgänglich. Das gleiche gilt für eine massive, die Krankheit aufrechterhaltende häusliche Konfliktsituation oder die Erfolglosigkeit ambulanter Therapieversuche. Die Behandlung der depressiven Erkrankung ist je nachdem, in welcher Phase der Erkrankung der Betroffene sich befindet, unterschiedlichen Zielen unterworfen: 1. Akuttherapie Die Akuttherapie sollte beginnen sobald eine akute Krankheitsphase auftritt. Sie wird so lange fortgesetzt bis sich die akuten Symptome der Depression deutlich gebessert haben, sie dauert daher in der Regel vier bis acht Wochen an. Die Aufklärung über die Erkrankung und das geplante Therapiekonzept sowie über die mögliche Notwendigkeit der Einnahme von Medikamenten stehen während der Akuttherapie im Mittelpunkt. Wenn möglich, sollten Bezugspersonen des Patienten zu dem psychoedukativen Gespräch miteinbezogen werden. Neben dieser so genannten Psychoedukation spielt auch der Kontakt zu Ihrem Arzt in dieser Phase eine ganz wichtige Rolle – er steht Ihnen für alle Fragen zur Verfügung und macht Ihnen Mut, die Behandlung fortzusetzen und die evtl. verordneten Medikamente regelmäßig 6 einzunehmen. Dabei sollten Betroffene wissen, dass die Wirkung antidepressiver Medikamente oft erst nach einigen Tagen bis Wochen eintritt. 2. Erhaltungstherapie Die Erhaltungstherapie (continuation) schließt sich an die Akuttherapie an und soll den Zustand des Betroffenen so weit stabilisieren, dass es nicht zu einem direkten Rückfall kommt. In der Regel dauert diese Phase ca. 6-8 Monate. Unter einem Rückfall versteht man das Wiederauftreten von Krankheitsanzeichen bevor es zur wirklichen Genesung gekommen ist. Kommt es zu erneuten Symptomen nach einer Wiederherstellung des ursprünglichen Gesundheitszustandes, sprechen Ärzte von einer Wiedererkrankung. Ziel der Erhaltungstherapie ist es, diesen stabilen Zustand die nächsten sechs Monate zu halten, da es in dieser Phase auch unter ansonsten alltäglicher Belastung leichter wieder zu einer Verschlechterung kommt. Wichtig ist es dafür, mögliche Warnzeichen für einen Rückfall frühzeitig zu erkennen und Mechanismen zur Abwendung zu kennen. Ein vertrauensvolles Arzt-Patienten-Verhältnis bildet die Basis einer erfolgreichen Therapie. 3. Wiedererkrankungs-Verhütung (Rezidivprophylaxe) Die Vorbeugung einer Wiedererkrankung beginnt, sobald sich die Stimmungslage des Betroffenen wieder längerfristig normalisiert hat. Sie soll, insbesondere bei Patienten, die bereits mehr als 2 Erkrankungsphasen durchlebt haben, langfristig verhindern, dass es zu einer erneuten akuten Krankheitsepisode kommt. Wie lange diese so genannte Rezidivprophylaxe durchgeführt wird, hängt u.a. von der Anzahl und Schwere der depressiven Episoden ab. Generell sollte die verordnete Therapie des Arztes nicht selbstständig abgesetzt werden und ein geregelter Ruhe/Aktivitätsrhythmus im Alltag erreicht und aufrechterhalten werden. Bei einer drohenden Wiedererkrankung sollten in der Psychoedukation erlernte Frühinterventionsmaßnahmen greifen. Die Einbeziehung des Partners und von Familienangehörigen spielt in der Therapie depressiver Erkrankungen häufig eine große Rolle. Die Angehörigen sollten über das Erscheinungsbild, die Behandlungsmöglichkeiten und die Prognose der Erkrankung eingehend informiert werden (Psychoedukation). Denn nur mit einem fundierten Wissen können sie den Patienten unterstützen, zur Fortsetzung der Behandlung motivieren und zum Schutz vor Rückfällen beitragen. Medikamentöse Therapie Viele Erkrankungen werden durch die auf die Psyche wirkenden Medikamente erst behandelbar, indem sie u.a. eine Basis für eine psychotherapeutische Behandlung und eine Soziotherapie schaffen. Oft wird nur durch die Gabe von so genannten Psychopharmaka eine ambulante Behandlung der Patienten möglich – mit dem Ziel, dass diese sich schneller wieder in Gesellschaft und Beruf einfinden können. Für die Behandlung einer Depression kommen so genannte Antidepressiva zum Einsatz. Unter der Bezeichnung „Antidepressiva“ wird eine Gruppe von Medikamenten zusammengefasst, die bei depressiven Erkrankungen die Stimmung aufhellen und den Antrieb normalisieren. Dementsprechend verringern sie auch die typischen körperlichen Symptome (z.B. Kopf- und Rückenschmerzen, Schlafstörungen und Magen-DarmBeschwerden), die eine Depression zur Folge hat. Der Wirkung der Antidepressiva beruht darauf, dass sie den Stoff-wechsel der körpereigenen Neurotransmitter Serotonin und/oder Noradrenalin (Botenstoffe, die wichtig sind bei der Übertragung von Nervenimpulsen) im Gehirn, der bei Depression gestört zu sein scheint, wieder ausgleichen. Man unterscheidet zwischen selektiven SerotoninWiederaufnahmehemmern (SSRI), selektiven Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmern (SNRI), dualen selektiven Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmern (SSNRI), noradrenergen und spezifisch serotonergen Antidepressiva (NaSSA), Monoaminoxidasehemmern (MAO-Hemmer) sowie tri- und tetrazyklischen Antidepressiva. 7 Weitere Informationen zur Wirkweise der einzelnen Antidepressiva finden Sie im Kapitel Therapieformen / Medikamentöse Therapie. Ihre Wirkung entfalten Antidepressiva meist erst nach 2-3 Wochen. Wenn die Symptome abklingen, müssen die Medikamente in der Regel noch weiter eingenommen werden. Sie sollten auf keinen Fall eigenmächtig abgesetzt werden, da dadurch die Gefahr eines Rückfalls bzw. einer Wiedererkrankung besteht. Antidepressiva machen auch bei längerer Einnahme nicht abhängig! Bei leichten depressiven Störungen kommen auch pflanzliche Alternativen wie Johanniskraut zum Einsatz. Aber auch hier ist mit Nebenwirkungen wie erhöhte Lichtempfindlichkeit oder Veränderungen der Blutspiegel anderer einzunehmender Medikamente zu rechnen. Liegen Begleitsymptome wie z.B. Schlafstörungen, starke Angst oder Nervosität vor, wird der Arzt evtl. entsprechend weitere Medikamente verordnen. Psychotherapeutische Verfahren Psychotherapeutische Verfahren gehen heutzutage gezielt auf die Erfordernisse des jeweiligen Krankheitsbildes ein, d.h. viele Psychotherapieformen sind nicht allgemeingültig, sondern störungsspezifisch auf die Erkrankung zugeschnitten. Das Ziel der meisten psychotherapeutischen Verfahren mit kommunikativen und/oder übenden Techniken besteht darin, dem Patienten Strategien zur Bewältigung von inneren und/oder zwischenmenschlichen Konflikten aufzuzeigen, ihm Handlungskompetenz zu vermitteln und sein Selbstvertrauen aufzubauen. Wichtig ist es auch, dem Betroffenen zu verdeutlichen, dass es sich um eine Erkrankung – ohne sein Verschulden - handelt. Im Wesentlichen kommen fünf verschiedene Formen der Psychotherapie bei depressiven Patienten zum Einsatz: Verhaltenstherapie Die Verhaltenstherapie entstand in den 50er Jahren und basiert auf Erkenntnissen der modernen Lerntheorie. Positive Konsequenzen oder verstärkende Faktoren wie Lob und Zuwendung erhöhen demnach die Häufigkeit bestimmter Aktivitäten; negative Folgen, etwa eine Bestrafung, mindern ein Verhalten. Depressive Störungen werden als Resultat eines Verlustes an positiven Verstärkern, insbesondere für aktives soziales Verhalten, angesehen ausgelöst etwa durch Partnerkonflikte oder Probleme am Arbeitsplatz. Die Verhaltenstherapie geht davon aus, dass jedes Verhalten erlernt, aufrechterhalten, aber auch wieder verlernt werden kann. Unter „Verhalten“ versteht sie heutzutage nicht nur die von außen beobachtbaren Verhaltensschritte und nachweisbaren körperlichen Reaktionen. Vielmehr gehört dazu auch das nicht unmittelbar beobacht- und nachweisbare Verhalten etwa Gefühle, Gedanken, Motive und Bewertungen. Psychische Störungen werden als fehlerhaft erlerntes Verhalten in Anpassung an äußere und innere Reize gesehen und nicht, wie etwa in der Psychoanalyse, als Symptom eines unbewussten Konflikts. Bei der Verhaltenstherapie geht es darum, „falsch“ Gelerntes umzulernen oder bisher NichtGelerntes zu erlernen. Der Patient wird motiviert, aktive positive Verhaltensweisen aufzubauen. Zu Beginn der Therapie versucht der Psychotherapeut, mithilfe der Verhaltensanalyse die Verhaltensmuster des Patienten zu verstehen. Es geht ihm darum herauszufinden, welche Bedingungen bestimmte Reaktionen des Patienten verursachen oder aufrechterhalten und wie die Lerngeschichte unerwünschter Verhaltensweisen aussieht: Wie wird reagiert, was sind die Folgen, welche Konsequenzen hat das Verhalten? Anschließend werden die Behandlungsziele detailliert definiert, die Behandlungsprinzipien und ein genauer Behandlungsplan festgelegt. Die aktive, übende Mitarbeit des Patienten ist für die Verhaltenstherapie erforderlich. Die Verhaltenstherapie kann einzeln oder kombiniert, z.B. mit der kognitiven Therapie oder Entspannungstechniken wie der progressiven Muskelrelaxation, angewendet werden. 8 Kognitive Verhaltenstherapie Die Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie für die Behandlung depressiver Störungen ist bisher am besten untersucht und am eindeutigsten nachgewiesen. Ausgangspunkt dieser Behandlung ist die Annahme, dass Depressionen mit negativen, selbstabwertenden Wahrnehmungs- und Denkmustern zusammenhängen. Diese erlernten realitätsfremden, unlogischen oder verzerrten Muster können das Denken, die Gefühlswelt und das Verhalten betreffen. Bei der Therapie soll der Patient zunächst lernen, sich selbst zu beobachten und dann seine Denk- und Verhaltensmuster umzubewerten, etwa indem er sich bewusst distanziert, etwas positiv umdeutet oder ein Problem als Herausforderung sieht. Der Patient erkennt seine eigenen Denk- und Verhaltensweisen als "hausgemachtes Problem", nicht als unumstößliche Realität. Er entwickelt eine vermehrte Selbstkontrolle in Situationen, die normalerweise von depressionstypischen Gedankengängen besetzt sind. Erfolgt die kognitive Therapie in Kombination mit einer Verhaltentherapie stellen folgende Aspekte die Schwerpunkte dieser so genannten kognitiven Verhaltenstherapie dar: • • • • • • Eingehen eines Arbeitsbündnisses zwischen Patient und Therapeut; Definition der Schlüsselprobleme; Aufbau von entlastenden , positiven Aktivitäten und den Abbau von belastenden, negativen Aktivitäten - Entwickeln von Ideen, wie dies im Alltag umzusetzen ist, z.B. häufige Pausen, Entspannungsübungen, kleine Belohnungen, Ablehnung von überfordernden Arbeitsgängen; Verhaltensänderung in alltäglichen Situationen / Wiederaufnahme von Kontakten - in Rollenspielen übt der Patient, mit spezifischen alltäglichen Problemen umzugehen (z.B. Durchsetzen in Konfliktsituationen), die eigenen Interessen wahrzunehmen und seine Kontaktfähigkeit wiederherzustellen bzw. aufzubauen; Vorstellung eines alternativen Denk- und Wahrnehmungsmodell, Planung von praktischen Aktivitäten und deren Umsetzung, z.B. konkrete Wochenplanung; Umgang mit Rückschlägen sowie vorbeugende Interventionen. Interpersonelle Therapie (IPT) Auch die Wirksamkeit der interpersonellen („zwischenmenschlichen“) Therapie (IPT) bei depressiven Patienten, gerade für betroffene ältere Menschen, ist in wissenschaftlichen Untersuchungen gut belegt worden. Ihr Ausgangspunkt ist die Annahme, dass depressive Episoden stets in einem zwischenmenschlichen und psychosozialen Kontext auftreten. Im Mittelpunkt der therapeutischen Gespräche stehen die Beziehungen des Patienten zu seinen Mitmenschen, die in einem Zusammenhang zur aktuellen depressiven Episode stehen. Basis der IPT bilden wissenschaftliche Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Depressionen mit folgenden vier Bereichen in Verbindung stehen: • • • • Verlust von geliebten Menschen und Trauer, zwischenmenschliche Konflikte, soziale Rollenveränderungen/Abschluss von Lebensabschnitten, Kontaktschwierigkeiten/soziale Isolierung. Aus diesen vier Bereichen werden meist ein bis zwei Themen ausgewählt, die den größten Beitrag zur depressiven Episode lieferten. Ist Trauer ein zentrales Thema, weil z.B. der Lebenspartner verstorben ist, wird der Ausdruck von Trauer gefördert, Interessen und neue Beziehungen werden aufgebaut. Stehen interpersonelle Konflikte im Mittelpunkt, sollen diese zunächst erkannt, Erwartungen definiert und mit Hilfe von Kommunikationsstrategien mit der Bezugsperson diskutiert werden. Bei einem problematischen Rollenwechsel, z.B. von der Berufstätigkeit in die Berentung, ist es von Bedeutung, den Verlust der alten Rolle anzunehmen und zu betrauern, die neue Rolle positiv zu sehen und das Selbstwertgefühl 9 wiederherzustellen. Leidet ein Patient unter Kontaktproblemen, wird er beim Eingehen von Beziehungen unterstützt. Der Psychotherapeut ermuntert den Patienten stets zum Ausdruck seiner Gefühle und Gedanken. Neue oder schwierige Situationen werden in diesem Zusammenhang im Rollenspiel geübt. Tiefenpsychologisch orientierte bzw. psychodynamische Psychotherapie Die tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie nimmt an, dass die Erkrankung auf einem unbewussten inneren Konflikt beruht, der durch negative oder unangenehme Erfahrungen oder Erlebnisse in der individuellen Geschichte/Kindheit entstanden ist. Der Psychotherapeut versucht daher, diesen Konflikt bewusst zu machen. Durch das wiederholte Erinnern und Durchleben dieser Erfahrungen sollen Symptome aufgelöst und die Depression geheilt werden. Wissenschaftlich abgesichert ist die Wirksamkeit einer tiefenpsychologisch orientierten Kurzzeittherapie bei leichten bis mittelschweren Depressionen. Zur Wirksamkeit der tiefenpsychologisch orientierten bzw. psychoanalytischen Langzeittherapien (über 80 Stunden) liegen bisher keine wissenschaftliche Belege im Rahmen randomisierter, kontrollierter Studien vor. Gesprächspsychotherapie Die Gesprächspsychotherapie nach Carl R. Rogers geht davon aus, dass jeder Mensch bestimmte Vorstellungen von sich hat und wie er sein möchte, also ein Selbstbild besitzt. Psychische Störungen und ein negatives Selbstbild entstehen, wenn Menschen Akzeptanz und emotionale Zuwendung nur unter bestimmten Bedingungen, etwa brav zu sein, erfahren. Der Mensch an sich strebe nach der Auffassung Rogers außerdem nach Selbstverwirklichung und Wachstum. Psychische Störungen bedeuten deshalb auch eine Unterdrückung dieser Wachstumsbedürfnisse. Inhaltlich konzentriert sich die Gesprächsführung darauf, dass der Patient lernt, seine Gedanken und Gefühle in Worte zu fassen, sie auf diese Weise ins Bewusstsein zu bringen und seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Daher wird besonders darauf geachtet, dass die Patienten ihren Behandler als zugewandt, wertschätzend, einfühlsam und echt erleben. Bei positivem Erfolg mit dem Therapeuten wird das für den Genesungsprozess als zentral erachtet. Gruppentherapien Gruppentherapien haben sich vor allem bei Trauerreaktionen oder bei depressiven Störungen in Folge chronischer körperlicher Erkrankungen bewährt. Der Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen und das Bewusstsein „ich bin nicht allein“ motiviert Patienten zum Durchhalten der Therapie. Leider werden Gruppentherapie im ambulanten Bereich von Niedergelassenen selten angeboten. Spezielle nicht-medikamentöse Therapieformen Wachtherapie (Schlafentzug) Nach einer vollständig durchwachten Nacht oder nach Wachbleiben in der 2. Nachthälfte, etwa ab 1.00 Uhr, zeigen viele der depressiven Patienten – allerdings meist nur vorübergehend - eine deutliche Besserung der Symptome. Besonders Patienten mit melancholischer Depression, mit starken Tagesschwankungen und bei Depressionen im Rahmen einer bipolaren Störung sprechen auf eine Schlafentzugstherapie an. Eine an den Schlafentzug anschließende Vorverlagerung der Schlafphasen, die dann stufenweise wieder zurückverlagert wird, oder wiederholte Schlafentzüge in der 2. Nachthälfte können vor einem möglichen Rückfall schützen. Elektrokrampftherapie (EKT) Die Elektrokrampftherapie wird bei schweren Störungen angewendet, wenn eine medikamentöse und psychotherapeutische Behandlung keine Besserung bringen bzw. nicht 10 möglich sind. Bei der EKT wird im Gehirn unter Vollnarkose mit Hilfe von Strom ein Krampfanfall ausgelöst, doch kommt es nicht zu einem Krampf der Muskulatur. Als Folge schüttet das Gehirn vermehrt die Neurotransmitter Dopamin, Noradrenalin und Serotonin aus. Diese Botenstoffe spielen bei der Stimmungsstabilisierung eine wichtige Rolle. Die Methode ist auch bei Patienten effektiv, die auf andere Verfahren, wie Antidepressiva und Psychotherapie sich nicht gebessert haben. Lichttherapie Lichttherapie kann bei saisonalen Depressionen wie der Winterdepression die Symptome innerhalb weniger Wochen deutlich lindern. Der Arzt verordnet bei Bedarf eine Lichttherapie mittels 10.000 Lux-Lampe für eine Stunde pro Tag. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten hierfür bisher nicht. Eine solche Lichttherapie-Lampe kostet für den Eigenbedarf ca. 1.000 Euro. Auch bei nicht-saisonaler Depression gibt es Hinweise, dass die Lichttherapie mit 10.000 Lux für eine Stunde täglich die Wirkung von Antidepressiva verbessern kann. Verlauf und Heilungschancen Etwa die Hälfte aller Patienten erkranken in ihrem Leben an einer Depression. Bei den anderen 50% gilt, dass bei etwa zwei Dritteln die Phasen der Erkrankung abgegrenzt sind durch Episoden völliger Gesundheit von unterschiedlicher Dauer. Bei einem Drittel der Betroffenen tritt jedoch lediglich eine teilweise Besserung ein. Die meisten depressiven Episoden bilden sich – insbesondere bei entsprechender Behandlung - innerhalb weniger Monate zurück, 15 % der Fälle weisen jedoch eine Dauer von mindestens 12 Monaten auf. Aber auch in diesem Fall ist eine Heilung möglich. Ungünstig auf die Prognose wirken sich z.B. Substanzmissbrauch (Alkohol, andere Drogen), Ess-Störungen, begleitende Angst- und Zwangsstörungen sowie chronische Verläufe aus. Informationen für Angehörige Depressive Störungen und auch die teilweise damit verbundenen körperlichen Schmerzen sind eine ernst zu nehmende Erkrankung. Die Angehörigen sollten akezeptieren, dass der Betroffene wirklich krank ist. Resignation ist unangebracht, Depressionen sind heute gut therapierbar. Depressive Patienten sollten unbedingt in Behandlung. Meist stößt diese Tatsache bei den Betroffenen auf Widerstand. Sie glauben nicht an eine Krankheit, halten einen Arztbesuch oder die Behandlung durch einen Psychologen für sinnlos. Angehörige sollten durch Unterstützung und Mitgefühl den Betroffenen zu einer Behandlung bewegen. Hausarzt bzw. ggf. Psychiater/Nervenarzt beraten umfassend über das Krankheitsbild. Vor allem, wenn man sich selbst mit der Situation überfordert fühlt, überlastet und erschöpft ist, kann der Austausch mit anderen Angehörigen depressiv Erkrankter in Angehörigengruppen sehr hilfreich sein. Angehörige sollten sich nicht scheuen, Hilfe für sich selbst anzunehmen. Es hat keinen Sinn, einem depressiven Menschen zu raten, abzuschalten und für ein paar Tage zu verreisen, denn eine fremde Umgebung verunsichert den Patienten meist zusätzlich. Man sollte dem Depressiven auch nicht raten, "sich zusammenzunehmen" - ein depressiver Mensch kann diese Forderung nicht erfüllen, denn eine Depression hat nichts mit mangelnder Willensstärke zu tun. Dieser Ratschlag verstärkt möglicherweise sogar seine Schuldgefühle. Gleiches gilt für ständige Versuche der Aufmunterung. Dagegen sollten Angehörige die Erkrankten immer dann unterstützen, wenn sie Eigeninitiative zeigen. Folgendes sollte man beherzigen: • • • Akzeptieren Sie die Depression als Erkrankung! Ziehen Sie den Arzt zu Rate! Machen Sie dem Betroffenen keine Vorwürfe! 11 • • • • Seien Sie zurückhaltend mit gut gemeinten Ratschlägen wie z.B. „Dir geht es doch gut, du hast doch gar keinen Grund!“ Bleiben Sie geduldig! Ermutigen und aktivieren Sie! Nehmen Sie Suiziddrohungen ernst! Aktivieren Sie ihn zu schrittweise körperlicher Aktivität, denn depressionsbedingte Inaktivität kann zu einem massive Trainingsdefizit führen. Die Autoren Prof. Dr. med. Mathias Berger, Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg i. Br. und langjähriges Mitglied im Vorstand der DGPPN Dr. med. Christa Roth-Sackenheim, niedergelassene Psychiaterin und Psychotherapeutin, Vorsitzende des Berufsverbandes Deutscher Psychiater (BVDP), im Vorstand der DGPPN Beauftragte für die Gremien der ärztlichen Selbstverwaltung. Weitere Informationen Fritz Hohagen und Thomas Nesseler (Hrsg.): Wenn Geist und Seele streiken. Handbuch Psychische Gesundheit. Mit einem Vorwort von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt. Gebundenes Buch, 368 Seiten. ISBN 978-3-517-08221-9. Südwest Verlag, München 2006. Preis: 29,95 Euro.