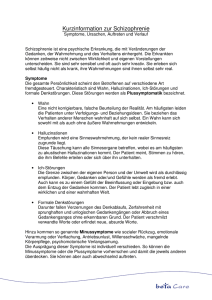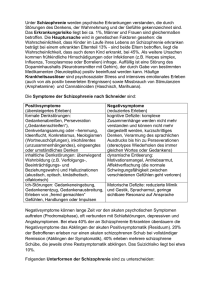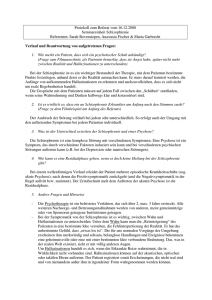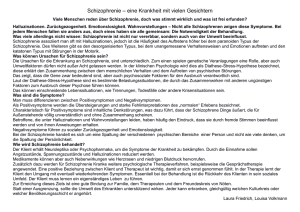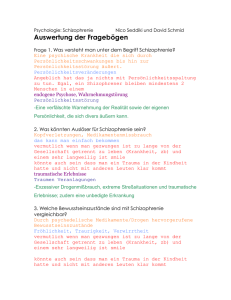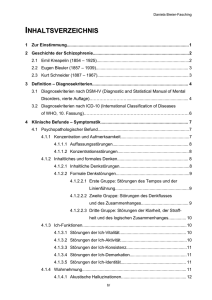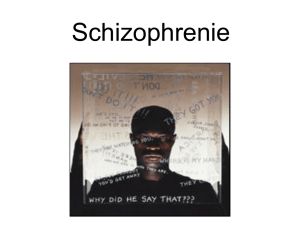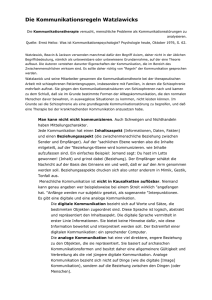Psychopathologie und biologische Grundlagen - UTB-Shop
Werbung

Fragenkatalog zur Vorlesung „Psychopathologie und biologische Grundlagen“ Lehrveranstaltungsleiter: Ao. Univ.-Prof. DDr. Christian Klicpera Universität Wien, Institut für Psychologie Ort der Lehrveranstaltung: HS 50, Hauptgebäude Zeitpunkt: SS 2007 – Do., 14:00–16:00 Uhr Die folgenden Fragen beziehen sich allesamt auf das Buch „Psychopathologie und biologische Grundlagen der Klinischen Psychologie“ (2007), welches die verpflichtende Literatur zur Vorlesung „Psychopathologie und biologische Grundlagen“ darstellt. In der Klausur sollen die entsprechenden Inhalte bzw. Abschnitte des Buches zusammenfassend wiedergegeben werden. Im vorliegenden Fragenkatalog sind mitunter mehrere Teilabschnitte in einer Frage zusammengefasst, dann sollen zu all diesen Teilen Angaben gemacht werden. Für die schriftliche Klausur zu dieser Vorlesung werden jeweils drei Fragen aus diesem Katalog ausgewählt. Literatur zur VL: Klicpera, Christian (2007): Psychopathologie und biologische Grundlagen der Klinischen Psychologie. Wien: WUV. 1 2 Fragen zu Kapitel 1: Psychologie emotionaler Störungen 1. Erläutern Sie Perzeptions- und Urteilsprozesse bei Emotionen. 2. Was betont Magda Arnold in ihrer kognitiv-motivationalen Emotionstheorie? 3. Wie ist die Art der Kodierung emotionaler Inhalte bei affektiven Reaktionen? 4. Was wissen Sie über Gedächtnisschemata für Emotionen? Was sagt insbesondere Leventhal dazu? 5. Was sind zentrale Aussagen der Selbsterfahrungstheorie von Emotionen? 6. Wie ist das Verhältnis von Einstellungen und Erwartungen zu Handlungssequenzen? 7. Welche sozialpsychologischen Ansätze zum Verständnis von Emotionen gibt es? Erläutern Sie Attribution, Aufmerksamkeit und Selbstbeobachtung. 8. Welche Auswirkungen von Angst auf kognitive Leistungen sind Ihnen bekannt? 9. Welche subjektiven Emotions- und Angstkomponenten gibt es? Wie sieht der sprachliche und kulturelle Einfluss darauf aus? 10. Was wissen Sie über die Bedeutung der körperlichen Emotionsund Angstkomponenten? 11. Was besagt die Emotionstheorie von James und Lange? Welche Einwände hat Cannon dagegen vorgebracht? 3 12. Was besagt die Emotionstheorie von Schachter und durch welche Untersuchung hat er diese Theorie zu belegen versucht? 13. Wieweit wurde die Theorie durch den Einfluss der Rückmeldung autonomer Reaktionen zusätzlich gestützt? An welche Bedingungen ist dies geknüpft? 14. Was wissen Sie über die Spezifität des mimischen Ausdrucksverhaltens bei Emotionen? Inwiefern spielt es eine Rolle bei der Kontrolle der Emotionen? 15. Beschreiben Sie die emotionale Entwicklung im ersten Lebensjahr. 16. Inwieweit ist die Ausbildung von differenzierten emotionalen Reaktionen an die kognitive Entwicklung gebunden? Inwieweit lässt sich dies bei den Wirkungen der Attribution nachweisen? 17. Welche Entwicklungen zeigen sich bei der Bewältigung von Ärger bzw. bei der Reaktion auf Traurigkeit? 18. Inwiefern bereitet das Erkennen von Emotionen Kindern noch Schwierigkeiten? 19. Welche Entwicklungstrends zeigen sich bei der Emotionsregulation? 20. Welche einfacheren und welche komplexeren Strategien zur Emotionskontrolle kennen Sie? 21. Wie können Kinder negative Emotionen reduzieren und positive Emotionen verstärken? 22. Welche Erscheinungen mangelhafter Emotionskontrolle bei Kindern kennen Sie? 23. In welchen Zusammenhang stellen Eisenberg und Fabes die Emotionsregulation? 4 24. Wieso sehen Eisenberg und Fabes einen Zusammenhang mit der sozialen Kompetenz und der sozialen Akzeptanz? 25. Wo haben andere noch ein Zusammenspiel von Emotions- und Verhaltensregulation festgestellt? 26. Was sind wichtige Teilbereiche der sozioemotionalen Entwicklung nach Saarni (1999)? Fragen zu Kapitel 2: Psychologie von Angst und Furcht 27. Welche zwei Entwicklungslinien und Formen psychoanalytischer Angsttheorien kennen Sie? 28. Beschreiben Sie den Beitrag Bowlbys zur Psychoanalyse. 29. Welche lerntheoretischen Erklärungen gibt es zur Entstehung von Angststörungen? Nennen Sie die wichtigsten Ansätze (klassische Konditionierung, operante Konditionierung, ZweiProzess-Theorie). 30. Welche kognitiven Theorien der Entstehung von Angststörungen sind Ihnen bekannt (Modelle des Erwartungslernens, sozial-kognitive Lerntheorie)? Beschreiben Sie diese Theorien etwas näher. 31. Stellen Sie die wesentlichsten Beiträge der Konflikttheorien, der Theorien der Angstkomponenten und der ethologisch orientierten Theorien der Entstehung von Angststörungen dar. 32. Zu den Prozessen der Angstbewältigung: Stellen Sie die Einteilung des basalen Beurteilungsprozesses in der Angstbewältigung als einen mehrstufigen Prozess dar. 5 33. Wie wird in der Folge zwischen Ziel und Methode der Bewältigung unterschieden? Was bedeutet es, dass die Bewältigungsreaktionen entweder nach innen oder nach außen gerichtet sind? 34. Inwiefern kann man sagen, dass es bei der Bewältigungsreaktion darum geht, die Konsequenzen, die sich für das Selbstbild ergeben, emotional zu verarbeiten? 35. Vulnerabilitätsmarker für die Entwicklung von Angststörungen: Inwieweit sind Temperament und Angstsensibilität Marker für eine erhöhte Anfälligkeit für Angststörungen? Was ist mit Angstsensibilität gemeint und welche komorbiden psychiatrischen und medizinischen Störungen treten häufiger zusammen mit Angststörungen auf? 36. Vulnerabilitätsmarker für die Entwicklung von Angststörungen: Was können Sie zur erhöhten Reaktivität des autonomen Nervensystems, zu psychophysiologischen Funktionen, zu Schaltkreisen im Zusammenhang mit Angststörungen, zu den Atmungsfunktionen und zu Transmitter-Störungen bei den Angststörungen sagen (neurochemische und neurohormonale Faktoren)? 37. Vulnerabilitätsmarker für die Entwicklung von Angststörungen: Was wissen Sie über die Aufmerksamkeit gegenüber Drohungen sowie zu Umgebungseinflüssen auf die Angstentstehung? 6 Fragen zu Kapitel 3: Affektive Störungen 38. Symptome der Depression: Können Sie das komplexe Bild der Depression in seiner Vielfalt beschreiben? Welche Bestandteile muss man hierzu rechnen? 39. Welche Formen unterscheidet man bei bipolaren Störungen (was zeichnet bipolare Störungen I aus, was bipolare Störungen II)? Welches System der Verhaltenssteuerung kann man sich generell als zugrunde liegend vorstellen? 40. Wieweit wird heute noch an der Vorstellung einer stärker biologisch fundierten Störung festgehalten? Was wären wesentliche Merkmale einer solchen „melancholischen“ Form oder der „endogenen“ Depression? 41. Welche weiteren biologischen Merkmale kennzeichnen die melancholische Depression? Was sind die Merkmale des Schlafprofils, was sind die Merkmale in der Hormonausscheidung? 42. Was sind die vielfachen Merkmale der Manie nach DSM-IV? Wie und wann kommt eine manische Episode bevorzugt vor? 43. Genetisch bedingte Vulnerabilität für depressive Störungen: Was gibt es an Untersuchungen über die Heritabilität bei der uni- und bipolaren Form der Depression? 44. Nennen Sie zentrale Merkmale der Entwicklung von Kindern depressiver Eltern. 7 Fragen zu Kapitel 4: Gliederung affektiver Beeinträchtigung – Angst und Depression 45. Wie wird die Relation von Angst und Depression gesehen und was sind die Merkmale eines gemischten Angst-Depressionssyndroms? Fragen zu Kapitel 5: Schizophrenie – Denkstörungen als Achsensydrom 46. Welche Untergruppen der Schizophrenie unterscheidet man? 47. Wie würden Sie den Beitrag Kraepelins und jenen Bleulers zur Entwicklung der Diagnose Schizophrenie im Einzelnen charakterisieren? 48. Wie ist der Beitrag der Heidelberger Schule und insbesondere Kurt Schneiders zur Definition diagnostischer Kriterien für die Schizophrenie – und welche Kriterien verwendet DSM-IV? Wie sieht Kurt Schneider den Unterschied zwischen den Symptomen ersten Ranges und den Symptomen zweiten Ranges? 49. Beschreiben Sie die diagnostischen Kriterien und die wesentlichen Merkmale der Prodromal- und der Residualsymptome der Schizophrenie, die im DSM-II angeführt werden! 50. Beschreiben Sie die diagnostischen Kriterien und die wesentlichen Merkmale der schizoaffektiven Störungen. Charakterisieren Sie wichtige neuere Entwicklungen in diesem Bereich (Kölner Studie, Häufigkeit der verschiedenen Formen schizoaffektiver Störungen)! 8 51. Was wissen Sie über die diagnostische Zuordnung kurz dauernder und akuter Psychosen in verschiedenen Ländern und über die diesbezüglichen Ergebnisse der Langzeitstudie in Halle? 52. Inwieweit liegt bei der Schizophrenie eine Aufmerksamkeitsstörung vor? Wie wurde dies bereits von Kraepelin gesehen und wieso wird dem heute wieder größere Beachtung geschenkt? 53. Stellen Sie den klassischen Fall einer Wahnstörung in der deutschsprachigen Psychiatrie (Hauptlehrer Wagner) kurz vor und heben Sie das Besondere an der Wahnstörung nach DSMIV hervor! 54. Gehen Sie auf zwei Interpretationsmöglichkeiten der Bewusstseinstörung bei der Schizophrenie ein: auf die Störung des IchBewusstseins und die Störung des Ich als Auswahlprozessor! 55. Beschreiben Sie die Bereiche bzw. Merkmale der Denkstörung bei der Schizophrenie nach Cutting und gehen Sie auf die Unterscheidung zwischen inhaltlichen und formalen Denkstörungen ein! 56. Stellen Sie die klassische Definition von Wahn durch Jaspers sowie eine neuere Definition durch Oltmans dar. 57. Stellen Sie Versuche dar, die wesentlichen Merkmale des Wahns zu erfassen und in Komponenten zu gliedern. 58. Inwieweit kann der Wahn durch Affekt- bzw. Persönlichkeitsstörungen oder aber durch Wahrnehmungsdefizite erklärt werden? 59. Inwieweit kann der Wahn durch eine Störung der Rationalität und des Denkens erklärt werden? 9 60. Was sind formale Denkstörungen und anhand welcher Merkmale kann man diese Denkstörungen beurteilen (Einteilung der Merkmale der Denk-, Sprach- und Kommunikationsstörung nach Andreasen)? 61. Erläutern Sie Details zu den Sprachstörungen bei der Schizophrenie (z. B. bei der Verwendung von Kohäsionsmitteln) oder zum Arbeitsgedächtnis bei Schizophrenen. 62. Stellen Sie die wesentlichen Auffälligkeiten schizophrener Patienten bei der Wahrnehmung (etwa Auffälligkeiten bei der Gesichterwahrnehmung oder qualitative Merkmale der Halluzinationen im Vergleich zu organisch bedingten Halluzinationen) dar. 63. Inwiefern und in welchen Bereichen sind bei schizophrenen Patienten auch die Emotionen beeinträchtigt? 64. Stellen Sie die wesentlichen Bewegungsstörungen bei der Schizophrenie dar und erläutern Sie das Konzept der positiven und negativen Symptome. 65. Was weiß man heute über den Verlauf der Schizophrenie im Allgemeinen und über den Verlauf der kognitiven Beeinträchtigung im Speziellen? 66. Was sind die Merkmale einer früh beginnenden Form der Schizophrenie (Early-Onset-Schizophrenie)? In welchen Bereichen zeigen sich v. a. erste Auffälligkeiten? 67. Wieweit bestehen im Verlauf Geschlechtsunterschiede? 68. Wie ist insbesondere der Verlauf der kognitiven Beeinträchtigung? Wieweit bestehen hier Untergruppen, wieweit sind die Auswirkungen auf verbale und nonverbale Anteile des IQ gleich? 10 69. Was wissen Sie über die Bedeutung der neurokognitiven Beeinträchtigungen für das längerfristige alltägliche Zurechtkommen schizophrener Patienten? 70. Beschreiben Sie von der Stadieneinteilung des Verlaufs der Schizophrenie einerseits das Trema und andererseits die ersten drei Merkmale der apophänen Phase (Apophänie des Angetroffenen, Wahnwahrnehmung, Bekanntheits- und Entfremdungserlebnisse). 71. Beschreiben Sie außer den ersten drei Merkmalen weitere Merkmale der apophänen Phase (Erlebnis der Omnipotenz, Anastrophe, Apophänie des Innenraums, Veränderungen des Denkgefüges etc.) sowie die übrigen Stadien des Verlaufs (apokalyptische Phase, Konsolidierung und Residualzustand). 72. Welche Hinweise durch radiologische Untersuchungen, CTUntersuchungen etc. gibt es für eine Veränderung der Hirnstruktur? 73. Welche neuropsychologischen Theorien zur Erklärung der schizophrenen Störung, welche Befunde zur Erklärung durch körperliche Krankheiten und durch Störungen des Transmitterhaushalts sind Ihnen bekannt? 74. Welche Unterteilung der Symptomatik in wenige Bereiche ist Ihnen außer der Zweiteilung in positive und negative Symptome noch bekannt? 75. Wie hat Frith (1992) versucht, das Zustandekommen von verbalen Halluzinationen zu interpretieren? 76. Wieweit erklären Schwierigkeiten bei der Bildung von Metarepräsentationen die Probleme schizophrener Menschen beim Verständnis sozialer Hinweisreize? 11 77. Wie kann es nach Frith (1992) bei der Schizophrenie zu ähnlichen Problemen wie bei der reduplikativen Paramnesie kommen? 78. Wie plausibel ist es, dass der Schizophrenie eine Störung im Transmitterhaushalt des Dopamins zugrunde liegt? 79. Wie groß ist das genetische Risiko für Verwandte schizophrener Patienten nach den klassischen Familienstudien, Zwillingsund Adoptionsuntersuchungen? 80. Was sagt das Konzept der Schizophrenie-Spektrum-Störung und der Schizotaxie über die genetischen Faktoren, die für die Schizophrenie verantwortlich sind, aus? Was wissen Sie über den Vererbungsmodus bei der Schizophrenie? 81. Erläutern Sie neuere Zugänge zur Untersuchung der genetischen Übertragungsmechanismen: Linkage-Untersuchungen, Assoziationsstudien mit Kandidaten-Genen, Antizipationen, das Velo-kardio-faciale Syndrom und Bemühungen um eine Spezifizierung des Phenotyps für molekulargenetische Untersuchungen. 12 Fragen zu Kapitel 6: Organisch bedingte psychische Störungen 82. Erläutern Sie die Wurzeln der Auseinandersetzung mit den organisch bedingten psychischen Störungen im deutschen Sprachraum und die heutige Einteilung der Störungsbilder. 83. Welche Störungen im Bereich der Affektivität und der Kognition deuten auf eine organische Genese hin? 84. Wieweit trifft dies für den Bereich des Gedächtnisses, der globalen Adaptation, der Schlafstörungen und der produktiven Symptome zu? 85. Was können Sie über die Ursachen, die Hauptmerkmale und die Differentialdiagnose der Demenz berichten? 86. Was wissen Sie über das Delir und das amnestische Syndrom, seine Merkmale und den Verlauf? 87. Beschreiben Sie die organische Halluzinose, das organische Wahnsyndrom, das organische affektive Syndrom, die organische Persönlichkeitsveränderung und Dämmerzustände. 13 Fragen zu Kapitel 7: Somatische Therapieverfahren 88. Erläutern Sie generell die medikamentöse Behandlung von Angststörungen, die Pharmakologie der Benzodiazepine und die Behandlung der generalisierten Angststörung durch Medikamente. 89. Was können Sie über die medikamentöse Therapie der Panikstörung berichten? 90. Was wissen Sie über die medikamentöse Therapie der Sozialphobie, des Posttraumatischen Stresssyndroms und der Zwangsstörung? 91. Was fällt Ihnen zur medikamentösen Behandlung von affektiven Störungen und zur Behandlung mit trizyklischen Antidepressiva ein? 92. Was können Sie über die Behandlung mit Monoaminooxidase (MAO)-Hemmern und die Antidepressiva der zweiten Generation bzw. die selektiven Serotonin-Reuptake-Inhibitoren (SSRIs) sagen? 93. Welche offenen, nur unzureichend geklärten Fragen gibt es in der medikamentösen antidepressiven Behandlung? 94. Was wissen Sie über Medikamente zur Maniebehandlung und zur Rückfallprophylaxe, primär bei bipolaren Störungen? 95. Was wissen Sie über die Schlafentzugs- bzw. Wachtherapie und die Lichttherapie? 96. Stellen Sie die Grundprinzipien sowie die Indikationen für die Anwendung einer Elektrokrampftherapie dar. 14 97. Erläutern Sie die Anwendung der Elektrokrampftherapie bei Manie und Schizophrenie, die Kontraindikationen und die Durchführung der EKT, die Elektrodenplatzierung, Stimulusdosierung und Funktionsweise. 98. Welche Prinzipien und Erfahrungen gibt es bei der Neuroleptika-Behandlung der Schizophrenie? 99. Beschreiben Sie Wirkmechanismus, Effektivität, Nebenwirkungen, Rückfälle, Kosteneffektivität, Behandlung in der ersten Phase und Erhaltungsbehandlung mit atypischen antipsychotischen Medikamenten. 100. Welche Auswirkungen der medikamentösen Behandlung auf die neurokognitiven Defizite der Schizophrenie und welche experimentellen medikamentösen Behandlungen gibt es? 15