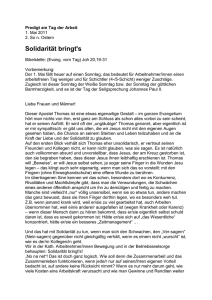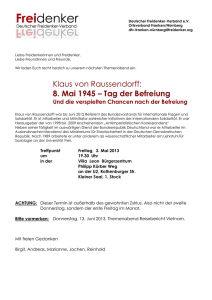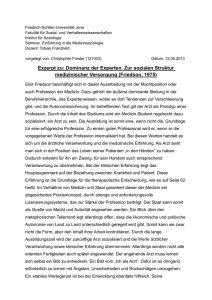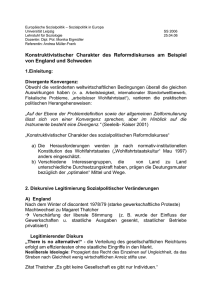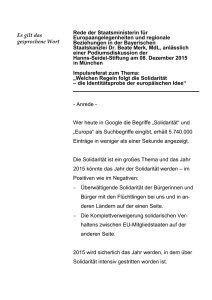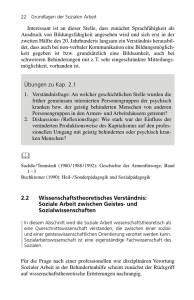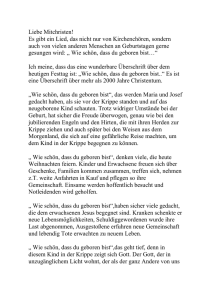Zwischen gerechter und ungerechter Gesellschaft
Werbung

Beiträge np 4/2006 Christian Wevelsiep Zwischen gerechter und ungerechter Gesellschaft Zur Frage des politischen Mandats der helfenden Professionen Einleitung Die Kritik an der Gesellschaft, in der wir leben, hat zur Zeit Hochkonjunktur. Dies betrifft nicht allein die z. T. sehr zugespitzten Diskussionen um problematische Auswüchse des Kapitalismus – es betrifft zumal Bereiche und Tendenzen kapitalistisch verfasster Gesellschaften, für welche die beliebten Etiketten der Leistung, des Wachstums und des Fortschritts nicht mehr greifen oder zumindest mehr Fragen als Antworten zulassen. Das Verhältnis zwischen den helfenden Berufen und der gegenwärtigen Gesellschaft scheint dabei beispielhaft die Schwierigkeit zum Ausdruck zu bringen, die Notwendigkeit der Kritik in eine akzeptable Form zu bringen. Denn es ist sicher ein Leichtes, Gesellschaftskritik nach einem rein konfrontativen Muster wahr zu nehmen, doch gerät man schnell in eine argumentative Sackgasse, wenn man etwa die Option der Kritik an der Leistungs- und Wachstumsgesellschaft gegen die vermeintlich »affirmative« Option ausspielt – man also nur »für« oder »gegen« die Gesellschaft sein kann. Dass diese scheinbare Alternative eher dialektisch zu vermitteln ist, ist eine Einsicht, die zwar unmittelbar einleuchtet, die aber zugleich im jeweiligen konkreten Bereich ausbuchstabiert werden müsste. Aus Sicht der helfenden Professionen ist hier die »Rückgewinnung der sozialen Gerechtigkeitsperspektive« (Wilken, 2002) angesichts der Verknappung der »Ressource Solidarität« (Gröschke, 2002: 286) oberste Priorität einzuräumen, aber: Mit einem solchen normativen Bekenntnis wird die inhaltliche Reflexion des sozialpädagogischen Mandats nicht abgeschlossen, sondern erst eröffnet. Das heißt: Die Reflexion über das, was mit sozialer Gerechtigkeit verknüpft wird, kann sich nicht mit der Einforderung einer solidarischen Gemeinschaft begnügen, sondern ihr muss eine gerechtigkeitstheoretische Tiefe verliehen werden. Um zumindest zu einer Skizze einer solchen politischen Reflexion zu gelangen, sollen, ausgehend von sehr heterogenen pädagogischen, schulischen, politischen und »biopolitischen« Beispielen, die Umrisse eines solchen Verständnisses nachgezeichnet werden. Um mit einem drastischen Beispiel aus der pädagogischen Praxis zu beginnen: In einer der letzten Ausgaben der »Zeitschrift für Heilpädagogik« wurde über eine bis dahin wenig rezipierte pädagogische Konzeption der schulischen Erziehungshilfe, der sogenannten »Konfrontativen Pädagogik« berichtet (Musial/ Trüter, 2005). Hierbei handelt es sich um einen eklektischen Ansatz, der sich aus Elementen der Gestalttherapie, der provokativen Therapie und selektiven lerntheoretischen Elementen zusammensetzt und sich dabei an diejenigen Schülerinnen und Schü- Ambivalenz der Gesellschaftskritik Verknappung der Ressource Solidatität 371 np 4/2006 Wevelsiep, Zur Frage des politischen Mandats der helfenden Profession ler wenden soll, die an verschiedensten Hilfemaßnahmen und -systemen scheiterten und deren destruktives Verhalten zu einem festen Lebens- und Überlebensmuster geworden ist. Eine wesentliche Komponente dieses Konzepts besteht in der Inszenierung einer Konfliktsituation, in der das Fehlverhalten durch Handlungen und eine bewusst vulgäre Sprache dramatisiert wird, um so das Muster der Verweigerung zu durchbrechen. Auch auf die Gefahr hin, eine umfassende Darstellung des pädagogischen Kontextes zu vernachlässigen, soll kurz veranschaulicht werden, was hier mit »Konfrontation« und »Härte« gemeint ist. Zur Praxis der »konfrontativen Pädagogik« »Thema: Regeleinhaltung 13:15., Mittagessen. Ein Kind überprüft, ob alle gerade und ruhig sitzen, dann wünscht es einen guten Appetit. Die Kinder beginnen, den Erwachsenen und sich gegenseitig lebhaft von ihrem Schulalltag zu berichten. Xaver (Pädagoge) ermahnt Malte (Kind), den Arm zu heben beim Essen. Xaver steht auf, geht zu Malte und nimmt ihm das Besteck weg: »Du kannst ohne Besteck weiter essen.« Er setzt sich wieder hin. Malte rührt sich nicht. Xaver (lauter) »Du isst wie ein Schwein. Malte, du brauchst kein Besteck. Wenn du isst wie ein Schwein, kannst du es auch richtig machen. Iss!« Malte weint. Ansonsten rührt er sich nicht. Nach einer Weile steht Xaver auf, nimmt die Hände des Jungen, vermengt mit diesen die Nahrung auf dem Teller und stopft ihm das Essen in den Mund. Dabei sagt er mit lauter, fester Stimme: »Iss doch. Wie ein Schwein, Malte, wie ein Schwein! Malte weint immer mehr. Xaver holt einen großen Spiegel und stellt diesen vor Malte. Dieser wird aufgefordert, ihn anzusehen. Wolf (Pädagoge) steht auf, geht zu ihm und hält seinen Kopf fest, so dass Malte in den Spiegel schauen muss. Malte wird gefragt, wie er aussehe. Es wird vorgegeben, dass er auf die Frage zu antworten habe: »Wie ein Schwein.« (Musial/Trüter, 2005: 219) Natürlich muss man die Drastik dieser Konfrontation in ihrem Kontext betrachten: Die Pädagogen berauben die Kinder ihrer abweichenden Lebensstrategien, was unumgänglich zu schmerzhaften Erlebenszuständen wie Angst, Verwirrung und Trauer führt und es geht in dieser Phase weniger um die kognitive Einsicht als mehr um die emotionale Erfahrung der Bedeutung von Regeln und Regelverstößen, also um einen von außen erzeugten Leidensdruck, zu dem die Kinder vermeintlich nicht mehr fähig sind. Im Anschluss an diese Phase schließt sich nach den Autoren die Hinwendung zu erwünschtem Verhalten entlang intrinsischer Motivationen und verstärkter positiver Methodiken an. Es kann nicht überraschen, dass diese Methodik in der Fachöffentlichkeit zwiespältig und kontrovers diskutiert wurde. Es gäbe eine lange Reihe von pädagogiNotwendige schen, psychologischen, moralischen und rechtlichen Implikationen, die hier Kritik zunächst zu klären wären, insbesondere wäre die Legitimität dieses Ansatzes selbst zu klären, insoweit die Personenrechte und Menschenrechte der Kinder betroffen sind, die ja hier für einen spezifischen Moment außer Kraft gesetzt werden. Jenseits dieser überaus notwendigen und dringlichen Diskussionen sollen die Überlegungen aber in eine ganz andere Richtung laufen, die sich auf die gesellschaftspolitischen und normativen Bedingungen richten. Das heißt, von der Frage der Legitimität/Illegitimität zur Frage zu kommen, vor welchem gesellschaftlichen Hintergrund überhaupt eine solche Notwendigkeit von Härte und Konfrontation artikuliert wird. Die Begründung der Indikation steht dann, wie zu zeigen ist, als ein möglicher Ausdruck für gewisse gesellschaftspolitische Tendenzen, für die man verschiedene Anzeichen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, hier: pädagogischen, sozialpolitischen und medizinischen Entwicklungen heranziehen kann (1). 372 Wevelsiep, Zur Frage des politischen Mandats der helfenden Profession np 4/2006 Dies führt zur These, dass die moderne Gesellschaft von mehreren Seiten gefährdet ist, zu einer desintegrativen Gesellschaft zu werden (2). Um dieser Gefahr zu begegnen, bedarf es abschließend einer Konturierung des Inklusionsbegriffs und darüber hinaus einer Rekonstruktion des Solidaritäts-Gedankens (3), für den dann abschließend die Unterscheidung von Reinheit und Unreinheit geltend gemacht wird. Gesellschaftspolitische Tendenzen (1) Die konfrontative Methodik ist, wie das eingehende Beispiel offenbarte, durch verschiedene Paradoxien gekennzeichnet. Dies betrifft die Ebene der Interventionsmethodik wie auch die Ebene der Persönlichkeitstheorie, da hier zunächst Beziehungs- und Erlebenswelten in einem gewissen Sinne abgebaut werden, um sie anschließend wieder aufzubauen. Jenseits dieser psychologisch wie rechtlich streitbaren Ebene interessiert hier aber die Ebene der Indikation: Die Kinder, die für die genannten Interventionsformen in Frage kommen, lassen sich mit den Autoren als »extrem grenzenlos, extrem werte- und orientierungslos« beschreiben (ders.: 20), als Kinder, die vehement Regeln und Normen verletzen und die für sich und andere akute Gefährdungen darstellen. Maßgeblich und für die folgenden Überlegungen wegweisend halte ich hier die Selbstbeschreibung einer »ultima-ratio« Logik. Diese »ultima ratio« wird dann eingesetzt, wenn alles andere versagt hat, wenn also das Ausmaß an destruktiven Haltungen so groß geworden ist, dass nur noch drastische Maßnahmen greifen. Mit dieser eher dünnen Begründung eines pädagogisch intuitiven Ausnahmerechts wird aber zugleich deutlich, dass es sich hier um zumindestens zwiespältige Diagnoseprozesse handelt, denn: wer entscheidet hier über die Grenzdefinition, die anzeigt, ob die genannte »ultima ratio« greift oder nicht? Eine reflektierte diagnostische Skepsis ist hier sicherlich angebracht, die betont, dass unterschiedlichste Variablen ins Spiel kommen können und auch eine eher hermeneutische oder rein praktische Erfahrung mahnt hier zur Zurückhaltung: Die kategoriale Trennung in Auffälligkeit und Erziehungsunfähigkeit lässt sich nicht ohne weiteres aufrecht erhalten. Damit kommen wir aber zu den gesellschaftlichen Bedingungen und Hintergründen, die die Grenzwertigkeit dieses Unternehmens zuspitzen. Denn es geht ja nicht allein um Aspekte gelingender Identitätsbildungs- und Sozialisationsprozesse, sondern auch um gesellschaftliche Eingliederungsprozesse, welche unter anderem auf die Frage der Leistungsfähigkeit des Bildungssystems verweisen. In diesem Kontext trifft man auf weitere problematische Entwicklungen, die sich etwa der beliebten Etikette »Pillen für den Störenfried« zuordnen lässt. Jenseits einer ausführlichen Diskussion über die Legitimität und Wirksamkeit medikamentöser Therapien bei Verhaltensstörungen muss zunächst darauf aufmerksam gemacht werden, dass wir es nicht nur im Kontext der Debatte um ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom) mit einem veränderten Wahrnehmungsbewusstsein und Rezipientenverhalten zu tun haben. Dies betrifft nicht allein die messbare Nachfrage und Produktion der entsprechenden Medikamente (Ritalin), es betrifft zugleich eine spürbare Normalisierung des Konsum- und Verschreibungsverhaltens . Auch hier haben wir also eine Grenze, die teils offen, teils verdeckt verschoben wird zugunsten eines funktionaleren, effizienteren Leistungsklimas (vgl. Jantzen, 2001). Tendenz der »ultima ratio« Medikation bei Verhaltensstörungen 373 np 4/2006 Wevelsiep, Zur Frage des politischen Mandats der helfenden Profession Man muss für die genannten Prozesse und Tendenzen nicht gleich das Foucault‘sche Theorem der Biopolitik heranziehen, aber man sollte einen dritten Aspekt gesellschaftspolitischer Entwicklungen hinzuziehen, die sich in der Tat auf bioethische Zusammenhänge beziehen, und hierfür müssen wir einen Bogen von pädagogischen zu politischen Zusammenhängen schlagen, insbesondere zur aktuellen Individualisierungsrhetorik, welche die einschlägigen sozialpolitischen Diskurse beherrscht. Jenseits der prominenten risikosoziologischen Konnotationen der Freisetzung Stichwort »Individuali- aus traditionellen Milieus und Zugehörigkeiten (Beck, 1986), zielt der Begriff sierung« Individualisierung vor allem auf sozialpolitische Vorstellungen, wonach der Einzelne als »seines Glückes Schmied« und mithin als selbstverantwortlich für sein Wohl und Wehe betrachtet wird. Während dies schon im Rahmen arbeitsmarktpolitischer Debatten zu problematischen Aussagen und Schlussfolgerungen führen mag, mündet eine rigorose Individualisierung im Rahmen wohlfahrts- und sozialstaatlicher Praxis in Tendenzen der Entsolidarisierung, bzw. mit Wilken im »Verlust der Selbstevidenz des Sozialen« (Wilken, 2001: 59). Rigide Unterscheidungen zwischen »Arbeitsscheuen« und »-tüchtigen« 374 Das heißt konkret: Dem globalen Trend neoliberalistischer Wirtschaftspraxis folgend werden Sozialleistungsgebote in eine Marktlogik gepresst sowie bislang sozialrechtlich gesicherte staatliche Zuständigkeiten in Frage gestellt. Die dabei kursierende Rhetorik einer »neuen« Balance zwischen Solidarität und Eigenverantwortung dürfte auch dem politisch Uninteressierten bekannt sein; sie eröffnet aber eine politische Interpretationsfreiheit, die gerade in sozialpädagogischen Zusammenhängen problematisch erscheint. Auch bezogen auf das Verhältnis von Lohnarbeit und gesellschaftlicher Integration ergibt sich eine spannungsreiche und krisenhafte Situation: die über Sozialversicherungen und garantierte soziale Leistungen vermittelte Form der sozialen Integration scheint nicht mehr zu greifen. Damit wächst die Orientierungslosigkeit, für die der Neoliberalismus eine hoch problematische soziale Unterscheidung bereit hält: zwischen »Arbeitssscheuen« und »Arbeitstüchtigen«. Nur auf der Oberfläche hat die neoliberale Optik eine sozialintegrative Funktion, denn es kann mit Gröschke (2002: 280) damit gerechnet werden »dass wie früher für die »würdigen Armen«, die »unverschuldet« arm werden – z. B. Behinderte, Alte, Kranke, Waisen – ein finanziell verschlanktes Modell von Caritas/Fürsorge wieder in Kraft gesetzt wird, während für die Arbeitsscheuen repressive Formen der Arbeitserziehung und -ertüchtigung gewählt werden, die ihre »imployability« (die ehemalige »Industriosität«) gewährleisten sollen«. Mit anderen Worten: der gesellschaftliche Auftrag der Inklusionsvermittlung kann hier nur dann erhalten werden, wenn zwischen »gesund und tüchtig« einerseits, »unvermit- telbar« und »unbrauchbar« andererseits unterschieden wird. Zugleich und darüber hinaus muss aber der Wert der »Anerkennung des Anderen« (Honneth, 2000) mitreflektiert werden. Es ist relativ unstrittig, dass dies eine rigide neoliberale Vergesellschaftung nicht leisten kann, insoweit sie die Vorstellung vom selbstbestimmt und eigenverantwortlich lebenden Bürger über Gebühr betont, der seine eigenen Entscheidungen trifft, um die von ihm angestrebte Lebensqualität zu verwirklichen. Unser gesellschaftliches Leben wird also zunehmend durch Individualisierungsdynamiken und Individualisierungszumutungen gekennzeichnet. Und in speziell diesem sozialpolitischen Zusammenhang muss auch die Frage nach der biopolitisch gefährdeten Gesellschaft gestellt werden, die von den aufgezeigten pädagogischen und sozialpolitischen Tendenzen keineswegs so weit entfernt ist, wie man glauben mag. Ein Blick auf die aktuelle Debatte um das sogenannte »Therapeutische Klonen« und den jüngsten Wissenschaftsskandal ist hier instruktiv, wenn man die Begleitsemantik sowie die symbolpolitischen Hintergründe untersucht, die etwa die biopolitischen Ereignisse um den koreanischen Forscher Hwuang begleiteten. Am 12. Februar 2005 erschien eine Briefmarke in Korea zum Jahrestag des vermeintlich ersten geklonten menschlichen Embryos, die von den westlichen Medien zunächst als südasiatische Bizarrerie abgetan wurde. Die Bilderfolge zeigt einen Mann, der im Rollstuhl sitzt, aufsteht, läuft und schließlich eine Frau umarmt, der also polemisch gesprochen, den perfekten Heilungsprozess von der Krankheit über die Leichtathletik zur Erotik durchläuft. Wevelsiep, Zur Frage des politischen Mandats der helfenden Profession Der durch den späteren Forschungsskandal desavouierte Forscher Hwuang hatte diese Briefmarke in einen Vortrag integriert, der u. a. Ende September in Berlin gehalten wurde und bei dem eine nahezu hermetische Bilderfolge in Gang gesetzt wurde: Denn die Sondermarke stand neben dem Foto des an Alzheimer erkrankten Präsidenten Reagan, des gelähmten Schauspielers Christopher Reeve und dem bewegungsunfähigen Stephen Hawking. In der Mitte dieser Leidpiktographie thronten Fotos aus der Petrischale mit Stammzellen kreisen (vgl. Süddeutsche Zeitung vom 31.12.2005: 27). Es ist nun auf der einen Seite bemerkenswert, dass die humanistische Sprengkraft eines solchen Wissenschaftsverständnisses erst jetzt das eigentliche mediale Interesse erfährt, seit die vermeintliche Scharlatanerie und der wissenschaftliche Betrug skandaliert wurden; das meines Erachtens eigentliche Politikum geht aber auf eben jenen biopolitischen Subtext zurück, der zuvor zumindestens eine südasiatische Nation in Atem hielt. Die Wende von einer externen zu einer internen Körperpolitik, die hierzulande zumindest kontrovers diskutiert wird, hatte im koreanischen Raum zu diesem Zeitpunkt eine hoch problematische Melange ergeben; einer Trias aus Patriotismus, Wissenschaftsgläubigkeit und Bilderglauben. Ein euphorisches bis hysterisches Klima ließ sich hier für eine unkritische, sicher auch nationalistische Teilöffentlichkeit nachweisen, die aber im bundesrepublikanischen Raum zumindest halbherzig aufgenommen wurde, hält man sich vor Augen, dass von Regierungsseite gefordert wurde, gesetzliche Regelungen im Lichte neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse zu revidieren und restriktive Gesetzgebungen zum therapeutischen Klonen zu ändern (ebd.). Ein solchermaßen von den wissenschaftlichen und politischen Eliten forcierte Drift zur biopolitischen Gesellschaft hat nun konkrete Folgen für die Ebene des Einzelnen. np 4/2006 Biopolitische Entwicklungen Auch Behinderung wird in diesem Zusammenhang oft als individuell zu verantwortendes Schicksal aufgefasst, wenn nicht gar als Konsequenz persönlichen Fehlverhaltens. Culpative Stigmatisierungen, etwa im Kontext der Pränataldiagnostik bei Down-Syndrom, die auch durch medienvermittelte Teilinformation gefördert wird, kann zur Negierung sozialer Verantwortung führen und entsolidarisierend wirken. Das heißt, im Zuge der Ausweitung pränataler diagnostischer und interventiver Verfahren wird die bestehende gesellschaftliche Tendenz zur Individualisierung noch verstärkt; die politische Programmatik des Sozialstaatsabbaus, die durch neue Verteilungskonflikte, von Deregulierungs- und Globalisierungsrhetorik gekennzeichnet ist, wird zugleich in eine biopolitische Atmosphäre der Perfektibilität gestellt: Der Marktwürdigkeit und Verwertbarkeit des neoliberalen Menschenbildes entspricht ein medizinisch-technisches Denken, das mittels prädiktiver Medizin und gentechnologischer Grenzerweiterungen einen unverhohlenen Fortschrittsoptimismus verbreitet. Der perfekte und durch keine Leistungsabweichungen eingeschränkte Mensch steht anerkanntermaßen auf der Agenda der biopolitischen Gesellschaft (vgl. dazu kritisch: Emmrich, 1999) – und es bedarf keiner allzu großen Vorstellungskraft, sich die Gefährdungen vor Augen zu halten, die langfristig durch die Allianz neoliberaler Gesellschaftspolitik mit der biopolitischen Umwandlung von Menschen in Sachen entstehen. Desintegrative Gesellschaft (2) Betrachten wir den Gesamtkontext der hier behaupteten Gefährdungen, dann ist bei all dem aber zu betonen, dass es sich bei den genannten Tendenzen und Gefährdungen um stets mögliche Grenzüberschreitungen und Grenzverschiebungen handelt, die für eine Gesellschaftsdiagnose nicht konstitutiv, nicht umfassend sind. In diesem kritischen Sinne lässt sich aber das politische Mandat der helfenden Professionen zusammenfassen: als Form der Kritik an gesellschaftlichen Erosionsprozessen, bei denen eine humane Wertebasis zunehmend gefährdet wird. Deren 375 np 4/2006 Defensive Minimalpädagogik oder offensive Bildungsund Sozialpolitik? Ambivalenz der gerechten Gesellschaft Wevelsiep, Zur Frage des politischen Mandats der helfenden Profession normative Position ist angesichts dessen durch eine eigentümliche Spannung gekennzeichnet, denn sie befindet sich in einer defensiven Lage, die sie aufgrund ihres normativen Selbstverständnisses von Beginn an vermeiden will und muss. Die eingeforderte Rückgewinnung des sozialen Zusammenhalts wird berechtigterweise mit der Frage nach den sozialen Bindekräften konfrontiert – also mit der Frage nach der möglichen Stärkung der Politik, bei der Vielfalt, Heterogenität und Differenz Anerkennung finden (Eberwein, 1999). Eine hieraus resultierende offensive Bildungs- und Sozialpolitik ist etwa durch das offensive Eintreten für das Lebensrecht, eine möglichst selbstbestimmte Daseinsentfaltung und partizipative Lebensgestaltung sowie durch eine humane Bildungsrechtsposition gekennzeichnet, die im Gegensatz zu einer defensiven Minimalpädagogik über das »Bildungsexistenzminimum« hinausweist (Gröschke, 2002; Lutz, 2005). Ist aber die sozialpädagogische Reflexion über das, was ihr politisches Mandat ausmacht, damit schon abgeschlossen? Die Frage ist dann zu verneinen, wenn man das Politische im Allgemeinen und die Demokratie im Besonderen als einen offenen Bereich der Gesellschaft betrachtet, bei dem der hegelsche »Kampf um Anerkennung« immer wieder aufs Neue zu definieren ist. Die pädagogische und politische Diskussion über das, was das Gemeinwesen ausmacht oder ausmachen sollte, ist also als notwendig offen zu betrachten; es gibt aber verschiedene Wege, diese Offenheit zu gefährden. Die Reflexion des politischen Mandats muss nämlich Gefährdungen von zwei Seiten begegnen: zum einen der Gefahr einer funktionalistischen und technologischen Engführung, bei der »ultima-ratio-Logiken«, bioethische und neoliberale Ausschlussprozeduren dominieren. Zum anderen aber muss sie auch der Gefahr begegnen, ihre eigenen ethischen und moralischen Ansprüche in einer reinen Interessenpolitik münden zu lassen, d. h., eine elaborierte normative Reflexion müsste ein Gespür dafür entwickeln, dass offene und wohlfahrtsstaatlich organisierte Gesellschaften auf der einen Seite und tendenziell wohlfahrtschauvinistische oder hegemoniale Gesellschaften auf der anderen keinen bipolaren und klar getrennten Gegensatz bilden, sondern dass die Drift vom einen zum andern Zustand stets möglich und nie ganz ausgeschlossen ist (vgl. Greven, 1999). Der gerechten Gesellschaft ist im Horizont der Weltgesellschaft stets das Risiko der Selbstverengung eingeschrieben. Um dieser doppelten Frontstellung gerecht zu werden, soll im Folgenden der Inklusionsbegriff konturiert werden, um im Zuge dessen zu einem nicht-reduktiven Begriff von Solidarität und Anerkennung zu gelangen. Inklusion und Solidarität (3) Der hier zugrunde gelegte Gebrauch des Begriffs Inklusion baut insofern auf einer anthropologischen Werteentscheidung auf, dass der Mensch nicht erst zu habilitieren sei, sondern im anthropologischen Sinne immer schon »habilis« sei, also : geeignet, nicht defekt, sondern unversehrt ist und damit seine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft nicht zu Disposition steht. Daneben bedingt der Begriff aber auch einen Anspruch auf subsidiär umfassende, ganzheitliche Nachteilsausgleiche i. S. einer Kollektivverantwortung gegenüber den Betroffenen. Zuletzt folgt aus dieser Definition des Rehabilitationsbegriffs das pragmatische Ziel der Ermöglichung von Partizipation an Lebensentscheidungen und Entscheidungsprozessen mit allen Rechten und Pflichten. 376 Wevelsiep, Zur Frage des politischen Mandats der helfenden Profession np 4/2006 Um diesen Inklusionsgedanken aber nun in eine politisierbare Logik zu übersetzen, ist es notwendig, den Solidaritätsbegriff, der ja hier im Hintergrund wirksam ist, aus seiner Eindimensionalität zu befreien und ihn von einer rein interessen- Inklusion und politischen Lesart abzugrenzen. Vor allem die Anerkennungsterminologie, die Interessenvon dem Frankfurter Sozialphilosophen A. Honneth auf ein elaboriertes Niveau politik gehoben wurde, ist in der Lage, diesem Anspruch zu genügen (Honneth, 2000; Stinkes, 2002). Der Begriff der Anerkennung wird hier zu einem moralphilosophischen Grundelement, das die konkurrierenden Begriffe der Verteilungsgerechtigkeit oder auch der Fürsorge nicht ersetzen, aber umfassen kann. Honneth beschreibt hier eine Noch-Nicht-Struktur, die die Ausdifferenzierung von Anerkennungssphären als moralischen Fortschritt, die Erweiterung von Individualisierung und die Steigerung sozialer Anerkennung als sozialmoralische Verbesserung, insgesamt also wachsende Inklusion als Ausdruck eines liberaldemokratischen Ideals beschreibt und begreift. Wenn aber Gesellschaften aus Sicht ihrer Mitglieder nur in dem Maße legitime Ordnungsgefüge darstellen können, indem sie sich dazu in die Lage versetzen, verlässliche Ebenen der Anerkennung auf unterschiedlichen Ebenen zu gewährleisten, wenn ferner deren Bedingungen unter das normative Ziel persönlicher Identitätsbildung und individueller Selbstverwirklichung gestellt werden, dann müssen diese normativen Prinzipien die Ebene des Allgemeinen verlassen. Sie müssen konkret werden und damit ergibt sich keine reine Ableitungslogik, keine reine lineare Steigerungslogik, sondern ein nicht-reduktives Spannungsfeld. Auf unsere Problematik übertragen heißt das, dass der Begriff der Solidarität durchaus in seiner Ambivalenz sichtbar wird, denn er bezieht die vielfachen Konnotationen mit ein, ohne sie zu überspielen und er übergeht auch nicht die Widersprüche, die etwa zwischen partikularistischer und universalistischer Solidarität entstehen kann. Aus der sozialpädagogischen Diskussion sind die einschlägigen Differenzen ja bekannt: Autonomie gegen Fürsorge, paternalistische Wohltätigkeit oder Nächstenliebe im Nahbereich? Jenseits dieser Dualismen ist hier zu betonen, dass erst die Komplexität des umfassenden Anerkennungsbegriffs in der Lage ist, das politische Mandat der helfenden Professionen zum Ausdruck zu bringen. Eine Konzentration auf eines dieser Elemente würde nicht nur die Anerkennungsterminologie verkürzen, sondern sie könnte auch in politische Sackgassen führen. Der Bezug auf universale Solidarität könnte die Chiffre einer »gerechten Gesellschaft« absolut setzen, die aber ausschließlich moralische, kaum politische Kategorien behandelt. Und damit sind wiederum problematische As- pekte verbunden, denn damit ist zugleich die Gefahr verbunden, die Unbedingtheit des inklusiven Anspruchs entweder im Allgemeinen und Abstrakten verschwimmen zu lassen, ohne konkret werden zu müssen oder schlimmer: Exklusions- und Ausschlusstendenzen werden nur so verschoben, dass sie nicht mehr sichtund wahrnehmbar sind. Denn hier wie dort stellt sich ja die Frage: Wer spricht hier für welche Gesellschaft, welche gesellschaftlichen Gruppen, für welches »wir«? Mit der Zugrundelegung eines unbestimmten »Wir« versichert sich der Sprechende der Reinheit seiner Aussagen durch Entgrenzungsrhetorik: Alles muss zur Sprache kommen, niemand darf ausgeschlossen werden. Universelle Solidarität? Gleichermaßen würde eine Konzentration auf partikulare Solidarität entweder im Systemwiderspruch oder in problematischen Verteilungskämpfen (auch etwa innerhalb der Fachdisziplinen) münden oder einfach zur Verschiebung von Ausschlussprozeduren führen. Partikularistische und universalistische Solidarität stehen also nicht in einem rein komplementären oder additiven Verhältnis, sondern sie bilden einen nicht-reduktiven Zusammenhang, der nur als unreiner 377 np 4/2006 Solidarität im Zwielicht Partikularistische Verengungen 378 Wevelsiep, Zur Frage des politischen Mandats der helfenden Profession verstehbar ist. D. h. es ist trivialerweise keineswegs so, dass eine Steigerung der partikularen Solidarität zu einer Steigerung der Gesamtrationalität führen würde. Gleichwohl können wir auf partikulare oder Kampfsolidarität nicht verzichten, denn diese ist ja, wie gezeigt, für eine offensive Sozialpädagogik geradezu konstitutiv. Schließlich führte auch eine Überbetonung oder Isolierung des Verteilungsgerechtigkeits- oder des Subsidiaritätsgedankens in die genannte neoliberale Sackgasse, insofern dieser die Idee der Solidarität ersetzt und nicht bloß ergänzt. Die auch für alle helfenden Berufe konstitutiven Elemente der Parteinahme, der Bindung, der Loyalität, der Zugehörigkeit werden also in einem reduktiven Begriffsrahmen unter Wert gehandelt, wenn man sich auf eines der genannten Elemente konzentriert. Es ist nun eben dieser Punkt, der die behauptete Politik der Reinheit plausibel macht. Reinheit meint hier eine normative Grundorientierung im Anschluss an die Dekonstruktion von Derrida, welche kategoriale, erkenntnistheoretische und damit auch ethische »Wahrheiten« von ihrem verschmutzten, vertrübten oder kontaminierten Anteilen frei hält (Derrida, 2000; Bonacker, 2002). Der Schmutz ist hier immer das Andere, das einer nicht-gewollten, einer fremden oder nicht geordneten Gesellschaft und deren Systemen anzulasten ist. Unreine Politik hingegen ist nun keineswegs mit einer selbstgenügsamen Perspektive zu verwechseln, die das nicht zu leugnende Unrecht, Ungleichheiten und Ausgrenzungen achselzuckend registriert. Die Politik der Unreinheit ist vielmehr als ein Unterscheidungsvermögen zu kennzeichnen, das die Gesellschaftskritik um entscheidende Nuancen verändert. Sie lässt sich nicht in klaren und reinen Kategorien oder Formeln wiedergeben, sondern sie kann nur innerhalb dieses Spannungsfeldes lesbar gemacht werden. Was bedeutet dies nun für die Frage nach der »gerechten Gesellschaft« ? Das Irritierendste einer Politik der Differenz, bzw. der Unreinheit ist die Überwindung des Phantasmas der Zugehörigkeit und der Ordnung zugunsten eingeschränkter, begrenzter und unvollkommener Zugehörigkeiten. Es geht, mit anderen Worten, darum, Anerkennungspolitik nicht zur reinen Interessenpolitik ausarten zu lassen, die letztlich immer von der Tendenz bedroht wird, den Ausschluss Anderer zu produzieren und ihn gleichzeitig als unhintergehbares Problem der Anderen zu verbergen. Betrachten wir noch einmal die eingangs genannten Gefährdungen, dann bleibt festzuhalten: Dem Bezug auf eine solidarische oder gerechte Gesellschaft liegt immer auch eine ausschließende Logik zugrunde, ohne dabei zwangsläufig chauvinistisch zu sein; »Alle« sind nie wirklich »Alle«: Die Grundlage des geteilten »Wir« geht tiefer, denn sie kann weder in Richtung eines völlig unbestimmten Universalismus aufgelöst werden; auch können soziale Zusammenhänge wie Bindungen, partikulare Interessen, Loyalitäten nicht reinlich hiervon getrennt werden. Um für den schleichenden und nicht immer offensichtlichen Prozess zunehmender Ausschlussprozeduren ein Sensorium zu entwickeln, muss sich das hierfür erforderliche kritische Denken eine nicht-reine Selbstbeschreibungsform gestatten und dies halte ich nicht zuletzt für eine entscheidende Leerstelle, welche die Selbstreflexion der helfenden Professionen begleitet. Sobald soziale Anerkennung als Forderung konkret wird, wirkt sie und schließt insofern aus, denn in jedem Modell der Anerkennung des anderen finden sich Annahmen darüber, was »Wir« sind oder sein sollten. Jede Politik der Anerken- Wevelsiep, Zur Frage des politischen Mandats der helfenden Profession nung kann folglich nur dann gelingen, »wenn sie die Grenze der Anerkennbarkeit benennt und durch diese Benennung die imaginäre Linie zieht, bis zu der Wir noch von Wir sprechen können« (vgl. Mecheril, 2003: 50 f.). Die Gefahr, die hier für die einzelnen pädagogischen Fachdisziplinen besteht, ist leicht nachzuvollziehen und doch schwer auf einen Nenner zu bringen. Genannt seien nur – die problematischen Verteilungskämpfe im schulischen und sozialpädagogischen Bereich, der allzu schnelle Vorwurf illegitimer Ressourcenverschwendung, – die stets präsente Gefahr einer Politisierung des Ressourcen-EtikettierungsDilemmas, – der historische Rückblick etwa auf die Zeit der Weimarer Republik, hier zeigt sich, wie schnell sich die humanistischen Professionen einer Semantik der Grenzdefinition des Brauchbaren und Nützlichen andienen, wie schnell also ein inklusiver Anspruch in rigide Differenzen umschlagen kann: zwischen denen, die ein vermeintlich parasitäres Dasein führen und denen, denen es »wirklich schlecht geht.« (vgl. Brill, 1993). Für die helfenden Professionen ist also eine zentrale Aufgabe darin begründet, sich verstärkt mit den paradoxen Bedingungen ihres Mandats auseinander zu setzen und die genannten Spannungen zwischen Interessenpolitik und partikularen Anliegen, zwischen der Leistungsgesellschaft und der »gerechten Gesellschaft« in ihrer Widersprüchlichkeit zu benennen und sie nach keiner Seite hin vorschnell aufzulösen. Wenn man nun die berechtigte Frage stellt, in welchen praktischen und politischen Konkretionen dies alles münden kann oder soll, dann wäre man gezwungen, eine Dialektik auf der Höhe des einzelnen Satzes zu fingieren; d. h. die Artikulation und Rekonstruktion diese Spannungsfeldes ist mit den logischen Mitteln der Sprache möglicherweise nicht einzufangen. Was aber konkret benennbar bleibt, ist die Präsenz und Virulenz gesellschaftlicher Exklusion. Greift man noch einmal das eingangs genannte Beispiel der »ultima-ratio-Logik« des pädagogischen Ausnahmezustands auf, dann liegt hier die größte Gefahr möglicherweise nicht allein in der Gewalt an sich begründet, sondern im latenten Prozess der Dekategorisierung; Dekategorisierung freilich in einem gegenläufigen Sinne, als eine der Inklusion verpflichtete Humanwissenschaft verfolgt. Dekategorisierung meint hier einen Zerfallsprozess gesellschaftlicher Selbstverständlichkeiten, als ein Prozess des Unsichtbarmachens von Menschen, die sich den etablierten Kategorien nicht zuordnen, zuordnen lassen oder in diesem Fall nicht zuordnen wollen. Der radikale Andere, für den, wie gezeigt, immer neuere Techniken der Funktionalisierung erfunden werden, er kann also in diesem Sinne nicht einfach »nur« geschützt oder verteidigt werden; seine Existenz muss immer wieder aufs Neue gegen die Tendenz verteidigt werden, ihn jenseits einer Grenze zu verorten. np 4/2006 Selbstreflexion der helfenden Profession Literatur Beck, U., 1986: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt M. Bonacker, T. 2002: Die Gemeinschaft der Dekonstruktion. In: Kern, A./Menke, C. (Hg.): Philosophie der Dekonstruktion. Frankfurt a. M: 264–289 Brill, W., 1993: Pädagogik im Spannungsfeld von Eugenik und Euthansie. Saarbrücken Dederich, M., 2002: Postmoderne – Pluralisierung – Differenz: Soziologisch, ethische und politische Implikationen. In: Greving/Gröschke, 2002: 33–57 379 np 4/2006 Wevelsiep, Zur Frage des politischen Mandats der helfenden Profession Derrida, J., 2000: Politik der Freundschaft. Frankfurt/M. Eberwein, H., 1999: Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Behinderungen lernen gemeinsam. Weinheim Emmrich, M, (Hg.) 1999: Im Zeitalter der Biomacht. 25 Jahre Gentechnik – ein kritische Bilanz. Frankfurt/ M. Feuser, G, 1990.: Für Lebensrecht und Integration. Gegen die Unvernunft der Euthanasie. In: Mitteilungen des Landesamtes Bremen 15: 4 – 71 Ders., 2002: Integration – eine conditio sine qua non im Sinne kultureller Notwendigkeit und ethischer Verpflichtung. In: Greving/Gröschke: 221–237 Greven, M.T., 1999: Die politische Gesellschaft. Kontingenz und Dezision als Probleme des Regierens und der Demokratie. Opladen Greving, H./Gröschke, D., 2000: Ein praxeologisches Fazit oder Versuch einer Zwischenbilanz. In: Ders. (Hg.): Geistige Behinderung – Reflexionen zu einem Phantom. Ein interdisziplinärer Diskurs um einen Problembegriff. Bad Heilbrunn: 201–210 Greving, H./Gröschke, D. (Hg.), 2002 : Das Sisyphus-Prinzip. Gesellschaftsanalytische und Ggesell-schaftskritische Dimensionen der Heilpädagogik. Bad Heilbrunn Gröschke, D., 2002: Was auf dem Spiel steht – die normativen Grundlagen der Wohlfahrt und des Sozialstaats. In: Greving/Gröschke, 2002: 271–293 Honneth, A., 2000: Das Andere der Gerechtigkeit. Frankfurt/M. Kissler, A., 2005: Die beiden Räder des Fortschritts. In: Süddeutsche Zeitung vom 31. 12. 2005: 27 Musial, R./Trüter, C.: Härte und Sanktionen statt Empathie und Mitgefühl – die konfrontative Pädagogik als letzte Chance für die Erziehungshilfe. In: Zeit- schrift für Heilpädagogik 2005 (6): 219–225 Hansen, E., 2005: Das Case/Care Management. Anmerkungen zu einer importierten Methode. In: neue praxis. Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik, 2005 (2): 107–126 Jantzen, W., 2001: Über die soziale Konstruktion von Verhaltensstörungen. Das Beispiel ADS. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 2001 (6): 221–231 Kersting, W., 1997: Recht, Gerechtigkeit und demokratische Tugend. Frankfurt/M. Lutz, R., 2005: Erschöpfte Sozialarbeit? Eine Rekonstruktion ihrer Rahmungen. In: neue praxis. Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik, 2005 (2): 126–145 Mecheril, P., 2003: Politik der Unreinheit. Ein Essay über Hybridität. Wien Rawls, J., 1975: Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt/ M. Rösner, H. V., 2001: Jenseits moralisierender Anerkennung. Reflexionen zum Verhältnis von Macht und Behindertsein. Frankfurt/New York Schildmann, U., 2002: Leistung als Basis-Normalfeld der postmodernen Gesellschaft. Kritisch reflektiert aus behindertenpädagogischer und feministischer Sicht. In: Bundschuh, K. (Hg.): Sonder- und Heilpädagogik in der modernen Leistungsgesellschaft. Bad Heilbrunn: 125–133 Stinkes, U, 2002: Zur schwierigen Frage nach der Anerkennung – Fürsorge oder Solidarität für Menschen mit Behinderung? In: Greving/Gröschke: 203–221 Wilken, U., 2002: Die Rückgewinnung einer sozialen Gerechtigkeitsperspektive angesichts von Individualisierung und Ökonomisierung des Sozialen. In: Greving/Gröschke: 57–89 Verf.: PD Dr. paed. habil. Dr. phil. Christian Wevelsiep, Surkenstr. 160 b, 44797 Bochum E-Mail: [email protected] 380