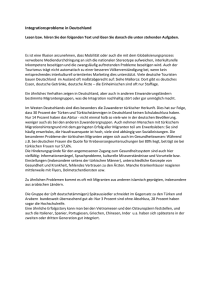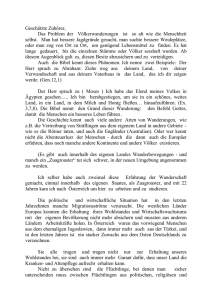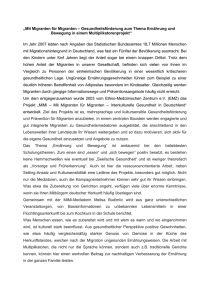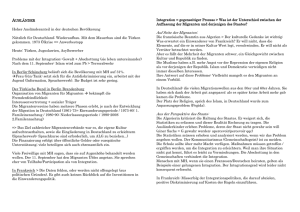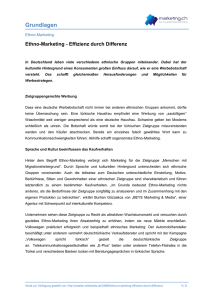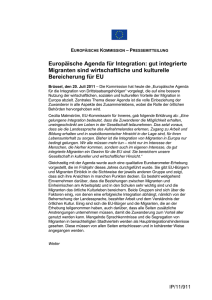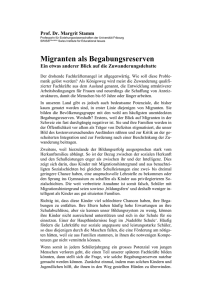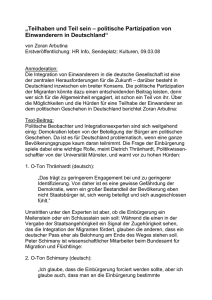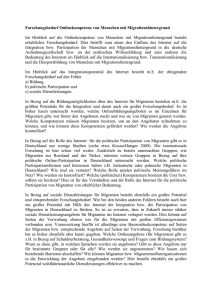Teil 2 - Refugio Stuttgart
Werbung

Traumafolgestörungen 2. Die Symptomatik, die so „verrückt“ erscheint, ist in Wirklichkeit eine normale Reaktion auf eine schreckliche und unmenschliche Situation, die niemals hätte passieren dürfen. 3. Die von anderen Menschen ausgeübte physische, sexuelle, strukturelle oder psychische Gewalt hat politische und/ oder gesellschaftliche Hintergründe. Ich lehne als Therapeut/in diese Gewalt ab. Es bedarf einer therapeutischen Beziehung, die ganz besonders von Vertrauen und Sicherheit geprägt ist. Sicherheit bedeutet aus der Sicht eines Gewaltopfers zuallererst äußere Sicherheit. Das meint die Abwesenheit der Täter, also auch das Vertrauen in die Therapeut/in und die dahinter stehende Organisation, die den Rahmen für die Beratung oder Therapie bietet. Dieses Vertrauen kann nur geschöpft werden, indem die Therapeut/in eindeutig gegen diese Gewalt Position bezieht und sich auf die Seite der Betroffenen stellt – UND gleichzeitig die Klient/in nicht auf das „Opfer“ reduziert, sondern auch Ressourcen und Stärken der Klient/in sieht und benennt. Äußere Sicherheit als notwendige Bedingung für die weitere, innere Stabilisierung ist jedoch in unserem Kontext, wie zuvor beschrieben, schon allein durch den unsicheren Aufenthaltsstatus und die oft als bedrohlich erlebten Unterbringungen meist nicht gegeben. Psychotherapie gerät vor diesen Hintergründen oft zu einem Balanceakt namens „Stabilisierung unter extrem instabilen Bedingungen“. Wie kann man eine sinnvolle stabilisierende Arbeit vor dem Hintergrund dieser permanenten äußeren Destabilisierung überhaupt anbieten, ohne selbst gewissermaßen unglaubwürdig 08 zu werden? Als erstes, indem wir zuhören, die Gewalt nicht leugnen oder nichts davon wissen wollen. Indem wir dies gemeinsam versuchen zu ertragen, vielleicht auch nur gemeinsam wahrzunehmen, diese Unerträglichkeit äußerer Bedingungen in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Wesentlich daran ist, dass es ein gemeinsamer Versuch ist, der Unmenschlichkeit etwas entgegen zu setzen: Indem wir uns in Beziehung begeben und zuhören, mitfühlen und nach Hilfen suchen, stärken wir das Vertrauen auf das Positive, die Hoffnung. Wir ermutigen dazu, trotz allem nicht aufzugeben und trotz allem weiter nach vorhandenen Ressourcen zu suchen und neue zu aktivieren. Auf den ersten Blick scheint das wenig zu sein, aber es ist nicht wenig. Das melden uns die Betroffenen oft zurück: „Als ich heute morgen auf dem Kalender gesehen habe, dass ich bei Ihnen heute wieder Termin habe, war ich so froh! Wissen Sie, es tut mir so gut, wenn ich mit Ihnen reden kann, dann ist mir wieder etwas leichter. Denn bei Ihnen, da kann ich über diese Dinge sprechen, die mir so schwer sind.“ Dipl. Psych. Ulrike Schneck Psychologische Leitung der Regionalstelle Tübingen Bekanntlich konzentriert sich die öffentliche Wahrnehmung von Traumafolgestörungen auf die sogenannte PTBS, die Postraumatische Belastungsstörung, deren Nachweis auch bei Gerichten immer wieder als Voraussetzung für die Zuerkennung einer Aufenthaltsberechtigung vorausgesetzt wird. Wir wissen jedoch inzwischen, dass es mehrere Verlaufsformen von Traumafolgestörungen gibt, die von unterschiedlichen Untersuchern unterschiedlich bewertet werden, und auch in den diagnostischen Manualen (ICD, DSM) sind keine adäquaten Darstellungen zu finden. Im Wesentlichen wird hier eine Komorbidität unterstellt, so als hätte die betroffene Person zwei Krankheiten. Tatsächlich ist es so, dass es unterschiedliche Verlaufsformen in der Verarbeitung von Traumafolgestörungen gibt. Eine häufige Möglichkeit ist die depressive Verarbeitung, die einher geht mit einer allgemeinen Antriebsminderung und generellen Freudlosigkeit. Häufig ist auch die angstbetonte Verarbeitung, oft verbunden mit sozialen Phobien oder auch einer generalisierten Angststörung. Weiterhin ist die dissoziative Bewältigungsform von großer Wichtigkeit, bei der es zur Spaltung verschiedener Bewusstseinszustände kommt, wobei das hierfür entscheidende Kriterium ist, dass der Betroffene in einem BewusstseinsZustand nichts vom anderen Bewusstseins- Zustand weiß. Eine weitere Möglichkeit ist die paranoide und psychotische Abwehr des traumatischen Geschehens. (Bei Interesse findet sich hierüber eine ausführliche Darstellung im Band 1/2015 der Zeitschrift „Trauma“.) Sowohl für die Diagnostik als auch für die Therapie ist es wichtig, mögliche traumatische Hintergründe von Angsterkrankungen, depressiven oder paranoiden Störungen zu erwägen, da man anderenfalls Gefahr liefe, am eigentlichen Problem vorbei zu therapieren. Zur Zeit meines Medizin-Studiums galt es weithin als unsinnig, Menschen mit schweren psychischen Störungen psychotherapeutisch behandeln zu wollen, obwohl dies selbstverständlich schon sehr viel früher (z.B. Freud 1911) bedacht worden war (auch TraumafolgeStörungen wurden noch kaum thematisiert). Insbesondere Frieda Fromm-Reichmann (z.B. Fromm-Reichmann 1950) hat dann zu schweren Störungen des seelischen Erlebens vielfältiges Material dargestellt, und auch ihre späteren Mitarbeiter haben dazu beigetragen, biographische Zusammenhänge psychotischer Zustände zu beschreiben. Im Vordergrund standen damals, wie auch heute, im Rahmen der biologischen Psychiatrie, die Abweichungen und Auffälligkeiten im Verhalten, Überlegungen zur Genetik und Nachdenken über eventuelle Transmitterkonstellationen, wobei hier selbstverständlich das Verhältnis zwischen Phänomen und Epiphänomen unreflektiert blieb. Dass psychische Einflüsse, z. B. im Rahmen von Traumatisierungen, zu einer Veränderung der Transmitterkonzentration führen, dürfte selbstverständlich sein; ebenso erscheint es aus psychosomatischer Sicht unausweichlich, dass körperliche Dispositionen sich auf die seelische Verarbeitung auswirken. Die jetzt aktuellen Forschungen zur Epigenetik (d.h., der lebensgeschichtlichen re- aktiven Aktivierung oder Deaktivierung von Genomabschnitten, teilweise auch über Generationen hinweg) existierten damals noch nicht. Es geht also nicht darum, die messbaren biochemischen Korrelate von schwerwiegenden psychischen Störungen zu übersehen, sondern die Entstehungsbedingungen derartiger Veränderungen ins Auge zu fassen. Dies hat weitreichende theoretische und praktische Folgen. So würde man aufgrund der jetzt bestehenden diagnostischen Kriterien davon ausgehen müssen, dass nicht wenige historisch bedeutende Menschen unter einer schweren Persönlichkeitsstörung, teilweise unter einer wahnhaften Störung gelitten haben (mit oft traumatischer Ätiologie, z.B. A. Hitler), was selbstverständlich immense Auswirkungen auf ihr gesellschaftliches Umfeld gehabt hat. Aber auch in der Gegenwart ist deutlich, dass wahnhafte Störungen zu Fehlhandlungen führen, die für die Gemeinschaft in hohem Maße bedrohlich sind. Auf der anderen Seite besteht ein Problem darin, dass hierarchisch und autoritär strukturierte Gemeinschaften dazu tendieren, Abweichungen von ihrer Wirklichkeitssicht als krankhaft, gegebenenfalls psychotisch zu definieren, um die gegebenen Strukturen und die bestehende Wirklichkeitsinterpretation nicht in Frage stellen zu müssen (als Beispiel mag das Problem des Galilei dienen, oder Solschenizyn). Die Definition, was psychotisch und was normal ist, was realitätsgerecht ist und was nicht, unterliegt immer den jeweiligen sozialen Bedingungen. Dies gilt selbstverständlich auch für die vermuteten Auslöser, ob sie nun genetisch, dämonisch, toxisch oder posttraumatisch vermutet werden. Es ist in vielem eine Glaubensfrage. Ein sinnvoller therapeutischer Umgang mit schweren, gegebenenfalls psychotisch anmutenden Störungen muss selbstverständlich alle diese Faktoren mit berücksichtigen. Zentral geht es jedoch darum, das Erleben des jeweiligen Betroffenen zu verstehen, und einen Weg aus der individuellen Angst und – inneren oder äußeren - Bedrohtheit zu finden. Zur Krankheitsentstehung Es dürfte inzwischen klar sein, dass ein Zusammenhang zwischen der Entstehung schwerer psychischer Krankheitsbilder, einschließlich schizophrener Psychosen, und schweren traumatischen Lebenserfahrungen besteht (Schatz 2009). Dabei kann es sich sowohl um frühkindliche Traumatisierungen als auch um nicht verarbeitbare Traumata im Erwachsenenalter handeln. Nun könnte man denken, dass die ätiologische Zuordnung solange bedeutungslos ist, wie eine angemessene Behandlung erfolgt („Diagnosen sind Schall und Rauch“). Dies wäre akzeptabel, wenn nicht die entsprechenden Diagnosen immense therapeutische und soziale Folgen hätten. Noch immer ist es so, dass die Diagnose einer schweren psychischen Störung in aller Regel zu einer ausschließlichen oder zumindest vorrangigen psychopharmakologischen Behandlung führt, wohingegen eine psychotherapeutische, insbesondere psychodynamische Behandlung eher bei weniger „schweren“ Erkrankungen erwogen wird. 09 Zur Abwehr Dass es einen Zusammenhang zwischen Trauma-Verarbeitung und psychotischer Symptombildung gibt, dürfte als belegt gelten (Schatz berichtete über 25 – 40% Koinzidenz in der Literatur, in unserer Auswertung der Befunde von schwer traumatisierten Menschen fanden sich 26% paranoide kürzere oder andauernde psychotische Episoden (Soeder 2009)). Wieweit nun primär eine durch Schmerz bzw. Affektsturm ausgelöste Bedrohung der Ich-Funktionen besteht, oder ob es unerträgliche Erfahrungsinhalte sind, die durch Spaltungsabwehr bewältigt werden sollen, d.h., was die Ich-Kohärenz in erster Linie bedroht, kann oft nicht entschieden werden – zumeist wohl beides. Hinsichtlich des überwältigenden Affektes dürfte es zumeist Angst sein, oft gepaart mit Schmerz. Soweit es lebensgeschichtlich bereits zu einem hinreichend sicheren Objekt kommen konnte, wird dessen Verlust befürchtet; wenn es noch kein sicheres Objekt gab, droht der Verlust des sicheren Ortes, an den das gefährdete Ich sich zurückziehen könnte (Steiner 1993). Gemeinsam ist jedenfalls allen Situationen, die zur Gefährdung der Ich-Kohärenz führen, dass es sich um intrusive Ereignisse handelt, also Ereignisse, denen gegenüber es nicht die Wahl zwischen „Flüchten oder Standhalten“ gibt (Richter 1976), also nicht einem letztlich „neurotischen“ Konflikt, sondern um eine existentiell hoffnungslose Situation, die den betroffenen Menschen in ausweglose Hilflosigkeit bringt. Dies kann sowohl durch krankheitsbedingte Auslieferungssituationen (z. B. ein Kind mit einem konnatalen Anfallsleiden) als auch sozial bedingte Ereignisse bedingt 10 sein. Damit ist, denke ich, der entscheidende Punkt gegeben, nämlich dass diese Ereignisse die üblichen Abwehrmöglichkeiten des Ichs überwältigen. So entspricht es auch in vielem der frühen Darstellung durch Freud. Bei der Beobachtung der einsetzenden Abwehr fallen nun verschiedene Dinge auf. Die primäre Abwehr scheint fast grundsätzlich in einer Spaltung zu bestehen. Diese kann jedoch, abhängig vom jeweiligen Menschen, unterschiedliche Formen annehmen. Wo der eine vielleicht wie ein Automat zu funktionieren beginnt, tritt bei einem anderen eine Schockstarre ein; ein Dritter verfällt in ein für den Außenstehenden nicht oder kaum nachvollziehbares Agieren oder Fantasieren. Bei den meisten wird jedoch der Affekt abgespalten, er ist nicht mehr integriert. In dem einen Falle verschwindet der Affekt aus dem Bewusstsein, im anderen Falle überwältigt der Affekt das Bewusstsein, so dass die Seite des potentiell handlungsfähigen Ichs nicht mehr bewusst ist; im Dritten kommt es zur Fragmentierung mit teils wechselnden, teils auch unvereinbaren Bewusstseinsbruchstücken. Unter den (potentiell) restitutiven Abwehrvorgängen findet sich in erster Linie die Identifikation; damit ist gemeint, dass das Individuum sich mit dem vermuteten Sinn des Ereignisses identifiziert (Strafe Gottes, gerechte Strafe für eigene Schuld, schicksalhafte Prüfung etc.). Je nach Umständen führt diese Art von Abwehr auch zu einer Identifikation mit dem Aggressor, was gerade bei Kindern häufig der Fall ist (Papa hatte ganz recht, mich zu verprügeln, ich bin ja ein so schlechtes Kind). In diesem Fall wird der prügelnde Vater (oder auch der sexuell missbrauchende Vater) letztlich in die ÜberIch-Struktur integriert, und bestimmt von daher das weitere Leben. Hier führt der Weg in die depressive Verarbeitung. Aus dieser Konstellation kann dann eine weitere Entwicklung erfolgen, die sich als Idealisierung der Angst beschreiben ließe. Diese Idealisierung kann in unterschiedlicher Weise erfolgen. Kriegserfahrung oder ähnliche Katastrophen wurden mit dem Wort „Per aspera ad astra“ (Durch das Harte zu den Sternen) idealisiert. Ein Persönlichkeitsideal besteht im Heldenmythos, der alle Schwierigkeiten überwindet, heute häufig in Form von Kriminalromanen oder Comics. Diese Idealisierung dient dazu, die traumatische Situation nicht nur zur Normalität, sondern eben zu einem Idealzustand zu machen, d.h., mit dem IchIdeal zu fusionieren; im Gegensatz zur depressiven Verarbeitung, die den Opfer-Modus zur vorherrschenden inneren Situation macht, wird hier die Identifikation mit dem Täter zur vorherrschenden Thematik in der Angstbewältigung. Auch auf diesem Weg kann eine Integration traumatischen Erlebens geschehen, wenn dabei auch zumeist wichtige und für die Beziehungsgestaltung unverzichtbare Erfahrungsbereiche, insbesondere das Affekterleben, dauerhaft abgespalten bzw. eingefroren werden müssen. Das andere Extrem wäre die unmittelbare Umsetzung der eigenen destruierenden Lebenserfahrung in Destruktion der Welt; auch hierfür haben wir hinreichend historische Beispiele. Selbstverständlich gibt es auch hier Übergangsformen. Manchmal spielen bei diesen Übergangsformen dissoziative Phänomene eine hervorragende Rolle, so dass ein Teil einer Persönlichkeit eine künstlerische (im Sinne der Externalisierung) oder karitative (im Sinne der altruistischen Abtretung) Bewältigung der Traumatisierung anstrebt, während ein anderer Teil die eigene traumatische Erfahrung mehr oder minder unverarbeitet weiterreicht. Zur therapeutischen Beziehung Das therapeutische Ziel kommt meines Erachtens im Titel eines Buches von Ruth Riesenberg-Malcom (2003) überzeugend zum Ausdruck: „Unerträgliche seelische Zustände erträglich machen“. Tatsächlich geht es nicht darum, primär Einstellungen oder Verarbeitungswege des Patienten zu verändern; soweit dies möglich werden kann, wird es sich zu einem späteren Zeitpunkt ergeben. Vielmehr geht es zunächst darum, den unerträglichen Hass, sowohl Fremdhass wie Selbsthass, die unerträgliche Einsamkeit und den unerträglichen seelischen Schmerz schrittweise zu akzeptieren, bewusst werden zu lassen und, soweit möglich, zu entgiften. Um dies zu ermöglichen, ist im Rahmen einer psychodynamischen Therapie die Ermöglichung einer tragfähigen therapeutischen Beziehung unerlässlich. In manchen, ebenfalls psychodynamisch begründeten Verfahren wird nahegelegt, hier mit eher suggestiven Verfahren („Sicherer Ort“, „Tresor“ usw.) zu arbeiten. Diese Vorgehensweise hat meines Erachtens zwei Nachteile: Zum ersten wirkt sie intrusiv, was von Menschen, die nahe der Ich-Auflösung sind, schwer toleriert wird, und zum anderen verlagern sie die Notwendigkeit der frühen personalen Bindung als Substitut für die missglückte primäre Bindung in einen entleerten, menschenlosen Raum. Der „sichere Ort“ kann für den schwerst gestörten Menschen oft nur in einer tragenden Beziehung liegen, nicht in einer selbst entwickelten Phantasie; dies würde seine Isolation und Einsamkeit nur noch vergrößern. Voraussetzung für eine solche tragfähige Beziehung ist meines Erachtens ein seitens des Behandlers begehrensfreies Beziehungsangebot im Sinne von Bion. Bei Menschen, deren psychische Grenzen, sei es aus Gründen genetischer Disposition, sei es aus Gründen biografischer Erfahrung, extrem verletzlich sind, kann das erste Gesetz für den Therapeuten nur darin bestehen, die Grenzen, soweit er sie überhaupt wahrnehmen kann, zu respektieren. Bereits der Wunsch an den Patienten, er möge anders sein, bedeutet eine Überforderung für beide. Noch schlimmer ist es selbstverständlich, wenn das Begehren des Behandlers auf die Beziehung Einfluss nimmt. Grundsatz müsste eine durchgehend abstinente, dabei von der Grundhaltung her empathische Beziehung sein, die aber auf Deutungen im traditionellen Sinn zumeist verzichtet. Insofern erscheint mir hier der Ansatz von Benedetti, den er als „Positivierung“ im Rahmen der Psychosenpsychotherapie bezeichnet, naheliegend und sinnvoll; es bedeutet nichts anderes als die Wertschätzung und Würdigung der Anstrengungen des Patienten, mit den ihn quälenden inneren und äußeren Ereignissen zurecht zu kommen. Hier geht es zum einen um die „lebensgeschichtliche Identitätsforschung“, zum anderen um die Phantasien und Assoziationen des Therapeuten, die, als Externalisierungen bzw. projektive Identifizierungen verstanden, dem Therapeuten die Verdauung des ihm anvertrauten Materials erleichtern können, und, in vorsichtiger Form, dem Patienten eine eventuell neue, alternative Sicht seiner inneren Problematik vermitteln können. Diese Interventionstechnik verzichtet insbesondere auf alle in irgendeiner Weise vorwurfsvoll oder fordernd zu verstehenden Formulierungen, im Bewusstsein, dass der betroffene Mensch von dieser Art Interaktion in seinem Leben mit Sicherheit schon mehr als erträglich erfahren musste. Zu diesem Artikel schicken wir auf Anfrage unter info@ refugio-stuttgart.de gern eine vollständige Literaturliste zu. Dr. Thomas Soeder 2. stellvertretender Vorstandsvorsitzender, refugio stuttgart e.v. 11 Die medizinische Versorgung von Migranten in Deutschland: Erfordernisse aus ärztlicher Perspektive Was wissen wir über die Gesundheitssituation von Migranten in Deutschland? Mit der wachsenden Zuwanderung in den letzten Jahren wird Fragen der Gesundheit und der medizinischen Versorgung von Migranten in verschiedenen Fachdisziplinen zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt. Dies zeigt sich in entsprechenden Spezialisierungen, etwa in der Geburtshilfe, Psychiatrie und in den Pflegewissenschaften, sowie in der steigenden Zahl an epidemiologischen, kultur- und sozialwissenschaftlichen Studien, die sich dem Thema `Migration und Gesundheit´ in den letzten 15 Jahren gewidmet haben. Die Ergebnisse dieser Forschungsvorhaben wurden auf Grundlage von Migrationsdaten in Publikationen im Auftrag des Bundes (Razum 2008; Kohls/BAMF 2011) und politischer Stiftungen (Knipper, Bilgin 2009) zusammengefasst und ausführlich erörtert. Hierbei wurde auch auf zahlreiche methodische Limitationen bisheriger Erhebungen hingewiesen, bei denen unzureichend Berücksichtigung fand, dass es sich bei `den Migranten´ um eine äußerst inhomogene Bevölkerungsgruppe handelt, die sich nicht leicht definieren lässt. Aus diesem Grunde sind generalisierende Aussagen stets kritisch zu sehen, was auch für einige Studienergebnisse zu Erkrankungsrisiken von Migranten im Vergleich zur deutschen Bevölkerung zutrifft: Bei Kindern von Migranten fanden sich in bundesweiten Erhebungen vergleichsweise häufiger Gesundheitsprobleme wie Übergewicht, Anämien (Blutarmut), Zahnkaries sowie psychosomatische Störungen, während allergische Erkrankungen, Asthma sowie Mittelohrentzündungen und Bronchitiden seltener 12 nachzuweisen waren. Unter türkischstämmigen Erwachsenen wurden im Vergleich zur sonstigen Bevölkerung in Deutschland häufiger Herz-Kreislauferkrankungen - mit einem im Durchschnitt um 10 Jahre früheren Auftreten von Herzinfarkten bei Männern – nachgewiesen. Ähnliches gilt für vergleichsweise höhere Raten an Diabetes mellitus, Krebserkrankungen der Lunge und des Magen-Darmtrakts sowie für das häufigere Vorkommen von Arbeitsunfällen. Auch werden bei Migranten durchschnittlich häufiger psychische und psychosomatische Erkrankungen beschrieben. Daneben ist in diesen Personengruppen auch das Auftreten von Infektionserkrankungen wie Tuberkulose, HIV sowie Hepatitis B und Hepa- Probleme der medizinischen Versorgung und der Nutzung von Gesundheitsdiensten titis C überproportional hoch. pietreue) und häufigeren Arztwechseln. Auch Zu Fragen des Verhaltens von Migranten im Krankheitsfall und zur Inanspruchnahme deutscher Gesundheitsdienste wurden aus den Studien der letzten Jahre folgende Schlussfolgerungen gezogen: Hiernach bestehe im Vergleich zur sonstigen Bevölkerung eine im Durchschnitt größere Medikamentengläubigkeit, einhergehend mit einer mangelnden Compliance (Therawürden Angebote der Vorsorge, wie z. B. Imp- Bei den genannten Gesundheitsproblemen und den zugrunde liegenden Risikofaktoren dürfen aber die Gesundheitssituation der Menschen im Herkunftsland, deren soziale und ökonomische Lebensverhältnisse und ihr Zugang zur Gesundheitsversorgung in Deutschland nicht außer Acht gelassen werden. Daneben sind auch solche Faktoren zu berücksichtigen, die sich günstig auf die Gesundheitssituation von Migranten auswirken können. So werden das vergleichsweise seltenere Auftreten bestimmter Erkrankungen und durchschnittlich niedrigere Sterberaten von Zuwanderern meist auf den sogenannten Healthy-MigrantEffect zurückgeführt, bei dem es sich möglicherweise um ein rein statistisches Phänomen handelt (Zuwanderung vorwiegend junger gesunder Menschen, Rückkehr im Alter etc.). Diskutiert werden hierbei auch günstige Auswirkungen einer relativ gesunden traditionellen Ernährungsweise, die auch in Deutschland über lange Zeit beibehalten wird, sowie schützende Effekte enger Familienverbände und sozialer Netzwerke. fungen bei Kindern, und der Früherkennung von Krankheiten im Durchschnitt seltener, dagegen medizinische Notfall-, Nacht- und Wochenenddienste vergleichsweise häufig in Anspruch genommen. Daneben werden sogenannte „Patientenkarrieren“ mit gleichzeitiger Endlosdiagnostik sowie die Verordnung von Beruhigungsmitteln mit größerer Häufigkeit beschrieben. Diese Problemstellungen werden zumeist auf Unterschiede in den Gesundheits- und Krankheitsverständnissen zurückgeführt, während sprachliche, finanzielle und rechtliche Gründe sowie ein unzureichender Kenntnisstand der Migranten oft ausgeklammert werden. Letztendlich sind viele der genannten Versorgungsdefizite auch bei Menschen ohne Migrationshintergrund unter vergleichbar schwierigen sozio-ökonomischen Lebensbedingungen anzutreffen. So bestehen auf vielen Gebieten wenig belastbare Daten und eine Vielzahl an offenen Fragen, was in der Folge nicht ohne Auswirkungen bleibt auf die Ge- sundheit und medizinische Versorgung von Flüchtlingen und hierbei vornehmlich auf die Situation besonders vulnerabler Personengruppen, zu denen Flüchtlinge mit Traumatisierungen gehören. Bei diesen Personengruppen lassen sich die mittel- und langfristigen Auswirkungen einer restriktiven medizinischen Versorgung durch das Asylbewerberleistungsgesetz auf die Betroffenen und ihre Angehörigen nur erahnen. Auch fehlt es an genaueren Informationen über die gesundheitliche Situation von Menschen, die in Deutschland ohne legalen Aufenthaltsstatus leben. In den letzten Jahren haben die psychosozialen Zentren für traumatisierte Flüchtlinge zwei Veröffentlichungen zum Thema „Good Practice in the Care of Victims of Torture“ vorgelegt, die auf Erfahrungen in mehreren europäischen Ländern zurückgreifen (Bittenberger 2010, 2012). Studienergebnisse zur ärztlichen Betreuung von Migranten in Deutschland wie z.B. Freude und Betroffenheit ausgedrückt wurden. Daneben wurde bei diesen Patienten seltener eine offene Frage gestellt, auf deren Äußerungen reagiert und sozialen Aspekten Aufmerksamkeit geschenkt. Auch hatten die Ärzte diese Patienten seltener in Entscheidungen eingebunden und verordnete Medikationen weniger genau erklärt. In Deutschland gibt es nach meinem Kenntnisstand aktuell keine repräsentativen Informationen zu den Erfahrungen von Ärzten und den von ihnen wahrgenommenen Problemstellungen bei der medizinischen Betreuung von Migranten. Deshalb möchte ich mich im folgenden Abschnitt auf Ergebnisse einer Umfrage bei der niedergelassenen Ärzteschaft im Raum Tübingen beziehen, die während meiner Tätigkeit in der Tübinger Tropenklinik vor acht Jahren mittels Fragebogen durchgeführt wurde. Bei dieser Umfrage war aus den 71 Rückmeldungen zu ersehen, dass von der großen Mehrheit der befragten Ärztinnen und Ärzte In der medizinischen Versorgung von Migranten besitzt die Beziehung des medizinischen Personals zu den Patienten zweifellos eine besondere Bedeutung. Zur spezifischen Rolle von Ärzten wurden vorwiegend in den USA, in Australien und den Niederlanden Studien durchgeführt, in denen deutliche Unterschiede in der ärztlichen Kommunikation und der Interaktion mit Migranten im Vergleich zu Patienten ohne Migrationshintergrund aufgezeigt wurden (Schouten, Meeuwesen 2006): die medizinische Versorgung von Migranten als ein wichtiges Aufgabengebiet angesehen und auch als bereichernd erfahren wurde. Gleichzeitig wurden von mehr als Dreiviertel der Befragten erhebliche Problemstellungen in der Betreuung dieser Patienten angegeben, auf die ich im nachfolgenden Teil des Beitrags eingehen werde: ● ● ● Die Studien zeigten, dass bei der Betreuung von Patienten mit Migrationshintergrund von Seiten der Ärzte deutlich seltener Emotionen Im Zusammenhang mit diesen Problemstellungen möchte ich im nachfolgenden Teil einige praktische Aspekte erörtern, die vor allem die Arzt-Patienten-Beziehung betreffen: ● Sprach- und Kommunikationsprobleme hoher zeitlicher Aufwand unzureichende Kenntnisse im psychosozialen Bereich mangelnde interkulturelle Kompetenz Defizite in der Compliance der Patienten Probleme der sprachlichen Verständigung „…oft muss ich mit Händen und Füßen Behandlungen anordnen“ (Zitat eines Tübinger niedergelassenen Arztes). Während die Bedeutung der „Sprechenden Medizin“ in der ärztlichen Praxis unbestritten ist, wurde sie im Vergleich zur sog. Apparatemedizin hinsichtlich der Vergütung ärztlicher Leistungen jedoch bisher deutlich unterbewertet. Bei der Betreuung von Migranten kommt die Rolle einer adäquaten Kommunikation besonders deutlich zum Ausdruck. Sie ist Grundvoraussetzung, um eine Krankenvorgeschichte sorgfältig zu erheben und die Patienten über medizinische Sachverhalte aufzuklären. Zugleich ist sie essentieller Teil einer vertrauensvollen therapeutischen Beziehung und trägt als Ausdruck menschlicher Zuwendung nicht zuletzt zur Gesundung bei. Im Falle von sprachlichen Verständigungsproblemen werden im Praxisalltag leider allzu oft Bekannte oder Familienangehörige, manchmal sogar Kinder gebeten, als Übersetzer auszuhelfen. Dies ist insbesondere dann höchst fragwürdig, wenn es sich um komplexe, teilweise intime Sachverhalte oder –z.B. bei traumatisierten Flüchtlingen –um lebensbedrohliche Erlebnisse und Gewalterfahrungen handelt. Hier erscheint es dringend erforderlich, muttersprachliche Dolmetscher hinzuzuziehen. Diese Personen sollten möglichst 13