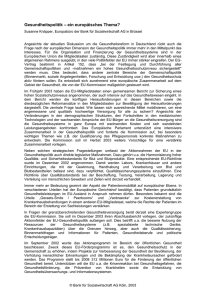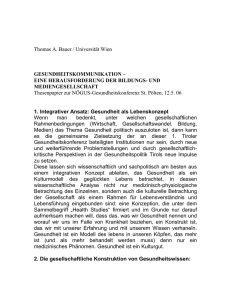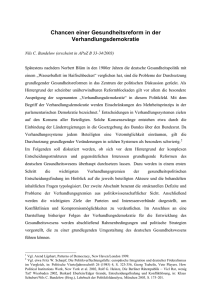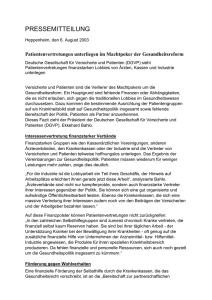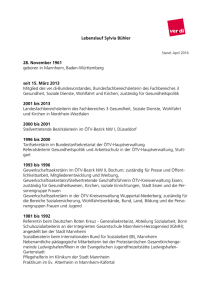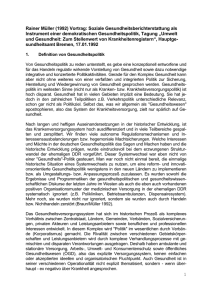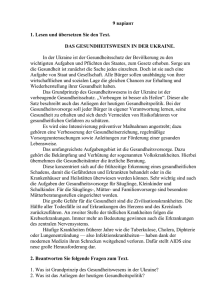Wie möchten die Wähler verarztet werden? Gesundheitspolitische
Werbung

Jan Böcken, Bernard Braun, Uwe Repschläger (Hrsg.) Gesundheitsmonitor 2012 Bürgerorientierung im Gesundheitswesen Kooperationsprojekt der Bertelsmann Stiftung und der BARMER/GEK Wie möchten die Wähler verarztet werden? Gesundheitspolitische Entscheidungsprozesse im Urteil der Bevölkerung Nils C. Bandelow, Florian Eckert*, Robin Rüsenberg* Einleitung Die Diagnose scheint unstrittig: Gesundheitspolitik gilt als komplex und intransparent. Entscheidungen werden in diesem Politikfeld hierzulande in unterschiedlichen formellen und informellen Gremien getroffen. Zu den zentralen Akteuren zählen neben Regierung und Parlament vor allem die sogenannten Bänke der Gemein­samen Selbstverwaltung, aber auch andere Interessengruppen und wissenschaftliche Experten. Mit Blick auf die weitreichenden Konsequenzen für Versicherte und Patienten, aber auch für die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik wird die Strukturierung der Entscheidungsprozesse zu einem wesentlichen Konfliktthema in der gesundheitspo­li­tischen Auseinandersetzung. Umstritten ist dabei das Verhältnis zwischen direkter staatlicher Steuerung, konsensorien­ tierten Verhandlungen und Wettbewerb im Gesundheitswesen auf der einen und der elementaren Frage auf der anderen Seite, ob und wie bestimmte Akteure – Interessenverbände des Gesundheitswesens, Tarifparteien, Patientenverbände oder (vermeintlich) unabhängige Fachleute – an den Entscheidungen beteiligt werden sollen (Bandelow, Eckert und Rüsenberg 2012). Die politischen Entscheidungsträger vertreten nicht nur konkrete inhaltliche Ziele, sondern auch unterschiedliche Präferenzen mit Blick auf die Ausgestaltung der gesundheitspolitischen Steuerungselemente. Insbesondere die politischen Parteien stehen für unterschied­ liche Konzepte zur Verteilung von gesundheitspolitischen Kompetenzen (Bandelow 1998). Dabei geht die Einstellungsforschung zugleich davon aus, dass in etablierten Politikfeldern wie der Gesundheitspoli*Der Beitrag gibt die persönliche Sicht der Autoren wider. 14 tik bei den politischen Eliten relativ zusammenhängende Überzeugungssysteme (belief systems) existieren (Putnam 1976; Peffley und Hurwitz 1985). Diese belief systems bezeichnen stabile allgemeine Werte und darauf aufbauende konkrete (z. B. politikfeldbezogene) Überzeugungen. In Parteiendemokratien suggeriert das Konzept der belief systems, dass die Anhänger derselben Partei jeweils auch in politikfeldbezogenen Fragen gemeinsame Überzeugungen vertreten. Einschränkend sei jedoch angemerkt, dass nicht alle parteipolitischen Ziele gleichermaßen von politischen Akteuren und ihren Wählern geteilt werden: So haben frühere US-amerikanische Studien ergeben, dass zwischen Parteizielen und Wählerpräferenzen mitunter große Unterschiede existieren (Converse 1964). Auf inhaltlicher Ebene scheint sich dieser Befund zunächst auch für die deutsche Gesundheitspolitik zu bestätigen: So erfahren Modelle der Bürgerversicherung weitaus stärkere Zustimmung zur Finanzierung des Gesundheitswesens als Prämienmodelle. Dies trifft auch auf die Anhänger von Parteien zu, die sich bisher entschieden gegen eine Bürgerversicherung ausgesprochen haben (Marstedt 2008). In der breiten, parteiübergreifenden Zustimmung der Bevölkerung zur Bürgerversicherung zeigt sich somit bereits, dass die Präferenzen von Wählern und Parteien auseinanderfallen können. Die bisher durchgeführten Befragungen zur Gesundheitspolitik konzentrieren sich allerdings vornehmlich auf die Beurteilung konkreter inhaltlicher Ziele oder der Gesamtleistung einer Regierung durch die Bevölkerung in diesem Politikfeld (Forsa 2008; TNS Emnid 2009; IfD Allensbach 2011; Forschungsgruppe Wahlen 2010). Relativ wenig ist dagegen bisher darüber bekannt, wie die Öffentlichkeit unterschiedliche Entscheidungsformen und Beteiligungen konkreter Akteure an der gesundheitspolitischen Regulierung beurteilt, weshalb folgende Fragen von Interesse sind: •• Welche Vorstellungen bestehen in der Bevölkerung darüber, in welchen Gremien und von welchen Akteuren wesentliche Entscheidungen in der Gesundheitspolitik getroffen werden? •• Welche Akteure sollen nach Ansicht der Bevölkerung an Entscheidungsprozessen beteiligt werden, und welches Vertrauen genießen die verschiedenen politischen Entscheidungsgremien? Besonders interessant ist dabei die Frage, ob und inwiefern in diesen öffentlich weniger diskutierten – aber gesundheitspolitisch zentralen 15 – Fragen die Wähler Positionen vertreten, die den von ihnen jeweils präferierten Parteien entsprechen. Die Legitimität der unterschiedlichen Regelungsformen und der Beteiligung konkreter Akteure lässt sich anhand der Ergebnisse zu folgenden Fragen beantworten: •• Entspricht die aktuelle Strategie einer Veränderung des traditionellen sektoralen Tauschkorporatismus durch zunehmende Zentralisierung und neue Wettbewerbsformen den Präferenzen der Bevölkerung? •• Wie wird die Einbindung der verschiedenen Interessengruppen im Detail beurteilt, und welche Rolle sollen Wissenschaftler in diesem Politikfeld spielen? Die Wahrnehmung und Bewertung gesundheitspolitischer Entscheidungsprozesse dient dabei als Grundlage zur Formulierung konkreter Empfehlungen für die zukünftige Gestaltung gesundheitspolitischer Entscheidungsprozesse. Diese sollen perspektivisch dazu beitragen, dem starken Vertrauensverlust der Bevölkerung hinsichtlich der Versprechen und Problemlösungsfähigkeit der Gesundheitspolitik (z. B. IfD Allensbach 2011) entgegenzuwirken. Methode Der Gesundheitsmonitor des Jahres 2012 enthält 15 spezifische Fragen zur Gesundheitspolitik. Die Fragen zielen darauf ab, die Einstellungen der Bevölkerung zur gewünschten Rolle verschiedener Akteure und ihrer Regelungsformen zu erheben. Die Antworten wurden im Hinblick auf mögliche Zusammenhänge mit parteipolitischer Präferenz (erhoben über die sogenannte Sonntagsfrage am Ende der Gesamtbefragung) ausgewertet, um auffällige Zusammenhänge anschließend im Hinblick auf ihr jeweiliges Ausmaß zu beurteilen. Der Zusammenhang zwischen parteipolitischer Präferenz und gesundheitspolitischer Einstellung operationalisiert ein wesentliches Element des Modells der belief systems, indem Übereinstimmungen zwischen Zielen der Parteien und deren Wählern sichtbar werden. Neben Anhängern der Bundestagsparteien sind in den Kreuztabellen jeweils auch die potenziellen Wähler der Piratenpartei aufgeführt, die zum Zeitpunkt der Befragung (Januar und Februar 2012) hohe Umfragewerte hatte. Bei den prozentualen Zustimmungswerten der 16 FDP-Anhänger muss jedoch beachtet werden, dass deren öffentliche Unterstützung im selben Zeitraum sehr schwach war. Aus diesem Umstand resultieren teils sehr niedrige Fallzahlen für die Liberalen, was bei der Auswertung der Aussagen über die FDP-Wähler unbedingt beachtet werden muss. Auch die konkreten Fragen zur Gesundheitspolitik orientieren sich am Modell der belief systems, indem sie einerseits allgemeinen politikfeldbezogenen Elementen und andererseits konkreten Einzelfragen zuzuordnen sind. Dem allgemeinen Kern ist etwa eine Frage zur präferierten Steuerungsform (Staat, Verhandlung, Wettbewerb, Technokratie) zuzuordnen. Allgemeine Überzeugungen werden auch zum gewünschten Einfluss der Akteure auf die Gesundheits­politik abgefragt. Spezifische Fragen, die das Modell der belief systems dem Randbereich zuordnet, wurden für einzelne Konfliktthemen wie etwa die Bestimmung der Arzneimittelpreise erhoben. Gesundheitspolitische Entscheidungsprozesse im Urteil der Wähler Ungeachtet der Komplexität des Politikfeldes sind die Präferenzen der Bevölkerung im Hinblick auf gewünschte Verantwortungen in der Gesundheitspolitik überraschend eindeutig: Die traditionelle mesokorporatistische Steuerung, also die Delegation bestimmter hoheitlicher Aufgaben an betroffene Akteure – die Verbände der Krankenkassen (Kostenträger) wie auch der (Zahn-)Ärzte und der Krankenhäuser (Leistungserbringer) –, die dann für die konkrete Ausgestaltung der gesetzlichen Rahmenvorgaben Sorge tragen, findet starken Zuspruch bei den Anhängern aller im Bundestag vertretenen Parteien (Tabelle 1). Mit fast 42 Prozent wünscht sich eine relative Mehrheit Verhandlungen zwischen Krankenkassen, Krankenhäusern und Ärzten als zentrale Form gesundheitspolitischer Entscheidungsprozesse. Weitere 28 Prozent vertrauen in erster Linie auf unabhängige Experten (z. B. Wissenschaftler). Mit fast 26 Prozent belegen allerdings die demokratisch legitimierten Staatsorgane von Bundesregierung und Parlament nur den dritten Platz. Lediglich die »Kräfte des freien Marktes« werden noch weniger positiv gesehen: Nur rund fünf Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass das Gesundheitswesen durch Marktkräfte gesteuert werden sollte. Die Unterschiede zwischen den Anhängern der Bun17 destagsparteien sind hier gering. Auffällig ist aber, dass die potenziellen Wähler der Piratenpartei deutlich geringeres Vertrauen in die Selbstverwaltung haben als die übrigen Befragten. Tabelle 1: »Das Gesundheitswesen sollte in erster Linie gesteuert werden durch ...« in Abhängigkeit von der Parteienpräferenz (»Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?«) SPD Gesetze von Bundesregierung und Parlament Verhandlungen zwischen Krankenkassen, Krankenhäusern und Ärzten die Kräfte des freien Marktes unabhängige Experten 35 35 4 27 CDU/CSU 28 42 7 23 Bündnis 90/ Die Grünen 22 39 2 37 FDP 27 40 13 20 Die LINKE 34 41 1 24 Piraten 33 30 4 33 Gesamtbevölkerung 26 42 5 28 n = 1.443 Anteile in Prozent der Befragten, Daten gewichtet Während also Wettbewerb und Markt in der Bevölkerung auf eher geringe Akzeptanz stoßen, erfreuen sich gerade die – in der Sozialwissenschaft als einflussreiche Vertreter von Partialinteressen oft kritisch gesehenen (Groser 1992; Webber 1992) – klassischen gesundheitspolitischen Verbände großer Unterstützung. 78 Prozent der Befragten wünschen einen mindestens »eher« großen Einfluss der Ärzte und Ärztinnen und ihrer Verbände auf die Gesundheitspolitik (Abbildung 1). Überraschend groß ist der Anteil der Befürworter einer »sehr« großen Rolle der Ärzteverbände mit 29 Prozent sogar bei den Wählern der Linkspartei, also einer Partei ohne traditionell enge Bindungen zur Ärzteschaft. Dieses Ergebnis gibt einen Hinweis da­ rauf, dass gerade Ärzte als Experten im Mikroumfeld der Bevölkerung ein so großes Ansehen genießen, dass auch ihre Interessenvertretung gegenüber der Politik daraus Prestige gewinnt. 18 Abbildung 1: » Wie groß sollte Ihrer Meinung nach der Einfluss folgender Einrichtungen und Verbände auf die Gesundheitspolitik sein?« Krankenkassen und ihre Verbände 17 Ärzte und ihre Verbände 50 20 Pharmaindustrie und ihre Verbände 8 58 13 Patientenverbände 29 10 Arbeitgeber und ihre Verbände 49 13 38 24 3 33 34 5 19 46 35 Gewerkschaften 4 3 18 48 23 Regierung, Bundestag 20 40 30 10 unabhängige Einrichtungen (Universitäten, Stiftungen) 20 40 30 10 0 sehr groß eher groß 10 20 eher gering 30 40 50 60 70 80 90 100 sehr gering n = 1.429 bis 1.562 Angaben in Prozent der gültigen Antworten, Daten gewichtet Auch die Krankenkassen und ihre Verbände genießen in der Bevölkerung große Zustimmung: 67 Prozent wünschen sich eine mindestens »eher« große Rolle in der Gesundheitspolitik. Geringer ist die Unterstützung für die »Pharmaindustrie und ihre Verbände«, der 21 Prozent der Bevölkerung einen mindestens »eher großen« gesundheitspolitischen Einfluss wünschen – ein Befund, der durchgängig auch für die Anhänger aller Parteien gilt. Die Patientenverbände erzielen wiederum die deutlichsten Zustimmungswerte: Mit 84 Prozent wünscht sich fast die gesamte Bevölkerung mindestens eine »eher« große Rolle dieser Gruppe von Akteuren. Auch hier wird das Antwortverhalten wenig von parteipolitischen Präferenzen beeinflusst. Im Gegensatz zu den Maklern der Patienteninteressen wünschen sich die Befragten hingegen keine stärkere Rolle der Gewerkschaften. Im Ergebnis fordert mit 44 Prozent nur eine Minderheit einen mindestens »eher« großen Einfluss. Wesentlich einhelliger ist allerdings 19 die Ablehnung einer Rolle der Arbeitgeber und ihrer Verbände in der Gesundheitspolitik: Nur rund 29 Prozent der Befragten sehen sie als »eher« wünschenswerten Akteur. Dies gilt fast identisch für alle Parteien. Überraschend ist hier, dass gerade unter den Unionswählern ein gesundheitspolitischer Einfluss der Arbeitgeber als sehr kritisch gesehen wird. Ihre Zustimmungswerte mit mindestens »eher groß« liegen bei gerade einmal rund 26 Prozent und damit sogar noch hinter jenen der Linkspartei-Anhänger, die sich immerhin mit 33 Prozent einen mindestens »eher großen« Einfluss wünschen. Zwar soll das Gesundheitswesen nicht primär staatlich gesteuert werden, eine starke Rolle von Regierung und Bundestag wird dennoch nicht abgelehnt: 60 Prozent der Befragten wünschen sich einen mindestens »eher großen« Einfluss auf die Gesundheitspolitik. Auch hier gibt es aufseiten der Parteienanhänger kaum nennenswerte Unterschiede. Erneut überraschend: Die Bevölkerung scheint im Zusammenhang mit Gesundheitspolitik ebenfalls auf unabhängige Einrichtungen (Universitäten, Stiftungen) zu setzen, wenn es um die Rolle ausgewählter Akteure in diesem Politikfeld geht. So wünschen sich 60 Prozent der Befragten einen stärkeren Einfluss unabhängiger Experten. Die Einbindung dieser Akteure könnte in der Organisation deliberativer Verfahren – verstanden als Kommunikation auf Grundlage eines möglichst machtfreien Austausches von Argumenten – zur Bürgerbeteiligung jenseits der etablierten Elitennetzwerke liegen. Auch hier ist das Antwortmuster wenig an parteipolitische Präferenzen gebunden, wenngleich sich die Anhänger von Bündnis 90/Die Grünen größere Anteile als die anderen wünschen (71 % für mindestens »eher großen« Einfluss). Die Auswertung der allgemeinen gesundheitspolitischen Fragen zeigt, dass in der Bevölkerung parteibezogene belief systems vorhanden sind, diese aber eher geringe Bedeutung haben. Wesentlich auffälliger ist die große Übereinstimmung auch über parteipolitische Lager hinweg. Dies bestätigt sich auch, wenn das Antwortverhalten zu Einzelfragen der Gesundheitspolitik betrachtet wird. Tabelle 1 hat bereits verdeutlicht, dass grundsätzlich Konzepte eines – vor allem korporatistisch – regulierten Marktes die breiteste Unterstützung finden. Wird nach den einzelnen Wettbewerbsmärkten gefragt, wünscht sich eine – wenn auch recht starke – Minderheit der Gesamtbevöl­ kerung von 40 Prozent, dass der Vertragswettbewerb zwischen den 20 Leistungserbringern (Ärzten und Krankenhäusern) »stark« oder »sehr stark« ausgebaut werden soll. Beim Krankenkassenwettbewerb ist die Zustimmung etwas geringer: Rund 36 Prozent der Befragten wünschen sich hier eine deutliche Stärkung. Überraschend sind die doch eher geringen Unterschiede zwischen den Anhängern der Parteien. Selbst bei den Anhängern der Linkspartei ist der Anteil der Befürworter von deutlich mehr Wettbewerb nicht geringer als in der Gesamtbevölkerung. Auch die tatsächlichen Differenzen in den Strategien der Parteien bezüglich einzelner Wettbewerbsmärkte finden sich kaum in der Wählerschaft: Während die SPD insgesamt eher zu einer Stärkung des Vertragswettbewerbs neigt und die Union hingegen für verstärkten Krankenkassenwettbewerb steht (Grunenberg 2010: 54), spiegelt sich dies in der Wählerschaft kaum wider (Abbildungen 2 und 3). Abbildung 2: D er Wettbewerb zwischen den einzelnen Krankenkassen um Versicherte sollte verstärkt werden SPD 9 CDU/CSU 26 15 Bündnis 90/Die Grünen 37 25 13 31 27 FDP 14 Piraten Gesamtbevölkerung 0 stark 20 12 46 26 24 10 24 18 20 12 28 18 22 22 30 33 47 Die LINKE sehr stark 28 33 29 30 ein wenig 40 50 35 60 70 80 90 100 gar nicht n = 1.403 Angaben in Prozent der Befragten, Daten gewichtet 21 Abbildung 3: Der Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern (z. B. Ärzten, Krankenhäusern) um Verträge mit den Krankenkassen sollte verstärkt werden SPD 8 34 CDU/CSU 12 Bündnis 90/Die Grünen 12 33 13 Piraten Gesamtbevölkerung 0 stark 30 10 20 30 ein wenig 13 21 24 10 28 25 28 17 24 32 37 Die LINKE 28 31 28 FDP sehr stark 30 40 50 25 38 33 26 32 28 60 70 80 90 100 gar nicht n = 1.276 Angaben in Prozent der Befragten, Daten gewichtet Auch das Beispiel der Festlegung von Arzneimittelpreisen bestätigt die Ergebnisse der allgemeinen Fragen zur gewünschten Form gesundheitspolitischer Entscheidungsprozesse. Hier spiegelt sich insbesondere die Forderung nach technokratischen Entscheidungen. So wünschen sich 46 Prozent der Bevölkerung eine Festlegung von Arzneimittelpreisen durch unabhängige Experten und Wissenschaftler (Abbildung 4). Neben den Anhängern der FDP stützen hier vor allem Grünen- und Piraten-Anhänger überproportional eine unabhängige Preisvorgabe. Insgesamt sind die Unterschiede zwischen den parteipolitischen Lagern jedoch auch hier geringer, als es zunächst in einem derart parteipolitisch kontroversen Bereich wie der Gesundheitspolitik hätte erwartet werden können. 22 Abbildung 4: Wer sollte die Preise für Medikamente in Deutschland bestimmen? 0 SPD 43 CDU/CSU 29 36 19 38 Bündnis 90/Die Grünen 14 55 FDP 21 35 25 57 gesamt 10 20 15 27 30 unabhängige Experten und Wissenschaftler Bundesregierung oder staatliche Einrichtungen Hersteller von Medikamenten alleine 4 3 8 22 40 50 60 7 9 11 46 0 3 27 17 Piraten 6 12 67 Die LINKE 6 70 9 11 14 6 80 90 4 4 2 5 2 100 Krankenkassen und Pharmaindustrie Krankenkassen alleine Apotheken n = 1.337 Angaben in Prozent der Befragten, Daten gewichtet Fazit: Experten stärken, Parteienkonkurrenz besser vermitteln Ausgangspunkt der Bevölkerungsbefragung zur Beurteilung gesundheitspolitischer Prozesse war die Frage nach der Existenz zusammenhängender belief systems, bei denen sich idealerweise in der Wählerschaft die Sichtweisen der jeweiligen Parteien spiegeln. Die Ergebnisse bestätigen weitgehend frühere Befunde, dass in der Bevölkerung nur eine geringe gesundheitspolitische Parteiprägung vorliegt (Marstedt 2008). Parteipolitisch geprägte belief systems, die in der Gesundheitspolitik oft zu langjährigen Erstarrungen kontroverser Fronten beigetragen haben, finden sich in der Bevölkerung kaum. Es lässt sich vielmehr ein (je nach Parteineigung unterschiedlich stark ausgeprägtes) Auseinanderfallen der Überzeugungen von Politik­ eliten und Wahlbevölkerung feststellen. Machtpolitisch scheint dies in der Vergangenheit bislang keinen größeren Nachteil mit sich gebracht zu haben. 23 Allerdings zeigen etwa die jüngsten Wahlerfolge der Piraten, dass partizipatorische Elemente bei der Erstellung von Parteiprogrammen und der inhaltlichen Positionierung stärker gefragt zu sein scheinen. Zugleich ermöglichen und erleichtern soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter diesen Paradigmenwechsel. Daher empfiehlt es sich aus Sicht der Parteien, künftig ihre Kommunikation mit (potenziellen) Anhängern zu verbessern, um Inhalte, Strategien und handelnde Personen früher mit den Wünschen der Wähler zu verzahnen, sie besser zu vermitteln und die so erarbeiteten Ergebnisse stärker zu berücksichtigen oder argumentativ zu entkräften. Darüber hinaus gibt es parteiübergreifend verbreitete Beurteilungen von Entscheidungsformen und einzelnen Akteuren, die durchaus einen Anstoß zum Nachdenken geben sollten: Auf der einen Seite genießt das deutsche Modell der Gemeinsamen Selbstverwaltung offenbar in der Bevölkerung größeres Vertrauen als politische Entscheidungsträger. In der Gesundheitspolitik sind die Vertrauenswerte in die demokratisch legitimierten Institutionen des Staates und in die staatliche Steuerungskompetenz augenscheinlich ambivalent. Doch auch der Wettbewerb genießt als Steuerungsinstrument nur eingeschränktes Vertrauen – wesentliche Reformstrategien der letzten Jahre stehen damit im Widerspruch zu den Wünschen der Bevölkerung: Politisch wurde eine Strategie der Wettbewerbsstärkung bei gleichzeitiger Zentralisierung und staatlicher Kompetenzerweiterung verfolgt (Bandelow, Eckert und Rüsenberg 2010; Gerlinger, Mosebach und Schmucker 2008). Genannt werden können exemplarisch die Festlegung des Beitragssatzes in der Gesetzlichen Krankenver­ sicherung durch die Bundesregierung, die steigenden Steuerzuschüsse oder jüngst die Einführung von Vetomöglichkeiten des Bundestagsausschusses für Gesundheit bei der Personalauswahl der unparteiischen Mitglieder des Gemeinsamen Bundesausschusses. Diese Politik war mit einem grundlegenden Umbau der Selbstverwaltung verbunden, die unter anderem auf Konflikten zwischen verbandlichen und staatlichen Akteuren fußte. Strategien der Entmachtung traditioneller Organisationen der Selbstverwaltung scheinen jedoch in der Bevölkerung nur schwer vermittelbar zu sein. Hier bieten die Befragungsergebnisse aber auch eine mögliche Lösung. Offenbar lässt sich eine Kompetenzverlagerung zulasten etablierter Verhandlungsgremien vor allem dann rechtfertigen, wenn damit eine stärkere Rolle unabhängiger Experten verbunden ist, da so die Ent24 scheidungsträger die wissenschaftliche Legitimation ihrer Entscheidungen verbessern: Mit den Enquetekommissionen gibt es im ­par­lamentarischen Prozess ein erprobtes Instrument für die institu­ tionalisierte Verknüpfung von parteipolitischen Akteuren mit wissenschaftlichem externem Sachverstand, welches in gesundheits­ politischen Fragen zuletzt Ende der 80er Jahre – erfolgreich – genutzt wurde (Reiners 2010). Eine solche Zusammenarbeit zwischen Abgeordneten und externen Sachverständigen zur systematischen wissenschaftlichen Fundierung von Positionen könnte auch künftig langfristig dazu bei­ tragen, Kompetenzen im Parlament zu stärken, zugleich einer dauerhaften übergreifenden Netzwerkbildung dienen und damit den Wissenstransfer zwischen Experten und Praktikern (z. B. Vertretern der Krankenkassen oder Patientenvertretern) sowie den Abgeordneten auch über ideologische Grenzen hinweg fördern. Es käme so zu einem Austausch zwischen den politischen Entscheidungsträgern, Akteuren der Selbstverwaltung und unabhängigen Experten, der Entscheidungen von Anfang an auf eine breitere Grundlage stellen und so auch deren Legitimation nach außen wie innen vergrößern könnte. Die Macht- und formelle Kompetenzverteilung im (gesundheits-)politischen System bliebe hiervon im Übrigen unberührt, was die Umsetzbarkeit des Vorschlags erleichtern würde (Bandelow, Eckert und Rüsenberg 2012). Der grundlegende Befund eines Auseinanderfallens von öffent­ lichen Positionen zur Gesundheitspolitik und parteipolitischen Konfliktlinien wirft darüber hinaus die Frage auf, wie gesundheitspoli­ tische Entscheidungsprozesse näher an die Bürger gebracht werden können. Denn wie auch in anderen Politikfeldern reicht offenbar die diffuse Legitimität traditioneller politischer Institutionen (Regierung, Parlament und Parteien) nicht aus, um die besonders in ­K risenzeiten angestrebten inhaltlich unpopulären Entscheidungen zu rechtfertigen. Diese Erkenntnis entspricht auch anderen Studienergebnissen, die in der Gesundheitspolitik die Notwendigkeit frühzeitiger Einbindungen der Bürger jenseits der Medien­öffentlichkeit betonen (Stollen 2011). Hier sind also die Entscheidungsträger gefordert, direkte Partizipationsmöglichkeiten zu stärken. Bürgerforen und Zukunftswerkstätten könnten beispielsweise die Legitimation der Entscheidungsprozesse verbessern (Bandelow, Eckert und Rüsenberg 2012). Mit Blick auf die unterschiedlichen Präferenzen stellt sich bei all dem 25 letztlich dann jedoch die Frage, wie viel Partizipation von Politik und Bevölkerung gewünscht ist – und in welchem Maße diese vor dem Hintergrund der Besonderheiten des Politikfeldes sinnvoll ist. Literatur Bandelow, N. C. Gesundheitspolitik: Der Staat in der Hand einzelner Interessengruppen? Opladen 1998. Bandelow, N. C., F. Eckert und R. Rüsenberg. »Wie funktioniert Gesundheitspolitik?« Masterplan Gesundheitswesen 2020. Hrsg. B. Klein und M. Weller. Baden-Baden 2012. 37–62. Bandelow, N. C., F. Eckert und R. Rüsenberg. »Reform(un)möglichkeiten in der Gesundheitspolitik«. Aus Politik und Zeitgeschichte (60) 45 2010. 6–11. Converse, P. E. »The Nature of Belief Systems in Mass Publics«. Ideology and Discontent. Hrsg. D. Apter. New York 1964. 206–261. Forsa. »TK-Meinungspuls Gesundheit 2008: Ein Jahr GKV-WSG: Eine Bilanz«. Berlin 2008. www.tk.de/centaurus/servlet/contentblob/269936/ Datei/2586/forsa_Umfrage_2008.pdf (Download 21.9.2012). Forschungsgruppe Wahlen. »KBV-Versichertenbefragung«. August 2010. www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Archiv__weitere_Um fragen/KBV-Versichertenbefragung_2010 (Download 21.9.2012). Gerlinger, T., K. Mosebach und R. Schmucker. »Mehr Staat, mehr Wettbewerb: Gesundheitsfonds ante portas«. Blätter für deutsche und internationale Politik (53) 10 2008. 107–116. Groser, M. Gemeinwohl und Ärzteinteressen – die Politik des Hartmannbundes. Gütersloh 1992. Grunenberg, M. »Wettbewerb im deutschen Gesundheitswesen. Ideen und Interessen bei der Reform der gesetzlichen Krankenver­ sicherung«. Gesundheits- und Sozialpolitik (64) 5 2010. 47–55. IfD Allensbach – Institut für Demoskopie Allensbach. »MLP Gesundheitsreport«. November 2011. www.mlp-ag.de (Download 28.10.12). Marstedt, G. »Gesundheitspolitische Positionen und Parteipräferenzen der Wähler«. gesundheitsmonitor. Newsletter 4 2008. 1–7. Peffley, M., und J. Hurwitz. »A Hierarchical Model of Attitude Constraint«. American Journal of Political Science (29) 4 1985. 871–890. Putnam, R. The Comparative Study of Political Elites. Englewood Cliffs 1976. 26 Reiners, H. »Ideenschmiede für die Gesundheitspolitik«. Gesundheit und Gesellschaft (13) 1 2010. 37–41. Stollen, T. Deliberation als Brücke zwischen passiver und aktiver Öffentlichkeit. Ein Feldexperiment zu den Chancen und Grenzen verschiedener Formen von Bürgerbeteiligung in der deutschen Gesundheitspolitik. Berlin 2011. TNS Emnid. »vfa Reformmonitor 2009: Meinungsbild der Bürger zur Gesundheitsreform«. Berlin 2009. www.vfa.de/de/download-­ manager/_emnid-reformmonitor2009-praesentation-schoeppner. pdf (Download 29.10.2012). Webber, D. »Die kassenärztlichen Vereinigungen zwischen Mitgliederinteressen und Gemeinwohl«. Verbände zwischen Mitgliederinteressen und Gemeinwohl. Hrsg. R. Mayntz. Gütersloh 1992. 211–272. 27